Urban Gardening
„Der Garten, das war das Einzige, was mich vor dem Verrücktwerden bewahrt hat,“ schrieb der tschechische Künstler Ludvik Vaculik über die Zeit nach 1968; ähnlich äußerten sich auch die gärtnenden Schriftsteller Bohumil Hrabal, Vaclav Havel und Pavel Kohut nach dem Einmarsch der Armeen des Warschauer Pakts in Prag.
.
Bei mir ist es noch nicht so schlimm, aber ich nehme den Garten ebenfalls zunehmend ernster. Es handelt sich dabei konkret um zwei kleine Gärten, die der taz-Genossenschaft gehören – einer oben auf dem Dach und einer unten am Café. In einem weiteren Dachgarten der Zeitung stehen zwei Bienenkörbe; sie werden von einem Imker versorgt. Viele taz-Mitarbeiter haben einen Kleingarten – meist gepachtet, mindestens einen Balkon, auf dem sie einige Nutz- und Zier-Pflanzen pflegen, und nicht zu vergessen, die vielen Büropflanzen. In der taz befindet sich auf jeder Etage mindestens eine Topfpflanzenansammlung, sie sind häufiges Gesprächsthema, besonders wenn sie kränkeln, wobei sich das biologische Wissen der Beteiligten langsam vermehrt. Es gibt bereits Firmenleitungen, die alle Büros ihrer Mitarbeiter mit Topfpflanzen ausstatten, diese leasen sie mitunter und lassen sie dann von einer Gartenbaufirma pflegen. Die Mitarbeiter dürfen nichts mit ihnen machen. Bei Ikea können sie sich jedoch „Die Gärten der Welt im Hinterhof“ – für 4 Euro 99 – kaufen und im Supermarkt „Real’“ für wenig Geld „Mein kleiner Bio-Garten“.
.

So fing alles an: Zur 750-Jahrfeier Berlin war 1987 der Volkspark Marzahn als „Gartenschau und Geschenk der Gärtner an die Hauptstadt der DDR“ eröffnet worden, den man 1991 erweiterte und ihn „Erholungspark Marzahn“ umbenannte. 2000 gelang es dort einem Verleiher von chinesischen Filmen aus Reinickendorf im Zusammenhang der Städtepartnerschaft Peking-Berlin einen chinesischen Garten mit einem Teepavillon von chinesischen Gärtnern und Arbeitern einzurichten. In den darauffolgenden Jahren kamen noch ein balinesischer, koreanischer, japanischer und ein arabischer sowie ein christlicher Garten dazu – und der Park wurde in „Gärten der Welt“ umbenannt. Mit der IGA jetzt kamen noch einige weitere Gärten dazu und aus dem balinesischen Garten wurde dank einer Industriespende ein großes Tropen-Gewächshaus, woraufhin die dort zwischen den Pflanzen stehenden Tempel von balinesischen Priestern noch einmal neu eingeweiht wurden.
.
Generell kann man sagen: Die Dörfer verschließen sich der Natur, während die Städte sich ihr öffnen. Der Münchner Biologe Josef Reichholf denkt dabei vor allem an die Tiere, die sich vom Land mehr und mehr in die Stadt wagen. Mit zu den ersten gehörte die mittlerweile allen Städtern vertraute Amsel – einst ein scheuer Waldvogel. Aber auch die vielen Garten- und Begrünungsinitiativen, die in den Städten entstanden und weiterhin entstehen, sind Ausdruck dieser veränderten Einstellung. Speziell in Berlin kam noch hinzu, dass der Staat, d.h. die Grünflächenämter in den Bezirken, sich personell und finanziell mehr und mehr zurückzogen – und stattdessen Fremdfirmen beauftragen, deren schlecht bezahlte Mitarbeiter sich mit schwerem Gerät immer mal wieder überfallartig an der urbanen Flora zu schaffen machen. Nach 1990 hatte es zunächst noch großzügigst „Begrünungsgeld“ gegeben – z.B. 100.000 DM für die gärtnerische Gestaltung eines Hinterhofs an einer Batteriefabrik in Oberschöneweide.
.
Anfänglich habe ich mich über das Wort „Urban Gardening“ geärgert: Schon wieder so ein Angloamerikanismus – warum sagt man nicht Stadtgärtnern? Aber dann verstand ich, dass es wie so vieles aus Amerika kommt, wo die Armen in den deindustrialisierten Städten wie Detroit, Chicago und New York Brachflächen besetzt und mit Gemüse bepflanzt hatten. Manche Afroamerikaner auch ironisch mit Baumwolle. Gleichzeitig bildete sich dort eine „Garden Guerilla“, die sie bei Auseinandersetzungen mit kommunalen und privaten Landbesitzern verteidigte. Bleiben wir also beim Urban Gardening, das im übrigen ideengeschichtlich auf die kalifornische Hippiebewegung zurück geht, die Anfang der Siebzigerjahre erst Landkommunen gründete und dann auch Gärten in der Stadt anlegte. Ihr theoretisches wie praktisches „Zentralorgan“ war der 1968 gegründete „Whole Earth Catalogue“. In Kalifornien experimentieren heute besonders viele Künstler mit „Öko-Kunst“, wie man das dort nennt. In England entstand vor einiger Zeit die Idee des Guerilla-Gardening: das heimliche Ausbringen von Pflanzensamen und Pilzsporen im öffentlichen Raum. In Berlin meinte kürzlich ein Teilnehmer an einem „Stadtforum von unten“ in der Kreuzberger Markthalle 9 – zu dem daneben tagenden, quasi offiziellen „Stadtforum von oben“: „Die Planer machen immer top-down-Gärten, wir müssen bottom-up-Gärten machen, d.h. aus grau – Beton – grün.“ Hierzulande wurde die Urban Gardening Bewegung auch noch von den Anthroposophen inspiriert, die in bezug auf Landwirtschaft und Bodenkunde, auf Gartenbau und Bienenwirtschaft die Klügsten sind, sie denken schon seit den Zwanzigerjahren ganzheitlich, d.h. in ökologischen Zusammenhängen. Ihr Vordenker Rudolf Steiner sah bereits 1923/24 den Rinderwahnsinn und das Bienensterben voraus.

.

Biene mit Empfangsmast auf dem Rücken und Rinder mit Forschungslöchern im Bauch. Je mehr man über diese Nutztiere forscht, desto hinfälliger werden sie.
.

Grillen im Garten, Marienfelde.
.
Das erste Urban Gardening Projekt entstand in Westberlin genaugenommen auf einem DDR-Grundstück – auf einer kleinen Verkehrsinsel, die beim Mauerbau gewissermaßen außen vor gelassen worden war. Mit Erlaubnis der Grenzsoldaten konnten zwei türkische Arbeiter dort 1983 Gemüsegärten anlegen und sich aus Abfallholz sogar zweigeschossige Lauben bauen. Ihre beiden Gärten existieren noch heute. Auch die Kinderbauernhöfe, die etwa zur selben Zeit entstanden, fingen langsam an zu gärtnern.
.
Die wahrscheinlich umfangreichsten Urban Gardening Projekte in der Stadt – das sind die massenhaft von den Anwohnern begrünten Baumscheiben. Es sind unzählige, zwar wird manche liebevolle Bepflanzung irgendwann wieder aufgegeben oder zerstört, aber es kommen immer wieder neue dazu. Die kleinen Einzäunungen werden verbessert und Sitzbänke drumherum gebaut. Anfangs versuchten die Bezirksverwaltungen diese seltsame Bürgerbewegung in Zeiten der Mieterangst noch mit Verfügungen zu stoppen. Aus Treptow hieß es 2010 beispielsweise: „Diese Begrünungsmaßnahmen mitsamt Umzäunung greifen ins öffentliche Stadtbild ein und stellen Gefahren dar.“ Das könne unter keinen Umständen erlaubt werden. In Neukölln ließ man 2015 etwa 60 Baumscheibenbänke entfernen – wegen Lärmbelästigung. Und in Pankow wurde noch kürzlich eine ganze Baumscheiben-Begrünung von Amts wegen entfernt.
.

Baumscheibenbegrünung mit Zaun und kleinem Picknicktisch in Kreuzberg.
.
Wenn man wie ich – in Vorbereitung auf das Thema „Urban Gardening“ – auf der Suche nach allem möglichen Grün in der Stadt ist, werden die Spaziergänge immer länger, gleichzeitig verfeinert sich der Blick. Und irgendwann kann man, oder jedenfalls ich, keine Werbung oder dergleichen mehr sehen, man braucht geradezu lebendes Grün im Blickfeld – und bemerkt bläuliches, gelbliches, gräuliches, bräunliches, silbriges, rötliches Grün, junges Hellgrün, altes Dunkelgrün usw.. Zum Glück stimmt es fast, was die Stadt-Werbung verspricht: „Berlin ist die grünste Stadt Deutschlands.“ Das ist zwar auch übertrieben, aber tatsächlich stößt man hier ständig auf Büsche, Bäume, Blumen, Rasenflächen und kleine Blumenbeete, auf wunderbare Gärten in Hinterhöfen, auf wahre Dschungel zwischen Gewerbehöfen. Vor den Häusern und Geschäften stehen immer mehr Kübel und Töpfe mit Pflanzen, die Fassaden werden berankt, Balkone bepflanzt, Dächer begrünt. An jedem der zigtausend Straßenbegrenzungspfähle, Poller genannt, sammelt sich mit der Zeit Erde und Staub und es sprießen irgendwelche Gräser. Manchmal sogar welche mit üppigen Blüten.In feuchten Sommern wachsen auch in den Ritzen zwischen den Naturpflastersteinen auf den Gehwegen allerlei Pflänzchen.
.

.
Es gibt vertikale Gärten, einer in der Glogauer Strasse in Kreuzberg bedeckt die ganze Fassade. Es gibt sechs „Gartenstädte“, initiiert von der 1902 gegründeten Deutschen Gartenstadt-Gesellschaft – mit „Villen für den kleinen Mann“, wie man damals sagte. Und egal welche Richtung man einschlägt, irgendwann stößt man immer auf einen kleinen oder großen Park sowie auf eine Schrebergarten-Kolonie. Letztere sind für Grünsucher besonders interessant, weil keine Parzelle der anderen im Hinblick auf ihren Bewuchs gleicht, und besonders viele Vögel singen.
.
Viele von ihnen haben es dort auf die Früchte und Beeren abgesehen und die Kleingärtner wissen nicht so recht, wie sie deren Ernteanteil beschränken können (Vogelscheuchen funktionieren nicht und in den Netzen verfangen sich die Jungvögel). Dennoch hängen in nicht wenige Parzellen Futterhäuschen und Brutkästen. Im Winter ziehen sich die Meisen aus dem Häusermeer in diese Gärten zurück. Um der Schneckenplage Herr zu werden, stellen die Kleingärtner Schalen mit Bier auf, das hilft, aber auch deren Freßfeinde, die Igel: Sie trinken gerne davon – werden jedoch anschließend oft betrunken überfahren. Der Maulwurf ist eigentlich ebenfalls ein nützlicher Schadinsektenvertilger, aber weil er dabei u.U. Rasen und Beete ruiniert, versuchen die Gärtner, ihn mit allerlei Mitteln zu vertreiben, töten dürfen sie ihn von Rechts wegen nicht: Er gehört seit 2002 zu den besonders geschützten Arten. Bei den ebenfalls gefürchteten Wühlmäusen ist nur die Bayerische und die Nordische geschützt.
.

.
Wir nähern uns dem moralischen Dilemma allen Gärtnerns: Man möchte eine harmonische Beziehung mit der Natur erreichen – und muß dabei ständig über Leichen gehen. Das geht bis zum Mähroboter, wie er auch hier auf der IGA eingesetzt wird, der die sich auf den Kurzrasen niederlassenden Insekten zerschreddert, wenn sie nicht schnell genug wegspringen oder -fliegen. Auf den Punkt gebracht hat das auf der IGA der Gerätehändler „Gartenpaul“, dessen Stand einem Waffenladen gleicht – sein Motto lautet: „Immer einen Schnitt besser als der Nachbar“.
.
Bio-Rasenmäher.
.

Nicht wenige Kleingärtner setzen auf Technik und ziehen sogar einen Handwerkerkittel bei der Gartenarbeit an.
.
Für den französischen Philosophen Michel Serres sind Pflug und Spaten gleichermaßen „Opfermesser“, mit dem alles kurz und klein geschlagen wird, die ganze chaotische Vielfalt, um hernach auf dem sauber geeggten bzw. geharkten Geviert die Homogenität zu zelebrieren, zu züchten:
„Wenn die Wut des Messers sich gelegt hat, ist alles bearbeitet: zu feinem Staub geeggt. Auf die Elemente zurückgeführt. Analyse oder: Nichts ändert sich, wenn man von der Praxis zur Theorie übergeht. Agrikultur und Kultur haben denselben Ursprung oder dieselbe Grundfläche, ein leeres Feld, das einen Bruch des Gleichgewichts herbeiführt, eine saubere, durch Vertreibung, Vernichtung geschaffene Fläche. Eine Fläche der Reinheit, eine Fläche der Zugehörigkeit…Der Bauer bzw. Gärtner, der Priester, der Philosoph. Drei Ursprünge in drei Personen in einer einzigen Verrichtung im selben Augenblick.“ Für Serres ging es dabei nicht darum, die Erde durch Bearbeitung fruchtbar zu machen: „es ging um Ausmerzen, Unterdrücken, Vertreiben, es ging um Zerstören, das Pflugmesser ist ein Opfermesser“.
.
Bei den Urban Gardening Projekten haben wir es meist mit einer Mischung aus drei Gartentypen zu tun: Nutzgärten, Ziergärten und Wilde Gärten. Letztere dienen primär dem Sammeln von Lebenswissen. Es geht darum, zuzuschauen, wie alles wächst oder eben nicht aus irgendeinem Grund, also das Leben zu studieren – was die Naturwissenschaften leider aufgeben: Sie interessieren sich nur noch für die „Algorithmen des Lebendigen“.
.
In den ästhetischen (Zier-)Gärten werden die Gewächse vorwiegend nach ihren Farben und Formen, vor allem der Blüten, ausgewählt. Eine solche „Gartenkunst“ gehört der geschichtlichen Herkunft, dem Aufwand und den Investitionen nach zur Hochkultur. Die Natur ist für diese Gartengestalter ein bloßer Materialfundus. Erwähnt sei der wohl bedeutendste und berühmteste Garten Englands – wie die Zeitschrift „Mein schöner Garten“ die Anlage „Sissinghurst“ von Vita Sackville-West nennt. Die Ehefrau eines Diplomaten schrieb mehrere Bücher über ihren Garten – zumeist Nachts, weswegen ihr „Weißer Garten“, den sie auch bei Dunkelheit bewundern konnte, als Krönung der gesamten Anlage gilt: Geometrische Beete mit Weißen Lilien, Kletterrosen, Lupinen, Eseldisteln, Honigblumen und die Blätter der Weidenblättrigen Birne. Wie viele reiche Gartenbesitzer ließ sie gärtnern. Nicht so der in Italien lebende Gärtner und Gartenbuchautor Rudolf Borchardt, dem ein Schweizer Bankier seine Liebhaberei finanzierte, ebenso sein Buch „Der leidenschaftliche Gärtner“. Borchardts Gartenphilosophie stammt aus dem Geist der Lebensreform-Bewegung und die Blume war für ihn das „Zentrum der Poesie“. Zwar schimpft er über die zu seiner Zeit in Deutschland propagierte „völkische Flora“, weil mit dem Kolonialismus Pflanzen aus aller Welt in Europa heimisch gemacht wurden, aber inzwischen haben wir ein etwas anderes Pflanzenproblem: Die Züchter meinen, ihre Kunden wollen immer neue Blumen mit immer üppigeren und knalligeren Blüten, und bei den Beerensträuchern und Obstbäumen immer verrücktere Kreuzungen mit immer größeren Früchten. So wird die Flora langsam denaturiert, verdinglicht ist sie schon lange. Mit der Gentechnik kreierte man erst violett blühende Rosen und Nelken und kürzlich auch noch blau blühende Chrysanthemen: „endlich!“ freute sich die FAZ, da Generationen von Blumenzüchtern dies vergeblich versucht hatten. Ich besuchte 2001 mit einer Staudengärtnerin einige Kleingärten in westpolnischen Kleinstädten: Dort züchteten die Kleingärtner ihre Pflanzen noch vielfach selbst, mit der Folge, dass sie noch etwa so aussahen wie unsere Gartenblumen und Nutzpflanzen in den Fünfzigerjahren. Meine Begleiterin wurde ganz neidisch.
.
Aber auch hierzulande kommt die gediegene Gartenkunst wieder – mindestens für Gutbetuchte: In Berlin wurde die zuletzt der TU angegliederte Königliche Gartenakademie in Dahlem wiederbelebt, diesmal auf privatwirtschaftlicher Basis von zwei in England ausgebildeten Garten-Designerinnen mit einer Beteiligung des Edel-Warenhauses „Manufactum“. Und eine Bonner Floristin folgte ihren Kunden, den Politikern, nach Berlin, weil sie meinte, „die Berliner haben keinen Blumengeschmack.“ Tatsächlich sagt man in der Politik noch viel mit Blumen: So belief sich z.B. der Jahres-Etat des relativ kleinen Auswärtigen Amtes für Blumen 2001 auf etwa 800.000 Mark jährlich, wie mir ein Mitarbeiter dort ausrechnete: „Alle Rednerpulte und Veranstaltungen sowie Büfetts werden mit Pflanzen bzw. Tischgestecken geschmückt. Außerdem bekommen der Minister, die zwei Staatssekretäre und die zwei Staatsminister regelmäßig frisches Grün auf ihre Schreibtische. Das wird über das Protokoll abgerechnet. Diese ganze Blumenpracht versteckt sich hinter unterschiedlichen Haushaltstiteln, etwa bei Restaurantabrechnungen, sodass eine genaue Angabe über die Höhe des AA-Blumenetats leider nicht möglich ist,“ teilte er mir mit.
.

Die Georgierin Olga Kasraschwili läßt sich von ihrem Mann Georgij wie viele andere Besucher der IGA vor einem Blumenbeet knipsen.
.

Auch die Journalistin Jutta Fischer-Geroldsen aus Bielefeld war von den IGA-Blumenbeeten angetan und wurde vor einem gerade blühenden Beet von ihrem in Berlin beim neuen Flughafen Berlin Brandenburg (BER) angestellten Onkel Joachim Fischer photographiert. Eigentlich war sie in die Hauptstadt gefahren, um über die Hintergründe der endlosen BER-Pleite zu recherchieren, weil das sonst niemand tut, wie sie sagte, aber ihr Onkel riet ihr, die Finger davon zu lassen, wenn sie nicht umgebracht werden wolle. Das selbe riet ihr dann ein auf hauptstädtische Korruptionsfälle quasi spezialisierter Journalist, der sich selbst auch nicht an diesen „Fall“ rantreut, und dann auch ein in Berlin lebender bosnischer Unternehmer, dessen Firma Aufträge für den BER ausgeführt hat. Danach gab Frau Fischer-Geroldsen ihr „Projekt“ lieber auf und widmete sich der IGA, über die sie dann ein Feature für den WDR veröffentlichte.
.

Wieder ein anderes Motiv für ihren wiederholten Besuch der IGA hatte Irmgard Schöttler aus der „Rosenstadt“ Sangerhausen, die extra wegen der Rosenpracht anreiste. Es gibt auf der IGA neben einem Rhododendrongarten auch einen Rosengarten mit 275 Sorten. Frau Schöttler fand jedoch den etwas schlichteren Rosengarten im Pankower Bürgergarten „ansprechender“. Sie meint: „Qualität geht vor Quantität“. Dafür fand sie jedoch die Organisation der IGA interessant: „Die Gartenarbeit obliegt Afrikanern, für die Sicherheit sind Russen zuständig und den Service erledigen Italiener und Araber.“
.
Viele Zeitungen haben inzwischen Kolumnistinnen, die regelmäßig über ihren und andere Gärten berichten. Dabei werden sie nicht selten zu anspruchsvollen Pflanzenexperten, die sogar Führungen durch ihren eigenen üppigen Garten anbieten. Er ist ihr symbolisches Kapital. Meine Lieblingskolumnistin ist Paula Almquist in der „Brigitte Woman“, eines ihrer Bücher heißt „Und wer gießt bei dir?“ Ein anderes hat sie dem berühmten Gartenbuch „Das Jahr des Gärtners“ des tschechischen Schriftstellers und Gärtners Karel Capek nachempfunden: Was muß in welchem Monat getan werden und was blüht wann. Über den November schreibt sie: „Wenn die Gartenfrau im Herbst aufatmend Schaufel und Hacke beiseitestellt, beginnt die lustvolle Form der Gärtnerei, die einem keine größeren Anstrengungen abverlangt als das Umblättern der Seiten in den neuen Frühlingskatalogen,“ um rechtzeitig neue Pflanzen zu bestellen.
.
Andere Kolumnistinnen mit ähnlich hohen Gartenansprüchen ironisieren ihre gestalterische Strenge, die sie nicht selten in Widersprüche verwickelt: die Kolumnistin der Berliner Zeitung, Sabine Vogel z.B.. Sie ist sehr gewissenhaft, auch auf ihrer Schrebergartenparzelle, wo sie stellvertretender Wegewart ist. Als „Öko-Spießerin“ lehnt sie zwar benzinmotor- und elektrisch betriebene Rasenmäher ab, wie sie schreibt, aber irgendwann kaufte sie sich doch eine elektrische Heckenschere, wobei sie auf die Männer schimpfte, die so ein Gerät haben, aber keine Zeit. „Männer im Garten sind eben doch nutzlos,“ sie können nicht mal richtig jäten und gießen, meint sie. Keine Garten-Kolumnistin versäumt es, die Männer gelegentlich als unfähige Hilfsgärtner und Reinredner zu kritisieren.
.
Die Frankfurter Gartenbuchautorin Eva Demski zitiert zustimmend Vita Sackville-West: „Der Gärtner muß grausam sein,“ aber dann hatte sie doch Mitleid mit ihren Usambara-Veilchen – holte sie aus dem Müll und pflanzte sie wieder ein, obwohl sie diese Blumen nicht ausstehen kann. Die FAZ nannte Eva Demskis „Gartengeschichten“ eine „Hommage an die schöne, stets gefährdete Ordnung“. Die Herstellung und Erhaltung der Ordnung in ihrem ästhetischen Garten ist ebenso „grausam“ wie die in den Nutzgärten.
.

Ähnlich äußerte sich auch Josepha Meiningen aus Lichtenberg, als sie sich im Birken- und Heide-Hain der IGA von ihrem Sohn Niklas photographieren ließ.
.
Im Gegensatz zu den Ziergärten entstanden die Nutzgärten aus der Ernährungsnot der Armen, sie institutionalisierten sich als Kleingartenkolonien in den zwei Weltkriegen. In ihren Satzungen ist vielfach noch heute festgelegt, dass auf mindestens Ein Drittel der Parzellenflächen Lebensmittel angebaut werden müssen. Aber die Zeiten, in denen z.B. massenhaft Kohl gepflanzt wurde, sind vorbei. Und damit z.B. auch die der vielen Kohlweisslinge, unserer einst häufigsten Schmetterlingsart, die ihre Eier nur auf Kohlpflanzen ablegt. Ähnlich erging es dem Kartoffelkäfer: Kartoffeln werden ebenfalls kaum noch angebaut – sie sind im Supermarkt „billiger zu haben“, wird gesagt. Zu den Kleingartenkolonien, die anfangs sogar noch Aufseher hatten, gehörte auch das Verbot zu politisieren.
.
In der Steglitzer Kolonie „Heimgarten“ kam es deswegen noch 1983 zu einem Konflikt, den der dortige Kleingärtner Gerhard Niederstucke, Pfarrer im Ruhestand, in seiner Koloniechronik erwähnt: Der Sohn des Kolonisten Reiß hatte damals die Parzelle in Abwesenheit seines Vaters zu einem „Friedensgarten“ umfunktioniert und dort Zusammenkünfte so genannter „Friedensfreunde – darunter Ausländer“ organisiert, wie es hieß. Der Vereinsvorsitzende Hartleb wandte sich deswegen an seinen Steglitzer Bezirksverband sowie an die Rechtsabteilung des Landesverbandes der Kleingärtner. Letztere befand, dass solche Meinungsäußerungen auf den Parzellen gestattet sein müssten. Der Chronist Niederstucke bemerkte dazu: die vom Studenten Reiß damals veranlasste Diskussion in der Parzelle 1a sei „eine der vielen tausend kleinen Beiträge dazu gewesen, dass die raketenbestückte Ost-West-Konfrontation nicht tödlich endete.“
.
Dieser einst proletarische Schrebergarten, in dem heute viele sogenannte Ausländer zwar nicht mehr politisieren, aber gärtnern, weist noch eine Besonderheit auf: 1972 beschloß das Bezirksamt dort den Bau eines Berufsbildungs-Oberstufenzentrums – und kündigte 64 Kleingärtnern ihre Parzellen – eine Fläche von fast 40.000 Quadratmetern. Die Verbliebenen teilten danach mit einigen der dabei Vertriebenen ihre Gärten, wobei sie sich jedoch bei mehreren Obstbäumen und Beerensträuchern ein „Mitpflückrecht“ vorbehielten. Seitdem spricht man dort z.B. vom „Helke-Apfel“ und von der „Hartlep-Brombeere“.
.
Bei den wilden Gärten gibt es einmal die, in denen zwar gezüchtete Pflanzen, Bäume und Sträucher wachsen, aber dies dürfen sie darin weitestgehend nach eigenem Gutdünken. Zum anderen gibt es solche wilden Gärten, in denen nur zuvor freilebende Pflanzen wachsen und gedeihen sollen. Auch das ist Kunst, insofern viele Pflanzen es übel nehmen, wenn man sie umpflanzt, u.a. etliche der hiesigen Orchideen, die zwar scheinbar anspruchslos auf Magerwiesen gedeihen, aber einen Bodenwechsel schlecht vertragen, weil sie auf einen bestimmten Pilz angewiesen sind. Und dann werden sie beim Umsetzen auch noch von ihren Partnerinsekten, oft nur einer einzigen Art, getrennt. „Florale Sozialfälle“ könnte man sie mit Eva Demsky nennen, wenn sie im Garten vor sich hinkümmern. Selbst an ihren natürlichen Standorten muß man sich um sie bemühen: Im Biosphärenreservat Rhön hat man extra einen Pfleger für die dort vorkommenden Orchideen angestellt.
.
Foto
Orchis italica (italienisches Knabenkraut), ihre Blüten sehen auch aus wie Knaben. Auf der IGA kann man Orchideen sowohl in den Aussteller-Hallen als auch im balinesischen Garten sehen.
.
Foto
Noch eine seltsame Orchideenart: „Telipogon Diabolicus“ – treffend bezeichnet von einem Forschungsteam um die Botanikerin Marta Kolanowska der Universität Danzig, die diese winzige Orchideenart kürzlich im Kolumbianischen Urwald entdeckte.
.
Der israelische Schriftsteller Meir Shalev schrieb ein schönes Buch über seinen „Wildgarten“. Er macht ihm anscheinend so viel Arbeit wie ein Ziergarten. An einer Stelle heißt es darin: „Die Bedeutung der Schubkarre in meinem Leben und meine Zuneigung zu ihr sind gar nicht zu überschätzen.“ In einem Sachbuch, von Reinhard Witt, wird der „Wildgarten“ als ein „Überlebensraum für unsere Pflanzen und Tiere“ bezeichnet. Der Schriftsteller Helmut Salzinger hatte genau dies im Sinn mit seinem großen Grundstück: Eine Natur-Arche in einem Meer der Verdinglichung. Ringsum befanden sich nur baumlose Weiden und Gräben, als er anfing, überall Sträucher, Büsche und kleine Bäume irgendwo auszugraben, um sie in seinem Garten wieder anzupflanzen: „Alle geklaut!“ wie er in seinem 1992 veröffentlichten Buch „Der Gärtner im Dschungel“ schreibt. Zunächst ging ihm vieles ein, aber anderes blühte geradezu auf. Und schon bald fanden sich die ersten Singvögel in seinem Garten ein – ihnen folgten wenig später die ersten Raub- und Rabenvögel. Helmut Salzinger gab dann eine kleine Zeitschrift namens „Falk“ heraus, in der er sich in „Nature Writing“ versuchte.
.
Es gibt die Geschichte einer Gartenbesitzerin, Len Howard, die sich irgendwann mehr für die Vögel als für die Pflanzen interessierte. Einzelne Tiere wurden ihr dabei sehr vertraut. Vor allem einige Blaumeisen und Amseln, die von ihr gefüttert und umhegt wurden, und vornehmlich in ihrem Garten lebten, wozu aber auch das Innere des Hauses gehörte. Das Vertrauen ging so weit, dass eine Meise aufgeregt an ihr Fenster pickte, damit sie ihr half, eine Elster zu verscheuchen, die es auf ihre Jungen abgesehen hatte. Die Autorin tat das auch. Aus der Sicht von Artenschützern und Ornithologen soll man das zwar nicht tun, aber andererseits möchte man auch nicht das Vertrauen der Tiere in seinem Garten verspielen. Dazu gehören neben den Vögeln Igel, Haselmaus, Eichhörnchen, Kröten und Frösche. Alles mehr oder weniger harmlose Tiere, auch für Gartenbesitzer. Neulich war in der Fachpresse jedoch auch einmal von einem ungewöhnlich aggressiven Grasfrosch die Rede, der Vögel, Rötelmäuse und Menschen angreift, indem er sich aufrichtet, sie lange fixiert und dann mit „schnappendem Maul“ auf sie zuhüpft.
.
Helmut Salzinger schreibt, dass er „den Garten als Versuch betreibt, Lebensraum zu schaffen, Raum für Lebewesen jeder Art.“ Dort soll wachsen, was da wachsen will. Und doch greift er immer wieder ein, und jätet z.B. gerne. Sein Garten verändert sich aber auch von sich aus jedes Jahr, wie er meint. Doch um das richtig wahrzunehmen brauchte er Jahre. Zudem wurde er beim Wachsen und Leben-Lassen noch von seiner Frau übertroffen, für die es schon ein schönes Gartenjahr war, wenn dort zwei Kröten viele Nachkommen bekamen. Für sie wäre es also vor allem wichtig, den Garten so „einzurichten, dass die Vögel, die Raupen und Schnecken satt werden. Der Rest ist für uns,“ übertreibt Helmut Salzinger, der die Nutzpflanzenecke seiner Frau nicht einmal betreten durfte. Dies ist seltsamerweise auch bei vielen sogenannten Naturvölkern in Lateinamerika der Fall: die Männer roden zwar einen Garten für die Frauen, dann ist er jedoch Tabu für sie, weil ihre Nähe die von den Frauen angebauten Pflanzen negativ beeinflussen würde.
.

Dieser Meinung war auch die IGA-Besucherin Marieluise Wittstock aus Dresden, die ein Photo schickte, das ihr Mann, aufnahm. „Zwischen den zwei Pflanzkübeln, das bin ich,“ schrieb sie dazu.
.
Auch in den Berliner Imkervereinen, deren Mitglieder inzwischen einen eigenen Stadthonigvertrieb haben, sind immer mehr Frauen organisiert. Es gibt unter ihnen einige professionelle, für die meisten ist das Imkern jedoch ein Hobby. Vor einigen Jahren wählten bereits die alten Charlottenburger und Wilmersdorfer Imker eine junge Kreuzberger Barbesitzerin, Erika Mayr, zur Vorsitzenden ihres Vereins. Sie schrieb 2012 ein Buch über „Stadtbienen“. Darin erklärte sie, warum es in Berlin besonders viele Imker gibt: Nicht nur stehen hier viele Straßenbäume, bei der Baumauswahl ließ man sich nach dem Krieg auch von einem berühmten Gärtner und Imker aus Potsdam beraten – und der, Karl Foerster, wählte gute Trachtbäume aus, deren Blütezeiten unmittelbar aufeinander folgen: Kastanie, Ahorn, Robinie und Linde… „Deshalb liegen die Erntemengen der Stadtimker auch deutlich über denen der Landimker.“ Außerdem enthalte der Stadthonig weniger Giftstoffe als der Landhonig. Von Mitarbeitern aus den Berliner Grünflächenämtern erfuhr die Autorin, dass sie mittlerweile nur noch wüßten: „Birken verursachen Schmutz und Autos werden von den Blattläusen der Linden ganz klebrig.“ Die in Mitte wohnende Schriftstellerin Nellja Veremej erwähnt in ihrem Buch „Berlin liegt im Osten“ (2015) einige neuere Anpflanzungen: Am Mauerpark und in der Lottumstrasse „exotische Kirschbäume, am Wasserturm im Prenzlauer Berg „duftende Rosen“ und in der Knaackstrasse „edle Gingkobäume“.
.
Ein drei bis fünf Meter hoher Straßenbaum kostet mit Pflege rund 1200 Euro. Eichen, Rosskastanien und Platanen leben oft nicht lange. Sie brauchen viel Wasser. „Dazu kommen Belastungen durch Abgase, weniger Nährstoffe durch kleine natürliche Bodenflächen, weniger Licht, Streusalze und Hunde-Urin,“ schreibt „Die Welt“. „Seit Jahren gibt es einen stetigen Baumverlust in der Stadt,“ der aus Kostengründen nicht mehr durch Neuanpflanzungen ausgeglichen werden kann, stattdessen hofft die Stadt auf Sponsoren und initiierte kleine Crowdfunds, die immerhin so erfolgreich waren, dass die Presse melden konnte: „Neuer Stadtbaum gepflanzt.“
An der Humboldt Universität empfehlen Wissenschaftler, Bäume anzupflanzen, „die dem Klimawandel besser gewachsen sind. Seit 2010 haben sie rund 80 Baumsorten geprüft. In Versuchen versorgten sie einige frisch gepflanzte Bäume optimal, andere aber setzten sie einem moderatem oder akuten Trockenstress aus. Außerdem untersuchten sie die Anfälligkeit für Krankheiten und Schädlinge. Die Tests gehören zu einem gemeinsamen Forschungsprojekt von HU und dem „Innovationsnetzwerk Klimaanpassung Brandenburg-Berlin“. In einem ersten Ergebnis sind unter anderem Kugel-Blumeneschen aus Ungarn, der amerikanische Amberbaum „Worplesdon“, die Kobushi-Magnolie aus Japan und das chinesische Rotholz besonders gut für Neupflanzungen in Berliner Straßen geeignet. Auch die Erlenart „alnus spaethii“ kommt als Alleebaum infrage: Sie hat eine kegelförmige Krone, ledrig dunkelgrüne Blätter und trotzt dem Wetter durch Frosthärte, Hitzetoleranz, Windfestigkeit und hohe Salzverträglichkeit.
.
„Das Problem bei Pflanzen war immer: Du willst Verhaltensforschung betreiben, aber wie soll das gehen, wenn es kein Verhalten zu beobachten gibt?“ – so fasste der englische Biologe Anthony Trewavas die Probleme seiner Wissenschaft zusammen. Doch dann brachte die Filmtechnik des „Zeitraffers“ die botanische Beobachtung voran: 1926 kam damit der Film „Das Blumenwunder“ von Max Reichmann in die Kinos. Die Pflanzenaufnahmen wurden von über 70.000 Zuschauern angesehen.
.
Der philosophische Anthropologe Max Scheler schrieb seiner Frau, er hätte im Kino fast geweint: „Man sieht die Pflanzen atmen, wachsen und sterben. Der natürliche Eindruck, die Pflanze sei unbeseelt, verschwindet vollständig. Man schaut die ganze Dramatik des Lebens – die unerhörten Anstrengungen. Am schönsten waren die Ranken.“ Der andere philosophische Anthropologe Helmuth Plessner war da gegenteiliger Ansicht: „Natürlich macht es Eindruck, wenn man im Film die Bewegungen etwa einer Ranke oder Winde“ sieht. Aber dabei eine Empfindungsfähigkeit zu unterstellen, sei grundsätzlich ein „Verrat am Wesen der Pflanze“. Ähnlich sah das auch der Lebensphilosoph Ludwig Klages. Er sprach von einer „Sachverhaltsfälschung, wenn im zeitverdichtenden Laufbild die Tabakspflanze hastig in die Höhe schießt und Wurzeln schlangenartig auseinandergleiten“.
.
Der Philosoph Theodor Lessing widmete sich dagegen 1928 ausführlich und begeistert dem Film: Er überführte für ihn die „Menschenoptik der Zeitlichkeit“ einer Täuschung und relativierte damit wohltuend die anthropozentrische Weltsicht. Auch für Walter Benjamin war der Pflanzenfilm eine hochwillkommene „Erweiterung des Blicks“, mit dem die gezeigten „Formen den Schleier, den unsere Trägheit über sie geworfen hat, von sich abtun“. Er schrieb mehrmals über die Wirkung der neuen optischen Techniken, in einem Text heißt es: „Ob wir das Wachsen einer Pflanze mit dem Zeitraffer beschleunigen oder ihre Gestalt in vierzigfacher Vergrößerung zeigen – in beiden Fällen zischt an Stellen des Daseins, von denen wir es am wenigsten dachten, ein Geysir neuer Bilderwelten auf.“
.
Aus eher praktischen Erwägungen heraus war der Biosoph Ernst Fuhrmann vom Film begeistert, er würdigte nicht nur ausführlich „Das Blumenwunder“, sondern veröffentlichte auch selbst eine illustrierte Reihe mit Monographien einzelner Pflanzengruppen, „Die Welt der Pflanze“ betitelt, sowie auch einen Bildband: „Die Pflanze als Lebewesen“. Seine Photos, die heute das „Museum of Modern Art“ besitzt, sollten es dem Betrachter ermöglichen, „sich auf das Wesen der Pflanze zu konzentrieren“. Der Schriftsteller Franz Jung sah in Fuhrmanns Arbeiten eine „Bloßlegung der geheimen Fäden, die Mensch, Tier und Pflanze verbinden“. Alfred Döblin rezensierte Fuhrmanns Fotobücher in der „Frankfurter Zeitung“, wobei er erwähnte, auch vom „Blumenwunder“-Film sehr beeindruckt worden zu sein. Danach habe er sich gefragt: „Was soll man jetzt machen? Tiere kann man nicht essen, nun sind auch noch die Pflanzen lebendig, jetzt fürchte ich mich, in ein Kohlblatt zu beißen.“
.


.
Tatsächlich zeigte das Haus der Kulturen der Welt in Berlin 2012 im Rahmen der Ausstellung „Animismus – Revisionen der Moderne“ einen sowjetischen Film, in dem ein Weißkohl zerschreddert wird, während ein anderer Kohlkopf neben ihm, an eine Art Lügendetektor angeschlossen, die heftigsten Reaktionen zeigt. Sie ließen sich als Todesangst deuten. Ironischerweise fand dort im Haus zur selben Zeit ein taz-Kongreß statt, auf dem die Tierrechtsaktivistin Hilal Sezgin bei der Frage „Was soll man jetzt machen?“ auf ihre vegetarische Lebensweise zu sprechen kam, die sie damit begründete, dass Pflanzen „keine Gefühle“ besäßen. Sie stieß mit dieser Meinung bei den Zuhörern auf heftigen Protest. Anscheinend traut man heute den Pflanzen mehr zu als nur ein Nahrungsmittel oder ein ästhetischer Genuß zu sein. Ich will annehmen, dass dies u.a. auch ein Resultat der ganzen Stadtgärtnerei ist. So meldete die Münchner Abendzeitung z.B.: „An einem Strauch in der Schulstrasse in Pfaffenhofen sind am Freitagabend nach Angaben der Polizei mehrere Zweige abgerissen worden. Der Täter ist unbekannt. Die Polizei Weißenhorn bitte um Hinweise.“ Da haben wir in gebotener Kürze den gedankenlosen Umgang mit Pflanzen als Dinge, gleichzeitig aber auch eine gesteigerte Empfindlichkeit der Öffentlichkeit ihnen gegenüber.
.

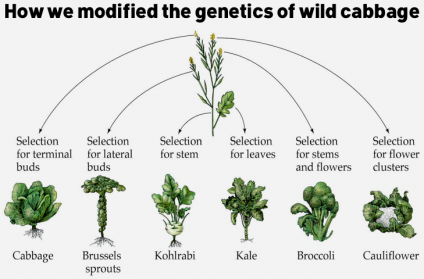
.
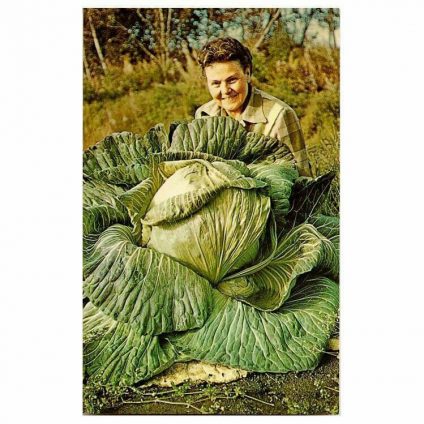
.
Ganz anders sah der Naturfrevel meines Bekannten Bernd aus: Er hatte LSD genommen und schlenderte guter Dinge durch den Tiergarten – über eine ungemähte Wiese, als er plötzlich bemerkte, wieviele Pflanzen er bei jedem Schritt zertrat oder umknickte. Er blieb stehen und rührte sich nicht von der Stelle, mehrere Stunden lang: bis die Wirkung der Droge nachließ – und er sich – wieder fast im Zustand normaler Gleichgültigkeit – traute, weiter zu gehen.
.
2015 besuchte der junge mongolische Schamane Sukhbaatar Tughsbayar Berlin, in einem Interview meinte er: Wenn ich durch Berlin fahre oder gehe, dann sehe ich schon, dass man versucht – und das selbst an Baustellen, die Bäume zu schonen. Das gefällt mir. Im Tiergarten fielen mir meine Ringe auf die Erde, daraufhin hat mein Schutzgeist mir gesagt: „Heb deine Ringe von der Erde auf, sie vergiftet sonst deine Ringe.“ Das habe ich nicht verstanden, da doch alles so schön grün war. Da hat mir mein Schutzgeist erklärt: Diese Pflanzen werden chemisch gedüngt, damit sie schneller wachsen. Die Natur will normalerweise, dass die Pflanzen mit den Insekten zusammenleben. Aber hier waren kaum Insekten. Darum kann die Natur nicht ins Gleichgewicht kommen.“
.
Alfred Döblin hätte sich damals, nachdem er sich den Film „Das Blumenwunder“ angesehen hatte, auch noch aus ganz anderen Gründen fürchten können: Gedreht wurde der mit einem Orchester musikalisch untermalte Stummfilm auf dem Versuchsgelände „Limburger Hof“ der BASF. Der Vorsitzende des Chemiekonzerns, Carl Bosch, war Hobbybotaniker, und seine Firma hatte gerade einen Volldünger – „Nitrophoska“ – auf den Markt gebracht. Der Film war eine Werbemaßnahme, denn der neue Kunstdünger musste bei den Bauern erst noch durchgesetzt werden. Und das wurde er dann auch. Die Biermösl Blosn sangen 1982 über das fast durchgehend kunstgedüngte Bayernland: „Über deinen weiten Fluren liegt Chemie von fruah bis spaat / Und so wachsen deine Rüben, so ernährest du die Sau / Herrgott, bleib dahoam im Himmi, mir hom Nitrophoska blau.“
.
Bei Homer gibt es den Begriff der „lachenden Wiese“. Er ist uns vielleicht nur noch in solchen wie eben erwähnten (LSD-) Momenten zugänglich, wir können uns eine „lachende Wiese“ – pratum ridet – nicht mehr vorstellen. Sie ist über Homer und Aristoteles und dann das latinisierte Griechisch, schließlich das christianisierte Latein, zu uns gelangt – als Paradebeispiel für eine Metapher. Den Poetiken und Rhetoriken des Mittelalters galt ihr Lachen als „uneigentliche Rede“, dahinter verbarg sich die „eigentliche“: eine blühende Wiese – pratum floret. Und heute haben wir es sowieso meist mit mehr oder weniger sauberen Rasenflächen zu tun. Ein Freund von mir lebt z.B. davon, dass er quadratmeterweise „Rollrasen“ verkauft.
.
Inzwischen ist die Technik der Zeitraffer- und der Mikrophotographie sehr viel weiter fortgeschritten, außerdem vergeht heute kaum noch ein Tag, an dem auf einem der vielen Fernsehkanäle nicht ein mit dieser Technik aufgenommener Pflanzenfilm gezeigt wird, daneben auch im Botanischen Garten und auf der Grünen Woche. Unser Staunen wird dadurch langsam geringer. Könnte es aber vielleicht doch sein, dass wir damit – über diesen technischen Umweg – der „lachenden Wiese“ auch in Wirklichkeit wieder näher kommen?
.
Die große Wiese in der Mitte des IGA-Geländes. Der Lamarckismusforscher Peter Berz hat mit Hilfe seines DDR-Pflanzenbestimmungsbuches und einer Lupe auf der Langgraswiese und drumherum einige Pflanzen identifiziert: „Am Wegrand, auf der wilden Wiese bei den Wasserspielen: Wimper Perlgras (Melica celiata), Immergrünender Gamander (Teucrium), Blaunessel (Cocosmia Montbretie), Heidenelke (Dianthius deltoides), Gemeiner Hornklee (Lotus corniculatus). Am Wegrand, überall und überreich: Wilde Möhre, Sterndolde und Wassersumpf-Kresse. Am Aufgang zum Aussichtsturm: Dornige Spinnenpflanze (Cleome spinosa) und Fiederblättriges Schmuckkörbchen.“ Der Baum gehöre da aber nicht hin – auf die Langgraswiese, und sie selbst sei in Wirklichkeit auch weniger hügelig gewesen, fast eben.
.
Es gibt eine Berlinerin namens Anette Muck, die regelmäßig Photos von der Entwicklung ihrer Balkonpflanzen und dem Verhalten von Insekten in ihren „Balkonblog“ im Internet stellt, mit kurzen Erklärungen versehen. Ihr blog „meinbalkon“ ist nur einer von vielen im Internet, auch die Liste von Büchern über Balkonpflanzen ist lang. Anette Muck berichtete zuletzt über die Ernte ihrer zwei Kohlrabis und die Raupen, die sich in deren Blätter reingefressen hatten. Sie war überrascht, wie viel sie geschafft hatten.
.
.
Die Kreuzberger Hobbyimkerin Rita Besser beobachtete vor einiger Zeit eine seltsame Verhaltensänderung bei ihren zwei Bienenvölkern, deren Kästen auf dem Dach standen: Sie wurden immer aggressiver, im Winter ist ihr dann ein Volk eingegangen. Die Ursache dafür sieht sie darin, dass ein Mobilfunk-Sendemast auf dem Dach des Nachbarhauses errichtet wurde. Ihr Mann der eine Ausbildung als Baubiologe macht, beschäftigte sich dann näher damit. Er meint: „Ihre Fühler wirken wie Antennen, das macht die Bienen verrückt. Die Stöcke standen ja nur 10 Meter Fluglinie entfernt von dem Mast – das war zu nahe. Die können von den elektromagnetischen Wellen sterben“.
.
Obwohl die Industrie und ihre Forscher das bestreiten, gibt ihm eine Broschüre des Kreuzberger Stadtteilausschusses mit neuen Forschungsergebnissen über diesen Elektrosmog recht: „Informationen zu Mobilfunk und UMTS“ betitelt. Ein neusseländischer Forscher meint darin: „Die Handys werden innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre mit hoher Wahrscheinlichkeit die Fallzahl vieler neurologischer Krankheiten sowie der Gehirntumore ansteigen lassen.“ Rita Besser entschärfte das Problem für ihre Bienen, indem sie ihre Völker in den Hinterhof stellte, wo die Strahlung nicht mehr so stark ankam: „Die Feldstärke eines elektromagnetischen Feldes im freien Raum nimmt mit dem Quadrat des Abstands zur Sendeantenne ab,“ heißt es dazu in der Broschüre. „Die Hauswände haben zudem laut Rita Besser eine abschwächende Funktion“.
.
Ich führte vor einiger Zeit unabsichtlich ein Experiment mit einer solchen Strahlenquelle durch, indem ich neben einem kleinen „Router“ (für den Internetempfang) eine große Yuccapalme in den Konferenzsaal der taz stellte: Nach zwei Monaten waren ringsum die Blätter dieser ziemlich robusten Pflanze vertrocknet – innerlich verbrannt. Daraufhin stellte ich eine vergleichsweise zarte Birkenfeige neben den Router: Ihr gelang es nach einigen Monaten, den der Strahlenquelle allzu nahen Ast davon weg zu drehen. Ob das reicht, muß sich noch zeigen.
.

Yuccapalme mit Router auf der Metallsäule.
.
Um gut zu Imkern, auch nur mit wenigen Bienenvölkern, braucht es etliche Jahre. Eines der Völker auf dem Dach der taz wurde kürzlich von einem Wespenschwarm getötet, so dass es in diesem Jahr nur wenig oder gar keinen Honig geben wird. Beim Imkern wie auch bei den Urban Gardening Projekten scheint es im übrigen ein Problem zu sein, dass viele ihr Interesse daran nicht jahrelang durchhalten können, weil sie einer Arbeitsstelle hinterherziehen, zu oft unterwegs sein müssen oder der Langsamkeit des pflanzlichen Gedeihens sonstwie nicht Rechnung tragen können. Nicht wenige Pflanzen brauchen einige Jahre, bis sie das erste Mal richtig tragen, Obstbäume noch viel länger.
.
Wir leben dagegen heute in nachgesellschaftlichen Projektwelten und die Projekte werden, wie die Produktzyklen, immer kürzer – d.h. kurzlebiger, auch die eigenen. Das Urban Gardening könnte eine Art Mode sein oder sich dazu entwickeln. „Man braucht dazu so gut wie nichts, nur den einfachen Übergang vom Männlichen zum Weiblichen, damit der Modus (le mode ) zur Mode (la mode ) wird; das Wort bleibt das gleiche, aber die angesprochene Sache ist nicht mehr die gleiche,“ meint der französische Waldpsychiater Fernand Deligny.
.
Die Zeitschrift „Gartenlust“, die wie die „Landlust“ inzwischen eine Riesenleserschaft hat – und dutzendfach imitiert wird, titelte: „Kleingärtner – das klingt ziemlich piefig. Urban Gardening gibt dem Freizeitgärtnern ein ganz anderes Gewicht.“ Als wir in den Siebzigerjahren auf dem Land anfingen zu gärtnern, war uns solch Distinktionsdenken bei der Bepflanzung von Beeten fremd. Jeder Rat war willkommen. Und unser Zentralorgan war damals das altehrwürdige Informationsblatt der gärtnernden Nonnen der Abtei Fulda. Im übrigen gibt es heute genug Urban Gardening Kritiker, die viele dieser mit politischem Anspruch auftretenden Projekte für zu spießig – zu klein gedacht – halten, wenn sie ihnen nicht sogar vorwerfen, damit der Gentrifizierung Vorschub zu leisten. Andere finden die massenhafte Begrünung der Baumscheiben schrecklich kitschig. Diese sind jedoch mindestens so unterschiedlich bepflanzt oder sonstwie gestaltet wie die Vorgärten der Wohnhäuser in Stadtrand-Bezirken wie Britz, Buckow und Rudow. Dort die Straßen entlang zu gehen ist abwechslungsreicher und ethnologisch anregender als jeder Schaufensterbummel.
.

Charlotte Brenner aus Rudow vor ihrem Vorgarten.
.
In London ist der Spatz aus der Stadt verschwunden, weil die Vorgärten aus Parkplatznot zum Abstellen von Autos umgenutzt wurden, sagen jedenfalls die englischen Spatzenforscher. Hierzulande sind bereits Hamburg und Münster nahezu „spatzenfrei“. Als Faustregel gilt wohl: Je reicher eine Stadt, desto weniger Tiere und Pflanzen. Das „Hamburger Abendblatt“ titelte im Juni „Hamburgs Gärten leiden unter Vogelarmut“. Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete im Frühjahr von einer Ausstellung in Landshut, die neue Trends bei den Hausgärten zeigte, ihr Fazit: „Büsche, Gras und Blumen werden durch allerlei Scheußlichkeiten aus Pflastersteinen, Beton und Kies verdrängt.“ In den Achtzigderjahren waren auch mal Gartenteiche mit Wasserpflanzen groß in Mode. Mit Sommerbeginn titelte die selbe Zeitung: „München verfärbt sich von grün zu betongrau“. Schuld daran sei der enorme Zuzug, was ja auch für Berlin gilt, wo wegen der vielen Industrieruinen und –brachen aber immer wieder neue Stadtgärten entstehen.
.
Zu den Urban Gardening Projekten gehören auch die „interkulturellen Gärten“ (den Anfang machte eine Gruppe von jugoslawischen Flüchtlingsfrauen). Erwähnt sei der „bürgernahe interkulturelle Garten“ am Schöneberger Gleisdreieck, von dem es kürzlich im Internet hieß, er habe „Feinde. Zum dritten Mal wurde die mühsame Bepflanzung zerstört. Dabei erkennt der Senat dort die Arbeit als Beitrag zur Integration an.“ Nicht wenige Bepflanzungen ohne Zaun drumherum leiden unter Blumendiebstählen, u.a. auch der Café-Garten der taz. Dennoch hofft man immer auch ein bißchen, der Dieb möge damit glücklich werden, mindestens seine Mutter. Ärgerlich ist vor allem, wenn ein Passant z.B. eine Rosenblüte vom Strauch vor dem Café abpflückt und diese wenige Schritte weiter wegwirft. Am Neuköllner Richardplatz wird mit Schildern in den Schaufenstern über den dortigen Blumendiebstahl geklagt.
.
Urban Gardening Projekte werden inzwischen gefördert, weil und insofern sie sozial integrative Aufgaben zu erfüllen versprechen. Seit 2003 sind über 100 „interkulturelle Gemeinschaftsgärten“ entstanden, ferner „Bürgergärten“, wie der auf der Laskerwiese in Friedrichshain, „Nachbarschaftsgärten“ und „Generationengärten“ , wie z.B. an der Kreuzberger Falckensteinstrasse. Dazu zählen muß man auch die „Unigardening-Projekte“, wie sie sich nennen, die Studenten u.a. auf dem Campus der TU und dem der Kunsthochschule in Weissensee anlegten. Daneben gibt es schon seit fast 100 Jahren für die Berliner Schüler Gartenarbeitsschulen – in vielen Bezirken. Sie sind z.T. riesig. In Marzahn-Hellersdorf ist jetzt einer geplant.
.
Umgekehrt gibt es aber auch Brachland, auf dem einige Generationen lang ein nahezu unberührter Wildwuchs entstand. In Schöneberg hat man das Ganze eingezäunt und zum Wildgarten „Südgelände“ erklärt, mit einem Café und einer Bühne, auf der die Schauspielerin „Fräulein Brehms Tierleben“ kenntnisreich über Regenwürmer aufklärt, dem wohl wichtigsten „Partner“ der Stadtgärtner, die auf möglicherweise kontaminierten Böden oder gar auf Beton und Asphalt siedeln und deswegen Hochbeete – meist aus Holz – bauen. Diese müssen mit Erde gefüllt werden – mit guter Erde, die durch den Magen von Regenwürmern gegangen ist. Die Bodenqualität ist ein Dauerthema in den Gärten, erst recht das Gedeihen eines Komposthaufens.
.

Der samstägliche Kompostkreis in einer Charlottenburger Schrebergartenkolonie; die aufgestelzte braune Hütte im Hintergrund ist ein Taubenschlag.
.

Der Taubenbesitzer Zygmunt Kowalski (rechts), er hat bereits viele Preise mit seinen Tauben gewonnen.
.

Einige seiner Tauben auf einem Dach in der Nähe der Kleingartenkolonie.
.
Um nicht auch noch die letzten Moore abzutorfen und sie als Gartenerde zu verkaufen, hat man ausgehend von einem kalifornischen Modell in Wassmannsdorf am neuen Flughafen BER ein modernes Klärwerk gebaut, das die Abwässer der Stadt mittels einer Klärschlammvererdungsanlage und Bakterien in Humus rückverwandeln soll, d.h. aus Scheiße Rosinen machen kann. Bisher ist das jedoch bloß theoretisch der Fall, denn der Klärschlamm enthält noch zu viele Schwermetalle, Medikamentenrückstände und unliebsame Keime, als dass man die frische Erde z.B. den Bauern anbieten könnte. Sie wird einstweilen noch verbrannt und liefert so dem Klärwerk Elektrizität. Eine EU-Verordnung legt fest: Wenn die Klärschlämme hinsichtlich des Schadstoffgehalts die Vorschriften erfüllen und hinsichtlich der Nährstoffgehalte den Vorgaben der Düngemittelverordnung entsprechen, dürfen sie auf die Äcker gebracht werden, jedoch nicht auf Grünland und Gemüseanbauflächen. Bisher kommen nur etwas 25% der zwei Millionen Tonnen Klärschlammtrockensubstanz, die jährlich in Deutschland anfallen, auf die Äcker. In etwa zehn Jahren will man mit einer neuen Verordnung den Klärwerken das Phosphorrecyling zur Pflicht machen. Daneben sollen unter den Stadthäusern Wurmkompostierungsbehälter gebaut werden. Derzeit sind wir jedoch „von einem ganzheitlichen Denken in Wertstoffkreisläufen noch weit entfernt,“ heißt es.
.
In Deutschland gehen im Durchschnitt pro Jahr und Hektar zehn Tonnen fruchtbarer Boden durch Erosion und Humusabbau verloren. Dem gegenüber steht ein jährlicher natürlicher Bodenzuwachs von nur etwa einer halben Tonne pro Hektar. Weltweit sind es mehr als 24 Milliarden Tonnen, die alljährlich durch Erosion abgetragen werden. Abgesehen davon muß das, was die Pflanze an Nährstoffen aus dem Boden zieht auch irgendwie wieder ersetzt werden – sei es durch chemischen oder organischen Dünger oder durch Komposterde. Die „Deutsche Welle“ berichtete Mitte Juni: „Die Bodenersion wird zur globalen Gefahr“. (*)
.
In „Oya“, eine der Zeitschriften aus der Urban Gardening Bewegung, heißt es: „Der Gang zur Toilette ist ein Akt politischen Handelns“, wozu in einem Bildteil neun alternative Möglichkeiten zur direkten Umwandlung von Fäkalien in Humus oder Kompost vorgestellt werden. Die meisten Urban Gardening Projekte haben keinen Wasseranschluß. Für ihre Pflanzen stellen sie große Wassertanks auf, aber für die Toiletten müssen sie sich etwas einfallen lassen. Es gibt in Berlin Ingenieurgruppen, die daran arbeiten. Man soll „Klug scheißen,“ heißt es. An der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich werden Trenntoiletten getestet, die aus Urin einen Flüssigdünger mit hohem Phosphorgehalt herstellen sollen.
.

Das ist ein noch unfertiges Bio-Klo, es dient erst einmal noch der Hobbygärtnerin Dorothea Schott als provisorisches Gewächshaus, das bis zum späten Frühjahr mit Plastikfolie eingekleidet wird: „ganz unökologisch,“ wie die Besitzerin zugibt.
.
Die Stadtgärten wollen nicht nur der Bodenerosion, sondern auch der Erosion des Sozialen entgegenwirken. In utopischer Hinsicht hat bereits der Frühsozialist Charles Fourier mit seinem noch vertikal organisierten Genossenschafts- bzw. Kommunemodell „Phalanstères“ die heute eher horizontal vernetzten Stadtgärtner-Kollektive 1808 vorgedacht. In seiner „Theorie der vier Bewegungen und der allgemeinen Bestimmungen“ heißt es: „Eine Serie der Leidenschaften (als Gruppe betrachtet) besteht aus Personen, die sich in jeder Hinsicht voneinander unterscheiden, in Alter, Besitz, Charakter, Verstand etc. Die Mitglieder müssen so gewählt werden, dass sie miteinander kontrastieren und eine Stufenfolge von reich zu arm, gebildet zu unwissend, jung zu alt etc. ergeben. Je größer und abgestufter die Unterschiede sind, um so mehr fühlt sich die Serie zur Arbeit hingezogen, erhöht sich ihr Gewinn, und das erzeugt soziale Harmonie.“
.
Fourier verdeutlicht das am Beispiel der „Birnen-Serie“: „Man wird 600 Personen in Gruppen aufteilen, die sich mit der Kultur von jeweils ein bis zwei Birnensorten beschäftigen. Es wird eine Gruppe von Züchtern der Butterbirne, der Bergamottbirne, der Rousseletten usw. geben. Wenn jeder sich in die Gruppe seiner Lieblingsbirne hat aufnehmen lassen (man kann in verschiedenen Gruppen Mitglied sein), so wird es vielleicht gut 30 Gruppen geben, die sich durch Banner und Zierrat unterscheiden.« Fourier denkt die Leidenschaft in der Arbeit nicht zuletzt von der Birne selbst her: »Handelt es sich um eine Zwitterpflanze wie die Quitte, die weder Birne noch Apfel ist, so stellt man ihre Gruppe zwischen zwei Serien, denen sie als Bindeglied dient. Diese Quittengruppe ist die Vorhut der Birnenserie und die Nachhut der Apfelserie. Unter den Leidenschaften gibt es zwittrige und bizarre Neigungen, ebenso wie man unter den Pflanzen Mischformen findet, die keiner Sorte zugehören. Die genossenschaftliche Ordnung zieht aus allen Wunderlichkeiten ihren Vorteil und weiß alle erdenklichen Leidenschaften zu nützen.“ So weit Fourier.
.
Er verspricht, dass „jede Arbeit zu einem Vergnügen wird, sobald die Beschäftigten in progressive Serien geordnet sind.“ Und dass dann Folgendes passiert: „Wie überall in der genossenschaftlichen Ordnung kommt es zu einem erstaunlichen Resultat: Je weniger man sich um den Gewinn kümmert, um so mehr verdient man.“
.
Für die Philosophin Christine Blättler ist es dabei wesentlich, „dass Fouriers Welt durch und durch erotisch ist. Alles begehrt und ist begehrlich. Alles basiert auf leidenschaftlicher Anziehung und richtet sich auf Lust hin aus. Das wahre Glück besteht nur in der ‚Befriedigung der Leidenschaften‘.“ Und diese erschöpfen sich nicht: „Es gibt hier Begehren in der Überfülle, nicht Bedürfnis aus einem Mangel heraus. Es gibt nur Sonntage. Es kann gar nicht zu viele Birnensorten geben.“
.
Bei den Äpfeln ist das inzwischen „Common sense“. Eine Zeit lang dachte ich, Pomologen, also Apfelforscher, gäbe es nur in der DDR. Ich hatte dort einige kennengelernt, während in der BRD ab den 60er-Jahren cirka fünf Millionen Apfelbäume gefällt wurden – es gab dafür Prämien von der Europäischen Gemeinschaft in Höhe von 50 Pfennig pro Baum. Den Verantwortlichen schwebte ein europäischer „Einheitsapfel“ vor. Mit dem Erstarken der Ökologiebewegung Ende der 70er drehte sich aber der Wind, heute gibt es in Deutschland wieder rund 2.000 Apfelsorten. Wirtschaftlich scheinen sie jedoch ohne große Bedeutung zu sein, denn diese Wissenschaft wird heute an keiner Universität mehr gelehrt. Im Kreuzberger Prinzessinnengarten halten gelegentlich freiberufliche Pomologen Vorträge. Ein ostdeutscher aus Werder erzählte mir, dass er andauernd zu Veranstaltungen irgendwo im deutschsprachigen Raum unterwegs ist.
.
Foto
Auch auf der IGA ist ab August Erntezeit. Auf dem „Weltacker“ schon jetzt.
.
Der Prinzessinnengarten am Moritzplatz nennt sich wegen seiner Beete in transportablen Kisten „nomadischer Garten“. Und tatsächlich sind einige der Pflanzen dort mit ihren Kisten auch gelegentlich unterwegs – zu einer Ausstellung z.B.. Die Gartengründer werden in den U-Bahnhöfen mit dem Spruch „Wir lernen vom Gemüse“. Sie verstehen sich nicht als Gärtner, sondern als Kuratoren (von „curare“ – sich um etwas sorgen). Robert Shaw war Filmemacher und Marco Clausen Historiker. Ersterer lebte zuvor auf Kuba und begeisterte sich dort für die aus der Not geborenen „Stadtgärten“, letzterer arbeitete u.a. in der Gastronomie. 2008 gründeten sie eine gemeinnützige Firma: die „Nomadisch Grün gGmbH“ und pachteten das Gelände eines ehemaligen Flohmarkts. Ihr Ansinnen hefteten sie zunächst mit Zetteln an den Zaun. In einer Anzeige in der Stadtzeitung riefen sie sodann dazu auf, ihnen beim Entmüllen der „6000 Quadratmeter Brachfläche“ zu helfen: „Es kamen über 100 Leute. Ein Dixi-Klo war das einzige, was wir bis dahin hatten.“ „Es kommen immer neue Mitmacher vorbei, tun was, klinken sich in das Projekt ein. Im August 2009 wurden die ersten Beete aufgebaut, dann haben wir angefangen, zu kochen und eigenes Gemüse zu verkaufen.“ Als nächstes kam ein Imker und stellte sechs Bienenstöcke im „Prinzessinnengarten“ auf. Inzwischen sind es vier Imker, die das Projekt nutzen und von denen die anderen profitieren, vor allem die Pflanzen. Es kam die dänische Künstlerin Åsa Sonjasdotter, die mit Kartoffeln arbeitet. Sie initiierte ein nomadisches Kartoffelfeld mit den unterschiedlichsten Sorten, mittels derer sie die Geschichte dieser Kulturpflanze gewissermaßen nachvollziehbar machte. Shaw und Clausen schätzen, dass es mittlerweile etwa 500 Leute sind, die zwischen ‚regelmäßig‘ und ‚auf eine Stunde‘ vorbeikommen. Natürlich passieren bei diesem weitgehend selbstbestimmten Engagement viele Mißverständnissen: Es kommt zum Einpflanzen von hybriden oder von stark mit Insektiziten behandelten Pflanzen oder zum vorzeitigen Abernten ganzer Möhrenbeete. Aber, so meint Shaw, „gemeinschaftlich gemachte Fehler sind gute Fehler. Es gibt Profis, die laufen hier rum und entdecken laufend Fehler – hier Stickstoffmangel, da zu früh Gepflanztes…“
.
Erwartungsgemäß beteiligen sich viel mehr Frauen als Männer an dem Projekt, wobei letztere auch noch lieber reden als mitarbeiten. „Gerade die türkischen Frauen sind sehr an Gartenarbeit interessiert,“ hat Shaw festgestellt. Inzwischen gibt es auf ihrem Gelände eine Nachbarschafts-Akademie – in einem Haus ohne Wände – mit Wänden wäre es nicht genehmigt worden. Ihre Pachtverträge sind – gemessen an Vegetationszyklen – zu kurzfristig. Die Initiatoren sehen ihre Arbeit als „gemeinnützig“ an, denn ihr Stadtgarten diene der „Belebung sozial schwacher Quartiere, der Sicherung der Lebensmittelversorgung, der Förderung von Biodiversität, der CO2-Reduktion, sowie der Verbesserung des Mikroklimas und der Verschönerung der Stadt“. Auf ihrer Internetseite erfährt man zudem, dass das Projekt zusammen mit 13 anderen in einem Wettbewerb „Über Lebenskunst“ von der Kulturstiftung des Bundes und dem Haus der Kulturen der Welt ausgewählt wurde, um den „Prototypen für einen Ein-Quadratmeter großen Acker zu entwickeln, der die urbane Landwirtschaft zu den Menschen nach Hause bringen soll: auf den Balkon, das Fensterbrett, die Hauswand…“ Im übrigen besteht die „Gemeinnützigkeit“ des Prinzessinnengartens darin, dass er den Gedanken an eine öffentliche Nutzung von Brachflächen äußerst anschaulich verbreitet. Ähnliches gilt für die z.T. winzigen Gärten in der Urban-Gardening-Kolonie auf dem riesigen Tempelhofer Feld, wo auch eine Anlaufstelle für Stadtgärten-Interessierte angesiedelt ist: das „Allmende-Kontor“. Das nicht mehr genutzte Flugfeld wurde erst besetzt, dann wurde gegen Bebauungspläne des Senats per Volksentscheid durchgesetzt, dass es quasi von unten genutzt werden durfte – „bespielt“ nennt es der Geschäftsführer der landeseigenen „Grün Berlin GmbH“, die dort nun für „Ordnung“ sorgt und auch die IGA organisiert hat.
.

Das allerdings auch die IGA-Besucher die Beete bespielen (hier im Bereich „Grabgestaltung“) sehen die Parkwächter nicht gerne. „Eine besondere, innovative und im Trend liegende Gestaltungsvariante ist die fließende Grabform, bei der feste Grenzen aufgehoben sind und Gräber ineinander übergehen,“ heißt es auf der Internetseite der IGA. Hier im Bild ist diese Variante jedoch nicht sichtbar.
.
Es gibt Urban Gardening Projekte, in Friedrichshain der „Nachbarschaftsgarten Rosa Rose“ z.B., die bereits mehrmals umziehen mußten. Beim letzten Mal gestalteten die dortigen Gärtner ihre Vertreibung als eine beeindruckende Menschenkette mit Pflanzen, die sich durch den Bezirk schlängelte. Es gibt aber auch einigermaßen gesicherte Stadtgärten, sie entstehen in einer Kooperation von unten und von oben, d.h. mit Künstlern, Gärtnern und Bezirksplanern: der „Chomeniusgarten“ am Neuköllner Richardplatz z.B., der zur 750-Jahrfeier der Stadt 1987 eröffnet wurde.
.
Bei der Planung des Britzer Gartens anläßlich der IGA 1985 konnten sich erstmalig die „Grünen“ unter den Planungsexperten etwas einfallen lassen. U.a. wagten sie es, vier uralte Weidenbäume aus Westdeutschland umzupflanzen – in ein künstliches Feuchtgebiet. Als Beitrag zur IBA 1987 errichtete man in der Bernburger Strasse nahe dem Potsdamer Platz in der Mitte eines Wohnblocks – mit der Nummer 6 – einen Teich mit Schilf, der Teil einer Wasserrecyclings-Anlage war, die nun zu einer Aquakultur (mit Speisefischen) und einer Hydrokultur (mit Nutzpflanzen) ausgebaut wird. Solch ein Aquaponik, wie es auch genannt wird, gibt es bereits in Tempelhof in einer Fabrik und am Holzmarkt. Diese und andere Versuchsanlagen werden von verschiedenen Seiten finanziell gefördert. „Die Welt“ schrieb: „Indoor-Farming erobert jetzt die Großstädte“.
.
Das Urban Gardening hat unter Umständen auch einen technischen Reiz. U.a. in Form von Permakultur-Gärten: Dafür braucht es ein Wasserkreislaufsystem, eine Heizung und ein Gewächshaus. Aber dann hat man mit etwas Glück auch das ganze Jahr über Gemüse und Kräuter zur Verfügung. Einige Bodenkundler propagieren das Gärtnern mit „Terra Preta“ – Schwarze Erde. Sie wird laut Wikipedia mit Holz- und Pflanzenkohle, menschlichen Fäkalien, Dung und Kompost hergestellt sowie mit Tonscherben und gelegentlich auch Knochen und Fischgräten.
.

.
Erwähnt sei ferner eine globale – fast schon ins Religiöse – lappende sozio-ökonomische und ökologische Bewegung, deren Alpha und Omega Milchsäurebakterien sind. Diese werden „EM“ – Effektive Mikroorganismen – genannt und so heißt auch die Bewegung selbst: Es gibt bereits EM-Kaffee, EM-Gemüse, EM-Erdbeeren, EM-Äpfel, Käse aus Milchviehhaltung mit EM, EM-Eier, EM-Fisch, EM-Fleisch, EM-Wurst, EM-Wein – demnächst auch noch EM-Bier und -Limonade. EM ist laut dem etwas ungenau bleibenden „EM Journal“ eine Lösung aus Zuckerrohrmelasse, von und in der „genau definierte“ Milchsäuremikroben, Hefepilze und Photosynthesebakterien leben. In den Handel gelangt diese „braune Flüssigkeit“, die auch als „Mikroben-Cocktail“ bezeichnet wird, in Flaschen oder Kanister mit dem „internationalen Zeichen EM1“. Es ist eine Erfindung des japanischen Gartenbauprofessors Teruo Higa.
Anwenden kann man sein Konzentrat nahezu überall: auf Feldern, in Wäldern, auf Wiesen und Äckern, im Kuhstall, auf den Kühen, auf der Diele, in der Scheune, in der Küche und in Weiterverarbeitungsbetrieben. Alles soll dadurch verbessert werden: die Lebensmittel schmecken intensiver, die Milch wird haltbarer, die Tiere und Pflanzen gesünder. Darüberhinaus gibt es noch viele weitere „EM-Lösungen“: Sie werden regelmäßig auf den Webseiten des „EM Vereins“, der „Gesellschaft zur Förderung regenerativer Mikroorganismen“ und in den „EM-Journalen“ vorgestellt. Ich habe den Mikroben-Cocktail bei den Topfpflanzen in der taz ebenfalls angewendet, allerdings nur halbherzig.
.
Das Gegenteil von dieser praktischen Bewegung ist die eher theoretische „Degrowth-Bewegung“, die im vergangenen Jahr mit einer großen Konferenz in Leipzig von sich reden machte. Es geht dabei, wie der Name sagt, um Argumente, nicht für eine Effektivierung, sondern eine Reduzierung des Wirtschaftswachstums. Zuvor hatte der Soziologe und Mitbegründer der Weltrettungs-Stiftung „Futur Zwei“ Harald Welzer auf dem 18. „Philosophicum“ der Jesuiten in Lech bereits ausgeführt, dass die Ökologiebewegung – inklusive Parteien, Lehrstühle, NGOs, Garteninitiativen, Umweltbundesamt- und -ministerien – seit der berühmten Studie „Die Grenzen des Wachstums“ (1972) eine enorme „Karriere“ gemacht habe. Gleichzeitig werde jedoch jedes Jahr „ein neues Weltrekordjahr im Material- und Energieverbrauch“ angezeigt. Eine ebenso absurde wie katastrophische Entwicklung. Seine Zeitschrift „Futur Zwei“ wird neuerdings von der taz herausgegeben.
.


.
Zurück zum Stadtgrün: Beim Suchen danach, es war mehr ein Spazierengehen und Herumschnüffeln, entwickelte ich einen gewissen Hang zur Vollständigkeit, d.h. ich wollte möglichst alle Grünflächen in Berlin kennen lernen. Das beseelte auch schon viele Autoren von Büchern über Urban Gardening, die eine Art Katalog dieser Gärten erstellten. Es gibt neben der soziologischen inzwischen aber auch noch andere Forschungsbereiche, die sich mit den alten und neuen Gärten befassen und ganz grundsätzlich mit dem Grün in der Stadt. Ich interviewte dazu u.a. den Landesbeauftragten für Naturschutz, den Stadtökologen und Landschaftsplaner an der TU Ingo Kowarik. Von ihm hatte ich zuvor eine umfangreiche Studie über den aus China importierten Götterbaum gelesen, der in Berlin inzwischen der häufigste Baum sein dürfte. Die Gärtner raten, ihn in einem Betonkasten zu ziehen, sonst wird man ihn nicht wieder los, weil er beim oberirdischen Absägen seine unterirdische Triebkraft verstärkt. Linné hatte ihn einst in das Palmenhaus auf der Pfaueninsel gepflanzt, weil der Götterbaum mit seinen gefiederten Blättern durchaus gelegentlich palmenartig wächst. Er ließ sich jedoch hier nicht vermehren – bis Berlin 1945 in Trümmer lag, da legte er los – und wuchert seitdem grandios, man zählt ihn zu den „invasivsten Arten“. In Wien führte man 1856 neben dem Götterbaum den Ailanthus-Spinner ein, Es handelt sich dabei um einen schönen braunen Schmetterling aus China, dessen Raupen ausschließlich von Götterbaumblättern leben. Nach ihrer Verpuppung läßt sich aus ihrem Kokon eine Seide – die sogenannte „Eri-Seide“ – herstellen, die haltbarer und billiger als die übliche sein soll. Das Experiment wurde jedoch irgendwann genauso eingestellt wie in Berlin die Anpflanzung von Maulbeerbäumen, um darauf Seidenraupen zu züchten. Reste der Baumplantagen findet man noch heute in Zehlendorf, Steglitz und Erkner. Damals wurden aus dem Kokon Seidentapeten, Seidentaschen, Seidenjacken und Seidenkleider, seidene Hüte und Schuhe, Schärpen und Ordensbänder hergestellt.
.
Von Professor Kowarik stammt das Wort „Biokulturelle Werte“. Historisch gesehen habe die Ökologie im 19. Jahrhundert die Stadt entdeckt und die Stadtbevölkerung im 20. Jahrhundert das Gärtnern. Zwar bestehe fast die Hälfte der Fläche Berlins aus Wälder, Seen, Friedhöfe und Parkanlagen, trotzdem sei die Stadt damit im Städtevergleich des Umweltatlas unterdurchschnittlich versorgt. Vor allem gäbe es hier keine „Umweltgerechtigkeit“. Er meinte damit glaube ich, dass pro Einwohner zwar 11 Quadratmeter Grün zur Verfügung stehen, in Kreuzberg aber nur drei Quadratmeter. Denkbar wäre mehr Straßengrün, u.a. auf Mittelstreifen, und eine verordnete Dachbegrünung von Neubauten – etwa mit Magerrasen für gefährdete Arten. Überhaupt ginge es darum, das Bauen mit der Natur zu versöhnen. Das erinnert an das Credo des Wissenssoziologen Bruno Latour: „Es gibt keine ökonomische Utopie mehr, nur noch eine ökologische.“
.
Ich erzählte Professor Kowarik, dass derzeit aber noch genau das Gegenteil geschieht: Obwohl ganzjährig geschützt, werden alljährlich bei Fassaden-Renovierungen und energetischer Verdämmung in dieser bauwütigen Stadt mit den zinslosen Krediten mutmaßlich tausende von Jungvögel in ihren Mauernestern getötet: lebendig eingemauert. Spatzen, Stare, Mauersegler und Meisen, aber auch Fledermäuse. Derzeit geschieht so etwas in Hellersdorf und in der Kreuzberger Otto-Suhr-Siedlung, in kleinerem Maßstab aber auch in allen anderen Bezirken. Ja, die Eingriffs-Regelung müsste verbindlicher gemacht werden, meinte Professor Kowarik dazu bloß. Ähnliches hatte ich bereits von zwei ehrenamtlichen Vogel- und Fledermausschützern im NABU und im B.U.N.D gehört, die täglich die Bauarbeiten und die Nester vor allem in Hellersdorf photographieren und damit die zuständigen Behörden zum Eingreifen bewegen wollen. Für das Töten eines einzigen Singvogels kann man bereits ins Gefängnis kommen. Ihre aufwändigen Rettungsversuche sind jedoch in den meisten Fällen vergeblich, die Bauarbeiten gehen vor, was sie sehr deprimiert.
.

Dieser Star wollte seine Jungen füttern, deren Nest jedoch gerade von den Bauarbeitern mit Bauschaum verstopft wurde. Die Bauarbeiter erledigten das mit einem Baulift. Anschließend wurde gesagt, sie seien nicht mehr auffindbar und die Firma, von der der Baulift angemietet wurde, kenne man nicht.
.
Abgesehen vom chinesischen Götterbaum ist die urbane Flora und Fauna durchaus fragil: So warnte die BZ unlängst vor einer Insektenplage, wegen des milden Winters, aber bis jetzt geschieht eher das Gegenteil: Es gibt so gut wie keine Insekten mehr. Die Auto- und Motorradfahrer können es bestätigen: Sie finden keine Insektenreste mehr an ihren Scheiben und Helmen. Als kürzlich ein Tagpfauenauge durch den Cafégarten der taz flog, war das schon fast eine kleine Sensation, alles hörte für einen Moment auf zu essen. Ein Gärtner rief mich an und legte mir nahe, unbedingt etwas über das Verschwinden der Schmetterlinge zu veröffentlichen. Außerdem würden die Linden gerade blühen und es gäbe nur noch ganz wenige Bienen und Hummeln, fügte der Gärtner hinzu. Der Weltbienenkongreß, der im Frühjahr in Berlin tagte, hatte diesbezüglich auch bereits Alarm geschlagen.
.
Wo Insekten fehlen, können auch keine Singvögel mehr existieren, selbst die Spatzen werden immer weniger, weil sie, obwohl Körnerfresser, zur Aufzucht ihrer Brut Insekten brauchen. Vom Biologen der Humboldt-Universität Dr. Rolf Schneider erfuhr ich, dass auch die Dohlen verschwinden. Ihre größte Kolonie befindet sich in Köpenick, dort gab es ab 2003 dann auch eine Kooperation der Humboldt-Biologen mit dem NABU, der dort Nistkästen für sie aufhängte. „Die Dohlen bekommen in der Stadt weniger Nachwuchs als auf dem Land. Das Futterangebot ist problematisch: Zwar gibt es genug Kohlehydrate (Brot z.B.), aber sie brauchen für die Aufzucht Eiweiß (Insekten, Würmer etc.). Die Sterberate der in der Stadt geborenen Jungen beläuft sich auf 70 bis 100 Prozent, auf dem Land betrifft es nur 25 Prozent. Die Köpenicker Jungvögel wurden z.T. gemessen und gewogen: Viele erreichten nicht das Ausfliegegewicht, wir fanden Anzeichen von Pilz- und Nierenerkrankungen.“
.
Neben den Dohlen stehen auch die Saatkrähen inzwischen auf der Berliner „Roten Liste der gefährdeten Arten“. Erstere sind Höhlenbrüter, gerne in (Kirch)türmen (sofern nicht vergittert), letztere sind Freibrüter (auf hohen Bäumen). Eine der letzten in Berlin brütenden Saatkrähen-Kolonien – am Tegeler Flugfeld – erforschte der FU-Biologe und ehemalige Vorsitzende des NABU Berlin, Dr. Hans-Jürgen Stork. Das begann, als die 75 Brutpaare dort mit der geplanten Umnutzung der Landebahnen zu einem Gewerbe- und Hochschul-Park ihre Brutbäume verlieren sollten. Die Arbeit der Forschungsgruppe auf dem Flughafen bewirkte, dass sie nicht mehr von der Flughafenfeuerwehr mit Wasser vergrämt werden, sondern dass man sie jetzt sogar füttert. Außerdem fliegen sie nicht mehr zu ihren Schlafbäumen am Tegeler See, sondern bleiben Nachts auf dem Flughafengebäude.
.
Mit Urban Gardening hat dies insofern zu tun, als die Planer der Umnutzung des Flughafens auch so etwas dort haben wollen. Der Stromkonzern Vattenfall betreibt bereits seit einem Jahr ein Urban Gardening Projekt vor seinem Kraftwerk in der Köpenicker Strasse. Als die Planer in Tegel einen Grafiker beauftragten, ein launiges Plakat von der zukünftigen Nutzung des riesigen Geländes zu entwerfen, sollte er auch ein Marihuanafeld einzeichnen. Diese Rauschpflanzen werden sicher auch von dem einen und anderen Stadtgärtner angepflanzt. Obwohl ihr Anbau noch illegal ist (zuletzt wurde ein kleines Feld am Kottbusser Tor von der Polizei vernichtet), steht eine Legalisierung kurz bevor. Schon fand im Mai im Grandhotel Maritim eine internationale Cannabis-Konferenz statt, veranstaltet von Amerikanern, auf der es bereits um Millionengeschäfte damit ging, zunächst im medizinischen Bereich. Der Eintritt kostete 800 Euro. Und erst kürzlich veranstalteten zwei junge Vietnamesen eine große Cannabis-Messe im ehemaligen Funkhaus an der Nalepastrasse.
.
Für Leute, die Marihuanapflanzen auf ihrem Balkon ziehen wollen, gibt es neuerdings die Sorte „Automatik“. Sie wird nicht wie die bisherigen Sorten bis zu drei Meter hoch, sondern nur noch etwa einen, so dass man sie nicht von der Straße aus sehen kann. Zudem sind die Automatik-Pflanzen zu 95% weiblich – und nur diese entwickeln, vor allem in ihren Blüten, die Rauschsubstanz THC. Man hat dazu eine seltene Zwitterpflanze mit anderen besonders THChaltigen gekreuzt. Sie bleibt nicht nur klein, sondern fängt auch nach sechs Wochen, egal in welchem Licht, an zu blühen, ist also ideal für den Kleingärtner.
.
Deren Gartenkolonien muß man allerdings – neben der „organismischen Biologie an den Universitäten – zu den bedrohten Art in Berlin zählen: Fast regelmäßig verschwinden Kleingartenanlagen, weil die Grundstücke privatisiert und bebaut werden. Noch gibt es etwa 70.000 Kleingärtner, aber in drei Jahren läuft für 159 Kolonien die Schutzfrist ab – das sind 86% aller Kleingärten. Zuletzt verkaufte der Bezirk Pankow und die evangelische Kirche eine riesige Kolonie mit 330 Parzellen für etwa 3 Millionen Euro an einen Investor, der auf die Schließung des Flughafens Tegel spekuliert. Noch überfliegt dort alle paar Minuten ein Billigflieger die Gärten. Die größte Schrebergartenkolonie in Berlin hat über 1000 Gärten – fast eine kleine Stadt.
.
Der Bestandsschutz für die z.T. über 100 Jahre alten Schrebergärten in Berlin läßt also auf sich warten, eher werden anscheinend neue Naturschutzgebiete ausgewiesen. Gegenwärtig gibt es 42 Naturschutzgebiete in der Stadt, auf einer Vorschlagsliste stehen 18 weitere Flächen.
.

Irmgard Möller mit ihren Freunden auf ihrer Parzelle in der Kleingartenkolonie „Grüne Aue“ am Priesterweg.
.

Hans-Peter Möwig mit seinem Bruder Detlef (links) auf seiner Parzelle in der Kleingartenkolonie „Saatwinkler Damm“.
.

Gisela Buchholz am Gartenteich auf ihrer Parzelle in der Kleingartenkolonie „Luisengärten“ Belziger Strasse.
.

Das Ehepaar Dormann mit ihrem Nachbarn Dirk Körber (rechts) auf ihrer Parzelle in der Kleingartenkolonie „Rosstrappe“ am Spandauer Damm.
.
Die Stadtgärten erforschende Soziologin der Freien Universität, Elisabeth Meyer-Renschhausen, erinnert in ihrem Buch darüber an ein nach dem Ersten Weltkrieg erlassenes Gesetz zum Schutz des Gartens und meinte: „Vielleicht war dieses Gesetz, die Kleingarten- und Landpachtverordnung der Weimarer Republik, eines der wichtigsten Gesetze der deutschen Novemberrevolution 1918. Es stellt das heute von vielen Bürgergruppen und NGO’s in aller Welt wieder geforderte Recht auf Nahrung mit einem Recht auf freien Zugang zu einem dazu notwendigen Stück Land vor das Recht auf ungezügelte Bau-, Boden- und Investmentspekulationen.“
.
Man könnte mittlerweile sagen: Es gibt hier auf Dauer gesehen ein Kommen und gehen von Stadtgärten. Die Villenbesitzer mit großen Gärten im Grunewald und in Zehlendorf/Wannsee halbieren oder dritteln oft und gerne ihre Grundstücke, um Zeit und Geld zu sparen, und errichten darauf ein oder mehrere Häuser, die sie verkaufen oder vermieten. Der Große und Kleine Tiergarten war, nachdem im letzten Krieg alle Bäume zertrümmert und die Reste zu Brennholz verarbeitet worden waren, erst einmal für den Anbau von Gemüse parzelliert worden. Bei der Wiederaufforstung legte ein englischer Offizier in einer Ecke noch einen „Englischen Garten“ an für den er das ganze „Material“ aus England heranschaffen ließ. Auf der IGA gibt es jetzt einen weiteren „Englischen Garten“, ebenfalls mit einem Restaurant.
.

Der turkmenische und der weissrussische Präsident pflanzen einen Baum und begießen ihn bei strömendem Regen.
.
Der Botanische Garten in Dahlem scheint mit seinen großen Gewächshäusern für die Ewigkeit gemacht. „Habt Ehrfurcht vor den Pflanzen,“ lautete einst die Gründungdevise. Doch die Journalistin Anjana Shrivastava meint, wenn man eine der sogenannten „Tropischen Nächte“ im dortigen Palmenhaus besucht, sieht man wenig von solcher Ehrfurcht, mehr eine Entfaltung von menschlichen Trieben statt pflanzlichen. Die Besucher trinken Caipirinhas und trippeln im Laufe des Abends immer schwankender durch die schmalen Pfade zwischen den Gewächsen – wie z. B. die Seychellen-Palme, die so schön ist, dass sie auf den Marketing- Broschüren für die Tropischen Nächte nie fehlt. Sie ist nicht nur schön, sondern fast ausgestorben, weil ihr Habitus auf der Insel schwindet und ihre Samen, die größten Samen der Pflanzenwelt, zu schwer sind, um von den Seychellen mittels Wind und Wasser woandershin getrieben zu werden. Die Besucher scheinen nicht zu wissen, was für ein Wunder in ihrer Mitte ist.
.
Sie wippen zu der Salsa-Musik, die von leichtbekleideten Sängerinnen geboten wird, und kaum einer kann es vermeiden, gegen die vielen Pflanzen zu stoßen, denn alle Paar Meter steht zwischen den Palmen eine Cocktailbar. Die seltenen Bäume fungieren gewissermaßen als grüne Tapetenkulisse für Eventversessene. Bei den „Sonnenaufgängen im Regenwald“, die der Botanische Garten früher dort organisierte, standen noch die Pflanzen im Mittelpunkt, nur die „Soundcollage“ war Kulisse. So wandelt eine Amüsierpolitik das Gartenpublikum zu Eventhoppern.
.
Ironischerweise besuchen die Feiernden heute einen Garten, in dem auch die Wissenschaftler ein zunehmend peripheres Interesse an lebenden Pflanzen haben, weil sie diese lediglich auf genetischer und molekularer Ebene untersuchen. Dabei gehört es bis heute zur Bestimmung der Gärten, die Studenten der Naturwissenschaften mit lebenden Pflanzen vertraut zu machen. Heute beklagen sich Gartendirektoren, dass viele Studenten nicht einmal mehr den Unterschied zwischen Gerste und Hafer kennen. Noch können Professoren solch mangelndes Wissen in der organismischen Biologie aufwiegen, doch bald experimentieren die Laborbiologen in Gewächshäusern mit bloß noch einer Art und das über Jahrzehnte. Die Humboldt-Universität hat sich dafür gerade auf einem der Dächer ihres „Campus Nord“ ein solches Glashaus gestellt. Das ist die neue wissenschaftliche Monokultur, einst galt die Botanik laut Albrecht von Haller als „Königsweg der Erkenntnis“.
.

Elsbeth Schiller und ihre Schwester Hannelore aus Nürnberg in der IGA-Blumenhalle.
.

Einige Besucher in der IGA-Blumenhalle, die mit einem Reisebus aus Hanau anreisten.
.
Die Botanischen Gärten sind meist den Universitäten angeschlossen – und diese würden sich lieber heute als morgen von ihnen trennen. In Holland wurden bereits mehrere Botanische Gärten geschlossen, in Hamburg verhinderte ein Bürgerprotest die Schließung des Botanischen Gartens, in Saarbrücken wurde er jedoch im vergangenen Jahr aufgegeben und sogleich geplündert, seitdem ist das Saarland das erste Bundesland ohne einen Botanischen Garten für die Bevölkerung. Die Sprecherin der dortigen Universität begründete den Abwicklungsbeschluss so: Für Forschung und Lehre werde der Garten nicht mehr gebraucht; mit seinem Jahresetat von 500.000 Euro könnten drei Professorenstellen finanziert werden.
.
Die Fachgärtner im Berliner Botanischen Garten spüren diese Entwicklung bereits: „Die Wissenschaftler wollen nur in die Pflanze reingucken, für die Pflanze interessieren sie sich nicht,“ sagt der Gewächshausgärtner Thomas Borowka. Er, der zusammen mit den Palmen und dem Palmenhaus als Gesamtpaket für die Tropische Nacht an die veranstaltende Firma mitvermietet wird, zeigt den angeheiterten Besuchern Fotos von Monokulturen wie Soja, die den südamerikanischen Regenwald quadratkilometerweise veröden lassen. Das ist nicht das Lateinamerika von Salsa und Bacardi-Rum. Die stille Botschaft des Gärtners, die er der Gruppe zeigt, will nicht zu dem lauten touristischen Marketing des Abends passen. Die lebende Natur wird zum Beiwerk für distinktiven Lifestyle. Die Freie Universität verfolgt dabei eine Art Doppelstrategie: Sie schwankt zwischen der Abwicklung und der Einnahmen-Steigerung ihres Botanischen Gartens: Auf Kosten des Personals wird gespart und ausgegliedert und gleichzeitig Millionen in multimediale Installationen investiert. Die Gewerkschaft Verdi bereitet derzeit eine Broschüre über diese Misere vor.
.
Der Verhaltensforscher an der Humboldt-Universität Professor Rolf Schneider meint, fast könne man bereits davon ausgehen, „dass die Tier- und Pflanzenforschung von der Naturwissenschaft zur Kulturwissenschaft und zu den Künstlern wandert. Ohnehin war es ja die Romantik, die den Naturschutzgedanken einst angestoßen hat.“ Darüberhinaus auch den Gedanken des „Kinder-Gartens“, fiel mir ein. Und wohl nicht zufällig hieß die erste moderne Massenillustrierte in Deutschland „Die Gartenlaube“, eine „moralische Wochenschrift“, die von 1853 bis 1984 existierte.
.

Die Pankowerin Elke Schnakenburg mit Ehemann, Sohn und Schwiegermutter vor einem der IGA-Beete, von ihrem Schwiegervater photographiert.
.

Else Machnitzke aus Buch muß immer wieder die Pflanzen berühren – „vorsichtig natürlich,“ versichert sie.
.
Die Humboldt-Universität will zwar ihre Sammlung exotischer Gehölze (das Arboretum in Treptow) einstweilen noch behalten, ihren Botanischen Garten in Blankenfelde-Pankow, anfänglich ein Schulgarten, hat sie jedoch an den Senat abgegeben, dessen „Grün Berlin GmbH“ daraus einen „Volkspark“ machte – mit zwei Bürgergärten. Diese sind groß und rund und die einzelnen Parzellen sind wie Tortenstücke angeordnet, so dass man sie von der Mitte aus alle auf einmal bewässern kann. Es gibt im Umland noch einige ähnliche Projekte – von Künstlern und von Landwirten. Eins wirbt mit dem Spruch „Wir beeten für Sie“. Man mietet ein oder mehrere Beete und die Arbeit wird gegen Bezahlung von den Vermietern geleistet. Danach muß nur noch selbst ernten.
.
Ich habe einmal kurz bei drei Diplomlandwirten gearbeitet, die in ihrem gepachteten Garten Gemüse für 40 Wohngemeinschaften anbauten, denen sie ihren Anteil Bohnen, Erbsen, Tomaten usw. in eine Kneipe lieferten. Sie wurden dafür von ihnen mit einem Monatsgehalt plus einer Investitionszulage bezahlt. Erwähnt sei außerdem noch eine Internetinitiative namens „Mundraub“, die auf einer Deutschlandkarte alle Stellen verzeichnet, wo man kostenlos Obst einsammeln kann – herrenloses sozusagen. An den Alleen wurden die Obstbäume früher einzeln verpachtet, inzwischen will sie niemand mehr. Hinzu kommt, dass die Schrebergärtner zur Erntezeit mittlerweile fast immer zu viel Obst an ihren Bäumen haben, das sie billig abgeben oder sogar verschenken müssen. Alle Schrebergarten-Romane und -Berichte thematisieren dieses Dilemma.
.
In der DDR waren die Schrebergarten-Vereine zunächst nur geduldet, mit wachsenden Versorgungsproblemen wurden die Kleingärtner jedoch gefördert und ihre Produkte beim Verkauf subventioniert. Wenig später wurden die Betriebe sogar verpflichtet, ihre nicht-betriebsnotwendigen Grundstücke als Kleingartengebiete für ihre Mitarbeiter auszuweisen. Diese legten ihre „Datschen“ selbst an, der Betrieb stellte jedoch Material und besorgte zusammen mit den Kommunen die Strom- und Wasserversorgung. Ähnliches galt auch für die Begrünung von Hinterhöfen und für die Anpflanzungen und Pflege der Freiflächen zwischen den Mietshäusern in den Neubaugebieten – wie Marzahn-Nord z.B..
.

Fedora Körber faßt für den Photographen, ihren Nachbarn Jürgen Kleeberg, vorsichtig eine Rosenblüte an. Vor dem taz-Café werden die Rosenblüten übrigens ständig von irgendwelchen schlechtgelaunten Passanten abgerissen und wenig später weggeworfen.
.

Eva-Maria Mildner hat auch den Drang auf ihrer Parzelle in der Kleingartenanlage Bornholm II Ibsenstrasse ständig die Blüten ihrer Rosen anzufassen und daran zu riechen, abpflücken tut sie sie aber nicht: „Ich mag keine Blumen in Vasen“.
.
In Westberlin hatten die Hausbesetzer in den Achtzigerjahren, vor allem in Schöneberg und Kreuzberg, im Zuge einer Politik der „behutsamen Stadterneuerung“, die gegen „Kahlschlagsanierung“ gerichtet war, ihre Hinterhöfe üppig begrünt. Und auch dafür waren sie bezahlt worden. Damals sprach man noch nicht von „Urban Gardening“, wohl weil man nicht Gemüse anbaute – es sollte vor allem schön aussehen, und ein bißchen wild. Die Schrebergärten wurden als „kleinbürgerlich“ abgetan. Die Geographinnen Frauke Pleines und Ines Schilke sagen es in ihrer im Internet veröffentlichten Examensarbeit „Ist der städtische Garten politisch?“ so: „Die Ästhetisierung städtischen Freiraumes schritt immer weiter voran und die Menschen distanzierten sich zunehmend von ’nach Armut aussehendem Gemüseanbau‘.“ Im Osten gaben nach der Wende viele, die für die Konsumläden Honig, Eier, Obst und Gemüse produziert hatten, auf, weil ihre Produkte nicht mehr subventioniert wurden.
.
Aber dann kam es ab den späten Neunzigerjahren wieder anders herum – mit Urban Gardening, das politisch, ökologisch und kulinarisch motiviert war. Die Vegetarierbewegung breitete sich aus. Deren Gärten unterscheiden sich damit von früheren städtischen Gärten: Diesen ging es eher um familiäre Überlebenssicherung und soziales Zusammensein, jenen mehr um die Erprobung neuer, gemeinschaftlicher Lebensstile und den Anbau gesunder Lebensmittel. Aber ihre Unterschiede verringern sich. So beteuerte z.B. ein Sprecher des Landesverbandes der Berliner Gartenfreunde, Jürgen Hurt, gegenüber der Presse: „Zu sagen: ‚Dit dürfen se nicht. Sonst kriejen Se den Garten nicht‘, wie das lange geloofen ist – das geht heute nicht mehr.“ In den Schrebergartenkolonien stehen jetzt vielleicht noch eher Gartenzwerge, während in den Urban Gardening Kolonien Buddhastatuen stehen. Aber so groß ist dieser Unterschied nicht.
.
Auf der IGA befinden sich beide nebeneinander: Zum Einen der „Weltacker“, mit dem gezeigt wird, dass man sich mit der Ernte eines 2000 Quadratmeter großen Gartens ein Jahr lang vegetarisch ernähren kann. Und zum Anderen gleich daneben die Schrebergartenkolonie „Am Kienberg e.V.“, wo die Kleingärtner auf ihren 260 Parzellen nicht nur Gemüse und Zierpflanzen anbauen und Obst und Beeren ernten, sondern sich auch mit Eiern und Fleisch (von Kaninchen, Hühnern und Tauben) versorgen. Die IGA selbst stellt in diesem Jahr erstmalig ebenfalls Tiere aus: drei kleine Pferde-, Rinder- und Schaf-Herden und eine Gänseschar. Der Unterschied zwischen den beiden Gartentypen wäre demnach einer zwischen Vegetariern und Fleischessern. Und während die Schrebergärtner wahrscheinlich chemischen Dünger gelegentlich verwenden, sowie auch Gift gegen Schnecken und Blattläusen einsetzen, vielleicht auch gegen Unkraut, das man heute politisch korrekt Wildkraut nennt, arbeiten die Urban Gardener, aber auch die IGA-Planer streng ökologisch. Andererseits werden jedoch die Blumen dort sofort nach Verblühen durch andere ausgetauscht, um den Besuchern für ihr Eintrittsgeld stets „blühende Landschaften“ zu zeigen. Von dem riesigen Haufen Tulpenzwiebeln durften sich die Mitarbeiter welche mitnehmen, Tulpen sind mehrjährige Gewächse, die IGA geht nur bis Oktober. Was hier auf großen Flächen passiert, geschieht auf Friedhöfen in kleinem Maßstab: dass grabpflegende Angehörige verblühte Pflanzen in Abfallcontainer werfen, aus denen andere Friedhofsbesucher sie wieder raussuchen, um sie bei sich zu Hause einzupflanzen.
.

.
Auch bei der Einzäunung gibt es Unterschiede: Bei den Schrebergärten erlaubt das Kleingartengesetz von 1913 zum öffentlichen Weg hin nur 1 Meter 25 hohe Hecken und zu den Nachbarparzellen bis zu 2 Meter 50. Vielen jungen Nachrückern in den Gartenkolonien wurde bereits die Parzelle wieder gekündigt, weil sie sich nicht an die Verordnungen hielten, besonders oft handelt es sich dabei um Westler in Ostberliner Schrebergärten, deren Antiautoritarismus dort nicht gut ankam. In den Urban Gardening Kolonien sind dagegen, ähnlich wie in vielen polnischen Kleingartenkolonien, die Parzellen meist nicht durch Zäune oder Hecken abgegrenzt.
.

Auch für Musik ist auf der IGA gesorgt. Sogar mehr als einem lieb ist.
.
Folgt man Jean-Jacques Rousseau, dann beginnt das Eigentum mit dem ersten Menschen, der sagt, das ist meins – und die anderen es akzeptieren, dass er einen Zaun zieht oder Grenzpfähle setzt. In einigen Regionen Deutschlands gibt es sogar staatliche Zuschüsse, wenn die Bürger sich dort beim Abgrenzen ihres Grundbesitzes von dem ihrer Nachbarn oder vom öffentlichen Gehweg regionaltypischer Zäune bedienen – in Norddeutschland z.B. für den „Friesenzaun“ und in Nordbayern für den „fränkischen Gartenzaun“. Auf dem Land verschwinden die Zäune dagegen, weil die Rinder heute meist ganzjährig in sogenannten Laufställen gehalten werden.
.
Man kann davon ausgehen, dass das Einzäunen mit der Seßhaftigkeit begann: Während die Nomaden den Raum beherrschten, nahmen die Seßhaften ihn in Besitz, sie zerstückelten und markierten ihn, um ihn aufzuteilen und zu verteidigen. Die Sozialhistorikerin Anny Milovanoff schreibt in „Die zweite Haut des Nomaden“: „Der Nomade hält sich an die Vorstellung seines Weges und nicht an eine Darstellung des Raumes, den er durchquert. Er überläßt den Raum dem Raum.“ Das galt auch für die frühgeschichtlichen Jäger und Sammler, d.h. für jene Gruppen, in denen die Männer Wild jagten und die Frauen Früchte, Beeren, Nüsse usw. sammelten. In den einzelbäuerlichen Haushalten ist die Frau bis heute meist für den Garten zuständig und der Mann für den Acker. Auch bei den Balkonbepflanzern handelt es sich heute meist um Frauen.
.

Eine Begegnung am Rande der IGA-Wege.
.
Berühmt sind die ersten Kämpfe gegen die Einzäunungen in England, als dort das Gemeindeland (die Allmende) privatisiert wurde. „Diggers“ und „Levellers“ nannten sich die Widerständler, die die Zäune und Hecken „ausgruben“ und „einebneten“, daher ihre Namen. Im Endeffekt wurden zigtausende von Kleinbauern aus ihren Dörfern vertrieben, als ihre Allmende verschwand.
.
Nach der Privatisierung des DDR-„Volkseigentums“ brachen auch in und um Berlin „Zaunkriege“ aus. Der Staat hatte ganze Seegrundstücke privatisiert und die neuen Besitzer sie eingezäunt, so dass die in der Nähe Wohnenden nicht mehr im See baden und angeln oder am See spazieren gehen konnten. Damit wurde ein Gewohnheitsrecht gebrochen. Nachts wurden Zäune entfernt oder Löcher in die Zäune geschnitten. Am Liebenberger See hielten die neuen Besitzer de „Seeschlosses“, die Deutsche Kreditbank (DKB), die Zudringlinge statt mit einem Zaun durch „Security-Kräfte“ von der Seenutzung ab. In und um Potsdam, wo um den Zugang zu den Seen am Heftigsten gestritten wird, führte ein „Zaunkrieg“ zur Gründung einer Bürgerinitiative gegen die Seeeinzäunung: „Mit Schildern, Lautsprechern und Trommeln in den Händen machten sich die Bewohner aus der Nähe des Groß- Glienicker Sees auf den Weg von der Seepromenade zum Fußweg am Ufer,“ um laut taz „für einen freien Zugang zu kämpfen“. Anwohner mit Seegrundstück hatten den Weg mit hohen Hecken und Zäunen gesperrt; Überwachungskameras und Securityleute mit Schäferhunden sollten dafür sorgen, dass niemand ihre Grundstücke durchquert. Nachdem sie drei Mal so protestiert hatten, ließ die Stadt mit Baggern die Hecken und Zäune auf zwei Grundstücken entfernen. Aber der Streit ging weiter. Der NDR meldete: „Am Griebnitzsee in Potsdam fliegen die Fetzen.“ 2012 wurde ein Potsdamer Landschaftsplan verabschiedet, der die Erschließung der Uferabschnitte, einen naturnahen Ufergrünzug und die Schaffung eines durchgängigen Uferweges als Planungsziele festschrieb.
.
Foto
Und hier und da steht auch Kunst in oder neben den Rabatten.
.
Foto
Ein Holzbildhauer, der nicht rechtzeitig vor Eröffnung der IGA fertig geworden ist.
.
In Kreuzberg hat vor allem die Bebauung des riesigen Spreegrundstücks an der Cuvrystrasse für Ärger gesorgt, weil eine Firma die kleinen Holzhütten von polnischen Bauarbeitern und bulgarischen Roma zerstörte und jetzt zwei gigantische Büroblöcke darauf entstehen, in die der Onlinehändler „Zalando“ einzieht – mit 2000 Mitarbeitern, was bedeutet, dass die Mieten in weitem Umkreis der ehemaligen „Cuvry-Brache“ noch einmal steigen werden. Anfänglich befand sich dort ein Fluß-Schwimmbad mit einem Park davor.
.
Die Forderung nach Rekonstruktion dieser öffentlichen Grünanlage hat bisher noch keinen öffentlichen Widerhall gefunden, obwohl in Berlin rund 600 ehemalige Park- und Gartenanlagen, auch viele private, vom Gartendenkmalamt kostenlos rekonstruiert wurden und werden. Den Künstlergarten von Max Liebermann am Wannsee konnte man anhand seiner Bilder, die er davon gemalt hatte, rekonstruieren. Hierfür spendeten 64 Politiker jeder einen Birkenbaum. Das Gartendenkmalamt beschwert sich ansonsten, dass man in der Stadt keinen Sinn für die Erhaltung historischer Gärten hat – und viel zu wenig Geld dafür ausgibt. Der inzwischen pensionierte oberste Gartendenkmalspfleger Klaus-Henning von Krosigk kann sich deswegen durchaus vorstellen, dass man öffentliche Parkanlagen wie z.B. den Tiergarten einzäunt und Eintrittsgeld verlangt. Die Autoren des Internetforums „gemeingut“ befürchten, dass die „Grün Berlin GmbH“, dies ebenfalls plant, auch für das IGA-Gelände.
.

Die Wege auf der IGA sind lang, aber es gibt genügend Bänke zum Ausruhen.
.

Besonders für Kurzbeinige wie dieser Dackel kann ein IGA-Besuch anstrengend sein.
.
Einige Landschaftsplaner kritisieren unterdes, dass man sich bei den Parkanlagen mehr einfallen lassen müßte als nur Liegewiesen, Wasserflächen, Bäume und Büsche. So fordern sie u.a., dass das Grillverbot im Tiergarten wieder aufgehoben wird. von der IGA wünschen sie sich, dass sie künftig kleinteiliger und dezentral angelegt wird. Im Görlitzer Park in Kreuzberg wurden kürzlich viele Büsche gerodet, um den Rauschgifthändlern ihre Drogenverstecke zu zerstören. Dort sowie auch in der Neuköllner Hasenheide scheint man es jedoch zu tolerieren, dass einige Bürger einfach Sonnenblumen, Kartoffeln und sogar Bäume pflanzen. Auf diese Weise greift die Grünplanung von oben und die Wiederaneignung von öffentlichem Land durch die Bürger langsam ineinander. Die jetzige rot-rot-grüne Regierung hat so etwas sogar in ihrem Programm festgeschrieben. Es ist dies vielleicht ein Nachhall der Praxis in der DDR, wie sie beim Tierpark in Friedrichsfelde und dem Volkspark Marzahn (heute „Gärten der Welt“) zum Tragen kam: Sie wurden von oben geplant und von unten beteiligten sich tausende Ostberliner mit freiwilligen Aufbaustunden, „Subbotniks“ nennt die IGA sie auf ihren Informationstafeln zur Geschichte des Bezirks, die in der Anlage verstreut herumstehen. Diese Mitarbeit der Bevölkerung hat bis heute einen ganz anderen – pfleglicheren – Umgang mit den Grünanlagen bewirkt als der in den entsprechenden Westberliner Einrichtungen.
.
Im Grunde würden sich dabei jedoch zwei Welten gegenüber stehen: die Klasse derer, die mit einem politischen Mandat ausgestattet seien, und eine Klasse neuer Bürger-Politiker, die ihre Interessen auf dem Weg der direkten Demokratie durchsetzen wollten, meinte der Sprecher des Vereins „Changing Cities“, der frühere Bahnmanager Heinrich Strößenreuther, der mit einer Bürgerinitiative gegen die Werbewahn in der Stadt vorgehen will, wie der Sender RBB berichtete: „Von visueller Verschmutzung ist die Rede und von der Kommerzialisierung öffentlicher Räume – gemeint sind die Werbeflächen in Berlin. Eine Bürger-Initiative will die Berliner vor zu viel Werbung schützen und strebt dafür ein neues Volksbegehren an.“
.
Aber dahinter steht der Zwang zu Produktion und Vermarktung. Wir sind inzwischen so weit, dass alles an und um uns herum – Häuser, Strassen, Autos, Kleidung, Kommunikationstechniken etc. – auf Mathematik basiert, nur die immer weniger werdenden Pflanzen und frei lebenden Tiere noch nicht ganz. Aber um zum Ende zu kommen: Unterm Strich kann man vielleicht sagen, dass sich trotz des um sich greifenden ökologischen Denkens das Verschwinden von Gärten und das Entstehen von neuen ungefähr die Waage halten. Die Auseinandersetzung zwischen Ökonomie und Ökologie scheint damit in Berlin fast ein Nullsummenspiel zu sein.
(Vortrag, gehalten auf dem „IGA-Campus“ am See – im Rahmen der Lesereihe „Ansichten zur Natur“ des Humboldt-Forums)
P.S.: Ende 2017 erschien noch eine Aufsatzsammlung über Urban Gardening mit dem Titel „Umkämpftes Grün. Zwischen neoliberaler Stadtentwicklung und Stadtgestaltung von unten“.
.

Dieser beeindruckende Baum stand schon lange vor der IGA am Kienberg.
.
Anmerkung
(*) Zwei Bodenforscherinnen haben sich lange damit beschäftigt und Bücher darüber veröffentlicht: Aber während die Mikrobiologin Annie Francé-Harrar die Ursache des zunehmenden Humusverlustes vor allem im Rückgang der Wälder und der damit zusammenhängenden Bodenerosion sah, hält die Tierärztin Anita Idel die Reduzierung von Weideland und damit die Zerstörung der Verbindung (der „Ko-Evolution“) von Gras und Grasfresser für die Ursache. Die Erhaltung der Graslandschaften – Steppen, Savannen, Prärien, Tundren und Pampas – durch nachhaltige Beweidung erhalte deren noch weltweit größte CO2-Speicherkapazität und trage wesentlich zur Humusbildung bei. Deswegen würde Anita Idel wohl eine Rückkehr zur Viehzucht mit Wanderhirten als optimal für das Grasland halten (wovon auch einige westafrikanische Regierungen inzwischen überzeugt sind), während Annie Francé-Harrar die Wiederaufforstung vieler für die Landwirtschaft gerodeter Flächen forderte. Erstere erforscht die Humusbildung quasi von oben – über die Kuh, letztere gelangte von unten über die Untersuchung der Bodenorganismen zur „Humuskatastrophe“.
Es gibt dazu eine Studie über drei Länder, in denen man ihr lange Zeit entgegentrat – mittlerweile ein Klassiker: Der Leiter der Abteilung für Bodenbearbeitung im US-Landwirtschaftsministerium, Franklin H. King, bereiste 1909 mit einem Team von Mitarbeitern China, Korea und Japan, sein begeisterter Bericht darüber: „4000 Jahre Landbau“ erschien 1911 (auf Deutsch wurde er zuletzt 1984 veröffentlicht). Der Autor kommt darin zu der Überzeugung, dass die amerikanische Landwirtschaft unbedingt von der in China, Korea und Japan lernen muß. „In Amerika verbrennen wir ungeheure Mengen Stroh und Maisstrünke: weg damit! Kein Gedanke daran, dass damit wertvolle Pflanzennährstoffe in alle Winde zerstreut werden. Leichtsinnige Verschwendung bei uns, dagegen Fleiß und Bedächtigkeit, ja fast Ehrfurcht dort beim Sparen und Bewahren.“ Noch mehr gelte das für den Umgang mit Fäkalien. Er wird auf Schiffen zusammen mit Schlamm aus Kanälen transportiert, an Land gelagert, dann in Gruben an den Äckern geschüttet, wobei man dazwischen Lagen mit geschnittenem Klee packt und „das Ganze immer wieder mit Kanalwasser ansättigt. Dies läßt man nun 20 oder 30 Tage fermentieren, dann wird das mit Schlamm vergorene Material über den Acker verteilt.“ Die US-Agrarforscher halten die „landbaulichen Verfahren“ der Chinesen, Koreaner und Japaner, mit denen sie „jahrhundertelang, praktisch lückenlos, alle Abfälle gesammelt und in bewundernswerter Art zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und Erzeugung von Nahrungsmitteln verwertet haben, für die bedeutendste Leistung der drei Kulturvölker.“ Wenn man sie studieren will, „dann muß man auf das achten, was uns die Hauptsache zu sein scheint, dass nämlich unter den Bauern, die die dortigen dichten Bevölkerungen jetzt ernähren und früher ernährt haben, richtiges, klares und hartes Denken Brauch ist.“
Eine Meldung auf „pflanzenforschung.de“ 2010: „Aufgrund des übermäßigen Einsatzes von Stickstoffdünger werden Chinas landwirtschaftliche Flächen immer saurer und bringen immer weniger Ertrag. Laut Experten könnte das in Zukunft die Lebensmittelproduktion Chinas gefährden.“ Greenpeace erklärte dazu: „Das Land hat seine Landwirtschaft mit großem Aufwand industrialisiert und mittlerweile einen Anteil von 34 Prozent am weltweiten Bedarf für Phosphor-Düngemittel. Die meisten werden im Land selber produziert.“ Die chinesische Landwirtschaft verbraucht heute 36,7 Millionen Tonnen jährlich. Flankierend dazu eine Wirtschaftsmeldung von 2013: „Schlechte Nachrichten für die Kali+Salz AG. China steigt beim russischen Düngemittelriesen Uralkali ein und schürt damit neue Spekulationen über die Machtverteilung in der Branche. Da die Volksrepublik zu den größten Konsumenten von Kali-Düngern gehört, wird es aus Sicht von Experten wahrscheinlicher, dass Uralkali die Preise wie angekündigt drückt und dies durch größere Verkaufsmengen wettmacht – unter anderem in China.“
Eine weitere Meldung aus China – auf „netzwelt.de“: „Huishan Dairy, ein chinesischer Milchhof, hat die weltweit größte Anlage installiert, mit dem Strom durch Methangase aus Kuhmist hergestellt wird. Darüber hinaus ist das System auch gut für die Umwelt. Die Anlage von Huishan ist etwa zehnmal so groß wie ein normalerweise übliches System das zur Strom-Gewinnung aus Kuhmist eingesetzt wird. Der Dung von 60.000 Kühen wird in Huishan verwendet und stammt von 20 Höfen in der Nähe von Shenyang. Dadurch können 5,6 Megawatt an Strom erzeugt werden.“
Es scheint, dass die chinesische Landwirtschaft spätestens seit Deng Xiaopings Privatisierungsparole „Bereichert Euch!“ (1983) kein Vorbild mehr für Amerika ist, sondern umgekehrt. Ein Machtwort von Mao tse Tung lautete einst: „Mist ist wichtiger als Dogmen!“ Das bezog sich auf die Düngung der Felder. Vor der Revolution mußten Landarbeiter sich verpflichten, die Toilette des Gutsbesitzers zu benutzen. An den Straßen standen Töpfe. Sie wurden regelmäßig geleert. Fäkalien waren ein Handelsgut, man konnte sie portionsweise auf dem Markt kaufen. Unternehmer zahlten viel Geld, um die Fäkalien ganzer Städte einzusammeln und an die Bauern zu verkaufen. Man weiß dort, da jede Pflanze Humus verbraucht, muß vor allem beim Anbau von Nutzpflanzen, der Humus immer wieder ersetzt werden.
.
IGA-Details
Einer der von Gartenkünstlern gestalteten kleinen Gärten auf d(Vortrag, gehalten auf dem „IGA-Campus“ am See – im Rahmen der Lesereihe „Ansichten zur Natur“ des Humboldt-Forums)er IGA heißt „Cultivated by Fire“ (Vom Feuer kultiviert) und wurde vom australischen Büro „T.C.L.“ geplant. Auf der Internetseite der IGA heißt es dazu:
„Seit Jahrtausenden schon nutzen die Stämme der australischen Ureinwohner (Aborigines) das Feuer als Instrument der Bodenkultivierung. Die Landschaftsplaner von T.C.L setzen diese Kulturtechnik der Aborigines für die Gestaltung ihres Gartenkabinetts ein. ‚Fire Stick Farming‘ (etwa: Feuerstab-Anbau) nennt sich die kontrollierte Verbrennung von Land zur Steigerung der Fruchtbarkeit des Bodens. Durch das Feuer wird so eine wichtige Grundlage für die Ernährung der indigenen Völker geschaffen: Essbare Pflanzen gedeihen ebenso wie Gräser, die als Nahrungsquelle für die von den Aborigines gejagten Wildtiere dienen. Zudem konnten Buschbrände mit dieser Technik kontrolliert werden. In Regionen, in denen das ‚Fire Stick Farming‘ praktiziert wurde und auch heute noch praktiziert wird, entsteht ein Mosaik aus verbrannten Landschaften unterschiedlicher Regenerationsgrade. T.C.L greift dieses Bild des Mosaiks in seinem IGA-Beitrag ‚Cultivated by Fire‘ auf und setzt die Jahrtausende alte Kulturtechnik des ‚Fire Stick Farmings‘ in abstrahierter Form als Mittel der Gestaltung ein. Seit 1989 widmet sich das Büro Taylor Cullity Lethlean (T.C.L) aus Melbourne der Frage, wie sich Landschaft und zeitgenössische Kultur Australiens auf poetische Art und Weise in Landschaftsinszenierungen einfangen lassen.“
.
Diese Darstellung ist nur zum Teil richtig, denn in Australien war es noch vor nicht langer Zeit straffrei, einen Aborigines zu töten. Sie wurden in immer abgelegenere – trockene – Gebiete abgedrängt, erst durch ihre Proteste und Streiks änderte sich ab den Sechziger- und Siebzigerjahren die Situation. „Die meisten Ureinwohner im Outback sichern ihren Lebensunterhalt heute durch Hilfsarbeiten auf Farmen und Ranches, als Fremdenführer oder durch den Verkauf von Kunsthandwerk,“ heißt es auf Wikipedia. „Unter dem Recht am Land verstehen die Aborigines kein Eigentum im Sinne des deutschen (oder römischen) Sachenrechts. Nach dem heutigen australischen Recht wird der rechtliche Bezug zum Eigentum an Land der Aborigines anerkannt. Dabei gibt es insbesondere je nach Bundesland unterschiedliche Anspruchsregelungen. Es ist festzustellen, dass im Norden vor allem der Native Title und im Südosten Landnutzungsrechte eine Rolle spielen. 1,1 Mio. Quadratkilometer Land wurden von 1966 bis 1991 den Aborigines zugesprochen, was etwa 15 % der Landfläche des australischen Kontinents sind.“
.
„Das kontrollierte Feuerlegen von trockenem Grasland, Buschwerk und Wäldern diente den Aborigines dazu, um Wege durch Dickicht und stachliges Gehölz zu schaffen, vorhandene Nutzpflanzen zu fördern und neues -wachstum zu initiieren, Jagdmöglichkeiten zu schaffen und nützliche Pflanzen zum unmittelbaren Verzehr oder Kochen, zur Wärmegewinnung oder auch zur Nachrichtenübermittlung, sowie auch für spirituelle Zwecke zu gewinnen. Die Nutzung des zweckgerichteten Feuers folgte bestimmten Regeln, die sich nach dem Vegetationsverlauf und dem Bedarf der Aborigines richteten. Es diente dem Wachstum essbarer Pflanzen oder um die Nahrungsaufnahme bejagbarer Tiere zu begünstigen, zum anderen aber auch, um das Risiko für unkontrollierte Buschfeuer zu reduzieren.
Frühe europäische Forscher und Siedler übernahmen die Gewohnheiten der Aborigines mit dem Feuer. Die Feuer erstreckten sich in der Landschaft über den gesamten Jahresverlauf. Die meisten Brände waren von relativ geringer Intensität und verbrannten in den meisten Fällen lediglich kleine Flächen, unkontrollierbare Buschfeuer in großem Umfang entstanden dadurch kaum.“ (Wikipedia)
In den vergangenen Jahrzehnten erforschten Umweltwissenschaftler die Wirkungen von „kontrollierten Buschfeuern“. Inzwischen herrschen „politisch korrekte“ Zeiten, auch Multikulti ist noch angesagt, und da sollte man tolerant gegenüber anderen Denksystemen sein – und möglichst kooperieren, sich vernetzen usw.. Ausgehend vom australischen Garten „Kultiviert durch Feuer“ auf der IGA las ich einen Artikel der Wissenschaftshistorikerin Helen Verran über zwei verschiedene Arten, ein kontrolliertes Buschfeuer zu entfachen. Einmal die Umweltwissenschaftler, die 1 qm große Versuchsfelder anlegen, die Pflanzen darin bestimmen und zählen, dann die Quadrate verbrennen und anschließend wieder die Pflanzen, die dort neu hochkommen, bestimmen, zählen usw….Sie stehen dabei in der ‚Tradition u.a. von Linné und Darwin und berufen sich genealogisch auch auf sie – beim Legen ihrer Buschbrände.
Während die Aborigines sich auf die Clan- und Familiengeschichte nebst ihrer eigenen in ihrer Region, in der sie die Buschfeuer entzünden, berufen und in der Tradition der „Traumzeit“ argumentieren – sowie auch handeln. Dazu gehört, dass rings um den Brand alles gesammelt (Yamswurzeln), geerntet (Muscheln) und gejagt (Känguruhs) wird. Anschließend wird dies alles gerecht unter allen Clanmitgliedern geteilt – bemessen nach ihrer Nähe bzw. Entfernung im Verwandtschaftsgrad.
Da stoßen zwei Vorgehensweisen, „zwei Wissenschaften“ würde Lévy-Strauss sagen, aufeinander. Und dann sollen die Umweltwissenschaftler und Aborigines auch noch zusammenarbeiten…Letztere organisierten dazu einen gemeinsamen Workshop auf ihrem Territorium. Der Text darüber findet sich in der Aufsatzsammlung „Science and Technology Studies. Klassische Positionen und aktuelle Perspektiven“ (2017).
Helen Verran, die feministische Wissenschaftshistorikerin an der Charles-Darwin-Universität in der Küstenstadt Darwin im Norden der Northern Territories von Australien, hat sie alle drauf: die „Akteur-Netzwerk-Theorie“, die Latours und Haraways und schließlich das „postkoloniale Moment“, das bei dem Bemühen, die beiden Denksysteme zu gemeinsamer Aktion zu führen, aufscheint. Während hierzulande das Fortdauern imperialistischer Machtverhältnisse in anderer Gestalt als „postkolonial“ kritisiert wird, deutet in Australien das „Postkoloniale“ auf etwas Überwundenes, auf einen Bruch – glückhaft Empfundenes – hin.
.

Der Garten „Cultivated by Fire“, Photo: C.Uhlemann
.
IGA-Kritik
Zwischen dem Bahnhof der U5 am Cottbusser Platz in Hellersdorf und der Einkaufsstraße Auerbacher Ring haben die Kaufhalle und die Läden drumherum geschlossen, dafür haben sich dort soziokulturelle Projekte angesiedelt. Eins – die „Station urbaner Kulturen“ – lud zu einer Diskussion über die Internationale Gartenausstellung.
.
Die Teilnehmer an der Veranstaltung „Soziales Grün“ ließen kein gutes Haar an dem über 100 Millionen Euro teuren Event: Die verantwortlichen GmbHs und Grün Berlin entzögen dem Bezirk damit einen vorhandenen Park und Grünflächen, trennten Wohngebiete, vergraulten seltene Tierarten, der Rodelberg werde eingezäunt, zehn Hektar Wald gefällt, das Brutgebiet des Wachtelkönigs zerstört, Bagger machten Krötenzäune platt (wobei man anonymen Rowdys die Schuld gab und höhere Zäune errichtete), die Seilbahn vertreibe die Vögel auf ihrer Strecke, der Teich wurde erweitert, sodass die Frösche im aufgewühlten Schlammwasser verstummten und die Kaulquappen starben.
.
Das alles listete eine Sprecherin der Bürgerinitiative „Kienberg-Wuhletal“ in der Diskussion auf. Sie kritisierte ferner, dass die Naturschutzverbände sich mit Kritik zurückhielten: „Sie wollen sich anscheinend lieber auf der IGA präsentieren“, und auch die Linkspartei im Bezirk begrüße die IGA kritiklos. Andere Diskussionsteilnehmer vom Kreuzberger Prinzessinnen- und vom Tempelhofer Gemeinschaftsgarten Allmende-Kontor stimmten zu: „Die ist eine vertane Chance. Wir sehen dabei nichts Positives.“
.
Als wäre das nicht schon schlimm genug, befürchteten einige Hellersdorfer im Publikum auch noch, dass der Liegenschaftsfonds die Billigwohngegend um den U-Bahnhof Kienberg, nachdem sie durch die IGA-Maßnahmen „asozial aufgewertet“ wurde, an den Konzern Deutsches Wohnen verscherbelt, der dann Mietwohnungen baut, die sich niemand im Bezirk leisten kann. Ein Hotel sei bereits geplant.
.
Die Grün Berlin GmbH wolle demnächst eine Stiftung gründen, mit der sie noch rigoroser projektieren könne. Sie sagen zwar, dass die Zäune und Zaunwächter später wegkommen, aber daran glaube niemand. Also was tun?
.
Die Leiterin der kommunalen Galerie „M“ (Marzahn) plädierte für subtile Eingriffe in den öffentlichen Raum, in denen Soziales, Künstlerisches und Ökologisches zum Tragen komme. Für Marzahn-Hellersdorf hieße das: mehr Brachflächen zur vielfältigen Nutzung durch die Bürger, mehr „interkulturelle Gärten“ (wie sie von den Russen in Pankow und Marzahn geschaffen wurden), Mietergärten (wie sie zu DDR-Zeiten sogar bezuschusst wurden). Der Sprecher des Prinzessinnengartens ergänzte: „Mit Nutzpflanzen statt repräsentativem Grün übernehmen die Gärten soziale Aufgaben.“ Und das nicht nur in der Stadt: „Sie könnten Brücken sein nach Brandenburg, also in den ländlichen Raum zurückwirken, um dort die Alternativen zur industriellen Landwirtschaft zu stärken.“ Der Kohlrabi und die Möhren wären demnach Vehikel des Sozialen.
.
Fazit: Wir haben es mit nachgesellschaftlichen Projektwelten zu tun, die scharf gegeneinander stehen: die einen oben, die anderen unten. Letztere können immer nur kleine Räume temporär besetzen oder erhalten, während Erstere am längeren Kapitalhebel sitzen, was politisch eine Katastrophe sei.
.
P.S.: Auf der IGA tun einige die BI „Kienberg-Wuhletal“ als eine AfD-Initiative ab, mit der man nicht diskutieren könne, andere erklären zu den vielen Bäumen, die der IGA-Planung weichen mußten, das seien „invasive Arten“ gewesen.
.

Eine kleine Feier auf einer Parzelle der Kleingartenanlage „Am Kienberg“, die in die IGA integriert wurde. Dafür wurden an ihren Wegen viele Obstbäume gepflanzt. Und wir nehmen an, dass die Mitglieder oder ihr Vereinsvorstand sich vor Eröffnung der IGA auch noch mal extra angestrengt haben, damit ihre Kleingartenanlage jetzt besonders üppig dasteht. Auf einer der Parzellen mittendrin hat die IGA selbst mit lebenden Kaninchen in Ställen ein Modell-Schrebergartenhäuschen ausgestellt und eingerichtet.
.
Beruhigungsgesetze
Kann es sein, dass dieser ganze Öko-Hype bloß ein frommer Selbstbetrug ist? Singvögel und Fledermäuse sind ganzjährig geschützt. Im Artenschutz-Gesetz, § 44 heißt es: „Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“ Und im neuen Tierschutzgesetz heißt es unmißverständlich – in § 17: „Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 1. ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder 2. einem Wirbeltier aus Roheit erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt.“ Darüberhinaus wurde in der Koalitionsvereinbarung festgehalten, die „Berliner Strategie der biologischen Vielfalt“ umzusetzen.
.
Aber all das ist jedoch praktisch ohne Bedeutung, denn alljährlich werden allein in Berlin ab dem Frühjahr zigtausende von jungen Spatzen, Stare, Meisen, Mauersegler (und sogar besonders geschützte Fledermäuse) bei Renovierung/Modernisierung und (energetischer) Sanierung von Fassaden lebendig eingemauert. Dies geschieht derzeit massenhaft in Marzahn/Hellersdorf durch die Wohnungsbaugenossenschaft „Grüne Mitte“ und in der Otto-Suhr-Siedlung Kreuzberg durch die Immobilienspekulanten von „Deutsches Wohnen“. In der entsprechenden Verordnung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt heißt es zwar: „Fortpflanzungs- oder Ruhestätten dürfen nur unter der Voraussetzung unbrauchbar gemacht oder entfernt werden, dass diese unbesetzt sind und weder Alt- noch Jungtiere oder Gelege zu Schaden kommen,“ aber kein Schwein hält sich daran. Am wenigsten die Arbeiter der Baufirmen, die einfach ihren Bauschaum in die Nester sprühen. Und dann kommt so ein armes Starenweibchen mit Insekten für die Jungen, landet auf dem Bauschaumklumpen und kann nicht mehr zu ihnen, so dass sie dahinter fiepend verhungern.
.

.
Es gibt zwar einige mäßig engagierte und sowieso überforderte Gutachter, beim NABU und bei der Unteren Naturschutzbehörde, den die Baufirmen vorab einschalten sollen, damit sie die Nester markieren, aber sie übersehen die meisten, und die sie nicht übersehen und markieren, werden von den Bauarbeitern ignoriert. Außerdem wird in Berlin schier überall gebaut, und die paar Gutachter können nicht überall sein. Die Hauptstadtpresse titelte „Dramatischer Rückgang der Vogelarten“ – in ganz Deutschland. Überall wird renoviert, Fassaden energetisch abgedämmt – und so heißt es auch in einer Pressemitteilung des NABU aus Leipzig: „Drama hinter Bauschaum. Bei Gebäudesanierungen werden täglich Vogelnester zerstört. Das macht sich mehr und mehr bemerkbar, immer mehr Bürger vermissen das Stadtgrün, summende Insekten und singende Vögel – sie sind einfach nicht mehr da. Wenn die Fassade saniert und gedämmt wird, werden Einschlupfmöglichkeiten für die Tiere beseitigt. Eigentlich ist ein Ausgleich für den Verlust von Mauernischen, Ritzen und Höhlen leicht: In die Fassade können künstliche Nisthilfen problemlos integriert werden. Beim Vorhandensein geschützter Tierarten sind die Bauleute dazu sogar gesetzlich verpflichtet. Doch das wird vielfach ignoriert – oft sicherlich in Unkenntnis der Rechtslage, oft aber wohl auch mit Vorsatz und vor allem: Es wird viel zu wenig von der Naturschutzbehörde kontrolliert!“
.
In Berlin werden die Singvögel nicht nur in ihren Nestern an den Gebäuden vernichtet, sondern auch auf der Erde: Bevor ihre Brutsaison begann, ließen die Grünämter großzügig Hecken und Sträucher (z.B. in der Leipziger Strasse und am Gendarmenmarkt) runterschneiden und Rattengift auslegen. Ratten versteckten sich jedoch gar nicht darin, wohl aber Spatzen und Amseln – und diese fraßen dann auch das Rattengift. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Grünflächenamts Kreuzberg meinte zu der Heckenvernichtung: „Unser Amt wurde bis auf vier Mitarbeiter verkleinert. Die Arbeiten werden seitdem von Fremdfirmen erledigt – und die beschäftigen Billiglohnarbeitskräfte, die ihren Mißmut mit schwerem Gerät bekämpfen, also am Liebsten Motorsägen, Laubbläser und andere laute Gartengeräte bei ihren Aufträgen einsetzen.“ Ähnliches gilt für die Firma, deren Billiglohn-Arbeitskräfte das Rattengift in der Stadt verteilen.
.
.
Mieterterror
300 Linke schützten kürzlich den linksalternativen Kiezladen in der Neuköllner Friedelstr 54 die Nacht über vor einer Räumung, wurden dann aber morgens von 500 Polizisten aus dem Weg geräumt. Die Entleerung seines Hauses von Mietern hatte der neue Eigentümer, die luxemburgische Briefkastenfirma Pinehill, beantragt. Einem anderer Laden in der Reichenbergerstrasse, der „Flora-Bäckerei“ hatten die neuen Eigentümer, zwei englische Investoren, mit der Begründung gekündigt, er würde „nicht mehr in den Kiez passen“. Dann hatten sie sich aber zum Glück doch eines Besseren belehren lassen. Ständig finden Protestveranstaltungen gegen Entmietungen (Gentrifizierungen) statt. Ein zur Räumung von Wohnraum befohlener Polizist meinte, „ich halte doch meinen Kopf nicht hin, um Privateigentum zu schützen.“ Da irrte er sich jedoch: Der ganze demokratische Rechtsstaat und seine Millionen Büttel sind dazu da, das Privateigentum und seine Expansionspläne zu schützen. Zur Erinnerung: Der von Herodot so genannte „Demokratie-Begründer“ Kleisthenes bildete (im 6.Jhd. v.Chr.) die neue Verfassung dem früheren „Stammesmodell“ nach – und verbarg so die Tatsache, dass mit ihr die letzten Überreste der urtümlichen gesellschaftlichen Verhältnisse hinweggefegt worden waren, d.h. die Warenbesitzer traten sich nunmehr in der „Freiheit des offenen Marktes als Gleiche gegenüber.“ Diese allgemeine „Gleichheit vor dem Gesetz“ (isonomia) bezeichnete bereits Diodoros aus Agyrion im 1. Jhd.v.Chr. als eine Farce, da sie ohne „Gleichheit des Eigentums“ (isomoiria) durchgesetzt wurde. Und das gilt bis heute.
.
Wenn wir uns ferner erinnern, dass die Kommunisten das Ziel hatten, das Kapital zu enteignen, und die Nationalsozialisten dann nur noch vom verwerflichen „jüdischen Kapital“ sprachen, dann verwundert es nicht, das die heutigen Kapitalbesitzer, wenn sie in Deutschland kritisiert oder, Gott behüte, angegriffen werden, sich quasi automatisch als verfolgte Juden präsentieren. So z.B. der Vorständler der Wohnungsgenossenschaft „Grüne Mitte“ Andrej Eckhardt, der sich in einem offenen Brief an alle Mieter in Hellersdorf darüber beschwert, dass eine tierliebende Bürgerin und ein Mitarbeiter des dortigen Naturschutzamtes versuchen, wenigstens einige der Nester in den Fassaden zu schützen, bevor sie mit Dämmplatten überdeckt und die Jungvögel dahinter vernichtet werden. Über die zwei harm- und hilflosen Vogelschützer schreibt dieser unselige Immobilienmanager: Sie hätten „offensichtlich zum Ziel, einen generellen Baustopp zu bewirken…Man könnte schon fast von einer kleinen Hetzjagd sprechen.“ Und nicht genug damit: Weil es auch noch einen Mieter gibt, der von seinem Fenster aus den Bauarbeitern zurief, dass sie doch nicht einfach die Nester mit Bauschaum überdeckeln dürften (was die Arbeiter jedoch auf Weisung der Bauleitung dennoch taten), und er sich daraufhin an das Naturschutzamt wandte, schrieb dieser Manager an das Sozialamt und an den Sozialpsychiatrischen Dienst: „Wir haben Kenntnis von einer psychischen Erkrankung von Herrn Ulrich, die ihm offensichtlich immense Probleme während der Bauphase bereitet. Wir haben Angst, dass er diese Situation nicht allein bewältigen kann und er sich etwas antut. Auch haben wir den Eindruck, dass sein Krankheitsbild von Dritten missbraucht wird. Daher regen wir die Einrichtung einer Betreuung an.“ Im Klartext: Schafft diesen Querulanten in die Irrenanstalt!
.
Ähnlich ist die Situation in der Kreuzberger Otto-Suhr-Siedlung, nur dass der Eigentümer dort nicht ganz so blöd ist. Es handelt sich dabei um die berüchtigte „Deutsches Wohnen“, die nicht mehr nur auf die automatische Wertsteigerung ihrer Immobilien setzt, sondern sich für aufwändiges Renovieren entschieden hat, so dass es zu üppigen Mieterhöhungen kommt – und die alten und finanzschwachen Mieter vertrieben werden. Dagegen hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die sich mit Veranstaltungen und Flugblättern wehrt. Sie scheinen sich auf eine längere Auseinandersetzung eingestellt zu haben, denn auf einer öffentlichen Veranstaltung forderte sie kürzlich ein Büro.
.

.
Staatstragende Armleuchter
-Ist das schon eine „Hassrede“ oder der Anfang davon? Ende Juni verabschiedete der Bundestag ein „Netzwerkdurchsetzunggesetz“, das „Hassreden“ in Internetplattformen wie „Facebook“ und „Twitter“ verbietet. Das „NetzDG“ verspricht, das „verbale Faustrecht“ darin beenden zu wollen. Die Forenbetreiber sollen dazu Algorithmen entwickeln. Bisher haben sie nur lustlos „Wetware“ (Billiglohnarbeiter) als Zensoren eingestellt, aber diese fühlten sich bald überfordert – und bekamen Weinkrämpfe.
.
Algorithmen sind jedoch grundsätzlich nicht in der Lage, die meist kontextbezogenen Hasssubstanzen herauszufiltern. Das NetzDG soll auch nur die Plattformbetreiber drängen, sich diesbezüglich mehr anzustrengen – und z.B. dreischichtig zu zensieren, es wird nach den Wahlen wahrscheinlich wieder in der Versenkung verschwinden.
.
Wenn man noch einmal meinen vorangegangenen Text liest, dann merkt man hoffentlich, dass ich voller Hass auf den Vorständler der Wohnungsgenossenschaft „Grüne Mitte“Andrej Eckhardt war und bin, der dem Sozialamt und dem Sozialpsychiatrischen Dienst schriftlich riet, einen Mieter zu „betreuen“, der sich beschwert hatte, dass bei Verdämmen der Fassaden in Hellersdorf Nester mit Jungvögeln zerstört werden. Aber Eckardts höflicher Brief war in Wahrheit eine einzige Hassrede, die auch tatsächlich Wirkung zeigte, denn prompt meldeten sich zwei sozialpsychiatrisch tätige Amtspersonen bei dem aufmerksamen Mieter.
.
Der war jedoch selbstbewußt genug und nahm sich statt eines „Betreuers“, den sie ihm aufdrängen wollten, einen Anwalt und dieser klagte gegen Eckardts Wohnungsgenossenschaft auf „Verstoß gegen das Datenschutzgesetz“ sowie auch gegen das amtliche „Betreuungsverfahren“, mit dem man ihn entmündigen wollte. Das Amtsgericht Lichtenberg entschied dann, das Verfahren einzustellen, da der Mieter „kategorisch“ dagegen sei und „Zwangsmaßnahmen unverhältnismäßig“ wären. In der Zwischenzeit ging das Vogelsterben weiter, hinzu kamen noch Fledermäuse, deren Höhlen z.T. ebenfalls „energetisch verdämmt“ wurden. Und da soll man keinen Hass auf diesen Wohnungsbau-Manager kriegen? Zumal dann auch noch zu erfahren war – aus seiner Genossenschaftszeitschrift „Grüne Mitte Aktuell“: Dass auf der „Mitgliederversammlung die heitere Stimmung überwog, als Andrej Eckardt berichtete, dass man beim Baugeschehen [in Hellersdorf] voll im Zeitplan liege.“
.
Die FAZ kommentierte das Anti-Hassreden-Gesetz auf der Wirtschafts- und auf der Zeitgeschehen-Seite. Auf letzterer meinte man: „Die milliardenschweren Betreiber globaler Marktplätze“, also Facebook, Twitter usw., hätten bisher lax und puritanisch-amerikanisch nur „blanke Brüste“ entfernt, „volksverletztende Inhalte“ dagegen ignoriert (in den USA sind diese alltäglich, und in den Actionfilmen Hollywoods sogar äußerst populär). Weil sie also nichts dagegen taten, so der Kommentator mit hocherhobenem Staatsfinger, „habe die Bundesregierung gehandelt“.
.
Ähnlich beginnt der Artikel auf der Wirtschaftsseite, dem man den Titel „Im Freiheitsvakuum“ gab (gemeint ist ein „parlamentarisches“): „Der Bundestag hat den Weg für Regeln frei gemacht. Justizminister Maas brauchte irgendein Ergebnis.“ Anfangs war dieser „Weg“ zwar umstritten, es wurde gesagt, mit dem Gesetz würden bloß „Anreize für übermäßiges Löschen“ (von Inhalten) geschaffen, weil man „auch bei Facebook ungern Bußgelder bis zu 50 Millionen Euro zahlt,“ aber dann entschied man sich wieder mal für die Regel und gegen die Freiheit. Der Kommentator vertritt die „liberalen Werte“: Die Netzinhalte muß man dem „Selbstregulierungsmechanismen“ überlassen, die bestehenden Gesetze reichen für Verstöße. Im übrigen zeige sich bei dieser Gesetzesverabschiedung mal wieder, „dass die Abgeordneten die Komplexität des Äußerungsrechts noch immer unter- und die Macht der Technologie überschätzen.“ Die „künstliche Intelligenz wird noch lange am Äußerungsrecht scheitern.“ An der „Ironie“ z.B. würden selbst viele Menschen scheitern. Aber nicht nur das, auch für die sozialdemokratische Idee, ähnlich wie in China und Russland europäische „Internetplattformen“ zu gründen, erschwert es das NetzDG, realisiert zu werden. Der FAZ-Kommentator meint jedoch, unter „Fachpolitikern gelten Google und Co sowieso als uneinholbar.“ Macht aber nix, denn auch die amerikanischen „Plattformen werden mittelfristig hygienischer“. Er meint wahrscheinlich, durch die „Selbstheilungskräfte“ (des Marktes), es geht aber hier um Kontrollalgorithmen, vornehmlich bei Facebook. Übersehen wird dabei, dass Facebook inzwischen nur noch etwas für ältere Damen und Herren ist, die „Kids“ dichten und dissen bereits auf ganz anderen Plattformen. Kürzlich erschien ein Buch einer fachkundigen Amerikanerin mit dem schönen Titel: „Weapons of Math Destruction“.
.

.
Löwenzahn
Der Spandauer Schuldirektor Christian Sprengel kam 1790 der geschlechtlichen Vermehrung der Blumen durch Insekten auf die Spur. Sein Buch „Das entdeckte Geheimnis der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen“ (1793) wurde jedoch lange Zeit als „absurd“ und „obszön“ abgelehnt.
.
Sein prominentester Gegner war Goethe, der Sprengel vorwarf, die Natur zu vermenschlichen. Ähnliches galt für Hegel, als er 1830 in seiner Vorlesung „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse“ auch „Die vegetabilische Natur“ behandelte. Für ihn war es noch „eine berühmte Streitfrage in der Botanik, ob wirklich bei der Pflanze erstens Sexualunterschied, zweitens Befruchtung wie bei den Tieren vorhanden“ sei. Er entschied sich, von der Geschlechtslosigkeit der Pflanzen auszugehen, selbst bei den Zweigeschlechtlichen, „weil die Geschlechtsteile, außer ihrer Individualität, einen abgeschlossenen, besonderen Kreis bilden.“ Zudem sah er für die „Begattung“, d.h. Bestäubung der Blüten, keine Notwendigkeit, es ist etwas „Überflüssiges: Luxus“, denn die Pflanzen können sich z.B. auch durch Ableger, Sprossen etc. vermehren. „Die Verstäubung ist für sich selbst Zweck der Vegetation, – ein Moment des ganzen vegetativen Lebens, welches durch alle Teile geht.“ Mit anderen Worten: Da die Blüte selbst ein Moment des „Fürsichseins“ ist, kann die Pflanze als Ganzes „nie eigentlich zum Selbst kommen“. Nicht erst die Befruchtung ihrer Blüten, sondern ihr bloßer Wachstumsprozeß ist bereits „Produktion neuer Individuen“.
.
Erst Charles Darwin verschaffte der von Sprengel entdeckten Symbiose zwischen Blumen und Insekten Geltung: In einem seiner letzten Werke „Über die Einrichtung zur Befruchtung britischer und ausländischer Orchideen durch Insekten“ (1862) urteilte er über Sprengel: „Dieses Schriftstellers eigenthümliches Werk mit seinem eigenthümlichen Titel wird oft geringschätzig beurtheilt. Er war ohne Zweifel ein Enthusiast und hat wohl auch einige seiner Ideen zu einer ausserordentlichen Länge ausgesponnen. Doch habe ich mich mittelst meiner eigenen Beobachtungen überzeugt, dass es einen gewissen Schatz von Wahrheit enthält. Und schon vor Vielen sprach Robert Brown, vor dessen Urtheil sich alle Botaniker neigen, nur mit hoher Achtung davon und bemerkt, dass nur Diejenigen darüber lachen können, welche nicht viel von der Sache verstehen.“
.
Hegel begriff alle geschlechtliche Vermehrung der Blumen als „Luxus“. Für den Basler Biologen Adolf Portmann war ihre Nektar- bzw. Saftproduktion zum Anlocken der Insekten 1962 nur noch beim Löwenzahn ein „Luxus“, den er vor allem gegen die Darwinsche Evolutionstheorie ins Feld führte, insofern darin stets auf die Nützlichkeit abgehoben wird. Dem gegenüber gibt es jedoch laut Portmann immer wieder zwecklose, „unadressierte“ Entwicklungsphänomene. „Auch die Schönheit einer Blüte ist nicht hinreichend durch den Zweck der Anlockung von bestäubenden Insekten geklärt, wie innig und sinnvoll solche symbiontischen Beziehungen auch in manchen Fällen sein mögen,“ schreibt der Biologe Joachim Illies in seiner Biographie über Adolf Portmann, der als Beispiel den Löwenzahn erwähnt: „Die ganze goldgelbe Pracht der Blüte, so nützlich sie für die zahllosen Insekten ist, die von ihr angelockt den Pollen und Nektar entnehmen, ist für die Pflanze selbst nutzlos, denn ihre Samenanlagen entwickeln sich grundsätzlich jungfräulich, d.h. ohne Befruchtung allein aus dem Erbgut der Mutterpflanze.“ Wenn die Orchidee ihre Insekten „täuscht“, dann „täuscht“ der Löwenzahn sich quasi selbst.
.
Portmann schreibt 1955 (in: „Ein Naturforscher erzählt“): „Das ist eine seltsame Geschichte; bereits um 1903 herum haben die Botaniker das alles aufgedeckt. Es entspricht dem ausgerichteten Zweckdenken unserer Zeit, daß der Löwenzahn wohl als ein sinnreiches Beispiel der Bestäubung von Blüten durch Insekten auftritt, daß aber die großartige Unnötigkeit dieses Verfahrens in allen diesen Darstellungen kaum gewürdigt wird.“
.
Großartige Unnötigkeit! „Worin also liegt der Sinn dieses für die Pflanze selbst unnötigen Verfahrens?“ fragt sich sein Biograph Illies. „Allein in der ‚fremddienlichen Zweckmäßigkeit‘ für die Insekten? Solcher Altruismus wäre darwinistisch erst recht unbegreiflich, denn wo sollte sein Selektionsvorteil für die Pflanze liegen?“ Portmann war es dagegen immer wichtig, zu betonen, „daß sich in den Gestalten die Lebensformen selber darstellen, daß Selbstdarstellung wohl gar die oberste Leistung ist, der die anderen dienen müssen.“ In diesem Sinne deutete er auch die Blütengestalten: „Spricht sich bereits in den Blattformen das besondere der Art aus, so ist die Blüte als reichste Gestaltung erst recht ein Ausdruck dieser Selbstdarstellung.“
.
Die darwinistischen Biologen, die epidemieartig (über Seminararbeiten und Praktikumsaufgaben) neben unzähligen anderen auch den Wikipedia-Eintrag „Gewöhnlicher Löwenzahn“ verantworten, kennen natürlich keine wie auch immer geartete „Selbstdarstellung“ bei Tieren und Pflanzen: keine Kultur in der Natur. Immerhin nehmen sie zur Kenntnis, dass die jungfräuliche Entwicklung des Samens bei den Löwenzahnpflanzen „ungewöhnlich“ ist, insofern sie, „obwohl sie keine Bestäuber benötigen, dennoch Nektar produzieren.“ Aber die Wikipedia-Darwinisten fanden einen Dreh, auch dieses seltsame Phänomen evolutionistisch sich zu erklären, indem sie das scheinbar altruistische, insektenfreundliche Verhalten des Löwenzahns dahingehend deuteten, dass diese Pflanzen „erst vor so kurzer Zeit entstanden sind, so dass ihre Energie verschwendende Nektarproduktion im Laufe der Evolution noch nicht eingestellt werden konnte.“ Aber wenn man gleichzeitig davon ausgeht, dass die Blumen-Insekten-Symbiose die „höchstentwickelte“ Form der Pflanzenvermehrung ist, dann sollte man doch eher davon ausgehen, dass sie dabei sind, ihre Selbstbefruchtung langsam aufzugeben. Vielleicht lockt der Löwenzahn die Insekten auch aus ganz anderen Gründen mit seinem Nektar an.
.
Der Löwenzahn gilt als „Unkraut“, weil er dazu tendiert, ganze Wiesen mit seinen gelben Blüten und den „Pusteblumen“ zu überziehen. Sein Nektar ist jedoch für die Nutzinsekten (Honigbienen und Hummeln) ein Segen. Und aus den jungen Blättern kann man Gänsefutter und „Löwenzahn-Salat“ zubereiten, für den Menschen noch „nützlicher“ ist indes sein Wurzelsaft. Aus der milchigen Flüssigkeit des russischen Löwenzahns „kok-saghyz“ gewannen die sowjetischen Botaniker einen Kautschuk-Ersatz, um das devisenschwache Land von Importen unabhängig zu machen. Bereits 1941 bestand ein Drittel der sowjetischen Gummiproduktion aus Löwenzahnsaft. In Deutschland stellte man, ebenfalls aus „Autarkiebestrebungen“ heraus, den Kautschuk synthetisch her – in den BUNA-Werken: zuerst bei Schkopau und zuletzt auch noch in Auschwitz. Es ging dabei um Reifen für Wehrmachts-Fahrzeuge („Räder müssen rollen für den Sieg!“), aber die produzierten Mengen waren zu klein. Die Endfertigung geschah u.a. im Werks-KZ Stöcken der Reifenfirma „Continental“. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion bemächtigten sich deutsche „Sammelkommandos“ unter der Führung von uniformierten Botanikern der sowjetischen „kok-saghyz“-Forschungsinstitute und -felder und Himmler ernannte sich zum „Sonderbeauftragten für Pflanzenkautschuk“. Im Pflanzenzüchtungsinstitut der SS in Auschwitz wurde damit unter der Leitung des Müncheberger Züchtungsforschers Wilhelm Rudorf weiter experimentiert, um den Kautschukanteil im Milchsaft des Löwenzahns, der einen Milliliter pro Pflanze betrug, zu erhöhen. Aber erst 2014 stellte die Hannoveraner Firma „Continental“ auf der Automesse IAA erstmals einen Reifen aus „Löwenzahn-Kautschuk“ vor, damit wolle der Gummikonzern sich vom schwankenden Weltmarkt für Naturkautschuk unabhängig machen, meldete „finanzen 100“. Wird man den Löwenzahn bald feldmarschmäßig angebauen? In Notzeiten wurden Löwenzahnwurzeln geröstet und zermahlen als Kaffee-Ersatz genutzt. Heute kann man „Kaffee aus Löwenzahnwurzeln“ kaufen – für 20 Euro das Kilo.
.
In dem kleinen Buch über „Botanische Wunder“ (2012) des Potsdamer Biologen Ewald Weber fand ich noch den Hinweis, dass die Früchte mit den Löwenzahn-Samen sich an einer Art Fallschirm so weit wie möglich vom Wind wegtragen lassen (und wir tatsächlich daraus das Bauprinzip für Fallschirme entnommen haben). Das Schönste aber ist, dass die Pflanze während des Reifens der Früchte noch einmal ihren Stängel verlängert, so dass die Pusteblume zuletzt die meisten der um sie herum wachsenden Pflanzen, wie ich im Tierpark sah, überragte – und der Wind da gut rankam.
.

.
Löwenmaul
Das Garten-Löwenmaul ist eine Modellpflanze zur Erforschung der Blütenentwicklung. Den mit ihr im 20. Jahrhundert experimentierenden Botanikern im Kaiser-Wilhelm-Institut für Kulturpflanzenzüchtung in Müncheberg erschloß das Löwenmäulchen die Idee der „Rassenhygiene“, der „Eugenik“ und des „Nationalsozialismus“, indem sie als Genetik-Pioniere ihre biologischen Erkenntnisse auf die Gesellschaft übertrugen, die sich nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg daran machte, sich selbst biologisch „neu zu erfinden“. In Müncheberg trieb dies der Gründer des Instituts, Erwin Baur, voran, danach forschte sein Schüler Hans Stubbe am Löwenmaul weiter. Nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg rettete er seine genetische Forschung gegen die sowjetische „proletarische Biologie“ in die DDR rüber, und brachte es schlußendlich mit seinem „Institut für Kulturpflanzenforschung“ in Gatersleben zum obersten DDR-Biologen. Indem Stubbe keimfähige Pollenkörper des Löwenmauls mit Röntgenstrahlen beschoß, wollte er künstlich Mutationen erzeugen, wobei er davon ausging, dass dessen erheblich von den normalen abweichenden „pelorischen Blüten“, die bereits sein Doktorvater Baur beforschte, durch Genmutation entstehen. 1934 berichtete er in der Zeitschrift „Die Naturwissenschaften“ über „Entwicklung und Stand der Mutationsforschung in der Gattung Antirrhinum majus“ – Garten-Löwenmaul.
.
Eine Kollegin von Stubbe in Müncheberg, die Genetikerin Gerta von Ubisch, kam wenig später als Jüdin im Exil zu der Einsicht: „Leider ist nicht zu leugnen, dass die große Popularisierung der Genetik durch Baur mit zu dem katastrophalen Mißbrauch beigetragen hat, den der Nationalsozialismus mit der Rassenfrage getrieben hat.“
.
Das Löwenmaul gilt inzwischen ironischerweise als ein Paradebeispiel für Mutationsbildungen, die – ebenso wie der Nationalsozialismus – gerade nicht genetisch entstehen. Schon Linné, der „Ordnung in die Natur“ bringen wollte, kannte eine mit den Löwenmäulern verwandte Pflanze, das Leinkraut, bei der ebenso „scheinbar aus dem Nichts abweichende Blütengestalten auftauchten,“ wie der Biologe Bernhard Kegel in seinem Buch „Epigenetik“ (2009) schreibt. Linné nannte die Abweichler „Peloria“ (Monster auf griechisch), die ihm nicht weniger phantastisch dünkte, „wie wenn eine Kuh ein Kalb mit Wolfskopf zur Welt brächte“.
.
Der einflußreiche Naturforscher Ernst Mayr war beeindruckt (wie er 1984 in: „Die Entwicklung der biologischen Gedankenwelt“ schrieb), „dass Linné bereits das Auftreten einer auffälligen Mutation (wie Peloria) kannte, die in den nachfolgenden Generationen unverändert bleibt und doch mit der Eltern-‚Art‚ kreuzbar ist. Botaniker und Gärtner fanden später viele Fälle, die Linnés Peloria ähnelten, indem plötzlich ein stark abweichender Typus auftrat. Linné kam dahin, daß ‚diese neue Pflanze sich mit ihrem eigenen Samen fortpflanzt und daher eine neue Art ist, die es zu Anbeginn der Welt nicht gab‚. Mehr noch: Nach Linnes Klassifikations-Methode war Peloria nicht bloß eine neue Art oder Gattung, sondern eine völlig verschiedene Blumen-Klasse. Dies erschütterte nicht nur seine Auffassung von der Konstanz der Arten, es schien auch seine Axiome der Klassifikation zu widerlegen.“ Das „Monster“ ließ ihn an seinem christlichen Glauben zweifeln.
.
Darwin, den dann vor allem das qualvolle Töten von Raupen durch Schlupfwespen an Gott verzweifeln ließ, begeisterte dagegen das Peloria-Problem. In „Die Variation von Tieren und Pflanzen unter Domestikation“ (1868) schrieb er: „Pelorische Rassen wie Löwenmaul können über Samen vermehrt werden, und sie unterscheiden sich auf eine wundervolle Weise von der typischen Form in Struktur und Erscheinung.“ Es ging ihm dabei um die „Vermehrungsweise“: „Es sind nicht die reproduktiven Elemente, auch nicht die Knospen, welche neue Organismen erzeugen, sondern die Zellen selbst durch den ganzen Körper. Diese Annahmen bilden die provisorische Hypothese, welche ich Pangenesis genannt habe…Bei Variationen, welche durch die directe Einwirkung veränderter Lebensbedingungen verursacht werden, … werden die Gewebe des Körpers nach der Theorie der Pangenesis direct durch die neuen Bedingungen afficiert und geben demzufolge modificirte Nachkommen aus, welche mit ihren neuerdings erlangten Eigenthümlichkeiten den Nachkommen überliefert werden.“
.
Dies Zitat zeigt laut Wikipedia, dass Darwin weit lamarckistischer im Sinne einer Vererbung erworbener Eigenschaften gedacht hat, als ihm das heutzutage zugestanden wird. Konkret äußerte er über das Peloria-Phänomen: „Wir müssen davon ausgehen, dass viele Ausdrucksformen, fähig zu evoluieren, in den Organismen verborgen sind. Wir wissen zum Beispiel, dass Pflanzen aus vielen Ordnungen gelegentlich pelorieren.“
.
Laut Kegel wurde aus Peloria, dem erstaunlichen Einzelfall, mit der Zeit ein ganzer Pelorismus: „Immer mehr Pflanzen wurden entdeckt, mit denen Ähnliches geschah.“ Bei ihrer Erforschung näherte man sich ungewollt der Vermutung, dass sich auch (Umwelt-) Erfahrungen vererben, was in der Mutations-Selektions-Lehre als unmöglich galt. Ironischerweise sind es die Genetiker, die sich nun für diese Vererbungsweise erwärmen (müssen). Bis dahin war sie stets nur von Vertretern der Geistes- und Sozialwissenschaften gegen die darwinistischen Genforscher und Biochemiker ins Feld geführt worden. Um sich nicht ganz von ihrer Sichtweise und ihrem Vokabular zu verabschieden, sprechen die Genetiker nun von „Epigenetik“, was bedeutet, dass sie zwar „das (komplizierte) Leben“ quasi akzeptieren, aber trotzdem weiterhin „lebendige Systeme“ und die „Algorithmen des Lebendigen“ erforschen, bei den Pelorien sprechen sie einstweilen auch noch von „Paramutationen“.
.
Im Vorwort seines Buches „Epigenetik“ fragt sich Kegel: „Erleben wir tatsächlich die Wiedergeburt der Lamarckschen Idee von der Vererbung erworbener Eigenschaften?“ Er erinnert daran, dass der Begriff des „Gen“ 2009 hundert Jahre alt wurde, und dass man ihn gebührend hätte feiern sollen, „denn ob dieser Begriff seinen nächsten runden Geburtstag noch erleben wird, ist fraglich“: Das „genzentrische Weltbild“ war allzu simpel. „Selbst Craig Venter, vor wenigen Jahren mit seinen Sequenzierrobotern an vorderster Front der biomedizinischen Forschung, muss heute eingestehen: ‚Im Rückblick waren unsere damaligen Annahmen über die Funktionsweise des Genoms dermaßen naiv, dass es fast peinlich ist‘. ‚Wir müssen blind gewesen sein‘, seufzte der Entwicklungsgenetiker Timothy Bestor von der New Yorker Columbia University gegenüber ‚Scientific American‚ angesichts eines ganzen ‚Universums‘ ungeahnter und unerwarteter Phänomene. Über Vererbung und Evolution muss neu und intensiv nachgedacht werden.“
.
Aber die „Epigenetik“ in den Analysegeräten und Rechnern der etwas ratlosen Genetiker, das ist noch kein „Lamarckismus“ – keine „Milieu-Biologie“: „In diesem Wort ‚Umgebung‘ drängt sich“ laut Heidegger 1946 „alles Rätselhafte des Lebe-Wesens zusammen“. Der sowjetische Dichter Ossip Mandelstam, der sein Schach vom Literarischen auf das Biologische setzte, damit das Spiel ehrlicher werde, schrieb 1930 über eine Fahrt nach Armenien: „Ich weiß nicht, wie es andern ergeht, aber für mich vergrößert sich der Zauber einer Frau, wenn sie eine junge Reisende ist, die in wissenschaftlicher Mission fünf Tage lang im Zug nach Taschkent auf einer harten Bank hat liegen können, die sich gut im Latein Linnés zurechtfindet, die im Streit zwischen Lamarckisten und Epigenetikern weiß, wo sie steht, und etwas übrig hat für Löwenmäuler, Baumwolle oder leichte Melancholie.“
.

.
Orchideen
Manche Blume, so schrieb Theodor Lessing, könnte man „als ein festgebanntes Insekt“ bezeichnen – und andersherum „viele Insekten, zumal die Bienen und Schmetterlinge, als frei bewegliche Blumen“. Die meisten Orchideen, von denen weltweit etwa 25.000 Arten bekannt sind, sehen wirklich wie „festgebannte Insekten“ aus – und wer weiß, vielleicht wird man sie irgendwann auch als solche neu bestimmen. Ganz sicher weiß man jetzt schon, dass diese „Königin der Blumen“ die komplizierteste Existenzform unter den „bedecktsamigen Blütenpflanzen“ entwickelt hat, obwohl oder weil sie angeblich in evolutionärer Hinsicht die jüngste „Familie“ bildet. Fangen wir unten an – im Boden oder (epiphytisch siedelnd) auf Bäumen: Dort braucht sie einen Pilz, damit der Keim überhaupt aufgeht. Man kann die Nährstoffe, die ihm der Symbiosepilz zuführt, künstlich herstellen, das machen die Orchideenzüchter auch, weswegen es bereits über 100.000 Neuzüchtungen (Hybride) gibt, sie werden bei der „Royal Horticultural Society“ registriert und dort gelegentlich auch in ihrem botanischen Namen als besonders ausgezeichnet – „geadelt“. Es gibt aber auch heute noch tropische Orchideen, wild lebend, für die reiche Liebhaber mehr zahlen, „als heute ein Luxusauto kostet“ wie es im Ratgeber „Orchideen“ des Züchters Jörn Pinske heißt. Dabei geht es „nur“ um ihre seltsame Schönheit und manchmal auch um ihren Duft. Einige Arten enthalten daneben noch „psychoaktive Inhaltsstoffe“, aber ansonsten ist sie keine „Nutzpflanze“.
.
Die Mehrzahl der Orchideen-Liebhaber sind Männer. Der Pflanzenname leitet sich vom griechischen Wort „orchis“ her, was „Hoden“ heißt. Damit waren anfänglich die Knollen verschiedener Erdorchideen gemeint. Wegen dieser Speicherknollen, die bei Wildschweinen begehrt sind, gehört das „Männliche Knabenkraut“ zu einer besonders gefährdeten Art. Orchideen sind zweigeschlechtlich. In der Blüte hat sie (männliche) Staubblätter und eine (weibliche) Narbe, die zu einem „Säulchen“ (Gynosterium) verwachsen sind. Die Pflanze bestäubt sich nicht selbst damit, sondern braucht ein Insekt, dass ihren Pollen zu einer anderen bringt und ihr gleichzeitig fremden Pollen an die Narbe trägt.
.
„Daß Hummeln, Bienen, Tagfalter, also Insekten, irgendetwas mit den Blumen haben, wußte man schon seit der Antike. Auch daß sie sich irgendwie von ihnen ernähren. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts wußte man auch, daß Blumen ein Geschlecht haben. Linné baute sein ganzes System der Pflanzen darauf auf,“ schreibt der Kulturwissenschaftler Peter Berz. Aber im Sommer 1787 entdeckt der Direktor der Spandauer Realschule Christian Konrad Sprengel auf einer Blumenwiese zwischen dem Wunder ihres Aussehens und den um sie herumschwirrenden Insekten eine völlig neue Beziehung.“
.
Sprengel findet, daß jedes kleinste Detail jeder Blume es nur auf Das Eine abgesehen hat: Insekten anzulocken, sie hinzuführen, hinzuweisen auf die in ihr verborgenen Schätze – Saft oder Nektar – also den „in der Luft herumschwärmenden Insekten als Saftbehältnisse schon von weitem ins Auge zu fallen“. Und „indem die (so angelockten) Insekten in den Blumen ihrer Nahrung nachgehen“ tun sie etwas ganz anderes: „Zugleich,“ schreibt Sprengel, „ohne es wollen und zu wissen“ befruchten sie die Blumen. Es wird dabei getäuscht und getrickst: viele der spektakulärsten Orchideen haben gar keinen Nektar. Sprengel: „Ich muß gestehen, daß diese Entdeckung mir keineswegs angenehm war.“ Denn: stimmt dann noch die Grundthese?
.
Die Blüten der Sexualtäusch-Orchidee „Ophrys insectifera“ (Fliegen-Ragwurz, die u.a. in der Rhön wächst) haben nicht nur die Form und Farben einer potentiellen Partnerin für Grabwespen-Männchen angenommen, sondern auch noch den weiblichen Sexuallockstoff. Bei seinen Kopulationsversuchen bekommt das Männchen zwei Pollenpakete auf die Stirn geklebt. „Dolchwespen fallen gerne auf Blüten der mediterranen Orchidee Ophrys speculum (Spiegel-Ragwurz) herein. Teilweise geht die Täuschung so weit, dass Bienenmännchen der Gattung Andrena die entsprechenden Ophrys-Blüten sogar einem Weibchen vorziehen. Verhaltensforscher nennen das eine überoptimale Atrappe,“ schreibt die Biologin des Berliner Botanischen Gartens Birgit Nordt.
.
Peter Berz fragte sich darob: „Duft als Belohnung. Wie geht das? Nur als Droge, Rausch. Fast zu schön, um wahr zu sein. Die unmittelbare Reaktion der männlichen Bienen auf die Flüssigkeit kann man nur als Rausch bezeichnen. Sie verlieren in erheblichem Maße die Kontrolle über ihre Bewegungen und werden unbeholfen und träge und unaufmerksam. Offenbar genießen sie ihre Empfindungen, denn sie kommen über lange Zeit immer wieder zurück.“
.
Einige südamerikanische Orchideen, die mit „Prachtbienen“ kooperieren, bieten den Prachtbienenmännchen sogar einen Duft an, der nicht ihnen direkt gilt. Die Bienen nehmen ihn laut dem Biologen Karl Weiß „in ansehnlichen Flakons an den Hinterbeinen“ auf und fliegen damit zu ihren „Balzplätzen“, wo sie „Präsentationsflüge“ unternehmen. „Dabei soll ihr farbenprächtiger Panzer zusammen mit dem betörenden Pflanzenduft die Weibchen anlocken.“
.
Besonders raffiniert ist die Duftproduktion bei der Germerblättrigen Stenderwurz, die im Jenaer Max-Planck-Institut für chemische Ökologie erforscht wurde: Um Schwebfliegen zur Bestäubung anzulocken, verströmt diese Orchidee einen Botenstoff, mit dem sich Blattläuse alarmieren, er lockt aber auch Schwebfliegenweibchen an, die ihre Eier bei Blattläusen ablegen, weil sich ihre Larven dann von ihnen ernähren. In der Orchideenblüte täuschen darüberhinaus „warzenartige Gebilde“ die Anwesenheit von Blattläusen vor. Es gibt dort aber gar keine, so dass die Larven der Schwebfliegen keine Nahrung finden und sterben. Der Biologe Johannes Stökl erwähnt zwei weitere Orchideenarten, die „stechende Insekten“ durch Vortäuschen von Schmetterlingsraupen in ihren Blüten zu deren Befruchtung verlocken.
.
Botaniker der Universität Wien erforschten auf Madagaskar Orchideenarten, die einen Geruch von faulem Fleisch verbreiten – um damit Aasfliegen anzulocken. Ihre Samen sind winzig klein und breiten sich wie eine Staubwolke aus, in jedem steckt ein Embryo. Es gibt daneben Orchideenarten, die bis zu zwölf Embryos in ein Samenkorn packen.
.
Über eine weitere auf Madagaskar vorkommende Art, die einen 30 Zentimeter langen Dorn in ihrer Blüte ausgebildet hat, an dessen Ende sich Nektar befindet, hat Darwin gemeint, man werde dort bestimmt auch einen Schmetterling finden, der einen genauso langen Saugrüssel hat. 1903 entdeckte man ihn tatsächlich.
.
Die Biogeochemiker der Universität Bayreuth haben bei einer Reihe südafrikanischer Orchideen herausgefunden: Wenn unterschiedliche Arten in enger Nachbarschaft leben und von den selben Insekten (Wespen z.B.) bestäubt werden, „platzieren sie ihre Pollen an unterschiedliche Stellen – z.B. auf verschiedenen Abschnitten ihrer Vorderbeine.“
.
Die Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari gehen von einer wechselseitigen Beeinflussung aus, die eine Angleichung von Pflanze und Tier hervorgebracht hat. Ein solcher Vorgang – „Werden“ von ihnen genannt – gehört „immer einer anderen Ordnung als der der Abstammung an. Werden kommt durch Bündnisse zustande. Es besteht gewiß nicht darin, etwas nachzuahmen oder sich mit etwas zu identifizieren; es ist auch kein Regredieren-Progredieren mehr; es bedeutet nicht mehr, zu korrespondieren oder korrespondierende Beziehungen herzustellen; und es bedeutet auch nicht mehr, zu produzieren, eine Abstammung zu produzieren oder durch Abstammung zu produzieren…Das Werden ist eine Vermehrung, die durch Ansteckung geschieht.“ Affizieren und Affiziert-werden. „Werdet wie die Orchidee und die Wespe!“ raten sie.
.
Nach Meinung einiger Orchideenforscher ist bei diesem Angleichungsprozeß die Pflanze die treibende Kraft. Sie wollen festgestellt haben, dass eine Orchidee, die außerhalb des Vorkommens „ihrer“ Insekten „Fuß gefaßt“ hat, sich in Form und Farbe an eine neue Insektenart angleicht.
.
Im übrigen kennen die Orchideen auch eine vegetative Fortpflanzung (durch Ableger z.B.), weswegen G. W. F. Hegel in seiner Vorlesung „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse“ (1830) die geschlechtliche Fortpflanzung für einen reinen „Luxus“ hielt. Sie wird dafür mit umso mehr Liebe betrieben. Wenn z.B. die mikroskopischen Samen einer asiatischen Orchideenart durch den Wind an eine Baumrinde geweht wurden, entrollen sie „spiralige Ankerfäden“, um sich festzuklammern und in Kontakt mit einem Symbiosepilz zu kommen. Ist keiner da, muß der Keim sterben, schreiben die Mitarbeiter des Berliner Botanischen Museums in ihrem Band über „die skurrile Welt der Orchideensamen“.
.
Als ich unlängst im Orchideengewächshaus des Kassler „Bergparks Wilhelmhöhe“ war, konnte ich es nicht fassen: Es werden dort fast nur Orchideen gehalten, die der menschlichen Vagina in Form und oft auch in Farbe glichen. Ich erfuhr dort: Die Schamlippe heißt bei den Orchideen ebenfalls „Lippe“ (Labellum), es ist ein zur Lippe geformtes Blütenblatt, das den Insekten eine Landefläche bietet, und die Klitoris ist bei den Orchideen das vorstehende „Säulchen“. Hinzu kommt bei manchen Orchideenarten ein Sexualtäuschduft, der auch auf Menschen, mindestens Männer, wirkt, die Orchidee „Vanille“ kommt dem bereits nahe. Einige Orchideenblüten ähneln der Vagina auch deswegen, weil sie „Haare“ drumherum haben. Kurzum: „Die Sexualorgane der Orchideen sind einzigartig,“ wie die überwiegend männlichen Autoren der „Kosmos-Enzyklopädie Orchideen“ schwärmen. „Wir könnten eine Geistesgeschichte der letzten Jahrhunderte schreiben, indem wir eine Orchideenblüte schildern,“ meinte schon der Basler Biologe Adolf Portmann in seinem Radiovortrag „Insekten und Blumen“ (1942). Gleiches ließe sich auch wohl über die menschliche Vagina (vulgo: Vulva) sagen.
.

Noch eine Orchidee – nachgestellt von der Künstlerin Christiane Seiffert.
.

.
Misanthropozän
In einer so schönen Umwelt, wie in Kalifornien, scheinen die Menschen besonders um sie besorgt zu sein. Die kalifornischen Künstler machen fast mehrheitlich „Ecoart“ (Ökokunst), die letzte „documenta“ zeugte davon. Bereits in den Achtzigerjahren waren kalifornische Künstler nach Westberlin gekommen, denen es um nichts Geringeres ging, als die Spree zu renaturieren. Jetzt, 30 Jahre später, kann das Brandenburger Landesumweltamt verkünden, dass in der Spree zwischen Wannsee und Spreewald wieder Flußkrebse leben; vor allem rund 30 Millionen Flußmuscheln, deren Filtriertätigkeit wir „die gute Wasserqualität der Spree zu verdanken“ hätten.
.
Die kalifornischen Schriftsteller, Geisteswissenschaftler und Ökologen arbeiten sich am „Nature Writing“ ab, am Schreiben über die Natur: Ein mit der Romantik entstandenes Genre, das derart forciert wurde, dass der Ökophilosoph Timothy Morton schließlich eine „Ökologie ohne Natur“ entwarf. Sie wurde 2016 auf Deutsch veröffentlicht – vom Verlag Matthes & Seitz, der in den letzten Jahren vor allem mit seiner großen Reihe „Naturkunden“ Aufmerksamkeit bekam, die von der Greifswalder Buchmacherin Judith Schalansky betreut wird. Dort erschien im selben Jahr auch das berühmte Buch des „Nature Writers“ Edward Abbey: „Die Einsamkeit der Wüste“ sowie einige Bücher des Klassikers Henry David Thoreau – mit dessen „Leben in den Wäldern“ (Walden) das „Nature Writing“ ab Mitte des 19. Jahrhunderts Amerikanisch wurde. Hier und heute stiftet der Verlag Matthes & Seitz einen „Nature Writing“-Preis und dort berufen sich vom „UNA-Bomber“ bis zu den US-Ökoaktivisten und -terroristen (der „Earth First“ u.a.), auf diese bioanarchistischen „Pioniere“. (*)
.
Timothy Morton hält diese Form der „Ökomimese“ jedoch für nicht ausreichend – in literarischer Hinsicht. Er beruft sich dabei auf Hegel, Heidegger, Lacan, Adorno, Derrida, Donna Haraway, Roland Barthes, Michel Foucault, Brian Eno, Bruno Latour, Wiktor Schklowsky und Slavoj Zizek – um nur die Wenigsten zu nennen. Alles Ökokritiker von Rang, so to speak, mit denen Morton „Eine neue Sicht der Umwelt“ entwirft, nach der wir den Natur-Begriff getrost fallen lassen können, denn er enthält tatsächlich zu viel und zu wenig (ebenso wie das Zentralorgan der Darwinisten: „Nature“). Mit den Worten von Donna Haraway: „Es gibt weder Natur noch Kultur, aber viel Verkehr zwischen den beiden.“ Die kalifornische Biopoetin betrachtet sich als „Follower“ (Mitforscherin) des Wissenssoziologen Bruno Latour und seiner „Akteur-Netzwerk-Theorie“. Für Latour gibt es keine ökonomische Utopie mehr, nur noch eine ökologische. Nicht trotz, sondern wegen Bienensterben und Artensterben, radioaktiver Verseuchung und Überfischung der Meere, Humusverlust und Verwüstung der Erde.
.
Mit postsowjetischem Schwung und kalifornischer Sachlichkeit setzte im „Critical Theory Institute“ (!) der Westküste das „close reading“ des „Nature Writing“ ein; 1991 veröffentlichte der marxistische Professor für vergleichende Literaturwissenschaft, Frederic Jameson, das bisher noch nicht insDeutsche übersetzte Buch „Seeds of Time“, das den theoretischen Rahmen der Kritik absteckte. Seine Gewährsleute sind Althusser, Adorno, Marcuse und Georg Lukacs. Jameson fand etliche „Schüler“. Der Verlag Matthes & Seitz veröffentlichte in diesem Jahr aber erst einmal einen frischen Ökoklopper: „Molekulares Rot“ von McKenzie Wark. Der australische Kulturwissenschaftler war Parteiarbeiter in der KP gewesen. Bereits in den Siebzigerjahren besaß die KP-nahe Bauarbeitergewerkschaft (BLF) ein „Umweltzentrum“, von dort gelang es ihnen, all jene Baustellen mit einem „grünen Bann“ zu belegen, „die als für die Umwelt schädlich eingestuft wurden.“ Wark beschäftigte sich lange mit der „Situationistischen Internationale“, er lehrt heute an der New Yorker „New School (for Social Research)“.
.
In „Molekulares Rot“ führt er mindestens die selbe Ökotheoretiker-Bandbreite wie Morton ins Feld, dazu noch Marx und vor allem die Sowjetschriftsteller Alexander Bogdanow und Andrej Platonow. Das „close reading“ ihrer Werke macht die Hälfte seines Buches aus. Die andere geht für die Feministin Donna Haraway und den Science-Fiction-Autor Kim Stanley Robinson (der bei Frederic Jameson studierte) drauf. Wark kann sich laut seiner Zitate auf gleich Dutzende von akademischen Arbeiten im englischsprachigen Großraum berufen, die sich nach 1991 mit einzelnen Aspekten, Literaturen und Zeitabschnitten der Sowjetunion befassten. Sein durchgehender Begriff – „Tektologie“ – stammt von Bogdanow, der damit ein System meinte, das Soziales, Biologisches und Physikalisches zusammenführt. Morton sagt es so: „In einer wahrhaft ökologischen Welt wird der Begriff der Natur sich in Rauch auflösen.“ Während Wark über den Istzustand urteilt: „Es handelt sich um eine denaturierte Natur ohne Ökologie.“
.
Anmerkung:
(*) Hier noch mal – etwas genauer: Der amerikanische Rabenforscher Bernd Heinrich ist an „Nature Narratives“, Naturerzählungen, geschult – praktisch und literarisch. Zu den besten „Nature Narratives in American Literature“ gehört das 1968 von Edward Abbey veröffentlichte Buch „Desert Solitaire“ („Die Einsamkeit der Wüste 2016). Es war Abbeys erstes Non-Fiction-Buch und handelte von seinem einjährigen Aufenthalt in den Canyons von Utah 1956-57. Der Schriftsteller und Anarchist arbeitete in verschiedenen Nationalparks, sein Roman über die militante „Universalschlüsselbande“, die diverse Sabotageakte verübt, trug zur Gründung der Umweltschutz-Organisation „Earth First“ bei, deren Aktivisten immer mal wieder des „Öko-Terrorismus“ verdächtigt werden. Ihr Ableger, die „Earth Liberation Front“ (ELF) wurde vom FBI als „einheimische Terroristengruppe Nummer 1“ bezeichnet.
Edward Abbey war zunächst Henry David Thoreau theoretisch wie praktisch in die Waldeinsamkeit gefolgt. Dieser hatte dort in einer selbstgebauten kleinen Hütte gut zwei Jahre verbracht und darüber 1854 seinen „Klassiker aller Alternativen“: „Walden oder das Leben in den Wäldern“ (von Maine) veröffentlicht. Er beschrieb darin laut Wikipedia „sein einfaches Leben am See und dessen Natur, aber er integrierte auch Themen wie Wirtschaft und Gesellschaft.“ Zentral war für Thoreau der Begriff „Reliance“ (Autarkie, Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten). Beeinflußt hat ihn in dieser Hinsicht der Dichter Ralph Waldo Emerson, der 1841 einen Essay mit dem Titel „Self-Reliance“ veröffentlicht hatte – über „the nature of the aboriginal self“. Seine „Self-Reliance“ läßt sich mit Selbständigkeit oder Autonomie übersetzen, die ebenso politisch gemeint ist.
In diesem Horizont denkt auch Edward Abbey, wenn er z.B. schreibt: „Wachstum um des Wachstums willen ist die Ideologie der Krebszelle.“ Einer seiner unmittelbaren Vorläufer war der Forstwissenschaftler, Wildbiologe, Jäger und Ökologe Aldo Leopold, dessen 1949 veröffentlichter Bericht über sein Renaturierungsprojekt am Wisconsin River „Sand County Almanac“ ebenfalls zu den „Landmarks of the Conservation Movement“ zählt.
Auf ihn sowie auf Abbey und Thoreau beruft sich Bernd Heinrich in seinem 1994 veröffentlichten Bericht „Ein Jahr in den Wäldern von Maine“. Auch der Zoologe lebte zurückgezogen in einer selbstgebauten Hütte. Der Universitätsprofessor, Langstreckenläufer und Jäger Bernd Heinrich ist aktives Mitglied der „Wilderness Society“, die sich seit 1935 auf jenes Viertel der US-Landfläche konzentriert, das allen Amerikanern gehört, d.h. auf Nationalparks, Bundesforsten, Wildreservate und die Regionen, die das U.S. Bureau of Land Management verwaltet.
Zu Heinrichs Studenten, die ihm ein paar Wochen bei seiner Rabenforschung im Wald halfen, zählte auch einmal einer, der ein T-Shirt von „Earth First“ trug. Da in einem der Wälder in der Nähe zuvor gerade eine „Earth First“-Sabotageaktion stattgefunden hatte: es wurden Maschinen sabotiert und Nägel in Bäume geschlagen, um diese vor dem Gefälltwerden zu schützen (der Konzern „Timberlands“ wollte 42.000 Festmeter Holz fällen lassen), befürchtete Bernd Heinrich, dass man ihn dieser Tat verdächtigen könnte, zumal er ebenfalls einige Nägel in Bäume geschlagen hatte, allerdings nur vorübergehend, um über sie an die Rabennester in den Baumkronen heranzukommen, diese Nägel lagen jedoch gut sichtbar in seinem Wagen. Außerdem hatte er sich zuvor „schon ziemlich aus dem Fenster gehängt“, als er das Konzept in Frage stellte, „mit dem Herbizidmaßnahmen ‚Forstwirtschaft‘ genannt werden.“ Dabei läßt der Holzkonzern Gifte der „Agent-Orange-Art“ vom Hubschrauber aus versprühen, um nach einem Kahlschlag das Sprießen der Laubbäume zu verhindern und damit das Wachsen seiner Koniferen zu fördern. Bernd Heinrich dämpfte seine aufkommende Angst vor der Verfolgung durch die Justiz, die in der Nachbarschaft nach den Tätern der Baum-Vernagelungsaktion fahnden ließ, damit, dass er sich erinnerte, „auch Thoreau war für kurze Zeit im Gefängnis“.
.

.
Rasenpflege
Für Jean Paul Sartre war der Rasen eine echte, nach außen reichende Erweiterung des Teppichs. Die Baumärkte bieten so etwas inzwischen an, sie sprechen von „Outdoorteppich“, „Kunstrasen“, „Fertigrasen“, „Auslegerasen“ und „Rollrasen“. Die „Deutsche Rasengesellschaft“ (DRG) empfiehlt die Verwendung von „Regel-Saatgut-Mischungen (RSM), weil sie Gewähr für gute Rasenqualität bietet. Die „gartenakademie.rip.de“ offeriert eine Liste „unerwünschter Gräser im Rasen“. An der Universität Göttingen wird „Graslandwissenschaft“ betrieben und u.a. „Grünlandmanagement“ gelehrt.
.
Auf Golfplätzen muß der Teil des Rasens (eine besondere Grassorte aus England), der um die Löcher herum angelegt wurde, frühmorgens abgefegt werden, weil die Sonne ihn sonst durch die Tautropfen an ihm verbrennt. Beim Golfrasen spricht man von „Green“ und der Oberpfleger nennt sich „Head-Greenkeeper“, er sorgt dafür, dass alle Rasenflächen täglich auf drei Millimeter gekürzt werden, „ab 2,8 Millimeter ist aber Schluss, dann ist der Rasen kaputt,“ meint der Head-Greenkeeper auf dem Golfplatz Bochum-Stiepel Jürgen Haarmann, der den Rasen außerdem „vertikutieren, und aerifizieren lassen muß und ihm anschließend ein „Topdressing“ verpaßt. Um Berlin herum entstanden schon gleich nach der Wende 12 Golfplätze.
.
In den Westberliner Bezirken der Reichen mit großen Gärten werden die (Rasen-) Flächen immer kleiner, indem sie, um (Garten)Arbeit oder die Anstellung eines Gärtners zu vermeiden, ihre Grundstücke halbieren, dritteln, sogar vierteln und darauf Häuser bauen, die sie wohnungsweise vermieten oder verkaufen.
.
Der US-Soziologe Thorstein Veblen meinte: Der Rasenmäher schaffte den „unfeinen“ Einsatz von Arbeitstieren ab – sie hatten zuvor den Mähbalken über den Rasen gezogen. Marx erwähnt in “Das Kapital“ den griechischen Dichter Antipatros, der ähnlich naiv die Erfindung der Wassermühle zum Mahlen von Getreide als Befreierin der Sklavinnen begrüßte. „Die Heiden, ja die Heiden!“ seufzte Marx. Sie hätten nichts von politischer Ökonomie und Christentum begriffen. Sie begriffen u.a. nicht, dass die Maschine das probateste Mittel zur Verlängerung des Arbeitstages ist.
.
In Ostfriesland, wo man besonders große Rasenflächen um die Höfe hat, schaffen die Besitzer sich gerne „Rasentraktoren“ an: „Damit macht meinen Kindern das Rasenmähen endlich wieder Spaß,“ meinte ein Bauer zu mir. Auf der IGA in Marzahn-Hellersdorf halten Mähroboter die riesigen Rasenflächen kurz, indem sie den ganzen ‚Tag darauf hin und her fahren.
.
In den USA gibt es hunderte von Bürgerinitiativen, die den Einsatz der lauten Laubbläser verbieten wollen. Dagegen haben sich jedoch mindestens ebenso viele Initiativen von Philipinos gegründet, die im Falle eines Laubbläser-Verbots ihren Job verlieren würden.
.
In den Bezirken der Armen vermehren sich die kleinen Rasenflächen: Hier werden die Baumscheiben am Straßenrand, die Hinterhöfe und Brachflächen „begrünt“ – gelegentlich illegal. In den Kleingarten-Kolonien, die laut Satzung auf 80% ihrer Parzellen Nutzpflanzen anbauen müssen, wird diese Verordnung mehr und mehr ignoriert, indem die Rasenfläche vergrößert und mit Sitzgelegenheiten, Swimmingpool oder Trampolin ausgestattet wird.
.
Auf den Dachgärten der Firmen muß der Rasen seit dem Rauchverbot nicht mehr gemäht werden, weil sich auf ihm so oft es geht die Raucher treffen, die das Gras kurz halten.
.
„Deutschland ist ein Land, in dem es keine Revolution geben kann, weil man dazu den Rasen betreten müsste,“ meinte Josef Stalin. Mindestens bis in die Achtzigerjahre standen an den öffentlichen Rasenflächen in Westdeutschland überall Schilder mit der Aufschrift „Rasen betreten verboten“. In Westberlin übertraten die Türken als erstes dieses Verbot: „Wir Deutsche haben es ihnen dann einfach nachgemacht,“ erinnert sich eine Kreuzberger Sozialarbeiterin.
.
Der US-Literaturwissenschaftler Timothy Morton schreibt in seinem Buch „Ökologie ohne Natur – Eine neue Sicht auf die Umwelt“ (2016): „Rasenflächen sind Räume eliminierter Gewalt, ausradierter Seiten, die leer und geräumig wirken sollen. Sie stellen nichts anderes dar als eine horizontale, zum Massenartikel umgeformte Version jener Wildnis, die die Menschen aufsuchen, um Frieden und Ruhe zu finden und ein abstraktes Naturgefühl zu erleben. Rasenflächen sind so etwas wie eine ‚Fertigdistanz‘.“
.

Ein Stadtgärtner baut sich eine neue Hütte auf seiner Parzelle in der Neuköllner Kleingartenkolonie „Ewige Heimat“ Rhodeländerweg.
.
Staatsfreie Territorien
Was haben die folgenden Geländegewinne gemeinsam: Der ehemalige Flugplatz in Lärz/Müritz des 33. Jagdfliegerregiments der Roten Armee/ die auf der zertrümmerten Wehrtechnischen Fakultät der TU errichtete und inzwischen verlassene Abhörstation der NSA im Berliner Grunewald/ das „Zytanien“ genannte Gelände einer abgewickelten Ziegelei bei Lehrte/Hannover/das einstige „Deutschlandlager“ an der „Führerschule der Hitler-Jugend“ in Kuhlmühle bei Wittstock/ und das weitläufige Gelände der Alten Spitzenfabrik in Grimma am Ufer der Mulde, die einmal in jüdischem Besitz war?
.
Es sind heute „Locations“ der anarchistisch inspirierten Bachelor-Generation, die hier drogenbefeuert ihre Lieblingsmusik wählt, Workshops über Widerstand und Veganismus abhält und Sport, Spiel Spaß hat. „Sie wollen alle bloß jung bleiben und keine Verantwortung übernehmen,“ meint eine Kritikerin, die aber trotzdem oder gerade deswegen gerne dort mitmacht, u.a. als „Speaker“.
.
Auf den allsommerlich stattfindenden „Weltkongressen der hedonistischen Internationale“, die u.a. in „Coolmühle“ und heuer auf dem Gelände des Fusion-Festivals in Lärz/Müritz stattfanden, wurde „A-nar-chia“ gejodelt und überhaupt die staatsferne bzw. -feindliche Selbstorganisation von der Größe mehrerer märkischer Dörfer aufs Sinnlichste und Feinste realisiert – obwohl oder weil den etwa 1400 daran mitwirkenden Neohippies nichts ferner lag als „Stress“. An Vorträgen wurden Analysen rechter Organisationen, u.a. der „Identitären“, geboten sowie von der Orgform „Peng-Kollektiv“ in Wort und Bild dessen aufwändige Inszenierungen gegen üble Konzerne und Geheimdienste zur Diskussion gestellt. Dabei wurden Ähnlichkeiten mit den Aktivitäten der „Yes-Men“ und des „Bundesverbandes der Schlepper und Schleuser“ deutlich, mit denen „Peng“ irgendwie zusammenhängt.
Ein bißchen auch mit „Wikipedia“, wo es heißt: „Die Hedonistische Internationale ist ein loses internationales Netzwerk aktionsorientierter linker Gruppen und Einzelpersonen. Es besteht seit 2006 und hat mehr als 30 Sektionen in Deutschland, Österreich, Italien, USA, Russland und der Schweiz.“ Diese Linken (vor dem Bachelor-, im Bachelor- und nach dem Bachelor-Examen), von denen nicht wenige auf den o.e. Locations „ehrenamtlich“ als „Neuköllner WGs“ für die Infrastruktur und Gastronomie sorgen, begreifen den Hedonismus „nicht als Motor einer dumpfen, materialistischen Spaßgesellschaft, sondern als Chance zur Überwindung des Bestehenden“ und „wollen Freude, Lust, Genuss und ein selbst bestimmtes Leben in Freiheit für alle Menschen!“ sowie „fröhliches Miteinander, Anarchie, die Ideen Epikurs, bunte Freude, Sinnlichkeit, Ausschweifung, Freundschaft, Gerechtigkeit, Toleranz, Freiheit, sexuelle Freizügigkeit, Nachhaltigkeit, Friede, freien Zugang zu Information, Kunst, kosmopolitisches Dasein, eine Welt ohne Grenzen und Diskriminierung.“
.
Epikur (geb. um 341 v.Chr., gest. um 279 v.Ch.)? Ja der, dessen Schule einst im „Garten“ (kepos) stattfand. Auch die o.e. „Locations“ sind Gärten – voller Haine und phantastischer Architekturen, in denen Schwalben und Mauersegler brüten. In den Gebäuden der Lehrter Ziegelei nimmt ihre Brut sogar an den Workshops teil. Diese werden vom Hannoveraner „Fuchsbau“-Kollektiv, bestehend aus Kultur- und Sozialwissenschaftlerinnen, organisiert. Über ihr nächstes „Fuchsbau Festival“ jetzt im August schreiben sie: „Kommet zusammen, ihr digitalisierten Seelen! Wir programmieren uns gegenseitig zu Liebesmaschinen. Wir lösen uns von den Ketten unserer analogen Existenz. Ihr einsamen Menschen und gefühlvollen Cyborgs, reibt euch den Schlafsand aus den viereckigen Augen und schreitet mit uns gen technischer Utopie!“
.
Das ist keine Drohung und auch nicht illusionär, aber durchaus kontrovers: Nicht wenige propagieren in einer Art Wiederholungsschleife der Hippiebewegung eine eher atechnische, gar antimathematische Utopie – ich z.B., deswegen werde ich den Fuchsbau heuer links liegen lassen. Kann man ja machen!
.
Dafür fuhr ich nach Grimma, das ebenfalls zu diesen seltsam anrührenden Öko-Soziotopen der Bachelor-Generation gehört. In dieses „Dorf der Jugend“ war die mobile meinland-Redaktion der taz mit Diskussionen, DJs und Isomatten eingefallen – und diskutierte an mehreren runden Tischen über dit und dat, es wurde aber auch Fußball gespielt und mit einer Flasche Raki über die Situation in der Türkei informiert sowie über den Journalismus in Afrika, dazu hatte die taz einige Journalistinnen aus Nigeria und Senegal eingeladen.
.
Die NSA-Abhörstation auf dem Westberliner Teufelsberg hat beides: Gärten, Wald und Technik, u.a. zwei riesige Silos, in denen man täglich mehrere Tonnen Papier, das 1500 Geheimdienstmitarbeiter mit abgehörten Gesprächen im Ostblock rund um die Uhr vollschrieben, zerschredderte. Anschließend wurden die Fetzen gewässert, getrocknet, gepreßt und verbrannt. Dieser Siloraum ist heute einer von mehreren „Musensitzen“ der Teufelsberg-Künstler. Im Vorraum zeigt Rotraud Vonderheide derzeit zwei Ausstellungen: Eine über „Women for Peace“ und eine über „Trümmerfrauen“ (auf die zerstörte „Wehrtechnische Nazi-Fakultät“ hatten diese nach dem Krieg 26 Millionen Kubikmeter Trümmerschutt gekippt). Unten hat die Künstlerin einen Rosengarten angelegt und oben, auf dem Radarturm, wo sie sich eine Meditationsetage gestaltete, hat man einen guten Überblick über Berlin, das von dort in alle Richtungen wie eine einzige grüne Hölle aussieht, nur am Horizont sieht man ein paar graue Häuser und den winzigen Fernsehturm.
.
Es gibt inzwischen zig solche Orte in Deutschland. All diese von Kapital und Staat verlassenen Geländegewinne eint, dass sie von einer Gruppe in Beschlag genommen, begärtnert und mit fantasievollsten Architekturen bestückt wurden – auf dass die ausbildungsfrustrierte Bachelor-Jugend sich auf diesen temporär befreiten Zonen massenhaft einfindet, amüsiert, diskutiert, informiert und vernetzt, nicht zuletzt deswegen, damit Geld für die weitere Geländegestaltung zusammenkommt. Es geht um die Kunst, nicht regiert zu werden!
.
Als ich nach 1989 von den ersten Sommer-Raves im Umland hörte, dachte ich: Na gut, in den verlassenen Industriekomplexen vergnügt sich jetzt gegen Eintritt die durch die Computerisierung überflüssig gewordene Jugend mit Maschinenmusik (Techno) und Drogen (Ecstasy). So wie man jetzt auch für die schweißtreibende Arbeit an Maschinen in sogenannten Fitnesscentern bezahlen muss. Ich engagierte mich lieber kostenlos für den Erhalt der letzten proletarischen Arbeitsplätze in den LPGen und Fabriken.
.
Aber langsam dämmerte es mir: „Wir haben es satt!“ – es gibt wohl wirklich keine ökonomische Utopie mehr, nur noch eine ökologische! Und das bedeutet, dass wir gar nicht genug deproletarisieren können und stattdessen diese idyllischen, inselgleichen Locations der Linken, die ja nicht nur temporäre Tanzflächen oder hübsche Urban-Gardening-Projekte sind, sondern kollektive, selbstorganisierte Existenzweisen (Start-ups), vor dem Verfall durch Profitabilisierung schützen sollten. Es sind nicht nur virtuelle Netz-, sondern auch reale Nestwerke: Wie viele Schwalben, Mauersegler und Stare allein an den schrägen Installationen in Grimma, Lehrte und Lärz brüten!
.
Schon gibt es ganze EU-Initiativen, um weitere „Dörfer der Jugend“ entstehen zu lassen. Aber ob diese – von oben gefördert – jene von unten, spontan entstandenen ergänzen oder gar ersetzen können, ist fraglich. Epikurs Schule fand einst im Garten statt. Auf dem „Stadtforum von unten“ in der Kreuzberger Markthalle Neun meinte kürzlich einer zu dem dazu tagenden „Stadtforum von oben“: „Die Planer machen immer Top-down-Gärten, wir müssen Bottom-up-Gärten machen, das heißt aus Grau – Beton – Grün.“ Die Experten in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft haben abgewirtschaftet. Sie haben keine Ahnung und nur statistisches Wissen. Kürzlich wurde der „Fischbüro-“ und „Tresor“-Clubgründer Dimitri vom Detroiter Bürgermeister gefragt: „Wie macht ihr das in Berlin, dass gebildete Jugendliche aus der ganzen Welt kommen? Was können wir hier tun?“ „Schafft einfach die Polizeistunde ab,“ antwortete ihm Dimitri.
.

Bienen im Abflug
Komisch, je mehr über Bienen geforscht wird, desto schlechter geht es ihnen. Die Anthroposophin Eva Rosenfelder erinnerte kürzlich daran: „In weiser Voraussicht sagte Rudolf Steiner 1923, dass die Bienenzucht in achtzig oder hundert Jahren in eine große Krise geraten werde. Als Grund dafür sah er vor allem die künstlich gezüchteten Königinnen. Heute findet mit Bienen ein globaler Handel statt: Königinnen aus aller Welt werden per Briefpost verschickt und an neuen Standorten eingesetzt. Was dabei zählt, ist der Profit.“
.
Ein der „Demeter-Imkerei“ verbundener Schweizer Autor, Markus Imhoff, filmte für seine Dokumentation „More Than Honey“, wie in den USA Großimker, die mit 50.000er- bis 100.000er-Völkern wirtschaften, das handhaben. Zwecks Effektivierung werden die Völker nach der ersten Bestäubungsaktion, zum Beispiel der riesigen Mandelbaum-Plantagen in Kalifornien, „gesplittet“: Die Bienenkästen kommen auf ein Fließband, werden oben maschinell abgefräst und dann macht man aus einem Volk vier, indem in vier leere Kästen jeweils ein Wabenrahmen mit Eiern, Larven, Honig und Pollen reingestellt wird. Die Bienen sind inzwischen an die Decke der Splitting-Halle geflogen. Von dort fegt man sie in Eimer, deren Inhalt dann auf die vier Kästen verteilt wird. Deckel zu und fertig sind die vier neuen Völker. Nach drei Tagen werden sie mit je einer gekauften Königinnen-Zelle bestückt. Das hessische Bieneninstitut in Kirchhain spricht dabei von einem „Kunstschwarm“ – mit dem der Imker „künstlich ein neues Bienenvolk schafft“.
.
Auf der Internetseite des anthroposophischen Vereins für „wesensgemäße Bienenhaltung, ‚Mellifera‘“, fassten Mitarbeiter der Lehr- und Versuchsimkerei Fischermühle diese industrielle Bienenbewirtschaftung so zusammen: „Zur künstlichen Bildung von Völkern, der Ablegerbildung, werden üblicherweise ‚Bienenmaterial‘, Brut- und Vorrats-Waben verwendet, die willkürlich aus voll entwickelten Völkern entnommen werden. Sie werden mit einer Königin aus künstlicher Zucht oder Nachschaffung in eine neue Bienenwohnung gebracht und mit Zuckerwasser gefüttert. Wie Bauteile eines technischen Gerätes werden sie zusammengesetzt. Der Imker vertraut dabei auf das Wunder der lebendigen Natur, die dem Organisationsprinzip des Bienenvolks folgend, aus den Teilen ein Ganzes macht, das heißt einen neuen Organismus bildet.“
.
Aber dieses Wunder bleibt zunehmend aus. Man macht dafür Glyphosat und die Varroamilbe verantwortlich. Die Autoren erinnern noch einmal an den Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital – auch bei den Bienen: „Jede moderne Betriebsweise unterdrückt den Schwarm. Die Maßnahmen der ‚Schwarmtrieblenkung‘ und einseitige züchterische Selektion sollen ihn im Vorfeld verhindern. Trotzdem aufkommende Schwarmstimmung wird notfalls mit einem oder mehreren massiven Eingriffen abgebrochen. Die somit fehlende natürliche Vermehrung der Völker wird durch künstliche Ablegerbildung und Königinnenzucht ersetzt.“ Dabei ist „der Schwarm der eigentliche Höhepunkt der Volksentwicklung“. Nur „der Schwarmakt“ kann als „Geburt von Bienenvölkern“ gelten.
.
Die Bienen erkennen sich als Schwestern am Stockgeruch, der anscheinend viel mit einem Drüsensekret der Königin zu tun hat, die normalerweise ihrer aller Mutter ist. Gesplittet sind die Bienen kein Volk mehr, ein „Staat“ sowieso nicht, sondern ein zusammengewürfelter Haufen. Deswegen fliegen sie vielleicht reihenweise aus und kommen nicht mehr zurück – ohne Volk sind sie aber auch so oder so nicht (mehr) lebensfähig. Das nennt sich dann Bienensterben: wenn zum Beispiel von 450 Völkern, die die Mandelbaumblüten in Kalifornien bestäubt haben, wie im o.e. Film dokumentiert, nur 230 übrig bleiben. In den anderen Kästen findet man nur noch eine Königin und ein paar Drohnen, die Waben sind ansonsten voll mit Eiern, Larven, Honig und Pollen.
.
Im Bienenstock gibt es streng genommen nur eine geschlechtliche Arbeitsteilung – zwischen der fruchtbaren „Königin“ sowie den wenigen sie befruchtenden Drohnen einerseits und den zigtausend „sterilen“ Arbeiterinnen andererseits. Während jene auf ihre Sexualfunktion reduziert sind, führen diese im Laufe ihres Lebens, das im Sommer rund fünf Wochen und im Winter fünf bis sechs Monate dauert, alle anfallenden Tätigkeiten nach und nach aus. Die weiblichen Bienen sind keine Spezialisten, sondern Generalisten. Sie verständigen sich auf den Waben im Stock tanzend, wenn es gilt, ein ergiebiges Blütenfeld abzuernten. Und wenn der Schwarm mit seiner alten Königin den Stock verlassen und sich zum Beispiel an einem Baum versammelt hat, übernehmen Sammelbienen auch die Suche nach einer neuen Unterkunft – über deren „Qualität“ sie sich auf dem Schwarm ebenfalls tanzend verständigen, und zwar um so heftiger und nervöser, je mehr die einzelne Tänzerin von der Qualität ihrer gefundenen neuen Behausung überzeugt ist. Daraufhin fliegen andere Sammelbienen noch einmal aus, um sich selbst von diesem „Supernistplatz“ zu überzeugen. Ausgehend von vielen Experimenten hat der US-Bienenforscher Thomas S. Seeley aus der Suche dieser Bienen und ihrer „kollektiven Entscheidung“ für die geeignetste Unterkunft eine auch für uns geradezu vorbildliche „Bienendemokratie“ konstruiert. Diese sollten wir uns alle zu Herzen nehmen. Der Autor praktiziert sie selbst erfolgreich als Leiter eines Forschungsinstituts . „Es gehört zu den erstaunlichsten Aspekten am Entscheidungsprozess der Bienenschwärme, dass er ein vollkommen demokratischer Vorgang ist“, heißt es dazu in seinem Buch: „Honeybee Democracy“.
.
Der Siegener Germanist Niels Werber hat sich in seiner „Faszinationsgeschichte ‚Ameisengesellschaften‘“ (2013) mit diesem Buch („Bienendemokratie“ auf Deutsch) beschäftigt: Seeley hatte seine Behauptung, dass der Schwarm in einer „demokratischen Debatte“ die Wahl für seine „neue Heimat“ trifft, natürlich genetisch begründet – und gleich an mehreren Stellen darauf hingewiesen, „dass die von ihm beschriebenen Verfahren der Entscheidungsfindung ‚durch das Prinzip der Selektion geprüft und optimiert‘ worden seien“. Im Bienenvolk – als Muster des derzeit angesagten „Schwarmdenkens“ – wirke die „Meisterhand der Selektion“.
.
Hinter dieser Konstruktion steckt laut Niels Werber eine unkritische „Rezeption von ökonomischen Theorien und Metaphern“, die bei den Insektenforschern anscheinend gang und gäbe ist, wobei sie ihr damit analysiertes Tierverhalten dann auch noch ärgerlicherweise zum „Modellfall der Gesellschaftstheorie“ erklären, also dass die Sozialwissenschaftler gefälligst bei den Entomologen in die Lehre gehen sollen, wenn sie weiterhin ernst genommen werden wollen.
.
In Deutschland wurde das allerdings schon einmal – während der Nazizeit – durchexerziert, weswegen die Rezensionen von Seeleys „Bienendemokratie“ hier meist wenig schmeichelhaft ausfielen. Auch wenn man damals das „Entscheidungsverhalten des Bienenschwarms“ noch nicht mit Hilfe moderner „Algorithmen und Quoren modellierte“, wie Seeley und die meisten anderen Erforscher dieser „Superorganismen“ heute. Der US-Autor denkt dabei jedoch nicht deutsch-„völkisch“, sondern eher wie der griechische Philosoph und Arzt Alkmaion von Kroton, der die Gesundheit eines Organismus mit den Fachausdrücken der demokratischen Verfassung beschrieb.
.
Der Bienenfreund
Der Dresdner Dichter und Bienenfreund Marcel Beyer, dessen verstorbener Dichterkollege Thomas Kling ein Wespenfreund war, trug in Göttingen Passagen aus seinem Essay „Mein Bienenjahr lesen“ vor. Die anwesende Literaturwissenschaftlerin Christiane Freudenstein wies ihn anschließend darauf hin, dass auch der Dichter und Zeichner Wilhelm Busch ein großer Bienenfreund war – und sogar einige bienenkundliche Artikel verfasste. Das war Marcel Beyer neu, er fragte Christiane Freudenstein, ob sie diese nicht veröffentlichen könne …
.
Sie erschienen dann im Göttinger Wallstein-Verlag. Im Vorwort der Literaturwissenschaftlerin erfährt man: Wilhelm Buschs Brüder Otto, Adolf und Hermann „unterhielten Bienenstände“ und Wilhelm Busch wurde im Alter von neun Jahren zwecks „Erziehung“ zu seinem bei Göttingen lebenden Onkel Pastor Georg Kleine gegeben: einer der „Koryphäen der deutschen Bienenzüchter“; Verfasser des Buches „Die und ihre Zucht“ und Herausgeber des „Bienenwirthschaftlichen Centralblatts“.
.
Er begeisterte Wilhelm Busch derart für die Imkerei, dass dieser, als die Eltern sein „Lotterleben“ als Künstler nicht mehr finanzieren wollten, den Gedanken fasste, als „Bienenzüchter nach Brasilien“ zu gehen. Aber „es sollte nicht sein; ich gerieth auf andere Bahnen“.
.
Im 19. Jahrhundert hatte der Honig eine große wirtschaftliche Bedeutung: Er war für die Armen das einzige Süßungsmittel. Bis zur Hochzüchtung der Zuckerrübe gab es bloß importierten Rohrzucker aus den Kolonien, den sich nur die Reichen leisten konnten. Heute ist es umgekehrt! Damals gab es allein im Königreich Hannover 300.000 Bienenstöcke, schrieb Wilhelm Busch 1867 in seinem Artikel „Unser Interesse an den Bienen“. Zuvor hatte der Direktor der Spandauer Realschule, Christian Konrad Sprengel, entdeckt, dass die Befruchtung der Blütenpflanzen durch Insekten geschieht (nicht mechanisch, durch direkten Kontakt oder den Wind, wie bis dahin angenommen) – und deswegen gefordert: „Weil die Bienenzucht die Wohlfahrt aller Einwohner eines Landes befördert, muss der Staat ein stehendes Heer von Bienen haben.“
.
Einer der ersten Beiträge von Wilhelm Busch für den „Münchner Bilderbogen“ hat den Titel „Die kleinen Honigdiebe“. Sein letztes größeres Werk – „Schnurrdiburr“ – thematisierte einen Bienenschwarm, der nicht wieder eingefangen werden konnte. Die Schwarmbildung war auch in der Korrespondenz mit seinen Brüdern immer Thema. In seinem Artikel für die Imkerzeitung, „Kennen die Bienen ihren Herrn?“, versetzte er sich in ihre Lage und kam zu dem Schluss: Die Imker sind „die allergrößten Honigdiebe unter der Sonne“.
.
Im dritten Artikel „Das Netz einer Bienenzelle“ (1868) erklärte Wilhelm Busch die Mathematik der Bienenwaben (zum Nachbauen). Der Würzburger Bienenforscher Jürgen Tautz erkennt dagegen die „Intelligenz der Bienen“ heute eher im verwendeten Wachs, den er einen „intelligenten Werkstoff“ nennt: „Die Bienen bauen ihre Waben rund, wenn sie das Wachs auf 45 Grad erwärmen, werden sie sechseckig.“ Demnach bauen die Wespen ihre papiernen Waben als präzisere Rhombendodekaeder.
.
Wilhelm Busch: „Umsäuselt von sumsenden Bienen. Schriften zur Imkerei“. Hrsg. von Christiane Freudenstein, Göttingen 2016.
Empfehlenswert: Jürgen Tautz und Diedrich Steen (Ein Bienenforscher und ein Imker): „Die Honigfabrik: Die Wunderwelt der Bienen – eine Betriebsbesichtigung“, Gütersloh 2017
Nicht empfehlenswert (kitschiger Bestseller): Maja Lunde: „Die Geschichte der Bienen“, München 2017
.
Bienensterben
Gestern lud die Restaurant- und Catering-Unternehmerin Sarah Wiener mit der Deutschen Umwelthilfe zu einer Pressekonferenz über das besorgniserregende Bienensterben. Es gab von ihren Köchen zubereitete Pilzschnittchen und Pflaumenkuchen. Diesen wird es im Gegensatz zu jenen wohl bald nicht mehr geben, wenn das „Bienensterben“, die Vergewaltigung der Bienenvölker aus Profitgründen und das Artensterben vor allem unter den Wildbienen, wegen der Ausbreitung von Monokulturen anhält. Pflaumenblüten müssen von Insekten bestäubt werden, um Früchte zu entwickeln.
.
Sarah Wiener ist die Tochter von Oswald Wiener, der mit seinem Antiroman „die verbesserung mitteleuropas“ (1969) und seiner Kreuzberger Ösi-Kneipe „Exil“ berühmt wurde, sie selbst lernte dort kochen. Heute engagiert sie sich für eine ökologische Landwirtschaft und als Imkerin für eine Rückkehr zur Haltung selbst organisierter Bienenvölker, das heißt keine Bestückung mit fremden Bienenköniginnen, keine Unterdrückung ihres Schwarmverhaltens und nur maßvollen Honigraub.
.
Das brachte sie mit der Verbraucherschutzorganisation „Deutsche Umwelthilfe“ zusammen, die von den Pflanzen aus argumentiert: So setzt sie sich für eine „nationale Stickstoff-Strategie“ ein, um die Überdüngung der Felder zu reduzieren, die viele Nahrungspflanzen der Insekten vernichtet. Der Bundesregierung wirft sie vor, die 1991 verabschiedete „Nitrat-Richtlinie“ der EU nicht konsequent umzusetzen, um die industrielle Landwirtschaft mit ihrer Massentierhaltung zu schonen.
.
Im Konflikt zwischen Ökonomie und Ökologie verhält sich das Kapital und sein geschäftsführender Ausschuss, die Politik, wie das „Diesel-Kartell“: Die Öffentlichkeit wird mit immer mehr Umweltgesetzen und ökologischen Begriffen wie „Nachhaltigkeit“ und „Bio“ eingenebelt, um dahinter mit business as usual fortzufahren. Kürzlich wurde sogar dem Panzer „Leopard 2“ ein Umweltpreis verliehen.
.
Derzeit sterben allein in Berlin wieder Tausende Jungvögel von Fassadenbrütern wie Spatz, Star, Meise und Mauersegler, weil die Häuser just zur Brutzeit energetisch verdämmt werden – von verrohten Bauunternehmern, obwohl diese Singvögel (wie auch Fledermäuse) streng geschützt sind und ihr absichtliches Töten mit Gefängnis bestraft werden kann. Aber weder die Umweltschutzbehörden noch die Polizei noch BUND und NABU sind wirklich willens, diese Ökoverbrecher zu stoppen.
.
Ähnliches gilt für die Grünämter in den Bezirken, die kaum noch Personal haben und stattdessen Aufträge an Firmen vergeben, die die „Grünpflege“ von schlecht gelaunten Niedriglohnarbeitskräften mit schwerem Gerät erledigen lassen. Der Flurschaden, den sie mit ihren Laubbläsern und Motorsägen hinterlassen, ist enorm. Der Ökologe Josef Reichholf erwähnt zudem: Zwar gebe es immer mehr Ornithologen und „Bürgerwissenschaftler“, die sich für den Naturschutz einsetzen, „aber die Widerstände gegen sie sind auch gewaltig gewachsen, sodass die Ergebnisse oft nur recht faule Kompromisse sind (Europäische Vogelschutzrichtlinie und die inzwischen praktizierten ‚Ausnahmen‘ mit regulärer Jagdzeit auf Krähenvögel!). Insbesondere in Westdeutschland wurden die Naturschutzgebiete zu Aussperrgebieten für die Naturfreunde, während die Nutzer darin ungehindert und unkontrolliert mehr oder minder tun und lassen können, was sie wollen.“ Gemeint sind Angler, Jäger und Holzkonzerne: Sie können weiter ihrem Hobby bzw. ihrem Raubbau in den Naturschutzgebieten nachgehen, während z.B. die Naturwissenschaftler eine Genehmigung brauchen, um dort zu forschen.
.

Waagerechter Säulenbasalt, der ebenfalls sechseckig ist, aber kein Mensch würde dabei von der Intelligenz der Vulkane reden.



