1. „Bücher und Fische“
Bei mir war es umgekehrt: Erst die Fische dann die Bücher. Wir hatten ein Warmwasseraquarium zu Hause und als Schüler besuchte ich oft die Tierpfleger des Aquariums im Bremer Überseemuseum, später richtete ich mir ein Kaltwasseraquarium mit einheimischen Fischen, Schnecken und Pflanzen ein, die ich selber fing. Dazu erwarb ich in einem Fischgeschäft noch einen Flußkrebs, er entwickelte sich zu einer regelrechten Persönlichkeit – und bekam einen Namen. Bald fing ich an, die ersten Biologiebücher zu lesen,
Gegenwärtig steigt die Attraktivität von Aquarien, sie steht im Zusammenhang „der Konjunktur einer Ästhetik des Prozessualen, Performativen, dem Bewegten und Liquiden,“ meint die Kunstwissenschaftlerin Ursula Harten in ihrem üppig gestalteten Buch „Aquaria“ (2014). Die „Welt im Glase“, wie Justus von Liebig sein Demonstrationsaquarium nannte, ist heute ähnlich hochtechnisch ausgestattet (eine Art Intensivstation für seinen „Besatz“) wie die Trawler und Fabrikschiffe (die sog. Vollfroster) der Hochseefischerei. Die ersten Leitfäden zur Instandhaltung und Pflege von Aquarien erscheinen Mitte der 1850er-Jahre. In der DDR brachte es der Ichthyologe Günther Sterba mit seinen Ratgeberbüchern zu einigem Ruhm.
.

.
Ausgehend vom Salonschmuck „Goldfischglas“ hatte sich ab Mitte des 19. Jahrhundert eine Aquaristik und aus dem Hobby-Aquarianer ein Fischforscher entwickelt. Während der mit seiner „Nase“ die Fischgründe aufspürende Fischer sich als Kapitän zu einem Betriebsleiter entwickelte, dessen Fanggründe und -quoten von Wissenschaft und Politik vorgegeben werden und der den Fang schon an Bord weiterverarbeiten läßt. Auf den ersten Forschungsreisen mußten die mitfahrenden Wissenschaftler sich noch den Befehlen des Kapitäns strikt unterordnen und auch seine Offiziere hatten für die Vorschläge der Landratten nur wenig übrig. Auf den heutigen, mit vielen technischen Geräten ausgestatteten Forschungsschiffen sind der Kapitän und seine Mannschaft nurmehr Dienstleister der Wissenschaftler, deren Institute meist auch Besitzer der Schiffe sind.
.

.
So wie man von den Speisefischen weltweit immer weniger fängt (in Tonnage gemessen), werden langsam auch die Zierfische in ihren natürlichen Lebensräumen knapp. Millionen von Hobby-Aquarianer sitzen nahezu täglich und ausdauernd vor ihren Fischbecken. Ihre Beobachtungen sind für viele berufsmäßige Fischforscher wichtig, zumal ihnen immer öfter Nachzuchten auch der heikelsten Tiere gelingen. Dennoch wächst der Markt für freilebende Fische, Garnelen, Korallen, Seeanemonen etc. weiter. Nach einem Report des Washingtoner Worldwatch Institutes werden jährlich weltweit 500 bis 600 Millionen Zierfische gefangen. Mehr als die Hälfte verendet, noch bevor sie von Aquarianern und öffentlichen Aquarienhäusern gekauft werden. In Deutschland werden in 3,2 Millionen Aquarien rund 80 Millionen Zierfische gehalten, wovon auch noch einmal etliche Millionen jedes Jahr eingehen. Nicht zuletzt deswegen, weil die Tiere in Indien, Indonesien und auf den Philippinen mit einem Betäubungsgift gefangen werden. Dazu schreibt eine Tierschutzorganisation: „Viele Fischtaucher kommen nur zu ihrer Beute, indem sie Cyanid oder andere Gifte in die Korallenriffe, in denen die Fische leben, einspritzen. Dies zielt darauf ab, die Fische zu betäuben und sie aus dem Riff heraus driften zu lassen, damit man sie dann leicht einsammeln kann; das Cyanid tötet allerdings gleich einmal die Hälfte der Tiere auf der Stelle. Viele weitere sterben an den Cyanid-Rückständen, wenn sie bereits verkauft wurden. Das Gift tötet außerdem die Korallen, auf der die Fische leben.“
In diesen Ländern werden allerdings immer mehr der für den Export in die Industrieländer begehrten Zierfische in Fischfarmen gezüchtet.
.
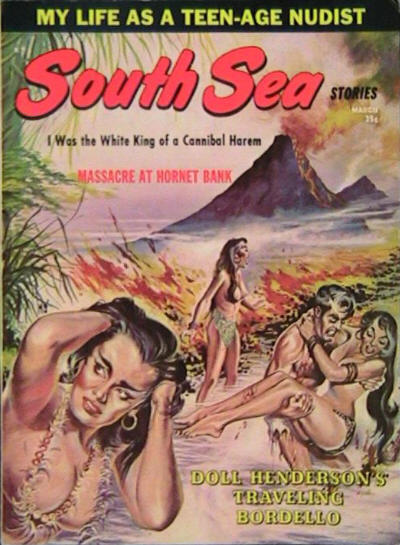
.
Seit dem ersten Schauaquarium im Londoner Zoo 1853 und bis zu den großen Aquarienhäusern, die um 1900 in den meisten Industrieländern entstanden, entwickelte das Publikum eine regelrechte „Aquariums-Manie“. Die Biologie dazu eine neue Aufgabe: Erforschung der „Beziehungen des Organismus zur umgebenden Aussenwelt, wohin wir im weiteren Sinne alle Existenz-Bedingungen rechnen können,“ wie der Zoologe Ernst Haeckel 1866 schrieb, der dafür den Begriff der „Ökologie“ vorschlug. Das Aquarium – die „Welt im Glas“ – ist ein Ökotop.
Elf Jahre später schlug der Biogeograph Karl August Möbius den Begriff der „Biocönose“ zur Erforschung maritimer Lebensgemeinschaften vor. Er hatte die Austernbänke an den deutschen Küsten erforscht, um herauszufinden, ob man dort wie an der französischen Westküste auch künstliche Austernzuchten anlegen könnte – was er dann verneinte÷ Der Untergrund in der Nord- und Ostsee ist dafür nicht geeignet. In seiner Schrift „Austern und Austernwirtschaft“ (1877) faßte er unter Biozönose „eine Auswahl und Zahl von Arten und Individuen, welche sich gegenseitig bedingen und durch Fortpflanzung in einem abgemessenen Gebiet dauernd erhalten.“
.

.
Es ging diesen Meeresforschern nicht mehr um die Manifestationen des Lebens im individuellen Körper, sondern um das Leben von Gemeinschaften verschiedener Organismen. Es hat den Anschein, als ob z.B. in Korallenriffen zwischen den vielen Arten ein ständiges Fressen und Gefressenwerden stattfindet, ein harter „Kampf ums Dasein,“ wie Ernst Haeckel an den ceylonesischen Korallenriffen beobachtet haben wollte – nicht jedoch bei den unaufgeregten Menschen auf der tropischen Insel. Gleichzeitig gibt es aber ebensoviele Bündnisse und Symbiosen zwischen den Riffbewohnern unter Wasser, um sich gegenseitig zu schützen, zu helfen und sogar zu ernähren. Bei der Erforschung der Korallenriffe standen sich gewissermaßen englische Darwinisten und französische Lamarckisten gegenüber.
In seiner hymnischen Naturgeschichte „Das Meer“ (1861) begriff Jules Michelet die Lebensgemeinschaft „Korallenriff“ sogar als Verwirklichung der „Ideale von 1789“, worüber der Historiker sein Hauptwerk verfaßt hatte, „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“. Er konnte sich dabei auf den von ihm verehrten Naturforscher Jean-Baptiste de Lamarck berufen, der sich mit den „wirbellosen Tieren“, speziell mit Muscheln befaßt hatte und den Begriff „Biologie“ prägte. In der Riffgemeinschaft hatten es Lamarck konkret vor allem die Medusen – Quallen – angetan, in denen er bei ihrer Erforschung „die Spiele, die Eleganz und das Lächeln der neuen Freiheit“ verkörpert sah.
Haeckels Kollege, der Gießener Korallenforscher Carl Vogt, meinte 1866 in einem Artikel für „Die Gartenlaube“, dass „der Korallen-Polyp nicht nur ein geselliges Thier ist, sondern auch Socialist und Communist in der verwegensten Bedeutung des Wortes; nur durch gemeinsame Arbeit vieler, engverbundener Thiere kann der werthvolle Korallenstock aufgebaut werden, den der Mensch aus der Tiefe des Meeres fischt, und diese gemeinsame Arbeit ist nur unter der Bedingung möglich, daß jedes Einzelwesen allen Gewinnst seiner ernährenden Thätigkeit an die Allgemeinheit abgiebt. Jeder Polyp sucht so viele kleine Thierchen als nur möglich zu fangen und zu verdauen, auf den Nahrungssaft, den er aus denselben zieht, hat er das erste unbestreitbare Recht, allein dieser Nahrungssaft gehört nicht ihm allein. Während die unverdaulichen Reste durch den Mund ausgeworfen werden (es existirt hierfür keine besondere Oeffnung), tritt der Nahrungssaft aus der allgemeinen Höhlung des Polypenleibes in mannigfache Canäle über, mittelst deren er sich in der lebendigen Rindensubstanz des Korallenstockes vertheilt und zu allen übrigen Theilen gelangt.“ Inzwischen weiß man, dass jeder Warmwasser-Korallen-Polyp auch noch eine Lebensgemeinschaft mit stickstofffixierenden Bakterien und Algen – der Art Symbiodinium – bildet, letztere wandeln das Sonnenlicht in Energie um. Die Koralle ist ein „Metaorganismus“.
.

Hawaii-Prinzessin Kaiulani
.
Für Ernst Haeckel, der sich sein „Material“ von Jugendlichen heraufholen ließ, auf Fischmärkten erwarb und sich von einem Fischer herumfahren ließ, wobei er mit feinem Kescher Mikroorganismen fing, war dagegen die Riffgemeinschaft ein Paradebeispiel für die Darwinsche Evolutionsthorie. Nach anfänglichem Schwanken, ob er Künstler oder Wissenschaftler werden sollte (was dann durch seine Verlobung mit Anna Sethe entschieden wurde: Er mußte Geld verdienen), wählte er die Forschung. Dabei konzentrierte er sich dann vor allem auf Radiolarien (Strahlentierchen), von denen er 1860 allein im Hafen von Messina 101 neue Arten entdeckte. Seiner Verlobten schrieb er: Damit dürfe er hoffen, „auch einen tüchtigen Stein zu dem wunderherrlichen Prachtbau der modernen Naturwissenschaft zu liefern.“ Zum Zeichnen benutzte Haeckel eine „Camera lucida“, weil mit ihr „die Formen alle genau mathematisch bestimmt sind, und also auch mit mathematischer Treue wiedergegeben werden müssen.“ Die meist durchbrochen runden Kalkpanzer der winzigen Radiolarien sind jedoch nicht mathematisch genau aufgebaut. Um sie erst einmal zu beschreiben, studierte er sie unter dem Mikroskop, wobei er sie „zu Tode guckte“. Nach seiner Rückkehr gab er einen „Atlas der Radiolarien“ heraus, seine vielgelobten Zeichnungen begriff er auch als Beitrag zur Kunstentwicklung, woran er 1924 noch einmal mit seinem Buch „Kunstformen der Natur“ erinnerte. 1969 gab das Ernst-Haeckel-Haus in Jena die gesammelten Berichte seiner Forschungsreisen – unter dem Titel „Tropenfahrten“ – heraus, mit politischen Kommentaren versehen. „Korallengärten“ suchte Haeckel neben der ceylonesischen auch noch an der arabischen und der indischen Küste auf. Darüber veröffentlichte er ebenfalls Expeditionsberichte. Zwischendurch fand der Freidenker noch Zeit, sich in Rom zum „Gegenpapst“ krönen zu lassen.
Sein Jenaer Kollege Anton Dohrn baute derweil eine maritime Forschungsstation in Neapel auf, wo Wissenschaftler Arbeitsplätze mieten konnten und können, daneben gibt es noch ein öffentliches Aquarium auf der Station, die inzwischen weltberühmt ist und Vorbild für hunderte weiterer Forschungsstationen an so ziemlich allen Küsten wurde. Der erste BRD-Bundeskanzler Theodor Heuss veröffentlichte 1940 eine sehr schöne Biographie über Anton Dohrn und seine Meeresforschungsstation am Golf von Neapel, wo auf der nahen Insel Capri die homerischen Sirenen einst mit ihrem Gesang die Seefahrer anlockten.
.

.
Der auf in seiner Villa auf Capri von Mussolini unter Hausarrest gestellte Schriftsteller Curzio Malapart schrieb in seinem Roman „Die Haut“ (1950), dass man eine dieser Sireniden im Aquarium der Forschungsstation gehalten habe. Sie sei jedoch, wie fast alle anderen Lebewesen in Dohrns Aquarien auch, 1944 vom Oberkommando der amerikanischen Streitkräfte, die Neapel eingenommen hatten, getötet worden – um anschließend von ihnen verspeist zu werden. Malaparte will selbst bei diesem „Gastmahl des Meeres“ mit dabei gewesen sein. Weil aber das „zur Gattung der Sirenoiden“ gehörende Meerestier ( „dessen Flanken in einem Fischschwanz endeten – genau wie von Ovid beschrieben“) einem kleinen toten Mädchen zum Verwechseln ähnlich sah, habe eine der anwesenden weiblichen US-Offiziere darauf bestanden, den „Fisch“ stattdessen ordnungsgemäß im Garten der Forschungsstätte zu bestatten.
Für die Amerikaner sind die Sirenen das, was wir „Seekühe“ nennen: pflanzenfressende Meeressäugetiere, die nur noch in tropischen Gewässern vorkommen. Vier leben heute in einem großen Wasserbecken des Tierparks Friedrichsfelde. Sie stammen aus den Sümpfen Floridas und jeden Tag steigt ein Taucher zu ihnen herab, um sie zu streicheln, was sie angeblich brauchen. Es gab noch eine größere Seekuhart – in den nordischen Gewässern: Der Naturforscher Georg Wilhelm Steller „entdeckte“ sie auf der 2. russischen Kamtschatka-Expedition, die vom dänischen Kapitän Vitus Bering geleitet wurde. Sie sollten u.a. die Passage zwischen Alaska und Sibirien erkunden, die später Bering-Strasse genannt wurde, und strandeten danach auf einer Insel, die dann ebenfalls nach Bering benamt wurde. Dort studierte Steller 1741 lebende und tote Seekühe. Schon 27 Jahre später waren die Tiere ausgerottet. Man tötete sie zu tausenden ihres Fettes wegen, dass zu Tran gekocht wurde. Sie wurden dann nach ihm, der auf dem Landweg zurück nach St. Petersburg gestorben war, „Stellersche Seekühe“ genannt. Sein Bericht „Ausführliche Beschreibung von sonderbaren Meeresthieren“ erschien 1753 in Halle. Die letzten Reste der Stellerschen Seekühe, in Form von Skelettteilen und Hautstücken, befinden sich heute in fast allen großen Naturkundemuseen der Welt.
.

.
Von den noch lebenden Seekühen, die mit Elefanten verwandt sind, und an der asiatischen Küste sowie an der amerikanischen leben, dazu noch in einigen tropischen Flüssen, werden die vor Florida am gründlichsten geschützt. Kürzlich wurde dort ein 21-jähriger Tourist verhaftet nachdem er ein Seekuh-Junges von seiner Mutter getrennt und es halb aus dem Wasser gehievt hatte, um eines seiner Kinder auf dem Tier reiten zu lassen. Anschließend hatte der Familienvater die Fotos des Seekuhritts auf Facebook gepostet. Die zuständige Florida Fish and Wildlife Conservation Commission wurde darauf aufmerksam und ließ ihn von der Polizei verhaften. Nach einigen Tagen im Gefängnis wurde er zur Zahlung einer Strafe von 2500 US-Dollar verurteilt.
Noch im 18. Jahrhundert hatte der dänische Bischof Erik Potoppidan die Existenz von „Meermaiden“ beglaubigt und der dänische Anatom Caspar Bartholin diese Wassernixen zusammen mit den Menschen undAffen als „homo marinus“ klassifiziert. Nicht zufällig hat Kopenhagen an seiner Uferpromenade eine bronzene „Kleine Meerjungsfrau“ als Wahrzeichen aufgestellt.
Seeleute, sehnsüchtig, wieder an Land und unter Leute zu kommen, können die im flachen Wasser Seegras abweidenden Seekühe durchaus für Mischwesen, halb Frau halb Fisch, halten, denn, wie Steller schreibt: was dieses Thier von allen Thieren unterscheidet, das sind seine ganz besonderen Arme, oder Vorderfüsse, wenn sie so heißen sollen. Mit diesen umarmen sie ihr Junges, die Weibchen säugen sie an ihren zwei Brüsten, „jede liegt unter ihrem Arme, wie bey Menschen, und eben in solcher Gestalt.“
Die feministische englische Anthropologin Elaine Morgan wies 1982 (in: „The Aquatic Ape“) nach, dass die Frauen einst, nach Verlassen der Bäume, erstmalig Schutz vor ihren Feinden im Wasser gesucht hatten. Dort lernten sie den aufrechten Gang, die Schmackhaftigkeit der Meerestiere, bekamen eine glatte, unbehaarte Haut, veränderten sogar ihre weibliche Anatomie und wurden intelligent und verspielt. So wie im übrigen alle Säugetiere (und Vögel), die wieder zurück ins Wasser gingen: Delphine, Wale, Seekühe, Robben, Otter und Pinguine z.B.. Während die Menschenmänner dagegen quasi auf dem Trockenen hocken blieben – und dabei jede Menge Jäger-Idiotismen ausbildeten. Elaine Morgans feministische Studie endet jedoch versöhnlich: „Wir brauchen weiter nichts zu tun, als liebevoll die Arme auszubreiten und ihnen zu sagen“ (oder zu singen): „Kommt nur herein! Das Wasser ist herrlich!“
.
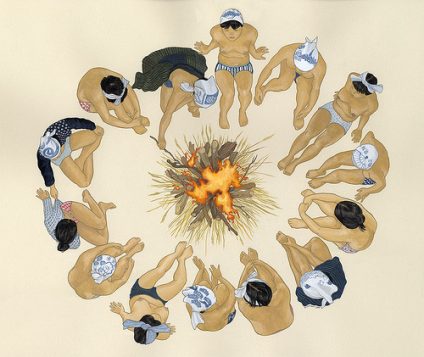
Japanische Muscheltaucherinnen
.
Die nach Muscheln und Algen tauchenden Haenyeo auf der Insel Jejudo nennt man in Korea „Meerfrauen“. Ihre Ausrüstung besteht seit den Siebzigerjahren aus einer Taucherbrille, Schwimmflossen, einem Neoprenanzug, einem Bleigurt, einer Harke zum Lösen der Meerestiere von Felsen, einem Netz zum Einsammeln des Fangs und einem Seil mit Boje, um ihren Standort zu markieren. Sie tauchen bis zu 20 Meter tief und können bis zu drei Minuten unter Wasser bleiben,“ heißt es in einer Reportage der „Welt“. Zwischendurch wärmen sie sich an Feuern, dass sie in windgeschützten Höhlen am Meer entzünden und essen Muscheln. „Meist hört man die Haenyeo schon, bevor man sie sieht. Denn beim Auftauchen stoßen sie den Sumbisori aus, einen lauten Pfeifton, der durch das Auspusten der Luft verursacht wird.“
Sie haben laut Wikipedia ein erweitertes Lungenvolumen und wie Wedellrobben nutzen sie die Milz als Sauerstoffreservoir. Beim Tauchen zieht sich das Organ zusammen, wodurch sauerstoffreiche rote Blutkörperchen in den Kreislauf gelangen und so einen längeren Tauchgang ermöglichen. Ihre Genossenschaft geht heute von noch etwa 5000 Taucherinnen aus, ihr Altersdurchschnitt liegt bei weit über 50. Auch bei ihnen werden die Fangquoten inzwischen streng kontrolliert. Sie sammeln neben Muscheln, Schnecken, Seegurken und Seeigel auch Algen, die sie trocknen und verkaufen. Ihre Insel gilt als matriachalisch organisiert.
Anders als die Haenyeo auf Jejudo tauchen die japanischen Muscheltaucherinnen, Ama, an einem Seil runter und hoch, bis zu 60 mal in der Stunde. Von den Ama wandern immer wieder welche als Arbeiterinnen in die Zuchtbetriebe für „Meeresfrüchte“ ab, zudem sind ihre Fanggründe überfischt und verschmutzt. In Korea und Japan wird die Algenart „Porphyra“ geerntet – und zu „Meeresgemüse“ verarbeitet, auch die im Westen beliebten „Sushi“ enthalten Algen. Aber nur die Japaner können sie auch verdauen, wie der Biologe Bernhard Kegel in seinem Buch über Mikroben – „Die Herrscher der Welt“ (2015) – schreibt. Denn nur sie, die fast täglich Algen essen, haben in ihrem Verdauungstrakt ein Bakterium namens „Bacteroides plebeius“, das ihnen die Enzyme zur Verfügung stellt, um die Kohlehydrate der Algen verdauen zu können, wobei dieses Bakterium die Enzyme nur produzieren kann, weil es vom algenfressenden Meeresbakterium „Zobellia gelactanivorans“ dazu „genetisch“ ausgestattet wurde. „Spannend ist die Frage, wann die Sushigene auch in amerikanischen und europäischen Därmen angekommen sein werden,“ meint Bernhard Kegel. Im Gegenzug fehlt den Japanern ein „Milchgen“ – zur Produktion des Enzyms Lactase, um Milch verdauen zu können. Ihre Lactoseintoleranz läßt jedoch nach.
Die in der Südsee lebenden Insulaner wurden von Weltumseglern wie Georg Forster und Adelbert von Chamisso als „Meervolk“ bezeichnet, weil sie oft und gerne ins Wasser gehen und ausgezeichnet schwimmen und tauchen können, wobei es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gab: Auf einigen Inseln fuhren die ersteren geschmückt und bewaffnet mit Begrüßungsgeschenken in Booten raus, mit denen sie sich den fremden Schiffen näherten, während die Frauen nackt rausschwammen. Nach Muschelperlen und Korallen tauchten beide Geschlechter.
Der russische Expeditionsleiter Adam Johann von Krusenstern schrieb über diese Meerfrauen in seinem Buch „Reise um die Welt“: Als ihr Schiff in der Südsee vor der Insel Nuka Hiwa ankerte kamen die Eingeborenen mit ihren Booten ans Schiff: „Mit Untergang der Sonne gingen jedoch alle Männer ohne Ausnahme wieder an Land. Mehr als 100 vom weiblichen Geschlechte blieben aber noch in der Nähe des Schiffs, um welches sie schon seit 5 Stunden herumschwammen.“ Nachdem es dunkel geworden war, baten „diese armen Geschöpfe in einem so jämmerlichen Tone, ins Schiff kommen zu dürfen, dass ich endlich die Erlaubnis dazu gab. Ich konnte auch desto eher in diesen Stücken nachsichtig seyn, da ich auf dem Schiffe nicht einen einzigen venerischen Kranken hatte, und Roberts [wahrscheinlich der Bordarzt] mir die Versicherung gab, dass diese Krankheit bis dahin auf dieser Insel nicht bekannt geworden wäre.“
Einen schönen Überblick über die ganzen Bearbeitungen des Nixen-Stoffes – von Paracelsus über die Romantiker bis zur amerikanischen Feministin Joanna Russ – bietet die Dissertation von Gerlinde Roth: „Hydropsie des Imaginären. Mythos Undine“ (1996). Sowie die Studie des Frankfurter Literaturwissenschaftlers Andreas Kraß, die 2010 erschien: „Meerjungfrauen. Geschichten einer unmöglichen Liebe“. Dieses literarische Motiv reicht bei ihm „von Homer über Andersen und Ingeborg Bachmann bis hin zu Disneys Arielle“. Außerdem gibt es noch einen Reader von Enn Vetemaa: „Die Nixen in Estland – ein Bestimmungsbuch“. Es erschien 1985 auf Deutsch, jedoch nicht aus dem Estnischen, sondern aus dem Russischen übersetzt, dafür aber mit zwei Nachworten auf Französisch und Plattdeutsch.
Neben dem berühmten Bild von Katsushika Hokusai „Kraken und Muscheltaucherin“ (1814) und vielen anderen Darstellungen von nackten Muscheltaucherinnen und lüsternen Kraken gibt es auch einen Photoband über japanische Muscheltaucherinnen
– von Yoshiyuki Iwase: „Bildnisse von Taucherinnen in Onjuku, Präfektur Chiba 1931-1964“ (Tokyo 2002).
Über die koreanischen Muscheltaucherinnen – Haenyeos – sind eine Vielzahl von wissenschaftlichen und journalistischen Veröffentlichungen erschienen, die meisten natürlich auf Koreanisch. Auf Youtube findet man jedoch fast 2000 Clips unter dem Stichwort „Haenyeo“, u.a. eine vierteilige Über- und Unterwasser-Dokumentation von Melissa Struben: „Haenjeo – Koreas Meerjungfrauen“.
.

Die Maori Wahine
.
Die Muscheltaucher in der Südsee, im Roten Meer und anderswo, die das Schnorcheln erfanden, sind sozusagen die Lehrmeister unserer Hobbytaucher. Aber bevor diese die Unterwasserwelt erkundeten, waren jene bereits zu bedauernswerten Geschöpfen herabgesunken. Nach der Eroberung des Azteken- und des Inkareiches durch die Konquistadoren Hernan Cortez und Francisco Pizzaro im frühen 16.Jahrhundert wurden die Indios zu Tausenden zum Goldgraben oder als Perlentaucher aus ihren Dörfern verschleppt. Ähnliches geschah auch auf den Karibikinseln. Der spanische Bischof Bartolomé de las Casas schreibt in seinem „Kurzgefaßten Bericht von der Verwüstung der Westindischen Länder”, der 1966 auf Deutsch veröffentlicht wurde: „Fast alle können diese abscheuliche Lebensart (Perlenfischerei) nur wenige Tage ertragen. Denn es ist schlechterdings unmöglich, dass Menschen, die ohne Atem zu schöpfen unter Wasser arbeiten müssen, lange leben können. Ihr Körper wird unaufhörlich von Kälte durchdrungen, ihre Brust wird vom häufigen Zurückhalten des Atems zusammengepreßt, mithin bekommen sie Blutspeien und Durchfall und sterben daran. Ihr Haar, das von Natur schwarz ist, bekommt eine ganz andere Farbe und wird brandrot, wie das Fell der Meerwölfe. Auf ihrem Rücken schlägt Salpeter aus; kurz, sie sehen wie Ungeheuer in Menschengestalt aus, oder doch wenigstens wie Menschen von einer ganz anderen Art. Durch diese unerträgliche Arbeit und wahre Höllenqual richteten die Spanier die sämtlichen Bewohner dieser Insel hin.“
Alles in allem soll die Eroberung Amerikas durch Weiße 50 Millionen Ureinwohnern das Leben gekostet haben. Im Nordwesten Australiens vernutzten die Weißen die Aborigines, die sie auf ihre Boote verschleppten und zum Tauchen nach Perlen zwangen. Die meisten starben nach zwei Jahren. Allein von der Perlenstadt Broome gingen Ende des 19. Jahrhunderts bis zu 3500 Taucher auf Muschelsuche. Bis zum Ersten Weltkrieg kam 70% des auf den Weltmarkt kommenden Perlmutts von dort. Der Krieg brachte jedoch die Erfindung des Plastikknopfs mit sich und damit brach die Nachfrage nach Perlmutt zusammen. In den niederländischen Kolonien, wo die Bedingungen für die einheimischen Taucher ähnlich grausam waren, ging die Regierung in Batavia (heute Djakarta) dazu über, Japaner und Chinesen ins Land zu holen, die mit einer Taucherausrüstung arbeiteten.
In Deutschland wurde die “Unterwasserwelt” durch den Taucher Hans Hass und seinen Haifilmen bekannt. Seine Tauchleidenschaft begann 1937 im Mittelmeer. Bereits zwei Jahre später kam sein erster Film in die Kinos: “Jagd unter Wasser mit Harpune und Kamera”. Nach dem Krieg unternahm er mit seiner Yacht “Xarifa 2” (die erste hatten ihm die Engländer beschlagnahmt), Expeditionen zu diversen Korallenriffen. Gelegentlich zusammen mit dem Verhaltensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeld. Beiden war daran gelegen, z.B. die “Raubtierinstinkte” bei Mensch und Tier zu erforschen. Aber während Hans Hass dabei ökonomisch dachte, Tauchsafaris anbot, Verbesserungen seines Tauchgeräts und seiner Kameras vermarktete und Haiabwehrtechniken ausprobierte, entwickelte Irenäus Eibl-Eibesfeldt seine “Humanethologie “ zu einem veritablen Institut der Max-Planck-Gesellschaft weiter. Nun soll es jedoch ebenso abgewickelt werden wie die Limnologische Flußstation in Schlitz, von der noch die Rede sein wird.
.

Muscheltaucherin
.
Das Genre “Unterwasserfilme” entwickelte dann vor allem Jacques-Yves Cousteau zu wahren Kassenerfolgen weiter, während die Tauchgeräte von dem Belgier Jacques Picard verbessert wurden. 1960 tauchte Picard mit einem kleinen U-Boot auf den Grund des sogenannten “Challengertiefs” im Marianengraben (zwischen Japan und Papua-Neuguinea) – fast 11000 Meter tief, tiefer ging es nicht. Cousteau war 1954 mit seiner Yacht “Calypso” u.a. im Persischen Golf unterwegs, an Bord befand sich der Regisseur Louis Malle. Er wollte in Dubeh die letzten Perlenfischer auf ihrem Boot filmen: “Die Taucher waren ältere, zerlumpt aussehende Männer. An den Perlengründen setzten sie Nasenklemmen auf, die aus einer Haifischwirbelsäule gemacht worden waren,” schreibt Cousteau in seinem Buch “Das lebende Meer” (1963)
Eibl-Eibesfeldt blieb trotz seines Interesses an großer Theoriebildung der Verhaltensforschung unter Wasser verbunden. In seinem Buch “Im Reich der Atolle” (1971) erzählt er u.a. kleine Beobachtungen – wie diese von einer Garnele, die in einer Sandhöhle mit einer Grundel in Symbiose lebte: Während die Garnele die Höhle ausbaute, paßte die Grundel am Eingang auf. “Bei der geringsten Störung verschwand sie in der Höhle und warnte so den kleinen Krebs, der offenbar sehr schlecht sieht.” In der Karibik hatte es Eibl-Eibesfeldt eine ähnliche Kooperation angetan: eine Putzerstation am Riff, wo Putzerfische ihre Kundschaft bedienen. Die Fische warteten geduldig, bis sie dran kamen – und die Putzfische sie von lästigen Parasiten befreiten. Sie schwammen dazu sogar durch deren Kiemen und ins Maul.
Es gibt jedoch auch Putzerfische, die sich an den Kunden selbst vergreifen wollen. Sie sind jedoch keine echten, sondern Schleimfische, die das Aussehen von Putzerfischen angenommen haben. Auf diese ihre “Mimikry” spezialisierte sich der Zoologe Wolfgang Wickler, Sein Hauptwerk “Mimikry. Nachahmung und Täuschung in der Natur” erschien 1971. Eibl-Eibesfeldt hockte derweil mit Atemgerät unter Wasser und zählte: Die echten Putzerfische bedienten in sechs Stunden über 300 Kunden. Der Andrang war enorm.
Im Aquarium – mit nur wenigen Fischen, u.U. sogar ohne Parasiten, werden ihnen dagegen die Putzerfische manchmal lästig. Eibl-Eibesfeldt schreibt über seine Taucherlebnisse auf den Malediven: “Bereits nach wenigen Tagen kannte ich eine Reihe von Fischen persönlich. Mit einem gefleckten Zackenbarsch schloß ich bald Freundschaft.”
.

.
Ein ähnliches Zusammentreffen mit einem Barsch hatte auch die Innsbrucker Verhaltensforscherin Ellen Thaler. Sie taucht regelmäßig an Korallenriffs, zudem hat sie im Institut und zu Hause Meeresaquarien. Auf den Seychellen stieß sie 1992 beim Tauchen im Vorriff auf einen fast drei Meter großen Zackenbarsch. Beide bewegten sich nicht, aber Ellen Thaler blätterte hastig in ihrem Bestimmungsbuch, in dem der Eintrag “Bisher keine Übergriffe auf Taucher bekannt” sie beruhigte. Der Barsch wurde in Ruhe von ein paar Putzlippfischen bedient, nach etwa einer halben Stunde ließ er sich einfach sinken und entschwand ihrem Blick. Aber an der nämlichen Stelle traf sie ihn danach noch viele Jahre wieder. Von einer “Freundschaft” würde Ellen Thaler dabei jedoch nicht so leichthin wie Eibl-Eibesfeldt gesagt haben. 2010 wurde ihr Barsch “zu Tode geangelt”, wie sie in ihrer Sammlung von Reiseberichten: “Die Stunde des Chamäleons” (2013) schreibt, die sie zuvor als Kolumnen in der Aquaristik-Zeitschrift “Koralle” veröffentlicht hatte: Darüberhinaus stellte sie 2008 eine ganze “Koralle”-Ausgabe über “Doktorfische” zusammen. Zuvor, 1995, hatte sie ein üppiges Buch mit dem Titel “Fische beobachten” veröffentlicht. Im Vorwort heißt es: “Ich will zeigen, dass bei all dem umfassenden Wissen über Technik und Systematik allzu oft etwas Wesentliches auf der Strecke bleibt: nämlich die Koralle, der Krebs, hier, die Muschel dort und schon gar der Fisch, das Individuum also, an dem wir unsere helle Freude haben sollten!” Ihre erste diesbezügliche “Prägung”, im thailändischen Phuket tauchend, bekam sie durch einige Grundeln. Seither gehören diese Barschverwandten zu ihren Lieblingsfischen. “Alles war neu, alles war unbeschreiblich. Nach einer Woche erst war ich in der Lage, Fische wirklich zu beobachten, zu bestimmen und nicht nur hingerissen zu bestaunen.” Die meisten Berichte in ihrem Buch beziehen sich indes auf Erfahrungen mit ihren Aquariums-Fischen – bis hin zu Pflegetipps.
.

.
Die Erlebnisse und Berichte vieler, auch berühmter Taucher werden gerne als Meeresforschung ausgegeben, auch von ihnen selbst, dabei handelte es sich meist um Unterwassertechniker und Sporttaucher, die vor allem daran interessiert sind oder waren, Tiefenrekorde aufzustellen oder möglichst große Fische mit der Harpune zu erlegen. Manche dieser Männer, deren Jagdgründe in den tropischen Gewässern immer unergiebiger geworden waren, wandelten sich im reifen Alter zu engagierten Umweltschützern. Der Marinebiologe Trevor Norton hat 2001 ein Dutzend dieser Männer in seinem Buch “In unbekannte Tiefen – Taucher, Abenteurer, Pioniere” porträtiert.
Darunter Louis Marie-Auguste Boutan. Er war alles drei: Als Student “sprang er in der Torresstrasse (zwischen Neuguinea und Australien) mit einheimischen Perlentauchern ins Wasser und sah zum ersten Mal den Reichtum der tropischen Meere,” schreibt Norton, der es eigentlich besser wissen müßte: Ihre Artenvielfalt verdanken die Korallenriffe gerade der Armut an Nährstoffen – ähnlich ist es bei den tropischen Regenwäldern. Die These: “Je nährstoffreicher eine Region desto weniger Arten” – des Münchner Ökologen Josef Reichholf, die er in seinem Buch “Der unersetzbare Dschungel” (1991) veröffentlichte, ist mittlerweile unbestritten.
Boutan bastelte sich Tauchausrüstungen, eine Unterwasserkamera und ein Blitzlichtgerät. Daneben experimentierte er mit Ohrmuscheln – Seeohren genannt. Deren Schale ist mit einer dünnen Haut, einem Mantel, ausgekleidet. Ihm kam die Idee, dass dieser Mantel jedes Objekt, das ihn berührt, mit Perlmutt überzieht. Er bohrte ein winziges Loch in eine Seeohrschale, ohne den Mantel zu verletzen und platzierte ein Muschelstück zwischen Schale und Mantel. Innerhalb weniger Monate wurde aus diesem “Samenkorn” eine leichte Wölbung aus Perlmutt. Boutan schloß daraus, dass jede Muschel, die ein solches, Perlmutt absonderndes Gewebe besaß, Perlen produzieren könne. Ausgehend von dieser Überlegung ließ sich eine Zuchtperlen-Farm einrichten. Davon versuchte er den Generalgouverneur von Indochina zu überzeugen, aber nichts geschah. Ab 1898 veröffentlichte er 18 Artikel über sein “Projekt”. Ein japanischer Nudelhersteller, der selbst versucht hatte, Perlen zu züchten, war der einzige, der den Wert von Boutans Überlegungen erkannte. 1920 kamen dessen Zuchtperlen auf den Markt, man konnte sie nicht von “echten” unterscheiden. Das Perlenkartell war entsetzt, es behauptete, der Markt würde mit “nachgemachten” Perlen überschwemmt. Man verhaftete den Perlen-Importeur und stellte ihn vor Gericht, Boutan wurde als Zeuge geladen. “Die Zuchtperle, erklärte er, sei genauso natürlich wie die ‚wild‘ gewachsene, die Auster kümmere es wenig, ob der Fremdkörper auf natürliche Weise oder durch Menschenhand in sie hinein gelange. Das Gerichtsverfahren machte Boutan berühmt, bereitete aber der Pariser Vorliebe für Perlen ein Ende,” schreibt Trevor Norton. 1924 wurde Boutan in Algerien Direktor einer Forschungsstation für Fischzucht und Fischereiwesen. Dort entwickelte er Verfahren zur Zucht von Austern, Eßmuscheln und Garnelen sowie Methoden, wie diese lebend nach Frankreich gebracht werden konnten.
.
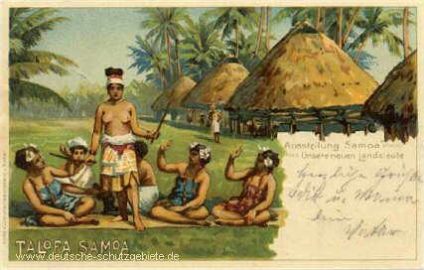
.
In den europäischen Süßwasser-Gewässern lebt die Flussperlmuschel, sie ist vom Aussterben bedroht. Nicht zuletzt deswegen, weil ihre Frühform als Wirt die Bachforelle benötigt, in deren Kiemenbereich sie zehn Monate parasitisch lebt. Dort wächst sie zu einer Jungmuschel heran, die sich etwa im Mai auf den Gewässergrund fallen läßt und sich eingräbt. Erst nach etwa sieben Jahren, im ausgewachsenen Stadium und mit der inzwischen gebildeten harten Schale, kommt sie an die Oberfläche des Gewässergrundes, wo sie dann den Rest ihres Lebens weitgehend stationär verbringt. In der Strömung läßt sie, gerne in Kolonien, das Wasser durch ihre Kiemen fließen und filtert dabei Nahrungsteile heraus. Mit Glück und wenn man ihr genug Zeit läßt, sie kann bis zu 280 Jahre alt werden, produzieren manche eine Perle. In der Rhön, im Vogelberg und im Odenwald mit ihren vielen Flüßchen und Bächen, wo sie noch bis 2008 nachgewiesen wurde, kam bis etwa 1680 bei den „hohen Herren“ immer wieder eine gewerbsmäßig betriebene Perlfischerei ins Gespräch. In der Regionalgeschichte „Vogelsberg“ (1984) heißt es dazu: „Von 30 bis 40 Muscheln, die man öffnen ließ, waren fünf bis sechs dabei, die Körner enthielten, seltsamerweise dann immer gleich zehn bis zwölf; große runde Perlen waren allerdings nicht darunter, wenn sie mal etwas größer gerieten, dann waren sie ganz schlimm und schepp, ‚gleichsam wie in einem Pläßchen liegend‘. Überhaupt hätten die Perlen bald nach dem Herausnehmen immer gleich ihre schöne weiße Farbe verloren. Trotzdem wollte die Regierung zunächst die Perlfischerei ‚in die Heeg schlagen‘, also dieses Recht als besondere Gerechtsame wie Jagd, Fischerei und Ähnliches ausdrücklich beanspruchen und pekuniär auswerten. Jedoch der Kellereiverwalter riet ab: die Fischerei sei für zwölf Gulden verpachtet, die Pächter würden sich in ihren Fischereirechten benachteiligt fühlen, außerdem würde sich eine besondere Perlfischerei nicht lohnen. Am 1.Oktober 1680 wurde verfügt, dass die Pächter die Muscheln, die sie aufgelesen hätten, bei hoher Strafe [u.a. Abhacken der Hand] nicht veräußern dürften, sondern abliefern müßten.“
Noch eine Bemerkung zu den Meeressäugetieren…Das kleine sibirische Volk der Niwchen auf Sachalin geht davon aus, dass ihre Urmutter eine Meerfrau war. Vielleicht haben die Stellerschen Seekühe sie darauf gebracht. Die Tschukschen und Inuit am Arktischen Meer auf der nördlichen Seite Sibiriens erzählen, dass sie aus einer Verbindung von einer Frau und einem Wal hervorgegangen sind. Der Schriftsteller Jurij Rytcheu berichtete davon in seinem 1995 erschienenen Roman „Wenn die Wale fortziehen“, in dem er verdeutlichte, was das Immer-seltener-werden und schließliche Verschwinden der großen Meeressäuger für seine Leute, die Tschukschen und Inuit, hieß.Daneben veröffentlichte er 2004 auch die Biographie eines Walfängers – unter dem Titel: „Der letzte Schamane“. Dabei handelt es sich um seinen Großvater Mletkin aus der Siedlung Uelen – an der Spitze der Tschukschen-Halbinsel vis à vis von Alaska. Mletkin sprach mehrere Sprachen und arbeitete wie andere Tschukschen auch auf amerikanischen Walfangschiffen. In Alaska lernte er den Kurator eines Museums für Naturgeschichte kennen, der sich auf einer Sammelexpedition für die Weltausstellung in Chicago 1893 befand. „Der Anthropologe malte vor Mletkin ein zukünftiges Weltdorf aus…und er versprach ihm viel Geld, einfach dafür, dass er vor den Besuchern auf einer grünen Wiese saß,“ heißt es in Rytcheus Buch. Mletkin willigte ein, mit zu kommen. In Chicago mußte er jedoch eine alte zerschlissene „Schamanenkleidung“ tragen – „und vor allem rohes Fleisch essen“. Einmal begrüßte ihn der US-Präsident, Mletkin grüßte höflich zurück. „’Sie sprechen Englisch?‘ fragte der Präsident und schaute dabei fragend in die Runde. ‚Wie das? Mir wurde gesagt, Sie sind ein Wilder!’“ Auch die Chicagoer Presse bezweifelte, dass es sich bei dem Schamanen und einen „reinrassigen Tschukschen“ handele – er sei bereits zu sehr „von der Zivilisation verdorben“. Man sprach sogar von „Fälschung“. Mletkin mußte lachen, als er das las, aber langsam machte ihn das alles doch traurig: Die Journalisten, die ihn interviewten, interessierten sich nur für den „Frauentausch“ der Tschukschen und die Besucher warfen ihm „wie einem Tier Münzen zu“. Der Anthropologe versuchte ihn aufzuheitern: „Du hast großen Erfolg…Du bist die Sensation der Ausstellung. Wir sind stolz auf Dich….Das Publikum ist zum größten Teil wild und ungebildet. Du musst ihnen verzeihen.“ Nach einigen „Schamanenvorstellungen“ stieg Mletkins Ruhm noch, aber gleichzeitig konnte er nun manchmal kaum noch seine Wut zurückhalten. „Am schlimmsten waren die Kinder“: Sie bewarfen ihn mit Süßigkeiten und schrien „Nimm! Nimm!“. Mletkin wäre am Liebsten mit seinem Messer, mit dem er das gekochte Fleisch schnitt, auf sie losgegangen. Als die Weltausstellung zu Ende ging, war Mletkin heilfroh. Er nahm sein Geld, kaufte sich einen Anzug und einen Lederkoffer und fuhr nach San Francisco, wo er sich in eine Afroamerikanerin, der Schwester seines verstorbenen Freundes, verliebte. Bei ihr blieb er einige Jahre. Mit einer anderen Expedition fuhr er danach zurück in seinen Heimatort Uelen an der Beringstrasse, wo er dem Enkel Jurij Rytcheu seine Erlebnisse erzählte.
.

.
Über die Wale dort veröffentlichte 1824 der spätere Kustos am Berliner Botanischen Garten, Adelbert von Chamisso, eine wissenschaftliche Abhandlung, nachdem er zusammen mit einem weiteren Naturforscher und einem Maler an der russischen „Rurik-Expedition“ teilgenommen hatte, die von 1815 bis 1818 die Nordwestpassage – den Seeweg nördlich des amerikanischen Kontinents zwischen dem Atlantischen und dem Pazifischen Ozean – erkunden sollte. Ihre Leitung hatte Otto von Kotzebue. Der Sohn eines damals berühmten Dramatikers hatte 1803 als 16jähriger bereits an der russischen Weltumseglung des Kapitäns Adam Johann von Krusenstern teilgenommen. Diese sollte vor allem den russischen Fernosthandel stärken. Sowohl Krusenstern als auch Kotzebue veröffentlichten anschließend interessante Reiseberichte. Vor allem hatten es ihnen die Südsee-Insulaner – auf Hawaii und den Marshallinseln – angetan. Die Französische Revolution zeigte dergestalt Wirkung, dass sie meinten, dort den Rousseauschen „Edlen Wilden“ sozusagen leibhaftig kennengelernt zu haben.
Otto von Koetzebues Reisebericht bekam auf Deutsch den Titel „Zu Eisbergen und Palmenstränden“ (2004). Über die Südseeinseln heißt es bei ihm: „wir schwelgten im Genuss dieser paradiesischen Natur“. Krusenstern schreibt in seinem Buch „Reise um die Welt in den Jahren 1803-1806“: Die Bewohner der Sandwich- Inseln (Hawaii) und der Washington-Inseln (Nukahiwa) werden von keinen andern an körperlicher Schönheit übertroffen.“ Es sei dies dort jedoch „kein Vorzug, den die Natur nur den Vornehmen gewährt, sie ist hier ohne Ausnahme einem jeden verliehen. Die mehr gleiche Vertheilung des Eigenthums mag wohl den Grund dazu legen. Der noch wenig aufgeklärte Nukahiwer erkennt in der Person seines Königs noch nicht den Despoten, für den allein er seine besten Kräfte aufopfern muß…Die geringe Autorität lässt ihm mehr Freiheit zur Arbeit und gewährt ihm den freien Besitz des Landes, so dass ein jeder mit sehr geringen Einschränkungen daran Theil haben kann.“
Auch Adelbert von Chamissos Bericht „Reise um die Welt“, zuletzt 1985 in der DDR veröffentlicht, zeugt von dieser Sichtweise. Vom Flensburger Botaniker Wilfried Probst erschien 2014 eine Biographie, in der der Autor die heutige Situation aller Inseln und Orte, die Adelbert von Chamisso besucht hatte, im Internet recherchierte. In seinem Text über den Wal schlägt sich Chamissos Humanismus und seine Modernität dergestalt nieder, dass er das Wissen der Eingeborenen, auf den Aleuten z.B., nicht mehr ignoriert, sondern übersetzt, d.h. in die westliche Wissenschaft einführt: die lokalen Walnamen und -kenntnisse werden dabei ins Internationale transponiert. Den Walen nützte das damals jedoch wenig, sie wurden mit immer raffinierterer Technik und von immer mehr Walfangflotten verfolgt. Erst die Förderung und Verbreitung des Erdöls ersetzte den Waltran als Lampenöl. Und dieses wurde dann von der elektrischen Beleuchtung abgelöst. Desungeachtet war der Ethnologe Claude Lévy-Strauss noch 1983 davon überzeugt, “So lange es KZs für Wale gibt, wird es auch welche für Menschen geben.”
Schon vor der Französischen Revolution hatte der Schriftsteller Georg Forster 1772 als 17jähriger zusammen mit seinem naturforschenden Vater an der „2. Südseereise“ des englischen Kapitäns James Cook teilgenommen, die zwar die Gewässer der Antarktis erforschen sollte, weil man dahinter einen weiteren Kontinent vermutete, aber dann vornehmlich zwischen den Südseeinseln gekreuzt war. Forsters radikaler Humanismus, der ihn in der kurzen Mainzer Republik zum politischen Engagement trieb, begeisterte ihn vor allem für die freie Lebensweise der Eingeborenen auf Tahiti, wie man seinem von Goethe und Lichtenberg gelobten Bericht „Reise um die Welt“ entnehmen kann, der 1779 auf Deutsch erschien.
Erwähnt sei noch Cooks erste dreijährige Südsee-Expedition: Sie begann 1768 und wurde auf Empfehlung der Royal Society unternommen, um im Rahmen einer international angelegten Messkampagne den Durchgang des Planeten Venus vor der Sonnenscheibe – den Venustransit 1769 – auf Tahiti zu beobachten.
Cooks dritte Weltumseglung von 1776 bis 1780 wurde zur Erkundung der Nordwestpassage unternommen. Gleichzeitig sollte der Vorzeige-Polynesier Omai– der auf der zweiten Reise aus Huahine mitgekommen und zum beliebten „Edlen Wilden“ der Londoner Gesellschaft avanciert war – wieder in seine Heimat zurückgebracht werden. Schon bei seiner ersten Südseereise hatte Cook vor der Anlandung auf Tahiti seiner Mannschaft befohlen, „sich auf jede anständige Art und Weise um Freundschaft mit den Eingeborenen zu bemühen und sie mit aller erdenklichen Freundschaft zu behandeln.“ Ferner durften die bei den Südseeindianern besonders begehrten Eisenstücke, eisernen Gegenstände und Kleidungsstücke nur gegen Lebensmittel eingetauscht werden – nicht gegen Liebesdienste z.B..
.
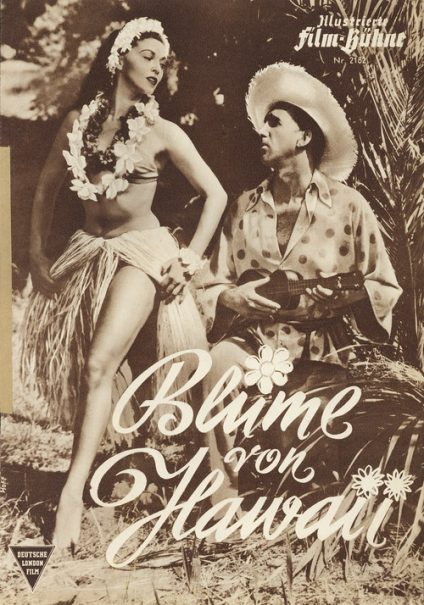
.
Den Engländern war das Eigentum heilig, deswegen wurde auf die Eingeborenen sofort geschossen, wenn sie ihnen etwas stahlen. Dazu gehörte, dass sie kein Eigentum und nur den Gabentausch, die Engländer aber vor allem den Warentausch kannten (um z.B. Proviant und wertvolle tropische Produkte einzuhandeln). Den einen ging es dabei um Erwiderung, den anderen um Gleichwertigkeit. Es kam noch hinzu, dass für die Europäer die Arbeit Fron war, aber begehrenswerte Tauschwerte hervorbrachte, während bei vielen sog. “Wilden Völkern” der Gebrauchwert ihrer Arbeit die Arbeitslust war. Das Gabentauschprinzip äußerte sich z.B. bei den Südseeinsulanern darin, dass sie als Begrüßungsgeschenke einfach von ihren kleinen Booten aus Früchte, Fische, Schweine, Hühner zum großen Segelschiff hochreichten – und dann eine ebenso freundliche Erwiderung erwarteten. Dadurch entstanden nicht selten Mißverständnisse, die von den Europäern nur allzu oft gewaltsam entschieden wurden. Das geschah 1779 auch auf Hawaii – als Cook dort einen Häuptling sogar als Geisel nehmen wollte, um Gestohlenes wieder zu bekommen. Dabei kam es zu einem offenen Kampf zwischen den Einheimischen und den mit Gewehren und Bordkanonen ausgerüsteten Seeleuten – in dessen Verlauf James Cook starb. Als Georg Forster von seinem Tod erfuhr, veröffentlichte er einen langen Nachruf auf „James Cook, den Entdecker“, er erschien 2008 auf Deutsch zusammen mit 8 von Forster angefertigten Farbtafeln tropischer Vögel. 1987 hatte Klaus Harpprecht eine ausführliche Biographie veröffentlicht: „Georg Forster oder die Liebe zur Welt“. Im Nachwort heißt es dort:„Das Bild des Revolutionärs verdunkelte die Erinnerung an den Weltumsegler. Doch er hatte mit seinen Erzählungen von Tahiti einen Traum in die Herzen der Deutschen gesenkt.“
Diese wollten dann auch gleich los – und dort Kolonien gründen. Ähnlich erging es den Franzosen. Hier war es vor allem Louis Antoine de Bougainville, der 1768 Tahiti und einige weitere polynesische Inseln bei seiner Weltumseglung sofort für Frankreich in Besitz nahm. Tahiti benannte er in „Neu-Kythira um – zur Erinnerung an das alte Kythira: Aphrodites „Liebesinsel“. Bougainville hatte seine Assistentin als Mann verkleidet an Bord geschmuggelt. Auf dem Rückweg brachte er den Sohn eines Stammesfürsten als ersten Polynesier mit nach Frankreich. Sein Bericht „Reise um die Welt“ wird auf Deutsch immer wieder neu verlegt. „Französisch-Polynesien“ ist auch heute noch eine Kolonie, dort auf dem Atoll Mururoa fanden ab 1966 die französischen Atomwaffentests statt. Als es deswegen 1995 zu schweren Unruhen auf Tahiti kam, dem sich ein weltweiter Protest anschloß, wurden die Versuche eingestellt.
.
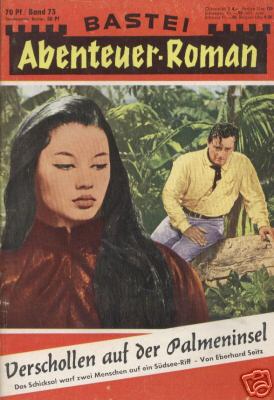
.
Als nächstes unternahm der Fregattenkapitän Louis Desaulces de Freycinet 1817 mit einigen Wissenschaftlern an Bord eine dreijährige Südsee-Expedition. Er schmuggelte seine Frau Rose in Männerkleiden mit aufs Schiff. Nachdem man sie als Frau erkannt hatte, machte sie sich dort nützlich. Als erste „Dame an Bord“ sorgte sie unterdes in Frankreich für einen kleinen Skandal, der jedoch überraschenderweise keine nachteiligen Folgen für ihren Mann hatte. Während er nach der Reise weitgehend von der Veröffentlichung des mehrbändigen Expeditionsberichtes in Anspruch genommen war, der laut Wikipedia die Kapitel Sprachstudien, Zoologie, Botanik, Pendelbeobachtungen, Beobachtungen des Magnetismus, Meteorologie und Hydrographie umfasste, veröffentlichte Rose de Freycinet ihr „Tagebuch einer Reise um die Welt“, auf Deutsch erschien es 2011. Über ihre positive Rolle auf dem Schiff berichtet sie weniger als über die Garderoben auf den Empfängen und Bällen. Bei fast jedem Landgang wurden ihr Mann und sie von Gouverneuren, Botschaftern und Honoratioren eingeladen, und umgekehrt wurden diese zu Empfängen auf Freycinets Schiff „Uranie“ gebeten. Man tauschte Salutschüsse aus und brannte Feuerwerke ab.
Der Norden wurde zur selben Zeit ebenfalls mit wissenschaftlichen Expeditionen erforscht. Der Naturforscher und Geograph Peter Simon Pallas leitete zwischen 1768 und 1794 gleich mehrere durch Rußland und Sibirien. Er war Mitglied der russischen Akademie der Wissenschaften, die damals fast von deutschen bzw. deutsch-baltischen Wissenschaftlern dominiert wurde; seine sogenannten „Akademie-Expeditionen“ wurden von Katharina der Großen gefördert. Pallas interessierte sich unterwegs für alles: Flora, Fauna, Gewässer, Gebirge, Siedlungen und Völker – ihre Sitten, ihre Feinde und ihre Ökonomie. Sie waren großteils bereits von Rußland unterworfen und infolge ihrer Ausbeutung und der dabei eingeschleppten Krankheiten dezimiert worden, wie Pallas feststellte, aber es gab sie noch. Pallas beschrieb ihre Lebensweise ohne westliches Ressentiment.
Seine Expeditionsberichte umfassen mehrere tausend Seiten. Da viele der von ihm bereisten Völker vor allem vom Fischfang und der Jagd lebten (die Felle aus Sibirien waren Russlands fast einziges Exportgut – und Gold wert), wurden diese beiden Erwerbszweige bei Pallas ausführlich behandelt. Ich beschränke mich auf zwei seiner Darstellungen des Fischfangs. Am Uralfluß wird dieser von ortsansässigen Kosaken betrieben, die dort in Dörfern zur Grenzsicherung gegen räuberische Überfälle eingesetzt sind. Sie haben eine streng-nachhaltige Bewirtschaftung des Flusses organisiert. Fische sind ihre Hauptnahrung und die Fischerei ihre Hauptbeschäftigung – neben dem Wachdienst an der sogenannten „Linie“, wie Pallas schreibt. Mir lag die 1987 in Leipzig erschienene, stark gekürzte Fassung seiner „Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches“ aus dem Jahr 1771 vor. Danach ist der Fischfang der Uralkosaken „durch Gewohnheitsgesetze so genau und so wohl eingeschränkt und angeordnet“ wie nirgendwo sonst in Russland. Es wird nur drei Mal im Jahr gefischt. Der wichtigste Fang ist im Januar mit Haken – an aufgeschlagenen Eislöchern. Der zweite, im Mai und Juni, und der dritte, „wenig beträchtliche“ Fang im Herbst, geschieht mit Netzen. Man könnte laut Pallas noch eine vierte Fangzeit zur Nikolauszeit dazuzählen, die jedoch nur in den Nebenflüssen und fischreichen Seen stattfindet und allein dem „häuslichen Verbrauch“ dient.
.
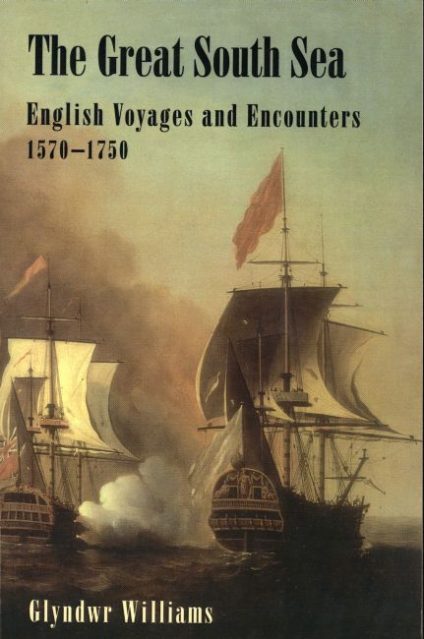
.
Im Ural werden mehrere Sorten Störe und Weißlachse sowie die minderwertigen Zander, Hechte, Zingelbarsche und viele kleine „Schuppenfische“ gefangen. Die Störe kommen Ende April in solchen Scharen zum Laichen aus dem Kaspischen Meer hoch, dass sie einmal sogar ein durch den Fluß gezogenes Wehr zu durchbrechen drohten, man war gezwungen, die Fische mit Kanonenschüssen zu verjagen, so wurde es Pallas erzählt, er hielt dies jedoch für eine „Sage“. Beim Hakenfischen müssen alle Kosaken, die einen Berechtigungsschein haben, täglich im Morgengrauen mit ihren Schlitten und ihren Fanggeräten antreten. Dann wird mit zwei Kanonenschüssen das Signal gegeben, zu der „festgesetzten Gegend“ zu eilen. Dort wird noch einmal mit Schüssen ein Signal gegeben, woraufhin jeder sich sein Eisloch aufhaut – und zwar nur auf einer Hälfte des Flusses, die andere dient den Fängen im Frühling und Herbst vom Boot aus – mit Netzen, die im übrigen eine Maschenweite von etwa 15 Zentimeter haben. Die Störsorten werden sowohl als Fisch als auch Rogen sofort den Kaufleuten übergeben, beides wird nach Gewicht bezahlt. Den besten Kaviar schickt man an den Hof der Zarin. Die „schlechten Fischsorten“ werden gesalzen oder getrocknet. Die Uralkosaken haben, wie Pallas schreibt, „die beträchtliche Freiheit, sich das Salz, das sie auch für die Kaviaraufbereitung brauchen, selbst zu besorgen, großenteils aus zwei Seen auf der kirgisischen Seite des Grenzflusses.
Am Ob, der in den Arktischen Ozean mündet, studierte Pallas den Fischfang der damals noch heidnischen Ostjaken, Chanten heute genannt. Ihre Methoden sind denen der Uralkosaken in gewisser Weise entgegengesetzt, weil sich die Fische hier im Winter aus dem „stinkenden Flußwasser“ zurückziehen und sich an den Bachmündungen versammeln. Dort fangen die Ostjaken sie mit Fischreusen. Daneben kommen nicht selten Belugawale den Ob hoch, den sie ebenso jagen wie die Samojeden, die man heute Nenzen nennt. Beider Jagdmethode hat Pallas nicht kennen gelernt, wohl aber das Innere und Äußere eines Belugawals, und zwar ausführlich, um sich davon zu überzeugen, dass es sich zum Einen um ein Säugetier und zum Anderen um eine bereits von „Grönlandfahrern“ bekannte Art handelt, die überdies schon von seinem Akademiekollegen Gmelin und dem Kollegienrat Müller beschrieben wurde.
.

.
Diese beiden Naturforscher waren Teilnehmer der sogenannten Großen Nordischen Expedition von 1733 bis 1743“ gewesen. Sie wird auch „Die Zweite Kamtschatka-Expedition genannt. An ihr nahm u.a. ein Adjunkt der russischen Akademie der Wissenschaften, Georg Wilhelm Steller, teil. Er reiste im Gegensatz zu Gmelin und Müller mit auf dem Schiff des dänischen Kapitäns Vitus Bering, der nach der ersten auch diese zweite „Kamtschatka-Expedition“ leitete. Beide Male ging es ihm u.a. um die Erforschung der Meerenge zwischen der sibirischen Tschukschen-Halbinsel und Alaska. Bering fand sie auch, allerdings wurde sein Schiff wenig später schon vom Eis auf eine kleine Insel westlich von Kamtschatka gedrückt, wo die Mannschaft überwintern mußte. Bering starb dort an Entkräftung, die Insel wurde später nach ihm benannt, ebenso die Meerenge: die „Bering-Straße“.
Von Alaska hatten die mitreisenden Forscher nur eine vorgelagerte Insel erkunden können – und das auch nur einen halben Tag. Der junge Biologe Georg Wilhelm Steller schimpfte in seinem Bericht „Von Sibirien nach Amerika. Die Entdeckung Alaskas mit Kapitän Bering“, der 1793 von Peter Simon Pallas veröffentlicht wurde, dass die „zehn Stunden“, die er in Alaska botanisieren durfte (und dabei immerhin 160 Pflanzen botanisierte) zehn Jahre Vorbereitung gebraucht hatten, an der insgesamt 3000 Menschen beteiligt waren. Sofern sie zu den unterworfenen sibirischen Völkern zählten – nicht immer freiwillig. Selbst auf der Beringinsel verstand es Steller „neben all den Strapazen und Gefahren, die der Überlebenskampf dort mit sich brachte, seine naturkundlichen Beobachtungen fortzusetzen“, heißt es auf Wikipedia. Als die Überlebenden endlich Kamtschatka erreichten, blieb Steller dort und erforschte einige weitere Jahre die Halbinsel sowie die Lebensgewohnheiten der Kamtschadalen. Er starb auf dem Rückweg nach St. Petersburg in Tjumen.
Nach der Revolution 1917 häuften sich die wissenschaftlichen Expeditionen in den Norden Russlands. Erwähnt sei die des rußlanddeutsche Mathematikers und Polarforschers Otto Julewitsch Schmidt. Als wissenschaftlicher Expeditionsleiter gelang ihm 1932 mit dem Eisbrecher „Sibirjakow“ unter Kapitän Wladimir Woronin erstmals die Fahrt durch der in Russland „Nördlicher Seeweg“ genannten Nordostpassage – zwischen dem Weißmeer und der Beringstraße, in einer Navigationsperiode innerhalb von 223 Tagen. Danach war Schmidt von 1932 bis 1939 Leiter der neugebildeten Hauptverwaltung Nördlicher Seeweg. 1933 leitete er die Tscheljuskin-Expedition, die es von Leningrad nach Wladiwostok schaffen sollte. Dabei wurde ihr Schiff, die „Tscheljuskin“, in der Beringstraße vom Eis eingeschlossen und zerdrückt. Einen Monat mußte die Mannschaft auf einer Eisscholle ausharren, bis sie von Polarfliegern gerettet wurden. Es gibt darüber einen von 39 Expeditionsteilnehmer verfaßten Bericht: „The Voyage of the Chelyuskin“ (1935) und einen Film von Christian Klemke und Christoph Schmidt: „Rote Arktis – die Eroberung des Nordpols“ (2014).
Otto Julewitsch Schmidts Nachfolger in der Leitung der Hauptverwaltung Nördlicher Seeweg wurde der Polarforscher Iwan Papanin. Er führte 1936 eine Expedition durch, die eine Eisdriftstation am Nordpol einrichten sollte. Diese driftete dann 274 Tage an der Ostküste Grönlands entlang. 1948 ließ Papanin das erste sowjetische Forschungsschiffe bauen – die „Witjas“, auf der in der Folgezeit fast alle sowjetischen Ozeanologen ausgebildet wurden.
1951 begutachtete Papanin eine biologische Station am Oberlauf der Wolga. Dort, bei Rybinsk, was Fischstadt heißt, war Europas zweitgrößter Staudamm gebaut worden, wobei der Stausee zwei Städte und 700 Siedlungen überflutet hatte. Auf dem See entstand eine nach „Darwin“ benannte Naturschutzinsel. Papanin votierte dafür, in die Station zu investieren statt sie zu schließen – und wurde schließlich ihr Leiter, bis zu seiner Pensionierung. Als wissenschaftlichen Leiter holte er sich den nach Kasachstan verbannten Biologen Boris Kusin. Die Station heißt heute „Papanin Institute of Inland Waters, Academy of Science, Borok“. In seinen „Erinnerungen: Eis und Flamme“, die 1981 auf Deutsch erschienen, erzählt Papanin, dass sie bei ihrem Vorhaben, die Fischzucht und -Fangergebnisse in den Stauseen der Mittleren Wolga zu verbessern, mit den Interessen der dortigen Fischereikolchosen kollidierten, die, um ihren Plan schnell und kräftesparend zu erfüllen, ausgerechnet in der Laichzeit rund um die Uhr, dazu noch mit äußerst engmaschigen Netzen, arbeiteten, was ihnen dann von den Wissenschaftlern verboten wurde: Seine Mitarbeiter gingen zur Kontrolle ihrer Anordnungen selbst auf Patrouille.
.
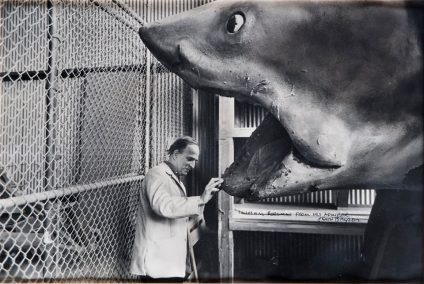
.
Boris Kusin war Lamarckist, d.h. er setzte auf die Vererbung von Umwelt-Erfahrungen statt wie Darwin auf eine Selektion zufälliger Mutationen. Dafür konnte er u.a. auch den Dichter Ossip Mandelstam in einer armenischen Teestube begeistern. Mandelstam verkündete hernach: „Ich habe mein Schach von der Literatur auf die Biologie gesetzt, damit das Spiel ehrlicher werde.“
Ein Gegenstück zu der am Station Borok am Rybinsker Stausee wäre die vielleicht kleinste limnologische Forschungsstation. Sie gehört der Max-Planck-Gesellschaft und befindet sich in Schlitz bei Fulda. Dort wird ein kleiner Fluß erforscht: den kaum einen Meter breiten und vier Kilometer langen Breitenbach. „Das besondere am Breitenbach ist, dass er nichts Besonderes ist. Sein Charakteristikum ist das Normale, er steht repräsentativ für viele Mittelgebirgsbäche“, erklärte der Stationsleiter und Experte für Steinfliegen Peter Zwick 2005. Der Breitenbach wurde von Anfang an ganzheitlich – ökologisch – erforscht, d.h. in allen Aspekten und Wechselwirkungen: die Umgebung, das Wasser, die Temperatur, Pflanzen, Pilze und Tiere, Mikroorganismen zu verschiedenen Tageszeiten, die Strömung zu verschiedenen Jahreszeiten usw.. Mittlerweile sind über 1.500 verschiedene Arten im und am Breitenbach nachgewiesen. Er ist wahrscheinlich das weltweit am besten erforschte Fließgewässer. Gegründet wurde die „Limnologische Flussstation“ von vier aus dem Krieg heimgekehrten Göttinger Biologiestudenten, die sich damit eine Arbeitsstelle schufen, nachdem der Graf von Schlitz ihnen ein Grundstück und Gebäude überlassen hatte. Heute arbeiten dort 5 Wissenschaftler und 17 Helfer auf 14 Stellen. Ihr erster Institutsleiter war Joachim Illies, sein Sohn, der Schriftsteller Florian Illies, veröffentlichte 2006 ein schönes Buch über Schlitz: „Ortsgespräch“. Joachim Illies interessierte sich vor allem für Süßwasserinsekten. Mit den Jahren wurde er immer gläubiger. In seinem letzten Buch „Der Jahrhundert-Irrtum“ (1982) schrieb er: Zwar gebe es eine schrittweise Generationenkette von der Amöbe bis zum Menschen, aber der Darwinismus mit seiner Reduktion auf Mutation und Selektion sei eine unzulässige Vereinfachung allen Evolutionsgeschehens. Hinter der Evolution stehe mehr; das sei etwas bisher Unverstandenes; dieses Unverstandene bilde die Brücke zum Religiösen.
.
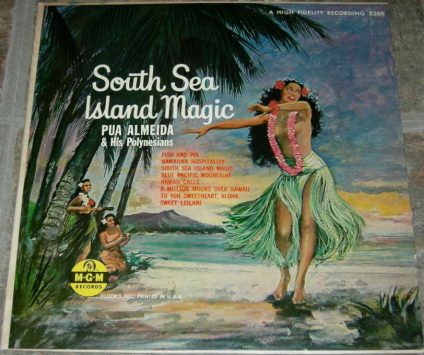
.
Um die Geschichte der Südseeinseln-Besiedlung ging es bei der Forschungsreise des norwegischen Anthropologen Thor Heyerdahl. Die herrschende Theorie ging und geht davon aus, dass sie von Neuguinea aus besiedelt wurden, weil von Madagaskar bis zur Osterinsel und von Taiwan bis Neuseeland austronesische Sprachen gesprochen werden. Heyerdahl glaubte jedoch den alten Quellen der Inkas dass sie es waren, die sich von Peru aus mit Flößen aus Balsaholz auf den Weg mindestens nach Polynesien gemacht hatten – der Humboldtstrom trug sie dorthin. Er baute ein solches nach, heuerte fünf Mitreisende an und fuhr los. Im Gegensatz zu den Segelschiffen und erst recht den modernen Motorschiffen lebte die Mannschaft fast auf einer Höhe mit dem Wasserspiegel. Dafür machten ihnen selbst hohe Wellen nichts aus, denn das Floß trieb wie ein Korken immer obenauf. Außerdem befanden sie sich mit den Meerestieren sozusagen auf Augenhöhe und trieben langsam und lautlos dahin. Heyerdahls Beobachtungen und Erlebnisse mit ihnen machen deswegen auch einen Großteil seines Reiseberichts “Kon-Tiki” aus, der 1948 auf Norwegisch erschien. Ich habe eine Ausgabe von 1986 aus der DDR, wo auch Berichte über seine zweite Expedition “Tigris” sowie seine dritte “Ra” erschien. Mit der “Kon-Tiki” waren sie 101 Tage unterwegs – bis ihr Floß vor Reroia im Tuamotu-Archipel auf das Riff auflief. Unterwegs fielen ständig fliegende Fische auf das Floß, auch Kraken, die sich durch Rückstoß quasi aus dem Wasser geschossen hatten. Und Thunfische, Bonitos und Goldmakrelen begleiteten sie. Unter dem Floß siedelte sich Tang und Seegras sowie Entenmuscheln an, und Remorafische saugten sich an den Balsaholzstämmen fest. Wenn sie nicht wollten, bekam man sie nicht los. Zwischen den Stämmen richtete sich eine Krabbe ein, die sie Johannes nannten.
“Das ganze bildete eine seltsame Tiergemeinschaft…Unsere intime Nachbarschaft mit dem Meer wurde Torstein zum ersten Mal richtig bewußt, als er eines Tages beim Erwachen eine Sardine auf dem Kopfpolster fand,” schreibt Heyerdahl. Ein andern Mal war es ein aalähnlicher, 1 Meter langer Gympylus, eine Schlangenmakrele. die man bisher nur als Skelett kannte, und die nachts auf dem Floß gelandet war: “Wir waren die ersten, die ein lebendes Exemplar dieser Gattung sahen.” Auch Lotsenfische, die stets bei einem Hai bleiben, wechselten zum Floß, nachdem die Männer ihre Haie weggefangen hatten. “Mit so kindlichem Vertrauen drängten sich die schnurrigen kleinen Fische unter unsere schützenden Fittiche, dass wir wie der Hai geradezu väterliche Gefühle für sie hegten. Sie wurden ‚Kon-Tikis‘ maritime Haustiere. Es war taubu an Bord, Hand an einen Lotsenfisch zu legen…Bei solcher Gesellschaft im Wasser wurde uns die Zeit niemals lang… Je enger wir Kontakt mit dem Meer bekamen und mit all den Geschöpfen, die in ihm zu Hause waren, desto weniger fremd wurde es uns und desto mehr fühlten wir uns selbst zu Hause.” Sie fischten Plankton und aßen es als Grütze: “Waren viele Zwergarnelen darunter schmeckte es wie Krabbenpaste, waren es überwiegend Fischeier, schmeckte es wie Kaviar.” Die Fahrt mit der Kon-Tiki war, ebenso wie die beiden anderen Expeditionen (vom Irak nach Somalia und von Marokko nach Barbados), empirische Archäologie, mit der einige westliche Kulturtheorien widerlegt werden sollten.
.
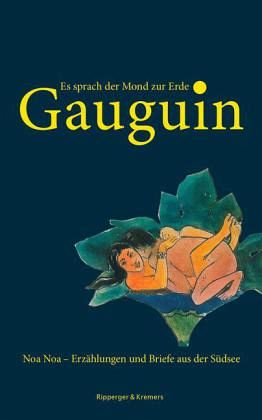
.
Ich will hier noch einige Ein-Mann-Forschungsexpeditionen erwähnen, die den Spieß in gewisser Weise umdrehten: Z.B. der Westafrikaner Tété-Michel Kpomassie. Sein Bericht aus dem Norden erschien 1982 auf Deutsch. Er sollte in seinem Dorf Schlangenkultpriester werden, hatte aber große Angst vor Schlangen und erfuhr dann in einem Bildband der nahen Missionsbibliothek Näheres über Grönland – wo es keine Schlangen gibt. 1965 machte er sich mit seinen Ersparnissen nach dorthin auf. Von Togo zunächst nach Dakar, dann von Marseille nach Paris, wo ihm zwei pensioniert Kolonialbeamte nach Kopenhagen weiterhalfen. Von dort aus gelangte er mit dem Schiff nach Grönland – zu “seinem Volk”, den Eskimos. Er lebte, liebte und forschte einige Jahre unter ihnen. Immer wieder verglich er dabei seine Dorferfahrungen zu Hause mit ihren Sitten und Gebräuchen. Als er wieder zurück mußte und bis nach Paris gekommen war, nahm er Kontakt zum Direktor des Instituts für arktische Studien am Centre National de la Recherche Scientifique, Jean Maleurie, auf. Dieser überredete ihn, seine ethnologischen Beobachtungen niederzuschreiben. Auf Deutsch bekamen sie den Titel: “Ein Afrikaner in Grönland”. Tété-Michel Kpomassie nahm danach eine Forschungsstelle am Pariser Institut für arktische Studien an.
Erwähnenswert ist außerdem der Bericht eines Südseehäuptlings, der den Seinen zu Hause schreibt, wie man in Deutschland lebt. Und die Briefe eines Westafrikaners, der seinem Häuptling aus Deutschland Bericht erstattet. Beide Bücher, “Der Papalagi” (1920) und “Die Forschungsreise des Afrikaners Lukanga Mukara ins innerste Deutschland” (ab 1912 in Fortsetzungen und 1921 als Buch erschienen) sind allerdings fiktiv – geschrieben wurde das erste von dem Maler und Publizisten Erich Scheurmann und das zweite vom Marineoffizier und Schriftsteller Hans Paasche. Während Scheurmann sich “der Naziideologie verschrieb”, wie Wikipedia schreibt, entwickelte sich der Kolonialschützer und Großwildjäger Hans Paasche zum Pazifisten, Tierschützer und Sprecher im Arbeiter- und Soldatenrat. Als er sich auf seinen kleinen Gutshof zurückzog, wo er die Landarbeiter agititerte, KPD zu wählen, wurde der 1920 von einem Reichswehr-Regiment erschossen.
Ebenso wie “Der Papalagi” war auch Paasches “Lukanga Mukara” ein Bestseller. Anlass und Namensgeber für diesen Reisebericht war ein junger, von Missionaren unterrichteter Afrikaner, den Paasche und seine Frau am Viktoriasee kennengelernt hatten. Paasche ließ ihn kurzerhand nach Deutschland reisen, um seine Kritik an Gesellschaft, Umweltverschmutzung und Kolonialismus in Lukangas unverblümter Sprache äußern zu können. Paasches Kritik am quasi-religiösen Wachstumswahn westlicher Industriegesellschaften war damals noch durchaus neu und sorgte für entsprechendes Aufsehen.
Sein Biograph, der Kapitän Werner Lange, schreibt in “Hans Paasches Forschungsreise ins Innerste Deutschland” (1995): Ein publizistisches Meisterstück gelang ihm 1914 in einem Beitrag für seine Zeitschrift “Vortrupp” mit dem Titel “Die Federmode”, in der er das Aussterben zahlreicher Vogelarten beklagt und überhaupt die Tendenz, alle lebenden Geschöpfe in Geld zu verwandeln. Es klebe Blut an deren Bälgern. So seien z.B. 40 Eingeborene Deutsch-Neuguineas von Kolonialsoldaten umgebracht worden, “weil sie einen marodierenden Paradiesvogeljäger getötet hatten. 300 Millionen Vögel werden derzeit jährlich abgeschlachtet. Paasche sieht gerade die Eulen Nordafrikas, die Wandertauben Amerikas und die Kolibris auf Trinida ausgerottet. Er kann sich nicht mit der Gewissenlosigkeit der Jäger und Händler abfinden, mit der Gleichgültigkeit der Menschen, die sich nur zu gern durch den Hinweis auf einige Straußenfarmen beschwichtigen lassen. Dabei weiß er doch, daß kaum Hoffnung besteht, denn ‚man kann nichts schützen, was im Busch umherfliegt und 100 Mark wert ist‘.”
.
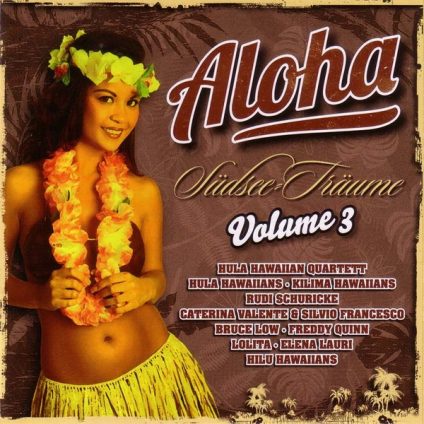
.
Einer dieser bald mit der Ausbreitung der Kolonien zu tausenden ausschwärmenden Jäger und Händler war der Engländer Alfred Russel Wallace. Er gelangte 1854 zu den indonesischen und malayischen Inseln und fand auf Tenate eine Unterkunft, von wo aus er Sammelexpeditionen zu den umliegenden Inseln unternahm. Die dortigen Gewürzinseln der Molukken waren erst in spanischem und dann portugiesischem Besitz gewesen, seit 200 Jahren aber bereits in niederländischem. Im Zweiten Weltkrieg wurden sie kurz von Japan besetzt und dann gegen ihren Willen und bis heute von Indonesien vereinnahmt.
Der auf Insekten und Vögel gewissermaßen spezialisierte Sammler Wallace, der aber auch Orang-Utans nicht verschonte, hatte seine Kunden vor allem in England. Bevor er den „Malayischen Archipel“ bereiste, durchstreifte er jahrelang Amazonien. Aber seine gesamte Ausbeute vom Amazonas und Rio Negro war dann mit dem Frachter nach einem Brand an Bord untergegangen: „eine der größten wissenschaftlichen Sammlungen seiner Zeit, zahllose unbekannte Tier- und Pflanzenarten aus entlegenen Regionen des Regenwaldes samt seinen Aufzeichnungen,“ schreibt der Evolutionsbiologe am Berliner Naturkundemuseum Matthias Glaubrecht in seiner Wallace-Biographie „Am Ende des Archipels“ (2013). Wallace konnte zwar gerettet werden, aber er verfiel danach in London in Depressionen – bis er sich zum Malayischen Archipel aufmachte und aufs Neue anfing zu sammeln.
Vor allem war er hinter Paradiesvögel her, die gerade auf Damenhüten in Europa groß in Mode waren – und deswegen hohe Gewinne versprachen. Wallace jagte sie ständig auf den Inseln, zeitweilig beschäftigte er dazu noch Jäger. Obwohl die Federn der männlichen Paradiesvögel schon lange aus der Mode sind, gelten diese Tiere heute noch immer als „bedrohte Art“. Daneben fing Wallace durchschnittlich 30 Nachtfalter täglich und insgesamt 13.000 Tagschmetterlinge. Auch sammelte er Käfer eifrig: Der Londoner Versicherungsmakler Saunders, ein Insektenkundler, dem Schmetterlinge zu sammeln inzwischen zu gewöhnlich geworden war, wollte so viele indonesische Käfer wie möglich haben – und zahlte Wallace, dafür 1 Schilling pro Stück.
.

Königin der Südsee
.
Jedes Schiff, das aus den Tropen kam, hatte Kisten und Käfige mit interesssanten Dingen an Bord. Das meiste davon wurde im Hafen der Welthauptstadt London gelöscht. Die Kulturwissenschaftlerin Julia Voss schreibt in ihrer 2007 veröffentlichten Studie „Darwins Bilder – Ansichten der Evolutionstheorie 1837 – 1874„: In den Lagerräumen der zoologischen Institutionen drohte sich diese Flut zerstörerisch auszuwirken. „Das Wachstum geriet hier außer Kontrolle…Da Großbritannien zur größten Kolonialmacht aufgestiegen war, besaß London nun die größte Sammlung an Tierpräparaten…Ununterbrochen trafen im Hafen neue ein, aus konservatorischen und transporttechnischen Gründen meist in Stücken. Die Massen an Tierhäuten, Fellen, Skeletten, Schädeln, eingelegten Organen, getrockneten Bälgen, Käfern, Insekten, Schnecken, Muscheln, Fischen“ waren von den Wissenschaftlern nicht mehr zu bewältigen. In den Kellern des „British Museums“ vergammelte ein Teil, ein anderer wurde von Motten und Würmern zerfressen oder zerfiel.
So ähnlich ging es vielen Museen. Noch 2009 stieß die Künstlerin Hanna Zeckau im Berliner Naturkundemuseum auf einen dort noch nie geöffneten Koffer mit 18.000 Schmetterlingen aus dem kolumbianischen Hochland. Der Koffer gehörte dem Forschungsreisenden Arnold Schultze, der in den 20er- und 30er-Jahren Lateinamerika durchreiste – und dessen gesamte Sammlungen und Forschungserträge 1939 mit dem Frachter versenkt wurden, der ihn nach Deutschland bringen sollte. Schultze selbst wurde auf Madeira interniert und nach seinem Tod 1948 vollkommen von der Welt vergessen. Und mit ihm der Schmetterlingskoffer, der auf anderem Weg vorausgereist war und dann im Naturkundemuseum landete. Hanna Zeckau tat sich mit dem Schriftsteller Hans Zischler zusammen und gab mit ihm 2010 ein Buch über diese Sammlung heraus: „Der Schmetterlingskoffer“.
.

.
Alfred Russel Wallace war nicht nur ein geschäftstüchtiger Jäger, er machte sich auch Gedanken um die Entwicklung der Arten, während er auf den verschiedenen Inseln auf Unterarten und Variationen der von ihm geschossenen oder gefangenen Tiere stieß. Wie kamen sie zustande – entwickelte sich durch räumliche Trennung irgendwann eine neue Art? Dem „Artenrätsel“, wie Glaubrecht es nennt, war auch Charles Darwin auf den Galapagos-Inseln nachgegangen, wo er sich auf seiner Weltreise 1835 vier Wochen aufgehalten hatte. Dort waren ihm die Galapagos-Finken aufgefallen, die auf den Inseln unterschiedliche Schnabelformen ausgebildet hatten – ja nachdem womit sie sich ernährten. Auch die vier Spottdrosselarten auf den Galapago-Inseln unterschieden sich von der, die auf dem südamerikanischen Festland lebte. Wallace und Darwin korrespondierten über die Kontinente hinweg miteinander. U.a. wahrscheinlich auch über Paradiesvögel sowie über den im Malayischen Archipel lebenden und ebenfalls prächtigen Argusfasan. Bei beiden Vögeln unterscheiden sich die Männchen stark von den Weibchen. In seiner 1871 veröffentlichten Arbeit „Die Abstammung des Menschen und die sexuelle Selektion“ dienen sie Darwin als Paradebeispiel dafür, dass die Männchen in Schönheitskonkurrenz zueinander stehen und die Weibchen den Imposantesten wählen: „Survival of the Prettiest“ – unter dieser Überschrift fand 2013 auch eine Konferenz des Berliner Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte statt. Dieses „Survival“ über die sexuelle Selektion war für Darwin neben der natürlichen Selektion bei der Entwicklung der Arten wesentlich. Der FU-Literaturwissenschaftler Winfried Menninghaus hatte davon ausgehend in seinem Buch „Wozu Kunst? Ästhetik nach Darwin“ (2011) eine neue Soziobiologie entworfen – indem er einen Bogen vom Rad schlagenden Pfau zu dem zu dem seinen Körper bunt bemalenden Neandertaler und darüberhinaus bis zu uns heute schlug. In der Zeitung „Die Welt“ hieß es dazu: „Menninghaus erwähnt den Trojanischen Krieg, wenn es darum geht, dass Tiere in blutigen Kämpfen um Weibchen konkurrieren, die dann ihre Wahl treffen.“
Laut dem Basler Biologen Adolf Portmann brachte jedoch „vor allem die Beobachtung keinerlei einwandfreie Beweise für eine Wahl seitens der Weibchen.“ Darwin hatte, wie auch viele andere Biologen, anscheinend zu „rasch verallgemeinert“, wobei er „begreiflicherweise besonders beeindruckt war von Vögeln mit starkem Sexualdimorphismus“ (d.h. bei denen man deutliche Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen erkennen kann). „Doch gerade mit den imposantesten Beispielen dieser Art, dem Pfau und dem Argusfasan, hatte er Pech: hier gibt es keinerlei Wahl durch die Weibchen,“ schreibt der Zürcher Tierpsychologe Heini Hediger. Ähnlich sieht es bei den Paradiesvögeln, Webervögeln und Seidenstaren aus, die mitunter „ganz für sich allein balzen“. Die Kampfläufer dagegen, die Hediger ebenfalls erwähnt, balzen zwar in Gruppen, aber zum Einen sind die „spektakulären Kämpfe“ der Männchen „harmlose Spiegelfechtereien“ und zum Anderen nehmen die Weibchen keinerlei Notiz davon: „Nicht einmal hinschauen tun sie.“ Ihr Erforscher, G. Dennler de la Tour, beobachtete zudem, dass es ganz antidarwinistisch der im Duell unterlegene Kampfläufer ist, der, sobald er sich erholt hat, zu den Weibchen geht und sie nacheinander begattet, während die Sieger davonfliegen. Die hier zitierten Autoren konnten bereits auf genaue Beobachtungen von Verhaltensforschern bei den Paradiesvögeln und dem Argusfasan zurückgreifen.
.

Lydia Kamakaeha
.
Wallace interessierte dagegen das Verhalten der Paradiesvögel wenig, seine Wahrnehmung war eher an optischen Unterschieden geschult: Habe ich die Art schon gehabt oder ist das eine andere, eine Unterart oder Variation? Und wie erwische ich den Vogel? Die Jäger tragen überhaupt nur wenig zum Wissen über die Tiere bei. Heini Hediger meinte 1984: „Es hat sich gezeigt, dass das Jagen im Grunde wenig Gelegenheit zum Beobachten bietet… Ein Schuß, selbst ein Meisterschuß, ist eben niemals Beginn, sondern stets das Ende einer allzu kurzen und meist nicht sehr vielsagenden Beobachtung.”
Wallace sah das mit den Paradiesvögeln so: „Auf der einen Seite erscheint es traurig, dass so außerordentlich schöne Geschöpfe ihr Leben ausleben und ihre Reize entfalten nur in diesen wilden, ungastlichen Gegenden, welche für Jahrhunderte zu hoffnungsloser Barbarei verurteilt sind; während es auf der anderen Seite, wenn zivilisierte Menschen jemals diese fernen Länder erreichen und moralisches, intellektelles und physisches Licht in die Schlupfwinkel dieser Urwälder tragen, sicher ist, dass sie die in schönem Gleichgewicht stehenden Beziehungen der organischen Schöpfung zur unorganischen stören werden, sodass diese Lebensformen, deren wunderbarer Bau und deren Schönheit der Mensch allein imstande ist, zu schätzen und sich ihrer zu erfreuen, verschwinden und schließlich aussterben.“ Desungeachtet schätzte er die holländische Kolonialverwaltung, die mit großer Strenge die Molukker zu regelmäßiger Arbeit auf ihren Plantagen zwang. Er verteidigte „selbst die Zerstörung der Muskatnuss – und der Gewürznelkenbäume auf vielen Inseln, um ihren Anbau auf eine oder zwei zu beschränken“ – auf denen die Holländer „das Monopol leicht aufrecht erhalten“ können. Dieses Monopol besaß zuletzt nebenbeibemerkt die Suharto-Familie – bis zu ihrem Sturz 1998.
Wallace fand 1885 einige Zeit zum Schreiben. Er setzte sich in seine Hütte und brachte eine Theorie der Entwicklung der Arten zu Papier. Dieses sogenannte „Tenate-Manuskript“ schickte er Darwin. Was der damit machte und wie andere damit umgingen bzw. ihm rieten, wie damit umzugehen sei, das hat der Evolutionsbiologe Matthias Glaubrecht in seiner umfngreichen Wallace-Biographie, die einem Detektivroman ähnelt, herauszubekommen versucht. Sein Verdacht ist, dass mit Darwins 1859 veröffentlichten Hauptwerk „Über die Entstehung der Arten“ Wallace‘ Anteil daran gewissermaßen unterschlagen wurde, obwohl sie ein Jahr zuvor noch beide ihre sich gleichenden Thesen öffentlich zur Diskussion gestellt hatten. Dies nahm die Londoner Linné-Gesellschaft 50 Jahre später zum Anlaß, um alljährlich eine „Darwin-Wallace-Medaille“ zu vergeben – die erste bekam 1908 sinnigerweise Alfred Russel Wallace selbst – vielleicht zur Entschädigung. Darwin hatte ihm in den Siebzigerjahren bereits zu einer Regierungspension verholfen, nachdem Wallace sich mit Aktien verspekuliert hatte und zu verarmen drohte. Wenn es denn eine üble Trickserei und vernichtete oder umdatierte Briefe um die Darwinsche Theorie gab, dann hat Wallace dies Darwin auf alle Fälle niemals übel genommen.
.

.
Als Jäger und Sammler belieferte Wallace auch Carl Hagenbeck sowie dessen Neffen, der in der Hamburger Firma seines Vaters “J.F.G. Umlauff” arbeitete, die ihre Geschäftsräume an der Reeperbahn hatte. Sie importierte und verkaufte Kuriositäten aus Übersee, stellten Muschelprodukte, Tierpräparate und Menschenfiguren her, „die die jeweiligen gesellschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Bedürfnisse bedienten. Für mehr als 100 Jahre sollte das Unternehmen den deutschen Markt für Zoologica, Ethnografica, Anthropologica und plastische Bilder vom Menschen bestimmen,“ schreibt die Kulturwissenschaftlerin Britta Lange 2006 in ihrer Doktorarbeit über die Firma Umlauff, die den Titel „Echt. Unecht. Lebensecht.“ hat.
„Echt“ – das waren z.B. Vogelbälger, Schilder und Speere von Eingeborenen, Häuptlingsschmuck und Lendenschurze aus Antilopenleder. Zu ihrer Beschaffung arbeiteten die Umlauffs mit Elfenbeinimporteuren und Sammelexpeditionen zusammen, ihre Kunden waren Völkerkunde-, Naturkunde- und Missionsmuseen in Europa und Amerika, aber auch Schausteller. Für die Wissenschaftler brauchte es gesicherte Informationen über die Herkunft der Objekte. Deswegen waren „Erzählungen ein Hauptgegenstand des Umlauffschen Geschäfts,“ schreibt Britta Lange. In den Museen und Völkerschauen ging es um eine Darstellung der „evolutionistischen Wissenschaftsauffassung“ (nach Charles Darwin), die analog zur Naturgeschichte eine evolutive Kulturgeschichte postulierte: – wenn dort die Entwicklung vom Urfisch zum Menschenaffen fortschritt – dann hier von den Hottentotten zu den Engländern. „Auf politischer Ebene arbeitete das evolutionistische Weltbild der Legitimation kolonialistischer Herrschaft über die außereuropäischen Ethnien in die Hände.“ Seit 1889 bot Heinrich Umlauff zur Illustrierung dieses Weltbildes den Museen lebensgroße „Modellfiguren verschiedener Völker“ an: „Als ‚Völkertypen‘ visualisierten sie in Papiermaché Vertreter von so genannten ‚Naturvölkern‘.“ Im Gegensatz zu den Ethnografica, die den Museen als Originale – „echt“ – verkauft wurden sowie auch zu den Präparationen, die mindestens Teile des originalen Tieres enthielten, waren die „Völkertypen“ unecht: „Sie stellten Leben vor. Von den Zeitgenossen wurden sie daher als ‚lebensecht‘ bezeichnet.
.

Perle der Südsee
.
Das Verhältnis dieser Begriffe zueinander wurde und wird immer „unübersichtlicher“: Wurden z.B. die Ethnographica aus dem „alltäglichen oder kultischen Zusammenhang der ‚Naturvölker’“ gerissen, waren es „Originale“. Kopien solcher Objekte, „die für den Handel hergestellt wurden, galten als „Fälschungen“. Während die von Eingeborenen auf Völkerschauen angefertigten Gegenstände zwar von einigen Museen später erworben wurden, jedoch nur als quasi „halbechte“ (und daher billigere) Exponate. Die „Fälschung“ konnte u.a. in der „Narration“ bestehen, die die „Echtheit“ der Objekte beteuerte, „statt sie zu beweisen.“ Und die „echten“ Gegenstände mussten zugleich „zirkulierenden Vorstellungen und Bildern des ‚Echten‘ entsprechen“.
Nachdem Kamerun und Togo 1884 deutsches „Schutzgebiet“ geworden war, organisierte der Herzog von Mecklenburg eine Expedition nach dort, die reiche „Beute“, „Ernte“ genannt, erbrachte. Der Ethnologe Hans Fischer hat geschildert, wie das im Falle der „Hamburger Südsee-Expedition“ 1909 aussah: Die Teilnehmer gingen immer dann an Land, wenn die „Eingeborenen“ nicht in ihren Dörfern waren – ungeniert betraten sie deren Hütten und nahmen sich, was ihnen wertvoll erschien. Dafür hinterließen sie die üblichen europäischen „Gegengeschenke“ (Tabak, Glasperlen, Spiegel).
.

Hawaiianerinnen-Kostüm
.
Nach Photos, die der Herzog von Mecklenburg von Pygmäen gemacht hatte, fertigte Heinrich Umlauff eine „Lebensgruppe, die eine Familiensituation vorführte“. 1912 bot er diese dem Stockholmer Ethnologischen Museum als „Zwergen-Gruppe aus Kamerun.Hinterland“ an – für „900.- ohne Hütte, mit imitierter Hütte genau nach Original 300.- mehr, mit Original-Hütte, jedoch lieferbar erst nach 5 Monaten 500.- mehr.“ Die Preisdifferenz zeigt, so Britta Lange, „dass Originale deutlich von originalgetreuen Reproduktionen unterschieden wurden“. Nachdem die Exponate in die Museen gelangt waren, erfolgte nicht selten eine neuerliche (Um-)Erzählung – wie man sie z.B. dem „Informationsblatt des Hamburger Museums für Völkerkunde“ aus dem Jahr 1998 noch entnehmen kann, wo der Ankauf eines Ahnenhauses der Maori als Rettungstat seines ersten Direktors dargestellt wird, bevor der Kolonialismus diese „bedrohte Kultur“ (und seine ganzen Ahnenhäuser) endgültig zerstörte: „Die Geschichtsschreibung der Hamburger Institution vereint ‚edle Wilde‘ und den ‚edlen Museumsdirektor‘ in einer Art Heilsgeschichte,“
Die Firma Umlauff schaffte sich nach dem Rückzug Hagenbecks aus dem Geschäft mit einem „Weltmuseum“ eine neue Bühne für Völkerschauen, wo sie u.a. Kameruner zeigte. An den zuvor durch Deutschland gezogenen „Kamerunschauen“ hatte man kritisiert: Es waren gar keine Kameruner – die Veranstalter wollten damit bloß auf das Publikumsinteresse an dem gerade zur deutschen Kolonie erklärten Land spekulieren. Es handelte sich mithin um „Fälschungen“. Die Wissenschaft sah sich herausgefordert, fortan die „ethnische Echtheit“ zu überprüfen. Rudolf Virchow klagte: „Es wird immer mehr Scharfsinn dazu erfordert, Aechtes und Unächtes zu unterscheiden.“ Während das Feuilleton bei einer Völkerschau der Samoaner überzeugt war, das Publikum könne auf den ersten Blick erkennen, „daß es natürliche und keine einstudirte Künste“ seien, führte der Bühnenauftritt einer Gruppe kriegerischer „Amazonen“ aus Dahomé zu einer regelrechten „Untersuchung“ – durch die von Virchow gegründete „Berliner Anthropologische Gesellschaft“.
In Umlauffs „Weltmuseum“ wurden die zunächst als „Prachtgruppen“ oder „Schaugruppen“ bezeichneten Exponat-Ensembles fortan „Lebensgruppen“ genannt: „Die Figuren sollten ‚Leben‘ vorstellen…Sie konnten nur ‚originalgetreu‘, ‚naturgetreu‘ oder ‚lebensecht‘ sein.“ Manchmal wurden jedoch auch echte Menschen „ausgestopft“. In der Firma Umlauf wurden zwar nur Tiere präpariert, aber sie scheute sich nicht, ihren Kunden auch ausgestopfte Menschen anzubieten.
.

Drei Samoanerinnen
.
Der holländische Journalist Frank Westerman hat 2007 die Geschichte eines solchen Menschenexponats rekonstruiert – in seinem Buch „El Negro“. Dabei handelt es sich um ein 1830 in Südafrika gestorbenes „männliches Individuum des Betjuanavolkes“ , dessen Leiche die Pariser Konkurrenten von Umlauff – die Brüder Verreaux, auf einem Friedhof in Südafrika nachts ausgegraben und dann präpariert hatten. Das Exponat wurde von dem Direktor des Zoos von Barcelona Francisco Darder erworben, der es während der Weltausstellung in Barcelona 1888 in einem Café ausstellte, von wo aus „El Negro“ schließlich in das Darder-Museum für Naturgeschichte von Banyoles (nahe Barcelona) gelangte. Dort blieb er, bis man ihn am 8.9. 2000 – nach Protesten eines Afrospaniers, die sich schnell international ausweiteten – zurück nach Südafrika expedierte, wo er bestattet wurde. Die Bewohner von Banyoles hatten auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung eine Bürgerinitiative gegen den Raub ihres „El Negro“ gegründet. Die Leiterin des dortigen Museums begründete dies u.a. mit einer „Museumsethik“, die darin bestände, eine einmal existierende naturhistorische Sammlung vor Abgängen oder Verlusten zu schützen.
Wie der Schamane und Walfänger Mletkin, hatte sich auch die Firma Umlauff an der Weltausstellung in Chicago beteiligt. Sie präsentierte dort zwei „Inszenierungen von Lebewesen“ – von präparierten Fischen bis zu ausgestopften Orang Utans (die möglicherweise von Wallace stammten), mit einem Tierpfleger als Wachsfigur daneben. Dazu erklärte Carl Hagenbeck der Chicagoer Presse: „Wer am Studium der Darwinschen Theorie interessiert ist, hat hier die Möglichkeit, den Fortschritt der Evolution bis zur höchsten Vollkommenheit nachzuvollziehen.“
.

Ein Seepferdchen
.
In den Dreißigerjahren verkaufte Johannes Umlauff vor allem Schädel und Skelette an die Institute für Rassenkunde in Berlin-Dahlem und Tübingen. Nach dem Krieg konzentrierte er sich „auf die Belieferung von Schulen und Krankenhäusern“, das Geschäft ging jedoch immer schlechter. Als er 1951 starb, führte es niemand weiter.
Um echt, unecht, lebensecht ging es erneut – mit den Arbeiten des Leichenpräparator Gunther von Hagens. Er wurde 1977 mit einem neuen Präparationsverfahren berühmt, dass er in Heidelberg entwickelte – und patentieren ließ: die „Plastination“. Inzwischen ist er damit reich geworden – und besitzt Firmen in China, Kirgisien, Heidelberg, Guben und Gibraltar, die jährlich hunderte von menschlichen Leichen ganz oder teilweise präparieren – und zu (medizinischen) Schulungszwecken, vornehmlich nach Arabien, verkaufen. Daneben organisiert der „umstrittene Plastinator“, der stets mit einem Beuys-Hut auftritt, Wanderausstellungen mit immer gewagteren Mensch- und Tierpräparationen: „Körperwelten“ genannt. Eine wird gerade in Berlin unter dem Fernsehturm gezeigt. Dabei laviert Hagens wie stets ähnlich wie die Firma Umlauff früher – zwischen Wissenschaft und Schaustellerei.
In der Presse warf man von Hagens vor, für seine „Plastinate“ Leichen aus chinesischen Arbeitslagern bezogen zu haben. Er meinte jedoch, es handelte sich dabei stets um „herrenlose Leichen“. Im Gegensatz zu den „Lebensgruppen“ der Firma Umlauff geht es von Hagens dabei jedoch nicht um „Menschentypen“, sondern um anatomisch aufbereitete Körper bzw. Teile und (deformierte) Organe – wobei er eine neue Verbindung von natürlichem und künstlichem Material erfand. Sein „Plastinationsverfahren“ besteht darin, dem toten Körper bei minus 20 Grad das Wasser zu entziehen und mit Aceton zu füllen. Anschließend wird die Leiche in eine Vakuumkammer gelegt, aus der langsam das verdampfende Lösungsmittel entfernt wird, dadurch entsteht ein Unterdruck im Präparat, in das nun flüssiger Silikatkautschuk gegeben wird. Zuletzt erfolgt die „Positionierung“ des Körpers, der nunmehr ein Gemisch aus Kunststoff und Naturresten ist. Gerade die „Ganzkörper-Plastination“, ist laut von Hagens „eine intellektuelle und bildnerische Leistung, bei der man das Ergebnis schon zu Beginn vor dem inneren Auge haben sollte, wie der Künstler die Statue.“
.

Katsushika Hokusai: „Zwei Kraken und Muscheltaucherin“
.
Ähnlich scheint es bei der Präparation von Tieren zu sein. Im Berliner Naturkundemuseum gibt es einen präparierten Schwarm von Fischen. An ihrer Vitrine, die im Bereich „Präparation“ steht, wird dazu erklärt: „Bei einem Fischschwarm fertigt man nur einen Abguß an, der mehrmals abgeformt wird, woraus dann Silikonpositive gemacht werden, die man sich hinbiegen kann.“ Die meisten Fische kann man auch lebend kaum voneinander unterscheiden. Mimiklos verkörpern sie zunächst ähnlich den Silikon-Exponaten „Typen“. Der Chefpräparator des Naturkundemuseums Detlev Matzke erklärte mir zu den Fischpräparaten: „Wir haben einen eigenen Präparator, der sich mit Fischabgüssen beschäftigt. Das hier sind alles Abgüsse. Man kann einen Fisch auch mit Haut und Schuppen präparieren. In beiden Fällen ist es so, daß sich die Farbe, die der Fisch hat, nicht erhalten läßt, die geht in jedem Fall verloren, er muß also hinterher bemalt werden. Da streiten sich die Geister: der eine möchte unbedingt das Original haben, dem ist es ganz wichtig, daß es der Originalfisch ist, der andere möchte lieber einen Abguß vom Fisch haben, weil die Struktur beim Vertrocknen nicht wegfällt. Beim originalen Fisch liegt ja ohnehin eine Schleimschicht drüber, die sich sowieso verliert. Wenn ich also den Originalfisch nehme und dessen Schuppen bemale, dann sehe ich hinterher auch bloß die Farbe und nicht mehr die Schuppen. Wir haben uns hier im Museum entschieden, mit Abgüssen zu arbeiten. Der Museumsbesucher kann das kaum unterscheiden – da kommt immer als erstes die Frage “Ist das Ding echt?” und wenn dann gesagt wird “Nein, das ist ein Abguß”, dann ist es nicht mehr interessant. Das Original hat bei vielen eine ganz andere Bedeutung noch.
Es gibt eine Technologie, die sich noch nicht so ganz durchgesetzt hat und die auch sehr kompliziert ist, die nennt sich Dermoplastik ohne Haut. Bei borstigen, sehr kurzhaarigen Tieren geht das sehr gut, bei einem Stachelschwein z.B. Da wird das fertig präparierte Tier mit einer Paraffinschicht umhüllt, dann trenn ich das Tier durch, und dann habe ich die Haut mit den Haarwurzeln in der Paraffinschicht drinne. Diese Schicht kann ich dann wegätzen. Dann bleiben nur noch die Haarwurzeln in dieser Kappe gehalten. Da rein läßt sich jetzt ein Kunststoff eingießen und dann füg ich das Ding wieder zusammen. Anschließend steht es als Kunststofftier da mit den Originalhaaren. Den Kunststoff kann ich einfärben. Ich habe also überhaupt kein Problem mehr, daß das Tier später mal reißt, es kann auch nicht mehr schrumpfen. Es ist ein Stück Plastik mit Originalhaaren.
Bei den Fischen ist das ähnlich. Es geht dabei ja nicht darum, zu zeigen, daß ist jetzt der Karpfen Kuno aus dem und dem Teich, sondern darum, eine bestimmte Form zu zeigen, die typisch sein muß für den Karpfen. Wir wollen ja in der Museumspädagogik ganz andere Sachen mit rüberbringen: Wir wollen darauf aufmerksam machen, welche Körperform hat er, wird er schnell schwimmen oder langsam, ist es ein Friedfisch oder hat er kräftige Zähne…Das kann man über ein naturgetreues Modell viel besser machen als mit einer Originalpräparation eines Fisches, wo ich immer aufpasssen muß, daß die Luftfeuchtigkeit nicht zu sehr abfällt im Winter und ich hinterher Risse habe und das Ding auseinanderfällt.“
Neben den Trockenpräparaten gibt es im Naturkundemuseum auch noch eine „nasse“ Fischsammlung, deren Grundstock einst Dr. Marcus Elieser Bloch im 18.Jahrhundert zusammentrug, „Millionen Fische, Reptilien, Krebs- und Spinnentiere, seit Humboldts Zeiten in aller Welt gesammelt, konserviert in 80 Tonnen reinem Ethanol, verteilt auf knapp 260.000 Gläser,“ schrieb die Berliner Morgenpost.
.

.
2014 bekamen die etwa 50000 Fische einen eigenen Saal: Gut ausgeleuchtet stehen da nun alle ihre Gläser auf hohen Metallregalen und mittendrin befindet sich der aus Brandschutzgründen bloß fiktive Arbeitsplatz eines Fischforschers. Als Besucher kann man bloß außen herum gehen und beeindruckt sein über die vielen Fische – in so einer modernen Museums-Inszenierung. In der Aufsatzsammlung „Wissenschaft im Museum“ (2014) der Wissenschaftshistorikerinnen Margarete Vöhringer und Anke te Heesen kritisiert letztere diesen neuen „Raum voller Gläser“, in dem „nicht das einzelne Objekt hervorgehoben und mit einer Erklärung versehen“ wird, sondern „ihr Erscheinen als Menge im Vordergrund“ steht. In den Naturkundemuseen wird die „Natur mithilfe toter Gegenstände dargestellt, ihre Präsentationen aber sollen das Leben selbst symbolisieren.“ Aus der Warte des naturkundlichen Objekts stellt der Raum mit den Fischgläsern ein „Unterforderung“ dar. Von der Warte allein des Atmosphärischen her stellt er jedoch eine Überforderung dar, „denn was sollen wir auswählen, was besonders intensiv betrachten, woran uns orientieren?“ fragt Anke te Heesen. Hier wurde mit großer Geste leichtfertig der Museumsauftrag Vermittlung von Wissen zugunsten einer künstlerischen Rauminstallation fallen gelassen, das Feuilleton lobte dann auch prompt den Verzicht auf „die sonst übliche Museumspädagogik“.
.

.
Je mehr die Fisch-Vorkommen im Meer abnehmen, desto mehr Forschung wird in sie investiert. Es ist bezeichnend, dass sich die Bestände der Speisefische in den Meeren nur während der zwei Weltkriege halbwegs erholen konnten, weil die Fischer und ihre Schiffe anderweitig unterwegs waren. In der Fischwirtschaft geht es um Fangmengen und -quoten, in der Fischereiforschung darum, das Wissen über die Tiere zu mehren, um Vorschläge zu machen, wie sie optimal bewirtschaftet werden können.
Der Wissenssoziologe Bruno Latour führte dazu 2010 aus: „Nehmen Sie den roten Thunfisch. Wenn die Nachfrage der Japaner nach rotem Thunfisch nicht massiv zurückgeht, wird es bald keinen roten Thunfisch mehr geben. Es gibt ganze Organisationen, die sich mit dem roten Thunfisch auseinandersetzen, das heißt, sie interessieren sich dezidiert für das Interesse des roten Thunfischs. Folglich ist es eine Selbstverständlichkeit zu sagen: Man nimmt die Interessen der Japaner für ihr Sushi und die Interessen des roten Thunfischs für sein eigenes Überleben, setzt sie in Relation und handelt die Interessen jeweils aus. Das Gegenargument lautet dann oft: Ich würde mich lediglich aus egoistischen, anthropozentrischen Gründen für den roten Thunfisch interessieren, was natürlich Quatsch ist. Ich kann sehr gut in einer Welt ohne roten Thunfisch leben. Weiterhin gibt es die Umweltschützer und Statistiker, die das drohende Aussterben des roten Thunfisches beschwören. Auch das Interesse der Sushi-Produzenten und der Fischer hängt vom Thunfisch ab. Eine ganze Reihe von Akteuren ist offensichtlich mit dem roten Thunfisch vernetzt, und das Interesse des letzteren ist dabei genauso legitim wie das der Menschen, die ja wiederum differenziert werden müssen in Japaner, Mittelmeeranrainer, große und kleine Fischereibetriebe usw.. Also konstruiert man ein Parlament der Dinge, einen Ort, an dem die Repräsentanten der jeweiligen Dinge, der nicht-menschlichen Wesen, die Interessen mit denen der menschlichen Akteure aushandeln. Und wenn Sie darauf erwidern, dass der Thunfisch in der Diskussion gar nicht auftaucht, sein Interesse also gar keine Rolle spielt, dann stimmt das nicht. Er ist in verschiedener Gestalt anwesend, in Statistiken, in den Diskursen der Fischer usw..“
In seinem Aufsatz „The Oil we Eat““ (abgedruckt im „Public-Journal“, Heft 30/2004 zum Thema „Eating Things“) hat der Publizist Richard Manning ausgerechnet, das der Thunfisch zu den verschwenderischsten Lebensmitteln gehört, die wir uns leisten, weil er als Raubfisch Fische frißt, die selber Fische fressen, die ebenfalls von kleinen Fischen leben: Mit jedem Fisch verringert sich die Energieausbeute um den Faktor 10. Anders gesagt, dass man beim Thunfisch-Verspeisen 1000 mal weniger Kalorien bekommt als am Anfang seiner Nahrungskette.
Für alle Fischer gilt: sie säen nicht, aber sie ernten. Mit der Ausnahme: Fischzuchtanlagen in Küstennähe und im Landesinneren. Sie werden immer mehr, aber sie sind keine wirkliche Alternative zum Fang freilebender Fische. Die in Aquakulturen gezüchteten und gemästeten Fische brauchen tierisches Eiweiß und werden deswegen meist mit dem „Beifang“ und dem geschredderten Abfall der großen Fischfangflotten gefüttert. Rund 15 Kilogramm Fisch verzehrt jeder Bürger pro Jahr, Tendenz steigend. Bei Untersuchungen in Fischfarmen im Rahmen des Europäischen Schnellwarnsystems für Lebensmittel meldeten die Prüfer des Bundes in 183 Fällen Nachweise von Rückständen der Fisch-Arznei Malachitgrün, die im Verdacht steht, Krebs zu erregen und Erbgut zu schädigen. Zudem seien Abbauprodukte verschiedener Antibiotika und Antiseptika nachgewiesen worden. Bei Krustentieren meldete Deutschland dem Bericht zufolge 306 Mal den Fund solcher Abbauprodukte. Untersucht wurden Lachse, Forellen und Shrimps aus Aquakulturen von 2005 bis Ende März 2015.
.

Eine Krake auf der Bühne
.
Aber auch bei den Fischzuchtanlagen ist die Forschung anscheinend noch nicht am Ende: Der im Indopazifik lebende Kobia, auch Offiziersbarsch genannt, ein Verwandter der Stachelmakrele, ist ein stattlicher Speisefisch zugleich ein großer Räuber ist. Nun aber haben Forscher der University of Maryland einen vegetarischen Speiseplan veröffentlicht, der dem bis zu 70 Kilo schweren Tier offenbar schmeckt und bekommt, wie die Süddeutsche Zeitung berichtete. “Statt Fischmehl und -öl erhalten die Zwangs-Vegetarier eine Mischung aus Soja- und Weizen-Eiweißen, Amino- und Fettsäuren. Damit die Tiere ordentlich wachsen, braucht es zudem die Substanz Taurin, die auch in Energy-Drinks steckt.
Grund für die Ernährungsumstellung der Raubfische ist der enorme Appetit der Weltbevölkerung auf Fisch – und die sich stetig leerenden Weltmeere. Einst galten Aquakulturen als Lösung für dieses Dilemma. So stammten im Jahr 2010 fast die Hälfte aller weltweit konsumierten Fischprodukte aus solchen Farmen. Doch auch dort verlangt ein Raubfisch nach Sardinen, Anchovis und anderer Beute. Da auch deren Bestände schrumpfen, begannen Forscher ihre Umerziehungsprogramme. Soja statt Sardellen – da müssen außer dem Offiziersbarsch auch andere beliebte Speisefische durch.” ‚Wenn Sie ein Forellenfilet aus Aquakultur kaufen, stammt es mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Tier, das zu etwa 70 Prozent pflanzliche Kost gefressen hat‘, sagt Fischernährungsexperte Ulfert Focken vom Thünen-Institut für Fischereiökologie in Ahrensburg. „Zwingend notwendig“ sei es, den tierischen Anteil in der Fischnahrung zu reduzieren.
Der Spandauer Zierfischhändler und -züchter Benjamin Wohlfeld, der zu den größten deutschen Koi-Händlern gehört, hat diese Ernährungsumstellung 1994 aus Experimentierfreude erfolgreich bei Piranhas durchgeführt. Er nahm ein Dutzend junge fleischfressende Piranhas und setzte sie in ein Becken zu einem Schwarm vegetarisch lebender. Anfänglich ging es ihnen schlecht, sie hungerten, in ihrer Not fraßen sie den Kot der Piranhas – und nahmen damit die zur Verdauung der Pflanzennahrung notwendigen Bakterien auf. Danach waren sie umgestellt.
.

Anacaona
.
Dies aber nur am Rande. Jährlich werden weltweit etwa 80 Millionen Tonnen freilebende „Speisefische“ (einschließlich Garnelen, Muscheln und Tintenfische) gefangen. Hinzu kommen rund 40 Milllionen Tonnen aus Aquakulturen (in China stammen bereits 90% aller Nutzfische aus Aquakulturen, die dort eine lange Tradition haben.) In Deutschland will man sie nun staatlich fördern.
Es gibt hier keine Hochseefischerei mehr – nachdem der Bremerhavener „Nordsee“-Konzern seine letzten Schiffe nach Island und China verkauft und die Treuhandberater von Roland Berger die Fischfangflotte der DDR „versenkt“ hatten. Schon in den Achtzigerjahren hatte der Direktor Günter Ubl vom VEB Fischkombinat Rostock seinem Minister „zwei Varianten“ vorgeschlagen, damit nicht länger jedes Stück Fisch hochsubventioniert werden mußte: 1. Investititionen in Schiffe, Gebäude, Maschinen in Höhe von 3,6 Milliarden Mark – „unmöglich zu bewilligen“. 2. Ähnlich wie zuvor die BRD: die Fischereiflotte abschaffen und Fisch importieren – das hätte jedoch die DDR „politisch erpreßbar“ gemacht (immer wieder hatte der Westen Handelsembargos verhängt).
Der Thüringer Journalist Landolf Scherzer fuhr 1977 als Produktionsarbeiter 100 Tage auf dem Fang- und Verarbeitungsschiff „ROS 703 ‚Hans Fallada’“ des Fischkombinats. Anschließend veröffentlichte er seine Erlebnisse. Das Buch „Fänger und Gefangene“ erschien 1998 noch einmal – ergänzt um Interviews mit seinen ehemaligen Bordkollegen, die nach Abwicklung der DDR-Fischfangflotte fast alle arbeitslos geworden waren. Die Fahrt der „Fallada“ geht nach Labrador. Sie hatten von Lizenzhändlern eine kanadische Fanglizenz – mit Mengenbeschränkung gekauft. Als sie in ihrem Fanggebiet ankamen, waren dort schon zwei andere DDR-Fischereischiffe, sowie 2 polnische, ein dänischer, ein bulgarischer, und vier westdeutsche. „Die Hochseefischerei ist wie die Hatz auf Hirsche oder Wildschweine kaum über das bloße Erbeuten hinausgekommen,“ schreibt Landolf Scherzer. Die Geräte zur Ortung von Fischschwärmen sind allerdings immer effektiver geworden. Es geht um Kabeljau. In den Filetieranlagen, wo der Autor arbeitet, werden sie zerlegt. Die ersten Tage ist er überfordert von den stetig hereinkommenen großen Fängen. Er fragt sich: „Warum überhaupt Filets produzieren? Auch bei gut funktionierenden Maschinen wird dabei lediglich ein geringer Teil des Fischfleisches ausgenutzt. Alles andere wirft man in die Fischmehlanlage.“ Er redet mit einem Kabeljau. Das macht er dann auch während einer Sibirienreise am Baikalsee mit einem Fisch – wie er in seinem Buch „“Nahaufnahmen“ (1978 ) schreibt. Sein Fangschiff hat sich inzwischen in ein anderes Gebiet aufgemacht – um Rotbarsch zu fangen. Unterwegs verladen sie den bisherigen Fang – 1000 Zentner in 25 Kilo-Kartons – auf ein DDR-Transportschiff. Als sie nach Wochen noch immer keine großen Rotbarsch-Schwärme gefunden haben, kommt aus der Kombinatszentrale in Rostock die Anweisung: „Noch 4 Tage vor Labrador fischen, dann nach England dampfen und im Hafen von Falmouth Makrelen, die englische Fischer verkaufen, verarbeiten.“ Für ein Kilo zahlen sie 5 Mark. Auf der Rückfahrt nach Rostock müssen die Fische an Bord noch sortiert, gewaschen, geköpft, filetiert und gefrostet werden. In den Läden kostet das Kilo dann 1 Mark 40.
Seit auch noch die Schiffswerften des Bremer “Vulkan” in Konkurs gingen und mit ihnen die Zuliefererbetriebe, ist Bremerhaven die westdeutsche Stadt mit den meisten Arbeitslosen. Die um Musealisierung der Reste bemühten Historiker schreiben: „Das Kapitel Hochseefischerei ist in der deutschen Wirtschaft im Wesentlichen abgeschlossen. Deshalb hat sich 1997 ein ‚Arbeitkreis Geschichte der deutschen Hochseefischerei‘ gebildet, der vom Deutschen Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven wissenschaftlich betreut wird – und dazu beitragen will, die mit der Hochseefischerei verbundenen Erinnerungen zu sammeln, zu bewahren und aufzuarbeiten.“ Landolf Scherzer erfuhr von einem ehemaligen Hochseefischereikapitän 1997: „Vor einer Woche war ich im Deutschen Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven bei einer Veranstaltung des Arbeitskreises ‚Geschichte der Hochseefischerei’“. Dort fand er sein „Selbstwertgefühl“ wieder.
.

.
Der Arbeitskreis hielt die letzten noch lebenden deutschen Hochseefischer an, ihre Erlebnisse an Bord aufzuschreiben. Der ehemalige Matrose Jens Rösemann z.B. tat dies in Form eines Briefes an seinen Enkel Armin, er schrieb: “Vielleicht meinst Du, dass wir Tierquälerei betrieben hätten. So dachte ich zuerst auch. Vor allem hatte ich etwas Angst, wenn ich vor einem Kabeljau von über einem Meter stand, der mit dem Schwanz schlug und sein großes Maul aufsperrte. Aber so ist das in der Natur, einer frißt den anderen. Und wir lebten nun davon, dass wir Fische fingen. Später sah jeder von uns nicht mehr das einzelne Tier, das da an Deck lag. Es war Geld! Davon lebten wir und unsere jungen Familien daheim.”
Die Fische, die von den Bremerhavener Trawlern tonnenweise gefangen wurden, konnte man einzeln und lebend im Bremerhavener „Nordsee-Aquarium“ sehen. Das „Nordsee-Aquarium“ gab es seit 1913, es wurde 15 Jahre später um die “Tiergrotten” erweitert. Das Aquarium arbeitete, um seinen Fischbestand immer wieder aufzufüllen, mit dem Bremerhavener “Institut für Meeeresforschung” zusammen, das 1986 in das “Polarforschungsinstitut” integriert wurde. Die Lebendfische für das “Nordsee-Aquarium” kamen außerdem noch von der “Bundesforschungsanstalt für Fischerei”, zu der lange Zeit das Forschungsschiff “Anton Dohrn” gehörte. Das Aquarium wurde vom Fischpfleger und Aquarianer Werner Marwedel betreut. Als ich mit ihm einmal die Becken entlang ging, zeigte er auf einen flachen grauen Korallenfisch und meinte: “Das ist unser ältester Mitschwimmer – ein Doktorfisch. Ein Seemann – Herr Sielinsky – schenkte ihn uns. Er hatte ihn beim Tauchen im Roten Meer, nach dem 6- Tage-Krieg – als der Suez-Kanal gesperrt war, gefangen. Damals war er Fünfmarkstück groß.”
.

.
Der Leiter des Aquariums im Meeresmuseum Stralsund, Karl-Heinz Tschiesche, wurde ab 1983 fast schon systematisch von Seeleuten der DDR-Handelsflotte mit Korallenfischen versorgt, wie er in seinen Erinnerungen “Seepferdchen, Kugelfisch und Krake” (2005) schrieb. Weil er im Westen für eine Garnele, die 18 DM kostete bis zu 250 Mark der DDR zahlen mußte, für einen Schmetterlingsfisch gar 1000 Mark, griff er die Idee eines Matrosen auf, sich Fische aus dem Roten Meer, wo die Schiffe stets eine längere Liegezeit hatten, mitbringen zu lassen. Er rüstete daraufhin zwei Schiffe mit je zwölf Aquarien aus. Am Anfang waren die Verluste hoch, weil die Offiziere und Mannschaften keine Erfahrung mit den anspruchsvollen Korallenfischen hatten, aber dann kamen die Ehefrauen der Offiziere, die alle zwei Jahre mit auf Fahrt gehen durften, darauf, sich während der vier- bis sechsmonatigen Reise, da sie nicht arbeiten mußten, der Fische anzunehmen. Seitdem “war der Gesundheitszustand der Fische bei ihrer Ankunft in Rostock immer ausgezeichnet.” Und Tschiesche sparte zigtausende von Mark. Außerdem profitierte noch so mancher Aquarianer von den Fängen.
Die zunehmende Unrentabilität der deutschen Fischfangflotten lag nicht nur an der „Überfischung“ der Meere, sondern auch daran, dass die Küstenländer seit dem 16. Jahrhundert sukzessive die Allmende Meer, wo alle ernten und niemand säht (die DDR-Fischrestaurantkette nannte sich bezeichnenderweise „Gastmahl des Meeres“!), ihre Hoheitsgewässer ausgedehnt hatten, so dass nun bald eins ans andere grenzt. Vor allem, dass es Island nach drei sogenannten „Kabeljaukriegen“ gelang, seine Fischereigrenzen von nahezu Null auf 200 Seemeilen zu erweitern, führte zum Aus der deutschen Flotte. Die Restaurantkette „Nordsee“ und der Fischgroßhändler „Deutsche See“ werden jetzt von isländischen Fischfabrikschiffen beliefert, die für Deutschland nun die seit den Nazis gefürchtete „Eiweißlücke“ schließen. Helmut Schmidt hatte ihnen noch verboten, deutsche Häfen anzulaufen. Jetzt landen sie „Just-in-Time“ an. Aber auch den Isländern geht immer weniger Kabeljau, Rotbarsch und Schellfisch ins Netz, vom ehemaligen Armeleute- und Fasten-Fisch Hering zu schweigen. Zudem droht ein neuer „Kabeljaukrieg“ mit Norwegen – in Spitzbergen. Es gibt jedoch Hoffnung: Die Makrelen wandern immer weiter nordwärts – bis nach Island. Dort werden die Schwärme von isländischen Fischern gefangen. Die Fischer in der EU möchten den Makrelenschwärmen nachfolgen, aber die isländischen Kollegen sind schneller. Die EU droht Island in dem Streit nun mit Sanktionen. Der Klimawandel habe das Verbreitungsgebiet der Tiere verändert, verteidigt sich und seine Fischer Islands Fischereiminister: „Große Mengen von Makrelen fallen in unsere Gewässer ein. Das sind gierige Tiere, die auch anderen Arten Futter wegnahmen. Island hat Anspruch auf einen gerechten Anteil von dieser wandernden Art. Das kann niemand bestreiten.“
Nach dem Zusammenbruch fast der gesamten Küstenindustrie in Bremen und Bremerhaven, richteten die “Küstendenker”, wie der Spiegel die hanseatischen Kaufleute nennt, sich zunächst in Richtung Land aus, in Bremen sogar in die Luft: man investierte Millionen in ein “Spacecenter”, das allerdings schon nach wenigen Monaten pleite ging. Inzwischen hat man aber wieder umgedacht: Seit die industrialisierten Länder die Tiefsee entdeckt haben, d.h. die Bodenschätze im Meer und darunter. In Bremen und Bremerhaven gibt es nun gleich mehrere Meeresforschungsinstitute. „Die Tiefseeforschung ist jetzt Gold wert,“ so sagte es eine Bremer Meeresbiologin. Die Industriestaaten, Bergbaukonzerne und Investmentgesellschaften stecken bereits ihre Claims auf den Meeren ab – und sagen erwartungsvoll: „Grüß Dich, alter Ozean!“ Das Gold stand schon am Anfang der europäischen Entdeckungen und Eroberungen. Und nun an deren Ende. Jedenfalls auf der Erde.
.

.
Die Bremer Marine-Umweltforscher von „Marum“ und die Kieler Ozeanforscher von „Geomar“ teilten bereits 2012 mit: „Wettlauf um Erze aus der Tiefsee steht bevor“. Inzwischen hat er begonnen: Es geht dabei laut Wallstreet-Online-Journal um „die Lösung aller Rohstoffsorgen“, der Sender „n-tv“ titelte: „Milliarden-Geschäft am Meeresboden“. Kürzlich unterzeichnete z.B. die Bundesregierung bei der „Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) auf Jamaika einen Lizenzvertrag über die Exploration von Industrierohstoffen im Indischen Ozean. Östlich von Madagaskar haben Forscher der Bundesanstalt für Geowissenschaften schon mal einhundert Claims von jeweils zehn Mal zehn Kilometer Länge abgesteckt. Zuvor hatte der Wirtschaftsminister den Tiefseebergbau zur Chefsache erklärt. 2006 hatte Deutschland über die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe bereits eine Forschungslizenz im Zentralpazifik für Manganknollen bekommen. An den Eispolkappen werden große Öl- und Gas-Vorkommen vermutet. Das Madrider Protokoll von 1991 verbietet jedoch die Förderung von Bodenschätzen bis 2041. Vorher darf dort nur geforscht werden. Anders in der Arktis: Dort stehen sich Russland, die USA, Kanada, Norwegen und Dänemark gegenüber. Sie beanspruchen die wirtschaftliche Nutzung der Schifffahrtsrouten, des Meeresbodens und der unter dem Eis liegenden Schätze. Greenpeace meldet: „Shell bereitet sich derzeit auf Ölbohrungen im Arktischen Ozean vor der Küste Alaskas vor. Anstatt auf erneuerbare Energien zu setzen, machen sich die Ölkonzerne die Folgen des Klimawandels zu Nutze. Denn inzwischen ist die Eisdecke auf dem Arktischen Ozean besorgniserregend geschrumpft.“
Die Ausbeutung der mineralischen Ressourcen auf und unter dem Meeresboden setzt noch mehr Forschung voraus, um zu einer Folgeabschätzung zu gelangen, meinen die Meeresbiologen, bei denen man dann auch nicht mehr mit Forschungsgeldern knausert. Ich vermute, das hat auch etwas mit einer schleichenden Kritik am Neoliberalismus zu tun. Im Zuge dessen bekam nicht nur die Genossenschafts- bzw. Allmendeforscherin Elinor Ostrom als erste Frau einen (Wirtschafts-) Nobelpreis. Unter den Biologen in Ost und West, mindestens unter den Verhaltensforschern, kam gleichzeitig auch das Thema „Altruismus“ auf. Und dabei ging es vornehmlich um “Symbiosen” und ihre Erforschung.
Inzwischen macht es zudem eine neue Sequenziertechnik in den Labors möglich, ganze Lebensgemeinschaften und ihre miteinander sowie mit Bakterien verbundenen Stoffwechselprozesse quasi auf einmal zu analysieren, d.h. die Genome ganzer Proben – aus dem Meeresboden, dem Wasser oder der Luft. Man spricht dabei von „Holobionten“ und denkt dabei z.B. an den Mensch und seine Milliarden Bakterien, Pilze, Protisten in und an ihm und um ihn herum, ohne die er nicht lebensfähig ist, so dass man von einem „Individuum“ nicht mehr reden kann. Im biologischen Sinne gibt es kein Einzelwesen (mehr), wie der Biologe Bernhard Kegel sagt. Einige US-Forscher sprechen bereits von einer wissenschaftlichen Revolution, die “das klassische Konzept einer isularen Individualität transformiert in eines, in dem interaktive Beziehungen zwischen Arten die Grenzen eines Organismus verschwimmen lassen und das Konzept einer essenziellen Identität auflösen.”
.

.
Schon im 19. Jahrhundert hatten russische Symbioseforscher (am Beispiel von Flechten) und dann um 1900 der Anarchist Kropotkin mit seinem Werk „Die gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt“ den Darwinschen „Kampf ums Dasein“ als Entwicklungsgesetz der Arten relativiert. Kropotkin sah auch bereits voraus, dass man mit der Verbesserung der Mikroskopiertechnik noch weitaus mehr Symbiosen entdecken werdde. In Rußland hielt man das „Konkurrenz“-Prinzip sowieso für englisches Insel- und Händlerdenken, das in der russischen Weite keine Gültigkeit habe. Vor und nach dem Ersten Weltkrieg setzte dann vor allem in Wien eine regelrechte Forschungswelle ein, die – oft in Arbeiterbildungseinrichtungen – „Genossenschaften in der Natur“ thematisierte. Aber schon in den Biologieseminaren an den DDR-Universitäten war dann selbst das Wort „Symbiose“ verpönt. Im Westen galten die kleinen Forschungsgruppen um die US-Mikrobiologin Lynn Margulis, die bei den Bakterien unverdrossen weitere Kooperationen suchten und fanden, als Abweichler. Aber nun ist sie die unwidersprochene Vordenkerin – vor allem der Meeresbiologen, die sozusagen täglich eine neue Symbiose in der Tiefsee entdecken. Die Erkundung des Meeresbodens zwischen 500 und 11000 Metern geschieht mittels Roboterfahrzeugen, die filmen, Bodenproben nehmen, Temperaturen messen, Tiere von Steinen pflücken, Mikroorganismen einsaugen, chemische Analysen vornehmen usw..
Antje Boetius, Professorin für Geomikrobiologie in Bremen und Leiterin der Forschungsgruppe Mikrobielle Habitate im Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung Bremerhaven erklärte kürzlich, warum ihre Tiefseeforschung so wichtig ist: “Im Meer setzen sehr viele Tiere auf Kooperation, auf eine freundliche Zusammenarbeit. Die haben teilweise Wege gefunden, sich aus der Vielfalt an Bakterien genau die besten für sich selbst auszusuchen und die anderen alle wegzu-halten. Wenn wir so etwas auch können in der Medizin, dann hätten wir nicht mehr diese gräßlichen Probleme mit bakteriellen Infektionen.
Dann hätten wir auch eine Lösung für die Resistenzentwicklung bei Antibiotika. Denn wir bräuchten keine mehr. Wir arbeiten im Grunde falsch, wenn wir immer nur versuchen, neue Stoffe zu finden, die das Wachstum von Bakterien aufhalten. Die Bakterien lernen immens schnell und bauen ihre Zellwände oder ihre Proteine einfach ein bißchen anders und schon wirken die Antibiotika nicht mehr. Wenn wir aber die Tricks der Tiefseelebewesen kennen, wie man selektieren kann, wer oder was in die Zelle rein darf oder nicht, dann könnten wir vielleicht eine ganz andere Medizin entwickeln.”
.
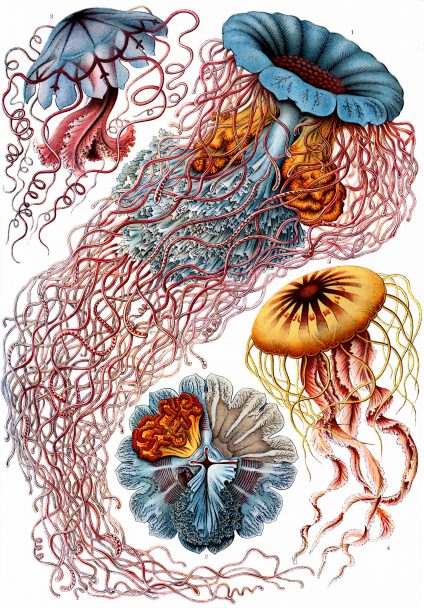
Ernst Haeckel: Quallen
.
Eine Kollegin und Freundin von Antje Boetius, Nicole Dubilier, Leiterin der Abteilung Symbiose im Bremer Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie erforscht seit Jahren einen Meereswurm, der weder Mund, Magen noch einen Darm hat – und sich trotzdem ernähren kann: Mit Hilfe von fünf Bakterienarten. Die Einzeller sitzen in einem Hautsack, liefern ihm Nährstoffe und entsorgen zugleich die Abfälle durch eine raffinierte Zusammenarbeit. Der Röhrenwurm lebt in Massen an “Schwarzen Rauchern” – kochend heiße Quellen in der Tiefsee, die aus dem Erdinneren sprudeln und zusammen mit schwarzen Wasser Schwefelwasserstoff ausstoßen. Seine Bakterien gewinnen daraus durch Sulfidoxidation Energie. Für Nicole Dubilier ist dieser Wurm ein wunderbares Beispiel für eine Symbiose – für das Zusammenleben von Lebewesen.
Einer solchen Symbioseforschung widmen sich weltweit Meeresbiologen, es sind mehr Frauen als Männer darunter. Für Nicole Dubilier ist das kein Zufall: „Ist doch klar, es geht um Kooperation.“ Aber die Männer unter den Meeresforschern haben auch ihren Spaß: 2012 zeigte das „Konsortium Deutsche Meeresforschung“ eine Leistungsschau in Oberbayern. Ihr Katalog dazu – „Tiefsee – Expeditionen zu den Quellen des Lebens“ – ist deswegen eher sehens- als lesenswert. Er endet technokitschig: mit Visionen des Designers Jacques Rougerie – schicke hochhausgroße U-Boote zum komfortablen Leben und Arbeiten in der Tiefe. Noch einen Schritt weiter gehen die Journalisten Wolfgang Korn und Ulli Kulke in ihrem 2015 erschienenen Prachtband “Lebensraum Meer. Menschen, Küsten, Handelsrouten“, in dem sie zuletzt die Seerechtsexpertin und Ökologin Elisabeth Mann Borgese zitieren, der zufolge das „landgestützte Dasein“ der Menschen vielleicht nur eine „Episode von kurzer Dauer“ ist – und folgern daraus: „Warum nicht, zurück in die Ozeane?“
Die Tiefseeforschung begann bereits mit der englischen Challenger-Expedition von 1872 bis 1876. Die “Challenger” war ein umgebautes Kriegsschiff mit Laboratorium, Aquarien, Kühlräumen, Mikroskopiertischen usw.. Sie war nicht bloß die erste globale Seeexpedition, die ausschließlich reinen Forschungszwecken diente, sondern auch die erste Tiefsee-Expedition – mit vielen Wissenschaftlern an Bord: “Philosophers” dort genannt. Sie brachten wichtiges Material über die geologische und zoologische Beschaffenheit des Ozeanbodens mit. Deren Bearbeitung dauerte allerdings Jahrzehnte. Dabei wurden 4717 neue Arten Meeresorganismen entdeckt, der Biologe Ernst Haeckel sollte die Ausbeute an Radiolarien bearbeiten, er benannte dabei über 3500 neue Arten, sein Bericht umfaßte drei Bände, sie erschienen 1888 – zunächst auf Englisch.
Noch während der Fahrt war kurz vor Tahiti der junge Biologe Rudolf von Willemoes-Suhm gestorben. Er hinterließ etliche Briefe an seine Mutter und an seinen Professor. Sie wurden 1984 unter dem Titel „Die Challenger-Expedition zum tiefsten Punkt der Weltmeere“ veröffentlicht – zusammen mit Auszügen aus dem Reisebericht des Schiffsingenieurs W.J.J. Spry. Am 17. Januar1873 schrieb Rudolf von Willemoes-Suhm z.B.: “Was das Leben an Bord anbelangt, so folgt ein Lunch auf den andern, wie die Dinners, in größter Regelmäßigkeit, und dazwischen wird gearbeitet und geraucht…Neben Zeichnen und Mikroskopieren nimmt das Wegstauen und Etikettieren der Sachen viel Zeit in Anspruch.” Am 31. August heißt es: “In den Windstillen fingen wir viele und schöne Tiere an der Oberfläche, namentlich des Nachts, weshalb ich oft bis spät aufblieb, um das Netz zu leeren.” Sie fingen aber auch Seehunde, eben alles Leben im und auf dem Meer. Auch Wale – mit einem extra Walfischboot, das jedoch bald kaputt ging.
Am 24.Mai 1874 beobachtet der Biologe in Sidney, dass die Trigonia-Muscheln mit ihrem dunklen Perlmutter-Lila bei den Damen sehr geschätzte Schmuckgegenstände abgeben. Wenn die Eingeborenen mit Teilen westlicher Kleidung herumlaufen mißfällt ihm das sehr. Auf der Insel Api, die zu den Neuen Hebriden zählt, lassen sie acht Einheimische von Bord, “die durch List oder Gewalt auf Arbeiterschiffen von ihrer Insel nach einer Plantage in Fidschi gebracht waren, wo sie drei Jahre gegen drei Pfund Sterling jährlichen Lohns dienen müssen.” (Die Neuen Hebriden wurden damals von England und Frankreich verwaltet, die Fidschiinseln gehörten der englischen Krone, und an die Stelle der Sklaverei war in der Südsee ein ähnlich schreckliches Kontraktarbeitersystem getreten.) In Ambon bemerkt von Willemoes-Suhm: „Die Chinesen wie die Malayen verkaufen Paradiesvögel zu circa 7 bis 10 englische Schilling das Stück, am Liebsten in Rum auszuzahlen.“ Eines der erlegten Tiere untersucht er auf Würmer. Auf einer der Aru-Inseln geht er selbst auf die Jagd nach Paradiesvögeln – auch wenn diese nichts weiter sind als “durch sexuelle Zuchtwahl entwickelte Krähen”, wie er sagt. Von Hongkong aus schreibt er seiner Mutter: “Mein Neger liegt leider an einer Lungenentzündung darnieder, von der er sich schwerlich wieder erholen wird; dagegen ist der Papagei wohl und gedeiht vorzüglich.”
.

Tahiti-Anacaona
.
1898 startete mit dem Dampfer “National” eine deutsche “Plankton-Expedition, die also gewissermaßen an der Oberfläche fischte. Im selben Jahr fuhr aber auch eine von der Frankfurter Senckenberg-Stiftung organisierte Tiefsee-Expedition – mit dem Dampfer Valdivia – von Hamburg los. Sie wurde von dem Zoologen Carl Chun geleitet. Neben umfangreichen Tiefenlotungen unter Leitung des Ozeanographen Gerhard Schott war das Sammeln von biologischen Proben das Hauptziel der Unternehmung. Die Ausbeute war so riesig, dass die Herausgabe des wissenschaftlichen Berichts in 24 Bänden erst 1940 abgeschlossen werden konnte. Im Berliner Naturkundemuseum ist der für Crustacea zuständige Wissenschaftler noch heute damit beschäftigt, die von der Valdivia-Expedition heimgebrachten Flohkrebse zu bearbeiten.
Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften schreibt über die Plankton-Expedition: “Mit eigens hergestellten Netzen, die auch den Fang allerkleinster Organismen erlauben würden, machten sich die Forscher unter Leitung von Victor Hensen, Professor in Kiel und Vorsitzender der Preußischen Meeres-Kommission, in den Atlantik auf – gewiß begleitet von den Hoffnungen der Fischereiwirtschaft, die Klärung der Frage nach dem Zusammenhang zwischen konzentrierten Vorkommen von Plankton und großen Fischschwärmen, weise den Weg zu sicheren und ergiebigen Fanggebieten. ‚Es ist Neues gefunden, mehr als mir lieb ist, namentlich unter den kleineren Formen‘, teilte Hensen mit.” Hinzu kam die Überraschung, dass die Menge des Planktons (altgriechisch: das Umherirrende, Treibende) in den tropischen Meeren geringer war als in den nördlichen.
Als die “Valdivia” im Indischen Ozean kreuzte, durch Gebiete, die ozeanographisch noch nicht erforscht und nicht ausgelotet waren, starb der Expeditionsarzt und Bakteriologe Martin Bachmann. Für ihn kam der Arzt G. Hay an Bord. Die Expeditionsteilnehmer begeisterten sich ebenso wie vor ihnen der Biologe Rudolf von Willemoes-Suhm auf der “Challenger” über das nächtliche Meeresleuchten: “Wir hatten neulich ganz herrliches Meerleuchten; die See war ein Feuermeer, herrührend von der Unzahl kleiner Infusorien (einzellige Wimpertierchen), die das Wasser ganz schleimig machten; auch die großen Feuerwalzen (Manteltiere, die aus mehreren tausend Einzeltieren bestehen können) tummelten sich im Kielwasser und gaben lebhaftes grünes Licht.”
Die Tiere können auf zwei Arten leuchten: Einmal durch eine Chemolumineszenz zwischen zwei organischen Molekülen: Luziferin und Luziferase genannt, bei deren Vermischung eine Photonen-Emission auftritt. An Land machen das z.B. die Glühwürmchen so. Die andere Möglichkeit ist, dass das entsprechende Tier zur Biolumineszenz fähige Bakterien anlockt und in bestimmte Körperteile einbaut, das Bakterium “Aliivibrio fischeri” u.a.. Das lässt sich leicht beobachten. Übergießt man einen Salzhering zur Hälfte mit Salzwasser und lässt ihn einige Tage im Kühlschrank stehen, kann man im Dunkeln die Bildung von Bakterienkolonien beobachten.
.

Queen Pomare IV. von Tahiti
.
Der von der Valdivia-Besatzung aus der Tiefe geholte kleine Tintenfisch “Vampirotheutis infernalis” leuchtet mit Hilfe der Bakterie “Aliivibrio fischeri”. Wie die neugeborenen Tintenfischchen diese finden (und wenn sie nicht mehr leuchten abstoßen) hat der Berliner Biologe Bernhard Kegel in seinem Buch “Die Herrscher der Welt: Wie Mikroben unser Leben bestimmen” (2015) erklärt. Die maximal fußballgroße Tiefseekrake, die in 1000 bis 4000 Meter Tiefe lebt, hat neben seinen lidbewehrten Augen zwei ebenfalls lidbewehrte “Leuchtorgane”. Darüberhinaus zwei dünne, aber sehr lange Spiralfühler und zwei ohrenartige Flossen. Der kleine achtarmige Tintenfisch hat zwar keine Tinte zum Verspritzen, dafür kann er sich jedoch bei Gefahr mit seinen Häuten zwischen den Fangarmen komplett ummanteln – und ist dann bloß noch eine stachelbewehrte rostrote Kugel mit hellen Flecken, die in der „abyssalen“ (abgründigen) „Sphäre“ – im sogenannten Meeresschnee – dahintreibt. Bleibt ein Freßfeind hartnäckig, sprüht sie ihm eine Wolke von Leuchtpartikeln entgegen und flüchtet hinter diesem Feuerwerk. Letzteres weiß man aber erst seitdem das Tier in der Tiefsee mit einem Tauchboot gefilmt wurde. Man kann sich die Aufnahmen von “Vampirotheutis infernalis” auf Youtube ansehen. Anders kann man ihm nicht begegnen. denn er implodiert in unserem himmlischen Universum und wir werden in seinem höllischen erdrückt.
Das Valdivia-Exemplar, über das der Zeichner des Tintenfisch-Experten Karl Chun urteilte: „Man meint, unser Herrgott hat alle Dummheiten, die er gemacht hat, in die Tiefsee verbannt,“ befindet sich heute in einem Glas mit Alkohol im Berliner Naturkundemuseum und sieht aus wie ein gelber Schrumpfkopf. Anläßlich einer Veranstaltung über das Tier wurde es hervorgeholt Der Kulturwissenschaftler Peter Berz führte u.a. aus: “Wir sind hart, haben ein Skelett, sind segmentiert und zweiseitig symmetrisch. Und während wir uns aktiv um unsere Nahrung bemühen müssen, treibt diese dem Kraken entgegen. Er muß bloß seine Tentakeln spreizen – wie ein aufgespannter Regenschirm mit dem Schlund in der Mitte. Gibt es schärfere Gegensätze als die zwischen ihm und uns?”
.
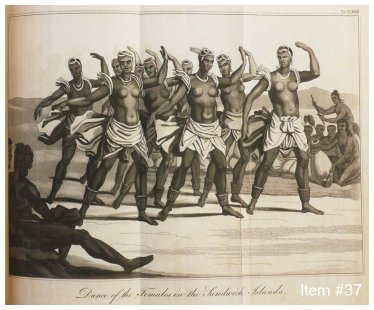
Südsee-Tänze
.
Zu einer etwas anderen Einschätzung war der Philosoph Vilem Flusser 1993 in seinem Buch über “Vampyrotheutis infernalis” gekommen: Er und wir haben vieles gemeinsam: Beides sind Sackgassen der Evolution. Zudem ist er ein Wesen, bei dem es nicht ausgeschlossen ist, daß es über das verfügt, was unsere Philosophen die Fähigkeit zur Weltanschauung nennen, denn sein tierisches Volumen und jener Teil, der die neuronischen Verknüpfungen beinhaltet, ist groß genug. Im Naturkundemuseum wurde anschließend ein Film über den Tintenfisch gezeigt: „Der Vampir aus der Tiefsee“. Die Aufnahmen machte ein US-Meeresbiologe, der ein ferngelenktes U-Boot bauen ließ, das er mit Scheinwerfern, Kameras und einer Fangvorrichtung ausrüstete. Damit beobachtete er einen Vampyrotheutis infernalis in großer Tiefe vor der Küste Kaliforniens, einen zweiten fing er ein, um damit aufzutauchen. Durch das Glas einer speziellen Druckkammer sah man dabei dessen langsames Sterben, das zuletzt gnädig weggeblendet wurde.
Der Soziologe Roger Caillois schrieb in seinem Buch „Der Krake“ (1986): Er “scheint aufrecht zu gehen wie ein Mensch. Sein kapuzenförmiger Kopf und die riesigen Augen erinnern an die als sadistisch verschrienen, in Kutten gehüllten Folterer einer geheimnisumwitterten Inquisition. Der Krake, dieses Hirntier, um nicht zu sagen, dieser Intellektuelle, beobachtet immerzu, während er agiert. Diese Besonderheit, die offenbar sein innerstes Wesen zum Ausdruck bringt, läßt sich sogar bei Hokusais wollüstigen Kraken feststellen: Er beugt sich über den Körper der nackten Perlentaucherin, die er in Ekstase versetzt, und läßt sie nicht aus den Augen, als verschaffe es ihm zusätzlichen Genuß, ihre Lust zu beobachten.“ Der Meeresforscher Jacques-Yves Cousteau meinte einmal: „Wenn ein Taucher die Augen eines großen Kraken auf sich gerichtet sieht, empfindet er eine Art Respekt, so als begegne er einem sehr klugen, sehr alten Tier.“ 1992 sorgten zwei Neurobilogen, Graziano Fiorito und Pietro Scotto, die mit in der Bucht von Neapel gefangenen Kraken Intelligenztests angestellt hatten, für Schlagzeilen, indem sie behaupteten, dass das Gehirn dieser Weichtiere ähnlich „hochdifferenziert“ wie das von Menschen sei, obwohl ganz anders aufgebaut besitze es ebenfalls die Fähigkeit des „Beobachtungslernens“.
Ich möchte noch auf den Hummer zu sprechen kommen: Der NDR meldete: „Der Hummer ist rund um Helgoland selten geworden. Früher bevölkerten rund 1,5 Millionen Hummer den felsigen Sockel rund um die Hochseeinsel. Bis zu 100 Fischerfamilien lebten in den 30er-Jahren vom Fang der Krustentiere – der einen großen Teil der Bevölkerung Helgolands ernährte. Damals wurden jedes Jahr 80.000 Fänge gemeldet. Seit 1980 finden nur noch 300 bis 500 marktreife Hummer jährlich den Weg in die Fangkörbe.“
.
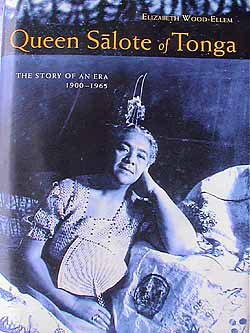
.

Tonga-Queen Salote
.
Während die Hummerforscher der Biologischen Anstalt Helgoland, die zur Bremerhavener Stiftung Alfred-Wegener-Institut und dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung gehört, ein Jahr lang 415 Hummer züchteten, die sie am Felssockel der Insel aussetzten, damit sich die dortige Hummerpopulation wieder erholt, deren „Ökosystem“ durch den „globalen Klimawandel durcheinander“ geriet, würde man an der Ostküste der USA stattdessen die Hummerpopulationen gerne künstlich reduzieren. Aus dem selben Grund – wegen der Klimaerwärmung nämlich – vermehren sich diese Edelkrebse dort wie noch nie: Jedes Jahr werden nun 10.000 Tonnen mehr gefangen, zudem werden die Tiere beunruhigenderweise immer farbiger. Laut den Behörden in der „Hummerhauptstadt“ Maine wurden 1990 knapp 13.000 Tonnen pro Jahr gefangen, 2012 jedoch bereits mehr als 57.000 Tonnen. Weil aber die Nachfrage nicht so schnell steigt wie das Angebot, fallen die Preise. „Nach Angaben eines Fischerverbandes in Massachusetts müssten die Einkäufer vier Dollar pro Pfund Hummer bezahlen, damit die Fischer keine Verluste schreiben. Tatsächlich würden aber nur etwas mehr als zwei Dollar bezahlt,“ heißt es im Deutschlandradio Kultur. Die Hummerfischer sind über ihre zunehmend üppigeren „Ernten“ alles andere als froh, denn das Überangebot macht mehr Arbeit und kostet mehr Benzin, gleichzeitig verdienen sie aber immer weniger. Jüngst kam es bereits zu einem heftigen Streit zwischen kanadischen und amerikanischen Hummerfischern, weil diese ihre Tiere in Kanada zu Dumpingpreisen verkauften. Nun setzen sie stattdessen ihre Hummer mehr und mehr in China ab, wo die neue Mittelschicht ganz wild auf den Edelkrebs ist.
Ähnliches gilt auch in Deutschland für die Neureichen: Auf der „Prominenteninsel“ Sylt gibt es z.B. einen Imbißstand, an dem man ausschließlich Hummer und Sekt bekommt. Und in Bayreuth sind seit 2013 Bratwürste aus Hummerfleisch der Renner. In den USA ist dagegen die einstige Armen- und Gefängnis-Kost Hummer drauf und dran, erneut zu einer solchen zu werden. Dort geraten die Hummerfischer auch noch immer häufiger mit den Tierschutz-Organisationen aneinander, die das Zubereiten der Großkrebse – z.B. auf der weltgrößten „Hummerparty“ in Maine – als barbarisch kritisieren: Die Tiere werden dort lebend in riesige Behälter mit kochendem Wasser geworfen. Das rohe Massenvergnügen in der „Hummerhauptstadt“ wurde vom Schriftsteller David Foster Wallace scharf kritisiert – und das ausgerechnet in einer amerikanischen Gourmet-Zeitschrift. Auf Deutsch erschien sein Essay „Am Beispiel des Hummers“ 2009. Argumentationshilfe lieferten ihm u.a. die US-Invertebratenforscher Fiorito, Sherwin und Elwood, die feststellten, dass Hummer „Nozizeptoren“ besitzen und demzufolge auch Schmerzen empfinden. Die hiesigen Tierschützer berufen sich auf eine schottische Studie von „Advocates for Animals“, die zu ähnlichen Ergebnissen kam, und fordern eine Gesetzesänderung: „Die derzeit gültige Verordnung über das Schlachten von Hummern stammt aus dem Jahr 1936, als über die Leidensfähigkeit der Krustentiere noch wenig bekannt war.“
.
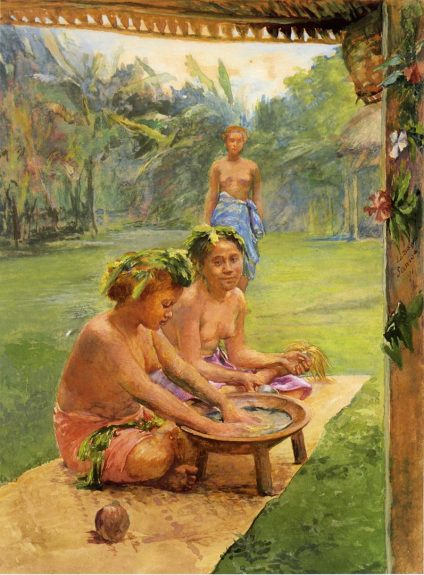
Kava-Zubereitung
.
Das gilt auch für Fische, aber ob und wie sie Schmerzen empfinden, ist schwierig zu erforschen. Subjektive Empfindungen, sogenannte “Qualia” können nicht objektiv erforscht werden, und das trifft z.T. auch auf den Schmerz zu. Untersuchungen haben jedoch gezeigt, berichtete “Die Zeit” 2014, dass Hechte, die mehrmals an einem Angelhaken hingen, mindestens ein Jahr lang einen großen Bogen um die Stelle machten, wo man sie erwischt hatte. Ein Forscherteam von Neurobilogen, Verhaltensökologen und Fischereiwissenschaftlern war jedoch 2013 zu dem Ergebnis gekommen, “dass Fische kein dem Menschen vergleichbares Schmerzempfinden haben,” wie die Süddeutsche Zeitung berichtete. Ihnen fehlen die dafür nötigen Gehirnstrukturen, was Angler schon immer vermutet hatten: no brain no pain. Forscher am Roslin-Institut in Edinburgh, die Forellen untersuchten, behaupten demgegenüber, dass ein schneller schlagendes Herz und ein veränderter Hormanhaushalt durchaus gleichbedeutend mit Schmerz sei. Ihnen wurde daraufhin vorgeworfen, nicht zwischen bewusstem Schmerz und “unbewusster Schadensmeldung” unterschieden zu haben.
.
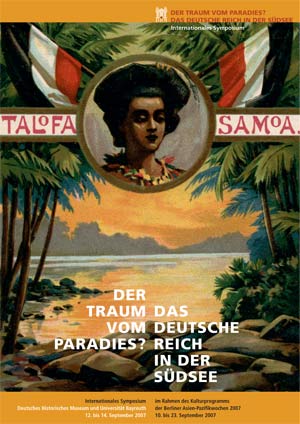
.
Bereits in den Neunzigerjahren hatte man jedoch die bei den Menschen wichtigen Neurotransmitter auch bei Fischen nachgewiesen. Neuerdings haben der Schweizer Philosoph Markus Wild und der Biologe Helmut Segner in einem Gutachten für die Schweizerische Ethikkommission das Fazit gezogen: Fische empfinden Schmerz. Diese Debatte um das Tierwohl erstreckt sich inzwischen auch auf die oft schrecklich engen Haltungsbedingungen von Fischen in Aquakulturen – insofern diese immer mehr Verbraucher nicht länger gleichgültig lassen. Bei einem zu dichten Besatz der Becken stehen die Fische ständig unter Stress, wie eine Studie der dänischen Fischökologin Caroline Laursen ergab. Auch die Hochseefischerei ist betroffen, weil in ihren Grundschleppnetzen die meisten Fische ersticken, und Fische aus großen Tiefen die Schwimmblase herausgequetscht wird. Der Schweizer Philosoph empfiehlt, keine Fische aus Hochsee-Wildfang mehr zu essen. Für Wale und Delphine haben die Fangverbote zwar die Belastung dieser Meeressäuger durch Fischer und Walfänger abgenommen, aber dafür hat die akustische Schmerzzufuhr – durch Schiffsmotoren, Luftpulser von Erdölkonzernen und das Einrammen von Pfählen für Windkraftanlagen – zugenommen. Und diese Lärmquellen können für die Tiere tödlich sein, behaupten Walforscher und Walschützer, zumal wenn ihr Hörorgan im Bereich der erzeugten Frequenzen besonders empfindlich ist. Die amerikanische Fischereibehörde will erst einmal genauere Forschungsergebnisse, bevor sie Lärmschutzmaßnahmen im Meer anordnet.
Der Gehörsinn von Fischen wird schon lange erforscht, ebenso ihre Lautäußerungen. Sie haben wie alle Wirbeltiere ein inneres Ohr und nehmen Geräusche mit der ganzen Körperoberfläche auf. Bei den meisten Arten werden die Geräusche auf die Schwimmblase übertragen, die als Resonanzboden wirkt, so wie bei Menschen das Trommelfell. Unter Wasser werden Töne zudem deutlicher wahrgenommen als über Wasser, weil sich dort der Schall 9 mal schneller fortpflanzt als in der Luft. Deswegen wurdden auch Aquarien in Kneipen vor einiger Zeit verboten: der Lärm ist eine Qual für die Fische.
Einer der ersten, der über ihren Gehörsinn forschte – mit Ellritzen in einem See neben seinem Haus, war 1932 der berühmte Entdecker der Bienen-Tanzsprache Karl von Frisch. Dabei war ihm die Frage aufgekommen, ob Fische erkennen können, woher der Schall kommt, denn ihnen sind die anatomischen Voraussetzungen dafür nicht, wie bei uns, gegeben. Sie können die Schallrichtung nicht erkennen, was er erwartet hatte, aber das führte ihn auf ein anderes Gebiet: Er hatte eine Ellritze gefangen und mit der Nadel einen bestimmten Nerv durchtrennt. Als er sie wieder ins Wasser entließ, flüchtete der ganze Schwarm und versteckte sich. Es stellte sich heraus, dass bei Verletzung der Haut einer Ellritze ein “Schreckstoff” ins Wasser gelangt, der für die anderen eine alarmierende Wirkung hat, sobald sie ihn riechen. Als Ergebnis vieler Versuche, auch mit anderen Fischen, stand für den Biologen fest, “dass ein Schreckstoff ganz allgemein bei Karpfenfischen vorkommt, zu denen fast ¾ unserer Süßwasserfische gehören.” Er berichtete darüber zuletzt in seinen “Erinnerungen eines Biologen” (1973).
Auch der Leiter des Aquariums in Stralsund erforschte die Lautäußerungen von Fischen. Dazu hängte er nachts, wenn keine Besucher mehr da waren, Unterwasser-Mikrophone in die Becken. Ähnlich verfahren die Meeresbiologen auf der Helgoländer Forschungsstation. Neuerdings wird diese regelmäßig von Fischforschungsforschern besucht: vom Team des Schweizer Wissenschaftshistorikers Christoph Hoffmann. Er erklärte kürzlich erklärte der Neuen Zürcher Zeitung, was ihn dort interessiere: “Schön ist an diesem Projekt, dass es drei Ebenen eröffnet. Die Fisch-Ökologen dort untersuchen, ob und wie Fische akustisch kommunizieren. Das Interessante für mich ist zum einen das Geisteswissenschaftliche, wo der Begriff der Kommunikation im Zentrum steht. Wenn Menschen kommunizieren, erkennt man das leicht. Bei Fischen von Kommunikation zu sprechen, verlangt zum andern aber nach neuen Kriterien. Diese müssen also zuerst definiert werden. Als Wissenschaftsforscher interessiert uns, wie diese entwickelt werden. Wir lernen dabei auch etwas über unsere eigenen Vorstellungen. Forschung an Tieren liefert oftmals den Anlass für Aussagen, was Menschen ausmacht. Auf einer weiteren Ebene spielt das Tier eine Rolle, das trotz eigenem Rhythmus mitspielen muss. Das Ziel des Forschungsprojekts muss also mit dem Leben des Tieres zusammengebracht werden. In den Forschungsperioden wird, damit man nicht in das Leben der Tiere eingreift, während sieben Tagen einfach das ganze akustische und optische Geschehen aufgezeichnet. Wir haben also riesige Datenmengen. Als dritte Ebene interessiert mich der Umgang mit dieser Datenflut.”
.

Alfred Wegener und Rasmus Willemsen
.
Die Helgoländer Ichthyologen (von griechisch ichthys: „Fisch“) haben eine Dependance auf Spitzbergen. Dort werden die “Habitate und Migrationen” von Fischen untersucht. Um dafür die notwendigen “konstanten Meßreihen zu erhalten, wurde vor der Küste die Unterwasserstation ‘RemOs’ installiert, die mit Meßsonden und Kameras bestückt aktuelle Daten wie Stereometriebilder, Temperatur, Trübheit oder Salzgehalt des Wassers ans Festland sendet. Über Remote und Datenstreaming kann aus großer Distanz auf diese Daten zugegriffen werden.”
Der Schweizer Künstler Hannes Rickli hat sie 2014 für eine Ausstellung “Fischen lauschen” in der Berliner Galerie der Schering-Stiftung “archiviert”. Daneben hatte er auch noch vor der Küste von Spitzbergen “sechs akustische Sensoren neben die Sonden” der Fischforscher unter Wasser installiert. Davon konnte man sich in der Galerie mit einem Kopfhörer überzeugen. Es passierte jedoch nicht viel unter Wasser, keine Fische, erst recht nicht sich miteinander unterhaltende. Dafür konnte jedoch der Künstler nichts, der die “akustische Kommunikation” ja bloß als “Daten vielspurig synchron ausspielt und damit eine vielschichtige Gleichzeitigkeit einer tausend Kilometer entfernten Forschungsrealität in den Raum der Galerie transportiert,” wie es im Beiblatt zu seiner Ausstellung hieß.
Bei einer anderen Fischforschung sind Laien und Wissenschaftler beteiligt. Es geht dabei um besonders billige Aquariumsfische: Guppys – kleine Süßwasserfische aus der Karibik, die sich in Gefangenschaft leicht züchten lassen – und das schon seit vielen Jahrzehnten, deswegen gibt es sie heute in einer überwältigenden Fülle an Farben, Mustern und Formen. Sie waren und sind im Osten wie im Westen beliebte Fische, die nach ihrem Aussehen gezüchtet werden (man veranstaltet mit ihnen „Championate“, in Moskau gibt es „Guppy-Wettbewerbe).
Daneben hat sich auch eine üppige Guppy-Forschung entwickelt. Das Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie berichtete 2014: „Bunte Guppy-Männchen haben die besten Chancen bei der Fortpflanzung“ – auch bei der Selektion durch Aquarianer, möchte man hinzufügen. „Für die Biologin Verena Kottler und ihr Team stellte sich die Frage, aus welchen Pigmentzell-Typen die Flecken männlicher Guppys aufgebaut sind. Nur dann ist es möglich, die Genetik, die den Farben zugrunde liegt zu verstehen. „Über das Verhalten der Tiere und die Ökologie weiß man mittlerweile schon sehr viel, aber die zugrundeliegenden genetischen Faktoren wurden bislang kaum untersucht“, betonte die Wissenschaftlerin.“ Wenn das getan ist, kann man als nächstes auch die Guppyfarben genetisch modifizieren, so wie es 1999 schon die Gentechniker an der National University of Singapore praktizierten, die das für das grün fluoreszierende Protein (GFP) codierende Gen aus der Qualle Aequorea victoria in das Genom eines Zebrabärblings klonierten (die Zeitschrift „Aquaristik“ behauptet dagegen, dass „diese Fische ein Gen für ein rot fluoreszierenden Protein aus einer Korallenart besitzen“). Die so gentechnisch veränderten Fische fluoreszieren jedenfalls bei Tages- und Kunstlicht – und heißen im Handel „GloFish“, ihr Verkauf ist in Deutschland aber verboten.#
.

Die letzte Königin von Hawaii
.
Einige englische Fischforscher beschäftigten sich mit der „sexuelle Belästigung“ von Guppyweibchen: „Wenn sich Weibchen untereinander bekämpfen und ‚rumzicken‘, sind Männchen daran nicht unschuldig. Das ergaben Versuche an Guppys. ‚Die Gegenwart von Männchen, die die Weibchen sexuell bedrängen, verändert das Sozialverhalten der Weibchen untereinander‘, berichteten die Wissenschaftler im Fachmagazin ‚Biology Letters‘ der britischen Royal Society. Die Weibchen verbrachten weniger Zeit miteinander und verhielten sich aggressiver gegenüber dem eigenen Geschlecht.“
Bei den etwa so groß wie Guppys werdenden Atlantik-Kärpflingen, deren Verbreitungsgebiet sich darüberhinaus mit dem der Guppys überschneidet, entscheidet sich das Weibchen angesichts zweier kämpfender Männchen danach eher für das „Verlierermännchen“, wie die Fischforscher David Bierbach und Martin Plath von der Goethe-Universität Frankfurt herausfanden. Sie erklären dieses Verhalten damit, dass Männchen nach einem gerade gewonnen Kampf die Weibchen stärker sexuell bedrängen. „Dieses Verhalten ist für sie stressig bis gefährlich: Sie wurden heftig bedrängt, vom Fressen abgehalten und ihr Genitaltrakt wurde häufiger als gewöhnlich beim Sex verletzt…Bei den Kärpflingen werden die vom Weibchen abgelegten Eier nicht wie bei vielen anderen Fischen vom Männchen im Gewässer befruchtet. Vielmehr geschieht die Befruchtung im Körper des Weibchens, das [wie die Guppys] lebende Junge zur Welt bringt.“ „Das Frankfurter Team hatte zuvor laut „Spiegel“ bereits berichtet, dass homosexuelles Verhalten von männlichen Kärpflingen die Weibchen anzieht. Ihnen sei es in dem Fall egal, welche geschlechtlichen Vorlieben ein Männchen habe, Hauptsache es habe Sex und zeige damit Aktivität an. Dieser ist offensichtlich weit attraktiver als ein siegreicher Kampf.“
Nicht als schwul, aber als Weibchen tarnen sich Männchen des australischen Riesentintenfisches, um ein Weibchen zu begatten, wie britische und amerikanische Biologen beobachteten. Die Zeitschrift „Focus“ berichtete: „Gemeinhin weisen die Tintenfisch-Damen 70 Prozent aller Annäherungsversuche ab. Zudem haben sie meist einen festen Partner, der den Großteil ihrer Eier befruchtet und Rivalen verjagt. Einzelgängerische Männchen färben ihre Haut blitzschnell ‚weiblich‘ und nehmen die Armhaltung Eier legender Weibchen an. Auf diese Art täuschen sie den Wächter, der die sich anschleichenden vermeintlichen Weibchen toleriert. In der Hälfte der Fälle kam es zum Geschlechtsverkehr.“ Aber dafür mußten die als Weibchen getarnten Männchen in Kauf nehmen, dass auch einige ihrer Geschlechtsgenossen versuchten, sich mit ihnen zu paaren.
Ein ähnliches Verhalten von Männchen gibt es im übrigen auch bei einigen Barschen: So tarnen sich z.B. die schwächeren Männchen der Buntbarsche aus dem Malawisee als Weibchen. „Weil das nicht immer perfekt gelingt, kann es zu heftigen Kämpfen mit tödlichem Ausgang kommen. Wenn jüngere Männchen stark genug sind, verdrängen sie das bisherige dominante Männchen,“ heißt es auf dem Aquarium-Forum „drta-archiv“.Die Abkürzung steht für „de.rec.tiere.aquaristik“, Näheres über diese „Community“ von Zierfischfreunden findet sich unter: https://www.drta-archiv.de/
Eine nicht sexuell motivierte Tarnung untersuchte der in England lehrende Biologe John Endler: Er bestückte zehn Aquarien mit möglichst farbenprächtigen Guppys der Art „Poecilia wingei“, die in Trinidad lebt. Die einen bekamen als Bodenschicht bunten Kies, die anderen bunten Sand. Dann teilte er diese beiden Gruppen noch einmal: Zwei blieben unter sich, die beiden anderen bekamen jeweils einen Fressfeind zugeteilt: entweder einen Buntbarsch (Crenicichla alta), der vor allem erwachsenen Guppys nachstellt, oder einen Zahnkärpfling (Rivulus hartii), der kleiner ist und sich eher an den Jungguppys hält. Die FAZ berichtete: „Auf diese Weise hatte Endler gleich vier Selektionsmechanismen eingeführt: erstens die Vorliebe der Guppyweibchen für besonders auffällige Männchen, zweitens deren höheres Risiko, gefressen zu werden, drittens die Chance, durch bessere Anpassung an die Umwelt zu überleben, viertens die Frage, wie sich eine Population entwickelt, wenn Nachwuchs und Sexualpartner unterschiedliche Überlebensraten haben.
Es dauerte keine 15 Generationen, und die vom Buntbarsch bedrohten Männchen hatten sich in ihrer Farbgebung weitgehend dem Untergrund angenähert – sie zeigten auf Kiesboden wenige große und auf Sandboden viele kleine Flecken. Die vom Zahnkärpfling verfolgte Population konnte sich größere Auffälligkeiten bei den geschlechtsreifen Männchen leisten, weil ihr Feind ja nur am Nachwuchs interessiert war, der noch nicht ausgefärbt zur Welt kam. Es dauerte allerdings länger, bis sich die Reproduktionsraten eingependelt hatten: Nach dreißig bis sechzig Generationen kamen in den Barschbecken wesentlich mehr Guppys zur Welt, die gleichzeitig deutlich kleiner waren und früher geschlechtsreif wurden. Im Kärpflingsbecken hatte der gegenteilige Trend eingesetzt: Weniger, dafür kräftigerer Nachwuchs, der sich seinerseits später fortpflanzte.“
.
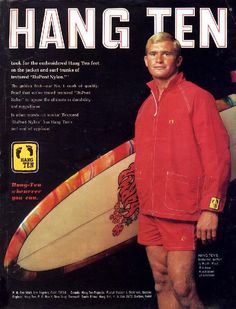
.
In den Sechzigerjahren starteten amerikanische Fischforscher ein Experiment mit Guppys, dass die Frage der Überfischung im Modell klären sollte. Dazu richteten sie zwei Aquarien mit ähnlichen Guppypopulationen ein. Aus einem fischten sie regelmäßig einige ab. Die Fruchtbarkeit der Guppys konnte das lange Zeit ausgleichen, aber ab 50% „reichte die Vermehrungsfähigkeit nicht mehr aus,“ schreibt H.W.Stürzer, der sich als Chefreporter der „Nordsee-Zeitung“ jahrzehntelang mit der Fischwirtschaft beschäftigt hat, in seinem Buch „Tatort Meer“ (2005). Es ging den Amerikanern bei ihrem Guppy-Experiment darum, den „sozialistischen Weg zum Reichtum der Fischgewässer zu widerlegen.“ Die Sowjetunion hatte nämlich 19 Millionen Ostseeheringe im schwach salzhaltigen Aralsee ausgesetzt und dieser relativ kleine Schwarm hatte sich schnell vermehrt, was die sowjetischen Fischforscher auf die größere Fresskonkurrenz in den dichten Schwärmen der Meere zurückführten. Sie folgerten daraus laut Stürzer: „Intensiver Fischfang halte die Schwärme kleiner und begünstige das Wachstum der Überlebenden. Überfischung war zu einem Prinzip des immerwährenden Reichtums geworden.“ Die amerikanischen Guppys hatten nun bewiesen, dass das ein Irrweg war, aber die Bundesforschungsanstalt für Fischerei in Hamburg unterstützte die sowjetische Theorie weiterhin, indem sie 1963 verkündete, dass der Schollenbestand an der deutschen Nordseeküste eine jährliche Abfischrate von 70% klaglos überstehen würde. Die Bremerhavener „Nordsee-Zeitung“ schrieb daraufhin: „Eine optimale Ausnutzung des Meeres macht also eine recht intensive Befischung sogar notwendig.“ Dabei hatte schon die bisherige Ausnutzung dazu geführt, dass die Fänge immer mehr zurück gegangen waren, von 20 westdeutschen Reedereien arbeiteten 18 bereits mit Verlust. Der Verband der Hochseefischerei forderte in dieser Situation: Zinsverbilligung für Neu- und Umbauten und die Suche nach neuen Fanggebieten. Nur so sei die Katastrophe zu verhindern. Alte Fanggebiete seien ausgefischt oder hinter vorgeschobenen Seegrenzen von Küstenstaaten nationalisiert (allein 140 Meerengen sollten Staatsgebiete werden. Die Sowjetunion machte es vor: „Sie entwickelte eine Flotillenfischerei nach Walfangmuster und ließen – in Kiel! – eine Serie von 24 mittelgroßen Heckfängern bauen zudem in Leningrad einen Super-Fänger…Für dessen Besatzung waren 582 Kojen vorgesehen, davon 270 für Industriearbeiter. Sie sollten auf einer Reise 10.000 Tonnen Frostfisch oder 10 Millionen Fischkonserven produzieren.“ Stürzer titelte „Fischbestände schrumpfen – Flotte wächst“. Zur besseren Bewirtschaftung der Fischbestände fand 1971 eine Konferenz in Moskau statt. Die sowjetischen Fischereiexperten drehten dort ihre im Aralsee gewonnene Fang-Theorie um: „Durch Verminderung des Fischereiaufwands um die Hälfte könnten die Erträge von jährlich neun Millionen Tonnen im Nordostatlantik nicht nur erhalten, sondern noch gesteigert werden…Für Mindestmaschen sei es bereits zu spät, deshalb sollten Gesamtfangmengen und daraus Fangquoten für die einzelnen Länder festgelegt werden.“
Vier Jahre später luden amerikanische Fischereiexperten von der „National Oceanic and Armospheric Administration“ erfahrene Heringsspezialisten und ihre sowjetischen Kollegen, die Heringe in den Aralsee verpflanzt hatten, ein, an einer Expedition zur „Georges Bank“ vor dem Golf von Maine, um dort in 32 Meter Tiefe das Ablaichen von Heringen zu verfolgen. Dazu charterten sie vom Helmholtz-Zentrum in Geesthacht das Unterwasserlabor „Helgoland“. U.a. fanden sie heraus, dass es viele auch innerartliche „Larvenräuber“ gibt und dass die kommerziell genutzten Bestände an Kabeljau, Schellfisch und Plattfische zurückgehen, während die Zahl der Knorpelfische – Rochen und Hundshaie – zugenommen habe. Diese fraßen die letzten Heringsschwärme: „Nur noch ein totaler Fangstopp wie in der Nordsee“ hätte laut Stürzer „die Heringe vielleicht retten können.“ Die Amerikaner zogen aus dem Forschungsergebnis jedoch den genau gegenteiligen Schluß: Sie motivierten ihre Fischerei mit zinsgünstigen Darlehen zum weiteren Ausbau ihrer Fangflotte.
.

Südseeinsulanerin mit Zierfischen
.
Inspiriert von den LSD-Versuchen der Harvard-Psychologen und der Armeeführung in den USA und England wollte ein Bekannter 1977 ebenfalls damit experimentieren, traute sich dann aber nicht und schmiss testete die Droge erst einmal bei seinen Fischen. Er besaß ein Aquarium – mit großen und kleinen Fischen. Die kleinen, Guppys, obwohl in der Überzahl, hatten unter den großen, Hechtlingen, gelegentlich zu leiden, vor allem fraßen sie ihnen regelmäßig den Nachwuchs auf. Nachdem er einen LSD-Trip ins Wasser geworfen hatte, verkrochen sich die großen hinter Steinen und Pflanzen, während die kleinen sich zunächst oben an der Wasseroberfläche sammelten. Dann schwammen sie zu den großen – und attackierten sie, so lange, bis sie tot waren.
Diese Geschichte kam mir wie ausgedacht vor. Aber dann las ich 2013 im „Spektrum der Wissenschaft“, dass zwei Zoologen der schwedischen Universität Umea die Wirkung von Medikamenten-Rückstände in Gewässern untersucht hatten, konkret: den Effekt des angstlösenden Wirkstoffs Oxazepam auf einheimische Flussbarsche (Perca fluviatilis). Sie beobachteten anschließend deren Verhalten vor und nach Zugabe von Oxazepam zum Wasser und stellten fest, dass die Fische durch das Präparat aktiver wurden, schneller fraßen und bereitwilliger neue Beckenbereiche erforschten. Die Barsche verbrachten außerdem weniger Zeit in der Gruppe. „Normalerweise sind Barsche scheu und jagen in Schwärmen. Das ist eine bewährte Überlebensstrategie. Doch diejenigen, die in Oxazepam schwimmen, sind wesentlich mutiger“, meinte einer der Forscher.
Neuerdings widmen sich auch in Moskau einige Fischforscher den Guppys: Sie untersuchten drei Populationen, die in der Moskwa leben – „dort wo eintretende Wärme von Heizkraftwerken für die nötigen Temperaturen sorgt. Jede der Populationen entwickelt endemische Eigenheiten,“ wie „moskau.ru“ 2014 berichtete.
Der Wiesbadener Kurier berichtete 2014 über den Gilbach, ein Nebenfluß der Erft, die in den Rhein fließt. Die Anrainer nennen das schmale Gewässer “Guppybach”. Ein Kraftwerk speist sein 30 Grad warmes Kühlwasser darin ein. Nicht nur ein Aquarianer scheint sich dort seiner Wassertiere entledigt zu haben: Neben Guppys und Zebrafischen leben im Bach auch noch Garnelen und tropische Schnecken. Die Guppys sind allerdings blasser und magerer als ihre Verwandten in Aquarien, was der Autor sich so erklärt: “Wer zu bunt leuchtet, wird schnell selbst zum Futter”.
In Berlin erzählte mir ein Techniker im Berliner Kraftwerk Rummelsburg, dass er zu Hause ein Aquarium mit Guppys besaß. Als er in Urlaub fahren wollte, wußte er nicht wohin damit und entsorgte sie deswegen im Kühlsystem des Kraftwerks. Jahre später mußte das System überholt werden – und dazu das Kühlwasser abgelassen werden, dabei kamen mehrere Zentner Guppys mit raus.
Von einer jungen Aquarianerin erfuhr ich: Eine Freundin von mir habe ich mit meiner Aquariumsleidenschaft angesteckt, die hat sich daraufhin auch ein Becken gekauft – mit vier an sich wenig anspruchsvollen Fischen: 2 Mollys, das sind lebendgebärende Zahnkarpfen, und 2 Platys, Spiegelkärpflinge aus der selben Familie. Aber die haben eine fast nicht heilbare Bauchwassersucht bekommen. Sie wollte die Fische aber nicht töten und hat sie dann in der Spree ausgesetzt. Ich war zuerst entsetzt, dass die vielleicht andere Fische anstecken, aber wahrscheinlich haben sie nicht lange in dem Flußwasser gelebt. Auch Guppys werden da manchmal ausgesetzt. Und im Brunnen nahe dem Dom lebt ein Krebs, den haben sie wahrscheinlich auch dort reingesetzt, ebenso wie die Wasserschildkröten im Engelbecken und im See des Thälmann-Parks.“
Es geht auch anders. Die Fischforscherin Ellen Thaler schreibt: “Ich werfe einige bedauernswerte Guppys in mein Salzwasser-Aquarium, die alle in Windeseile meine alte Clownfisch-Frau schnappt und ihrer Anemone verfüttert.”
.
(Vortrag gehalten im Steglitzer Antiquariat “Hennwack” – Ausgangsmaterial für das 2016 in der Reihe “Kleiner Brehm” erschienene Buch “Fische”. )
.

.
.
2. Surfer/Wellenreiter/Beachcomber/Strandläufer/Strandpenner/Omoos/Bezznesser/Beach-Boys/Skateboarder
Das Surfen kam wie fast alles aus Amerika über uns. Noch vor der Hippie-Bewegung entstand an den kalifornischen Stränden eine Surfer-Scene und eine „Surfmusik“, die mit den 1961 gegründeten „Beach-Boys“ berühmt wurde. Der harte Kern der Surfer bestand aus „Aussteigern“, sie lebten quasi am Strand. Wenn sie keine reichen Eltern hatten, schlugen sie sich mit Gelegenheitsjobs, als Surflehrer oder Surfequipmentverkäufer, mit Drogenhandel, Diebstahl oder Schnorren durch. Ansonsten versuchten sie, ihre Ausgaben zu minimieren, indem sie die Haare lang wachsen ließen, halbnackt herumliefen und betont entspannt wirkten, am Liebsten hingen sie am Lagerfeuer oder Grill ab, ihr „Beach-Lifestyle“ galt als Leben „im Einklang mit der Natur“. 1968 veröffentlichte der Schriftsteller Tom Wolfe eine größere Reportage über sie: „The Pump House Gang“. Dabei handelte es sich um Jack Macpherson und seine Surfer-Gang, die sich an der alten Kläranlage am Windansea-Strand in La Jolla trafen.
Damals lebte auch der Schriftsteller Thomas Pynchon noch in Kalifornien, 2010 kam er auf die Hippie-Zeit in seinem Roman „Natürliche Mängel“ zurück, der ebenso wie dann auch der Krimi von Don Winslow – „Kings of Cool“ – an südkalifornischen Stränden spielt und sich vornehmlich um die dort konsumierten Drogen dreht. Während Pynchons Detektiv ein vergrübelter Kiffer ist, dem seine jeweiligen Fälle eher wegschwimmen, ist Winslows Surfer „Doc“ ein Macher. Zitat: „Der Doc gibt Stan und Diane Tacos. Stan und Diane geben dem Doc Acid. Der Doc geht wieder ins Wasser, schwingt sich auf eine Welle und entdeckt, dass die Welle aus denselben Molekülen besteht wie er selbst, so dass er gar nicht eins werden muss mit der Welle, sondern bereits eins ist mit ihr, dass wir alle dieselbe Welle sind. Der Doc kommt mit seinen Surferkumpels wieder zu Stan und Diane und alle werfen sie Trips. Was jetzt entsteht, ist der schlimmste Alptraum der Republikaner von Orange County – die übelsten antisozialen Elemente (Surfer und Hippies) vereinen sich in einem dämonischen, berauschenden Fest der Liebe und planen, es zu einer festen Einrichtung zu machen. Stan und Diane verkaufen das Tibetanische Totenbuch, das Anarchist Cookbook und On the Road, außerdem Räucherstäbchen, Sandalen, psychedelische Poster, Rockplatten, Batik-T-Shirts, Freundschaftsbändchen, das ganze Hippie-Zeug, und verteilen Acid an die Angetörnten.“
In einer Rezension heißt es: „Winslow beschreibt den Sündenfall Kaliforniens. Als Hippies und Surfer zusammentrafen, verlor das Paradies seine Unschuld. In der Gegenkultur grassierte plötzlich ein Krankheitskeim. Und der hieß: Geldverdienen…Ausgerechnet die Outlaws also, die für das andere, neue, süße, freie Leben standen, fanden Geschmack an den harten Dollars, die nicht zuletzt im Drogengeschäft zu verdienen waren. Das Geld wurde in Immobilien investiert.“
.

Artwork Earl Nor
.
Die taz und der Spiegel interviewten dazu 2012 den internationalen Surfstar Darryl Virostko, der aus der „Westsiders-Gang“ im nordkalifornischen Santa Cruz stammt. „Drogen und Gewalt gehörten zur Surfszene dazu und Santa Cruz war schon immer eine Drogenstadt,“ erklärte er ihnen, „die Leute hier haben eine Menge Geld damit verdient. In den Achtzigern kostete ein Kilogramm Gras 10.000 Dollar – da haben viele der Surfer im professionellen Stil Marihuana angebaut. Die Hälfte der Surffirmen in Santa Cruz wurde mit Drogengeld gegründet.“ Der Big-Wave-Surfer, der drei mal den „Mavericks Contest“ in 20 Meter hohen Wellen gewann, wuchs in dieser Kultur auf, „also kannte ich es nicht anders. Wir rauchten vor der ersten Session eine Bong, und am Ende des Tages trafen wir uns auf ein paar Bier. Und wenn man zu betrunken wurde, zog man sich eine Line Koks rein. Meine erste Session in Mavericks, damals ein sagenumwobener Secret Spot, surfte ich 1991 nach einer durchgemachten Nacht, völlig high. Es war easy, ein großer Spaß. Damals war das Leben eine endlose Party.“ Verheiratet strebte Virostko jedoch eine Surferkarriere an – und meint nun rückblickend: „Als Surfprofi ist man ständig fremdbestimmt. Die Reisen zu Surfmessen, Demo-Touren und Shop-Eröffnungen saugen einen aus. Jeder Surfer, der zu viele Sponsorentermine wahrnehmen muss, baut ab. Es gibt da nichts anderes zu tun, als sich zu betrinken. Man reist mitten im Sommer tagelang in einem Wohnmobil durch New Jersey, klappert Strand um Strand ab, um Hände zu schütteln, obwohl gar keine Wellen da sind. Auf diesen Reisen hat fast jeder ein Alkoholproblem…Nach einer Surfsession in Mavericks fällt man in ein Loch, wenn man keine sinnvolle Beschäftigung an Land hat. Mein Leben entglitt mir ab 2007 immer mehr. Aber ich war nicht der Einzige. Chrystal-Meth mischte die Surfszene auf. Anthony Ruffo fing als erster Westsider mit dem Zeug an, fast alle anderen folgten ihm. Auch auf Hawaii sind viele Profis süchtig geworden.“
Auf Hawaii wurde das Surfen vor 4000 Jahren erfunden. Deswegen kamen dann auch immer wieder die „Surfstars“ von dort. In ihrer Studie über die Wellenreiter „The American Surfer – Radical Culture and Capitalism“ (2011) bezeichnete die amerikanische Soziologin Kristin Lawler den hawaiianischen Surfer Buttons Kalihiokalani als „’black is beautiful‘ poster boy“, dessen „image of the primitive-looking, free-living, love-and-peace-aloha brown man“ für eine „Gegenkultur“ zu der des weißen „clean cut male“ stehe. Einen anderen hawaiianischen Schwimmer und Surfer, Duke Kahnamoku, der in den Zwanzigerjahren nach Kalifornien kam und dort als Strandwächter acht in Seenot geratene Fischer mit seinem Surfbrett rettete, nennt die Soziologin eine „Verkörperung des Surfers als Edlen Wilden“.
.

.
Die Rousseauschen Edlen Wilden begeisterten auf den Südseeinseln schon die Mannschaften der Walfangschiffe und die ersten englischen, russischen und französischen Weltumsegler – die Südsee-Entdecker. Z.B. Georg Forster, der als Sechzehnjähriger James Cook auf seiner 2. Südseeereise begleitete (auf der 3. wurde Cook 1779 von Eingeborenen auf Hawaii getötet). Über Georg Forster heißt es in einer Biographie von Klaus Harpprecht: „Er hat mit seinen Erzählungen von Tahiti einen Traum in die Herzen der Deutschen gesenkt.“ Forster bezeichnete in seinem vielgelobten Bericht „Reise um die Welt“, ebenso wie nach ihm der Weltumsegler Adelbert von Chamisso, die Südseeinsulaner als „Meervolk“, weil sie oft und gerne ins Wasser gingen und ausgezeichnet schwimmen und tauchen konnten, wobei es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gab: Auf vielen Inseln fuhren die ersteren geschmückt und mit Begrüßungsgeschenken in Booten raus, mit denen sie sich den fremden Schiffen näherten, während die Frauen nackt rausschwammen und quasi sich zur Begrüßung anboten.
Der russische Expeditionsleiter Adam Johann von Krusenstern schrieb in seinem Bericht „Reise um die Welt 1803-1806“: Als ihr Schiff in der Südsee vor der Insel Nuka Hiwa ankerte, kamen die Eingeborenen in ihren Booten ans Schiff: „Mit Untergang der Sonne gingen jedoch alle Männer ohne Ausnahme wieder an Land. Mehr als 100 vom weiblichen Geschlechte blieben aber noch in der Nähe des Schiffs, um welches sie schon seit 5 Stunden herumschwammen.“ Nachdem es dunkel geworden war, baten „diese armen Geschöpfe in einem so jämmerlichen Tone, ins Schiff kommen zu dürfen, dass ich endlich die Erlaubnis dazu gab. Ich konnte auch desto eher in diesen Stücken nachsichtig seyn, da ich auf dem Schiffe nicht einen einzigen venerischen Kranken hatte, und Roberts [der Bordarzt] mir die Versicherung gab, dass diese Krankheit bis dahin auf dieser Insel nicht bekannt geworden wäre.“
.
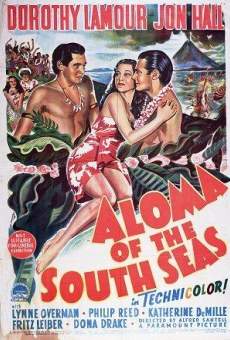
.
Ähnlich verhielt sich auch der russische Weltumsegler Otto von Koetzebue den nackten nassen Frauen gegenüber. Aus seinem Reisebericht „Zu Eisbergen und Palmenstränden“ (1821) geht hervor, dass er sich in den nördlichen Meeren nur kurz aufhielt, über die Südseeinseln schrieb er: „wir schwelgten im Genuss dieser paradiesischen Natur“.
Der französische Weltumsegler Louis Antoine de Bougainville wollte nicht nur genießen, sondern nahm 1768 gleich Tahiti und einige weitere polynesische Inseln drumherum für Frankreich in Besitz, wobei er Tahiti in „Neu-Kythira umbenannte – in Anspielung an das antike Kythira: Aphrodites „Liebesinsel“. Bis heute ist „Französisch-Polynesien“ eine Kolonie, wo bis 1996 die französischen Atombombenversuche stattfanden. Andere Südsee-Inselgruppen nahmen die Holländer, Engländer, Deutschen und zuletzt die Amerikaner in Besitz, die dort ebenfalls eine Insel – das Bikiniatoll – mit Atombomben in die Luft sprengten.
1817 unternahm der französische Fregattenkapitän Louis Desaulces de Freycinet mit einigen Wissenschaftlern an Bord eine dreijährige Südsee-Expedition. Es gab dort noch viel zu entdecken und zu kolonialisieren. Die etwa 30.000 Südseeinseln verteilen sich im Stillen Ozean auf ein Gebiet, in dem alle Kontinente der Erde Platz hätten. Motiviert von den Berichten der Weltumsegler machten sich in der Folgezeit zigtausende Abenteurer, Kopra-, Sandelholz-, Perlen- und Menschen-Händler sowie Kolonialbeamte, geflüchtete Sträflinge, desertierte Seeleute und Projektemacher aus Europa und den USA zu diesen paradiesischen Inseln auf. Mit der Folge, dass über die Hälfte der Eingeborenen von ihnen und ihren eingeschleppten Krankheiten ausgerottet wurde. Den Überlebenden gewöhnten die protestantischen und katholischen sogenannten „Kannibalenmissionare“ die Menschenfresserei ab, sie verboten ihnen außerdem ihre heidnischen Tänze und Lieder, ihre Nacktheit, ihre Vielehen und ihre freizügige Sexualität. Alle diese europäischen Weltverbesserer zusammen sorgten aber vor allem dafür, dass das Privateigentum auf den Südseeinseln durchgesetzt wurde und der Geschenketausch einem Warentausch wich.
Von den Weißen, den Papalagi, wurden dabei jedoch nicht alle reich und selig – viele strandeten, wie der Südsee-Ausdruck für diese Gescheiterten lautete. Dazu gehörten oft auch die Südseeinsulaner selbst, die man als Sklaven und später als Kontraktarbeiter für Plantagenarbeiten auf andere Inseln verschleppt hatte und die es mangels einer Passage nicht wieder nach Hause schafften. Alle diese Gestrandeten wurden „Beachcomber“ genannt, Strandpenner bzw. Strandläufer, wie sie auf Deutsch schlecht übersetzt heißen, dabei liefen oder joggten sie nicht wie etwa unsere Sylt- und Rügenurlauber am Wellensaum entlang, sondern lagerten eher am Strand unter den Kokospalmen und verdämmerten langsam mittels Alkohol, Opium und seltsamen Krankheiten. Diese Beachcomber, das sind die eigentlichen Vorläufer der Surfer.
.

Europa gestützt auf Amerika und Afrika
.
Vor allem amerikanische Schriftsteller haben Bücher über sie geschrieben: Robert Louis Stevenson und seine Frau Fanny Osbourne, die sich zuletzt eine Plantage auf Samoa kauften, Jack London und seine Frau Charmian Kittredge, die mit ihrer Yacht zwischen Hawaii und Australien kreuzten, Herman Melville, der selbst als Seemann auf Walfangschiffen zwei Mal zu einem Beachcomber herabkam. Von einem desertierte er auf eine Südseeinsel, wurde von den Eingeborenen gefangen genommen und floh auf einem anderen Walfänger. Weil er sich auf diesem an einer Meuterei beteiligte, kam er auf Tahiti ins Gefängnis; von dort gelang ihm die Flucht auf einem weiteren Walfänger, den er auf Hawaii wieder verließ. Seine Erzählungen „Taipi“ (1846) und im Jahr darauf „Omoo“ handeln davon.
Robert Louis Stevenson schrieb eine ganze Reihe „Südsee-Geschichten“, in einer, „Die Ebbe“, die von drei Beachcombern handelt, heißt es gleich zu Anfang: „Versprengte Männer vieler europäischer Rassen und fast jedes gesellschaftlichen Stands sind überall in der Inselwelt des Pazifik verbreitet. Manche kommen zu Wohlstand, manche vegetieren dahin. Manche haben die Stufen von Thronen bestiegen und herrschen über Inseln und Flotten. Wieder andere müssen heiraten, um ihr Leben fristen zu können; im nichtsnutzigen Müßiggang werden sie von einer drallen, lebenslustigen, schokoladenbraunen Dame ausgehalten; dann stolzieren sie wie Eingeborenen gekleidet umher, behalten aber in Haltung und Gestik ein gewisses fremdländisches Gehabe, vielleicht noch verstärkt durch ein Überbleibsel des Offiziers und Gentlemans wie etwa ein Monokel, lümmeln auf palmblattbedeckten Veranden herum und unterhalten ihr Inselpublikum mit Erinnerungen an die ‚Music Hall‘. Und schließlich gibt es jene – weniger anpassungsfähig, weniger wendig, weniger glücklich, vielleicht auch nur weniger brutal -, denen es selbst auf diesen Inseln des Überflusses am täglichen Brot mangelt.“
Stevensons Frau erwähnt in ihrem Tagebuch „Kurs auf die Südsee“, das 1914 posthum veröffentlicht wurde, sone und solche „Beachcomber“: „Einer hatte vor Starbuck Island Schiffbruch erlitten, dabei verlor er alles, was er besaß, und sagt, er brenne darauf, von hier fortzukommen, und dass er es satt habe, von Kokosnüßen zu leben; doch als sich ihm die Chance bot, auf der ‚Janet‘ seine Heimreise abzuarbeiten, fragte er besorgt, ob es ‚leichte Arbeit‘ sei, und verweigerte jede andere.“
.

.
Einen anderen schiffbrüchigen Seemann, „der sich auf dem besten Weg befand, Strandläufer zu werden,“ beglückwünschte die Autorin dagegen zu seinem Schicksal, denn er hatte bereits die Sprache der Eingeborenen fließend gelernt – „in vornehmster Inselart, die Brauen nach der allseits geschätzten Mode hebend und senkend, während er älteren Damen Dinge zuflüsterte, die zweifellos besser unübersetzt bleiben.“
Wieder drei andere „Strandläufer“ sahen bestens aus und waren gut gekleidet, in Jacken und Hosen, aber einer gab zu, „dass seine gegenwärtige Lebensweise vielleicht ‚den Anschein, als schmarotze er von den Eingeborenen‘ erwecken könnte, was ihm zu schaffen machte; aber sie waren sichtlich stolz auf ihre hohe Stellung als Weiße, mit Ausnahme des Exmarinesoldaten, der von seinen Gefährten verachtet wurde, da er sich ‚kanakisiert‘ hatte.“ Kanake ist das hawaiianische Wort für Mensch.
.

.
Melville erwähnt in seinem Buch „Omoo“ einen weiteren Beachcomber-Typ, den die Matrosen der Südsee auch „wandernde Charaktere“ nennen, da sie sich, „ohne einem Schiff die ganze Fahrt anzugehören, dann und wann auf kurze Walfischfahrten einschiffen und zwar unter der Bedingung, das nächste Mal ans Land gesetzt zu werden, sobald das Schiff wieder an einem Hafen vor Anker geht. Es ist dies meistenteils ein wildes, tollkühnes Volk. In der stillen See heimisch, das nie mehr daran denkt, nach Hause zurückzukehren…“
Ebenfalls zu den Beachcombern zählt laut Melville der geflohene „Ticket-of-Leave-Man“. Er gehört zu den angeseheneren Sträflingen in Australien, „bei denen man noch Hoffnung hat, dass sie sich noch bessern können. Sie werden von der Regierung an Plantagenbesitzer auf den Inseln vermietet „und erhalten dadurch gewissermaßen eine bedingte Erlaubniß frei umherzugehen. Diese bekommen nun Tickets oder Karten, welche sie jedem vorzeigen müssen, dem es einfiele, sie in Verdacht zu haben, dass sie ohne Erlaubniß aus wären.“
.
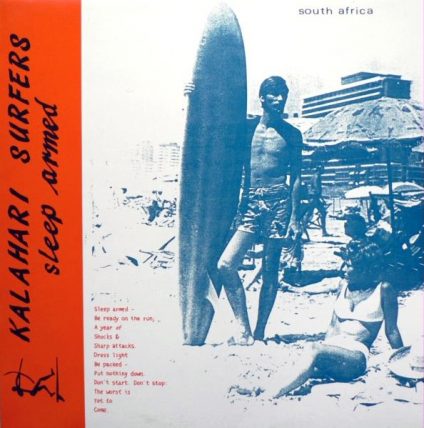
.
Einer von ihnen, ohne „Ticket-of-Leave“, war der berühmte Beachcomber William Harris, der sich 1842 von der britischen Strafkolonie der Norfolkinsel absetzte und auf Nauru heimisch wurde. „Er war wohl der einzige Strandläufer, der als vollwertiger Nauruer akzeptiert und dort uralt wurde,“ heißt es auf Wikipedia.
Ein typischer Beachcomber, den es genauso auch heute noch gibt, war Robert James Fletcher. Ein halbwegs gebildeter Engländer, der in jeder Anstellung nur Verblödung und Fron sah und deswegen 1912 in die Südsee auswanderte, auf eine der Inseln der Neuen Hebriden, östlich von Australien, wo er sich in mehreren Berufen versuchte, u.a. als Plantagenverwalter und Landvermesser. Er heiratete eine junge Einheimische und bekam mit ihr ein Kind. Aber zum Einen „findet er auf den Inseln eine Gesellschaft vor, die vom Kolonialismus durchsetzt ist und von Händlern, Siedlern und Missionaren ruiniert wird,“ wobei er voller Verständnis ist für die armen Eingeborenen und ihren Unwillen, sich ausbeuten zu lassen; zum Anderen ist er jedoch derart vom englischen Rassismus durchdrungen, dass er in seiner Frau nur eine kindlich-naive Wilde und in seinem kleinen Sohn einen dunkelhäutigen Halbwilden sieht, mit dem er sich nie in England sehen lassen könnte. Er trennt sich deswegen von den beiden und lebt wieder alleine – auf einer anderen Insel: als Sachbearbeiter in einer französischen Phosphorfabrik. Irgendwann hört er dort auf, regelmäßig Briefe an seinen Freund zu schreiben und verschwindet. Man weiß nicht, wo und wie er endete. Seine Briefe erschienen 1923 unter dem Titel „Inseln der Illusion“. Im vorletzten Brief erwähnt er einige Beachcomber: „Es gibt ein paar Yankees, die hier das einfache Leben suchen, von Kokosnüssen leben und in ‚Pareos‘ herumlaufen. Die Moskitos kurieren die meisten von ihnen in wenigen Wochen, und die, die den Moskitos standhalten, stellen dann später die wenigen Fälle von Elephantiasis bei Europäern. Am Pier von Papeete [Tahiti] habe ich einen gesehen, total übergeschnappt. Die einzigen, die sich tatsächlich auf das Leben in der Wildnis verstehen, die ein wirklich einfaches Leben mit den Eingeborenen führen können, ohne Schaden zu nehmen, sind die Deutschen.“ Eine kühne These.
Ein Gedicht von Gottfried Benn, dass sich auf die deutschen Südsee-Kolonien bezog, fängt so an: „Meer- und Wandersagen-/unbewegter Raum,/keine Einzeldinge ragen/in den Südseetraum,/nur Korallenchöre,/nur Atollenflor,/’ich schweige, daß ich höre‘,/somnambul im Ohr.“
Derart malten sich auch Emil Nolde, Paul Gauguin und Max Pechstein ihre „Südseeträume“ aus – im Gegensatz zu Benn jedoch vor Ort. Für den friesischen Bauernsohn Nolde standen die dortigen Wilden nicht am Anfang, sondern am Ende der Menschheitsentwicklung.
.
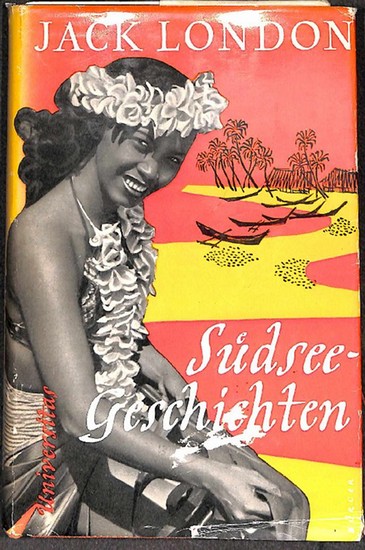
.
An den Küsten der islamischen Länder und an der ostafrikanischen, namentlich in Kenia, gibt es heute jede Menge Beachcomber, die mangels Arbeitsplätze eine derartige Existenz führen. Die arabischen und türkischen nennt man „Beznesser“ – das Wort setzt sich zusammen aus „Beziehung“ und „Business“. Diese jungen Männer lungern am Strand rum und versuchen europäische Frauen aufzureißen, denen sie ihre Liebe gestehen, um sie finanziell auszunehmen, wobei ihre Familie und oft auch ihre Ehefrau mitspielen. Es fallen derart viele alleinreisende, meist ältere Frauen auf sie rein, mehrere tausend jedes Jahr, dass es inzwischen deutsche und russische Internet-Foren gibt, die vor ihnen – quasi steckbrieflich: mit Photo, Namen, Adresse und Handynummer – warnen. Ähnliches unternehmen inzwischen auch die Tourismusagenturen für Tunesien, Marokko, Ägypten und die Türkei. Es nützt aber wenig. „Bezness bei meiner Oma. Ich brauche euren Rat!“ schrieb kürzlich eine junge Frau, deren verwitwete Großmutter ihrem jungen Liebesschwindler in der Türkei bereits über 1000 Euro geschenkt hatte.
Für den Badeort Hurghada können sich amerikanische und russische Ägyptenurlauberinnen inzwischen vorab bei ihren Reiseveranstaltern die zu ihnen “passenden” Beznesser in Katalogen aussuchen. Dadurch gewinnen sie quasi ihre Initiative wieder, die ansonsten – am Strand – von den Beznessern ausgeht. Da es für einen Ägypter verboten ist, mit einer europäischen Frau Kontakt aufzunehmen, erleichtert es das Zusammenkommen. Für Last-Minute-reisende Frauen gibt es dort – ähnlich wie im Iran – die „Zeitehe”, die sogenannte Orfi-Heirat: Der Vertrag dafür, auf drei Tage bis drei Jahre, wird gegen Gebühr von Notaren ausgestellt, neuerdings auch gleich in Discotheken, so dass die Frau ihren „Habibi” (Liebling) quasi von der Tanzfläche weg direkt ins Hotel mitnehmen kann. Die Urlauberinnen sind nicht selten 30 – 40 Jahre älter als die Beznesser. In der Regel wird die Beziehung für sie umso teurer je älter sie sind und umso sexueller je jünger sie sind – wie 2007 eine Beznesser-Studie von Franziska Tschanz für die Schweizerische Tourismusfachschule in Siders ergab.
In Kenia und auf Sansibar, wo das Surfen angeblich immer beliebter wird, heißen die Strandläufer „Beach-Boys“. Den Touristinnen versprechen sie – im Gegensatz zur kalifornischen Surf-Band: „I don’t want to party with you!“ Womit sie sagen wollen, dass sie es ernst meinen. Die Wiener UNO-Mitarbeiterin Ariane Müller schreibt in ihrem „Handbuch für die Reise durch Afrika“ (2013): „Sie sparen auf ein Fischerboot. Aber sie werden älter und haben nie genug Geld für ein Boot und nie genug Geld um zu heiraten, also heiraten sie jemanden, der sie bezahlt und dort bleibt und der sich in sie verliebt und und leben ein Leben zwischen Amsterdam und Lamu oder Hannover und Lamu und kaufen Häuser oder bauen Häuser, in die wieder weitere junge Frauen kommen, aus Europa.“ Einer der „Beach-Boys“, die auf die großen Yachten eingekauft werden, ist inzwischen Hausbesitzer, er erzählte der Autorin, dass er mit den Frauen immer auf Booten mitfuhr, mehrere Tage und jeden Abend war Party. Die Inseln, an denen sie vorbeikamen, wurden immer kleiner, und „überall Strände. Die Frauen waren immer nackt, sagt er anerkennend, und sie brauchen immer Drogen.“ Er lächelte. „All die Drogen!“
.

.
Bei der US-Surfkultur sieht die Soziologin Kristin Lawler in den darüber verbreiteten „images“ (Photos, Spielfilme, Surfmagazine, Soft-Pornos, Krimis etc.) eine Vermittlung von Freiheitsmotiven, die – trotz ihrer kommerziellen Medialisierung – als Inspirationsquelle für Alternativen zu den Arbeitsverhältnissen in der kapitalistischen Gesellschaft dienen, da die Surfer-Subkultur hedonistisch ist und eben nicht auf Produktivität aus. Deswegen sollten sie auch keine Sozialhilfe bekommen, wie der US-Philosoph John Rawls in einem Text über das „Malibu Surfer Problem“ vorschlug. Wadsworth Yee, Senator von Hawaii, wo es die größten Wellen gibt, war der selben Meinung: „Es darf keine Parasiten im Paradies geben!“ Kommt noch hinzu, die Surfer standen und stehen mit ihrer Propagierung des schönen, gebräunten Körpers und der Promiskuität quer zur christlich-puritanischen US-Mehrheitskultur. Die Soziologin erinnert in diesem Zusammenhang an Sigmund Freud, für den die erfüllte Liebesbeziehung zunächst ein „wirkungsvolles Mittel gegen das Unbehagen in der Kultur“ war, weil nur sie imstande ist, ein ozeanisches Gefühl befriedigten Narzißmus hervorzurufen. Da jedoch nichts verletzender sei als der Bruch einer Liebesbeziehung, nahm er wieder Abstand von dieser Vorstellung – und damit auch vom „ozeanischen Gefühl“ als etwas, für das es sich zu kämpfen lohne. An die Stelle der gefährlichen Ambivalenz der Liebe trat die öde Balance des bürgerlichen Ichs – zwischen Nähe und Distanz. Den Surfern geht es dagegen um das „ozeanische Vergnügen“ – auf Dauer. „Surf bums“ nennt man sie deswegen auch – in der Los Angeles Times z.B.: Surf-Penner also. In einem Internetlexikon heißt es: „Der Surf Bum wird oft als ein Obdachloser angesehen, obwohl er meist einen VW-Bus besitzt, aber man weiß nicht, wo er das Benzin dafür herkriegt, zumal er nichts so sehr ablehnt wie einen regelmäßigen Job.“ Daran hat sich bis heute wenig geändert – nur dass die Drogen härter geworden sind und die Kriminalität in der Scene brutaler.
Eine legale Möglichkeit, zu Geld zu kommen, ist ein Surfprofi zu werden, an internationalen Surfwettbewerben teilzunehmen und Sponsoren zu finden. Nicht wenige Surfer strengen sich ordentlich an, um so weit zu kommen.
Eine andere Möglichkeit ist die, das Surfen auf Seen, Flüsse und Meere ohne große Wellen auszuweiten: mit Windsurf- und Kitesurf-Schulen, Windsurf-Wettbewerbe, -Festivals und dem Verkauf von allem, was dazugehört: Neoprenanzüge, Bretter, Segel, Apps wie „Windfinder“, sowie Grill und Bier etc.. Und natürlich ein Bus für den Transport. Es gibt bald kaum noch ein Gewässer ohne eine wenigstens kleine Surf-Scene.
.

Südsee-Comic
.
Aber nun gibt es schon wieder etwas Neues. Der Spiegel schreibt: „Beim Wellenreiten dachte man bisher an Strände, Palmen und natürlich das Meer. Doch die Zukunft des Sports sind riesige künstliche Anlagen mit perfekten Wellen auf Knopfdruck. Der Millionenmarkt ist heiß umkämpft, mit dabei: Surf-Superstar Kelly Slater. Der Surf-Lifestyle boomt, das Gerangel um die besten Wellen wird zunehmend aggressiver. Brauchbare Wellen sind demnach eine begrenzte Ressource – so glaubte man jedenfalls bisher. Dieser Glaube ist einer neuen Hoffnung dreier Firmen gewichen, die fast schon an Goldgräberstimmung grenzt. Sie liefern sich ein Wettrennen um den Markt der perfekten Kunstwelle. Eine davon ist das spanische Unternehmen Wavegarden: „Im Wavegarden können unvorhersehbare – z.B. wetter- oder auch saisonbedingte – Faktoren ausgeschlossen werden. Diese Revolution im Surfsport macht es möglich, jeden Tag und zu jeder Jahreszeit perfekte Wellen zu genießen“, verspricht der Prospekt.
Um die Jugendlichen abseits aller freien Gewässer für das Surfen zu gewinnen, wurde zunächst das Skateboard erfunden – von einem Surfer, den man als Chemiestudent wegen Faulheit von der Universität in Berkeley/Kalifornien relegiert hatte. Er erfand zu Hause ein Plastik, das weich war, aber keinen Abrieb hatte. Damit ließen sich Räder für Bretter herstellen, mit denen man auf der Straße surfen konnte. Schon bald waren jedoch auch die Einkaufszentren voll mit „Skateboard-Fahrern“, so dass dieses neue Spielzeug dort schnell verboten wurde. Das war die Stunde der „Skate-Park“-Gründer: Sie pachteten Ödland und stellten halbierte Röhren oder anderes Abschüssiges aus Beton auf. Als diese Parks von immer mehr Skatern – gegen Eintritt – genutzt wurden und die Abschüssigkeiten immer gewagter wurden, wobei das Spielzeug sich zu einem ernsthaften Sportgerät (mit Meisterschaften etc.) wandelte, schaltete sich der Verband amerikanischer Mütter ein, denn die Verletzungsrate ihrer skateboardenden Kinder stieg rasch. Sie forderten Sturzhelme für Skater, dazu Ellenbogen- und Knieschützer. Und die gab es dann auch bald – in allen Preislagen. Aus dem neuen Weichplastik für die Räder war damit eine ganze Freizeitindustrie geworden, die sich sofort geographisch und sozial ausbreitete, wobei hierzulande noch eine staatliche Komponente hinzukam: Viele Kommunen legten solche Parks an, um laut Wikipedia „Möglichkeiten der Freizeitgestaltung für Jugendliche und Junggebliebene zu schaffen.“ Daneben gibt es hier inzwischen auch Allwetter-„Skatehallen“: z.B. „Children of the Revolution Skatehalle Berlin“, „Heizhaus“ (Leipzig) oder „Skate Factory“ (Essen); sie kosten natürlich Eintritt. Nicht selten befinden sie sich in stillgelegten Fabriken – und zeigen damit den Wandel von der Produktions- zur Konsumptionsgesellschaft an. In Hamburg und Frankfurt fanden „Surffilm-Festivals“ statt, auf denen u.a. ein Dokumentarfilm über die Münchner Surferszene gezeigt wurde. In Berlin wurde auf einem Festival um Spenden für die Produktion eines feministischen Pornos im Surfer-Milieu gebeten und auf dem Kurfürstendamm fand ein „Longboard-Wettbewerb statt.
.

.
Genug. Während eine Südseeinsel nach der anderen an Millionäre verkauft wird (Tchibo hat heuer allein 7 im Angebot) und die letzten Eingeborenen nun europäische Kleidung tragen, Fastfood essen, überwiegend Christen sind, monogam leben und regelmäßig zur Arbeit gehen, versuchen die Surfer im Westen deren frühere Lebensweise an allen Stränden zu übernehmen. Was von der einstigen „Eroberung“ der Karibik und der Südsee übrig blieb, fand ich neulich auf „wie-flirte-ich.com“ unter „flirttipps für männer“.
Zitat: „Wenn wir das Wort „Eroberung” definieren sollten, dann würden wir sagen, es handelt sich dabei um etwas, das man haben möchte. Man spürt eine Anziehung und versucht die Person für sich zu gewinnen und das so schnell wie möglich. Die Basis ist also, sie muss etwas an Dir interessant finden. Hier ein Beispiel: SIE: Was machst du so beruflich? ER: Ach, weißt du, ich bin Perlentaucher in der Karibik. Wenn du nett bist, nehme ich dich vielleicht mal auf einen Trip mit…
Vielleicht spürst Du es, ein Mann der so antwortet, wirkt viel attraktiver als mancher, der jede Frage beantwortet als wäre er in einem ehrlichen Interview. Eine Frau will immer einen Mann, den sie als anziehend empfindet. Werde also zu diesem Mann.“
Mehr über “Perlentaucher” und ihre Geschichte findet sich auf dem internet-eintrag: http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2015/08/16/gabeware-perlen-vor-die-saeue/
.
(Vortrag gehalten bei der “Provinzlesung” auf der Kalten Buche des Verlegers Peter Engstler/Rhön)
.
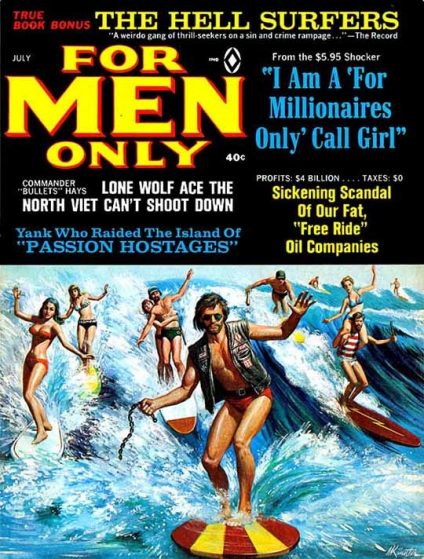
.
.
3. Die Zeit der Sammlung und die Zeit der Zerstreuung
Als das Internet aufkam, herrschte bei den Antiquaren zunächst Freude, denn damit ließen sich die Bücher weltweit anbieten, zudem sparten sie fortan kostspielige Kataloge. Nun heißt es aber: „Der Antiquariats-Buchhandel befindet sich in einer Krise“, wie ein Antiquar im „Börsenblatt“ des Deutschen Buchhandels schreibt: „Genauer gesagt sind es zwei: eine konjunkturelle und eine strukturelle. In einer konjunkturellen Krise mag es noch Sinn ergeben, sich im Einkaufsverhalten antizyklisch zu verhalten, weil spätestens nach der Krise die Nachfrage wieder steigt. Aber was tun bei einer strukturellen Krise, in der ganze Absatzmärkte weggebrochen sind, Sammelgebiete regelrecht veröden und neue Sammler kaum noch nachwachsen?“ Der Börsenblatt-Autor weiß auch keinen Rat, während ein Antiquar nach dem anderen aufgibt. Zum Einen fielen die Preise für Bücher seit dem Internet ins Bodenlose und zum Anderen kaufen die Leute seitdem immer weniger Bücher. Hinzu kommen Billigantiquariate, die alle Bücher für 1 Euro anbieten und „Büchertische“, deren Angestellte das Arbeitsamt die Gehälter zahlt. Ich fragte den 51jährigen Antiquariatsbesitzer Harald Hentrich: Wie wird man Antiquar und was macht man in dieser Situation?
Schon mit 15 besuchte Harald Hentrich jede Woche den alten baltischen Antiquar am Bahnhof Lichterfelde-West und las sich – angefangen mit Camus, Ionesco, Böll und Lenz – durch die Weltliteratur bis zurück zu Grimmelshausen. Sein Großvater besaß eine Druckerei in Steglitz, wo er nach dem Krieg u.a. das Mitteilungsblatt „FU-Spiegel“ druckte. Das Geschäft wurde dann von seinem Vater und seinem Onkel übernommen, die noch zwei Verlage gründeten: die „Edition Hentrich“ und „Hentrich & Hentrich“. Schwerpunkt von beiden war die jüdische Geschichte – und ist es immer noch. Seit 2012, als der Vater starb, allerdings in anderem Besitz. Sein Sohn hatte sich unterdes, nach einem Politologiestudium 1980 mit einem Antiquariat in Schöneberg selbständig gemacht. Das Geschäft verkaufte er 1990 wieder, um in Teetz bei Kyritz einen Kulturgasthof mit Antiquariat und Verlag zu eröffnen. Zehn Jahre später zog er wieder zurück nach Steglitz, in die Albrechtstrasse 111, wo er für seine 400.000 Bücher eine große Halle anmieten konnte, dazu beschäftigte er und beschäftigt immer noch drei Mitarbeiter. Er hatte auch einen Partner, Holger Wackershausen, der jedoch noch vor der Eröffnung starb.
.
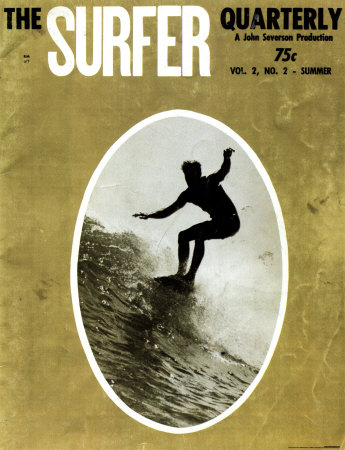
.
In Steglitz hat Harald Hentrich ein bildungsbürgerliches Publikum. „Ich habe versucht, alles da zu haben: Arbeiterbewegung, Sozialismus, Anarchismus, Islam, Buddhismus, Naturwissenschaft usw – und natürlich viel Belletristik..“ Gut sortiert in langen Regalreihen.
Im 1.Stock stehen die interessanten Bücher: „teilweise aus dem 16. Jahrhundert noch, z.B. über die Folter der Heiligen, mit Holzschnitten.“ Von Erben erwarb er den Nachlaß eines Sammlers erotischer Literatur („viel über Flagellantismus“). Ferner die Nachlaß-Bibliothek eines Mittelalter-Historikers („6000 Bände in vielen Sprachen“). Dann den Nachlaß eines Byzantinistik-Professors: Bücher über das frühe Christentum, ebenfalls in mehreren Sprachen („die habe ich in die ganze Welt verkauft“). Ferner den Pitaval-Nachlaß eines Rechtsanwalts („eine Quellensammlung mit Gerichtsfällen aus dem 18. und 19. Jahrhundert“). Und jüngst, ebenfalls aus einem Nachlaß: Aktenkonvolute zur Geschichte der Besetzung Hessens durch Napoleon und die sich daraus ergebenden Briefwechsel zwischen der alten und der neuen Obrigkeit.
Der Nachlaß eines Bildhauers, den Harald Hentrich aufkaufte, bestand nicht nur aus dessen Bibliothek, sondern auch aus seinen privaten Photoalben, Entwürfen und Zeichnungen von Kollegen. Aufgekauft hat er auch „Spuckis“ (Klebezettel) von Freikorps-Verbänden, Keramikverschlüsse von Bierflaschen („z.B. mit dem Eisernen Kreuz drauf“), ein paar hundert Lesezeichen und Spitzenschnitte, die man als Schmuckrahmen für Photos verwendete.
.
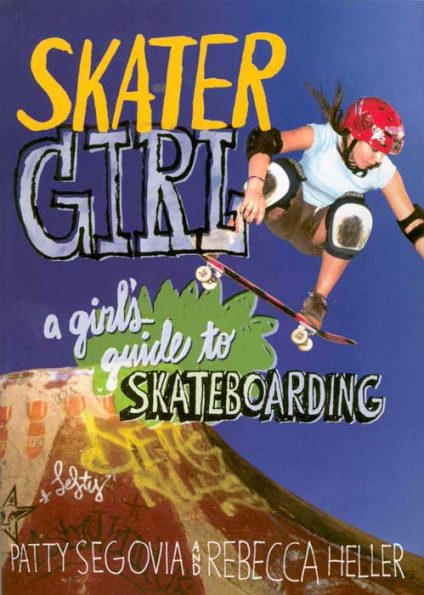
.
In einem Zeichnungsschrank liegen neben alten Photos Chromo-Lithographien und handkolorierte Kupferstiche: „Die kosten ein paar hundert Euro das Stück.“ Gelegentlich ersteigert er auch ein Gemälde. Einmal fand er zwischen dem Schutzumschlag und dem Einband eines Buches 8000 DM. Wenn man ganze Privatbibliotheken aufkauft, sind meist umgekehrt auch wertlose Bestseller dabei. Diese verkauft er bananenkistenweise für fünf bis 10 Euro an Hotels, Möbelhäuser und Filmausstatter. Das Gegenteil sind die Erstausgaben, die jedoch seltsamerweise keine Relevanz mehr haben, jedenfalls in Deutschland: „Expressionisten z.B., die kosteten früher 100 Euro, jetzt 20, ähnliches gilt auch für Arno Schmidt und Ernst Jünger…Eine Ausnahme ist die Erstausgabe vom ‚Kapital‘, für die alleine 600.000 Euro bezahlt wird.“ Aber ansonsten gilt: „Die Sammler sterben weg. Wir reagieren darauf, indem wir immer weiter zurück gehen und Bücher ab dem 16. Jahrhundert suchen – mit Illustrationen, Kupferstichen, Holschnitten…Z.B. ein chinesisches Album mit 500 Miniaturen, handgemalt auf Reispapier – für 7000 Euro.“
.

.
Natürlich offeriert das Antiquariat Hennwack seine Bücher auf einer eigenen Homepage, daneben kann man sie aber auch über Internetanbieter wie Abebooks, Amazon, ZVAB und Booklooker bestellen („Ohne die Einnahmen aus dem Online-Verkauf könnten wir unser Antiquariat nicht halten“). Von dem, was direkt über den Verkaufstisch geht, erwähnt eine Mitarbeiterin, „dass alles von Marx bis Lenin wie nie zuvor gekauft wird, auch Kropotkin ist restlos ausverkauft“.
Nach dem Tod des DDR-Historikers Jürgen Kuczynski 1997 wurde Harald Hentrich dessen riesige Bibliothek angeboten – für einige Millionen Euro: „Die hätte ich auch zusammen bekommen, aber seine Sammlung sollte nicht auseinandergerissen werden. Sie ging dann an die Landesbibliothek.“ Anders war es beim Nachlaß des Leiters des Ministeriums für Staatssicherheit, Ernst Wollweber, die seine in Köpenick lebende Witwe verkaufte: vor allem Marine-Bücher. Wollweber hatte am Kieler Matrosenaufstand teilgenommen und danach in verschiedenen Funktionen Seeleute-, Hafenarbeiter- und Binnenschiffer-Aufstände organisiert, ab 1936 leitete er Sabotageaktionen gegen die Marine der faschistischen Staaten. In seinem Nachlaß befanden sich Briefe der berüchtigten DDR-Richterin Hilde Benjamin sowie des kommunistischen Schriftstellers Otto Gotsche… „Das habe ich alles einzeln über Kataloge verkauft, auch manch andere Sammlung habe ich aufgelöst.“
.

.
Die teuerste Sammlung stammte von einem Zehlendorfer Antiquar, Elßmer, für sie mußte er 60.000 Euro zahlen. „Eine gute Bibliothek im Jahr reicht mir,“ meint er. In der Regel zahlt er 20% vom Schätzpreis. Für Kirchen, Banken und Erbengemeinschaften erstellt er gelegentlich Sammlungs-Gutachten. Als ich erwähne, dass ich jemanden kenne, der ihm eventuell seine komplette Donald-Duck-Sammlung – in Leder gebunden und mit Goldprägung, verkaufen würde, sagt er: „Das ist wertmindernd bei Heften“.
.
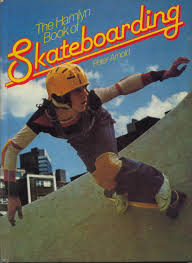
.
Erwähnt sei ferner, dass es neben den vielen Klagen in den alten und neuen Medien über die wirtschaftliche Situation der Antiquariate auch viele Beiträge über das Glück in Antiquariaten gibt: „Freude an alten liebenswerten Bäumen“, „Freude beim Stöbern“, „Freude an der Vielfalt und Unterschiedlichkeit“ usw.. Eine Mitarbeiterin bei Hennwack erwähnt einen schwäbischen Handwerker, der 800 Euro für Barlach-Literatur ausgab, und einen Berliner Porzellanmaler bei KPMG, „der bei uns alte Aquarellen oder Kupferstiche von Blumen kauft. Andere Handwerker wollen was über alte Techniken mit Holz wissen. Ein alter Mann, der Jahrzehnte in Karstadts Tierabteilung gearbeitet hat, kauft die teuerste Bücher mit Chromolithographien aus dem 19. Jhd. über Papageien und Brieftauben. Die Farben sind so intensiv, dass sie vom Rest des Buches immer mit einem Stück Seide oder Pergamentpapier getrennt werden müssen. Er erwarb auch einen Band über Stubenvögel, Falken und Hühner. Die Bücher waren unglaublich teuer, es war, als ob der Mann sich ein kleines Paradies zusammengekauft hat. Dann ist da noch ein Schlachter, der Jahrzehnte in der Schweiz gearbeitet hat, er kauft kiloweise Bücher über Tiere. Weil er, wie er mir anvertraute, in seinem Leben so viele Tiere getötet hat, er könnte sie gar nicht zählen. Er hat ein grosses Regal gebaut nur für seine Tierbücher. Kafkas Grossvater war auch Schlachter, und Kafka begründete seinen Vegetarismus damit, dass er das wieder gut machen muss, was sein Grossvater alles abgeschlachtet hat.“
Im Laden kann man sich außerdem noch an zwei Mongolische Künstler aus Ulan Baataar erinnern, die eine ganze Kunstbibliothek für zu Hause erwarben. Und dann sind da auch noch die Chinesen: „Sie kaufen sehr gründlich, je nachdem was sie interessant finden: Manchmal ist es Philosophie, oder sie wollen eine frühe Ausgabe von Buffon. Aber sie sind vorsichtig mit dem Geld.“ Eine Chinesin kaufte alles über Märchen, deutsche Romantik, die Emotion in der Romantik. Und erst kürzlich kaufte eine Gruppe von Chinesen alles über die Seidenstrasse. „Sie sind einfach sehr wissenschaftlich und systematisch. Die Koreaner auch. Und dann posten sie Photos vom Laden in den asiatischen Social Media.“
.

Photo.



