Die Vorbereitungsqual: Was muß man mitnehmen? Was kann man getrost zu Hause lassen? Seinen „inneren Schweinehund“ vielleicht?
.
Einträgliche Fernwirkungen
In „Die Wirkung nicht vererbter Elterngene“ referierte die FAZ kürzlich die „aktuelle Ausgabe von ‚Science‘: Die Genetiker um den bekannten isländischen Gründer der Firma deCODE genetics, Kári Stefánsson, nutzten Erbgutdaten von 21637 Isländern, um zu belegen, dass sogar jene Genvarianten unsere Eigenschaften beeinflussen, die unsere Eltern uns nicht vererbt haben.“ Also: eine „spukhafte Fernwirkung“? (Niels Bohr) Mitnichten: „Insgesamt dürften die neuen Daten für viele Adoptiveltern tröstlich sein. Auch wenn sie ihre Gene gar nicht vererbt haben, so wirken diese sich über den Umweg der Umwelt doch noch maßgeblich auf die Kinder aus.“
Bisher standen Umwelteinflüsse (Lamarck) gegen Genprägung (Darwin), Nurture vs. Nature, auf englisch. Angesichts der Erfolge von Symbioseforschung und Epigenetik sind die Genetiker zu seinem Kompromiß bereit – obwohl die ganzen Nationalliberalismen Biofakten brauchen: Die Gene wirken nun zwar weiter – aber über die „Umwelt“. Also die Gene der Nichteltern wirken durch ihre Erziehungsbemühungen hindurch. Wenn wir in diesem Fall nicht von den Genen, sondern vom Charakter und der sozialen Stellung der Adoptiveltern sprechen, ist das eine Binsenweisheit. Obwohl man umgekehrt oft davon ausgeht, dass die (früh)kindlichen Traumata des adoptierten Kindes nach-„wirken“. Übrigens habe ich Anzeichen gefunden, dass die Kinderheime im Osten genauso viele Schriftsteller und Wissenschaftler hervorgebracht haben, wie die im Westen Sozialfälle. Seit Wende und Privatisierung hat sich das aber, wenigstens in Deutschland, angeglichen: zum Negativen hin.
Der Wissenssoziologe Bruno Latour hält die ganze Genetik für einen ärmlichen „Reduktionismus“, er räumt jedoch ein, dass er in der Industrie durchaus Sinn macht. Und mit Industrie ist in gewisser Weise die amerikanische Biologie gemeint: über 80% aller US-Biologen sind auch Geschäftsführer oder Teilhaber von Firmen. Wie das geht, dass diese Gene plötzlich im Leben auftauchen, hat die Genkritikerin Silja Samerski in einem Interview angedeutet: „Das ,GEN‘ ist nichts anderes als ein Konstrukt für die leichtere Organisation von Daten, es ist nicht mehr als ein X in einem Algorithmus, einem Kalkül. Aber außerhalb des Labors wird es dann zu einem Etwas, zu einem scheinbaren Ding mit einer wichtigen Bedeutung, mit Information für die Zukunft… über das sich anschaulich und umgangssprachlich reden lässt. Es ist jedoch sehr fraglich, ob man umgangssprachlich über Variablen von… oder Bestandteile eines Kalküls oder Algorithmus sprechen kann, ob sich also überhaupt außerhalb des Labors sinnvolle Sätze über ,GENE‘ bilden lassen, die von irgendeiner Bedeutung sind. Wenn aber solche Konstrukte in der Umgangssprache auftauchen und plötzlich zu Subjekten von Sätzen werden, mit Verben verknüpft werden, dann werden sie sozusagen in einer gewissen Weise wirklich.“
Mit den Worten des Beraters von Biotech-Unternehmen, William Bains in der Zeitschrift „Nature Biotechnology“: „Die meisten Anstrengungen in der Forschung und in der biotechnologischen industriellen Entwicklung basieren auf der Idee, dass Gene die Grundlage des Lebens sind, dass die Doppelhelix die Ikone unseres Wissens ist und ein Gewinn für unser Zeitalter. Ein Gen, ein Enzym, ist zum Slogan der Industrie geworden…Kann das alles so falsch sein? Ich glaube schon, aber ich bin sicher, das macht nichts. Denn die Hauptsache ist, dass es funktioniert: Manchmal funktioniert es, aber aus den falschen Gründen, manchmal wird es mehr Schaden anrichten als Gutes tun…Aber die beobachtbare Wirkung ist unbestreitbar…Wir müssen nicht das Wesen der Erkenntnis verstehen, um die Werkzeuge zu erkennen…Inzwischen führen die Genom-Datenbanken, die geklonten Proteine und anderes Zubehör der funktionalen Genetik zu Werkzeugen, Produkten, Einsichten, Karrieren und Optionen an der Börse für uns alle.“ Und darum geht es!
Als man anfing, statt von Individuen und ihren Genen von Holobionten zu sprechen (das meint z.B. den Menschen und seine Mikroorganísmen bis in alle Zellen hinein), als man also mit der Ökologie ernst machte, veröffentlichte der Biologe Bernhard Kegel das Buch „Epigenetik“ (2009), darin heißt es: Man hätte den Begriff des „Gen“, der gerade hundert Jahre alt wurde, gebührend feiern sollen, „denn ob dieser Begriff seinen nächsten runden Geburtstag noch erleben wird, ist fraglich“: Das „genzentrische Weltbild“ war allzu simpel. „Selbst Craig Venter, der vor wenigen Jahren mit seinen Sequenzierrobotern an vorderster Front der biomedizinischen Forschung stand, muss heute eingestehen: ‚Im Rückblick waren unsere damaligen Annahmen über die Funktionsweise des Genoms dermaßen naiv, dass es fast peinlich ist‘. ‚Wir müssen blind gewesen sein‘, seufzte der Entwicklungsgenetiker Timothy Bestor von der New Yorker Columbia Universität angesichts eines ganzen ‚Universums‘ ungeahnter und unerwarteter Phänomene. Über Vererbung und Evolution muss neu und intensiv nachgedacht werden‘.“
Dieses Eingeständnis verdankt sich nicht zuletzt der Endosymbiontentheorie der US-Biologin Lynn Margulis, deren Buch „Die andere Evolution“ dieser Tage neu veröffentlicht wurde – unter dem Titel „Der symbiotische Planet Oder wie die Evolution wirklich verlief“. Es geht darin ums Ganze: vom kleinsten Gen in mir bis zur Gasatmosphäre über mir.
.

Dann heißt es Abschied nehmen von Frau und Hund und Hollywoodschaukel.
.
Gesellschaftstheorie
„Eine Theorie der Gesellschaft, die davon absehen würde, dass tatsächlich heute das Los der Arbeiter sich gegenüber ihrem Los in den klassischen Analysen von Marx und Engels geändert hat, dass also, ganz schlicht gesagt, die Proletarier heute wirklich mehr zu verlieren haben als ihre Ketten, nämlich im allgemeinen also doch ihr Kleinauto oder ihr Motorrad – wobei ich dahingestellt lasse, ob diese Autos und Motorräder nicht eine sublimiertere Form von Ketten sind – , darüber ist jedenfalls kein Zweifel,“ meinte Theodor W. Adorno 1964, als das Motorrad in der „Evolution“ der kleinbürgerlichen BRD-Mobilität vom Fahrrad bis zum VW noch vor dem Auto angeschafft wurde.
Ich fragte mich bei diesem Adorno-Satz: Waren die wirklichen Ketten etwa auch schon „sublimiertes“ Zeug? Wenn man das mit einem historischen Blick auf die Arbeit beantworten will: Ja, denn die Glieder, aus der eine Kette besteht, sind meist aus Eisen und das will erst einmal aus Bergwerken hochgeholt, geschmolzen und geschmiedet sein, ebenso die dazu notwendige Kohle. Sublimieren bedeutet hochentwickeln, hochholen, das paßt zum Bergwerk. Seltsam aber, dass gerade die Menschen, die diese Arbeit machen, am Wenigsten an den „sublimierteren Formen von Ketten“ hingen. Ich denke dabei an die vielen Bergarbeiterstreiks in der Geschichte – bis heute. Wie viele „Ruhrkumpel“ sich allein aufmachten, um sich mit den streikenden Kalibergarbeitern in Bischofferode zu solidarisieren (die Arbeiter aus anderen Branchen schickten Soli-Faxe). Dann der Streik der englischen Bergarbeiter,, die sich fast allein gegen die Thatchersche Durchsetzung eines real existierenden Neoliberalismus wehrten. Die Rote Ruhrarmee. Die Streiks in den Zwanzigerjahren im Mansfeldischen Bergbaurevier. Die rote Fahne von Kriwoi Rog. Davor die Arbeitskämpfe in Oberschlesien usw..
Mit der heutigen Arbeit beschäftigt sich seit 1989 der Soziologe Wolfgang Engler. Seine Bücher dazu werden bereits im Titel inhaltlich: „Die Ostdeutschen/Die Ostdeutschen als Avantgarde/Bürger ohne Arbeit/Unerhörte Freiheit – Arbeit und Bildung in Zukunft/Die ungewollte Moderne/ Die zivilisatorische Lücke“.
Noch bevor sich – wenigstens in Berlin – alle in der Tourismusbranche wiederfanden, war schon vom neoliberalen „Dienstleistungsgeschäft“ die Rede, wobei es nicht zum geringsten Teil um Computer-Bedienung ging. Aber generell handelt es sich dabei um einen Service – servieren: kellnern, was sich vom lateinischen Wort für „Sklavendienst“ herleitet. In Tirol ist man schon – so lange wie die Engländer für die Alpen glühen – im Tourismusgeschäft. Die Infrastrukturbesitzer dafür waren Bauern, das Bedienungspersonal kam meist aus Serbien. Aber mit dem Zerfall Jugoslawiens war damit Schluß. Stattdessen kamen Ostdeutsche, von denen inzwischen viele dort auch wohnen. Gleichzeitig warb der Tiroler Tourismusverband in Indien für die „Destination Tirol“. Es kamen lauter Neureiche – und die verlangten für ihr Geld, dass man sie quasi kriechend bediente. Das ging überhaupt nicht. Schnell wurde die Indienwerbung gestoppt. Heute urlauben dort Westdeutsche, bedient werden sie von Ostdeutschen, die Chefs sind Tiroler Ex-Bauern. Erzählt hat diese Geschichte der Tiroler Tourismusforscher Michael Zinganel im Kreuzberger Kunstverein NGBK. Wohingegen der Künstler Andreas Seltzer in der Prenzlauer Berg Messe „Geldbeschaffungsmaßnahmen“ den Touristen als wandelnde Geldbörse darstellte, den man mit List und Tücke und notfalls Gewalt wie eine Weihnachtsgans auszunehmen versucht, wobei es gleichzeitig darauf ankommt, dass er trotzdem halbwegs „anständig bedient“ wird. Das ist sozusagen die Kunst des Fremdenverkehrswesens.
Man erinnert sich vielleicht noch daran, dass versucht wurde, dieses Geschäft ganz anders abzuwickeln und in diesem Zusammenhang an den Einwand des DDR-Dramatikers Heiner Müller gegen Kritiker aus dem Westen, mit dem er ihnen zu bedenken gab, „dass auch die schlechte Laune der Kellnerin eine echte sozialistische Errungenschaft ist“. Das Gegenteil sind die ewig lächelnden und zuvorkommenden Kellnerinnen in den USA, über die man in Berlin urteilt: Das kann nicht „echt“, das muß erzwungen sein. „Der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse“. Dazu paßt, was mir kürzlich ein Mitarbeiter des größten Berliner Antiquariats sagte: „Marx bis Lenin wird gekauft wie nie zuvor; Kropotkin ist restlos ausverkauft“.
.

Auch die ganze krummpuckelige Verwandtschaft ist gekommen, um einen zu verabschieden.
.
Bauchläden
Neulich sprach eine Frau, die Zwillinge erwartet, von ihrem Bauchladen. Es gibt in Berlin eine Hebammenpraxis namens „Bauchgefühl“ und immer wieder hört man – auch von Männern: „Das entscheide ich aus dem Bauch heraus“ und blöder noch „Meine Bauchentscheidungen habe ich noch nie bereut“. Ein Team um Jennifer Lerner von der Harvard University hat das erforscht: „Zuerst wollte es wissen, worauf die Versuchspersonen selbst am ehesten setzen würden, wenn es darum geht, die Gefühle anderer Menschen möglichst gut einzuschätzen: auf analytisches Denken oder auf ihr Bauchgefühl?“ heißt es dazu in „Spektrum der Wissenschaft“. Der Großteil der Befragten, so das Ergebnis, plädierte dabei zwar für Letzteres, die Harvardwissenschaftlerin fand dann jedoch – wenig überraschend – heraus: „Wir können die Emotionen unserer Mitmenschen besser deuten, wenn wir systematisch denken und alle Informationen sorgsam gegeneinander abwägen.“
Anders der Psychologe Andreas Glöckner von der Fernuniversität Hagen: Für ihn sammeln wir erst Informationen, erinnern ähnliche Erfahrungen, kombinieren und wägen ab – „bis sich ein stimmiges Gefühl für die richtige Entscheidung ergibt: das Bauchgefühl.“ Wobei solche „Gefühle“, wie finnische Forscher herausfanden, nicht unbedingt nur aus dem Bauch in unser Bewußtsein dringen: „So spüren wie zum Beispiel Traurigkeit im Hals, Stolz in der Brust, Scham und Neid im Kopf. Wut-, Freude-, Sorge-, Angst- und Ekelgefühle machen sich im Bauchraum breit. Depression und Traurigkeit machen Arme und Beine schlapp. Die Liebe ist das stärkste Gefühl – bis auf Beine und Arme ‚glüht‘ der ganze Körper“ (so faßt der WDR die finnische Studie zusammen). Die ganzen Internet-Rategeberseiten kommen uns dagegen nach wie vor mit Feststellungen wie „Warum dein Bauch mehr weiß, als dein Verstand glaubt.“
Ich komme hier jetzt mit dem wirklichen „Bauchladen“…Man kennt ihn vielleicht noch aus dem Kino: Früher wurde vor den Vorstellungen daraus noch Eis verkauft. Heute laufen gelegentlich noch Asylbewerber mit einem Bauchladen durch die Kneipen, aus dem sie Feuerzeuge, Süßigkeiten usw. verkaufen. Gleich nach der Wende erfand der Elektriker Peer Wagner aus Leipzig angesichts wachsender Fastfood-Konkurrenz und immer seltener erteilter Imbißstand-Genehmigungen eine mobile „Variante“, wie man in Sachsen sagt: einen „Bratwurstbauchladen“ – für den man keine „Standgenehmigung“ braucht. Er besteht aus vier Campingkühlakkus, Gasflasche, Grill, Sonnenschirm und Tragegurte. Einschließlich der Ware – achtzig Würstchen, Senf, Ketchup und Brötchen – wiegt das Ganze etwa 30 Kilogramm. Und nichts davon darf während des Verkaufsvorgangs den Boden berühren: „Das ist der Knackpunkt!“ Seit seiner Erfindung laufen Arbeitslose in vielen Städten mit solch einem Bauchladen herum. Inzwischen hat der Erfinder auch schon Konkurrenz bekommen – und es kam zu juristischen Klagen zwischen ihnen. Da interessierte Kunden immer wieder die Bauchladenbesitzer fragen: „Ist das nicht zu schwer auf die Dauer?“ – verkauft Wagner ihnen auch noch gleich eine kluge Antwort: „Mit jeder Wurst wirds leichter!“
Pfiffige Bauchladenbesitzer warten jedoch nicht so lange, sondern geben sich gleich als Rollstuhlfahrer aus – und können dann ihren Bauchladen am Gefährt befestigen: „Leichter gehts nicht!“ Ich habe ebenfalls einen Bauchladen, mit dem ich rumlaufe und der mich ernährt: Ich verkaufe daraus lange und kurze Texte, Lesungsauftritte, Gesprächsleitungen, Interviews, Photos, kleine Filmmitwirkungen, Farbdias aus den 50er-, 60er- und 70er-Jahren, unkomplizierte Reparaturen in Haus und Hof, Übersetzungen aus dem Englischen, Umzugshilfe, Gartenmitarbeit, Bibliotheks-, Archiv- und Internet-Recherchen, offene Ohren für Querulanten, Wissen über Poller, Glühbirnen, Prostituierte, Chinarestaurants, Tiere und Pflanzen; Erfahrung mit Pferden, Katzen, Hunden und Zierfischen, mit Landwirtschaft, Zeitungen im Selbstverlag und verstopften Klos. Bei vielen Anfragen müßte ich jedoch sagen: Kann ich nicht oder habe ich nicht. Stattdessen sage ich: Versuchen kann ichs ja. Und bei manchen Anfragen müßte ich eigentlich sagen: Mach ich nicht. Aber das kann ich mir nicht leisten.
.

Sogar viele der ehemaligen Klassenkameraden haben es sich nicht nehmen lassen, „Gute Fahrt“ zu wünschen.
.
Sport Utility Vehicle (SUV)
Der Mercedes-Benz-Chef sprach 2015 von einem „Jahr des SUVs“. Die Auto-Motor-Sport-Journalisten staunen: Diese hohen schweren Safari-PKWs mit Allradantrieb und womöglich Känguruh-Fanggittern vorne dran werden immer beliebter (540.000 wurden 2016 verkauft). Zwar zum Glück nicht an die juvenilen Raser, weil sie ihnen zu teuer sind, aber das nützt einem nichts: wenn man einen Mittelklassewagen fährt und mit einem SUV kollidiert, dann ist man nämlich platt. Fast alle Autokonzerne stellen inzwischen welche her, dementsprechend fahren immer mehr davon in den Städten, obwohl sie für die Wegelosigkeit geschaffen wurden. Auch die Neureichen, Mafiosi und Zuhälter sind deswegen inzwischen vom Alfa Romeo oder Porsche auf SUVs umgestiegen.
SUV-Fahrer repräsentieren den rücksichtslosen Konsum unserer Gesellschaft, sagte der Politologe Markus Wissen – und wurde von der Süddeutschen Zeitung dazu interviewt, der er dann erklärte, dass und warum es sich beim Besitz eines solchen Vehikels um eine „imperiale Lebensweise“ handelt.
So wie die Guerilla weltweit mit MGs auf „Pick-Ups“ (Geländewagen mit Pritsche), die ebenfalls von vielen Autokonzernen hergestellt werden, ausgerüstet sind, gibt es auch bei den SUVs eine Tendenz zur Militarisierung in Form und Farbe und bei den SUV-Fahrern eine, von der Fahrbahn aus- und ins freie Gelände einzubrechen, notfalls tut es auch ein schlammiger Wald- und Wiesenweg. Der SZ-SUV-Testfahrer fragte sich eine „typische Radfahrer-Frage: Wird man automatisch ein Arsch, wenn man so ein Ding fährt?“
Markus Wissen gibt dann auch als Grund, warum er die SUVs heftig kritisiert, an: „Mein Co-Autor Ulrich Brand und ich sind leidenschaftliche Fahrradfahrer. Wir führen also jeden Tag in Berlin und Wien einen Kleinkrieg mit Autos und SUVs.“ Deswegen fragten sie sich: „Warum kaufen Menschen Autos, von denen klar ist, dass sie die Umwelt verpesten, andere gefährden und schon durch ihre Bauart die Rücksichtslosigkeit darstellen? Man zerstört Natur im Herstellungsprozess der Autos und auch in der Art, wie man sie nutzt, weil sie eben mehr Sprit brauchen. Zugleich empfindet man es als normal und auch als Anpassung an die zunehmenden Unsicherheiten. Das ist zumindest unsere These.“
Ich denke, die „zunehmende Unsicherheit“ entwickelt sich eher auf der Seite der Kleinwagenfahrer. Während viele SUV-Fahrer laut Markus Wissen denken: Damit „komme ich überall durch, ich trotze Starkregen und kann meine Kinder trotzdem noch sicher zur Schule bringen.“ Zudem nehme die Ungleichheit in Deutschland zu und die „Statuskonkurrenz“ treibe die Reichen, sich immer fettere PKWs zuzulegen.
Wenn ich den Soziologen Jean Baudrillard richtig verstehe – in seinem Buch „Das Andere selbst“ (1987), dann hat sich das Auto gewandelt, es ist nicht mehr „psychologisches Allerheiligstes“, sondern ein mit immer mehr Elektronik ausgestattetes Fortbewegungsmittel, „das über das Fahrverhalten wacht“. Es spricht sogar zu uns und informiert über seinen allgemeinen Zustand. Man wird zunehmend gefahren, das macht aber nicht weniger angespannt, im Gegenteil. Die Alternative dazu ist – für Reiche – der SUV, weil man damit eben etwas wagen kann – und sei es nur als Möglichkeit. SUV-Fahrer neigen dazu, wenigstens im Suff, sie auch zu testen, indem sie durch einen Bach fahren, einen Berg hoch oder auf größere Brachflächen – in „ökologischen Nischen“ – herumkurven. Es geht darum, die Grenzen des SUV-Möglichen zu kennen. Man weiß ja nie. Die SZ weiß aber: „Die Motorleistung der Autos in Deutschland ist von durchschnittlich 95 PS im Jahr 1995 auf 140 PS angestiegen.“ Gleichzeitig hätte auch die Mülltrennung zugenommen. Die SZ-Redakteure und der SUV-Experte denken von Ökologie und Radfahren aus. Dabei würde es wahrscheinlich schon helfen, wenn man die ganze Scheißelektronik aus den Autos rausnehmen würde und sie dafür wieder so konstruiert, dass man sie selbst reparieren, wenigstens das Blinklicht wechseln und die Batterie ausbauen kann. Die SUV-Fahrer „sitzen in iZum Baden reichte leider die Zeit nicht.hrem kleinen Panzer,“ da wähnen sie sich sicher, meint Markus Wissen. Den Mittelklassewagen-Besitzern in ihren stetig dünner werdenden Blechkästen soll dagegen immer mehr Elektronik „Sicherheit“ verschaffen, so wie auch dem Staat und überhaupt jedem Scheiß. Die SUV-Fahrer wissen es besser: statt hochsensibler Computer braucht es furzstabile Känguruh-Fanggitter.
.

Aber dann geht es endlich los! Die Halbschwester begleitet einen noch zum Hafen und aufs Schiff.
.
Adbuster
„Arsch bewegen – Plakate kleben!“ (Die Außenwerber)
Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble gibt im Jahr mehrere Milliarden für Marketing aus. Und hat nun Zweifel an der Wirksamkeit der Methode von Facebook, Werbung auf ein spezifisch definiertes Publikum abzustimmen, wie die FAZ berichtet.
Der Marxist Alfred Sohn-Rethel meinte einmal über die Werbung: In der kapitalistischen Produktion gibt es von Anfang an eine Überproduktion, die ständigen Absatzdruck hervorruft, dabei wird die Werbung immer wichtiger, das was Marx laut Ludwig Pfeiffer „achtlos“ als „faux frais“ (falsche Kosten) bezeichnete. 1974 bekam der Künstler Indulis Bilzens eine Anstellung als antikapitalistischer Kritiker bei der renommierten Düsseldorfer Werbeagentur GGK (die später einmal kostenlos eine taz-Werbekampagne entwarf), Bilzens wollte und sollte die Werber mit ständigem „faux frais“-Gerede verunsichern – was ihm jedoch nicht gelang. 1991 bat „Die Zeit“ die Redakteure des „Sonntag“, eine Ausgabe des „Zeit-Magazins“ herauszugeben. Unter einer Reihe von Photos, die Plakatwände an einer Landstrasse der neuen Bundesländer zeigten, schrieben sie: „Die Werbung überzieht das Land flächendeckend wie früher die Stasi.“ „Die Zeit“ bekam daraufhin eine harsche Beschwerde vom Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft.
Unterdes hatten zwei arbeitslos gewordene Kollegen aus der LPG „Florian Geyer“ Saarmund eine neue Anstellung als Plakataufsteller gefunden. Nach einigen Wochen verloren sie diesen Job aber wieder, weil ihr Chef behauptete, sie hätten ihn betrogen, indem sie nicht-aufgestellte Plakatwände abgerechnet hätten. In Wahrheit hatten sie aber alle Wände, die auf ihrer Liste standen, brav aufgestellt. Diese waren nur wenig später von Unbekannten wieder beseitigt worden. Ähnlich wurde in den letzten Jahren auch die „Wall“-Werbung an den BVG-Wartehäuschen immer mal wieder zerstört. Die zwei LPG-Kollegen heuerten dann bei einem anderen Aufsteller von Plakatwänden an, der sie mit Polaroid-Kameras ausstattete, mit denen sie ihre Arbeit dokumentieren sollten. Damit gab es keinen Abrechnungsstreit mehr.
1975 hatte der Schriftsteller und Naturforscher Edward Abbey einen Roman mit dem Titel „The Monkey Wrench Gang“ (die Universalschraubenschlüssel-Bande) veröffentlicht, in dem es vier „Terroristen“ darum geht, das Vordringen der Industriegesellschaft in die Fast-Noch-Wildnis des Südwestens der USA durch SabotageAktionen mindestens zu erschweren. Der Roman beginnt mit zwei Protagonisten, die es zunächst auf die Werbeplakate an den Highways abgesehen hatten: mit Motorsäge, Flex und Benzinkanister. Irgendwann sind sie zu viert so weit, dass sie sich an größere „Projekte“ heranwagen und sich sagen: „Der Krieg hat begonnen“. 2000 erschien auf Deutsch noch ein Roman „Die Kunst des Verschwindens“, von Jim Dodge, der sich mit einer kleinen elitären aber militanten Untergrundgruppe befaßt. Bei ihr gehört die Plakatzerstörung quasi zur Ausbildung. Der anarchistische Autor Thomas Pynchon schreibt im Vorwort: „Man wird darin nicht nur eine Gabe für Prophetisches bemerken, sondern auch eine ständige Verherrlichung jener Lebensbereiche, wo noch bar bezahlt wird – und die sich daher dem digitalen Zugriff widersetzen.“ Eine solche „Verherrlichung“ des Analogen findet man auch schon bei Edward Abbey. In Deutschland kennt man bisher nur Angriffe auf sexistische Werbeplakate sowie auf die Wahlwerbung der Parteien.
Sein Roman führte in den Siebzigerjahren zur Gründung der Umweltschutz-Organisation „Earth First“, deren Aktivisten immer mal wieder des „Öko-Terrorismus“ verdächtigt werden. Der Biologe Bernd Heinrich erwähnt in seinem Buch „Ein Jahr in den Wäldern von Maine“ (1994) eine Sabotage-Aktion in den Wäldern von Maine, wo Mitglieder von „Earth First“ Maschinen unbrauchbar machten und Nägel in Bäume schlugen, um sie vor dem Gefälltwerden zu sachützen (der Konzern „Timberland“ wollte dort 42.000 Festmeter Holz fällen). Ein Ableger von „Earth First“, die „Earth Liberation Front“ (ELF), wurde vom FBI als „einheimische Terroristengruppe Nummer 1“ bezeichnet.
Ein DDR-Graphiker hielt 1994 einen Vortrag in Braunschweig, in dem es um Produktwerbung ging. Er führte darin aus: Wer solche Werbung macht oder betreibt, der stehe „auf der Seite des Verbrechens“. Ich nehme an, das er das als ökologisch Denkender im Hinblick auf Ressourcenschonung meinte. In der DDR wurde die Film- und Fernsehwerbung im übrigen 1976 eingestellt. In Warschau beauftragte man eine Graphikbrigade, die gesamte Lichtwerbung in der Stadt zu gestalten. Das Ergebnis war beeindruckend und den Warschauern gefiel es auch. In Moskau sagte ich 2001 zu der Reiseleiterin, einer Germanistin, angesichts der vielen schrillen Werbung in der Stadt: „Alles so schön bunt hier!“ „Schrecklich!“ erwiderte sie.
In Berlin hat die Werbung inzwischen ebenfalls schreckliche Ausmaße angenommen: An den Straßen und Plätzen werden immer mehr Werbeplakate aufgestellt und in den U-Bahnhöfen sogar schon die Fußböden mit Werbeplakaten beklebt. Auf immer mehr Hochhäusern drehen sich riesige Mercedessterne. Und auch die Ladenwerbung wird immer umfangreicher und greller. Hinzu kommt die Werbung an Bussen und Bahnen, die riesige Blow-Up-Werbung an Brandmauern und Baugerüsten und die vielen täglich wahllos und wild auf alle möglichen Freiflächen und Pfähle geklebten Veranstaltungsplakate. Nicht zu vergessen, die sich über schier alles ausbreitenden Tags und Graffitis, wobei letztere durchaus auch als eine subversive Reaktion auf den Overkill der Werbung des Kapitals gelesen werden kann, und die tags sowieso illegale Werbemaßnahmen des kleinen Mannes auf der Straße sind.
Die des großen im Loft, in diesem Fall des Bauunternehmers Reinhard „Wertkonzept“ Müller, das ist u.a. der riesige Schöneberger „Gasometer“, aus dem man inzwischen eine einzige Werbefläche gemacht hat, die Nachts weithin leuchtet. Laut ihres „Betreibers“ – Ströer Megaposter GmbH – hat sie „pro Nacht einen Werbewert von 165.000 Bruttokontakten“. Eine Bürgerinitiative in unmittelbarer Nähe bekämpft diese aufdringliche Nutzung des Industriedenkmals. Sie beruft sich u.a. auf den Urbanisten Giuseppe Pitronaci: „Die Bürger haben ein Recht auf werbefreie öffentliche Räume. Und wirklich öffentlich ist ein Raum nur in dem Maß, in dem er nicht von privatwirtschaftlichen Interessen vereinnahmt wird – in einer auf Gemeinschaft orientierten Bürgergesellschaft ist ein solches Gegengewicht zu kommerziellen Einzelinteressen unverzichtbar“. Pitronaci warnt, das „der Druck, Flächen für Werbung zur Verfügung zu stellen, immer größer wird, je weiter sich der Staat aus der Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen zurückzieht.“
Für den Philosophen Michel Serres bedeutet die Werbung bereits „das eigentliche Übel“. Im Juni 2017 gründete sich gegen diesen um sich greifenden Werbewahnsinn in Berlin eine erste Bürgerinitiative. Der Sender RBB berichtete: „Von visueller Verschmutzung ist die Rede und von der Kommerzialisierung öffentlicher Räume – gemeint sind die Werbeflächen in Berlin. Eine Bürger-Initiative will die Berliner vor zu viel Werbung schützen und strebt dafür ein neues Volksbegehren an.“
Sie kritisiert gerade das an der Reklame, was der Fachverband Außenwerbung hervorhebt: Die Außenwerbung stehe „im permanenten Kontakt mit der Bevölkerung. Immer, überall, 24 Stunden an jedem Tag des Jahres, unausweichlich, unübersehbar.“ Auf der Internetseite der BI heißt es dagegen: „Werbung nervt. Jeden“. Die Stadt werde von Plakat-, Licht- und Display-Werbung geradezu „überflutet“, sagen die Initiatoren von „berlin-werbefrei“, die mit einem neuen Volksbegehren, das möglicherweise in einen Volksentscheid mündet, die Werbung im Berliner Stadtbild auf ein allgemein verträgliches Maß zurechtstutzen und einer „unkontrollierten Ausbreitung“ zuvorkommen wollen. Der Titel des neuen Gesetzes lautet: „Gesetz zur Regulierung von Werbung in öffentlichen Einrichtungen und im öffentlichen Raum“ oder kurz „Antikommodifizierungsgesetz“ (AntiKommG). In verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und im kritischen politischen Diskurs steht der Begriff „Kommodifizierung“ für die Kommerzialisierung öffentlicher Ressouren. Kritiker des Neo-Liberalismus sehen darin die Gefahr, dass auch der Bereich des Sozialen zunehmend wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten unterworfen wird. Weiterer Bestandteil des geplanten Volksentscheids wird das Werbefreiheitsgesetz (WerbeFG) sein. Damit soll Werbung und Sponsoring an Schulen, Universitäten und anderen öffentlichen Einrichtungen reguliert und transparent gestaltet werden.
Die Initiatoren von „Berlin Werbefrei“ kritisieren in diesem Zusammenhang, dass der Senat die inflationäre Ausbreitung von Werbung unterstützt und selbst noch Geld damit verdienen will. Die taz fragte den Rechtsanwalt Fadi El-Ghazi, der den Gesetzesentwurf der BI mit ausgearbeitet hat, ob die Werbung wirklich mehr werde. „Ja,“ sagte er, „gerade an stark frequentierten Straßen und Plätzen nimmt die Außenwerbung massiv zu. Der Senat hat gerade 8.100 Werbeflächen neu ausgeschrieben. Wollen wir wirklich an jeder dritten Laterne einen leuchtenden Hinweis auf Aldi, Lidl oder McDonald’s?“
Es geht auch anders: In Zürich haben sich die Bürger z.B. Werbung an ihren blauen Straßenbahnen entschieden verbeten. Als Beispiel für werbefreie Städte erwähnt „Berlin Werbefrei“ die brasilianische Metropole São Paulo. Diese sei im Jahr 2007 durch das „Clean City Law“ zur weltweit ersten Metropole ohne Banner, Poster und Plakate erklärt worden. Ein weiteres Beispiel sei Grenoble in der Schweiz. Dort habe man 2014 den Slogan „Bäume statt Werbetafeln“ ausgegeben und betreibe seitdem die „Erfindung einer neuen schöneren, städtischen Lebensweise“.
Im Grunde würden sich dabei zwei Welten gegenüber stehen: die Klasse derer, die mit einem politischen Mandat ausgestattet seien, und eine Klasse neuer Bürger-Politiker, die ihre Interessen auf dem Weg der direkten Demokratie durchsetzen wollten, fügte der Sprecher des Trägervereins „Changing Cities“, der frühere Bahnmanager Heinrich Strößenreuther, hinzu.
Eine Umfrage unter 347 Berlinern ergab laut Berliner Zeitung, dass die Hälfte der Antiwerbungs-Initiative positiv gegenüber steht. Bei einer Umfrage zum selben Problem im Internet meinte der Facebook-Nutzer David Helmus: „Müll nervt jeden. Lasst uns Müll verbieten!“ Auch das ist eine gute Idee: Wegen der vielen „To Go“-Imbißläden und vor allem „Starbuck’s“Filialen ist z.B. der Bürgersteig vor der taz und der taz-Café-Garten jeden Tag voller Verpackungsmüll. Einmal in der Woche wird er von zwei Mitarbeitern beseitigt, aber das reicht längst nicht mehr.

.
MeToo-Anfänge
Wochenlang diskutierte die taz „MeToo“, hier die Anfänge der Debatte: 1896 hatte Sigmund Freud vor Wiener Kollegen einen Vortrag gehalten, indem er berichtete, dass etliche seiner Patientinnen in ihrer Kindheit von Familienangehörigen, meist von ihren Vätern, sexuell mißbraucht („verführt“) wurden. Aus diesem Trauma entwickelten sich bei ihnen hysterische Symptome. Freud stieß damit auf eine derartige Empörung, dass er seine Befunde widerrief: Fortan waren diese Mißbrauchsgeschichten bloße Phantasien gewesen. – Bis der Projektleiter des Sigmund-Freud-Archivs in London, Jeffrey M. Masson, in Briefen und bei Recherchen in Paris den Vorgang aufklärte und ein Buch darüber veröffentlichte: „Was hat man Dir, Du armes Kind angetan. Sigmund Freuds Unterdrückung der Verführungstheorie“ (1984). Er wurde daraufhin aus der psychoanalytischen Vereinigung geworfen und wandte sich der Erforschung des Verhaltens von Tieren zu, woraus weitere Bücher entstanden – unbeanstandet.
1994 kam der amerikanische Evolutionstheoretiker Stephen Jay Gould noch einmal auf Freuds irrealisierte Hysterie-Theorie zurück. Sie beinhaltet den Gedanken, dass die „Reifung der Frau“ aus einem geglückten Übergang „vom klitoralen zum vaginalen Orgasmus“ besteht. „In diesem Wechsel der leitenden erogenen Zone“ liegen Freud zufolge „die Hauptbedingungen für die Bevorzugung des Weibes zur Neurose, insbesondere zur Hysterie. Diese Bedingungen hängen also mit dem Wesen der Weiblichkeit innigst zusammen.“
Freuds Theorie wurde von Medizinern, Psychologen und Anthropologen dankbar aufgegriffen, schreibt Stephen Jay Gould, der sodann auf die großen empirischen Untersuchungen der amerikanischen Sexualforscher, angefangen mit dem berühmten „Kinsey-Report“, zu sprechen kommt, die ab 1953 beim Befragen von vielen tausend Frauen eindeutig, wie er sagt, zu dem Ergebnis gekommen waren, dass sie fast alle einen Orgasmus bei Reizung ihrer Klitoris bekommen, in der Vagina dagegen keinen. Zeugung und Lust sind getrennt. Man ging jedoch allgemein davon aus, dass der Geschlechtsverkehr der Zeugung dient und der Orgasmus quasi der Anreiz dazu ist. Auch die Biologen und Anthropologen haben den Befund der Sexualforscher lange nicht zur Kenntnis genommen, denn, so Gould, „der klitorale Orgasmus ist ein Paradoxon nicht nur für die herkömmliche darwinistische Biologie, sondern auch für das Nützlichkeitsvorurteil, auf das sich alle funktionsbezogenen Evolutionstheorien (einschließlich derer von Lamarck und Darwin) gründen, sowie für die viel ältere Tradition der Naturtheologie.“ Biologisch gesehen ist die Klitoris das weibliche Pendant zum Penis, im frühen Embryonalstadium sind sie noch eins. Auch später ist sie noch genauso groß, nur zu Teilen im Körper verborgen.
1975 argumentierte der deutsche Humanethologe Irenäus Eibl-Eibesfeld desungeachtet noch, „dass die Evolution des weiblichen Orgasmus die Bereitschaft der Frau zur Unterwerfung fördere und außerdem die emotionale Bindung zum Partner stärke.“ Mit der „Evolution“ war der Freudsche „Übergang“ vom klitoralen zum vaginalen Orgasmus gemeint. 1981 schätzte die US-Anthropologin Sarah Blaffer-Hrdy ein, dass die Klitoris vielleicht einmal einem „Zweck diente“, aber nun wohl „ohne Bedeutung“ sei. Obwohl dieses Vorurteil Millionen Frauen unglücklich machte, weil sie laut Gould meinten, „sie müßten ihre Reife anhand dieses biologisch unmöglichen Übergangs definieren.“ Da konnte man schon hysterisch werden!
Die „Heerscharen von Psychoanalytikern und Hunderte von Artikeln in Zeitschriften und ‚Eheberatern’“ gaben aber nicht auf: Sie erfanden den „G-Punkt“ in der Vagina und fahndeten danach. Der G-Punkt heißt auch „Zone“ und wird nach dem Gynäkologen Ernst Gräfenberg benannt, der 1950 in einem Artikel von einer „erogenen Zone in der vorderen Vaginalwand“ schrieb, „die bei sexueller Stimulation anschwillt“. Heute gibt es von „gofeminin.de“ neben 5 Millionen weiteren Interneteinträgen zum G-Punkt das Versprechen: „Ekstase pur und ein plus an Lust“. Während „lovebetter.de“ weiß, wie Frauen „Den G-Punkt finden“. Wenn nicht, kann man ihn sich mit Kollagen vergrößern – „aufspritzen“ – und zudem die Vagina „straffen“ lassen. Immer wieder kommen auch neue G-Punkt-Gadgets auf den Markt. 2008 meldete „Die Welt“: „Den G-Punkt gibt’s tatsächlich“. Aufatmen bei den Männern: Bis dahin reicht ihr Penis locker. Und dann hat die Frau ja auch was davon. Das stärkt die emotionale Bindung zum Partner, mit Eibl-Eibesfeldt zu reden.
Aber schon fragt sich „fem.com“: „U-Punkt: Heißer als der G-Punkt?“: Diese quasi neuentdeckte Stelle, ebenfalls eine „Zone“, soll sich rund um die Harnröhre befinden. Man soll den „U-Punkt (von Urethra = Harnröhre) fühlen, kann ihn aber auch mit dem „G-Punkt-Vibrator“ finden. Inzwischen fragt sich schon „erdbeerlounge.de“: Was, „du kennst den U-Punkt nicht? Dann wird es höchste Zeit.“ Das stimmt, denn „Focus“ spricht bereits von einem „A-Punkt“ – und verrät auch gleich den Männern (!), wo der sich nun genau befindet, damit sie ihre Partnerin noch glücklicher machen. Auch diese ganze Stellensuche (A-, U- und G-Punkt sowie die gute alte Klitoris) hat was Hysterisches. Aber diese Bedingungen hängen eben mit dem Wesen der Frau innigst zusammen, wie Freud meinte. Oder vielleicht doch eher mit der Männermacht?
.

Die Crew macht zwar keinen vertrauenserweckenden Eindruck, aber es ist auch das falsche Schiff.
.
Privatisieren
Nachdem man die nordamerikanischen Indianer in Reservate zurückgedrängt hatte, waren von den einst rund 10 Millionen Indigenen noch 1, 5 Millionen übrig. Der größte Teil starb an Pocken, die von den weißen Siedlern eingeschleppt worden waren. In mindestens einem Fall geschah dies bewußt, indem man ihnen mit Pockenviren infizierte Decken lieferte, wie der Historiker Aram Mattioli in seiner Geschichte der Indianer Nordamerikas. Verlorene Welten“ (2017) erwähnt. Danach ging es darum, ihre laut dem US-Innenminister Carl Schurz „großen und wertvollen territorialen Besitzungen, die ungenutzt daliegen“ zu parzellieren und zu privatisieren, damit sie auf den freien Bodenmarkt gelangen konnten. Dazu wurde 1887 ein nach dem republikanischen Senator Henry Dawes benanntes Gesetz, der „Dawes Act“, verabschiedet, mit dem die indianischen Gemeinschaften zerschlagen werden sollten – „pulverisiert“, wie Präsident Theodore Roosevelt es ausdrückt, um die Indianer als ethnische Minderheit zum Verschwinden zu bringen. Die Indianer sollten laut Mattioli „Ich“ statt „Wir“ sagen: „Ihnen sollte ein gesunder Egoismus eingeimpft werden,“ denn „Selbstsucht ist die Grundlage der Zivilisation,“ verkündete Senator Dawes.
Etwas moderner drückten sich später in bezug auf die südamerikanischen Indianer die Verfasser der brasilianischen Staatsdoktrin zur Eingeborenenpolitik aus, die der Ethnologe Pierre Clastres in seiner „Archäologie der Gewalt“ (2008) zitiert: „Unsere Indianer sind Menschen wie wir alle. Aber das Leben in der Wildnis, das sie in den Wäldern führen, setzt sie Elend und Leid aus. Es ist unsere Pflicht, ihnen dabei zu helfen, sich aus ihrer Zwangslage zu befreien. Sie haben ein Recht darauf, sich in den Stand der Würde eines brasilianischen Staatsbürgers zu erheben, um ganz am Fortkommen der einheimischen Gesellschaft teilzunehmen, und um in deren Annehmlichkeiten zu kommen.“
Die Moral blamierte sich noch immer, wenn sie vom Interesse geschieden wart: In Wirklichkeit wurden und werden sie von Bergwerken, Staudämmen und Landwirtschaftskonzernen in die Slums der Städte vertrieben.
In Australien war es noch vor nicht langer Zeit straffrei, einen Aborigines zu töten. Inzwischen herrschen jedoch „politisch korrekte“ Zeiten, auch Multikulti ist noch angesagt, und da sollte man tolerant gegenüber anderen Denksystemen sein – und möglichst kooperieren, sich vernetzen usw.. Ausgehend vom australischen Garten „Kultiviert durch Feuer“ auf der IGA des australischen Büros „T.C.L.“ las ich einen Artikel der Wissenschaftshistorikerin Helen Verran über zwei verschiedene Arten, ein kontrolliertes Buschfeuer zu entfachen. Einmal die Umweltwissenschaftler, die 1 qm große Versuchsfelder anlegen, die Pflanzen darin bestimmen und zählen, dann die Quadrate verbrennen und anschließend wieder die Pflanzen, die dort neu hochkommen, bestimmen, zählen usw….Sie stehen dabei in der ‚Tradition u.a. von Linné und Darwin und berufen sich genealogisch auch auf sie – beim Legen ihrer Buschbrände.
Während die Aborigines sich auf die Clan- und Familiengeschichte und ihre eigene in ihrer Region, in der sie die Buschfeuer entzünden, berufen und in der Tradition der „Traumzeit“ argumentieren – sowie auch handeln. Dazu gehört, dass rings um den Brand alles gesammelt (Yamswurzeln), geerntet (Muscheln) und gejagt (Känguruhs) wird. Anschließend wird dies alles gerecht unter allen Clanmitgliedern geteilt – abgemessen nach der Nähe bzw. Entfernung im Verwandtschaftsgrad.
Da stoßen zwei Vorgehensweisen, „zwei Wissenschaften“ würde Lévy-Strauss sagen, aufeinander. Und dann sollen die Umweltwissenschaftler und Aborigines auch noch zusammenarbeiten…Letztere organisierten dazu einen gemeinsamen Workshop auf ihrem Territorium. Der Text darüber findet sich in der Aufsatzsammlung „Science and Technology Studies. Klassische Positionen und aktuelle Perspektiven“ (2017).
Helen Verran, die feministische Wissenschaftshistorikerin an der Charles-Darwin-Universität in der Küstenstadt Darwin im Norden der Northern Territories von Australien, hat sie alle drauf: die „Akteur-Netzwerk-Theorie“, die Latours und Haraways und schließlich das „postkoloniale Moment“, das bei dem Bemühen, die beiden Denksysteme zu gemeinsamer Aktion zu führen, aufscheint. Während hierzulande das Fortdauern imperialistischer Machtverhältnisse in anderer Gestalt als „postkolonial“ kritisiert wird, deutet in Australien das „Postkoloniale“ auf etwas Überwundenes, auf einen Bruch – glückhaft empfunden – hin.
Aber geht das Privatisieren des Nichtkapitalistischen nicht ständig weiter? „Heute bereiten diejenigen, die sich als die Herren Brasiliens fühlen, ihre Schlußoffensive gegen die Indios vor. Gegen die Indiovölker Brasiliens ist ein Krieg im Gang,“ zürnt der brasilianische Ethnologe Eduardo Viveiros de Castro in seinem „Lettre“-Aufsatz „Die Erde und der Körper“ (2017). Dabei macht der Staat, der sich doch verpflichtet hat, die Indios zu schützen, gemeinsame Sache mit der „Bourgeoisie des Agrobusiness“ und dem internationalen Kapital.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die Recherche „Auf den Spuren der malaysischen Holzmafia. Raubzug auf den Regenwald“ (2017) von Lukas Straumann, dem Geschäftsführer des Bruno-Manser-Fonds. Dabei geht es konkret um die Penan auf Borneo, für die der Bruno Manser Fonds Landrechtsklagen einreicht und ihnen Zugang zu „Bildung, Arbeit und medizinische Versorgung“ verschafft.
.

Dieses Schiff ist es zum Glück ebenfalls nicht.
.
Verdrängungswettbewerb
Bevor nach der Wiedervereinigung auch in den Westberliner „Problembezirken“ die Verdrängung der „Sozialschwachen“ einsetzte (2011 gab es allein im kleinen Neuköllner „Schillerkiez“ über 500 Entmietungen), kam es schon einmal zu einer „Gentrifizierung“. Und das kam so: Nach dem Mauerbau 1961 verließen die reichen Besitzer der Immobilien rund um den Kudamm die Stadt, weil man dachte, nun sei sie an die Kommunisten verloren. So fragte der Personalchef einer Zehlendorfer Textilfabrik vier Italiener, die bei Mercedes in Untertürkheim arbeiteten und 1962 um Arbeit nachfragten: „Haben Sie auch keine Angst vor den Russen?“ Nein – im Gegenteil: Sie waren selbst Kommunisten. Als sie zurück nach Untertürkheim fuhren, um zu kündigen, meinte der dortige Personalchef: „Ihr seid verrückt, Westberlin fällt doch bald den Kommunisten zu.“ Der Kabarettist Wolfgang Neuss war einer der wenigen Westberliner, die den Mauerbau differenzierter sahen: „Der hat auch was Gutes gehabt; die schlimmsten Leute haben die Stadt verlassen.“
Ihre leerstehenden riesigen Wohnungen wurden billige Studenten-WGs. Fast alle Demonstrationen nach 1966 fanden zwischen Kudamm und Bahnhof Zoo statt. Aber als die Kommunisten Westberlin bis Mitte der Siebzigerjahre noch immer nicht geschluckt hatten, faßten die reichen Säcke Mut und kümmerten sich wieder um ihre Frontstadt-Immobilien – mit der Folge, dass die Studenten nach Schöneberg und Kreuzberg abgedrängt wurden. Dort war aber kein Leerstand – in den heruntergekommenen Häusern in Stadtbesitz. Es lebten hier massenhaft „Fußkranke“: das waren all jene exproletarischen Existenzen, die nicht ihren Betrieben nach Westdeutschland gefolgt waren. Hinzu kamen jede Menge Alkoholiker und Kleinkriminelle. Ihre geringe Miete und darüberhinaus verdienten sie u.a. bei „Sklavenhändlern“, allein in der Muskauer Strasse gab es zwei: „Arbeitseinsatz 13“ und „23“. Ich arbeitete erst bei „23“, als der wegen „Unregelmäßigkeiten“ geschlossen wurde, bei „13“. Man bekam frühmorgens eine Nummer und wurde aufgerufen: „Baustelle Wedding!“ Dann fuhr man zu viert oder sechst dorthin, meine Kollegen tranken schon während der Fahrt jeder eine Familienflasche Cola leer, so einen Brand hatten sie.
Ich wechselte dann als „Erzieher“ in ein Kinderheim. Dort war es noch schlimmer: Anders als drüben im Osten waren sich hier die Heimerzieher sicher: „Aus diesen ganzen Waisenkindern werden sowieso nur Kriminelle und Nutten.“ Ich sollte mich da nicht groß ins Zeug legen. Das war meine Einweisung. Ich konnte mir einen Gebrauchtwagen leisten, er war dann das einzige Auto, das in der ganzen Forsterstrasse parkte. Aber das änderte sich – mit den Studenten, die nach und nach alle „Fußkranken“ in den Wedding oder sonstwohin verdrängten. Als die Studenten dann auch noch die eine oder andere Freßkneipe besuchten, die „Stiege“ und das „Samira“ – viel mehr gab es in diesem Teil Kreuzbergs nicht, schwangen die Nazirocker, die ihr Vereinsheim im ungenutzten U-Bahnhof unterm heutigen Alfred-Döblinplatz hatten, sich zu Rächern der von Gentrifizierung bedrohten Subproletarier auf – stürmten die Lokale und verprügelten die Studenten. Das war natürlich nicht im Interesse der Wirte: drei Palästinenser, die erst aus Israel und dann aus Beirut vertrieben worden waren, sie organisierten mit den anderen Wirten im Kiez eine Schutztruppe , die sich gewaschen hatte. Nach einem Jahr durften die Rocker sogar wieder in ihre Lokale – jedoch nur ohne ihre hakenkreuzgeschmückten Jacken. So war das: die erste Mieterverdrängung nach dem Krieg im Kiez.
Es gab da auch schon die Künstler, die Bohème, „Kreuzberger Nächte sind lang“. Bereits 1964 registrierte Ingeborg Bachmann, dass Kreuzberg „im Kommen“ sei. In ihrer Dankesrede zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises führte sie dazu aus: „die feuchten Keller und die alten Sofas sind wieder gefragt, die Ofenrohre, die Ratten, der Blick auf den Hinterhof. Dazu muß man sich die Haare lang wachsen lassen, muß herumziehen, muß herumschreien, muß predigen, muß betrunken sein und die alten Leute verschrecken zwischen dem Halleschen Tor und dem Böhmischen Dorf. Man muß immer allein und zu vielen sein, mehrere mitziehen, von einem Glauben zum andern. Die neue Religion kommt aus Kreuzberg, die Evangelienbärte und die Befehle, die Revolte gegen die subventionierte Agonie. Es müssen alle aus dem gleichen Blechgeschirr essen, eine ganz dünne Berliner Brühe, dazu dunkles Brot, danach wird der schärfste Schnaps befohlen, und immer mehr Schnaps, für die längsten Nächte. Die Trödler verkaufen nicht mehr ganz so billig, weil der Bezirk im Kommen ist, die Kleine Weltlaterne zahlt sich schon aus, die Prediger und die Jünger lassen sich bestaunen am Abend und spucken den Neugierigen auf die Currywurst…An einem Haustor, irgendeinem, wird gerüttelt, ein Laternenpfahl umgestürzt, einigen Vorübergehenden über die Köpfe gehauen…Nach Mitternacht sind alle Bars überfüllt.“
Das war zwar völlig übertrieben (dichterisch überhöht), aber 20 Jahre später galten die Kreuzberger Künstler den linken Studenten und Hausbesetzern als „Speerspitze der Gentrifizierung“ und wurden bekämpft. Als sie ihrerseits dann von den „Grünen“ bekämpft wurden, schimpfte der Renegat Karl Schlögel sie im Tagesspiegel als „Landsknechte“. Sie leben inzwischen fast alle auf dem Land und betätigen sich dort tatsächlich als „Knechte“.
.

Und auch dieses Schiff leider nicht.
.
Invasive Arten und Weisen
Nicht nur soll das Putinsche Hacken sich hierzulande zwar unbemerkt aber desto „invasiver“ auswirken, es verstören uns auch immer mehr „invasive“ Tiere und vor allem Pflanzen. Regelmäßig warnen die Zeitungen vor besonders giftigen und sich rasendschnell ausbreitenden. Zu den invasivsten, wenn auch ungiftigen gehört der chinesische Götterbaum, der millionenfach z.B. an den Rändern der Schienentrassen wächst. In der Schweiz wird diese und andere „invasive Arten“ besonders rigoros verfolgt. Dort darf ein schwarzer Schwan als invasiver Australier sich noch nicht einmal mit einem weißen Schweizer Schwan verpaaren. Für den Münchner Biologen Josef Reichholf ist dies Ausdruck von „konservativ-anthroponationalistischem Denken“.
Im Frühling pflanzte ein Gärtner an einem Berliner Café in deren Blumenkübel ein Doldengewächs namens Bärenklau. Davon gibt es etwa 70 Arten weltweit, als dieses Exemplar für den Garten langsam seine großen Blütenstände entfaltete, kamen ständig mit floralem Halbwissen auftrumpfende Leute ins Café und schimpften: „Wie könnt ihr bloß diesen Riesenbärenklau hier einpflanzen? Der kommt aus Sibirien und ist hochgiftig!“ Es handelte sich dabei jedoch um eine nichtgiftige hiesige Bärenklauart, was die Cafébetreiber auch stets geduldig erklärten – aber nach zwei Monaten wurde es ihnen doch zu viel: Sie rissen die lebensfroh wuchernde Gartenstaude aus und warfen sie auf den Müll.
Heute haben wir es aber eigentlich mit ganz anderen invasiven Pflanzen zu tun, die uns wirklich gefährlich werden können: Die Züchter meinen, ihre Kunden wollen immer neue Blumen mit immer üppigeren und knalligeren Blüten, und bei den Beerensträuchern und Obstbäumen immer verrücktere Kreuzungen mit immer größeren Früchten. So wird die Flora langsam denaturiert. Mittels Gentechnik kreierte man u.a. violett blühende Rosen und Nelken und kürzlich auch noch blau blühende Chrysanthemen: „endlich!“ freute sich die FAZ, da Generationen von klassischen Blumenzüchtern dies vergeblich versucht hätten. Ich besuchte 2001 mit einer Gemüsegärtnerin einige Kleingärten in westpolnischen Kleinstädten: Dort züchteten die Kleingärtner ihre Pflanzen noch vielfach selbst, mit der Folge, dass sie noch etwa so aussahen wie unsere in den Fünfzigerjahren. Meine Begleiterin wurde ganz wehmütig.
Bei den Gemüsepflanzen besteht die unheilvolle Invasion darin, dass z.B.. bei den Tomaten zwar alle regionalisiert und ökologisiert angeboten werden: Sie kommen aus „Italien, Spanien und Holland“ oder werden – in Österreich – als garantiert „gentech-frei“ verkauft. Aber es gibt nirgendwo gentechnisch veränderte Tomaten im Handel. Es ist alles Etikettenschwindel. So gut wie alle Tomatensamen stammen aus Holland – von den dortigen Tomatenzüchtern, deren Firmen jedoch großenteils den multinationalen Chemiekonzernen Monsanto, Bayer und Syngenta gehören. Letzterer wurde gerade von einem chinesischen Konzern, der „China National Chemical Corporation“ übernommen und erstere schlossen sich zusammen. „Heute sind noch zehn Samenhäuser verantwortlich für 85 Prozent des Weltmarktes in Gemüsesamen,“ schreibt die holländische Autorin Annemieke Hendriks in ihrer hervorragenden Reportage „Tomaten“ (2017). U.a. interviewte sie darin einen Manager der niederländischen Saatgutzucht-Firma „Rijk Zwaan“, die „an vorderster Front“ gegen die Patentierung von klassischen Samenveredlungsprozessen kämpft. Gleichzeitig arbeitet „Rijk Zwaan“ jedoch mit dem Biotech-Unternehmen „KeyGene“ zusammen und erwarb 2016 ein Tomatenpatent, drei Jahre zuvor hatte die Firma bereits ein Salatpatent erworben. Annemieke Hendriks nennt „Rijk Zwaans“ Firmenpolitik „zwiespältig“, während der Manager meint: „Wir haben eine kuriose Situation“. Damit will er sagen, dass seine Firma auch weiterhin und mit guten Argumenten gegen EU-Patente auf Lebensmittel kämpft, dass sie aber dennoch dabei mitmachen muß, um konkurrenzfähig zu bleiben.
.

Aber hier sind wir richtig! Die Kursmanager auf der Kommandobrücke bestätigen es uns lächelnd: „Welcome on board“.
.
Gefühlswaren
Die kapitalistische Konsumsphäre beeinflußt unsere Emotionen nicht mehr bloß „irgendwie äußerlich“, meint der Leiter des Frankfurter Instituts für Sozialforschung Axel Honneth, inzwischen haben „unsere Gefühle selbst die Form von jederzeit einsatzfähigen Waren“ angenommen, weswegen die israelische Soziologin Eva Illouz von „Gefühlswaren“ spricht – in ihrem neuen Buch „Wa(h)re Gefühle“, das von Axel Honneth bevorwortet wurde. Laut Illouz hat der Neoliberalismus geradezu eine „Intensivierung des Gefühlslebens“ hervorgerufen. Der FAZ zufolge führt dies dazu, dass uns die „Fähigkeit“ abhanden kommt, „unsere echten Gefühle von jenen zu unterscheiden, die der Kapitalismus bewußt hervorbringt“.
Waren werden für den Markt gemacht, auf dem Äquivalente getauscht werden. Schon immer. Sind die „Partnerbörsen“ vielleicht nur die neuen Supermärkte für Gefühlswaren? Aber was sind überhaupt „echte Gefühle“? – Zumal in einer Servicegesellschaft, in der für die Beschäftigten Lächeln und Freundlichkeit obligatorisch ist. „Sie müssen lernen, sich besser zu verkaufen!“ Man spricht von „vertrauensbildenden Kommunikationsstrategien“…
Bereits Arthur Schopenhauer fragte sich: „Woran sollte man sich von der endlosen Verstellung, Falschheit und Heimtücke der Menschen erholen, wenn die Hunde nicht wären, in deren ehrliches Gesicht man ohne Misstrauen schauen kann?“ Der Psychoanalytiker und Haustierbesitzer Jeffrey Masson schrieb ein ganzes Buch, um zu beweisen: „Hunde lügen nicht“, die Psychologin Susanne Preusker, die kürzlich Selbstmord beging, kam dagegen in ihrem Ratgeberbuch „Wenn das Glück mit dem Schwanz wedelt“ zu dem Schluß: „Ein Hund versteht es, Dankbarkeit zu heucheln.“ Auch Konrad Lorenz bemerkte schon bei seinen Hunden „Bully“ und „Stasi“, dass sie „geschickt lügen“ konnten. Der Verhaltensforscher Kurt Kotrschal, Autor der „sozioökonomischen Bestandsaufnahme ‚Faktor Hund‘“ (2004) erwähnt einen, der mit seinem Herrn gewissermaßen mitlog: „Checker“ – der Hund des US-Präsidenten Nixon: Er half ihm, vor laufender Kamera seiner Watergate-Lüge mit treuherzigem Gesichtsausdruck Glaubwürdigkeit zu verleihen. Laut den „Simpsons“ kam „Checker“ dafür in die „Hundehölle“. Fast alle US-Präsidenten besaßen Hunde zur Glaubwürdigkeitssteigerung (über 400 bisher). Die USA sind aber nicht nur ein Hundeland, sondern auch ein Katzenland, und wenn ein Politiker dort irgendetwas Dummes oder Brutales gesagt bzw. getan hat, inszenieren seine Berater schnell eine telegene Aktion für ihn, die sie „Eine Katze retten!“ nennen. Dass domestizierte Tiere aufgrund ihrer „Sklavenposition“ (sie sind „Sachen“ im Privateigentum) sich mindestens korrumpieren lassen können in ihrem Gefühlsleben, darauf hat der Verhaltensforscher und Zoodirektor Heini Hediger bereits 1954 in seinen „Skizzen zu einer Tierpsychologie im Zoo und im Zirkus“ abgehoben: „Bei Säugetieren besteht eine weitverbreitete und überraschend hoch entwickelte Fähigkeit, menschliche Ausdrucksweisen ganz allgemein aufs feinste zu interpretieren. Das Tier, und besonders vielleicht das Haustier, ist oft der bessere Beobachter und der präzisere Ausdrucksinterpret als der Mensch.“ In dem jüngst erschienenen Buch des Herausgebers des Regensburger Punk-Magazins „Marionett“, Jürgen Teipel: „Unsere unbekannte Familie“, in der rund 40 Leute berührend über ihre Beziehung zu einem oder mehreren Tieren berichten, erzählt die Reittherapeutin Sybille Wiemer von einem Pferd, dass gelegentlich humpelte und dann wieder nicht. Nachdem zwei Tierärzte es untersucht hatten, kam sie zu dem Schluß: „Dieses Pferd lügt, dem fehlt nichts.“ Es gelang ihr, dies dem Tier abzugewöhnen, indem sie ihm quasi bewies, dass es das bei ihr nicht nötig hat. Bei all diesen Beispielen handelt es sich um Tiere in menschlicher Alsobhut, es könnte also durchaus sein, dass ihre Gefühle den Besitzern gegenüber schon gelegentlich Warencharakter angenommen haben, zumal sie keine Nutztiere (mehr) sind und ihnen von daher nur noch ein „emotionaler Wert“ zukommt, den sie sich gewissermaßen erarbeiten (müssen).
Sind Wildtiere vielleicht ehrlicher? Heini Hediger meinte, sie seien die am wenigsten „beeinflußtesten“ und deswegen „die Norm für alle Beurteilung tierlichen Verhaltens.“ In diesem Sinn behauptet auch der US-Autor Mark Rowlands in seinem autobiographischen Buch „Der Philosoph und der Wolf“ (2009): „Wölfe sind nicht in der Lage zu lügen”.
.

Die nette Passagierin in der Kabine nebenan ist jetzt schon seekrank, dabei sind wir noch nicht mal aus der Kieler Förde raus.
.
Positiv und Negativ denken
Theodor W. Adorno riet seinen ins Berufsleben entlassenen Studenten: „Und vergeßt nie den bösen Blick. Sonst seid ihr verloren.“ Beim Lesen der Jungen Welt von vorne bis hinten denke ich manchmal: Da waltet noch immer der böse Blick, und die Herausgeber haben wahrscheinlich auch allen Grund, der westlichen Welt, die sich jetzt auch über den Osten erstreckt, das als DDR-Intellektuelle übel zu nehmen. Dementsprechend entdecken sie dann auch täglich in allen Ländern, Branchen und Themenbereichen irgendwelche Sauereien, die sie aufdecken. Da traten z.B. 40 Arbeiter einer Textilfabrik in Nordaustralien in den Streik – und schon veröffentlichte die Junge Welt ein Interview mit dem Streikführer. Woher haben die bloß so schnell von dem Streik erfahren und die Telefonnummer des Streikführers rausgekriegt, fragte ich mich – und frage ich mich immer noch bei diesem oder jenem Artikel. Klar, sage ich mir dann, da arbeiten einige DDR-Auslandsspione in der Redaktion mit, die haben damals natürlich viele Kontakte geknüpft und wissen, wie man an Informationen rankommt. Aber das erklärt es nur zum Teil.
Neulich habe ich mehrmals auch die taz von vorne bis hinten gelesen, dabei ist mir aufgefallen – und fällt mir immer mehr auf: dass sie im Gegensatz zu früher heute zu glücklichen Lösungen – in allen Fällen – neigt. Also es wird nicht marxistisch, wie das anfänglich mal „Gesetz“ war, ein Phänomen, ein Vorfall analysiert, aufbereitet und in Textform gebracht, sondern man bleibt oft an der Oberfläche und findet um so schneller ein Ende-gut-Alles-gut in der Berichterstattung, mindestens, dass es So-und-so gut ausgehen könnte. In Kalifornien gibt es einen Radiosender, der nur positive Nachrichten veröffentlicht. So schlimm ist es mit der taz noch nicht, auch wenn sie sich immer mehr auf „weiche Ideologien“ beschränkt, die sie bearbeitet: Menschenrechte, Umweltschutz, Gender etc.. und die „harten Ideologien“ (Klassenkampf, Bürgerkrieg) nur noch distanziert-amüsiert betrachtet. Ich führe das auf „westliches Denken“ zurück, das ökonomisch durch sicheren Arbeitsplatz, Heirat, Kinderkriegen, Kleinwagen, Datscha, Urlaub etc. fundiert wird – mit immerwährenden „Atlantikbrückentage“. Anders gesagt: Dass die jungen Leute im großen Ganzen mit der kapitalistischen Welt, wie sie ist, zufrieden sind und sich und ihrem Nachwuchs eine Zukunft darin gönnen, also dass es immer so weiter geht wie bisher, natürlich immer mal mit einigen üblen Folgen, aber wir arbeiten daran, das läßt sich alles lösen. Die optimale Lösungsstruktur findet man in einer „Genossenschaft“, die für den Markt produziert, die dort acquiriert, die sich im freien Spiel der Kräfte behauptet, ökonomisch halbwegs erfolgreich.
Noch extremer finde ich diesen ganzen, aus positivem Denken resultierenden Komplex unter meinen sogenannten Facebook-Freunden, die dazu noch die Tendenz verfolgen, ihre Gedanken in großen amerikanischen Sprüchen auf farbigem Hintergrund auszudrücken – à la „Der Betroffene schreit/Der Weise schweigt“. Oder etwas ähnlich Bescheuertes. Auf Englisch auch noch meistens. Bei ernsteren „Posts“, also bei Eintragungen mit „Content“, taucht garantiert ein „Wir“ auf: „Wir müssen…“, „Wir sollten eine Online-Petition machen…“ Bei vielen FB-WIRs kann eigentlich nur die Weltbevölkerung, wir alle – 6,5 Milliarden gemeint sein.
Das erste Mal, dass mir solch ein Sinneswandel von einem Den-Dingen-auf-den-Grund-gehen, also von der Notwendigkeit, täglich die Kacke des Seins umzugraben, hin zu einer freundlichen Oberflächenbetrachtung auffiel, war bei dem, was ein kriegsgewinnlerisch gestimmter Subautor von „Merian“ mit meinem Text über die Privatisierungssauereien bei Narva gemacht hatte. Er hatte im Wesentlichen nur einen Satz hinten angefügt: „Die D-Mark wird es schon richten!“ Zum Glück konnte ich diesen Satz wieder entfernen lassen, der Ausdruck einer willentlichen Gedankenlosigkeit war – und im Grunde meinen ganzen Text davor als eine Schilderung von (für Außenstehende) unterhaltsamen, aber überflüssigen Querelen charakterisieren sollte. Die willentliche Gedankenlosigkeit im Denken/Schreiben, die sich beim obigen Beispiel auch noch als „professionell“ gerierte, ist analog dem Weggucken bei Bettlerelend, Grausamkeiten in Film und Fernsehen oder bei einem Ehestreit, der einen nichts angeht. Man guckt auch weg, wenn ein Schwein, das gerade geschlachtet werden soll, einem in die Augen blickt. Daneben gibt es auch ein intellektuelles Übersehen, es besteht darin, dass man eine singuläre Sauerei so „hochrechnet“ (argumentativ einordnet), dass sie nur noch als eine fast unwichtige Ausnahme der allgemeinen Mainstream-Meinung erscheint. Etwas Runterspielen durch hochrechnen geht immer. Zumal das Hochrechnen zum täglichen Brot des Journalismus gehört, insofern er nie die Relevanz eines berichtenswerten Phänomens einschätzen kann – und sich deswegen mit Wörtern wie „zunehmend“ und „immer mehr“ aus der Affäre ziehen muß: Wenn ihm ein Mensch mit einem Nagel im Kopf gemeldet wird, kann er das nur produktiv wenden, wenn er von „immer mehr“ Menschen ausgeht, die „zunehmend“ mit einem Nagel im Kopf herumlaufen.
.

Es ist ein italienisches Schiff. Ok. Das Kreuz hängen wir aber trotzdem ab.
.
Strategisch denken
B. war in der Westberliner Hausbesetzerbewegung aktiv, die sich bald spaltete – in „Verhandler“ und „Radikale“; letztere warfen den ersteren, zu denen auch B. gehörte, Verrat vor. Dem trat B entgegen, indem er sich als Herausgeber der verbotenen „radikal“ anbot. Später – im Europäischen Parlament, konzentrierte er sich auf die alle organismischen Probleme zu lösen versprechende Gentechnik, d.h. auf ihre gesetzliche Einhegung in Europa. Daraus entwickelte sich das „Gen-ethische Netzwerk“ mit dem Magazin „Gen-ethischer Informationsdienst“.
Dann engagierte sich B. wegen des Ozonlochs bei Greenpeace in einer Kampagne für FCKW-freie Kühlschränke, dazu gab es ein Patent für FCKW-freie Kühlschränke. Nach der „Wiedervereinigung“ bot Greenpeace (B.) es dem DDR-Kühlschrankhersteller dkk scharfenstein an, die prompt mit der serienmäßigen Herstellung dieses Öko-Kühlschranks begannen. Die „chlorreichen Sieben“ – Kühlschrankhersteller der BRD – sahen darin eine Marktgefährdung und versuchten das „Projekt“ im Erzgebirge zu verhindern, u.a. mit einem Rundbrief an alle Kühlschrankhändler, in dem sie vor diesen brandgefährlichen neuen Kühlschränken – Greenfreeze“ – warnten. Einmal begleitete ich B. nach Scharfenstein. Er sprach mit einigen Mitarbeitern dort. Mir fiel auf, dass ihn der Betrieb eigentlich wenig interessierte, obwohl das Greenpeace-Patent entscheidend zum Überleben des Betriebs beitrug. Aber B. war da schon weiter: Es ging ihm darum, die „global player“ unter den Kühlschrankherstellern dazu zu bringen, nur noch FCKW-freie Kühlschränke zu produzieren. Dazu sollte eine große Konferenz in Peking stattfinden. B. war gut vorbereitet, in ökologischer wie ökonomischer Hinsicht – Gaia und Weltmarkt.
Viel später erfuhr ich aus der Presse, dass die Firma in Scharfenstein mehrmals den Besitzer gewechselt hatte und dann pleite gegangen war, nicht zuletzt, weil sie sich gegenüber Greenpeace verpflichtet hatte, keine weiteren Patente auf ihren neuen Kühlschrank anzumelden. „Die Umweltschützer wollten das Wohl der Welt fördern,“ wie der Spiegel erklärte, und nicht die Arbeitsplätze der 630 Kühlschrankbauer sichern. Diese fielen mir aber ein, als eine Frau aus dem Erzgebirge mir erzählte, wie schrecklich es dort jetzt sei. Sie dachte dabei nicht an die AfD, sondern an die vielen Bergarbeiter, die bei ihrer gefährlichen Arbeit ihre Gesundheit ruiniert hatten und dann arbeitslos geworden waren, wobei sie nicht wußten, wie weiter. Niemand wußte es. Ihr Problem waren die „Weltmarktpreise für Bodenschätze“ (u.a. Zinn und Uran), wie die Frau meinte, „die Bergwerke dort waren nicht mehr konkurrenzfähig“. Ich erinnerte sie daran, dass die Kaligrube in Bischofferode gerade deswegen auf Druck des West-Kalikartells geschlossen wurde, weil ihr spezielles Produkt nach der Wende noch begehrter geworden war – u.a. von einem kanadischen Konzern, der nicht mit dem Haber-Bosch-Verfahren Dünger daraus herstellte.
B. übernahm die Büroleitung einer Stiftung für Saatgutvielfalt: auch ein Patentproblem, und ein globales obendrein. Mehrmals organisierte er kleine und große Kongresse über Pflanzen – mit interessanten Wurzel- und Symbioseforschern aus der Schweiz. Nachdem man ausgerechnet hatte, dass jedem Menschen auf der Erde theoretisch 2000 Quadratmeter Boden zustehen, startete er ein Experiment: ein „Weltacker“ von dieser Größe, der einen „Freiwilligen“ ein Jahr lang ernähren sollte. So viel ich weiß, war dieses „Projekt“ bislang ziemlich erfolgreich. Es war jetzt auch auf der Internationalen Gartenausstellung, allerdings hat man dort die 2000 Quadratmeter derart globalisiert, dass auch exotische Nutzpflanzen wie Sorgum, Yams und Baumwolle angebaut wurden. Viele Interessierte besuchten täglich das Projekt, kompetente Mitarbeiter vermittelten ihnen nützliches Pflanzenwissen. Zwei Informatikstudenten verkauften dort ein Set zum Selberbauen eines Pflanzentopfs, bei dem man das Wachsen der Wurzel in der Erde mitverfolgen konnte. In einer Diskussion waren wir von B.s enormem Wissen über globale Ernährungsprobleme beeindruckt.
Wenig später fiel mir der „Kritische Agrarbericht 2017“ in die Hände, in dem B. sich mit den Zukunftsstudien der Bio-Agrarverbände auseinandersetzte. Ihrem technokratischen Denken, das mit dem der traditionellen Landwirtschafts-Funktionäre inzwischen nahezu konform geht, hielt er die „Werte“ der „Öko-Bewegung“ entgegen, die u.a. auf „Ganzheitlichkeit“ und „Gemeinsinn“ besteht. Ich sah statt einer „Öko-Bewegung“ eher eine „Öko-Mode“, die sich leichtherzig in das bestehende Schweinesystem integriert. Ein Freund schickte mir einen Satz aus B.s Text und wollte wissen, was ich davon halte. Der Satz lautete: „Die Bodenfruchtbarkeit ist sowohl das entscheidende Produktionmittel als auch ein wesentliches Produkt.“ Ich antwortete ihm: Das ist sehr technokratisch produktivistisch gedacht – insofern die Pflanzen dabei nur Mittel zum Zweck sind – nicht für sich selbst Zweck. Dieses Denken sah ich schon beim erzgebirgischen FCKW-freien Kühlschrank in „Bewegung“. Die Arbeiter waren dort auch nur Mittel zum Zweck – der Durchsetzung einer anderen – besseren – Technologie. So wie auch die Pflanzen des Weltackers nur Mittel zum Zweck der Durchsetzung einer anderen – besseren – Ernährung sind.
Bei beiden Projekten geht es um die Weltbevölkerung, d.h. um die Rettung der ganzen Welt. Ich schickte meinem Freund einen Satz von einem anderen Weltdenker – vom bayrischen Filmemacher Herbert Achternbusch, den der DDR-Dramatiker Heiner Müller als einen „Klassiker des antikolonialen Befreiungskampfes auf dem Territorium der BRD” bezeichnete: „Da, wo früher Pasing und Weilheim waren, ist heute Welt. Ein Mangel an Eigenständigkeit soll durch Weltteilnahme ersetzt werden. Man kann aber an der Welt nicht wie an einem Weltkrieg teilnehmen. Weil die Welt nichts ist. Weil es die Welt gar nicht gibt. Weil Welt eine Lüge ist. Weil es nur Bestandteile gibt, die miteinander gar nichts zu tun haben brauchen. Weil diese Bestandteile durch Eroberungen zwanghaft verbunden, nivelliert wurden. Welt ist ein imperialer Begriff. Auch da, wo ich lebe, ist inzwischen Welt. Die Welt hat uns vernichtet. Das kann man sagen.“
.

Die Kabine ist klein aber oho. Erst mal umziehen – etwas Seetüchtiges vielleicht. Danach gilt es, das riesige Schiff zu erkunden.
.
Touristenantreibung
Als Touristen antreibende Maßnahmen („Tourismusbooster“ – eigentlich müßte es anziehende Maßnahmen heißen) werden im Zuge der Standortkonkurrenz große Immobilienprojekte bezeichnet: u.a. die Hamburger Elboper, das Stralsunder Ozeaneum oder das „grösste Süßwasser-Aquarium Europas“ in Lausanne. Wir leben in nachgesellschaftlichen Projektwelten und stets zeichnen sich diese „Projekte“ durch wahre Größe aus, so groß, dass ihren Betreibern irgendwann die Luft ausgeht, wie man so sagt. Ihre Großprojekte mit extrem vielen Festangestellten und Honorarkräften unterliegen zudem als „Tourismusbooster“ den „Destination-“ bzw.“Location“-Moden.
In den meisten Fällen sind es die Touristen selbst, die durch ihre zunehmende Massenpräsenz den Ort, das Event, die Sehenswürdigkeitsansammlung irgendwann derart versauen, dass keiner mehr dort hin will. Zudem muß immer wieder was Neues, noch größeres womöglich, her. Erinnert sei an die in Berlin einst in festen Häusern gastierenden Zirkusshows, in denen Dressur-Kunststücke mit Pferden vorgeführt wurden. Es waren Kassenknüller (Blockbuster). Aber dann kamen andere Etablissements mit Raubtierdressuren – und kein Mensch wollte mehr Pferde sehen. In neuerer Zeit war es z.B. die berühmteste Westberliner Diskothek „Dschungel“, die nach dem Mauerfall sofort pleite ging, weil alle ihre berufsneugierigen Gäste in die Ostberliner Oranienburgerstrasse abgewandert waren.
Ganze Orte wie Rothenburg ob der Tauber, Neuschwanstein, Rimini wurden bereits von Touristen verschluckt, verdaut und ausgespuckt. Bei den Kulturprojekten gibt es ein Schwanken zwischen Bildung/Aufklärung (das Dresdner Hygienemuseum) und Unterhaltung/Amüsement (die Naßfischsammlung im Berliner Naturkundemuseum) – also um Konzentration und Zerstreuung gleichzeitig (Infotainment). Das Bauernkriegsdenkmal in Frankenhausen „mit dem größten Gemälde der Welt“ oder die „Weltausstellung Reformation“ in der Lutherstadt Wittenberg versus „Heidepark Soltau“ oder „Karls Erlebnis-Dorf in Elstal“. Zwar scheiden sich hierbei die Geister – mindestens statistisch, in dem die einen eher von bildungsbeflissenen Mittelschichtlern und die anderen mehr von amüsierentschlossenen Unterschichtlern frequentiert werden, aber grundsätzlich fühlt sich jeder aufgefordert, alle diese Urlaubs- und Freizeit-Projekte kennen zu lernen, um, wie es heißt, mitreden zu können. Ausnahmen bestätigen die Regel. Dazu zählt z.B. jene friesische Reisegruppe, die jahrelang immer in der Westberliner Pension Nürnberger Ecke Sommerurlaub machte – und sich ausschließlich im „Europa-Center“ herumtrieb.
Berlin betreffend sind die zweistelligen Zuwachsraten im Tourismusgeschäft eingebrochen – was auf die „Air-Berlin-Pleite“ zurückgeführt wird. Burkhard Kieker, Berlins oberster Tourismuswerber steht nun laut Morgenpost „vor einer schwierigen Aufgabe“. Allen müsse klar sein, sagt Kieker, dass der Tourismus kein Selbstläufer ist und Berlin etwas tun müsse, „um international am Ball zu bleiben. Gingen die Gästezahlen zurück, seien nicht nur Fluglinien und Hotels betroffen, sondern auch Kultureinrichtungen und Einzelhandel.“ Und das wiederum heißt, dass die Arbeitslosenzahlen steigen. Kieker sammelt bereits Geld, für eine große Marketingkampagne in diesem Jahr. Einen Slogan verriet er der Morgenpost bereits: „Berlin will im Sommer mit der Idee ‚Hot City, cool Water‚ Gäste anlocken. Vormittags zu Nofretete, nachmittags zum Baden oder Sonnen an den Wannsee, abends ins Konzert oder Restaurant.“ Diese Verbindung von Weltstadt-Leben, Kultur und Wasser habe sonst nur Sydney zu bieten, schwärmte Kieker. Weitere bereits geplante Aktionen seien eine „Roadshow“ durch Deutschland, bei der lokale Politprominenz für Berlin werben soll sowie eine Werbekampagne zum Start der TV-Serie „Babylon Berlin“ in der ARD.
Die Touristenantreibung ist ein schwieriges Geschäft: Ich mußte während der Grünen Woche für eine Reisegruppe aus einem bayrischen Dorf bei Regensburg einen Nachmittag und Abend organisieren. Sie hatten das die Jahre zuvor immer selbst gemacht – via Internet und z.B. solche tollen Veranstaltungen wie eine Kabarettvorstellung im Kulturhaus Karlshorst ausgesucht. Obwohl ich meinte, mich gut in der Stadt auszukennen und gerade nichts „Sceniges“ ausgesucht hatte, gefielen ihnen alle „Locations“ überhaupt nicht. Davor mußte ich mir mal eine abendliche Zerstreuung für eine Verdi-Gewerkschaftsschulungsgruppe aus Westdeutschland ausdenken. Aber sie lehnten alle Vorschläge ab, weil sie jeden Abend in „Berlins bekanntester Fußballkneipe ‚Hanne am Zoo‚“ gehen wollten. Da wäre ich auch nie drauf gekommen. Die „Hanne“ hat nun zugemacht – und damit hat die Stadt wieder einen „Tourismusbooster“ verloren. Andere „Locations“ versuchen mit Neuerungen attraktiv zu bleiben: Nach der Technomusik, den Designerdrogen und den verschämten Darkrooms werben nun immer mehr Clubs mit „Sex im digitalen Strobolight“. „Berlin hat hier europaweit eine Vorreiterstellung“, schrieb der Tip und meinte, dass diese „sexpositiven Events eine logische Konsequenz“ aus der bisherigen Clubentwicklung seien.
.

Unter Deck ist am ersten Abend bereits der Teufel los.
.
Reichsein-Sauberwerden
Mindestens drei Mal in der Woche bekomme ich per Email von mir unbekannten Absendern (Unternehmen?) die Chance, schnell ganz viel Geld zu verdienen. Meistens lösche ich sie sofort (wie z.B. die regelmäßigen riesigen Gewinne aus einer spanischen Lotterie, der Aufforderung vom Münchner „Lotto24“ mein Jahresabo zu verlängern, wenn ich weiter gewinnen will, und die vielen Beteiligungsangebote von betrügerischen Investmentfirmen auf dubiosen Südseeinseln), aber manchmal leite ich sie auch weiter an einen spamkundigen Computernerd, der mir dann sagt: nicht öffnen, löschen.
Aber jetzt bekam ich Post von Bernie Madoff, den 79jährigen New Yorker „Anlagebetrüger“ und ehemaligen „Vorsitzenden der Technologiebörse NASDAQ“ (Wikipedia), der 2009 wegenVeruntreuung von 65 Milliarden Dollar zu 150 Jahren Haft verurteilt wurde. Theoretisch müßte er also noch im Knast sitzen, dennoch scheint er einen unkontrollierten Zugang zum Internet zu haben, denn er verschickt ebenso verführerische wie geheime Angebote zur Zusammenarbeit, wo viel Geld bei rumkommen würde. Der Grund ist: Er bedauert sein Vergehen und will allen durch seinen Anlagebetrug Geschädigten (u.a. ging die italienische Medici-Bank daran pleite) eine Wiedergutmachung zukommen lassen. Bernie Madoff weiß auch schon wie – in seiner Mail schreibt er: „Ich habe Millionen Euros in Offshore-Finanzhäusern, von denen nur meine Bankmanager wissen, es befindet sich auf einem Nummernkonto. 50% davon soll für Wohlfahrtszwecke ausgegeben werden und 20%, um damit den Bau von Kirchen und Moscheen in der ganzen Welt zu forcieren. 25% sind für Dich (also für mich – H.H.), während 4% für die Bankmanager sind, die Dir (also mir – H.H.) beim Geldtransfer helfen und 1% ist für mich im Knast. Ich weiß, ich werde bald sterben. Meine Frau Ruth hat sich von mir abgewendet, meine beiden Söhne leben nicht mehr: Mark hat 2010 Selbstmord begangen und Andrew starb 2014 an Krebs. Ich möchte mit dem Bewußtsein sterben, auch einmal etwas Gutes getan zu haben. Bitte, ich will dieses Geschäft so schnell wie möglich abschließen. Mit höflichem Respekt Bernie Madoff.“
Dass ein kleiner Betrüger oder eine ganze Bande mit dem guten Namen eines Großbetrügers für ihren Betrug wirbt, hat schon was. „Er reproducirt eine neue Finanzaristokratie, neues Parasitenpack in der Gestalt der Unternehmungsprojectors und Directors (blos nomineller managers); ein ganzes System des Schwindels und Betrugs mit Bezug auf den Aktienhandel, ihre Ausgabe etc.“, schrieb Marx im „Kapital“ über den Übergang von der produktiven Investition zur betrügerischen Spekulation.
Die Theatermacher von „Rimini Protokoll“ haben das „Kapital“ auf die Bühne gebracht. U.A. spielte der letzte Direktor des Instituts für Wirtschaftsgeschichte der DDR und Mitherausgeber der Marx-Engels-Gesamtausgabe, Thomas Kuczinski, mit. Er sagte: Würde er dem Publikum das 751-seitige Drehbuch komplett vorlesen und pro Seite eine Stunde „intensiven Nachdenkens“ veranschlagen, was notwendig sei, um das Buch wirklich zu verstehen, dann dauerte das ein ganzes Arbeitsjahr.
Das Handelsblatt interessierte sich in seiner Rezension des Stücks mehr für die im „Kapital“ von Marx nur kurz erwähnten Finanzbetrüger: „Da tritt Ulf Mailänder auf und erzählt in Ich-Form die Geschichte des Millionenbetrügers Jürgen Harksen, der mit seiner ‚Faktor 13‚-Masche einst Reiche um Hunderte von Millionen prellte, weil ihre Gier – Marx sah das schon 1867 voraus – keine Grenzen kannte. Der echte Harksen kann leider nicht mittun beim Rimini-Theater: Er sitzt wegen Betrug im Gefängnis. Aber Mailänder schrieb seine Biografie – wie auch die des Ex-Baulöwen und Deutsche-Bank-Abzockers Dr. Jürgen Schneider.“ Dieser wurde jedoch aus dem Gefängnis entlassen, und, weil inzwischen „verhandlungsunfähig“, hat auch keine weitere Verurteilung mehr zu befürchten.
Bei den beiden hier erwähnten Finanzbetrügern handelt es sich sozusagen um kleine deutsche Bernie Madoffs, wobei der 83jährige Jürgen Schneider mit dem Kapital seiner Geldgeber immerhin eine ganze Reihe historischer Gebäude saniert hat – in Frankfurt/Main, Berlin und Leipzig, wo man ihn inzwischen ob seines Wagemutes lobt: „An ihm scheiden sich die Geister in Leipzig,“ nennt die Leipziger Volkszeitung das. Sie zitiert Schneider: „Leipzig war mein Waterloo“. Und schreibt: Er entwickelte dort „eine ungewöhnliche Kaufwut: Neben Edelimmobilien wie Barthels Hof und dem Fürstenhof erwarb er unter anderem 60 Prozent der Mädlerpassage, das Romanushaus und den Zentralmessepalast. Seine große Leidenschaft gehörte den Durchgangsverbindungen und Höfen der City. Er besaß am Ende ein Zehntel der Innenstadt. Das Geld dafür besorgte sich Schneider bei mindestens 22 Banken…Als die Immobilienbranche in die Krise geriet, brach sein Kartenhaus aus Lügen in Leipzig zusammen.“ Nun seufzt er: „Hier habe ich nicht nur mein Herz verloren an die vielen schönen alten Häuser, sondern auch sehr viel Geld.“ Aber er hätte „guten Grund zur Hoffnung, dass die Anerkennung der bleibenden Werte,“ die er vor allem in Frankfurt und Leipzig hinterlassen habe, „auf langer Sicht schwerer wiegt als der Makel der Verfehlungen.“ Seltsam, dass auch dieser Finanzbetrüger partout mit einer reinen Seele sterben möchte.
.

Den tanzenden und singenden Blondy-Sisters gelingt es, die Stimmung noch mal zu steigern.
.
Weltretter
Ein ägyptischer Reiseführer erzählte mir, die deutschen Touristen sind besonders: „Schon nach 10 Minuten im Bus wissen sie, wie man den ganzen chaotischen Verkehr in Kairo vernünftig regeln kann“. Das kennen wir gut: „Am deutschen Wesen wird dereinst die Welt genesen!“ spottete einst die „Weltbühne“. Heute sind jedoch die Amis die wahren „Weltretter“. Überall sind sie engagiert: mit ihren „Interventionen“ in Honduras und Panama (1903) über Nicaragua, Mexiko und Haiti (1914) bis Russland und China (1918-25) und ihren militärischen „Missionen“ in Chile, Kuba, Grenada, Indonesien, Griechenland, Ägypten, Vietnam, Laos, Kambodscha, Jordanien, Afghanistan, Libanon, Libyen, Iran, Kolumbien, Kuwait, Jugoslawien, Somalia, Sudan, Irak, Uganda, Liberia, Syrien. Zuletzt flogen sie 500 ihrer wichtigsten ISIS-Kämpfer aus dem umkämpften Mossul aus.
Aber darum geht es hier gar nicht: Die US-Soldaten kämpfen immer für eine bessere und gerechtere Welt! Es geht hier um amerikanische Zivilisten: Jede dritte US-Idee ist eine weltrettende Maßnahme. Ob es „Superman“, der „Terminator“, „Superwoman“, der „Whole Earth Catalogue“ oder die „Chicago-Boys“ sind… Und jede zweite US-Erfindung geschieht zur Weltverbesserung: der Reißverschluß, die Glühbirne, das Radio, der Scheibenwischer, der Trockenrasierer, der Waschsalon, die Geschirrspülmaschine, das Mobiltelefon, der Gummireifen, das Kaugummi, „Sprit aus Licht“, Gentechnik, Internet, Künstliches Fleisch oder ein afroamerikanischer US-Präsident mit einer sympathisch aussehenden Ehefrau – obwohl dabei das Magazin „The European“ (!) von „Obamas geheuchelter Weltrettung“ spricht.
Aber das kennen wir ja auch: In Deutschland ist man gerade bei solch anspruchsvollem, weltbeglückenden Bemühen leicht skeptisch geworden. Wahr ist jedoch, dass eigentlich so gut wie jede amerikanische Lebensäußerung stets auf die ganze Welt bezogen ist: Egal, ob in Las Vegas ein Fräulein zur „Miß World“ gekürt wird, ob einige Kalifornier „die längste Pizza der Welt backen“ oder ein Kalifornier „die meisten Kreditkarten der Welt“ besitzt, eine Texanerin „die älteste Frau der Welt“ ist, eine New Yorkerin sich „die meisttätowierteste Frau der Welt“ nennt, eine Frau in Nevada „die längste Katze der Welt“ besitzt, eine Detroiterin sich als „glücklichste Frau der Welt“ bezeichnet, ein Pornostar aus Los Angeles behauptet, mit so vielen Männern wie sie hätte „noch keine Frau der Welt Sex“ gehabt oder ein Mann aus Miami verkündet, seine Frau sei „die schönste der Welt“. Deswegen ist es auch nur konsequent, wenn die Redaktion des „Guinnessbuchs der Rekorde“ meldet, dass sie nun eine „full time presence“ in Los Angeles und Miami etabliert, denn von dort kommt das Weltheil und von sonst nirgendwo. Als nächstes werden uns die Amis das in vielen US-Staaten legalisierte Haschisch zur Weltrettung verkaufen – wetten!
Aber bis es so weit ist, müssen es die amerikanischen Pilze tun: „they can save the world,“ verkündete jüngst der Pilzforscher Paul Stamets, Inhaber von elf Fungi-Patenten, auf der weltberühmten alljährlichen „TED Konferenz“, was eine internationale Innovations-Konferenz in Kalifornien ist, um die Welt immer wieder aufs Neue zu retten. Er begann seine „Keynote“ mit dem Satz: „Wir alle wissen, dass die Erde Probleme hat, wir sind jetzt in der 6. bedeutenden Phase der Vernichtung auf diesem Planeten eingetreten.“ Noch jeder Ami hat eine Analogie zwischen Computer und Gehirn hergestellt, Paul Stamets, der am „Bioshield-Programm des US-Verteidigungsministeriums“ beteiligt war, steht dem nicht nach: „Ich habe als erster die These aufgestellt, dass das Myzel [Pilzgeflecht] ein natürliches Internet der Erde ist.“
Der US-Berater von Biotech-Unternehmen, William Bains, deutete bereits an, worum es bei diesem ganzen imperialistischen Größenwahn, der allein auf Weltignoranz basiert, in Wahrheit geht – in der US-Zeitschrift „Nature Biotechnology“ schrieb er: „Die meisten Anstrengungen in der Forschung und in der biotechnologischen industriellen Entwicklung basieren auf der Idee, dass Gene die Grundlage des Lebens sind, dass die Doppelhelix die Ikone unseres Wissens ist und ein Gewinn für unser Zeitalter. Ein Gen, ein Enzym, ist zum Slogan der Industrie geworden…Kann das alles so falsch sein? Ich glaube schon, aber ich bin sicher, das macht nichts. Denn die Hauptsache ist, dass es funktioniert: Manchmal funktioniert es, aber aus den falschen Gründen, manchmal wird es mehr Schaden anrichten als Gutes tun…Aber die beobachtbare Wirkung ist unbestreitbar…Wir müssen nicht das Wesen der Erkenntnis verstehen, um die Werkzeuge zu erkennen…Inzwischen führen die Genom-Datenbanken, die geklonten Proteine und anderes Zubehör der funktionalen Genetik zu Werkzeugen, Produkten, Einsichten, Karrieren und Optionen an der Börse für uns alle.“ Ja, vor allem für alle Arbeitslosen, Obdachlosen, Siechen und Verwirrten.
.

Am nächsten Tag liest Wladimir Kaminer bei rauer See einige Kapitel aus seinem im Herbst erscheinenden Kreuzfahrt-Buch vor. Auch das kommt gut an.
.
Rinderpfleger zur See
Nach dem sogenannten »Zusammenbruch des Sozialismus« wurde die Ausfuhr von Schlachtrindern zu einem Milliardengeschäft. Ich interviewte dazu einen Hamburger Bekannten, der als Rinderpfleger auf Schiffen arbeitete:
»Das Geschäft funktionierte so, dass arabische Einkäufer herumfuhren – zu den Bauern von Süddeutschland bis Schleswig-Holstein und sich die Tiere bei denen aussuchten. Zehn im Allgäu und 30 in Nordfriesland zum Beispiel. Anschließend kam die Spedition Schenker, die zur Bundesbahn gehört. Sie sammelte die Rinder – zunächst mit Lkws – auf den Höfen ein und brachte sie zum Hamburger Hafen. Mitunter transportierte ein Bauer seine Rinder auch selbst zur Verladestation. Die Lkws wurden dort brutto wie netto gewogen. Damit die Differenz, das Gewicht der Rinder, größer wurde, steckten die Verkäufer ihnen vorab auch schon mal einen Schlauch in den Darm und pumpten die Tiere mit Wasser auf – wodurch sie schwerer wurden. Die Anlieferung der Tiere in Hamburg geschah meist unter Zeitdruck. Ein Fahrer hat mal seine Schlachtrinder für Ägypten zu schnell aus dem Lkw getrieben. Dabei ist ein Tier zwischen Lkw-Klappe und Waggontür geraten und hat sich das Bein gebrochen, wir haben es erstmal auf eine kleine Wiese am Hafen gebracht, da wo jetzt die ›Hafen-City‹ entsteht – früher wurden von dort aus die Juden deportiert. Rinder sind robust und stoisch, das Tier hat sich auf der Weide hingelegt und sofort weitergefressen. Es wurde dann jedoch geschlachtet.
Einmal ist uns beim Rauftreiben auf die Gangway ein Tier ins Wasser gesprungen. Sofort kam die Wasserschutzpolizei, hat den Verkehr auf der Elbe gestoppt und das Tier an Land getrieben. Dort hat es sich dann einfangen lassen. Aber bis es wieder bei uns an der Verladestation ankam, war das Schiff schon weg – und das Rind musste auf das nächste Transportschiff warten. Wir haben uns um Jutta, so nannten wir sie, in der Zwischenzeit gekümmert. Zuletzt war sie ganz zahm. Ein andern Mal ist uns ein holsteinisches Rind ins Wasser gefallen. Ein Feuerwehrmann hat die ganze Nacht vergeblich versucht, ihm ein Halfter umzulegen. Als es hell wurde, hat ein Scharfschütze der Polizei es erschossen…
Die Transporte, die insgesamt 12–14 Tage dauerten, gingen zunächst mit dem Zug nach Marseille. Die mit Zuchtvieh bestanden aus rund 300 Rindern – Färsen und tragende Kühe, sieben oder neun Tiere pferchten wir jeweils in eine Box. Bei Schlachtvieh waren es mehr, auch die Schiffe waren dann größer. Von Marseille dauerte die Fahrt übers Mittelmeer fünf bis sieben Tage. Wenn es um Zuchtvieh ging, bin ich mit aufs Schiff, statt Viehtreiber war ich da dann Ladungsoffizier, Supercargo genannt. Und in Afrika ein Veterinär, weil ich den Viechern Spritzen gab und Geburtshilfe leistete. Die unterwegs geborenen Kälber haben wir benamt. Am Bestimmungshafen – in Marokko oder Ägypten z. B. – kamen die Tiere erst mal einige Wochen zur Quarantäne in eine große Halle, damit sie sich ein bisschen entgifteten. Einmal hat einer seine Kuh mit einem Pkw abgeholt und sie in einem Campinganhänger transportiert. Die meisten nahmen jedoch z. B. gleich 150 Tiere auf einmal mit.
Einen Aufkäufer gab es dort für Tiere, die nicht ganz in Ordnung waren. Mit dem haben wir gehandelt: der hat Prozente gekriegt – ich wollte die Tiere ja nicht wieder mit zurücknehmen. Auch die übriggebliebenen Medikamente und das Stroh nicht: Die hat die Mannschaft gekriegt – zum Weiterverkaufen, weswegen sie auf der Fahrt auch blöderweise allzu sparsam damit umging …
Ab und zu hatten wir einen Transport mit schottischen Hochlandrindern nach Dubai und Saudi-Arabien. Dort hatten irgendwelche reichen Araber sich eine riesige gekühlte Halle in die Wüste stellen lassen. Die wollten da diese zotteligen Rinder züchten. Ihnen wurde ein großer Kühlschrank mitgeliefert – für den Bullensamen.
Für mich waren diese Rindertransporte wie ein bezahlter Urlaub, ich habe gerne mit Tieren zu tun und hätte das noch lange weitermachen können. Irgendwann war jedoch plötzlich Schluss. Da wurde festgestellt, dass das Gewicht von vier Waggons brutto fehlte. Es kam daraufhin in Hamburg zu einer Prüfung, dabei kam raus: Der Verlader dort und sein Wagemeister hatten die Waage manipuliert. Da das mit den Rindern subventionierte Exporte waren, handelte es sich um Staatsbetrug. Die beiden wurden verknackt und mussten ins Gefängnis. Und Schenker machte seine Verladestation in Hamburg dicht. Dadurch verlor ich meinen Job.«
.

Das Angebot an alkoholhaltigen Erfrischungsgetränken an Bord ist zufriedenstellend.
.
Neue Geldbeschaffungsmaßnahmen
Facebook, Google,Amazon und andere Ami-Schweinekonzerne vermitteln „zwischen Werbenden, Softwareentwicklern, Firmen, die das Netzwerk als Kommunikationsplattform nutzen und individuellen Nutzern. Interaktionsdaten werden wie ein Rohstoff extrahiert und verwertet,“ meint der Engländer Nick Srnicek, Autor das Buches „Platform Capitalism“, in dem er zu dem Schluß kommt: Wir müssen was dagegen tun. Denn, „in diesem Ausmaß hat es so etwas in der Geschichte des Kapitalismus noch nicht gegeben. John Deere und Monsanto versuchen gerade, eine Plattform für die Landwirtschaft aufzubauen, Siemens und General Electric tun es für die verarbeitende Industrie“. Neben diesen Schweinekonzernen gibt es aber weltweit noch hunderttausend Schweine-Start-Ups, die eine wahre Pest sind, weil sie unsere niedersten Instinkte wecken wollen – auf niedrigstem elektronischen Niveau.
Z.B. die „Firma“ von Felix Krause: „Heute möchte ich Ihnen eine neue interessante Investitionsmöglichkeit vorstellen, die Ihre Welt auf den Kopf stellen wird. Das richtige Geschäft zu finden, das eine Veränderung Ihrer finanziellen Situation mit sich bringt, wird immer schwieriger. Ich glaube jedoch, hier genau das Richtige für Sie zu haben. Eine simple und effektive Möglichkeit, um ihr monatliches Einkommen zu verfielfachen.“ Man muß nur bestimmte Worte in diesen Sätzen anklicken, also „links“, dann würde man schnell reich! Die EDV-Abteilung riet mir aufs Eindringlichste vom Klicken ab!
Ähnlich verhält es sich mit der folgenden Betrugsofferte – von einem Herrn Liu – ich vermute aus Memmingen: „LETZTE ERINNERUNG: Ich kann den für Sie reservierten Platz im inneren Kreis nur noch drei Stunden lang halten…Ich befürchte, dass sich danach die Türen schließen. Meine Innenkreis Strategie erzeugt alle 12 Monate mindestens 5 Bitcoins (42.325 EUR). Daher kann ich Ihnen voller Zuversicht mitteilen, dass ich weiß, dass sie beim Aufbau Ihrer finanziellen Zukunft nützlich sein wird. AUSSERDEM sind Sie vollkommen durch meine 100% Geld-zurück-Garantie abgesichert und haben nichts zu verlieren, heute einen Test zu starten. Hier klicken, und sichern Sie sich Ihren reservierten Platz heute noch vor Mitternacht!“
Auch der gute alte Carlos Sanchez meldet sich immer mal wieder, ich nehme an aus Rumänien. 2016 berichtete ich bereits über ihn, zuletzt, Anfang Februar, die schon sehr viel drängender war als die davor. Ich nehme an, er verliert langsam die Geduld mit mir – es geht um mehrere Millionen, die mir und nicht ihm angeblich zustehen: „Wir möchten Sie informieren, dass das Büro des nicht Beanspruchten Preisgeldes in Spanien, unsere Anwaltskanzlei ernannt hat, als gesetzliche Berater zu handeln in der Verarbeitung und der Zahlung eines Preisgeldes, das auf Ihrem Namen gutgeschrieben wurde, und nun seit über zwei Jahren nicht beansprucht wurde. Anbei finden Sie die wichtige Nachricht. Die angehängte Datei ist sicher und scannt die PDF-Datei. Bitte laden Sie es herunter. Vielen Dank. Carlos Sanchez.“
Auch hierbei riet mir die EDV-Abteilung jedoch wie bei jeder Mail von Carlos Sanchez: Finger weg! Obwohl er sich diesmal nicht als Präsident der spanischen Nationallotterie sondern als Justitiar des „European Social Fund“ vorstellte.
Was sagt der Plattformforscher Nick Srnicek vom Londoner King’s College in seinem Zeit-Interview dazu? Gar nichts! Ihn interessieren nur die großen im Silicon Valley und drumherum – nicht die in Memmingen, Rumänien oder meinetwegen Spanien. Den „Big 5“ wirft er Monopolbildung vor, weswegen die berühmte amerikanische „Konkurrenz“ nur noch „auf der Ebene von Algorithmen stattfindet“. Im „Guardian“ forderte er deswegen kürzlich bereits, alarmistisch gestimmt, deren „Verstaatlichung“. Die kleinen Fische, Felix Krause, Herr Liu und Carlos Sanchez, dürfen jedoch weitermachen (-mailen), wenn ich ihn richtig verstanden habe.
.

Bereits beim ersten Landgang merkte man: Als Tourist ist man überall willkommen.
.
Würgeengel Festanstellung
Der Begriff „Würgeengel“ ist zwar auch der Name einer „Cocktail Bar“ in Kreuzberg, aber er bezieht sich auf den Titel eines Films von Luis Bunuel 1962. Darin geht es um eine Abendgesellschaft, die irgendwie nicht mehr aus dem Haus raus kann, wodurch langsam ihre Sitten zerfallen.
In einigen Firmen habe ich beobachtet, dass mit den Jahren immer mehr Festangestellte etwas am Arbeitsplatz vergaßen und deswegen nach Feierabend noch einmal kurz zurückkehrten, manche sogar zwei, drei Mal. Der Betrieb entwickelt hierbei schleichend etwas Würgeengelhaftes. Dazu gehört auch, dass in den Kantinen meist die selben Leute zusammen sitzen und essen, die auch oben in den Büros zusammen arbeiten.
Nicht zuletzt würgt solch ein Betrieb auch deswegen, weil der regelmäßige Lohn sowohl räumliche als auch zeitliche Wünsche hervorbringt: eine feste Beziehung, Kinder, größere Wohnung, Datscha, Auto, Urlaub, Fortbildung, Kitaplatz, Bastelkeller, Tennisverein, Musikunterricht, Reisen, einen neuen Rechner usw…
Dann entwickelt auch das Miteinander am Arbeitsplatz, die tägliche Feinjustierung zwischen Nähe und Distanz, einen Würgecharakter, insofern sie ausbalanciert den Wunsch nach Dauer weckt, verbunden mit einer wachsenden Abhängigkeit vom Gehalt, wenn nicht gar von einem stetig steigenden. Zwar ist man nur wegen des Geldes zusammengekommen, auf dem Arbeitsmarkt quasi zusammengewürfelt worden, aber dabei entsteht mit der Zeit am Arbeitsplatz wesentlich das Soziale. Etwas der „Luft zum Atmen“ durchaus Vergleichbares. Wenn da nicht der Ansatzpunkt zum Würgen liegt…
Der Würgeengel der Geschichte ist also net so swat as hum oft malt, wie die deichbauenden Friesen sagen würden: Er ist besser als sein verstörender Ruf – spätestens seit Bunuels Film aus dem Jahr 1962. Kommunistisch gestimmt könnte man sogar von einem „Die Menschen zu ihrem Glück zwingen“ sprechen. Bunuel neigte zu einer mythisch-pessimistischen Formel, wenn ich das Filmende richtige erinnere. Wikipedia hilft mir da komischerweise nicht weiter.
Nebenbeibemerkt sieht man, in welche Arbeitsräume man auch immer reinkuckt, nur noch Leute an Bildschirmen sitzen, auf dem Hin- und Rückweg zur Arbeit sitzen sie zudem auch noch fast alle vor ihrem Smartphone-Bildschirm. Der eine oder andere kuckt vielleicht sogar Bunuels „Würgeengel“ auf Youtube.
Als Journalist fällt mir – in den U-Bahnen z.B. – auf, dass so gut wie niemand mehr Zeitung liest. In Westberlin lasen früher die meisten Leute BILD oder BZ, nach 89 vermischte sich alles, mit vielen neuen Zeitungen, die alle wieder eingingen. Spätestens mit dem Internet, verschwanden dann auch die restlichen nach und nach, ihre Auflagen gingen enorm zurück, viele Arbeitsplätze waren und sind gefährdet. Gleichzeitig vermehren sich die Jobs der Paketausträger wegen des boomenden „Online-Shoppens“.
In den Betrieben, die ich kennen lernte, waren die vornehmlich mit Zahlen arbeitenden Festangestellten mit am Längsten dort beschäftigt, gleichzeitig war bei ihnen der Krankenstand mit am Höchsten. „Ich würde auch krank werden, wenn ich nur mit nackten Zahlen arbeiten müßte,“ meinte einmal ein „Controller“ zu mir, der es wissen mußte. Mein Lieblingsbuchtitel sagt es so: „Weapons of Math Destruction“ (von Cathy O’Neil)
Jede Gemeinschaft fördert dieses und ächtet jenes. Dies kommt einem langsamen Würgen gleich. In einer anderen Gemeinschaft wäre etwas ganz anderes abgewürgt oder abgefordert worden. Ich erwähne nur jene Abteilungen, in denen eine kollektive Fußballbegeisterung herrscht, der jeder Neue sich beugen muß – bis hin zu Tischfahnen, Wetten und „Kicker“-Diskussionen.
Es gibt inzwischen nicht wenige Abteilungen, die sich für etwas Besseres halten und „Elf Freunde“ abonniert haben. Dieser Begriff „Elf Freunde“ trifft übrigens weit mehr auf die Fußball- oder Nichtfußball-Begeisterten Abteilungen in den Betrieben der Festangestellten zu als auf die Fußball-Mannschaften, vor allen die in den Massenmedien verhandelten „Teams“, in denen die Mitspieler von überallher zusammengekauft werden. Nur in den oberen Ligen wird „richtig Geld“ verdient. Das würgt enorm. Vor drei Jahren würgte ein Spieler des 1. FC Bayern (Pep Guardiola) seinen Mitspieler (Thomas Müller) buchstäblich, und „der bestbezahlte Sportler der Welt“ (Ronaldo) würgte einen Reporter.
Da neuerdings vermehrt Frauen in den Abteilungen eingestellt werden, bis hin zu den Forschungsabteilungen und dem Literaturbetrieb, verstärkt sich – wenn in der Mehrzahl – hier und da das Soziale, das gelegentlich sogar die bezahlte Tätigkeit selbst durchdringt; und auch so etwas wie die „Brigademuttis“ wieder auferstehen läßt. „Die Zeit“ heilt alle Wunden. Der Westberliner Kabarettist Wolfgang Neuss ergänzte: „Und ‚Der Spiegel‚ leckt sie dir“.
.

Und man lernt unaufdringlich fremde Sitten und Gebräuche kennen – z.B. dass man anderswo sein Lieblingsschaf sogar auf Versammlungen mitnimmt.
.
Glas Wasser
Nicht nur, dass die jungen Frauen heute ständig Wasser trinken, sie praktizieren auch die Sexualtät so, meinte ein älterer Journalist aus Brno (Brünn) und spielte damit zum Einen auf die Forderung der berühmten Bolschewikin Alexandra Kollontais nach freien Beziehungen auch in sexueller Hinsicht an, der Lenin widersprochen hatte, indem er meinte, die Sexualität könne und dürfe nicht so umstandsdlos praktiziert werden wie man „ein Glas Wasser“ trinke.
Zum Anderen war damit das Geschehen in einem heutigen Prager Club gemeint, in dem ein US-Produzent namens Dr. Bob Marshal aus dem San Fernando Pornvalley seit 1998 regelmäßig Partys veranstaltet. Dazu werden jedesmal rund 80 Prager Vorstadtschönheiten eingeladen, wo sie von fünf ganz schlechten aber gut gebauten Strippern erwartet werden, die sie mit Alkohol versorgen und ihnen dreist unter die Wäsche gehen. Dabei gilt es vor allem, gutgelaunt zu bleiben. Die Partys, bisher nahezu 200, werden von mehreren Kameraleuten gefilmt, geschnitten und weltweit unter dem Titel „Party Hardcore“ vertrieben. Die Filme gehören zu den erfolgreichsten Pornos überhaupt. Damit sich die Handlung jedesmal einigermaßen ründet, werden neben den Clubmädchen einige wie „Amateure“ aussehende Prostituierte angeheuert, die den fünf Strippern den „Einstieg ins Geschäft“ erleichtern: ihnen den Schwanz lutschen, sich von vorne und hinten vögeln und in den Mund abspritzen lassen. Währenddessen wird ringsum fröhlich getanzt und gewunken.
Dadurch wird nach einigen Stunden eine sexuell aufgeladene Swingerclub-Atmo (allerdings mit viel mehr Frauen als Männer) hergestellt, sodass, wenn alles gut läuft, schließlich mehr Mädchen mit den fünf Strippern ficken wollen, als die das schaffen können, so dass ihre Akte immer kürzer werden. Sie sind dabei nackt, die Mädchen bleiben halb angezogen, weswegen die Pornos auch „CFNM“ heißen: „Clothed Female Nude Male“. Besonders gut mitspielende Pragerinnen werden in San Fernando Valley unter Vertrag als Pornodarstellerinnen genommen und bekommen einen Internetblog, in dem sie vom lustigen US-Pornoprofileben schwärmen. Die Stripper treten anfänglich auf dem „Cat-Walk“ in US-Uniformen auf, wie man sie von der Band „YMCA“ kennt, vor ihrer kompletten Nacktheit verdecken sie ihren Schwanz gerne noch mit der amerikanischen Flagge. Die Mädchen versuchen, sie ihnen zu entreißen. Mitunter durchkreuzt ein Dutzend Mädchen auch die San Fernando Pornodramaturgie, indem sich auf dem „Cat Walk“ sogleich alle ausziehen und an die Stripper drängen, die darob nicht mehr weiter wissen – aber am Ende lassen sie sich doch alle von ihnen vögeln und zuletzt mit Samen bespritzen. Mindestens in den fertigen Filmen, die wegen ihrer männerdummen Handlung immer die selbe Dramaturgie haben – mit dem selben Ende haben, so dass eigentlich ein Hardcore-Partyabend wie der andere abläuft. Gelegentlich kritisiert die Prager Presse das Geschehen, vor allem, wenn sie im Film die Tochter eines bekannten Prager Politikers wiederentdeckt hat.
Darüberhinaus fiel einigen Journalisten darin auf, dass die Stripper darin wie bezahlte Professionelle (wie Prostituierte) agieren und die Mädchen als mehr oder weniger neugierige bis übergriffige Freier, wobei sie Zärtlichkeit und Küsse vor allem bei anderen Partymädchen fänden. Insofern spräche das für eine freiere Sexualität unter den Bedingungen eines feministisch werdenden Kapitalismus, die sich massenmedial zu erkennen gibt – und das ausgerechnet in einem kalifornischen Pornonetzwerk.
Aus der anderen Seite vermasseln die Stripper mit ihrer professionellen Lieblosigkeit und ihrem Muckibuden-Machismus oft vieles. Für die Mädchen ist es auch eine Mutprobe oder sie spielen Sextheater, wenn sie einzeln vorgenommen werden. Oft lassen sie sich auch vom Stripper von hinten vögeln und gleichzeitig vorne von ihrer Nachbarin lachend umarmen und küssen. Manche lassen sich auch von hinten vögeln und lutschen gleichzeitig einem anderen Stripper den Schwanz. Alle drücken derweil ihre großen Handtaschen an sich. Manche stecken sich dabei auch eine Zigarette an. Sie bleiben „cool“.
.

Durchweg willig und freundlich stellen sich die Einheimischen für ein Erinnerungsphoto zur Verfügung…


.
Friesenforschung
Der Kulturhistoriker Hans Peter Duerr war 1994 per Schiff mit einer Gruppe Bremer Studenten ins nordfriesische Wattenmeer nahe der Hallig Südfall aufgebrochen, um dort nach Spuren der in Sturmfluten untergegangenen Stadt Rungholt zu suchen. Nach 19 „Expeditionen“ war sich Duerr anhand der Funde sicher, Spuren von minoischen Seefahrern gefunden zu haben, die einst auf Kreta lebten; die Minoer hätten vor mehr als 3000 Jahren den weiten Weg in die Nordsee bewältigt – viel früher als bislang angenommen. Demnach waren die minoischen Abenteurer wegen des englischen Zinns, das sie für die Herstellung von Bronze brauchten, nach Nordeuropa gesegelt – und hatten von England aus dann den Abstecher in die nordfriesischen Gewässer unternommen, um auch Bernstein an Bord zu nehmen. „Unsere Funde im Wattenmeer sind eindeutig“, sagte Duerr und nannte Keramikscherben, exotische Muscheln und das persönliche Siegel eines minoischen Seemanns als Beispiele.
Der Heidelberger Forscher hat viele Bücher über die Mittelmeer-Kulturen geschrieben, für ihn konnte es nur so sein, dass alte mittelmeerische Hochkulturen mit ihrer Segelkunst die Nordsee quasi „entdeckt“ und einen gewissen Tauschhandel mit den Friesen betrieben hatten. Duerr schrieb zwei Bücher darüber: „Rungholt: Die Sucher nach der verlorenen Stadt“ (2005) und die „Fahrt der Argonauten“ (2011). Im Nachwort des letzteren rechnet er mit seinen Gegnern ab, die umgekehrt davon ausgehen, dass friesische Seefahrer im Mittelmeergebiet Handel trieben. Über sie schrieb er, „dass der gesunde Menschenverstand durch Pseudoobjektivität, die bisweilen an Realsatire grenzt, verdrängt worden ist.“ Namentlich schimpfte er über einige Mitarbeiter des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein, die nicht nur Duerrs Forschungen, sondern auch seine Vorgehensweise kritisierten und ihm vorwarfen, er suche widerrechtlich nach den Überresten der Siedlung und anderen zivilisatorischen Überbleibseln, seine Funde seien nicht glaubwürdig dokumentiert und seine Schlussfolgerungen nicht haltbar. An der Küste sieht man in Duerr, vielleicht nicht zu Unrecht, einen verbohrten Friesenhasser.
Zu einer ganz anderen Einschätzung der friesischen Zivilisationsleistungen gelangte der Oxford-Historiker Michael Pye in seiner „Geschichte der Nordsee“ (2017): Ja, die Friesen wurden zwar immer – von den römischen Geschichtsschreibern bis zum Bischof von Utrecht im 9.Jahrhundert – „recht lieblos“ behandelt, aber völlig zu Unrecht: Zum Einen organisierten sie alles, vom Deichbau über die Fischerei bis zu ihren Handelsexpeditionen, genossenschaftlich klug und zum Anderen „erfanden sie das Geld neu“ – in Dorestadt prägten sie Silbergeld. „Die Friesen nahmen die Idee des Geldes auf all ihren Fahrten mit. Mit ihr kam auch die Vorstellung, dass Dinge einen Wert besitzen, samt der Möglichkeit, diesen abstrakten Wert auf dem Papier zu berechnen. Es hieß, die Welt mathematisch zu betrachten.“
Der Friesenforscher Rudolf Muus hatte bereits in den Siebzigerjahren geurteilt: „Am ausgesprochensten ist der Sinn der Friesen fürs Rechnen“. Sie waren berüchtigt für ihre Geschäftstüchtigkeit. In London war das Wort „Friese“ im 7.Jhd. gleichbedeutend mit „Kaufmann“.
2003 hatte der Politikwissenschaftler Wolfgang Dreßen in seiner großen Aachener Ausstellung „Aachen Jerusalem Bagdad“ gezeigt, dass Karl, der damals noch nicht der große hieß, um 800 einen gewissen Handel mit dem Kalifen der damaligen Kulturhauptstadt Bagdad, Harun al-Raschid, trieb. Um die Geschäftsbeziehung zu ihm zu festigen, schenkte Karl dem Kalifen eine Wasseruhr, die der jüdische Kaufmann Isaak aus Aachen, begleitet von zwei Rittern, überbrachte. Auf dem Rückweg, den seine Begleiter nicht überlebten, brachte er als Gegengeschenk, einen weißen Elefanten, von Harun al-Raschid mit nach Aachen. Zu den wenigen Handelsgütern der Franken zählten slawische Sklaven, Jagdhunde und Eisenwerkzeuge (die u.a. gegen „Münzen aus Aleppo“, die sich laut Pye „überall im Umfeld der Nordsee finden“, getauscht wurden). Diesen Handel erledigten vornehmlich die freien Friesen und Wikinger mit ihren Schiffen. Um 1230 wird den ersteren quasi offiziell bescheinigt: „omni jugo servitutis exuti“ – Sie haben das Joch der Knechtschaft verlassen.
.

Hier wird die Gastfreundschaft noch groß geschrieben…
.
Rasenpflege
Für Jean Paul Sartre war der Rasen eine echte, nach außen reichende Erweiterung des Teppichs. Die Baumärkte bieten so etwas inzwischen an. Sie nennen es „Outdoorteppich“, „Kunstrasen“, „Fertigrasen“, „Auslegerasen“ und „Rollrasen“. Die „Deutsche Rasengesellschaft“ (DRG) empfiehlt die Verwendung von „Regel-Saatgut-Mischungen (RSM), weil sie Gewähr für gute Rasenqualität bietet. Die „gartenamademie.rip.de“ offeriert eine Liste „unerwünschter Gräser im Rasen“. An der Universität Göttingen wird „Graslandwissenschaft“ betrieben und u.a. „Grünlandmanagement“ gelehrt.
Auf Golfplätzen muß der Teil des Rasens (eine besondere Grassorte aus England), der um die Löcher herum angelegt wurde, frühmorgens abgefegt werden, weil die Sonne ihn sonst durch die Tautropfen an ihm verbrennt. Beim Golfrasen spricht man von „Green“ und der Oberpfleger nennt sich „Head-Greenkeeper“, er sorgt dafür, dass alle Rasenflächen täglich auf drei Millimeter gekürzt werden, „ab 2,8 Millimeter ist aber Schluss, dann ist der Rasen kaputt,“ meint der Head-Greenkeeper auf dem Golfplatz Bochum-Stiepel Jürgen Haarmann, der den Rasen außerdem „vertikutieren, und aerifizieren lassen muß und ihm anschließend ein „Topdressing“ verpaßt.
In den Westberliner Bezirken der Reichen mit großen Gärten werden die (Rasen-) Flächen immer kleiner, indem sie, um (Garten)Arbeit oder die Anstellung eines Gärtners zu vermeiden, ihre Grundstücke halbieren, dritteln, sogar vierteln und darauf Häuser bauen, die sie wohnungsweise vermieten oder verkaufen.
Der US-Soziologe Thorstein Veblen meinte: Der Rasenmäher schaffte den „unfeinen“ Einsatz von Arbeitstieren ab – sie hatten zuvor den Mähbalken über den Rasen gezogen. Marx erwähnt in “Das Kapital“ den griechischen Dichter Antipatros, der die Erfindung der Wassermühle zum Mahlen von Getreide als Befreierin der Sklavinnen begrüßte. „Die Heiden, ja die Heiden!“ fügte Marx hinzu. Sie hätten nichts von politischer Ökonomie und Christentum begriffen. Sie begriffen u.a. nicht, dass die Maschine das probateste Mittel zur Verlängerung des Arbeitstages ist.
In Ostfriesland, wo man besonders große Rasenflächen um die Höfe hat, schaffen die Besitzer sich gerne „Rasentraktoren“ an: „Damit macht meinen Kindern das Rasenmähen endlich wieder Spaß,“ meinte ein Bauer zu mir. Auf der Internationalen Gartenbauausstellung in Marzahn-Hellersdorf halten Mähroboter die riesigen Rasenflächen kurz, indem sie den ganzen ‚Tag hin und her fahren.
In den USA gibt es hunderte von Bürgerinitiativen, die den Einsatz der lauten Laubbläser verbieten wollen. Dagegen haben sich jedoch mindestens ebenso viele Initiativen von Philipinos gegründet, die im Falle eines Laubbläser-Verbots ihren Job verlieren würden.
In den Bezirken der Armen vermehren sich die kleinen Rasenflächen: Hier werden die Baumscheiben am Straßenrand, die Hinterhöfe und Brachflächen „begrünt“ – gelegentlich illegal. In den Kleingarten-Kolonien, die laut Satzung auf 80% ihrer Parzellen Nutzpflanzen anbauen müssen, wird diese Verordnung mehr und mehr ignoriert, indem die Rasenfläche vergrößert und mit Sitzgelegenheiten, Swimmingpool oder Trampolin ausgestattet wird.
Auf den Dachgärten der Firmen muß der Rasen seit dem Rauchverbot nicht mehr gemäht werden, weil sich auf ihm so oft es geht die Raucher treffen, die das Gras kurz halten.
„Deutschland ist ein Land, in dem es keine Revolution geben kann, weil man dazu den Rasen betreten müsste,“ meinte Josef Stalin. Mindestens bis in die Achtzigerjahre standen an den öffentlichen Rasenflächen in Westdeutschland überall Schilder mit der Aufschrift „Rasen betreten verboten“. In Westberlin übertraten die Türken als erstes dieses Verbot: „Wir Deutsche haben es ihnen dann einfach nachgemacht,“ erinnert sich eine Kreuzberger Sozialarbeiterin.
Der US-Literaturwissenschaftler Timothy Morton schreibt in seinem Buch „Ökologie ohne Natur – Eine neue Sicht auf die Umwelt“ (2016): „Rasenflächen sind Räume eliminierter Gewalt, ausradierter Seiten, die leer und geräumig wirken sollen. Sie stellen nichts anderes dar als eine horizontale, zum Massenartikel umgeformte Version jener Wildnis, die die Menschen aufsuchen, um Frieden und Ruhe zu finden und ein abstraktes Naturgefühl zu erleben. Rasenflächen sind so etwas wie eine ‚Fertigdistanz‘.“
Vor einigen Jahren hatte ein Freund von mir einen LSD-Trip genommen und war im Tiergarten über die weitläufigen Rasenflächen gegangen; plötzlich bemerkte er, dass er bei jedem Schritt Dutzende Pflanzen und Tiere zertrat. Er blieb stehen und rührte sich nicht – so lange, bis der Trip nachließ und er wieder in sein normales, fast gedankenloses Bewußtsein zurückfand.
.

Selbst die Stammgäste begrüßen einen fröhlich.
.
Glas Wasser (2)
Der Übergang vom Industriekapitalismus zum „pharmakopornographischen Kapitalismus“ dauert an. Es geht weiter. Zunächst übernahm der Berliner „KitKat“-Club die Idee, aus seinen „Hardcore-Partys“ eine Pornofilmreihe zu machen, er gab jedoch bald auf, sie war zu scheußlich. In Prag selbst boten immer mehr Clubs Pornoparty-Fakes an, d.h. sie luden Prostituierte ein, die sich den Touristen widmeten. Aber dann kam einem Betreiber beim Ansehen von „Big Brother“ im Fernsehen die Club-Idee „Big Sister“: Hier durfte jeder mit jedem sexuell verkehren, er mußte vorab nur schriftlich erklären, dass er mit der filmischen Verwertung seines Tuns einverstanden sei. „Big Sister“ wurde jedoch nach einiger Zeit aus den selben Gründen geschlossen wie die Pornoserie des „KitKat“-Clubs: zu viele Asoziale und Drogen-Gestörte.
Der Begriff „pharmakopornographischer Kapitalismus“ stammt von der Queer-Theoretikerin Beatriz Preciado in ihrem Buch „Pornotopia“. Für sie begann dieser mit dem amerikanischen Magazin „Playboy“ und seinem Herausgeber Hugh Hefner, der daraus in den Fünfzigerjahren einen ganzen Befreiungs-Feldzug für Männer aus der oberen Mittelschicht kreierte. Dazu erfand er die „Playboy-Villa als multimediales Bordell“, das eine „Mutation des traditionellen Bordells“ war. Für die unteren Schichten trafen derweil laut Preciado „in ein und derselben Zeitschrift Praktiken der Text- und Bildlektüre und der Masturbation zusammen.“
Während in der Konzernzentrale des Playboy die eingeladenen Mädchen das für die „VIP“s tun mußten, wie der „Deep Throat“-Pornostar Linda Lovelace in seiner Biographie klagte. Aber diese amphetaminbefeuerten und rund um die Uhr gefilmten Arrangements erforderten mit den Jahren immer mehr Aufwand. So berichtete zuletzt z.B. das Sexmodel Jill Ann Spaulding in einem Interview, wie Playboy-Herausgeber Hugh Hefner seine „Sex-Nächte“ zwei Mal wöchentlich aufs Sorgfältigste inszenierte – inszenieren mußte, um überhaupt noch so etwas wie Lust zu empfinden. Er brauchte dazu erst einmal zwölf Mädchen, „Bunnys“, die zuvor aus hunderten von Bewerbungen nach optischen Gesichtspunkten ausgewählt wurden, u.a. von seiner Tochter. Die jungen Frauen mußten vorher baden und sich rosarote Pyjamas anziehen, die sie dann in seinem Schlafzimmer auszogen, „während sie so taten, als hätten sie miteinander Lesbensex“. Parallel dazu liefen auf zwei Großleinwänden Schwulenpornos. Hefner lag währenddessen mit einer „Viagra-Erektion“ auf seinem runden Bett. Seine „Hauptfreundin machte ihm dann Oralsex und bestieg ihn auch als erste“. Danach war ein Mädchen nach dem anderen für jeweils zwei Minuten dran, während die anderen elf Hefner „wie eine Gruppe Cheerleader“ anspornten – mit Rufen wie „Nimm sie, Papi, nimm sie!“ Abschließend hatte er noch kurz „Analsex mit seiner Hauptfreundin“, die ihm dann auch, wenn er endlich einen Orgasmus bekam, „den Schwanz abwischte“. Dann wurde das Licht ausgemacht. Dergestalt wurden Preciado zufolge die „beschränkten alten Formen des Sexkonsums“ (im Bordellmilieu) „in audiovisuellen Konsum“ verwandelt.
Und so endete mit Hefner die erste Etappe bei der Durchsetzung des „pharmakopornographischen Kapitalismus“. Der „Playboy war einmal „eine der weltweit größten Wirtschaftsmächte“. Es gab „Playboy-Clubs“ auf der ganzen „freien Welt“. Seine Mitarbeiter bekamen von ihm täglich „orangefarbene Pillen“ (Speed), um ihr „Leistungsvermögen“ zu verbessern. In Westberlin gab es eine kleine Dépendance: den „Eden Playboy-Club“ von Rolf S. Eden, einem Playboy, der sich ebenfalls ständig mit jungen Blondinen umgab und mit seinem Rolls-Royce den Kudamm auf und abfuhr, von Touristen photographiert.
1965 gründete der US-„Playboy“ Bob Guccione ein „Me Too“-Produkt in Konkurrenz zum Playboy: das etwas schärfere Magazin „Penthouse“. Guccione besaß ebenso wie Hefner ein eigenes Flugzeug. Bei der Vorstellung der deutschen Ausgabe in München ließ er damit extra aus den USA seine „Diät-Cola“ (mit wenig Zucker) einfliegen, wie die BILD-Zeitung berichtete, die schon immer „Verständnis für Toleranz“ hatte (eine Maxime eines Swingerclubs in Karlshorst).
Man kann inzwischen sagen, mindestens in den USA hat dieser Kapitalismus sich rasant durchgesetzt, insofern im Internet Dutzende von Clips und Photos zirkulieren, auf der die Präsidentengattin Melania Trump als Sexmodel und Pornodarstellerin posiert. Gleichzeitig gilt für Beatriz Preciado aber auch: „Jedes Mädchen im tiefsten Russland, jede junge Frau in der spanischen Provinz kann heute mit einem Computer, einer Webcam und einem Paypal-Konto ausgerüstet eine legitime Konkurrentin des Playboy und damit Teil eines Marktes werden, dessen Landschaft so gewunden ist wie ein Traum.“ Die Inneneinrichtung und die Stewardess-Uniformen von Hefners Flugzeug „Big Bunny“ wurden bei Ebay versteigert und das Flugzeug verschrottet. Mission accomplished.
.

Sogar die Zollbeamte haben nichts dagegen, geknipst zu werden.
.
Sag zum Abschied leise Service!
Man geht davon aus, dass die Computerisierung noch weitere Massenarbeitslosigkeitswellen hervorruft. Den entlassenen Arbeitern und Angestellten wird wie stets geraten, sich zu „qualifizieren“, umzuschulen und selbständig zu machen. Einer der Betroffenen erwiderte: „Reparaturwerkstätten, klar! Ich wollte eine aufmachen, als ich arbeitslos geworden bin. Jan, Sam und Alf auch. Wir haben alle geschickte Hände, also laßt uns alle eine Reparaturwerkstatt aufmachen. Für jedes defekte Gerät in Ilium ein eigener Mechaniker. Gleichzeitig sahnen unsere Frauen als Schneiderinnen ab – für jede Einwohnerin eine eigene Schneiderin.“ Dies ist ein Zitat aus dem 1953 veröffentlichten Buch des US-Schriftsteller Kurt Vonnegut: „Das höllische System“ – 1953!
Damals ging es um die Massenarbeitslosigkeit produzierenden Folgen der Einführung des „Zentralcomputers“. Heute ist es das Internet und die „Coaches“ der Jobcenter raten ihren „Kunden“ nun, „Spätis“ und Friseurläden zu eröffnen – in jeder Straße 10. Da das aber nicht funktioniert, geht es darum, „Zwischenhändler“ zu werden – möglichst im zukunftsoptimistischen Internet: Sei es mit immer neuen Apps und Papps, sei es mit „Datendiebstahl“ und -verkauf, oder mit erschlichenen Dienstleistungen: „Sag zum Abschied leise Service,“ wie dazu der Netzkolumnist Peter Glaser sagte.
Es vergeht kein einziger Tag, an dem man mir nicht per mail versichert, ich hätte irgendwo 50.000 Euro oder 5 Millionen gewonnen, geerbt oder sonstwie verdient, ich müßte nur Soundsoviel vorschießen, überweisen. Am Schlimmsten ist das vollkommen mafiöse Firmengeflecht des Dr. Klenk aus dem Westerwald. Seit drei Jahren bekomme ich von einem seiner vielen Callcenter mindestens zwei Mal in der Woche eine unsittliche Aufforderung: Ich soll ihnen das Jahresabogeld für „Die Zeit“ überweisen, dann soll ich endlich die Jahresgebühr für ihren Flugsicherheitsdienst FAS zahlen und neuerdings soll ich das Jahresabo für „Lotto24“ verlängern. Dazu mahnen mich auch noch ständig die Deutsche Bank, die Commerzbank und die ‚Sparkasse an, dass da was mit meinem Konto nicht stimmt. Ich habe aber überhaupt kein Konto!
Klenk und seine Comrads in Crime“ sind nicht zimperlich: Einen abtrünnigen Geschäftspartner hat Klenk schon mal die Ohren abschneiden lassen (er bekam dafür 2001 eine sechsjährige Haftstrafe). Und einen jungen Abowerber, der es in der Drückerkolonne für das Pressevertriebszentrum“ (PVZ – das so ziemlich alle Kapitalmedien mit Abos versorgt) nicht mehr aushielt und sich absetzen wollte, hielten sein Kolonnenführer bei voller Fahrt auf der Autobahn aus dem Fenster, um ihn wieder zu motivieren. Bei den Juristen der Uni Erfurt hatte man 2015 zusammen mit dem LKA angefangen, ein Organogramm vom Klenk-Geflecht anzufertigen, dann erstellten sie dort ein zweites Organogramm von einigen der darin verflochtenen Firmen und schließlich ein Liste der vielen Branchen, in denen Klenk wirkt, mit den jeweiligen Jahresumsätzen. Das reichte bis zu Videoclubs, Pornoproduktionen, Drückenkolonnenfirmen, Hotels, Restaurants usw.
Mit der Liste der Geschäftsführer, Miteigentümer und Teilhaber dieser ganzen vernetzten Firmen sind sie noch immer beschäftigt, was nicht verwundert, denn diese neue „Servicebranche“ (mit ihren ganzen mehr oder weniger schwachsinnigen, aus Amerika kopierten „Start-Ups“) verändert sich ständig. Es ist ein Geflecht, in dem laufend Löcher entstehen (nicht zuletzt durch Gerichtsurteile), das sich gleichzeitig aber auch permanent nach außen erweitert, durch Verschmelzungen (Rationalisierungen) verdichtet, und im Inneren Teile liquidiert, weil bei diesen immer schneller überholten Technologien und Märkten ganze Branchen plötzlich hinfällig werden: zuletzt die Videoclubs… Ach, es wird böse enden.
.

Und auch die Besitzerin des Hafenrestaurants sorgt für eine bleibende Erinnerung.
.
Klirrende Zweifel
Als der „Palast der Republik“ abgerissen und an seine Stelle ein Hohenzollern-Schloß aus Beton errichtet werden sollte, wurde dort ein Transparent mit dem Wort „Zweifel“ aufgehängt. Dieses, wenn auch vielleicht nicht das selbe, hängte man später an die Volksbühne, als ihr Leiter, der Ostregisseur Frank Castorf ersetzt werden sollte durch einen englischen Werbefuzzi. Hier wie dort „bezweifelte“ man also, dass die Herrschenden aus dem Westen mit ihren restaurativen Eingriffen in die beliebtesten Kultureinrichtungen der DDR-Hauptstadt (man könnte auch noch die Staatsoper und den Tierpark dazuzählen, wo nun Ähnliches passiert) wirklich als sog. „Partner“ (wie man im Kapitalismus alle diejenigen nennt, die man schädigen will) sinnvolle, nach vorne weisende Entscheidungen im „Anschlußgebiet“ treffen, d.h. ob sie noch alle Tassen im Schrank haben. Bleiben wir beim Zweifel, der auf allen Ebenen und überall aufkommen kann.
So z.B. bei Joachim Illies, dem Gründer und ehemaligen Leiter der limnologischen Forschungsstation der Max-Planck-Gesellschaft in Schlitz bei Fulda: Er zweifelte im Laufe seiner Erforschung von Süßwasserinsekten immer mehr an Darwins Evolutionstheorie bzw. an deren tragenden Begriffen – und wurde immer gläubiger: In seinem letzten Buch „Der Jahrhundert-Irrtum“ (1982) schrieb er: Zwar gebe es eine schrittweise Generationenkette von der Amöbe bis zum Menschen, aber der Darwinismus mit seiner Reduktion auf Mutation und Selektion sei eine unzulässige Vereinfachung allen Evolutionsgeschehens. Hinter der Evolution stehe mehr; das sei etwas bisher Unverstandenes; dieses Unverstandene bilde die Brücke zum Religiösen.
Eine Brücke vom Religiösen zum Revolutionären schlug der sowjetische Schriftsteller Andrej Platonow 1929 in seinem dystopischen Roman „Tschewengur“: Einer der Hauptpersonen des Dorfes, Dwanow, „hörte in der Melodie der Kirchenglocke Beunruhigung, Glauben und Zweifel. In der Revolution wirken auch diese Leidenschaften – nicht allein durch den gußeisernen Glauben bewegen sich die Menschen, sondern auch durch klirrende Zweifel.“
Leider haben auch die Kommunisten, wie schon der Kirchenvater Augustinus, solch einen „Skeptizismus“ bekämpft: So kritisierte z.B. der SED-Vorsitzende Erich Honecker auf der 11. Tagung des Zentralkomitees 1966 die „Ideologie“ und das „Gift des Skeptizismus“ bei all jenen Schriftstellern und Künstlern, „die den Zweifel als Schaffensmethode benutzen“. Es würde keinem Arbeiter einfallen, dem Skeptizismus „zu huldigen“.
Der DDR-Philosoph Herbert Lindner, der zunächst Aushilfsweichenwärter war und dann auf einer Arbeiter- und Bauern-Fakultät studierte, bestand in seinem Buch „Der Zweifel und seine Grenzen“ (1966) darauf, Zweifel und Skeptizismus, „obwohl sie das selbe bezeichnen, unbedingt zu trennen“, denn kurz vor dem 11.Plenum hatte Walter Ulbricht einen Brief an den Regisseur Kurt Maetzig veröffentlicht, in dem er ausdrücklich eine „gewisse produktive Potenz des Zweifels“ anerkannte – und so die „positive Seite eines fruchtbaren Zweifels“ hervorhob, wohingegen ihm der Skeptizismus „uferlos“ und damit als unproduktiv galt.
Ulbrichts und Honeckers Äußerungen hatten damals Wirkung, wie mir u.a. der einstige Absolvent der Agraringenieurschule Oranienburg, Hanns-Peter Hartmann, erzählte: „Das 11. Plenum des ZK der SED hatten wir, mein Freund Siegfried Mattner und ich, an der Wandzeitung kritisiert. Es ging damals um die Zügelung der Kulturschaffenden und der Begriff ‚Skeptizismus‘ war darin zentral. In unserem Text hatten wir davor gewarnt, gerechtfertigte Kritik von unten nun als ‚Skeptizismus‘ abzutun. Und dadurch standen wir in der Schule auf der Abschußliste.“
Wann und wie der Zweifel in einen spätantiken Skeptizismus abgleitet, ließ Herbert Lindner leider ungeklärt. Zwölf Jahre später diskutierte das linke westdeutsche „Kursbuch“ einige „Zweifel an der Zukunft“: Hans-Magnus Enzensberger schrieb über den Weltuntergang, Bodo Kirchhoff über den Mangel, Klaus Binder über Fremdbestimmtheit, Rudolf Kohoutek über den Massenwohnungsbau und einige andere Autoren über mehr oder weniger traurige Utopien und Utopisten. Inzwischen sind Zweifel und Skeptik jedoch wiedervereint (synonym).
Aber das macht es nicht einfacher – jetzt, da es anscheinend keine ökonomische Utopie mehr gibt, sondern nur noch eine ökologische. So klagt z.B. der Literaturwissenschaftler Timothy Morton in seinem Buch „Ökologie ohne Natur“ (2016): „Genau dann, wenn es Sicherheit bräuchte, wartet die Ökomimese mit einer Überdosis Zweifel auf.“ Mit „Ökomimese“ ist die gedankliche Auseinandersetzung mit der Natur gemeint: „Nature Writing“.
.

In der Grottenbar an der Hauptmoschee stehen für alleinreisende Herren Tanzpartnerinnen bereit.
.
Einzelhandelselend
In der Nürnberger Strasse gab es einen Laden mit teurer Damen-Unterwäsche (auch Reizwäsche oder Dessous genannt). Zu Weihnachten dekorierten die Besitzer ihr Schaufenster mit einer kleinen elektrischen Eisenbahn, die alle Schlüpfer und BHs im Kreis herumfuhr. Sehr ansprechend, besonders für Eisenbahnfans, aber der Laden war „Halb schon vorbei“, wie Andrea Roedig über die Agonie „der kleinen Geschäfte“ in ihrem Buch „Über alles, was hakt“ (2013) bemerkt: Diese Läden verlieren nach und nach „die Funktion des ‚Geschäfts‘, manche tun irgendwann „nur noch so als ob“. Bei anderen Einzelhandelsunternehmen denkt man schon bei ihrer Eröffnung: „Das ist aber gewagt“. Bei einem Laden in der teuren Kantstrasse z.B., der nur Ventilatoren anbot oder bei einem anderen, der Wasserbetten verkaufte oder bei einem dritten, der es mit „Buddelschiffen“ versuchte.
Derzeit werden die meisten Einzelhändler über Mieterhöhungen vertrieben: Allein in der Kreuzberger Oranienstrasse mußten drei sehr gute türkische Läden mit Waren des täglichen Bedarfs idiotischen Touristenkneipen weichen. Andere Existenzgründungen wurden und werden vom „Fortschritt“ weggefegt: Viele Videoläden z.B.: „Das Internet hat uns das Genick gebrochen,“ erklärte mir einer der Besitzer. Ähnliches sagen die Betreiber von Dorfläden über den neuen Supermarkt in der Nähe und die Textilverkäufer über die neuen Einkaufspassagen (Malls). Bei den Antiquariaten, aber auch bei den Buchläden, ist es das Smartphone: „Keiner liest mehr Bücher!“ Darüber klagen selbst die Universitätsdozenten, deren Seminarliteraturlisten dennoch immer länger werden. Während die Kürschner und Pelzhändler schimpfen: „Die Tierschützer haben uns das Geschäft kaputt gemacht“.
Mein Lieblingsverlierer an der Konsumfront war die Drogerie des „großen Hisserich“, wie ich ihn nannte. Er fand seine Gegner in Rossmann, DM und anderen Ketten. Statt wenigstens „anständig“ seine Rente abzusichern, schwankte er lange Zeit zwischen Expandieren und Aufgeben, derweil er eine Filiale nach der anderen schließen mußte – bis auf sein „Kerngeschäft“ in der Mariannenstraße. Seine Frau arbeitete im Laden mit, außerdem gab es da noch eine (treue) letzte Verkäuferin. Er hatte über all die Existenzsorgen ein Nervenleiden bekommen und konnte nicht mehr schlafen, zigmal war er deswegen in Behandlung gewesen und schimpfte sehr qualifiziert auf Ärzte und Urban-Krankenhaus. Schon mehrmals hatte er im Laden junge Mädchen beim Lippenstiftklauen erwischt – deswegen schimpfte er auch auf die Jugend, vor allem auf die türkische. Selbst das Saunatreiben der feministischen „Schokofabrik“-Frauen im Hinterhaus ließ ihn nicht kalt, ebensowenig die komischen Geschäftsfrauen des Bioladens nebenan, wozu natürlich auch ihre Kunden gehörten. Der Große Hisserich machte sie alle und alles runter. Dabei war er jedoch kein Gesellschaftskritiker geworden. Alles blieb streng im Empirischen, wobei ihm natürlich schon die Unfähigkeit der heutigen Ärzte als allgemeine Tatsache galt. Selbst die Drogeriewaren und -arzneien waren schlechter geworden, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Das alles ging weit über „Kraft durch Nörgeln“ hinaus. Wenn ich schlecht gelaunt war, pflegte ich schnell einen Diafilm vollzuknipsen, um ihn beim Großen Hisserich entwickeln zu lassen. Wichtig war mir dabei vor allem, seinen Klagen zuzuhören. Wenn gerade niemand im Laden war, was meistens der Fall war, gesellten sich seine Frau und seine Verkäuferin, beide in blütenweißen Kitteln, dazu und lächelten gequält über seine Tiraden oder murmelten Versöhnlerisches, wenn er sich allzu sehr in Rage redete. An sich waren sie sich aber wohl einig: Der Sinn liegt allein in der Expansion, d.h. im Erfolg, und der letzte Laden – das hat alles keinen Zweck mehr, da wird jetzt nur noch weitergemacht, weil er damals zu wenig geklebt hat: „Sie wissen doch, wie das so ist…“
Ja, aber dennoch wagen immer wieder mutige „Start-Upper“ Neueröffnungen – mit Luftballongirlanden. Die neuen Spielhallen und Wettbüros sowie die Friseur- und Dönerläden verfluche ich allerdings inzwischen – ob ihrer dümmlichen Phantasielosigkeit. Und sowieso ist doch jede Geschäftspleite auch eine Erlösung, insofern man nicht sein ganzes Leben hinter einem Verkaufstresen verbringen und zu jedem Arschkunden freundlich sein muß. Erwin Strittmatter hat dieses Elend in seiner Trilogie „Der Laden“ wunderbar herausgearbeitet.
.

Einige der an Land angebotenen Kulturveranstaltungen enttäuschten allerdings.
.
Misanthropozän
In einer so schönen Umwelt, wie in Kalifornien, scheinen die Menschen besonders um sie besorgt zu sein. Die kalifornischen Künstler machen fast mehrheitlich „Ecoart“ (Ökokunst), die letzte „documenta“ zeugte davon. Bereits in den Achtzigerjahren waren kalifornische Künstler nach Westberlin gekommen, denen es um nichts Geringeres ging, als die Spree zu renaturieren. Jetzt, 30 Jahre später, kann das Brandenburger Landesumweltamt verkünden, dass in der Spree zwischen Wannsee und Spreewald wieder Flußkrebse leben; vor allem rund 30 Millionen Flußmuscheln, deren Filtriertätigkeit wir „die gute Wasserqualität der Spree zu verdanken“ hätten.
Die kalifornischen Schriftsteller, Geisteswissenschaftler und Ökologen arbeiten sich am „Nature Writing“ ab, am Schreiben über die Natur: Ein mit der Romantik entstandenes Genre, das derart forciert wurde, dass der Ökophilosoph Timothy Morton schließlich eine „Ökologie ohne Natur“ entwarf. Sie wurde 2016 auf Deutsch veröffentlicht – vom Verlag Matthes & Seitz, der in den letzten Jahren vor allem mit seiner großen Reihe „Naturkunden“ Aufmerksamkeit bekam, die von der Greifswalder Buchmacherin Judith Schalansky betreut wird. Dort erschien im selben Jahr auch das berühmte Buch des „Nature Writers“ Edward Abbey: „Die Einsamkeit der Wüste“ sowie einige Bücher des Klassikers Henry David Thoreau – mit dessen „Leben in den Wäldern“ (Walden) das „Nature Writing“ ab Mitte des 19. Jahrhunderts Amerikanisch wurde.
Hier und heute stiftet der Verlag Matthes & Seitz einen „Nature Writing“-Preis und dort berufen sich vom „UNA-Bomber“ bis zu den US-Ökoaktivisten und -terroristen (der „Earth First“ u.a.), auf diese bioanarchistischen „Pioniere“. Timothy Morton hält diese Form der „Ökomimese“ jedoch für nicht ausreichend – in literarischer Hinsicht. Er beruft sich dabei auf Hegel, Heidegger, Lacan, Adorno, Derrida, Donna Haraway, Roland Barthes, Michel Foucault, Brian Eno, Bruno Latour, Wiktor Schklowsky und Slavoj Zizek – um nur die Wenigsten zu nennen. Alles Ökokritiker von Rang, so to speak, mit denen Morton „Eine neue Sicht der Umwelt“ entwirft, nach der wir den Natur-Begriff getrost fallen lassen können, denn er enthält tatsächlich zu viel und zu wenig (ebenso wie das Zentralorgan der Darwinisten: „Nature“). Mit den Worten von Donna Haraway: „Es gibt weder Natur noch Kultur, aber viel Verkehr zwischen den beiden.“ Die kalifornische Biopoetin betrachtet sich als „Follower“ (Mitforscherin) des Wissenssoziologen Bruno Latour und seiner „Akteur-Netzwerk-Theorie“. Für Latour gibt es keine ökonomische Utopie mehr, nur noch eine ökologische. Nicht trotz, sondern wegen Bienensterben und Artensterben, radioaktiver Verseuchung und Überfischung der Meere, Humusverlust und Verwüstung der Erde.
Mit postsowjetischem Schwung und kalifornischer Sachlichkeit setzte im „Critical Theory Institute“ (!) der Westküste das „close reading“ des „Nature Writing“ ein; 1991 veröffentlichte der marxistische Professor für vergleichende Literaturwissenschaft, Frederic Jameson, das bisher noch nicht übersetzte Buch „Seeds of Time“, das den theoretischen Rahmen der Kritik absteckte. Seine Gewährsleute sind Althusser, Adorno, Marcuse und Georg Lukacs. Jameson fand etliche „Schüler“. Der Verlag Matthes & Seitz veröffentlichte in diesem Jahr aber erst einmal einen frischen Ökoklopper: „Molekulares Rot“ von McKenzie Wark. Der australische Kulturwissenschaftler war Parteiarbeiter in der KP gewesen. Bereits in den Siebzigerjahren besaß die KP-nahe Bauarbeitergewerkschaft (BLF) ein „Umweltzentrum“, von dort gelang es ihnen, all jene Baustellen mit einem „grünen Bann“ zu belegen, „die als für die Umwelt schädlich eingestuft wurden.“
Wark beschäftigte sich lange mit der „Situationistischen Internationale“, er lehrt heute an der New Yorker „New School for Social Research“. In „Molekulares Rot“ führt er mindestens die selbe Ökotheoretiker-Bandbreite wie Morton ins Feld, dazu noch Marx und vor allem die Sowjetschriftsteller Alexander Bogdanow und Andrej Platonow. Das „close reading“ ihrer Werke macht die Hälfte seines Buches aus. Die andere geht für die Feministin Donna Haraway und den Science-Fiction-Autor Kim Stanley Robinson (der bei Frederic Jameson studierte) drauf. Wark kann sich laut seiner Zitate auf gleich Dutzende von akademischen Arbeiten im englischsprachigen Großraum berufen, die sich nach 1991 mit einzelnen Aspekten, Literaturen und Zeitabschnitten der Sowjetunion befassten. Sein durchgehender Begriff – „Tektologie“ – stammt von Bogdanow, der damit ein System meinte, das Soziales, Biologisches und Physikalisches zusammenführt. Morton sagt es so: „In einer wahrhaft ökologische Welt wird der Begriff der Natur sich in Rauch auflösen.“ Während Wark über den Istzustand urteilt: „Es handelt sich um eine denaturierte Natur ohne Ökologie.“
.

Aber die beeindruckenden Architekturzeugnisse entschädigten für so manches.
.
Fake News
Ausgedachte Nachrichten also. Wenn früher ein sogenanntes Interview gewollt wurde, die Gewollten sich jedoch versteckt hielten (anarchistische Strommastenabsäger, der Schriftsteller Klaus Theweleit, die Terroristin Inge Viet, der Regisseur Woody Allen, der Grenzer im toten U-Bhf Brunnenstrasse Jürgen S. u.a.), dann setzten wir uns zusammen, rauchten einen Joint und „fakten“ das Interview mit ihnen, wobei wir uns in die betreffende Person und in ihre Gedanken einzufühlen versuchten. „Die Wahrheit halluzinieren,“ nannte der damals im Vogelsberg lebende Verleger Jörg Schröder dieses nächtliche Verfahren. Er ging dabei davon aus, dass wir doch schon alles wissen (jede Blödheit und Sauerei), man muß sich nur trauen, sie auch zu veröffentlichen.
Mit dem Internet hat sich alles geändert, denn jetzt schreibt jeder Smartphonebesitzer, schon morgens in der U-Bahn, eine „News“ (seine persönliche Neuigkeit). Das reicht von „Frühstücke gleich ausgiebig“ über „Angela Merkel ist ein blödes Arschloch“ bis zu ganzen Geschichten über Greueltaten von Ausländern an Deutsche. Oder – worüber ich oft und gerne „poste“: über Haltungsschäden von Wildtieren und -pflanzen im Zoo bzw. auf der Internationalen Gartenausstellung. Auch über die drei Westheinis, die man, von Westberlin aus gedacht, den drei Ostberliner „Flaggschiffen“ Staatsoper, Tierpark und Volksbühne vorgesetzt hat, würde ich gerne so manche „Fake News“ verbreiten, meinetwegen auch „echte“ – d.h. abgesicherte – Informationen, aber meine Informanten in den drei Institutionen schweigen.
Mit den früheren Fake News war es dann so weiter gegangen, dass „wir“ irgendwann merkten, bei einer gründlichen Lektüre und Überprüfung des deliranten Romans „Die Enden der Parabel“ von Thomas Pynchon, dass alles darin wahr ist, in Summa: dass die sogenannte Wirklichkeit genug Seltsames und Lehrreiches entbirgt, man muß sie sich nicht „neu erfinden“ – auch wenn das jetzt gerade große Mode ist: Jeder soll/muß/kann/darf sich nun neu erfinden. Dazu wird erst einmal alles Drumherum Amerikanisch aufpoliert: Z.B. Fake News statt gut oder schlecht Ausgedachtes. Amerikanisch ist daran, dass dort die Literatur – dort „Fiction“ genannt, immer schon populistisch (als Massenware) daherkam: Pop-Kultur, die den Kulturimperialismus über den Weltmarkt „exportiert“.
In den USA war es dann auch, schlimmer noch: in Kalifornieren – und noch schlimmer: in Hollywood, das der Fake, der bei uns in Oberhessen aus Armut geboren war (keine Reisespesen, minimalstes Honorar), dort nun einem teuren Lebensstil diente: dem des Schweizer Tennislehrers Tom Kummer, der Hollywood-Prominente für die Süddeutsche Zeitung scheinbar interviewte. Seine „Fake News“ aus diesem sagenhaften Ort voller reicher Berühmtheiten waren hoch angesehen und honoriert. Aber irgendwann flog der Laden auf.
So wie auch der des Pferdesportberichterstatters beim WDR, der „live“ aus England berichtete, dies in Wirklichkeit jedoch von seiner Datscha in Neuss aus tat. Tom Kummers Entlarvung sorgte für einen Skandal – bei all jenen, die „Nachrichtensicherheit“ wollen. Seitdem reagiert die bürgerliche Presse hysterisch auf „Fake News“. Aus Amerika kommt nun aber auch das Gegenmittel: Ein Computerprogramm, ein Algorithmus, der alle „Fake News“, schon Sekunden nachdem sie gepostet wurden, aufspürt – und vernichtet. Der deutsche Staat, der sogenannte Volkswille (über den die BILD-Zeitung bis zur Internetverbreitung wachte) verlangt den Einbau von so etwas Kompliziertem (und eigentlich Unmöglichen) auch bei Facebook und den anderen asozialen Medien. Neulich hörte ich, dass die dort schon mal vorläufig eingesetzte „Wetware“ dafür, d.h. die Zensoren, unter Heulkrämpfen leiden. Waren die im Sozialismus eigentlich auch so zart besaitet? Apropos: Der Dissident Boris Jampolski urteilte 1975 über Fiction und Non-Fiction: „Wenn [E.T.A.] Hoffmann schreibt: ,Der Teufel betrat das Zimmer‘, so ist das Realismus, wenn die [Sowjetschriftstellerin] Karajewa schreibt: ,Lipotschka ist dem Kolchos beigetreten‘, so ist das reine Phantasie.“ Zuvor hatte der geschätzte Dichter Ossip Mandelstam bereits verkündet „Ich habe mein Schach von der Literatur auf die Biologie gesetzt, damit das Spiel ehrlicher werde.“
Das Wort „Fake News“ ist heute ein „Sammelbegriff für jede Form von problematischen Inhalten,“ meint eine New Yorker „Analystin“, also für „Propaganda jeglicher Art“ – das heißt wahrscheinlich: für antikapitalistische Äußerungen aller Couleur.
.

Hier sorgte die Chefstewardess Uschi unkompliziert für einen belebten Vordergrund.
.
Alimente
Ich höre immer mal wieder von Vorwende-Vätern, dass sie nach der Wiedervereinigung eine gehörige Summe an Alimenten zahlen mußten. Dabei wird unwidersprochen wissenschaftlich, d.h. biologisch, argumentiert: Es fand ein Geschlechtsverkehr statt und dabei wurde ein Kind gezeugt, dieses stammt zur Hälfte vom Mann ab, indem die weiblichen und männlichen Keimzellen sich zu einem vollständigen, diploiden Zwei-Chromatid-Chromosomensatz vereinigten. Glasklar! Nun sind zwar die biologischen Wissenschaften (als „Life Sciences“) spätestens seit dem Nationalsozialismus zur Leitwissenschaft schlechthin aufgerückt, was zu solchen gedankenlosen Theorieexzessen führte wie der, dass selbst die Löwen angeblich hochinteressiert daran seien, ihre Gene weiter zu „geben“, und als sei das nicht schon idiotisch genug gedacht, da noch einen drauf zu setzen mit dem „egoistischen Gen“, für das der interessierte Löwe nur ein Vehikel ist, um sich fortzupflanzen, ja, sein Vererbungsinteresse, seine Geilheit und alles Getue drum herum geschieht nur im Dienste dieser fortpflanzungsbesessenen Gene. So weit so schlecht gedacht – und bloß in ökonomischer Hinsicht produktiv und damit auch justitiabel. Es gibt inzwischen eine „künstliche Befruchtung“ und die „Leihmutter“, 2014 gebar eine solch künstlich befruchtete Frau aus Thailand Zwillinge für ein kinderloses Ehepaar aus Australien. Weil aber ein Kind mongoloid war, nahm das Ehepaar ihr nur eins ab – das „gesunde“. Daraufhin klagte die Leihmutter auf seine Herausgabe – und bekam Recht, so viel ich weiß.
Da wir aber zugleich auch postkolonialistisch zum Relativismus gezwungen sind, erinnerte der Ethnologe Claude Lévi-Strauss an die Samo in Burkina Faso, die ein Äquivalent zur Insemination mit Spender erfanden: Jedes heiratsfähige Mädchen, das einem Ehemann versprochen ist, muss vorher einen Geliebten haben, der sie befruchtet. Das daraus entstehende Kind gilt dann als das Erstgeborene der legitimen Verbindung. Quasi umgekehrt gibt es daneben auch noch afrikanische Völker, bei denen der Vater, wenn die Mutter seiner Kinder ihn verläßt, ein Vaterschaftsrecht auch auf ihre zukünftigen Kinder hat. „Auf diese Weise kann ein mit einer unfruchtbaren Frau verheirateter Mann kostenlos oder gegen Bezahlung mit einer fruchtbaren Frau vereinbaren, dass sie ihn als Vater ihrer Kinder bestimmen soll.“ Bei den Nuer im Sudan sind die unfruchtbaren Frauen den Männern gleichgestellt. Als „väterlicher Onkel“ erhalten sie daher einen Anteil am Vieh, das bei der Heirat ihrer Nichten als „Brautpreis“ gezahlt wird. Diesen Teil verwenden sie dafür, eine Gattin zu kaufen, „die ihnen dank den entlohnten Diensten eines Mannes, oft eines Fremden, Kinder schenken wird.“ Bei den Yoruba aus Nigeria können auch reiche Frauen Gattinnen erwerben, um sie dazu zu drängen, sich mit einem Mann zusammenzutun. Die daraus entstehenden Kinder beanspruchen sie – als rechtmäßige Gatten. Falls ihre „wirkliche Erzeuger“ sie behalten wollen, „müssen sie reichlich dafür zahlen.“
Diese Beispiele entnahm ich der Biographie über Claude Lévi-Strauss von Emmanuelle Loyer. Der Ethnologe erwähnte seinerzeit noch das „Levirat bei den alten Hebräern“, das es ihnen erlaubte und zuweilen sogar vorschrieb, dass der jüngere Bruder im Namen seines verstorbenen Bruders Kinder mit dessen Witwe zeugt: „Hier haben wir ein Äquivalent der Insemination post mortem.“ Die haben wir heute auch, als z.B. die US-Sängerin Madonna sich in einer italienischen Samenbank einen Mann aussuchte, der gestorben war, was ihr aber nur recht sein konnte, als sie mit dessen gekauften Samen schwanger wurde. Wir lernen aus diesen verwirrenden Fakten, dass die „biologische Lösung“ keine Endlösung ist und auch nicht sein darf, weil das die Auslöschung aller Anderen voraussetzen – und uns damit laut Lévi-Strauss „zu austauschbaren und anonymen Atomen“ machen würde. Wir erinnern uns: Berlin-Buch 1933 „ein Gen – ein Atom“.
.

Auch die Politik kommt nicht zu kurz: Beim nächsten Landgang wird mit viel Raki lauthals Erdogan kritisiert.
.
Oller Marx
Wenn westliche Wissenschaftler sich Marx widmen – spätestens seit der sogenannten „Wende“, als der BRD-Arbeitsminister Norbert Blühm sofort tönte: „Marx ist tot, aber Jesus lebt!“ – geschieht das fast immer ironisch, distanziert, mit der Handkante und eigentlich mißmutig. Oft geht es ihnen dabei um einen schnellen Beweis, dass „Marx“ überholt sei, veraltet – nicht mehr der Rede wert. Es verhält sich dabei ähnlich wie mit den „68ern“: Noch fast zwanzig Jahre danach bezeichneten sich damals eigentlich reaktionär gewesene Dozenten und Politiker gerne als „68er“ – sogar der ehemalige CDU-Bürgermeister von Berlin Diepgen. Aber dann distanzierten sich alle möglichen Trottel von „68“ – und gefielen sich sogar darin, herauszuarbeiten, dass die „68er“ eigentlich am Zerfall der Familie, an der Drogen- und Partysucht der Jugendlichen, an der allgemeinen Politikverdrossenheit und sogar am weltweiten Terrorismus schuld seien. Die „68er“ wurden „totgesagt oder für alle Übel der Gegenwart verantwortlich gemacht,“ wie der Spiegel über eine dumme „68-Debatte bei ‚Maybrit Illner‚“ schreibt. Gerne bedient man sich bei solchen Gelegenheiten der Renegaten, der abgefallenen „68er“, die es ja genau wissen müssen und die der Spiegel deswegen in der Talkshow vermißte.
Im „Freitag“-blog schrieb Daniela Waldmann: „Marx blieb Hegel verhaftet – Hegels Weltgeistfanatismus und seinem Ablaufmodell der Geschichte. Er hat (wie Hegel) ein geschlossenes Weltbild. Und Marx konnte sich zeitlebens nicht durchringen, sich zur Freiheit und Liebe als Weg zu bekennen, obwohl er sah, dass jede Revolution eine Konterrevolution hervorruft.“ Ihr antwortete eine „Magda“: „So ein Quatsch. Er konnte sich nicht durchringen. Ich glaube, er war ganz sicherlich sehr liebevoll zu seinen Frauen.“
Einst, als die Willy-Brandt-Regierung „nach 68“ analog zu den „Arbeiter- und Bauern-Fakultäten“ der DDR (die 1963 geschlossen wurden) ein Dutzend „Reformuniversitäten“ gründete und zugleich das „Begabtenabitur“ einführte, das nahezu jeder Jungarbeiter und Jungbauer bestand, waren die Westberliner U-Bahnwaggons voll mit hier vor allem Kindergärtnerinnen und Krankenschwestern, die auf dem Weg zur Uni oder PH alle (wirklich alle!) in den „blauen Bänden“ lasen. Ihre Abiturprüfungen liefen dann ähnlich freundlich ab wie Hermann Kant sie 1965 in seinem Roman „Die Aula“ an der ABF der Uni Greifswald schilderte.
„Die Zeit“ fand jetzt „im Keller“ der Uni Münster einen von Studenten selbstorganisierten Marx-Arbeitskreis. Das schien ihr so bemerkenswert, dass sie die Initiatorin, Isa Steiner, über dieses Phänomen (das letzte gar?) interviewte.“Marx ist Ihnen an der Uni nie begegnet?“ fragte die Zeit. Frau Steiner antwortete: „Nur kurz in einem Kurs, der sich ‚Geschichte der ökonomischen Theorie‚ nennt. Ich habe gehofft, dass wir dort mehr über Marx lernen. Aber der Dozent hat uns hauptsächlich erklärt, dass Marx geistiger Vater der Input-Output-Tabelle sei, also eines Teils der heutigen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, der zeigt, wie aus Rohstoffen Produktionsmittel und Konsumgüter werden. Er wollte uns davon überzeugen, dass alles Brauchbare von Marx in der Neoklassik aufgegriffen werde. Deshalb seien Forderungen mancher VWL-Studenten, sich im Studium mehr mit Marx auseinanderzusetzen, nicht gerechtfertigt.“
Lang ists her: Zehn Jahre nach dem „Mai 68“ hatte der Pariser Philosoph Roland Barthes noch gemeint, Marx brauche man nicht mehr zu studieren, dessen einschneidende Gedanken bekomme jeder mit der Muttermilch mit. In der „Deutschen Zeitschrift für europäisches Denken ‚Merkur’“ wurden gerade gleich zwei Marx-Texte veröffentlicht – von einem in den USA lehrenden Germanisten, Matthias Rothe, und einem Mitarbeiter des Berliner Zentralinstituts für Literaturforschung, Patrick Eiden-Offe. Dazu heißt es gleich im Vorwort der Redaktion: „Wenn einer nicht totzukriegen ist, dann Karl Marx, all den in seinem Namen begangenen Verbrechen zum Trotz.“ Und so sind die beiden Aufsätze auch quasi im „Trotz dessen“ geschrieben: der erste über Marx‘ und die Indianer und der zweite über den „alten Marx“ (in Gegensatz gestellt zu dem „jungen“ der „Frühschriften“). Die Befunde und Fundstücke des ersteren kennt man bereits aus dem Buch „Karl Marx, die ethnologischen Exzerpthefte“ des Anthropologen Lawrence Krader, der an der FU lehrte – von 1972 bis 1982 „in sehr schwierigen Zeiten“, wie Wikipedia meint. Der letztere befaßt sich mit dem Buch „Karl Marx. Größe und Illusion“ des Historikers Gareth Stedman Jones, der sich darin dem „’Elefanten Kapital‘ (Alain Badiou)“ stellt – und sogar „dem berüchtigten ersten Kapitel.“ Der Autor folgt hierbei jedoch nicht Stedman Jones, sondern einer von ihm „’Neue Marx Lektüre‘ (NML)‘ genannten Gruppierung, vor allem der „wertkritischen Lesart“ von Robert Kurz. Im übrigen begreift er den „Marxismus“ als eine fortschrittsgläubige „Gegenwissenschaft“. Während Marx im ersten Aufsatz über die Indianer eher als nicht ausreichend rückschrittsgläubig dargestellt wird.

Das soziale Geschehen bleibt ebenfalls nicht unkommentiert: „Kein Wunder, dass es mit der Wirtschaft bergab geht – bei einer solchen Arbeitseinstellung“.
.
Lieferketten
„Durch die Sexyness des Designs einen Blick auf die Lieferkette erhaschen,“ u.a. darum geht es der Ethnologin Luise Meier in ihrem Buch „MRX-Maschine“, das 2018 in der Reihe „Fröhliche Wissenschaft“ erscheint. Vor einiger Zeit hatte ich bereits die „Lieferkette“ der Gartenzwerge verfolgt, die als Tonfiguren epidemisch wurden. Bis 1977/78 führten die Zwerge in westdeutschen Spießer-Vorgärten bzw. Arbeiter-Schrebergärten ein vom bürgerlichen Geschmack eher geduldetes Dasein. In der kämpferisch sich gebenden Bürgerkultur der DDR wurden sie in den Fünfziger Jahren in einer Kampagne „Gegen den Kitsch“ sogar offiziell geächtet. Während dieser Zeit verlegte der Welt erster moderner Hersteller von Massengartenzwergen – die Firma Heissner KG, gegründet 1872 – ihre Produktionsstätten von Thüringen nach Oberhessen.
Mit der Zerschlagung der RAF kristallisierte sich langsam ein Bewußtsein von der BRD (als Deutschland?!) heraus — so der Kabarettist Wolfgang Neuss; die Grünen konstituierten sich und die Gartenzwerg-Verkaufszahlen stiegen wieder (1980 betrug ihre Steigerungsrate 15 %, die der Grünen zwischen 8 und 16 %). 1984 wurde ein Griechenlandbesuch des Grünen MdB Otto Schily in Saloniki gar mit drei grasgrünen Gartenzwergen angekündigt. Eine Sprecherin der Firma Heissner KG erwähnt, daß „die Alternativen“ privat vorwiegend unbemalte Rohlinge aus Ton kaufen (seit 1965 werden dort auch Gartenzwerge aus Plastik hergestellt). Der Chef der Firma , Walther Denk, wies bei einer Betriebsbesichtigung durch Journalisten darauf hin: „Alles was hier steht, verdanken wir dem Zwerg!“ Nichtsdestotrotz wirbt seine Firma damit, dass sie „Garten-Makeup“ herstellt.
Seit dem 2. Weltkrieg sind — in mittlerweile fünf Firmen — 30 Millionen Gartenzwerge produziert worden, 35% davon wurden exportiert, vornehmlich in die USA und nach Japan, für Südafrika wird den Zwergen extra ein besonders heller Teint verpaßt —normalerweise sind sie braungebrannt (die aus Plastik etwas blasser). In New York wirbt ein Gartenzwerg-Geschäft mit dem Hinweis „Japanische Gartenzwerge nach Original Heissner-Vorlage“. In der „Zeit“ und gleichlautend in einem „Vogelsberg“-Buch (der „Agentur Standard Text“) schreiben die Autoren, daß die arbeitenden Zwerge (mit Schaufel, Schubkarre oder Axt) am Beliebtesten sind, weniger gefragt sind dagegen musisch Tätige (schreibende, lesende oder musizierende), die faulenzenden, bloß herumliegenden oder pfeifenrauchenden Gartenzwerge gelten sogar als unverkäuflich. In dieser Zeit steigenden „Umweltbewußtseins“, Mitte der Achtzigerjahre, wird jedoch das westdeutsche Feuilleton auf den Zwerg aufmerksam (Artikel in ‚Spiegel‘, ‚Zeit‘, ‚Cosmopolitan‘, ‚Merian‘, ‚taz‘ – letztere allein in den letzten 18 Jahren 851). 1985 schreibt der grüne Frankfurter Gartenzwerg-Experte Florian Lindemann in der grünen „Frankfurter Rundschau“: „Etwas stimmt bedenklich: die steigende Nachfrage nach Gartenzwergen, ‚die gar nichts tun, nur noch selig Muße ausstrahlen'“: Vom verkitschten Miniatur-Denkmal des ewigen Schaffers zum Meditations-Objekt für Entspannungs- und Harmonie- (auch im Ökologischen und Gesellschaftlichen) Suchende…“
Ab Ende der Achtzigerjahre bekamen die Heissner-Gartenzwerge eine starke Konkurrenz durch billige Plastikzwerge aus Polen. Sie waren viel größer als alle bis dahin in die Gärten gestellten Zwerge. Die „Ökos“ reagierten darauf, indem sie statt weiterhin kleine unbemalte Meissnersche Rohlinge Buddhastatuen aufstellten. Und die „Neosexuellen“, indem sie sich rosa Flamingos anschafften. Nach 1990 kam es zu Gewaltakten: Die Gartenfiguren wurden geklaut oder sogar an Ort und Stelle zertrümmert. Einige Zwergbesitzer zertrümmerten sie auch eigenhändig. Ich sah einen Film über den Garten des ehemaligen Hanauer KPD-Genossen Dammbruch, den sein Sohn in den Sechziger Jahren gedreht hatte: Ein komplettes Gartenzwergland mit funktionierenden Wassermühlen, säckeschleppenden Zwergen, Windrädern und und und. Anschließend, d.h. nach den Dreharbeiten, im Film also nicht mehr sichtbar, hatte der alte Dammbruch seine sämtlichen Gartenzwerge mit dem Hammer kaputt geschlagen – und dann neue – Plastikgartenzwerge – aufgestellt. Damit wollte er sagen – schon damals: Eine neue noch modernere Zeit ist angebrochen. Ich habe dann auch gewechselt – von den Outdoor-Figuren zu den Zwergen im Inneren der deutschen Häuser und Wohnungen: den Hummel-Figuren aus Porzellan, entworfen von der Franziskaner-Nonne Maria Innocentia Hummel, mit Namen wie „Mutter’s Liebste“, „Wanderbub“ und „Mädchen am Schwanenteich“, hergestellt und vertrieben von der Hummel Manufaktur im fränkischen Rödental, hinzu kommt der „M.I. Hummel Club“, der laut FAZ „eines der wichtigsten Vermarktungsinstrumente der Figuren ist, er zählt nach Angaben des Bayrischen Rundfunks 26.000 Mitglieder, davon 20.000 in den Vereinigten Staaten. In Spitzenzeiten sollen es einmal bis zu 80.000 Mitglieder gewesen sein.“ Bevor ich jedoch noch ernsthaft die ganze „Lieferkette“ verfolgen konnte, meldete die „Hummel Manufaktur GmbH“ insolvenz an.
.

Der Besitzer dieser Hazienda begrüßte uns hoch zu Roß.
.
Staatsfreie Territorien
Was haben die folgenden Geländegewinne gemeinsam: Der ehemalige Flugplatz in Lärz/Müritz des 33. Jagdfliegerregiments der Roten Armee/ die auf der zertrümmerten Wehrtechnischen Fakultät der TU errichtete und inzwischen verlassene Abhörstation der NSA im Berliner Grunewald/ das „Zytanien“ genannte Gelände einer abgewickelten Ziegelei bei Lehrte/Hannover/ und das einstige „Deutschlandlager“ an der „Führerschule der Hitler-Jugend“ in Kuhlmühle bei Wittstock? Es sind temporäre „Locations“ der anarchistisch inspirierten Bachelor-Generation, die hier drogenbefeuert ihre Lieblingsmusik wählt, Workshops über Widerstand und Veganismus abhält und Sport, Spiel Spaß hat. „Sie wollen alle bloß jung bleiben und keine Verantwortung übernehmen,“ meint eine Kritikerin, die aber gerne dort mitmacht, u.a. als „Speaker“.
Auf den allsommerlich stattfindenden „Weltkongressen der hedonistischen Internationale“, die u.a. in „Coolmühle“ und heuer auf dem Gelände des Fusion-Festivals in Lärz/Müritz stattfanden, wurde „A-nar-chia“ gejodelt und überhaupt die staatsferne bzw. -feindliche Selbstorganisation von der Größe eines Dutzend märkischer Dörfer aufs Sinnlichste und Feinste realisiert – obwohl oder weil den etwa 1400 daran Mitwirkenden nichts ferner lag als Stress. An Vorträgen wurden Analysen rechter Organisationen, u.a. der „Identitären“, geboten sowie von der Orgform „Peng-Kollektiv“ in Wort und Bild dessen aufwändige Inszenierungen gegen üble Konzerne und Geheimdienste zur Diskussion gestellt. Dabei wurden Ähnlichkeiten mit den Aktivitäten der „Yes-Men“ und des „Bundesverbandes der Schlepper und Schleuser“ deutlich, mit denen „Peng“ irgendwie zusammenhängt. Ein bißchen auch mit „Wikipedia“, wo es heißt: „Die Hedonistische Internationale ist ein loses internationales Netzwerk aktionsorientierter linker Gruppen und Einzelpersonen. Es besteht seit 2006 und hat mehr als 30 Sektionen in Deutschland, Österreich, Italien, USA, Russland und der Schweiz.“ Diese Linken (vor dem Bachelor-, im Bachelor und nach dem Bachelor-Examen), von denen nicht wenige auf den o.e. Locations als „Neuköllner WGs“ für die Infrastruktur und Gastronomie sorgen – „ehrenamtlich“, begreifen den Hedonismus „nicht als Motor einer dumpfen, materialistischen Spaßgesellschaft, sondern als Chance zur Überwindung des Bestehenden“ und „wollen Freude, Lust, Genuss und ein selbst bestimmtes Leben in Freiheit für alle Menschen!“ sowie „fröhliches Miteinander, Anarchie, die Ideen Epikurs, bunte Freude, Sinnlichkeit, Ausschweifung, Freundschaft, Gerechtigkeit, Toleranz, Freiheit, sexuelle Freizügigkeit, Nachhaltigkeit, Friede, freien Zugang zu Information, Kunst, kosmopolitisches Dasein, eine Welt ohne Grenzen und Diskriminierung.“
Epikur? Ja der, dessen Schule einst im „Garten“ (kepos) stattfand. Auch die o.e. „Locations“ sind Gärten – voller Haine und phantastischer Architekturen, in denen Schwalben und Mauersegler brüten. In den Gebäuden der Lehrter Ziegelei nimmt ihre Brut sogar an den Workshops teil. Diese werden vom Hannoveraner „Fuchsbau“-Kollektiv, bestehend aus Kultur- und Sozialwissenschaftlerinnen, organisiert. Über ihr nächstes „Fuchsbau Festival“ dort im August schreiben sie: „Kommet zusammen, ihr digitalisierten Seelen! Wir programmieren uns gegenseitig zu Liebesmaschinen. Wir lösen uns von den Ketten unserer analogen Existenz. Ihr einsamen Menschen und gefühlvollen Cyborgs, reibt euch den Schlafsand aus den viereckigen Augen und schreitet mit uns gen technischer Utopie!“ Das ist keine Drohung und auch nicht illusionär, aber durchaus kontrovers: Nicht wenige propagieren in einer Art Wiederholungsschleife der Hippiebewegung eine eher atechnische, gar antimathematische Utopie – ich z.B., deswegen werde ich den Fuchsbau heuer links liegen lassen. Kann man ja machen!
Die NSA-Abhörstation auf dem Westberliner Teufelsberg hat beides: Gärten, Wald und Technik, u.a. zwei riesige Silos, in denen täglich zwei Tonnen Papier, das 1500 Geheimdienstmitarbeiter mit abgehörten Gesprächen im Ostblock rund um die Uhr vollschrieben, zerschreddert wurden. Dieser Siloraum ist heute einer von mehreren „Musensitzen“ der Teufelsberg-Künstler. Derzeit sind dort zwei kleine Ausstellungen zu sehen: Eine über „Women for Peace“ und eine über „Trümmerfrauen“ (auf die „Wehrtechnische Nazi-Fakultät“ hatten diese nach dem Krieg 26 Millionen Kubikmeter Trümmerschutt gekippt). Oben, auf dem Radarturm, hat man einen guten Überblick über Berlin, das wie eine einzige grüne Hölle aussieht, nur am Horizont sieht man ein paar Häuser und den winzigen Fernsehturm. Und unten kann man nackt baden.
.

Seine Scheune hat er zu einer Werkstatt für Reiseandenken ausgebaut, die man dort auch käuflich erwerben kann.
.
Revolutionsgedenken
Das Kunstmuseum im sibirischen Krasnojarsk war 1987 das letzte in der Sowjetunion errichtete Leninmuseum. Es hatte keine Originalexponate und wurde gleich als Kunst- und Kulturzentrum genutzt. Derzeit findet dort die „13. Biennale für zeitgenössische Kunst“ statt, mit finanzieller Beteiligung des Österreichischen Kulturforums und des Goethe-Instituts. Gezeigt wird revolutionäre Kunst aus der russischen Provinz. Das mußte die Russland-Korrespondentin der FAZ, Kerstin Holm, interessieren. Wie wir täglich erleben, wird ständig antikommunistisch auf amimäßige Unart und Weise Russland runtergemacht, da hat es eine engagierte Russland-Korrespondentin nicht leicht. Kerstin Holm erledigt die Russlandkritik pflichtgemäß auf den ersten Politik-Seiten, mit ihren Kürleistungen ist sie jedoch aufs Feuilleton ausgewichen und schreibt dort ellenlange Riemen über dieses und jenes russische Museum, von dem sie jedesmal hellauf begeistert ist.
Über das Krasnojarsker Leninmuseum heißt es: „Der brutalistisch fensterlose Monumentalbau am Jenissej-Ufer, der keinerlei Originalobjekte beherbergt, entschädigte sein Publikum von Anfang an durch Immersion.“ „Immersion“? „Fachsprachlich für ‚Eintauchen‚“! Holm erwähnt an Ausstellungen, die dort stattfanden: eine über den GULag, über den Zweiten Weltkrieg und den Afghanistan und Tschetschenienkrieg…Eintauchen aha! Jetzt immersierten dort die Museologen das russische Dorf und wie die Revolution dort wirkte. Dazu wurden die Künstler in die Provinz geschickt. Einige kehrten z.B. mit zwei Bortsch-Rezepten, von 1917 und 2017, zurück und die Ausstellungsbesucher dürfen diese zwei Suppen kosten: Einige „behaupten, das Borschtschrezept von 1917 sei eindeutig gehaltvoller gewesen.“ Eine Photographin kehrte mit Bildern über das Leben von Altgläubigen zurück, die sich nach der Kirchenreform im 17.Jahrhundert in die Einsamkeit zurückzogen, wo sie noch heute „ohne Geld, Technik und Medien“ leben. Eine ihrer kleinen Siedlungen am Jenissei wurde erst 1986 vom Flugzeug aus zufällig entdeckt, es gibt ein sowjetisches Buch darüber. Die Photographin mußte den Photographierten versprechen, „ihre Wohnrefugien nicht preiszugeben“. Ein anderer Künstler „huldigte“ ebenfalls der Armutskultur – des Dorfes, aus dem er kommt. Zwei Filmer dokumentierten den Maultrommel-Einsatz einer jakutischen Schamanin. Ein Künstler hat verlassene Dörfer aufgesucht, es gibt inzwischen 150.000 in Russland seit der Auflösung der Sowjetunion, vor allem in Sibirien.
Zwei Moskauer Bevölkerungswissenschaftler meinen inzwischen: Wenn die Chinesen Sibirien nicht kultivieren, dann macht das niemand. Und die Chinesen sowie die Nordkoreaner kommen auch tatsächlich. Der Künstler hat einige der Häuser in den verlassenen Dörfern angezündet und sie photographiert, „wie es revolutionäre Bauern mit den Villen ihrer geflohenen Gutsherren taten, damit sie nicht zurückkehren konnten“. Das machte auch Sinn, ich hatte mich immer gefragt: Warum haben die bloß diese tollen Gutshäuser zerstört? Die schöngeistige Kerstin Holm erinnerten diese Exponate an das Schwarze Quadrat von Malewitsch, aber auch an die heutigen „Brandbereinigungen durch Developer oder Industrieplaner“.
Die FAZ-Korrespondentin hatte zuvor auch die Moskauer Tretjakow-Galerie besucht, in der russische Kunst von 1917 gezeigt wird: eine empirisch künstlerische „Bestandsaufnahme der Umbruchszeit vor hundert Jahren. Den versammelten Bildern, die höchst unterschiedliche Stilrichtungen repräsentieren, ist gemeinsam, dass sie um jenes Schicksalsjahr herum entstanden sind.“ Auch hierbei „huldigten“ viele den Bauern, „dem schlichten Landvolk“ – einer „faltige Melkerin“, einem „strohblonden Burschen“, der „mit dräuender Heugabel posierte“…Die Ausstellung heißt „Jemand 1917“.
In Leningrad, jetzt Petersburg“, besuchte Kerstin Holm das „offiziöse Internationale Kulturforum“, dessen Schwerpunkt ebenfalls die Revolution 1917 war, was der als Moderator fungierende Historiker Lew Lurie begrüßte, denn hundert Jahre nach dem großen Umbruch hätten nun die Weißen gesiegt. Das zeigte sich kürzlich im Moskauer Bolschoi-Theater, wo unter Abwesenheit des Regisseurs Kirill Serebrennikow sein Stück „Nurejew“ Premiere hatte. Der Republikflüchtling Nurejew war der berühmteste Tänzer seit Nijinski. Im Westen reichte sein Ruhm an den der Beatles heran, wobei sich Privatleben und Auftritte vor den Reichen und Mächtigen skandalös vermischten. Er starb 1993 an Aids. Die Inszenierung versprach Einiges davon. Die SZ-Kollegin von Holm, Sonja Zekri, berichtete: „In seiner ganzen 150jährigen Geschichte hat das Bolschoi-Theater männliche Nacktheit und Homosexualität wahrscheinlich noch nie so offen gezeigt. Und dann dieser Jubel“ – diesmal der russischen Reichen und Mächtigen!
.
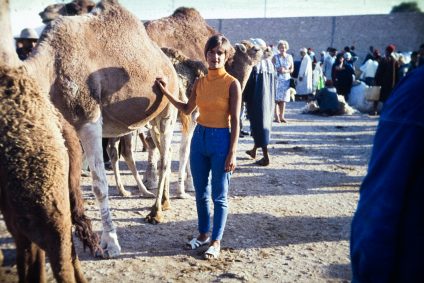
Nicht zu vergessen die Fülle pittoresker Naturerscheinungen.
.
Beruhigungsgesetze
Als der Wissenssoziologe Bruno Latour verkündete: Es gibt keine ökonomische Utopie mehr, nur noch eine ökologische, erntete er wenig Widerspruch. Und es stimmt ja auch, dass die Ökologiebewegung – inklusive Parteien, Gesetze, Verordnungen, Forschungsinstitute, Lehrstühle, NGOs, Naturschutzbeauftragte Umweltbundesamt- und -ministerien – eine enorme „Karriere“ gemacht hat. Der Soziologe Harald Welzer gibt jedoch zu bedenken: Gleichzeitig werde jedes Jahr „ein neues Weltrekordjahr im Material- und Energieverbrauch“ angezeigt.
Kann es sein, dass dieser ganze Öko-Hype bloß ein unfrommer Selbstbetrug ist? Ein Beispiel: Singvögel und Fledermäuse sind ganzjährig geschützt. Im Artenschutz-Gesetz, § 44 heißt es: „Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“ Und im neuen Tierschutzgesetz heißt es unmißverständlich – in § 17: „Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 1. ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder 2. einem Wirbeltier aus Roheit erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt.“ Darüberhinaus wurde in der Koalitionsvereinbarung festgehalten, die „Berliner Strategie der biologischen Vielfalt“ umzusetzen.
Aber all das ist faktisch ohne Bedeutung, denn alljährlich werden allein in Berlin ab dem Frühjahr zigtausende von jungen Spatzen, Stare, Meisen, Mauersegler und Fledermäuse bei Renovierung/Modernisierung und (energetischer) Sanierung von Fassaden lebendig eingemauert. Dies geschieht derzeit massenhaft in Marzahn/Hellersdorf durch die Wohnungsbaugenossenschaft „Grüne Mitte“ und in der Otto-Suhr-Siedlung Kreuzberg durch die Immobilienspekulanten von „Deutsches Wohnen“. In der entsprechenden Verordnung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt heißt es zwar: „Fortpflanzungs- oder Ruhestätten dürfen nur unter der Voraussetzung unbrauchbar gemacht oder entfernt werden, dass diese unbesetzt sind und weder Alt- noch Jungtiere oder Gelege zu Schaden kommen,“ aber kein Schwein hält sich daran. Am wenigsten die Arbeiter der Baufirmen, die einfach ihren Bauschaum in die Nester sprühen.
Und dann kommt so ein armes Starenweibchen mit Insekten für die Jungen, landet auf dem Bauschaumklumpen und kann nicht mehr zu ihnen, so dass sie dahinter fiepend verhungern. Ich habe Photos davon. Es gibt zwar einige mäßig engagierte und sowieso überforderte Gutachter, beim NABU und bei der Unteren Naturschutzbehörde, den die Baufirmen vorab einschalten sollen, damit sie die Nester markieren, aber sie übersehen die meisten, und die sie nicht übersehen, werden von den Bauarbeitern ignoriert. Außerdem wird in Berlin schier überall gebaut, und die paar Gutachter können nicht überall sein. Die Hauptstadtpresse titelte „Dramatischer Rückgang der Vogelarten“ – in ganz Deutschland. Überall wird renoviert, Fassaden energetisch abgedämmt – und so heißt es auch in einer Pressemitteilung des NABU aus Leipzig: „Drama hinter Bauschaum. Bei Gebäudesanierungen werden täglich Vogelnester zerstört. Das macht sich mehr und mehr bemerkbar, immer mehr Bürger vermissen das Stadtgrün, summende Insekten und singende Vögel – sie sind einfach nicht mehr da. Wenn die Fassade saniert und gedämmt wird, werden Einschlupfmöglichkeiten für die Tiere beseitigt. Eigentlich ist ein Ausgleich für den Verlust von Mauernischen, Ritzen und Höhlen leicht: In die Fassade können künstliche Nisthilfen problemlos integriert werden. Beim Vorhandensein geschützter Tierarten sind die Bauleute dazu sogar gesetzlich verpflichtet. Doch das wird vielfach ignoriert – oft sicherlich in Unkenntnis der Rechtslage, oft aber wohl auch mit Vorsatz und vor allem: Es wird viel zu wenig von der Naturschutzbehörde kontrolliert!“
In Berlin werden die Singvögel nicht nur in ihren Nestern an den Gebäuden vernichtet, sondern auch auf der Erde: Bevor ihre Brutsaison begann, ließen die Grünämter großzügig Hecken und Sträucher (z.B. in der Leipziger Strasse und am Gendarmenmarkt) runterschneiden und Rattengift auslegen. Ratten versteckten sich jedoch gar nicht darin, wohl aber Spatzen und Amseln – und diese fraßen dann auch das Rattengift. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Grünflächenamts Kreuzberg meinte zu der Heckenvernichtung: „Unser Amt wurde bis auf vier Mitarbeiter verkleinert. Die Arbeiten werden seitdem von Fremdfirmen erledigt – und die beschäftigen Billiglohnarbeitskräfte, die ihren Mißmut mit schwerem Gerät bekämpfen, also am Liebsten Motorsägen, Laubbläser und andere laute Gartengeräte bei ihren Aufträgen einsetzen.“ Ähnliches gilt für die Firma, deren Billiglohnsklaven das Rattengift in der Stadt verteilen.
.


.
Forschung in Postkolonien
Der französische Ethnologe Maurice Godelier studierte zunächst Planwirtschaft (für „Entwicklungsländer“), er wollte aber lieber „die Funktionsweise von realen Wirtschaftssystemen vor Ort untersuchen, und zwar nicht die der kapitalistischen Länder.“ D.h. er wollte keine Planung betreiben sondern höchstens Planungskritik – also auf Abstand gehen. Da bot sich das Studium der Sitten und Gebräuche fremder Völker geradezu an: „ökonomische Anthropologie“. Der Ethnologe von „Überbau“-Phänomenen Claude Lévy-Strauss suchte einen „Oberassistenten“ für die „Basis“, das wurde er. Später riet Lévy-Strauss ihm, nach Neuguinea zu gehen: „Das Paradies der Anthropologen ist jetzt Neuguinea“. Weil Godelier Frau und Kinder mitnehmen wollte, landete er buchstäblich in einem Dorf der Baruyas, bei denen der Gartenbau eine größere Rolle als die Jagd spielt und die deswegen weniger provisorisch siedeln. Dort ließ er von Einheimischen und einem bei der lutherischen Mission angestellten Zimmermann ein „großes Haus“ bauen. Er machte aber auch viel selber: Er stellte z.B. „Betten und Fenster aus Kunststoff“ her. Wie? das sagt er nicht in seinem Interview, das die Zeitschrift „Lettre“ in ihrer letzten Ausgabe veröffentlichte.
Die etwa 20 Baruyas, die ihm das Haus bauten, hatte er mit „Macheten, Decken und Tabak entschädigt,“ wie er sagt. So hat noch jedes Initial kapitalistischer Planwirtschaft bei indigenen Völkern der sogenannten Dritten Welt angefangen. Für viele christliche Missionaren, vor allem den amerikanischen Pfingstlern, ist das sogar ein wesentlicher Programmteil: In die Marktwirtschaft einführen. Konkret ist davon in dem darauffolgenden Lettre-Aufsatz des interessanten Ethnologen Eduardo Viveiros de Castro die Rede. Nämlich: Wie Brasiliens Indios und Indigene zu Unfreiwilligen des Vaterlands werden – um am Ende der Regierungsanstrengungen als „landlose Indios“ dazustehen. Die kapitalistische Expansion wird auch noch die letzten vernichten.
In Godeliers Baruya-Dorf ist es noch nicht so weit. Überhaupt hatte er andere Probleme: Er hatte zwar Marx, Husserl und viele andere gelesen, „aber jetzt sollte er den Beruf eines anthropologischen Feldforschers ausüben, den er bisher nur aus Büchern kannte.“ Learning by Doing! Dabei merkte er, „Distanz“ reicht nicht aus, er mußte sich „dezentrieren, um besser zu beobachten, um besser zu verstehen.“ Aber „was und wie beobachten? Wenn Beobachten in gewisser Hinsicht auch Teilnehmen bedeutet, dann stellt sich eine andere Frage: Woran, wie und wieweit teilnehmen? Beobachten heißt, anwesend zu sein, wenn etwas geschieht, das die Grundsätze, Vorstellungen und Erwartungen erhellt, von denen sich die Menschen in ihren verschiedenen Lebenskontexten leiten lassen.“
Wie weit man sich auch als Ethnologe von diesen (mit-)leiten läßt, regeln berufständische Ethiklisten und die Gesetze der Länder, in deren „Schutzgebieten“ sie forschend tätig werden. Das letztere dazu oft nicht in der Lage sind – und die Ethnologen, im Verein mit den christlichen Missionaren schon ganze indigene Völker gegeneinander gehetzt haben, enthüllte Patrick Tierney 2002 in seinem Buch „Journalisten und Wissenschaftler zerstören das Leben am Amazonas“. Die Rechercheure aus dem Westen hatten es vor allem auf die Yanumami am Orinoco angetan, die als die „gewalttätigsten Indianer“ galten und deswegen so etwas wie ein Ausgangspunkt der bürgerlichen Aggressionsforschung waren, die alle Kriege dieser Welt biologisch fundieren will. Die Yanumami, die bereits Alexander von Humboldt erwähnt, wurden in den filmischen Aufzeichnungen der Rechercheure zu Statisten, die man mit Macheten „entschädigte“.
Auch Godelier filmte bei den Baruyas – mit einer Rolleiflex, ausdrücklich lobt er die heutigen „Digitalkameras“. Dennoch meint er: Die einstige Parole der Anthropologen – von Ministerpräsident Jules Ferry „Kolonisieren heißt Zivilisieren“ gilt nicht mehr. Man findet sie jedoch etwas verklausuliert noch heute in der brasilianischen Verfassung. Zu Godeliers Filmteam gehörte neben einem Missionar sein einheimischer „Informant“ Koumaineu. Dieser drehte wenig später selber Filme „über seine eigene Gesellschaft“. Also fast ohne „Dezentrierung“. Auch Godelier machte sich auf, die eigene (französische) Gesellschaft zu erforschen. Er ließ es dabei nicht an (politischem) Engagement fehlen, u.a. setzte er sich sowohl als Bürger wie auch als Politik-Experte für „homosexuelle Familien“ ein. Die zuständige Ministerin lobte seine Argumentation, gab aber zu bedenken: „Wenn wir ihren Vorschlägen folgten, würden wir die Wahl verlieren.“ Das Humboldt-Forum zeigt derzeit an verschiedenen Berliner Orten Filme von indigenen Regisseuren.
.

Auch die exotische Flora begeisterte so manchen.

.
Dazwischen/Mittenmang
In den frühen Siebzigerjahren gab es eine Prostituierte, die am Kurfürstendamm lebte – zusammen mit einem Gepard, den sie dort frühmorgens an der Leine spazieren führte. Sie wilderte ihn gewissermaßen ein. Mehr weiß ich nicht über sie. Dafür um so mehr über die österreichische Künstlerin Joy Adamson, die ungefähr zur selben Zeit in einem kenianischen Wildschutzgebiet einen Gepard auswilderte. Sie berichtete darüber in zwei Büchern: „Die gefleckte Sphinx“ und „Abschied von Pippa“ (1974). Diese Gepardin hinterließ einige Nachkommen, die bereits „wild“ geboren wurden. Ihr Mann, George Adamson, der sich vom Großwildjäger zum Tierwächter in einem kenianischen Nationalpark entwickelte und mit ihr nacheinander in Zoos geborene Löwen, Leoparden und Geparde auswilderte, schrieb ebenfalls einen Erfahrungsbericht: „Meine Löwen – Mein Leben“. Die beiden wurden in den Achtzigerjahren ermordet.
Es gibt auch noch ein „Dazwischen“: einen Gepard, der mit den Kindern des Großwildhändlers George Munro in Kalkutta aufwuchs und dann mit drei wilden Geparden in ein Gehege des Bremer Zoos kam, den George Munro in den späten Sechzigerjahren errichtete. Er blieb zahm, aber hatte nun weder eine Wohnung mit Menschen, die sich ständig mit ihm beschäftigten, noch die Freiheit, sondern nur ein Zoogehege (40 mal 20 Meter), in dem er sich täglich mit drei fremden Geparden auseinandersetzen mußte.
„Gesetzt den Fall, schreibt die feministische US-Biologin Donna Haraway, eine Wildkatze hinterlässt Junge, die von einem Haushalt bestehend aus überqualifizierten, wissenschaftlich ausgebildeten Kriegsgegnern mittleren Alters aufgenommen werden, oder von einer Tierwohlfahrtsorganisation, die eine Ideologie zum Schutz des Wilden und Tierrechte propagiert: Wird das Tier garantiert glücklich werden? Die Wildheit bleibt doch laut Haraway unsere ganze Hoffnung,“ schreibt Elisabeth von Samsonow über Donna Haraways Buch „When Species meet“ (2008).
Die Zahmheit, um nicht zu sagen Zivilisiertheit, bleibt jedoch die ganze Hoffnung der Tiere. Wild lebend werden die Menschen sie nach und nach ausrotten. Dieses Schicksal ist auch für die letzten indigenen, autonom lebenden Völker gültig. Die vielen Tierarten, die jetzt schon vom Land in die Städte gezogen sind, versuchen gerade, sich anzupassen oder haben sich bereits angepaßt. Ansonsten bliebe ihnen nur der Zoo. Eine „Festplatte der Evolution“ hat man ihn genannt. Von dort aus stellt sich für ihre Nachkommen das zootechnische Problem: Wohin damit? Wenn alle „Festplatten“ voll, neue zu teuer sind, und es kein „wildes Land“ mehr für sie gibt. Im übrigen werden auch die ganzen „Nationalparks“ und sonstigen Schutzgebiete „bewirtschaftet“, d.h. die Tiere werden ab einer bestimmten Anzahl erschossen. Einige afrikanische Nationalparks haben eigene Schlachthöfe – und Souvenirshops, in denen man Geweihe, Felle und Pelzmäntel kaufen kann.
Die zivilisatorische Leistung besteht aus einem friedlichen Nebeneinanderleben – wobei die Städter sozusagen die Leitkultur vorgeben. Wohl den Tieren, die in eine menschliche Umgebung gedrängt werden, die ihnen von vorneherein halbwegs wohlgesonnen ist. Das ist in vielen Teilen Burmas und Indiens der Fall. So gibt es z.B. bei Bombay ein Dorf namens Akole, in dessen näherer Umgebung ein Dutzend Leoparden lebt – und die Dorfbewohern wollen, dass das auch so bleibt. Es gibt darüber einen wissenschaftlichen Bericht, den das Norwegian Institute for Nature Research im Internet veröffentlichte, er heißt: „The Whagoba Tales“.
Aber die Debatte darüber wird nicht in Skandinavien, sondern vor allem in Indien geführt, wo man traditionell (buddhistisch gesonnen) ganz anders mit wilden und erst recht mit nicht so wilden Tieren umgeht. Das gilt z.T. auch umgekehrt für die Tiere, die dort ganz anders mit den Menschen umgehen als die hiesigen. Die renommierte „Times of India“ schrieb: „Die meisten Leute wissen nicht, aber eine neue Studie zeigt es, dass eine große Zahl von Leoparden unerkannt in von Menschen dominierten Gegenden lebt.“
Auf der indischen Plattform „downtoearth.org.in“ wurde unter der Überschrift „Die Leoparden in meinem Hinterhof“ noch einmal das Akole-Beispiel hervorgehoben und daran erinnert, dass Leoparden quasi schon immer an den Rändern menschlicher Siedlungen gelebt hätten. Heute – in Akole, wie in jedem anderen Dorf des Maharashta Zuckeranbaugebiets – gäbe es keinen Wald mehr, sondern nur noch ein Mosaik von Äckern, was den Leoparden um so mehr den Dörfern nahe bringe. Im übrigen hätte man deswegen auch einigen Grund zum Stolz, denn Indien sei „das einzige Land weltweit, in dem die Menschen und ihr Vieh in nächster Nähe zu Raubtieren leben.“ Wir können das hier ja schon mal mit Hauskatzen üben.
.

Das Meer war angenehm temperiert, aber zum Baden reichte die Zeit nicht, denn schon rief uns die Schiffssirene an Bord zurück.
.
Zu viele Dinge?
Hannah Arendt schrieb: „Gegenstände sind die eigentlich menschliche Heimat des Menschen.“ Die Schriftstellerin Tina Stroheker hat einigen in ihrem Buch „Inventarium“ eine späte Huldigung nachgetragen. Dazu heißt es: „Für die Autorin gilt, was Mallarmé einmal befand: ‚Alles in der Welt ist dazu da, in einem Buch zu landen.“ Bücher sind natürlich auch Gegenstände, und basieren wie fast alles um uns herum auf Mathematik, insofern sie industriell hergestellt sind. Für viele (auch für mich) sind sie sogar „die eigentlich menschliche Heimat“. Es gibt jedoch immerhin noch einige Menschen, die darin einen erheblichen Verlust an Menschlichkeit sehen. Ein Indianerhäuptling, der als Bremser auf einer Strecke der Union Pacific arbeitete, sollte einmal von einem deutschen Ethnologen interviewt werden, er verwies ihn jedoch an die Nationalbibliothek in Washington: „Dort steht alles über die Indianer!“ Heute gibt es in den USA eine spezielle „First Nations“- Bibliothek, auch in Kanada, wo ein kanadischer Indianer einmal zu einem Ethnologen, der ihn über die Büffeljagd ausfragte, meinte: „Unsere Vorfahren haben die Tiere geheiratet, sie haben ihre Lebensweise kennengelernt, und sie haben diese Kenntnisse von Generation zu Generation weitergegeben. Die Weißen schreiben alles in ein Buch, um es nicht zu vergessen.“
Die Designforscherin Dagmar Steffen erwähnt in ihrem Buch „Welche Dinge braucht der Mensch“ (1995), dass der durchschnittliche BRDler 10.000 Gegenstände besitzt, bei den Massai sind es 30. So lange die Indianer der beiden Amerikas noch nicht gänzlich von den Weißen unterworfen waren, gab es vom 17. bis zum 19. Jahrhundert massenhaft „kulturelle Überläufer: White Indians‘“, die „ihre“ Gesellschaft ablehnten. Der Journalist Patrick Tierney berichtet in seinem Buch „Verrat am Paradies: Journalisten und Wissenschaftler zerstören das Leben am Amazonas“ (2002) von einer Yanomami-Indianerin, Yarima, die umgekehrt zu den Weißen ging, indem sie den Ethnologen Kenneth Good heiratete und mit ihm nach New Jersey zog, wo sie als Hausfrau mit drei Kindern in einem Reihenhaus lebte. Ihr Ehemann verschaffte sich „durch die Heirat mit ihr einen einzigartigen Zugang zur Gesellschaft der Yanomami“. Seine Frau verließ ihn und ihre Kinder jedoch nach einigen Jahren – und ging zurück an den Orinoko. Sie hielt es in den USA nicht aus: „Das einzige, was sie lieben, sind Fernsehen und Einkaufszentren. Das ist doch kein Leben“, erklärte sie Patrick Tierney, dem sie gestand, dass sie inzwischen sogar wieder das Zählen verlernt habe, und dass sie ihren Mann in New Jersey als zu wenig kriegerisch empfand.
Aus dem 17.Jahrhundert stammt ein Bericht des Genfer Geistlichen Jean de Léry, der zu den Tupi-Indianern überlief, diese lebten in der Umgebung der heutigen Stadt Rio de Janeiro – damals ein französisches Fort, aus dessen Wachregiment sich ebenfalls einige mit indianischen Frauen liierten und fortan als „Wilde“ lebten. Dies galt auch für den deutschen Ethnologen Curt Unckel, der um 1900 zu den Guarani von Sao Paulo gekommen war. Er hatte Kinder mit einer ihrer Frauen und bekam von ihnen den Namen Nimuendaju. Der Bauer Hector St. John de Crèvecoeur schrieb 1782 in seinen „Letters from an American Farmer“: „In ihrer [der Indianer] sozialen Bindung muß etwas ungewöhnlich Fesselndes liegen, das allem, dessen wir uns rühmen können, weit überlegen ist: denn Tausende von Europäern sind Indianer geworden, aber wir kennen kein Beispiel, dass auch nur ein einziger Eingeborener freiwillig Europäer geworden wäre.“
Dieses Zitat entnahm ich einen Beitrag des Ethnologen Marin Trenk in einem Katalog zum „Priber Sommer 2016“ in Zittau. Es ging dabei um den Juristen Christian Gottlieb Priber, der 1734 Frau und Kinder in Zittau verlassen und sich in Amerika den Cherokee angeschlossen hatte. Er heiratete eine Squaw und beriet die Indianer bei Landverhandlungen mit den Franzosen und Engländern. Und das so erfolgreich, dass letztere ihn einfingen und ins Gefängnis steckten, wo sie ihn sterben ließen, auch sein Buch „Kingdom Paradise“ vernichteten sie. Die Görlitzer Germanistin Ursula Naumann hat ihm schon 2001 ein aufwändig recherchiertes Buch gewidmet: „Pribers Paradies. Ein deutscher Utopist in der amerikanischen Wildnis“.
.

Wo immer man hinkommt stößt man auf deutsche Architekturen. Da wird einem ganz heimatlich zumute.

Das war auch auf dem Kindergeburtstag in der deutschen Schule von Athen der Fall, wo man das „Happy Birthday“ mit norddeutschem Zungenschlag sang.

Und ebenso auf der beeindruckenden Ausstellung eines deutschen Künstlers in Piräus.
.
Restitution
Während es in einigen Teilen Afrikas immer noch um die Restitution von riesigen weißen Farmländereien und Plantagen an die einheimische Bevölkerung geht, bemühen sich diese zugleich um eine Rückgabe der von ihren Vorfahren geraubten Kultgegenstände, die sich bis heute in vielen europäischen und amerikanischen Museen befinden. Ihre diesbezüglichen Bemühungen dienen auch der Identitätsfindung und -absicherung, denn die massenhaft deportierten, umgesiedelten und vermischten Volksstämme müssen ihre Anrechte auf bestimmte Ländereien quasi kollektiv nachweisen. Ähnliches gilt z.B. auch für einige nordamerikanische Indianerstämme, die sich erst alte Wasserreste erstritten und nun ihr Reservat wieder ausdehnen wollen (auf den von der Holzindustrie ausgebeuteten Waldruinen), um dort zu ihrer „traditionellen Lebensweise“ zurückzufinden. Auch ihre Kunst- und Kultgegenstände befinden sich heute vielfach in Museen. Man kann darauf so souverän reagieren wie die Polen auf das deutsche Ansinnen, die in Poznan und Krakau liegenden Teile des deutschen Staatsarchivs zurückzubekommen – sie erwiderten: Ihr könnt doch jederzeit Einsicht in die Archive nehmen. Unser halbes Staatsarchiv liegt, von den Schweden konfisziert, seit 300 Jahren in Uppsala und so lange fahren die polnischen Historiker auch dort hin.
Bei den Kunst- und Kultgegenständen, bis hin zu ganzen Booten und Hütten, handelt es sich jedoch um solche zur Vergewisserung der eigenen Volksgeschichte. Die meiste Aufregung gab es bei den Exponaten, die aus Menschenteilen bestanden: Schädel, Skelette, Schamlippen und ganze ausgestopfte Afrikaner. Sie wurden nach internationalen Protesten in ihre vermeintlich alte Heimat zurückgeschickt und dort mit Staatsbegräbnissen beigesetzt. Zwei ausgestopfte Afrikaner, die im Besitz von zwei deutschen Apothekern waren, blieben verschwunden. Über einen dritten, ein etwa 27jähriger Buschmann, der bis zu seiner Restituierung zu den wichtigsten Exponaten des kleinen spanischen Museums von Banyoles gehörte, schrieb der holländische Schriftsteller Frank Westerman ein Buch: „El Negro. Eine verstörende Begegnung“ (2005). Initiiert wurde die Rückgabe von einem in Spanien lebenden Haitianer, woraus eine regelrechte politische Bewegung entstand, aber auch eine Gegenbewegung: in Bayoles selbst, wo man „El Negro“ partout behalten wollte. Es gab Anstecker und Autosticker mit seinem Konterfei.
Während die französischen Museen sich langsam ihrer Schätze aus den einstigen Kolonien entledigen, bleibt man in England cool. In Frankreich kam es zu einer weitgreifenden Debatte darüber. Dabei ging es 1. um den möglicherweise rechtmäßigen Erwerb der Gegenstände und 2. um die Rechtmäßigkeit, Kultgegenstände fremder Völker als Kunstgegenstände sich gewissermaßen einzuverleiben. So hatte der Ethnologe Lévi-Strauss z.B. scharf kritisiert, dass man die beeindruckensten Stücke der Pariser Ethnologischen Museen in einem Flügel des Louvre zeigte – und zwar so präsentiert wie die sonstigen Kunstgegenstände dort. Sie wurden dadurch verwandelt. Das selbe Problem und die selbe Debatte schwillt nun auch hier langsam an, forciert vor allem durch das Humboldt-Forum in dem mit Beton wiederhergestellten Berliner Schloß, in das die ethnologische Sammlung der Stadt, die sich bisher im Dahlemer Museum befand, einzieht. Dabei handelt es sich um etwa 500.000 Objekte und 1.000 Schädel beziehungsweise Knochen vorwiegend von Ostafrikanern. Wollte man die und das alles auf eine saubere Herkunft prüfen, und dabei wohlmöglich noch fragwürdige Begehren weckt, hätte das akademische Proletariat in der Stadt eine Daueranstellung.
Selbst die gesichertsten Umstände des Erwerbs dieser Exponate erweisen sich als fragwürdig, wenn man eine gründliche Neuuntersuchung, geschult diesmal an den „Postcolonial Studies“, den „Critical Whiteness Studies“ und den „Gender Studies“, vornehmen müßte. Beim kostbaren Perlenthron aus Kamerun z.B., den der Sultan von Bamun dem Berliner Häuptling Wilhelm II. „schenkte“ (die „Berliner Zeitung“ schrieb dieses Wort bereits in Anführungsstrichen), ist man sich unsicher, ob nicht Zwang dahinterstand. Die Deutschen hatten nach 1884 auf ihrem Unterwerfungsfeldzug durch das Land „etliche Ethnien massakriert, Dörfer verwüstet und Überlebende zur Sklavenarbeit verpflichtet“. Um seinem Sultanat dieses Schicksal zu ersparen, stellte Ibrahim Njoya den Deutschen Soldaten für ihre „Strafexpeditionen“ zur Verfügung und trennte sich von seinem Thron, wobei er ein entsprechendes Gegengeschenk von Wilhelm II. erwartete. Er bekam jedoch nur eine Kürassieruniform und ein Orchestrion.
Unter dem Aspekt des Warentauschs, bei dem es um Äquivalente geht, ein zumindest fragwürdiger Deal. Da der Sultan zudem unter Druck stand, liegt ein Vergleich mit den „preisgünstigen“ Arisierungen von jüdischem Eigentum nahe. Unter dem Aspekt des Geschenketauschs, der nur die Verpflichtung zur Erwiderung der empfangenen Geschenks beinhaltet, ginge dieser asymmetrische Austausch aber eventuell in Ordnung. Das müßte man jedoch noch mal genau prüfen – ob es ein Waren- oder ein Gabentausch war.
.

Auf einem der vielen bunten Märkte deckten wir uns äußerst preisgünstig mit edlen Stoffen ein.
.
Marktwirtschaftlich umzingelt
»Der letzte Herr des Waldes« heißt ein neues Buch von Thomas Fischermann, dem Brasilien-Korrespondenten der Zeit, in dem er Madarejúwa, einen »jungen Krieger« aus dem Amazonasbecken, zu Wort kommen lässt. Er erzählt von der »Zerstörung seiner Heimat und den Geistern des Urwalds«. Er gehört zum Volk der Tenharim, dem nur noch 1.000 Menschen angehören. Früher waren es einmal 10.000.
Das Verschwinden der großen tropischen Urwälder und von deren Bewohnern geht uns direkt etwas an, insofern die Zerstörung dieser Sauerstoff produzierenden »grünen Lungen« des Planeten die ganze Erdatmosphäre verändert. Der Biophysiker und »Gaia«-Theoretiker James Lovelock zählt die Motorsäge inzwischen zu den drei schlimmsten Übeln der modernen Zivilisation.
Diese Wälder und die »Reservate« der etwa 600 noch existierenden indigenen Völker des Amazonasgebiets, die jeweils zwischen 10 und 1.000 Menschen umfassen, sind umzingelt von Holzfällern, Goldsuchern, Ölkonzerngeologen, Staudammprojektierern, Missionaren, Landlosen, Agenten der Indianerschutzbehörde (FUNAI), gelegentlich der Bundespolizei und einer wachsenden Zahl von Touristen.
Jährlich werden mehrere Millionen Bäume gefällt, Straßen angelegt, Bergwerke und Siedlungen errichtet. Madarejúwa erzählt davon, wie der brasilianische Kapitalismus auf sein Herz zielt: Natürlich kann er Mopeds, Handys, Facebook und anderen »westlichen Werten« etwas abgewinnen, »aber wo kriegt man das Geld dafür her?« Einer seiner Häuptlinge ist Lkw-Fahrer und stellt im Auftrag der FUNAI die Verbindung zwischen den Tenharim-Siedlungen und der Stadt her. Die größte dieser Siedlungen liegt direkt an der Transamazônica-Trasse.
In seinem kleinen Volk existieren unterschiedliche Vorstellungen über den Widerstand gegen die Zwangsintegration in marktwirtschaftliche Verhältnisse. Die Radikalsten haben sich schon in den siebziger Jahren in den Wald zurückgezogen, z. T. sind sie auch einfach vor den Bulldozern geflüchtet, sie leben nomadisch und vermeiden jeden Kontakt zu den Weißen, auch zu den anderen Tenharim, man nennt sie »Isolados«.
Die auf ihrem Land lebenden Tenharim werden vom Staat mehr schlecht als recht alimentiert. Gleichzeitig macht sich ein Heer von Stiftungen, Experten, Ethnologen, NGOs und Journalisten auf, um die »letzten Krieger« zu beraten, wie sie ökonomisch, aber auch ökologisch denken und handeln könnten, was meist darauf hinausläuft, dass sie sich im Ökotourismusgeschäft selbst vermarkten sollen, einschließlich ihrer kunsthandwerklichen Produkte. Darüber hat 2002 der Journalist Patrick Tierney in seinem Buch »Verrat am Paradies: Journalisten und Wissenschaftler zerstören das Leben am Amazonas« berichtet.
Die Tenharim haben auch schon mal zur Selbsthilfe gegriffen und auf der Transamazônica »fliegende Zollstationen« errichtet, um alle Lkws und Pkws zur Kasse zu bitten. Die FUNAI verbietet ihnen, auf Reservatsland kommerzielle Landwirtschaft zu betreiben. Die Konflikte zwischen den Bewohnern der illegalen Siedlungen der Holzfäller, Viehzüchter und Sojabauern werden zuweilen blutig ausgetragen und Intellektuelle, die sich auf Seiten der Indigenen besonders engagieren, teilweise umgebracht.
Der Zeit-Journalist Fischermann begleitete Madarejúwa in den Wald und auf dem Fluss. Dort wusste der junge Krieger auf alles eine Antwort, kannte alle Tiere und Pflanzen. Fischermann hat sie mit Hilfe eines Botanikers in die lateinischen Namen übersetzt, für einige gab es jedoch noch gar keine. Der Urwald ist also noch nicht gänzlich durchforscht.
Die Tenharim verarbeiten einige Früchte des Waldes zu Ölen, die sich – ebenso wie Baumsaatgut – verkaufen lassen, auch an eine nachhaltige Holzproduktion wurde schon gedacht. Es gibt bereits einige, die sich in ihrer Not als Holzfäller verdingt haben. Andere sind in die Stadt gezogen. Überfälle von antiindianisch eingestellten Weißen werden von ihnen auf Video dokumentiert.
Schon früher wurde über die Tenharim berichtet, beispielsweise im Bumerang, einer »Zeitschrift für gefährdete Kulturen«, die die Biologin und Liedermacherin Hannelore Gilsenbach von 1992 bis 2010 herausgab. Heute hat einer ihrer Mitarbeiter, der mit einer Schamanin und Ärztin verheiratet ist, eine Anlaufstelle für Rat und Tat bei Erwerbsproblemen für die Tenharim und einige andere Völker in ihrer Nachbarschaft geschaffen. Über all diese Berichte ist mir dieses kleine Urwaldvolk witzigerweise näher als z. B. die Bremer, wo ich herkomme, gerückt. Zumal ihr Wald-Land-Fluss-Denken den hehrsten Ansprüchen gerecht wird.
.

Danach ließen wir uns an Ort und Stelle noch zu einem Glücksspiel hinreißen.
.
Auf Transport
Ich arbeitete einmal im Bremer Tierpark, der einem indischen Großtierhändler gehörte, George Munro, er belieferte die Ost- und westeuropäischen Zoos. Einen seiner vier Elefanten verkaufte er an den Ostberliner Tierpark. Das Geschäft wurde über Verrechnungseinheiten abgewickelt – so kostete ein indischer Elefant z.B. zwei sibirische Tiger, die in Leipzig gezüchtet worden waren. Ich sollte den Elefanten hinbringen, d.h zusammen mit einem der indischen Pfleger, Cholaf, in einem Güterwaggon begleiten. Normalerweise wird bei so einem Elefantentransport (und die Elefanten, besonders die Bullen, sind laufend unterwegs von einem Zoo zum anderen) ein Mordsauswand betrieben – mit Veterinär, Sicherheitskräften, qualifizierten Pflegern und Generalproben, aber die Inder gehen lockerer mit Elefanten um, Cholaf und ich hatten noch nie etwas mit Elefanten zu tun gehabt und wir gingen davon aus, dass wir vielleicht einen halben Tag brauchten.
Der Elefant ließ sich willig auf einen LKW verladen und anschließend in einen auf dem Güterbahnhof stehenden geräumigen Waggon führen, wo man ihn ankettete. Ich einer Ecke wurde Heu und Stroh gestapelt. Kurz vor Abfahrt erfuhr ich von einem Bahnbeamten, dass die Fahrt fast drei Tage dauern würde: zu spät, ich hatte nur ein paar Schokoriegel mit. Der Chef drückte mir ein paar hundert Mark in die Hand – aber wo sollte ich die unterwegs, ausgeben? Der Güterzug hielt alle paar Kilometer, weil er einen Personenzug vorbeilassen mußte oder umrangiert wurde. Einige Waggons hängte man ab, andere wurden angekoppelt. Bei jedem Halt versuchte ich mit einem Eimer frisches Wasser für den Elefanten zu besorgen, wobei ich ständig befürchten mußte, unseren Waggon nicht mehr wieder zu finden – sie wurden ständig umrangiert. Cholaf blieb die ganze Zeit im Waggon. Noch schwieriger als das Wasserholen gestaltet sich das Essenbesorgen.
Wenn der Lokführer und sein Assisstent uns nicht mehrmals mit ihren von zu Hause mitgebrachten Butterbroten ausgeholfen hätten, wären wir fast verhungert. Wir schliefen neben dem Elefanten auf Heu und wuschen uns die ganze Zeit nicht. An der DDR-Grenze wechselten die Zugführer. Bevor es weiter ging, besuchten die neuen uns erst einmal im Waggon. Dann luden sie mich auf ihre Lok ein. Beim nächsten Halt stieg ich zu ihnen. Mit Cholaf konnte ich mich so gut wie gar nicht unterhalten und zu lesen hatte ich auch nichts mitgenommen. Der Lokomotivführer tauschte seine Zigaretten gegen meine. Er erzählte mir lustige DDR- und Reichsbahn- Geschichten. Die Fahrt zehrte an meinen Nerven, außerdem stellte ich mir unsere Nahrungsmittelversorgung in der DDR noch schwieriger vor als im Westen, nicht einmal Ostgeld besaß ich. Der Lokomotivführer tauschte mir fünfzig DM zum „Freundschaftskurs“ von 1:1 ein.
Bei einem Rangierpunkt wurden drei Waggons mit Pferden an unseren Waggon gehängt. Sie waren ebenfalls für den Tierpark bestimmt – für die Raubtiere. Die etwa 60 Pferde, Maultiere und Esel wurden auf ihrer letzten Fahrt von einem alten Mann begleitet, der seine Tiere, die er zuvor überall in der DDR eingesammelt hatte, noch einmal ordentlich verwöhnte: sie bekamen Heu und Hafer so viel sie wollten und standen buchstäblich bis zum Bauch im Stroh. Unsere Waggons sollten am Bahnhof Lichtenberg ankommen, von dort wollte man uns mit Lastwagen abholen. Kurz vor Berlin gerieten wir jedoch bei einem neuerlichen Rangiergeschehen an die falsche Lok und fuhren in Richtung Norden. Hinter Oranienburg gelang es mir, den Lokomotivführer von der Fehlzusammenstellung seines Zuges zu überzeugen. Beim nächsten Halt wurden Pferde und Elefanten abgekoppelt und wir mußten erneut endlos warten, wieder und wieder wurden wir umrangiert. Dem alten Pferdebegleiter war es egal: „So leben meine Tiere noch eine Weile länger,” meinte er.
Schließlich setzte sich der Güterzug aber doch in Richtung Bahnhof Lichtenberg in Bewegung. Ich stieg bei dem bärtigen alten Mann in den Pferde-Waggon. Weil er schon seit Jahren so unterwegs war, hatte er es weitaus gemütlicher als wir in unserem Elefanten-Waggon. Seine drei Waggons hatten elektrisches Licht, während es in unserem völlig dunkel war, so daß wir die Waggontür immer ein bißchen offen ließen, wodurch jedoch die Kälte hereinkam. Außerdem waren Cholaf und der Elefant so gut wie stumm. Manchmal machten sie den Eindruck, als hätte man gemeinerweise zwei völlig unschuldige Inder auf den Weg nach Sibirien geschickt. Ich war mir fast sicher, daß die beiden ihr Schicksal inzwischen bedauerten. Cholaf wurde immer dunkelhäutiger im Gesicht und der Elefant immer blasser, fragend wiegte er seinen Kopf hin und her. Wir verstanden uns, konnten aber nur wenig mehr füreinander tun, als weiter höflich und freundlich zueinander zu sein. Als wir am nächsten Morgen den Elefant sozusagen offiziell übergaben – im Büro, bot uns die Tierparkleitung an, zwei Tage länger als geplant zu bleiben, damit wir uns erholen konnten. Auf die Weise lernte ich auch noch Einiges von Ostberlin kennen – allerdings nur den Tierpark, aber der war damals noch der weltweit größte.
.

Am letzten Tag hat man das Hauptrestaurant unter Deck festlich geschmückt und die halbe Crew tanzte ausgelassen mit den Passagieren.
.
Bildet Banden!
Der Bandenforscher Patrick Deville beschäftigte sich u.a. mit der Pariser „Pasteur-Bande“, die überall auf der Welt die Erreger von Seuchen „entdeckte“ und Gegenmittel erprobte. Ihr Gegenspieler war die „Kochbande“. Während erstere den Pest-Bazillus in Hongkong isolierte, fand letztere den Ansteckungsmechanismus des Cholera-Erregers in Kalkutta heraus. Mit ihnen entstand die Mikrobiologie. Devilles Buch „Pest und Cholera“ (2013) konzentriert sich auf die Männer um Louis Pasteur und dort auf Émile Yersin, der sich nach Entdeckung des Pest-Erregers in dem vietnamesischen Fischerdorf Nha Trang niederließ, wo er sich mit Viehzucht und Ackerbau, den Gezeiten und der Astronomie befaßte, Straßen baute und Krankenhäuser errichtete. Die Armen behandelte er umsonst, denn sich von ihnen bezahlen zu lassen, hieße den Patienten zu erpressen: „Geld oder Leben?“ Yersin starb 1943, noch heute wird dort sein Andenken hoch gehalten.
In seinem Buch „Viva“ (2017) geht es Deville um die „Mexiko-Bande“: die kleine Gruppe um den Maler Diego Rivera, die Künstlerin Frida Kahlo und den Revolutionär Leo Trotzki mit seiner Frau Natalia Iwanowna, einer Botanikerin. Drumherum gibt es nicht nur weitere „Muralisten“ wie Rivera, die sich bald in „Stalinisten“ und „Trotzkisten“ spalten und bekämpfen, sondern auch etliche berühmte Flüchtlinge aus Europa: der anarchistische Schriftsteller Ret Marut (B.Traven) und der anarchistische Boxer und Schriftsteller Artur Cravan, der Trotzki auf einer Schiffsreise kennengelernt hatte. Später kam noch der Surrealist André Breton dazu, mit dem Trotzki ein Manifest der revolutionären Künstler verfaßte. Deville hat noch Malcolm Lowry mit in seine zehnjährige Mexiko-Recherche aufgenommen, der in seinem Buch „Unter dem Vulkan“ dieser „Mexiko-Bande“ atmosphärisch mit viel Alkohol nachspürte.
In seinem Buch „Äquatoria“ (2013) setzt Deville die „Brazza-Bande“ gegen die „Stanley-Bande“ – beide Erforscher des Kongos und seiner Nebenflüsse. Patrick Deville ist ebenfalls „ein akribischer Quellenforscher und grosser Reisender,“ schreibt die Neue Zürcher Zeitung. Pietro Savorgnan de Brazza (1852–1905) gab sein Familienvermögen aus, um Sklaven zu befreien. Während der Journalist Henry Morton Stanley den Kongo für den belgischen König erschloß. Um die beiden tummelten sich noch etliche andere Eroberer und Idealisten: David Livingstone, Albert Schweitzer und Ferdinand Céline, der Sklaven- und Elfenbeinhändler Tippu Tip und der Revolutionär Che Guevara. „Reale und fiktive Reisen von Joseph Conrad, Pierre Loti und Jules Verne ergänzen den Reigen,“ schreibt die NZZ.
Erwähnt sei noch Devilles viertes auf Deutsch vorliegendes Buch „Kampuchea“ (2015). „Alexandre Henri Mouhot (1826-1861), französischer Forschungsreisender und Naturalist, die Botanisiertrommel umgehängt, das Schmetterlingsnetz in der Hand, hascht nach einem Sommervogel, stößt sich dabei den Kopf, hebt verblüfft die Augen und steht unverhofft vor den Tempeln von Angkor.“ Im Klappentext heißt es weiter: „Wir schreiben das Jahr 1860, das Jahr null dieser Erzählung,“ die bis zu André Malraux, König Sihanouk und Pol Pot reicht. Der NZZ-Rezensentin gefiel Devilles „packender Zickzack-Kurs“ auf dem Weg durch Indochina, „frei von Dogmen und Illusionen, voller Empathie und Melancholie“. Deville war dabei, als einige Kader der einstigen „Kambodscha-Bande“, der Roten Khmer, sich vor Gericht verantworten mußten.
Sein Insistieren auf Bandenforschung soll dem Hang entgegenwirken, die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte überzubewerten. Dazu ist Patrick Deville (geb. 1957) ein französischer Autor, der die Pariser Philosophen kennt. So z.B. die Werke von Gilles Deleuze und Felix Guattari und ihre Theorie des Werdens: Dabei handelt es sich immer um ein Plural – um Schwärme, Meuten, Banden… Und diese bilden sich durch “Ansteckung”. Ist das auch noch der „Pasteur-Bande“ geschuldet? Über das “Werden” generell führen D&G aus: Es gehöre „immer einer anderen Ordnung als der der Abstammung an. Es kommt durch Bündnisse zustande…Werden besteht gewiß nicht darin, etwas nachzuahmen oder sich mit etwas zu identifizieren; es ist auch kein Regredieren-Progredieren mehr; es bedeutet nicht mehr, zu korrespondieren oder korrepondierende Beziehungen herzustellen; und es bedeutet auch nicht mehr, zu produzieren, eine Abstammung zu produzieren oder durch Abstammung zu produzieren. Werden ist ein Verb, das eine eigene Konsistenz hat; es läßt sich auf nichts zurückführen und führt uns weder dahin, ‘zu scheinen’ noch ‘zu sein’. Das Werden ist eine Vermehrung, die durch Ansteckung geschieht.“ So wie beim Vampir – der sich ja auch nicht fortpflanzt, sondern ansteckt.
.

Der Soziotop-Analyst Michael Rutschky war zwar nicht mit dabei, aber wir gedachten seiner unterwegs quasi zwangsläufig.
.
Normal!
In dem Dokumentarfilm „Jarmark Europa“ geht es um zwei Minskerinnen, die eine pensionierte Ärztin und eine Musiklehrerin. Sie fahren regelmäßig mit dem Zug nach Warschau auf den Basar im Nationalstadion, dem nach Übernahme des Kapitalismus größten Arbeitgeber Polens. Die eine verkauft dort Uhren aus der von der neuen Marktwirtschaft gebeutelten Uhrenfabrik ihrer Heimatstadt Pensa, die andere russische Bücher, die sie sich vorher in Minsk auf einem nächtlichen Bücherbasar besorgt. Ihre Gewinne sind minimal: etwa 40 Euro pro Tour.
Wie sie machen das tausende aus ganz Osteuropa auf dem „Jarmark Europa“, ebenso auf den tausend anderen Basaren, die dort in den Neunzigerjahren entstanden. Aus Brettern auf Steinen wurden dort erst Verkaufstische mit Überdachung und dann regelrechte Boutiquen – auf dem „Polenmarkt“ in Leknica (am Fürst-Pückler-Park) zum Beispiel. Auf dem Warschauer „Jarmark Europa“ traf ich einmal zwei Georgierinnen, die ein paar Lorbeerblätter verkauften. Das war dann doch erschütternd, eher befremdend wirkte dagegen ein Kurde, der auf einem Berliner „Flohmarkt“ vier rostige Wolfsfallen verkaufen wollte. Für all diese Handelsreisenden mit mehr oder weniger Geschäftssinn fand man den Begriff „Ameisenhandel“. Er erstreckte sich geographisch über den großen „chinesischen Markt“ in Budapest (auch darüber gibt es einen Dokumentarfilm) bis nach Wladiwostok, wo der Hauptstrom sich jedoch in die andere Richtung bewegt: bis nach Pusan in Südkorea, wo die „Russen“ (d.h. alle europäisch aussehenden „Ameisen“) eine eigene Einkaufsstraße haben. Soziologisch werden dazu auch die vietnamesischen Zigarettenhändler in Berlin gezählt.
Die „Sänger der Marktwirtschaft“ fanden nur lobende Worte für dieses mühsame Geschäft – der Slawist Karl Schlögel in der FAZ beispielsweise: „Hunderttausende lernen dabei im Westen, daß man „‘normal‘ leben und die Früchte seiner Arbeit genießen kann“. Auf diese Weise werden die Marktbesuche ihnen zu „Schulen des Lebens“, d.h. wenn man ein Leben „im Sog und im Schatten des Basars“ führt, werden „nicht Institutionen ausgewechselt, sondern eine ganze Lebensform“. Diese ist zwar nicht mehr geplant – wie im Kommunismus, sie hat dennoch eine, wenn auch schwer erkennbare „Ratio“: Sie wird nämlich gelenkt von einer „unsichtbaren Hand“ (der Marktwirtschaft selbst), die „nicht nur stärker als die Faust jedes noch so mächtigen Diktators ist, sondern auch effizienter“, denn sie setzt sich aus der „kollektiven Intelligenz Tausender von Menschen“ zusammen.
Ist das die berühmte „Schwarmintelligenz“, über die Eva Horn ein ganzes Buch veröffentlicht hat? Egal, die Ameisen lernen bei diesem nomadischen Handeln, wenn der sie bis in den Westen abtreibt, „dass man ’normal’…leben kann“.
1997 erschien ein Buch der Pirnaer Lokalredaktionsleiterin der Sächsischen Zeitung, Heike Sabel mit dem Titel „Normalno“, in dem sie zehn Frauen aus Minsk porträtierte. Über eine heißt es: „Bei Swetlana (40) ist immer alles ’normalno“. Egal, ob die fünfjährige Tochter mal wieder die Schränke ausgeräumt hat, ob sie ewig auf den Bus warten muß, ob es der Mutter nicht gut geht, das Auto kaputt ist…“ Heike Sabel sieht in Swetlanas „normalno“ ihre Lebensphilosophie aufscheinen. Nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl zog Swetlana, die damals als Kindergärtnerin nur 47 Kilometer entfernt davon lebte, nach Minsk, wo sie in einem Neubauviertel für Tschernobyl-Evakuierte wohnt und als „Dispatcherin“ in der Hausverwaltung arbeitet. Dass sie damit mehr Geld verdient als Kindergärtnerinnen und sogar mehr als Hochschullehrer, findet sie auch „normalno“.
In einem oberhessischen Nachtclub, in Schotten, trat in den Achtzigerjahren eine brasilianische Tänzerin auf, die aus Lyon kam und gerne Geschichten erzählte: Dass Maria sich von ihrem Freund getrennt hat und der daraufhin durchgedreht ist, dass sie ihre Mutter schon seit sechs Jahren nicht mehr gesehen hat, dass der Laden zur Zeit nicht so gut läuft usw. So wie man hier und jetzt ständig seine Ausführungen mit einem „Genau!“ abschließt, sagte sie damals ständig „c’ést normal eh!? Auch eine wirklich krasse Geschichte endete bei ihr mit der Versicherung: „Ist doch normal!“
Der Literaturwissenschaftler Niels Werber eröffnete seine Studie über „Ameisengesellschaften“ (2013) mit einem Dialog zwischen dem ehemaligen „Disney“-Chef Michael Eisner und dem „Microsoft“-Gründer Bill Gates, die in einer Episode der US-Zeichentrickserie „Family Guy“ mit einem Jet-Pack über eine Großstadt fliegen: „Die Leute sehen wie Ameisen aus von hier oben“, bemerkt Eisner, woraufhin Gates ihn korrigiert: „Nein, Michael, es sind Ameisen.“ Und deswegen haben die seinen im Silicon Valley auch gleich einen sogenannten „Ameisenalgorithmus“ entwickelt: Wenn z.B. „Amazon“ Bücher mit der Bemerkung empfiehlt, „Kunden, die Artikel gekauft haben, welche Sie sich kürzlich angesehen haben, kauften auch…“, dann war da ein solcher „Ameisenalgorithmus“ am Werk, den der US-Konzern dergestalt weiterentwickeln will, dass er bestimmte Waren auswählt, die einem so gut gefallen könnten, dass Amazon sie sogleich zustellt – ohne dass man sie bestellt hat. Und angeblich arbeiten die großen Kreuzfahrt-Anbieter bereits daran, Plätze für einen zu reservieren bevor man überhaupt daran gedacht hat, eine Fahrt zu buchen.
.

Wieder zu Hause.



