Nachahmungstäter
Am Kreuzberger Mehringdamm gibt es dicht nebeneinander zwei Schnellfraß-Stände: einer mit Currywürsten und einer mit vegetarischem Kebab im Angebot. Am ersten stehen fette Männer und werden fast sofort bedient, am zweiten stehen dünne Hipster beiderlei Geschlechts und warten mitunter über eine Stunde in der Schlange, bis sie ihren Gemüsepapp to Go bekommen. Überhaupt hat sich die Hipstermode: gestutzter Bart, an den Seiten kurz geschnittene Haare, kleine Tätowierungen, vegetarisches Essen, Club-Mate, Rucksack und ein möglichst teures Fahrrad – wie die Spanische Grippe über den Globus verbreitet. Und generell gilt: Damit irgendetwas eine Mode wird, muß es ausreichend Nachahmer geben. Dazu brauchen die Hersteller neben jede Menge Werbung Trendsetter, Opinion-Leader, Multiplikatoren oder Vorbilder, die mit ihrem Produkt angeben. Neuerdings werden dazu auch gerne die sogenannten „sozialen Medien“ benutzt. Als „Vorbilder“ – „Influencer“ – gelten z.B. Hollywood-Stars. Als eine der Hauptdarsteller der TV-Serie „Dallas“, Sue Ellen, nahezu weltweit berühmt wurde, liefen Millionen Frauen mit ihrer Frisur rum. Viele Friseure warben dann damit.
So wie nach Ausstrahlung des Walt-Disney-Zeichentrickfilms „Findet Nemo“ die Aquarienhäuser mit Hinweisschildern auf ihre Clownfische warben – und die ans Hysterische grenzende Nachfrage nach diesen kleinen Korallenfischen diese fast an den Rand des Aussterbens brachte, denn die einheimischen Fischer befriedigten den plötzlichen Riesenmarkt nur dadurch dass sie die Zierfische mit Natriumcyanid betäubten und dann einsammelten: Weltweiter Marktführer dieser Chemikalie ist der Essener Konzern „Evonik Industries“. Auf der Internetseite „spektrum.de“ heißt es: „Viele Meeresbiologen halten das Fischen mit Cyanid für eine der größten Bedrohungen der Ökologie südostasiatischer Gewässer. Nach Schätzungen tötet das Gift etwa die Hälfte der Fische schon am Riff, und von den Übrigen gehen vierzig Prozent ein, bevor sie überhaupt ein Aquarium erreichen.“
Vor allem die weibliche Mode hat schon viele Tierarten an den Rand des Aussterbens gebracht: Rote Korallen, Perlen, Zobel, Seeotter, Robben, Paradiesvögel, Strausse und mehrere Elfenbein liefernde Tierarten.
Der französische Soziologe Gabriel Tarde veröffentlichte 1890 „Die Gesetze der Nachahmung“, in dem er die Erklärung gesellschaftlicher Veränderungen mit dem Begriff der Nachahmung vorschlug: „Gesellschaft ist Nachahmung!“ Er konzentrierte sich darin nicht auf Individuen und Gruppen, sondern auf ihre Handlungen und Ideen. Seine Theorie wurde vor allem in den USA heftig diskutiert: die Psychologen (Behavioristen damals) und Anthropologen waren damit absolut nicht einverstanden, auch nicht all jene, die ständig von „Freiheit“ und „freier Wahl“ faselten, von den Linken (Marxisten) ganz zu schweigen. Mit der Studentenbewegung, dem Schichten- und Klassenbegriff, der Organisationspolitik und der Psychoanalyse, geriet Tardes Soziologie in Vergessenheit. Erst vor einigen Jahren hat sich der französische Wissenssoziologe Bruno Latour wieder ihrer als Multiplikator angenommen – und fast sofort erschienen auf Deutsch ganze Suhrkamp-Aufsatzsammlungen über „Nachahmung“, d.h. über Tardes Hauptwerk.
Aber so wie viele nachahmende Moden – z.B. die Bio- und Öko-Welle – neben all dem oben Erwähnten und trotz allem Ego-Lifestyle auch eine soziale Komponente brauchen, eine soziale Bewegung gar (von Doktorarbeiten und Staatsgutachten flankiert), so sehr unterscheidet sich der Tardesche Begriff der Nachahmung als gesellschaftsbildendes Begehren vom linken Begriff des „Werdens“, wie ihn die französischen Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari für die revolutionäre Bewegung geltend machten. Bei ihrem Werden handelt es sich in jedem Fall um ein Plural – um Schwärme, Meuten, Banden… Und diese bilden sich durch “Ansteckung”. Das könnte noch als die praktische Seite einer Nachahmung beim Kaufakt gelten, aber weiter heißt es: Das Werden gehört „immer einer anderen Ordnung als der der Abstammung an. Es kommt durch Bündnisse zustande…Werden besteht gewiß nicht darin, etwas nachzuahmen oder sich mit etwas zu identifizieren; es ist auch kein Regredieren-Progredieren mehr; es bedeutet nicht mehr, zu korrespondieren oder korrepondierende Beziehungen herzustellen; und es bedeutet auch nicht mehr, zu produzieren, eine Abstammung zu produzieren oder durch Abstammung zu produzieren. Werden ist ein Verb, das eine eigene Konsistenz hat; es läßt sich auf nichts zurückführen und führt uns weder dahin, ‘zu scheinen’ noch ‘zu sein’.“
Die Nachahmung ist danach das grundlegende Gesetz atomisierter Individuen, die durch ihre Kaufakte eine warenproduzierende Gesellschaft halbwegs zusammenhalten, während das Werden ihre radikale Negation ist. In Wirklichkeit haben jedoch auch linke Bewegungen erhebliche Mode-Anteile (und umgekehrt?). Erinnert sei an die Parka-Lange-Haare-Mode der Hippie- und Studentenbewegung und an die Mode-Accessoires der Punkbewegung. Übrigens warb damals der „Kaufhof“ schon nach kurzer Zeit für seine Punk-Kollektion mit dem Spruch: „Wir machen aus Punk Prunk!“ Der französische Philosoph (!) Jean Baudrillard nannte diese Schnelligkeit und Wendigkeit „Energieteufel Kapitalismus“, wir kennen das auch noch von Lenin, der über die unternehmerische Flexibilität im Westen urteilte: „Die Kapitalisten werden uns noch den Strick verkaufen, an dem wir sie aufhängen!“ Nach Auflösung der Sowjetunion haben die Amis übrigens als erstes für ihren christlichen Glauben und ihre Gender-Theorien in Moskau und St.Petersburg geworben – mit teilweise „hochkarätigen“ Predigern bzw. Feministinnen.
.

.
Ansteckungsgefahr
In Fortsetzung der „Nachahmungstäter“: „Das Werden ist eine Vermehrung, die durch Ansteckung geschieht,“ heißt es im „Anti-Ödipus“ von Deleuze/Guattari. Aber wie geschieht die Ansteckung? Ende 1967 fahre ich mit der Straßenbahn zur Arbeit in eine Schiffsmaklerei. Von meinem Gehalt hatte ich mir bis dahin schon eine „Timex“-Armbanduhr gekauft, und wollte mir noch einen schicken Morgenmantel und später einen noch schickeren Karmann Ghia zulegen, einen „Volksporsche“. Am Bremer Marktplatz steige ich aus und sehe in einiger Entfernung, dass am Rathaus etwa hundert Menschen die Schienen blockieren: Sie demonstrieren gegen eine Fahrpreiserhöhung. Statt zur Arbeit setze ich mich zu ihnen. Bald kommen Polizisten: Sie zerren und heben uns weg. Dabei reißt mir einer die Uhr vom Arm. Seitdem habe ich nie wieder eine feste Anstellung gehabt, und mir vom Gehalt etwas Tolles kaufen müssen.
Man kann sagen, die Sitzblockade der Bremer Schüler hatte etwas „Ansteckendes“, zugleich hatte aber meine stupide Büroarbeit in der Schiffsmaklerei auch etwas „Abschreckendes“. Eine der Aufsatzsammlungen über Gabriel Tardes Theorie hat den Titel „Nachahmung und Begehren“. Es war mein Begehren, mich von der Demonstration anstecken zu lassen – am Werden eines neuen Rudels oder einer neuen Bandeoder eines „Zusammenhangs“ (mit interessanten, kämpferischen Gleichgesinnten) teilzuhaben. dieses Begehren entwickelte sich jedoch spontan aus dem hoffnungslosen Stumpfsinn meiner Festanstellung heraus. Beides gehört zusammen.
Die Rädelsführer dieser Bremer Bewegung waren Schüler aus der oberen Mittelschicht am altsprachlichen Elitegymnasium, gutaussehend, selbstbewußt, von Mädels umschwärmt, wirkten sie auf mich in der Folgezeit nachahmend, d.h. ich entledigte mich meiner Büroarbeitskluft, ließ die Haare wachsen, ging in die Kneipen und Clubs, wo sie sich trafen, kaufte Bücher, die sie diskutierten etc.. Mein Tanzstil und mein Reden änderte sich, die Klamotten, die ich anzog, wurden immer billiger, keine Markenjeans oder ähnlichen Quatsch mehr.
Was war das in der Schule unter uns Schülern für ein Terror gewesen – mit dem, was man trug, wie man aussah. Wie man das Geld dafür den Eltern abpresste usw..Wenn ich heute junge Leute sehe, die sich schier verausgaben, um ein bestimmtes Aussehen nachzuahmen, schwanke ich zwischen Mitleid und Wut. Aber dann fallen mir meine eigenen Anstrengungen beim Nachahmen ein und ich denke: Bei der Geburt und die Jahrzehnte danach sind wir kulturell so leer, dass wir uns unbedingt füllen müssen, angefangen mit der Sprache. Und bei diesem Begehren, sich auszufüllen, ständig anzureichern, sind wir schon in der Kita dabei, irgendwelchen kleinen oder partiellen Vorbildern nachzuahmen, indem wir die selben Klamotten, die selbe Federtasche, dann die selbe Schultasche, den selben Füllfederhalter usw. haben wollen – d.h. verlangen, also so sein wollen wie unsere Freunde oder Freundinnen, wie die umschwärmten Klassenkameraden. Und später an der Universität wollen wir so reden und diskutieren wie die Eloquentesten. Es sind alles Versuche, echt zu wirken. Zunächst ohne dabei zwischen gut und schlecht bzw. sinnvoll und idiotisch unterscheiden zu können.
So berichtete ich meinem linken Vater z.B. einmal begeistert, dass ich einen seiner Kollegen von der Kunsthochschule in der vordersten Reihe einer Demonstration gesehen hätte. Vorsicht, sagte er, dass ist das allergrößte rechte Arschloch. Da gibt es mehrere von, die die Studenten immer kujoniert haben und sich nun in ihre vordersten Demoreihen einordnen, um sie auch weiterhin zu dominieren. Später lernte ich an den Unis auch noch eine Reihe von Dozenten kennen, die es vor allem auf die schönsten und klügsten Studentinnen abgesehen hatten, oder, wenn sie schwul waren, die interessantesten Studenten begehrten, wobei die aktive Verführung oft jedoch durchaus von den Jüngeren ausging. Ich unterstelle ihnen aber, dass es ihnen dabei weniger um Begehren als um Nachahmung ging. Für gewöhnlich und in den Massen besteht diese bloß darin, dass sie sich ständig mit Gegenständen aus der Warenwelt eindecken, vervollkommnen und ängstlich darauf achten, nicht den falschen Schlips zu tragen, nicht das falsche Auto sich zu kaufenund die Kinder nicht in die falsche Einrichtung zu stecken. Im Spätsommer ging ich durch eine Siedlung, die aus lauter Einfamilienhäusern mit großen Gärten bestand: in jedem stand ein Trampolin – ausnahmslos. Oder, anderes Beispiel, wenn man Nachts durch eine Gegend geht, in denen die Easyjetter bzw. die Clubgänger sich herumtreiben, dann hat ausnahmslos jeder und jede eine Flasche Becks Bier in der Hand, obwohl die Hälfte dieses Scheißzeug bestimmt gar nicht mag. Und je weniger sie das mögen, desto cooler, schnöseliger benehmen sie sich beim Kauf dieser Getränke in den „Spätis“ der Türken. Apropos: Dass die arbeitslos gewordenen Türken alle Dönerimbisse oder Spätkaufläden oder Friseurläden eröffnen, hat auch etwas mit dem Tardeschen Hang und Drang zur Nachahmung zu tun. Das Traurige daran ist, dass sie sich damit gegenseitig ins Elend konkurrieren. Und wenn die Rechten ständig davon reden, dass die neuen Einwanderer sich partout nicht „integrieren“ wollen, dann ist das nichts anderes als Druck zu machen, damit sie nachahmen, nachahmen, nachahmen, also sich wirklich anstrengen, genauso belämmert wie die ganzen braven Deutschen um sie herum zu „werden“. Gabriel Tarde hat im übrigen darauf bestanden, dass beim Nachahmen das Nachgeahmte jedesmal modifiziert wird.
.

.
Archäologie der Erfahrung
Nikita Chruschtschow sorgte angeblich dafür, dass die Bücher des norwegischen Biologen und Geographen Thor Heyerdahl in der Sowjetunion veröffentlicht wurden. Es handelte sich dabei vor allem um die Berichte seiner vier Reisen: mit einem Floß aus Balsaholz, „Kon-Tiki“ genannt, auf dem Humboldtstrom von Peru nach Polynesien; mit Papyrusbooten, „RA I“ und „RA II“, von Marokko bis nach Barbados; und mit einem Schilfboot, „Tigris, vom Irak nach Somalia. Mit diesen abenteuerlichen Fahrten, an denen sich nicht wenige seiner Freunde beteiligten, wollte Thor Heyerdahl etwas beweisen: dass nicht die Europäer die ersten Entdecker neuer Länder jenseits der Meere waren und dass auch die scheinbar primitiven Boote der Inkas, der Küstenindianer Nordwestamerikas, der Südseeinsulaner etc. höchst seetüchtig waren. Als Norweger war ihm bereits die Geschichte der Wikinger (kein Volk, sondern Gruppen junger skandinavischer Krieger) nahe, die mit ihren Ruderbooten Grönland und die Küste Kanadas besiedelt hatten und für das fränkische Reich den Handel bis nach Bagdad ermöglichten.
Die Spanier, Portugiesen und Engländer hatten die indianischen Kulturen zerstört und die Völker großenteils ausgerottet, die westlichen Wissenschaftler erledigten dann den Rest, indem sie sozialdarwinistisch davon ausgingen: Diese „Primitiven“ waren eben nicht „fit“ genug, die westliche Zivilisation war ihnen haushoch überlegen. Diese halbnackten Menschenfresser und müßiggängerischen Heiden mußten einfach untergehen. Dagegen sammelte der norwegische „Sozialdemokrat“, wie Fidel Castro ihn nannte, der mit Heyerdahl befreundet war, ein Leben lang Beweise. Ihn hatten es sozusagen die Verlierer der Geschichte angetan, deren spärliche Hinterlassenschaften er suchte und verglich. Neben den gefährlichen Bootsfahrten unternahm er dazu Ausgrabungsexpeditionen: auf einer der Galapagos-Inseln, auf der Osterinsel, den Malediven, in Peru und auf Teneriffa, wo er zuletzt auch wohnte.
Nach seinem Studium in Oslo war er zunächst mit seiner ersten Frau Liv 1937 für ein Jahr auf eine der Marquesas-Inseln gefahren, wo sie ohne Streichhölzer und sonstige Errungenschaften des Industriekapitalismus lebten. Kurz danach schloß er sich den norwegischen Streitkräften im Ausland an, wurde zum Funker ausgebildet und kämpfte zusammen mit der Roten Armee an der norwegisch-russischen Grenze gegen die Deutschen, wobei er wieder ein kleines Kommando unter sich versammelte. 1947 unternahm er sein erstes Bootsabenteuer: Zwar führte der Erfolg dieser Floß-Expedition in Oslo (nicht weit vom „Wikinger-Schiffsmuseum“) zur Gründung eines „Kon-Tiki-Museums“, das ihm dann auch einige Ausgrabungen finanzierte, aber für die lebenslänglich-festangestellten Wissenschaftler im Kapitalismus und im Sozialismus war er zunächst bloß ein leichtsinniger Spinner, höchstens ein guter norwegischer Seemann. Dass seine Bücher Bestseller wurden und sein Dokumentarfilm „Kon-Tiki“ zwei Oscars bekam, sprach auch eher gegen ihn. Seine Theorie, dass die Besiedlung Polynesiens nicht von Asien, sondern von Südamerika aus erfolgte, habe er mit dem Floß nicht beweisen können. Unermüdlich stellte er sich daraufhin der Kritik auf den Weltkongressen der Archäologen und der Amerikanisten. Wenn man seiner Autobiographie „Auf Adams Spuren“ (1998) glauben darf, überzeugte er dabei mit der Zeit auch seine geharnischten Kritiker. Im besonders konservativ-wissenschaftsgläubigen deutschen Wikipedia-Lexikon heißt es jedoch noch heute: „Anthropologen werten die Fahrt der Kon-Tiki nicht als Beweis für die Theorie. Die Möglichkeit der Durchführung bedeutet nicht, dass ein Ereignis auch tatsächlich stattgefunden hat.“
Zugegeben, sein 1997 auf Deutsch erschienenes Buch „Laßt sie endlich sprechen. Die amerikanischen Ureinwohner erzählen ihre Geschichte“ (anhand von Artefakten, jesuitischen Dokumenten und archäologischen Studien), erinnert mich ein bißchen an die endlosen „Jesus“-Geschichten des „Spiegel“, mit denen Rudolf Augstein immer wieder dessen Realexistenz beweisen wollte (zuletzt fanden die Amiarchäologen eine heiße Jesus-Spur im Jemen). Für uns, die wir mit französischer Philosophie und Ethnologie „groß“ geworden sind – und an so gut wie gar nichts Reales glauben, ist dieses halbchristliche Multitalent (Tausendsassa) mit seinen ganzen Weltumrundungen etwas langweilig – als Lektüre, aber er ist ein Guter, ein Grundsympath. Man sollte seine gesammelten Werke neu herausgeben und die weißen Wissenschaftler auffordern, diesmal die Schnauze zu halten: „Laßt sie endlich sprechen“ – die anderen Wissenschaftler, in Afrika, Polynesien, Lateinamerika etc.. Aber vielleicht ist das alles auch Schnee von gestern, denn uns geht es inzwischen gar nicht mehr um die Wahrheit der Geschichte, sondern um eine Geschichte der Wahrheit.
.

.
Pollerforschung
Ein Literaturwissenschaftler der Universität Siegen, Philipp Goll, hatte freundlicherweise meine verstreuten und längst abgeschlossenen Poller-Recherchen nebst -Fotos zusammengesucht und mit einem Nachwort versehen als Bachelorarbeit eingereicht. Einige Jahre später, als er schon mit ganz anderen „Gegenständen“ beschäftigt war – für seine Masterarbeit, hat er die Pollerarbeit daneben noch im Hamburger Verlag „adocs“ als dickes Buch herausgegeben – unter dem Titel „Helmut Höge Pollerforschung“. Dazu hat er im Anhang noch einige Autoren gesellt, die u.a. über Pollerarten und Blumenkübel forschten sowie über den Pollerforscher selbst, d.h. über mich. Das hat nun alles mit „Wirtschaft“ nichts zu tun, insofern ich keinen Pfenning daran verdiene, höchstens der Herausgeber Philipp Goll und der Verleger Oliver Gemballa (es sei ihnen gegönnt).
Aber zum Einen sind die Poller, Straßenmöblierung auch genannt, ein Milliardengeschäft (allein in Berlin wurden mehrere Millionen Poller „eingepflanzt“, in Kreuzberg hat man sie wegen der 1.Mai-Randale „ankerverstärkt“) und dann haben sich mehr und mehr Innenstädte und sensible Objekte (Leipzig, Banken, Geheimdienste, US-Botschaften) auch noch mit elektronisch versenkbaren Pollern, sogenannten Zufahrtskontrollsystemen, „geschützt“ (die alles in allem über zehntausend Euro das Stück kosten), zudem ist es neuerdings Mode geworden, öffentliche Plätze mit noch fetteren „Antiterrorpollern“ gegen durchgeknallte Islamis, Haßkappen, Agent provocateurs und Ausländerfeinde oder ähnliche Misanthropen bzw. bezahlte Drecksäcke zu „sichern“. Kurzum: Es ist zwar genug Geld bei diesen Scheißpollern im Spiel, aber es ging hier ja um die „Pollerforschung“ (erst als Uniarbeit und zuletzt als Buch) und für letzteres bat der Herausgeber mich kürzlich noch um zwei aktuelle Beiträge: Zum Einen um einen Text über „Antiterrorpoller“ und zum Anderen über „Poller-Ökologie“, über das, was man auch „Poller-Grün“ nennt. Darüber habe ich gerne geschrieben, denn damit wollte ich schon früher meine Poller-Recherche abschließen, die 1989 begann (kurz bevor ich in der LPG „Florian Geyer“ als Rinderpfleger anfing) und die 2010 mit einem Pollervortrag endete (als ich mich endgültig der Tier- und Pflanzenforschung zuwandte). Da sah ich nämlich noch einmal genau hin: bei den Pollern, und entdeckte an jedem ihrer Füße kleine Pflanzen, manchmal sogar große mit schönen Blüten. So hatte ich die Poller bis dahin noch nie gesehen: als Biotopschutz.
Es ist nämlich so, wie ich dann herausfand: Diese Scheißpoller, mit denen die Moral (hier sollst Du nicht parken oder durchbrettern!) einfach an die Technik delegiert wird (die das Parken oder Bürger umnieten verunmöglicht) – so wie die frühere Respektsperson Polizist jetzt ein waffenstarrender Kampfbulle ist, weswegen man die Poller auch stumme oder tote Polizisten nennt…An jedem dieser Poller sammelt sich Sand, Staub, Samen und Hundepisse. Und weil so gut wie niemand auf diese kleinen Anhäufungen tritt, gedeiht dort das schönste „Unkraut“. Diese Pflänzchen kamen mir im Übergang von der Proletariats- (d.h. Menschen-) zur Fauna- und Flora-Forschung wie gerufen.
Ich kaufte mir das Bestimmungsbuch „Berliner Pflanzen – Das wilde Grün der Großstadt“ von den RBB-Journalisten Heiderose Häsler und Iduna Wünschmann, lieh mir eine automatische Kamera und legte los. Leider war es noch Vorfrühling und die Pflänzchen gerade mal aus ihren Sand-Staub-Haufen herausgewachsen, aber ich konnte und wollte nicht warten. Das Bestimmungsbuch nützte mir gar nichts, weil die ersten zarten Blätter alle fast gleich aussahen und – wie man ja weiß – die Pflanzenarten von Linné einst nach den Sexualorganen in den Blüten bestimmt worden waren. Es gab aber noch lange keine Blüten. Ich photographierte die kleinen Pflanzen zu Füßen der Poller trotzdem. Aber auch die Fotos waren Scheiße, komisch, als Pollerfotograf bin ich glaube ich Weltspitze (ich habe mindestens 10.000 Poller und Pollerverwandtes photographiert), aber bei den Pollerpflanzen kamen keine guten Bilder zustande. Einige konnte der Herausgeber des Pollerbuches dennoch verwenden – und ich mußte bloß noch einen kurzen Text dazu schreiben (über mein Scheitern quasi), den er dann auch akzeptierte. Etwas Gutes hatte dieser Auftrag dennoch für mich: Seitdem kucke ich nie mehr auf Poller (höchstens wenn ich auf ein allzu idiotisches Pollerensemble stoße), sondern auf die Pflanzen zu ihren Füßen. Es sind manchmal richtige Minigrünflächen und die fast 6 Millionen Flächen zusammengenommen bestimmt größer als z.B. der Treptower Park. Sie sind also nicht zu verachten, wo doch die jetzige halblinke Berlinregierung gerade die Hege und Pflege und Erweiterung des städtischen Grüns sich in ihr Programm geschrieben hat. Die CDU und die AfD haben aber schon verkündet, wenn sie „an die Macht“ kommen, werden sie wieder für „saubere Gehwege“ sorgen. Da sei der mündige Öko-Berliner vor! (Kleiner Witz)
.

.
Wir alle
Ständig stößt mir das „Wir“ in letzter Zeit auf. „Wir müssen die Vermüllung der Meere stoppen!“ „Wir müssen den Waffenexport nach Saudi-Arabien unterbinden!“, „Wir wissen zu wenig über die Klitoris“, „…Wer, wenn nicht wir“ usw. Besonders absurd ist das in den „sozialen Netzwerken“, auf Facebook z.B., wenn da das „Wir“ („…müssen etwas gegen den Elfenbeinhandel tun“) mit der Aufforderung zur Unterstützung verbunden wird – die darin besteht, dass man sie anklickt. Und gut is! Ich verstehe: Es gibt viele „Wirs“ – ein Fußballvereins-Wir, ein „Partei- und Gewerkschafts-Wir „Wir Opelaner“, Schlesiertreffen, „Wir Motorradfahrer“, „Wir Friesen“ – Apropos: Als dieses „Wir“ Theodor Storm gepackt hatte, zieh ihn Theodor Fontane der „Husumerei“. Trotzdem sollte man nicht den Husumer Nationalökonomen Ferdinand Tönnies und seine Unterscheidung von Gemeinschaft und Gesellschaft dabei vergessen. „Gemeinschaften“ gibt es viele, sie können sich in den unmöglichsten Gesellschaftsecken entwickeln: So gibt es z.B. in Ost- und in Westdeutschland je einen Kreis von Leuten, die Tausendfüßer züchten („Tausi“ von ihnen genannt) und die sogar je eine eigene Zeitschrift herausgeben. Dass sind nun zwei kleine „Wirs“, aber die Aufrufer im Facebook sprechen mit ihrem apellativen Wir die Weltbevölkerung, Sieben Milliarden People, an, mindestens die zigmillionen Facebook-Nutzer: Wir, der kleine man auf der Straße, sollen den Elfenbeinhandel stoppen – den Elefanten zuliebe, dem Genpool. Im günstigsten Fall läuft es darauf hinaus, dass man 10 Dollar an „Elephant Watch“ überweist – und die sich davon sinnlos betrinken.
Dieses „FB-Wir“ kann sich aber auch dahingehend entwickeln (Energieteufel Kapitalismus), dass es bei einer hohen Klickzahl die knappe Ressource Aufmerksamkeit der alten Medienhengste in Funk und Fernsehen erregt und sie das virtuelle Anti-Elfenbeinhandels-Wir „aufgreifen“: Erregen und Aufgegriffen-Werden. Ja, ein Thema muß auch „sexy“ sein. Wie bei allem wird es auch hier ein Ranking geben. Eine Beliebtheitsskala. Die drei am meisten angeklickten Einträge der Woche in den Netzwerken z.B.. Um möglichst viel „Aufmerksamkeit“ zu erheischen könnte man theoretisch die Anzahl der Klicks selbst oder mit Freunden erhöhen – im Dauereinsatz. Dagegen braucht man danneine Initiative bzw. Organisation oder Prüffirma, die, ähnlich wie bei der Ermittlung der Auflagenhöhe von Zeitungen (wonach sich deren Anzeigekosten bemessen), im Netz eine Art Klickwart installiert. Man kann es positiv aber auch so sehen: Das Facebook-Wir trägt mit dazu bei, dass neben dem Elfenbeinhandel nun auch im Anti-Elfenbeinhandel immer mehr Arbeitsplätze entstehen. Gerade lese ich in einem Buch über das Meer von einem Kieler Meeresforscher den Satz „Wir Menschen behandeln die Ozeane äußerst sorglos.“ Wieder dieses komische „Wir“.
Ich argwöhne, dass es etwas mit mit dem starken Glauben an die „Demokratie“ zu tun hat, „der Gleichheit aller vor dem Gesetz“(isonomia) Dabei wußte man schon im alten Griechenland nach drei Generationen Demokratie, dass sie ohne eine „Gleichheit des Besitzes“ (isomoiria) ein Beschiß ist. Dieser starke Glaube verbindet sich nun noch mit der Idee vom freien Individuum, das permanent wählen darf und soll. Sein Wir ist eine Konsumenten-Demokratie. In ihr gibt es ein Gesetz der großen Zahl, dass auch noch der vereinzelteste Konsument für sich nutzen kann: Indem er z.B. à la Ralph Nader den Boykott eines bestimmten Produkts organisiert, um den Hersteller zu etwas zu zwingen. Das war bei der „Anti-Shell-Kampagne“ Mitte der Neunzigerjahre der Fall, die u.a. von „Greenpeace“ getragen wurde. Dieser Global NGO-Player spricht im übrigen gerne von Wir. Derzeit wirkt er bei der „Anti-Nestle-Kampagne“ mit: Ein Boykott wegen der auf Privatisierung drängenden „Wasserpolitik“ dieses Mischkonzerns und seiner Palmölimporte, für die in Indonesien der Urwald Palmölplantagen weichen muß. In diesem Geschäft hängen noch zwischen der Palme und Nestle so viele andere Konzerne und Interessensgruppen, dass man glatt von einem „Palmöl-Wir“ – nach Art einer Mafia, einer Verschwörung –sprechen könnte.
Ich erinnere mich, dass um 2000 im handelsisolierten Burma die Leute unter dem schlechten Palmöl gesundheitlich litten, das eine Art Palmöl-Ersatz war und aus Indonesien kam, das umgekehrt aus Burma gutes Palmöl bezog.Der Begründer der Nationalökonomie Adam Smith wußte bereits 1776: Unternehmer aus der selben Branche kämen selten zusammen, „ohne dass ihre Unterhaltung mit einer Verschwörung gegen das Publikum oder einem Plan zur Erhöhung der Preise endigt“. Ob man bei „Comrads in Crime“ von einem „Wir“ sprechen kann, das ist aber noch die Frage, denn dieses wäre auf alle Fälle ein gegen das Publikum gerichtetes. Im Berliner Landesarchiv liegt z.B. ein Rundbrief des internationalen Elektrokartells (Phoebus) an seine Mitglieder, Osram, Philips, General Electric, Alcatel, der sich mit der Werbung und der Präsentation ihrer Produkte befaßt, ihnen wird darin geraten, möglichst eigenständig, also jeder auf seine Weise, für sich zu werben, damit der Eindruck von Konkurrenz erhalten bleibt und die Kunden nicht auf den Gedanken kommen, keine Wahl zu haben.
.

.
Rund ums Schaf
Mich beschäftigen gerade Schafe. Die Literatur dazu ist unbefriedigend, die meisten Studien beschäftigen sich mit ihrem Nutzen, der Herde, den Rassen und den Schäferproblemen (Fleisch- und Wollpreise), kaum mit einzelnen Schafen. Vielleicht kann man so beginnen: Im „Hirtenwettstreit“, den der antike Dichter Theokrit besang, gab es eine Hierarchie der Hirten, die vom Nimbus ihrer Tiere herrührte. Die Rinderhirten waren angesehener als die Ziegen- und Schafhirte. Mit der „Türkenherrschaft“ ab 1460 drehte sich diese Hierarchie um, die Rinder wurden weniger und die Schaf- und Ziegenherden gehörten immer öfter den Besatzern. „Mit oft groß angelegten Raubzügen“ wurden deren Herden von griechischen Viehdieben und Partisanen entführt und als „Herden des Volkes“ auf die Berge getrieben. „Viehdiebstahl galt als patriotische Tat,“ schreibt der Spiegel 1981 in einem Bericht, der davon handelt, das auf Kreta, wo die Türkenherrschaft erst 1913 endete, das nächtliche Entführen von Schafen und Ziegen aber noch immer ein „Volkssport“ ist.
Der italienische Sprachforscher Cam Carotta hält die ganze Schafkultur Griechenlands für ein Ergebnis der „Türkenherrschaft“. Schafe sind die letzte Degenerationsstufe fruchtbarer Landschaften. Die Griechen züchteten einst mehr Rinder als Schafe, sie opferten ihren Göttern gelegentlich bis zu 5000 Rinder auf einmal. Ihren Anfang nahm die Schaf-Devastierung aber bereits mit den fortwährenden Eroberungen der Flotte des attischen Seebunds: Homer besang sie noch, die fleißigen Holzfäller, die Arkadiens Wälder für den Schiffsbau vernichteten. 400 Jahre später beklagte Platon die Folgen – Humusschwund und Erosion: „Geblieben sind nun im Vergleich zu einst nur die Knochen eines erkrankten Körpers, nachdem ringsum fortgeflossen ist, was vom Boden fett und weich war, und nur der dürre Körper des Landes übrig blieb,“ heißt es in seinem Fragment „Kritias“.
Die Schaf- und Ziegenherden gaben der Landschaft den Rest, sie sind sozusagen die letzte Fruchtfolge, danach kommt nur noch Bauerwartungsland. Rund um das Mittelmeer und in weiten Teilen des Nahen Ostens haben Schaf- und Ziegenherden das Land buchstäblich verwüstet. Es ist eigentlich nur noch für den Tourismus zu nutzen. Libyen war einst die Kornkammer des Römischen Reiches. Es wird gesagt, dass die riesige Sahara-Wüste entstand, weil Schäfer den Urwald niedergebrannt und dann immer größere Schaf- und Ziegenherden das Gebiet überweidet hätten. „Rund 35 Prozent der weltweiten Landoberfläche sind inzwischen Wüstengebiete – und jedes Jahr kommt ein Gebiet von der Größe Irlands hinzu,“ berichtete der Bayrische Rundfunk.
Mit der Schaf- und Ziegenzucht und ihrer Ausbreitung war auch noch schwer Metaphysisches über die Welt gekommen – eine Hirtenideologie: der Monotheismus (Judentum, Christentum und Islam). Wahrscheinlich wurden vor etwa 10.000 Jahren zuerst wilde Schafe im Orient domestiziert. Mit ihrer Domestizierung entwickelte sich der Hirtenstand. Und bald wurden dort auch alle Herrscher als Hirten begriffen, sie behüteten die Menschen als Herde wie auch als Individuen. Der Wissenshistoriker Michel Foucault geht in seiner „Geschichte der Gouvernementalität“ (2006) davon aus, dass die Idee einer „pastoralen Macht“ (sei es Häuptling, König oder Gott) ebenfalls im Orient entstand. Man findet diese Machtvorstellung in Ägypten, Assyrien und Babylon. „Der Titel des ‚Hirten‘, der Titel des ‚Pastors‘ gehört zur königlichen Titulatur für die babylonischen Monarchen.“ Vor allem bei den Hebräern wurde dann das „Pastorat ein grundlegender Verhältnistypus zwischen Gott und dem Menschen“. Es ging dabei, anders als heute, da man in Israel die Heilige Schrift gerne als Grundbuch liest, nicht um das Besetzen eines Territoriums: „Die Macht des Hirten wird per definitionem auf eine Herde ausgeübt.“ Dem griechischen Denken ist die Idee fremd, dass die Götter die Menschen wie ein Pastor, wie ein Hirte seine Schafherde führen. Sie haben „territoriale Götter“. Die orientalische Hirtenmacht wird dagegen laut Foucault auf „eine Herde in ihrer Fortbewegung, in der Bewegung“ ausgeübt. Das „Heil der Herde ist für die pastorale Macht das wesentliche Ziel.“ Moses, Abraham, Isaak und Jakob waren Schafhirte. Moses wurde als Hirte seines Volkes von Gott auserwählt, weil er seine Schafe in Ägypten so umsichtig gehütet hatte. Der erste (nomadische)Schafhirte nach der Vertreibung aus dem Paradies war Abel, der von seinem (seßhaften) Ackerbauern-Bruder Kain erschlagen wurde.
In der „hebräischen Thematik der Herde“ schuldet der Hirte laut Foucault seinen Schafen alles, „derart, dass er hinnimmt, sich selbst für das Heil der Herde zu opfern…Etwas, das im Mittelpunkt der christlichen Problematik des Pastorats steht.“ Dabei hat der „abendländische Mensch“ in Jahrtausenden gelernt, „was zweifellos kein Grieche je zuzugestehen bereit gewesen wäre, sich als Schaf unter Schafen zu betrachten.“
.

.
Fake-News
Die sich am Lautesten über Fake-News von Laien im Internet beschweren – sind die professionellen Fake-Journalisten in den Kapitalmedien. Unsere kleine Publizistentruppe hat sich nie beschwert, wir waren immer aufgeschlossen für alle Fakes. Anders als die Profis haben wir unsere Texte jedoch nicht aus Geldgier und Angeberei (wie Tom Kummer – SZ und jetzt Claas Relotius – Spiegel) gefakt, sondern im Gegenteil aus Armut und Zurückhaltung: Ein Interview mit Woody Allen z.B. – weil wir uns das Flugticket nach New York nicht leisten konnten, ein Interview mit Inge Viett – um die Untergetauchte nicht zu gefährden, ein langer Text von Bundespräsident Weizsäcker – weil er ungefakt zu blöd gewesen wäre, usw. Wir haben uns bei den Fakes Mühe gegeben, es ging uns darum, die Wahrheit zu halluzinieren – und tatsächlich konnten wir elf Mal Bingo rufen, den Hauptverdienst daran hatte Märzverleger Jörg Schröder, der im Vogelsberg unser Nachbar war.
Einmal haben wir jedoch Angst gehabt, dass der Fake platzt: Wir hatten in der LPG, wo wir im Dezember 89 als Rinderpfleger anfingen, einen Kollegen namens Egon, der in den Pausen im Sozialraum als erster anfing, Existenzgründungs-Ideen zur Diskussion zu stellen. „Das reichte von einem Imbißstand am Badesee bis zum Getränke- und Eisverkauf von seinem Wohnzimmerfenster aus. Schon vor der Wende hatte Egon sich in diversen Nebenerwerben versucht: Autos in seinem Schrottablade-Garten repariert, Einwegfeuerzeuge wiederaufgefüllt und auf den Westmüll-Kippen des Kreises Betten und Kissen gesammelt, deren Feder-Inhalt er reinigte und weiterverkaufte. Obwohl Egon der fleißigste in unserer Brigade war, wurde der etwas Eigensinnige als erster entlassen. Er nahm in einem Steglitzer Hotel einen Job als Reinigungskraft an. Erst als er diese erste „West-Anstellung“ wieder – wegen zu geringer Bezahlung – hinschmiß, sagte man ihm, daß das Kleingeld auf den Kissen sein Trinkgeld gewesen war: Er hatte es stets unangetastet gelassen, im Glauben, man wollte damit seine Ehrlichkeit testen. Der Lehrherr meines Vaters hat seinerzeit die Ehrlichkeit seines Lehrlings wirklich so getestet. Egon fing danach als Detektiv beim ersten Heimwerkermarkt in Teltow an – wieder scheiterte er in gewisser Weise an seiner Ehrlichkeit: Er erwischte einen Familienvater mit acht PVC-Rohren. Der Mann ging in seiner Not zum West-Geschäftsführer und der ließ sich erweichen: Der Kunde sei noch nicht mit dem neuen West-Kassensystem vertraut gewesen. Egon empfand das als Ost-Schmähung – und wurde barsch. Am Ende verlor er seinen Job. Sein Nachbar, Ulli, hatte unterdes eine Anstellung als Plakatwand-Aufsteller gefunden. Es gelang ihm, Egon in „seiner Firma“ unterzubringen. In Sachsen-Anhalt rissen Unbekannte ihnen mehrere Plakatwände um. Ihr Chef bezichtigte sie daraufhin der falschen Aufstellungsabrechnung. Sie kündigten und fingen bei der Konkurrenz an, die sie mit Polaroid-Kameras ausstattete. Damit gab es nun kein Vertun mehr. Aber dafür hatten sie bald das Rumfahren und ewige Imbiß-Essen satt. Egon träumte von einer Kneipe – und sammelte dafür schon mal alles Brauchbare unterwegs ein.“ Und hier beginnt der Fake: „Da traf es sich, dass sein Freund Ulli ihm von einem leerstehenden Laden im Nachbardorf erzählte, der 600 DM Monatspacht kosten sollte: Da kannst du doch alles auf einmal machen – Getränke und Eis verkaufen und Blumen und Gemüse noch dazu,“ meinte er zu Egon.“
Und so geschah es dann auch, wobei wir Egons Einrichtungs-Fimmel bei seiner „Taverne“ genau beschrieben. „Im Endeffekt stand dann neben dem Spielautomaten ein Fax-Gerät, und neben der Eistruhe ein Schwarz-Weiß-Kopierer, im Gang zur Toilette konnte man sich an einem Drehgestell mit Postkarten aus der Region sowie mit Glückwunschkarten aller Art eindecken, daneben hingen ein Kaugummi- und ein Präservativ-Automat sowie ein Schild ‚Für Garderobe wird nicht gehaftet‘. Dem eher zufälligen Besuch einiger Taxifahrer folgte bald ein selbstgemaltes Schild am Fenster: ‚Für Taxifahrer verbilligtes Angebot – Kaffee 1 DM‘“ usw. Den fertigen Text schickten wir der „Zeit“, die ihn auch veröffentlichen wollte – aber nur mit Foto. Was nun? Ideenlos schicksalsergeben fuhr ich mit dem Hamburger Fotografen raus nach Saarmund. Egon war kein Kneipenwirt sondern inzwischen Beifahrer bei einer Spedition, er war jedoch Zuhause und – kein Fake! – führte uns sofort, bevor ich etwas erklären konnte, nach hinten zu seinem kleinen Gartenhäuschen, das er entrümpelt und als Kneipe nur für sich und seine Frau, mit Theke und Hirschgeweih an der Wand, eingerichtet hatte. Dort bot er uns wie in alten Tagen Kirschwhisky an – wir redeten über die LPG und der Fotograf knipste. Alles stimmte. Als die Geschichte veröffentlicht wurde, brachte ich sie Egon. Der fand alles prima, nur dass ich ihn darin als PDS-Wähler (bei den Märzwahlen 1990) bezeichnet hatte, fand er Scheiße, weil er inzwischen dank seines Freundes Ulli eher ein Rechter geworden war.
Unsere Fakes unterscheiden sich von denen der beiden Hochstapler Kummer/Relotius (die erst sympathisch werden, wenn sie auffliegen). Dass letzterer jetzt laut Frankfurter Rundschau Spendengelder für syrische Waisenkinder „auf sein Privatkonto aufgerufen haben“ soll, ähnelt auch nur scheinbar der Praxis von „Holzjournalist Christian Specht“, der einer von uns ist, und immer mal wieder in den linken Redaktionen der Stadt Spenden für irgendeinen guten politischen Zweck Geld sammelte, mit dem er dann selbst etwas anstellte, z.B. indem er mit dem Taxi zum „Grenzcamp“ nach Zwickau fuhr – und dann über die ärgerlichen Gesichter der dort versammelten Antifas süffisant lächelte.
Generell geht es nicht um Anpasslerisches, sondern um eine gewisse Ungenauigkeit – aber diese „Approximation“, wie Deleuze/Guattari sagen, nicht als eine Annäherung an eine immer größere Genauigkeit, sondern „die Ungenauigkeit als genau der Ort des Durchgangs zu dem, was geschieht“.
.

.
Staatsaufträge
Wenn das lokale Tiefbauunternehmen im Vogelsberg dem Bürgermeister mitteilte, es müsse wegen Auftragsmangel neun Leute imWinter entlassen, setzte der es durch, dass die Kurve am Berg „entschärft“, d.h. verbreitert wurde. Und prompt war die Strukturkrise im Baugewerbe dort überwunden. In großem Stil passiert so etwas, wenn z.B. ein Warndreieckhersteller es mit Drohen und Klagen und Quetschen schafft, dass Warndreiecke für alle Autobesitzer Pflicht sind. Das geht immer weiter: Bis hin zu den französischen „Gelbwesten“, die als „Warnwesten“ bald sogar für die Bildschirmarbeiter in den Nichtraucher-Büros zur Pflicht werden (nur damit die Hersteller keine Leute entlassen müssen).Vor einiger Zeit waren anscheinend die Hersteller und Installateure von Rauchmeldern in eine Konjunkturflaute geraten, es gelang ihnen jedoch, den sogenannten „Gesetzgeber“ davon zu überzeugen, dass ihnen geholfen werden muß (Arbeitsplätze!): Daraufhin wurde es zur Pflicht für jede Wohnung, jedes Büro und jedes Haus, Rauchmelder in dem Raum anbringen zu lassen. Auch beim Neubau der taz war das der Fall, wobei als Positivum für die gesetzestreuen Mitarbeiter noch dazukam, dass man dort nun nicht einmal mehr eine Zigarette rauchen darf, wenn alle Kollegen längst nach Hause gegangen sind: Die Rauchmelder, wozu übrigens für den Fall eines Stromausfalls einen eigener zigtausend Euro teurer Generator im Keller gehört,der die dazugehörige Springleranlage zum Pumpen bringt, könnte ja losmelden. Damit dieser ganze Sicherheitsquatsch nicht nur die Rauchmelder-/Springleranlagen-/Generator-Hersteller und -Installateure finanziell sanierrt, sondern auch wirklich funktioniert, muß er jede Woche unter lautem Krach Probe gefahren werden. Die Feuerwehr prüft, ob das auch wirklich der Fall ist. Noch kennt sich jedoch kein Mensch im Haus mit der ganzen Anlage aus, die Details bei der Einweisung haben alle, die dabei waren, längst vergessen. Neben einem Datenschutzbeauftragten brauch ir nun auch noch eine Rauchmelderbeauftragten.
Der genialste Coup gelang jedoch dem seltsamen Konzern-Trio Osram, Philips und Greenpeace in Brüssel: Weil auch in Billiglohnländern inzwischen Glühbirnen produziert werden, schafften sie esbei der EU, einen sogenannten Komitologie-Ausschuß für Beleuchtung zu bilden, und am Parlament vorbei ein allgemeines Glühbirnenverbot zu verhängen – zugunsten ihrer hochgiftigen und umweltschädigenden zudem völlig überteuerten „Energiesparlampen“.Dann wurden auch noch die Halogenlampen von der EU verboten, und die Energiesparlampen langsam von der nächsten Lichtgenerationverdrängt: den Leuchtdioden, die immer heller und billiger wurden – und immer schädlicher für unsere Augen. Und je heller desto weniger lange leuchten sie.
Bis zu dem Punkt, da es sich für die Lampen- und Leuchtenhersteller lohnte, die LEDs fest in ihre Designobjekte zu integrieren, d.h. wenn die Leuchtdiode ihren Geist aufgab, mußte man die Lampe – wahrscheinlich auch noch als „Sondermüll“ – entsorgen. Und derMüll gelangte dann wohlmöglich bis nach Ghana. Über diesen Elektroschrott-Skandal hat Cosima Dannoritzer den Film „Hergestellt für den Müll“ gedreht, in einem zweiten Film „Giftige Geschäfte“ verfolgte sie mit einem ghanaesischen Kulturhistoriker zusammen den Weg einiger Elektroschrottteile zurück zu dem Ort, wo sie aus den Recyclingssystemen des Landes, im Film ist es England, herausgenommen und nach Afrika verschifft wurden.
Bei einer Untersuchung der Stiftung Warentest, deren Ergebnis ihr journalistischer Leiter Reiner Metzger kürzlich veröffentlichte, kam heraus, dass man bei fast 50 Prozent aller Leuchten nicht mehr die LEDs auswechseln kann.
Zum „Fest des Lichts“ sind die Funk- und Fernsehanstalten traditionell auf Leuchtkörper gepolt, und zuletzt eben auf Leuchtdioden. Diese LEDs waren eigentlich so gut wie unsterblich, weil sie keine Wärme entwickelten, aber inzwischen eben doch. Die Hersteller werben mit einer Lebensdauer von 10 bis 25 Jahren, tatsächlich halten sie aber nur noch etwa 25.000 Stunden, wobei die Lichtqualität immer schlechter wird – u.a. aufgrund der Alterung des Phosphors in den LEDs.
Genug, ich komme aus Bremen und da gab es eine „Strukturkrise“ der Werftindustrie, vor allem der großen Vulkan-Werft – keine Schiffsbauaufträge mehr, die gingen in die Billiglohnländer. Es standen viele Arbeitsplätze auf dem Spiel. Deswegen gründete der Bremer Senat schnell eine eigene Reederei: die „Senator-Linie“. Und diese vergab fortan Schiffsbau-Aufträge an die Vulkan-Werft. Das klappte alles wunderbar. Nur mußten für die Transportschiffe auch Waren acquiriert werden – von der Reederei, das lief nicht so gut, denn es kamen dafür immer mehr Schiffe aus Billigfrachttarifländern in Betracht. Nach der Wiedervereinigung hatten die Senatoren und die Vulkan-Chefs eine neue Idee: Sie erwarben an der Ostsee günstig eine DDR-Werft nach der anderen von der Treuhandanstalt –und bekamen dazu Zigmillionen für deren Modernisierung. Diese Gelder leiteten sie um zu den Bremer und Bremerhavener Vulkan-Werften. Das ging, im Gegensatz zum Leuchtdioden-Geschäft, wo man schon bei der militärischen Anwendung ist, nicht gut aus.Aber es mußte ja weiter gehen. Bremen versuchte nach der Vulkan-Pleite die Werftimmobilien zu verwerten: mit einem „Space-Park“ – einem „galaktischen Ausflugsziel“ (Der Spiegel“). Daraus wurde bereits nach sieben Monaten „eine der größten Pleiten der Hansestadt“.
.

.
Angst einjagen
In Berlin darf jetzt wieder gejagt werden – auf junge Rehe, junge Reh-Mütter und ältere Mütter. Ganzjährig werden Wildschweine, Waschbären, Füchse und Kaninchen gejagt. In der letzten Saison erwischten die Berliner Jäger 338 Rehe, 2339 Wildschweine, 18 Waschbären, 81 Füchse und 862 Kaninchen. Deutschlandweit wurden 2017 rund 134.000 Waschbären und 435.000 Füchse getötet.
Rechtzeitig zur Jagdsaison erschien das Buch des Ethnopsychoanalytikers Paul Parin: „Die Jagd – Licence for Sex and Crime“ – mit Nachworten von einer Zoologin, einer Historikerin, einem Bibliothekar und einem Ethnologen. Das Buch war bereits 2003 mit einem Nachwort von Christa Wolf erschienen, aber völlig verstümmelt worden, „in einer eigenartigen Mischung aus Respektlosigkeit, Prüderie und sachlicher Unkenntnis“ – so dass eine Neuherausgabe notwendig wurde. Der Autor war Jude und Sozialist: Beide jagen nicht, aber Parin war eine „Ausnahme“. Zudem gehörte er zu den Tiermördern, die bei einem gelungenen Schuß einen Orgasmus bekamen, auch beim Reiten gelegentlich, ebenso beim Ausgepeitscht werden und beim Auspeitschen. „Das Jagdfieber gewährleistet hemmungslosen sexuellen Genuss und die Lust am Verbrechen,“ schreibt er, denn natürlich ist das alles extrem unmoralisch, außerdem jagt man heute nicht mehr, um sich zu ernähren, sondern um mit Lust zu morden. „Jagd ohne Mord wäre ein Oxymoron.“ Schon für seinen Vater, ein Gutsbesitzer in Slowenien, galt: Seine „Jagdleidenschaft hatte die Grenze verwischt, die Anstand und Moral von Vergehen und Verbrechen scheidet.“ Nach dem ersten erlegten Rehbock bekam die jugendliche „Gier“ seines Sohnes „ein Ziel: der Mord an eine Kreatur“.
Die heutigen Jäger benutzen eine verharmlosende „Waidmannssprache“, um dies zu kaschieren, einige entblöden sich nicht, sich als „Ökologen“ und „Naturschützer“ zu bezeichnen. Parin meint, dass „solche unbeholfenen Versuche, die Jagd vom Geruch der Sucht und Grausamkeit freizusprechen, gar nicht mehr nötig sind,“ denn „es könnte sein, dass die brutale Umgestaltung der Welt nicht mehr rückgängig zu machen ist.“ Zwar wird gelegentlich behauptet, dass Jäger aggressiver und sadistischer als nicht jagende Menschen sind, aber, wie es in einem der Nachworte heißt, „neuropsychologische Forschungen legen nahe, dass vor allem Männer Gewalt um der Gewalt willen ausüben und daran Spaß haben.“
Die Jagd hat natürlich mit Macht (über die Tiere) zu tun, mit der Herrschaft des Menschen über die Natur, aber mit der Forderung nach mehr Frauen in den Führungsetagen legen nun auch immer mehr Frauen die Jagdprüfung ab – und auf jagdbares Wild an. Die Schriftstellerin Dörte Hansen erwähnt in ihrem norddeutschen Dorfroman „Mittagsstunde“ (2018) einen Jagdverein, in dem die Frauen bereits die Mehrheit stellen, mit der Folge, dass das Wild von ihnen nicht mehr gejagt, sondern gehegt und gepflegt (gekuschelt) wird. Dies mag ein bloßer Autorenwitz sein, für den Münchner Ökologen Josef Reichholf steht es jedoch fest, dass die Angst der Tiere vor den Menschen eine Folge der Jagd ist und dass sich bei einem umfassenden Jagdverbot wieder eine Art „Urvertrauen“ bei ihnen einstellt, wie es die Tiere in vielen Gegenden der Welt an den Tag legten – bevor die Weißen kamen und alle zutraulichen töteten.
Parin hat solche „Tierparadiese“ noch erlebt – in der Sahelzone, dort hielten sich Gazellen und Trappen zwischen den Rinderherden der Einheimischen auf, die keine Gewehre besaßen. Reichholf erlebte im Golf von Kalifornien, wo Wale nicht mehr gejagt werden dürfen, dass ein Walweibchen an sein „Whale-Watcher-Boot“ kam und sich von ihm die lästigen Seepocken abpflücken ließ. Die Erfahrung, dass mit dem Jagdverbot die Fluchtdistanz von Wildtieren geringer wird, macht man in fast allen Nationalparks. In Berlin darf man bei Strafe keine Wildtiere füttern – und sollte das auch nicht, dann sobald sie etwas weniger scheu werden, erschießt man sie. Aber ist das nicht ihre einzige Überlebensmöglichkeit – dass wir halbwegs friedlich mit ihnen zusammenleben? Die in die Städte eingewanderten Tiere bemühen sich doch bereits darum.
.

.
Die Jagdsaison ist eröffnet (2015)
In Berlin wurden in der vergangenen Saison allein 1.000 Wildschweine geschossen – von insgesamt 6.000, die angeblich in der Stadt lebten. In Brandenburg töteten die Jäger „rein statistisch gesehen täglich jeweils 195 Wildschweine und Rehe“, wie der Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB) meldete. Die Presse stellte ansonsten das Waidwerk heuer eher ins Allgemeine.
Inzwischen haben die Naturschützer eine stabile Konkurrenz zu den Jägern geschaffen, indem sie hier Wölfe ansiedelten, die ganzjährig geschützt und von „Wolfmanagement-Plänen“ flankiert werden. Bei den Wölfen, so argumentieren sie, handelt es sich um eine Art „Gesundheitspolizei“: Sie schützen mithin die Natur. Hinzu kommt die von den Grünen geplante „Agrarwende“, die die „Jäger um die Vorherrschaft im deutschen Wald fürchten“ lässt, wie Die Welt schreibt. Das hat bei etlichen dazu geführt, dass sie sich selbst nun allen Ernstes zu „Umweltschützern“ deklarieren.
Darüber hinaus haben die jagdlichen Recherchen der Intelligenzpresse ergeben: Es gibt unter den deutschen Jägern einen Generationenwechsel und mit diesem immer mehr Frauen in den Jagdgesellschaften. „Nie war die weiblicher, nie war sie jünger,“ jubelt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Der ehemalige -Redakteur der FAZ, Eckhard Fuhr, der jetzt für die Welt-Gruppe bloggt, machte kürzlich seinen Frieden mit der Jagdkonkurrenz – in einem Buch über die „Rückkehr der Wölfe“, die er begrüßt. Er kommt dabei noch einmal auf sein Lieblingsthema „Frauen und Wölfe“ zurück: „Früher musste man, um als richtiger Mann zu gelten, einen Wolf erlegt oder wenigstens eine Gams gewildert haben … Ganz anders bei den Frauen. Sie erlegen den Wolf nicht, Sie lassen sich von ihm küssen.“
Zum Beweis führt Fuhr eine Reihe mehr oder weniger berühmter Frauen an, die über dieses einschneidende Erlebnis ein Buch veröffentlichten. „Der Wolfskuss, so Fuhr, „ist der Stern, der ihnen auf dem Weg zur Selbstfindung leuchtet.“ Aber sie waren nur die Pioniere – inzwischen kann man sogar sagen: „Die Frau scheint zu lernen, den Wolf als Ressource weiblichen Selbstbewusstseins zu nutzen.“
Dies gilt nicht nur für die Frauen, die den Wolf an sich heranließen, und auch nicht für die auf Distanz bleibenden weiblichen Wolfsforscher und -schützer, die er interviewte, sondern auch für jene wachsende Zahl von Frauen, die sich auf die andere Seite schlagen – und in Konkurrenz zum Wolf treten, indem sie sich eine mehrjährige teure Jägerausbildung leisten: das „grüne Abitur, das laut Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) „angeblich schwerer als die Hochschulreife“ ist und etwa 12.000 Euro kostet.
Dass diese „Investition“ für Frauen immer attraktiver wird, auch garderobenmäßig, hat nicht zuletzt mit der Ökonomie zu tun: Bis zur Finanzkrise leisteten sich Großkonzerne wie Siemens, Thyssen-Krupp und die dann „untergegangene“ Landesbank WestLB eigene – bis hin nach Afrika. Dieser Luxus wurde beziehungsweise wird gerade abgeschafft. Mit anderen Worten: „Es ist“, laut FAS, „Bewegung im Markt, das eröffnet Chancen für Einsteiger.“ Und die werden heute schon früh herangeführt.
Die Jagdschule Emsland zum Beispiel verhilft bereits Jugendlichen zum Jagdschein. Was da geschult wird, nennt der Biologe und Jäger Roman Wüst „Urinstinkt“. In der Süddeutschen Zeitung führte er dazu aus, dass das Erschießen von Tieren eine ganz „ursprüngliche Leidenschaft“ und „Grenzerfahrung“ ist, die jedoch immer „nur so gut wie der Mensch“ sei, „der hinter dem Gewehr steht“. In Afrika könne durch die Großwildjagd sogar „Artenschutz betrieben“ werden. Im Übrigen jage man nicht, „um zu töten, sondern, umgekehrt, man tötet, um gejagt zu haben“.
Ähnlich kann der Autor Luzius Theler nach dem tödlichen Schuss auf eine Gams in der Neuen Zürcher Zeitung sagen: „Ich bin glücklich, ich habe gejagt.“ Für ihn hat die wenig mit Naturschutz zu tun: „Das ist eine Mär, die von wohlmeinenden Verbandsleuten und deren Kommunikationsberatern in die Welt gesetzt wurde. , das ist eine Leidenschaft, eine Sucht gar, die uns beglückt, die uns beherrscht und die uns quält. Und ähnlich wie bei den Verlockungen einer ‚Femme fatale‘ können wir nicht davon lassen.“
„Die Leidenschaft des Jägers“, das hat, wenn der Betreffende selbst davon redet, immer etwas von einem Geständnis, einer Beichte. So auch in dem gleichnamigen Buch von Paul Parin, einem leidenschaftlichen Jäger und Angler, der bereits als 13-Jähriger bei seinem ersten tödlichen Schuss auf ein Haselhuhn einen Orgasmus bekam: „Seither gehören für mich und Sex zusammen:“ Dieser Doppelschuss, wenn man so sagen darf, machte ihn zu einem „Mann: glücklich und gierig“.
Der linke Psychoanalytiker Parin weiß, ein „aufgeklärter Mensch jagt nicht“, und auch ein „Jude jagt nicht“ – das sind „gleichermaßen Gesetze abendländischer Ethik. Ich muss mich zu den Ausnahmen zählen.“ Aber er hat von sich selbst und vielen anderen erfahren: „Wenn mein Vater nicht seine gehabt hätte, wären wir Kinder in der strengen und sterilen Familienatmosphäre erstickt.“ Deswegen kann er rückblickend eher genuss- als reuevoll zum Beispiel seine auf eine Gazelle in der Sahara und das Forellenfischen in Alaska – als Sucht – beschreiben. In einem Nachwort rühmt Christa Wolf Paul Parins „Lebenskunst“.
Nun gibt es aber noch eine erregendere Tätigkeit als die des Jägers: die des Wilderers, „der gleichzeitig Jäger und Gejagter ist“, wie der Sozialforscher Norbert Schindler in seiner wunderbaren Studie über das Salzburger Land: „Wilderer im Zeitalter der Französischen Revolution“ hervorhebt.
Und es gibt die Jagdunfälle: nicht nur dass sich, wie in diesem Jahr wieder geschehen, Jäger gegenseitig erschießen, auch dass eine angeschossene Wildsau oder ein wütender Hirsch einen Jäger tötet. Grundsätzlich gilt jedoch wohl: Tiere sind nicht in der Lage, sich zu einem (Sklaven-)Aufstand gegen die Menschen zusammenzutun. Eine Revolution ist mit Tieren nicht zu machen, weswegen der Harvard-Neurologe Marc Hauser ihnen in seinem Buch „Wild Minds“ mangelnde Moral attestiert: „Kein Tier hat je eine Koalition mit Verbündeten gebildet, um das System aus den Angeln zu heben.“
Der deutsche Jäger Eckard Fuhr empfindet die hier eingewanderten und heimisch gewordenen Wölfe zwar als eine Bereicherung, aber mit einzelnen „Problemwölfen“ würde er dennoch kurzen Prozess machen.Es dürfe nicht so weit kommen, dass sie die „Spielregeln“ bestimmen: „Von allen denkbaren Begründungen für die Wolfsjagd wäre das immerhin diejenige, die am meisten einleuchtet.“
Nun muss man aber den Jäger Fuhr in dieser Sache nicht allzu ernst nehmen. Unter anderem der Tierpsychologe Heini Hediger versichert uns, dass die Jäger nur wenig zum Wissen über die Tiere beigetragen haben und beitragen: „Ein Schuss, selbst ein Meisterschuss, ist eben niemals Beginn, sondern stets das Ende einer allzu kurzen und meist nicht sehr vielsagenden Beobachtung.“
.

.
Witzigerweise hat man den „Welt“-Redakteur Eckhard Fuhr nach seinem Wolfs-Buch gebeten, ein Buch über „Schafe“ (2017) zu schreiben. Darin beschäftigt ihn noch immer der Wolf. Gleich der erste Satz lautet: „‘Da drüben im Wald schläft der Wolf‘, sagte der Schäfer, als wir mit seinem Pick-up über brandenburgische Sandwege schaukelten.“ Ungeachtet seines Themas „Schafe“ muß Eckhard Fuhr zugeben: „Wie Schäfer mit dem Rückkehrer Wolf zurechtkommen, das ist eine Frage, mit der ich mich schon lange beschäftige.“
Als Eckhard Fuhr aber mit dem Schäfer bei den Schafen stand, hörte er „in ihrem Meckern und Blöken die Aufforderung, sie endlich einmal angemessen zu würdigen und sie aus ihrer Opferrolle zu befreien.“ Guter Vorsatz, aber der Hobbyjäger Fuhr bekommt trotzdem nicht den Wolf aus dem Thema, höchstens mäßig abgebremst durch schafkulturhistorische Ausschweifungen. Im Zusammenhang einer Schäferidylle von Caspar David Friedrich fällt ihm z.B. ein: Die Schafe liefern nicht nur Wolle und Fleisch, „ohne selbst große Ansprüche zu stellen, sondern auch einen metaphysischen Mehrwert.“ Sie schaffen nicht nur Landschaften, sondern auch die Möglichkeit „für eine Ästhetisierung oder Vergeistigung von Landschaft“. Der gesunde Einfluß der Schafe reicht bei Fuhr bis zum „Seelenfrieden“, den er mit einer gender-soziologischen Aussage einholt: „Junge Frauen entdecken den Schäferberuf für sich. Ältere Männer fangen immer öfter etwas mit Schafen an.“ Weil: „Schäfer bestätigen, dass es Momente der völligen Zufriedenheit tatsächlich gibt.“ Und: „Auf der nie abschließbaren Suche nach dem guten und richtigen Leben man irgendwann dem Schaf begegnet.“
Wenig später kommt Fuhr auf das im zentralasiatischen Hochgebirge lebende Riesenwildschaf, das Argali, zu sprechen, aber dazu fällt ihm sofort ein: „Für Trophäenjäger ist der Argali so etwas wie der Rolls Royce unter den Schafen.“ Schnell fügt der Schafschütze hinzu: „Findet Trophäenjagd unter kontrollierten Bedingungen statt, kann sie für den Bestand einer Wildart sehr nützlich sein.“ Über eine andere Wildschafart, das Mufflon, weiß Fuhr zu berichten: „In der Lausitz, wo die wölfische Wiederansiedlung Deutschlands ihren Anfang nahm, war das ‚Muffelwild‘, wie die Jäger sagen, nach wenigen Jahren ausgerottet.“ Das bezweifel ich, denn die Wölfe siedelten sich zuerst in den riesigen Tagebuch-Löchern der Lausitz an und die wurden doch erst nach der Wende stillgelegt: Wie können da schon Mufflons gelebt haben? Nebenbeibemerkt war hier der erste Wolf 2000 ein dreibeiniger.
Mittlerweile werden zwischen Weihnachten und Neujahr immer schon die neuesten Wolfzahlen veröffentlicht: Gesamtzahl der Wölfe in Deutschland/ Von Jägern erschossene Wölfe/ Illegal erschossene Wölfe/ Überfahrene Wölfe /Von Wölfen getötete Schafe. 2018 war ein gutes Wolfsjahr, so viel habe ich verstanden. Die Bild-Zeitung titelte: „Wolfpanik. Schäfer verkaufte seine Herde“.
.

.
Bärenjagd in Osteuropa
1998 band man dem Biologen Cord Riechelmann in Bulgarien eine lustige Bärengeschichte auf: Als der KP- und Staatschef Todor Schiwkow einmal auf Bärenjagd gehen wollte, requirierten seine Jäger kurzerhand von einem Zigeuner einen Tanzbären. Dieser Bär wurde Schiwkow dann vor die Flinte getrieben. Dabei entriss er jedoch einem der Treiber ein Fahrrad, schwang sich rauf und radelte davon. 2001 hatte sich diese Geschichte derart ausgebreitet, dass sie – in Lettland – schon auf reiche Jäger aus dem Westen umgemünzt wurde, denen auf einmal Gleiches widerfahren sein sollte. Wladimir Kaminer erfuhr dort etwa vom Leiter des Goethe-Instituts in Tallinn, ein estnischer Förster habe neulich für zwei bayrische Jäger einen Zirkusbären in St.Petersburg gekauft, der sich dann mit dem im Wald liegengelassenen Fahrrad einer Blaubeerensammlerin auf und davon machte, ehe die Bayern ihn erlegen konnten.
Wladimir Kaminer machte daraus sogleich einen Lesebühnentext, der bei dem Berliner Bärenpublikum sehr gut ankam. 2006 griff der Wahlberliner Ingo Schulze diese Geschichte noch einmal auf. In seiner Bärengeschichte kommen der Leiter des Tallinner Goethe-Instituts und seine Frau, „eine bildschöne Argentinierin“, auch vor, daneben aber noch ein Jäger mit Namen Arne, der den Bär persönlich aus St. Petersburg abholte und ihn sogleich dem Autor, Ingo Schulze, und seiner Freundin Tanja vorführte, bevor er ihn zum Einsatz in den Wald brachte, wo der Bär sich dann wie gehabt ein Fahrrad klaute und damit aus dem Staub machte.
Wladimir Kaminer konterte 2007 mit einer neuen Bärengeschichte – frisch von der Internationalen Tourismus Börse, wo sich einige Tourismusmanager aus Russland und den ehemaligen Sowjetrepubliken mit einem deutschen Jagdreiseveranstalter trafen: „Wir haben die Zählung der Braunbären abgeschlossen, 1.500 leben allein in unserem Gebiet“, berichtete ein Beamter aus Tomsk „Davon brauchen wir höchstens ein Drittel, 1.000 Bären können also jederzeit abgeschossen werden. Wir haben Personal, fähige Leute vor Ort, die den Bären innerhalb von 24 Stunden ausstopfen, so dass der Tourist seinen Bären gleich mitnehmen kann“. „Sehr gut!“, sagte der Reiseunternehmer und notierte sich das.
Ein Delegierter aus Kasachstan meinte: „Wir haben eine große Muflon-Population – wilde Bergziegen. Unsere Leute vor Ort können die Tiere ausstopfen, bevor der Tourist wieder geladen hat.“ „Das ist alles schön und gut“, unterbrach ihn sein kirgisischer Kollege, „aber nichts ist spannender als eine Pegasen-Safari.“ Es handelt sich dabei um sehr große, aber auch sehr scheue Murmeltiere. Schon mehrmals waren deutsche Jagdreisegruppen unverrichteter Dinge – betrogen quasi – aus Kirgistan heimgekehrt: Das wusste der Reiseveranstalter, er hakte deswegen nach, ob es bereits ausgestopfte Pegasen gäbe. Das musste der Kirgise verneinen. „Na, sehen Sie?“, sagte der Reiseveranstalter fast triumphierend und beendete das Gespräch mit dem Satz: „Zum Anfang schnüre ich ein Standardpaket aus einer Ziege und einem Bären“.
Die Bärengeschichten dringen nicht nur aus dem Osten, dem Einflussgebiet des russischen Bären, zu uns, sie kommen auch von Süden: Seit der allseits kritisierten Exekution des als „Problembären“ charakterisierten italienischen Braunbären Bruno durch bayrische Jäger, Grenzschützer und GSG-9-Beamte kann man hierzulande von einer Bärengeschichtenschwemme sprechen. Die einen wollen Schutzparks für sie haben, die anderen fordern Bären-Management-Pläne (in Analogie zum Brandenburger „Wolf-Management“ und zum Schleswig-Holsteinischen „Miesmuschel-Management“), wieder andere wollen erst einmal das Leben und Treiben der Braunbären in seinen letzten eurasischen Verbreitungsgebieten erforschen lassen. Sie warnen vor vorschneller Wiedereinbürgerung des Raubtiers. Gleichzeitig werden sofortige Schutzmaßnahmen für die angeblich vom Klimawandel bedrohten arktischen Eisbären gefordert – und in Berlin gibt es Knut, den „Weltstar aus Deutschland“ (Vanity Fair).
Der Berliner Bärenwahn geht inzwischen so weit, dass die lebenden Braunbären in ihren Zwingern im Köllnischen Park und am Tierpark Personenschutz bekommen – um zu verhindern, dass sie von militanten Tierschützern befreit werden. Die taz erhielt bereits mehrfach diesbezügliche „Aktions-Bekennerschreiben“. Und der Polizeipräsident warnte die potenziellen Täter öffentlich: „Mit Bären ist nicht zu spaßen!“ Das sei was anderes, als weiße Mäuse aus den Labors der FU zu befreien.
.

.
Arktische Jagdverbote
Jeder erinnert sich noch an die süßen kleinen Robbenbabys auf dem Packeis vor Neufundland, die alljährlich zu tausenden von gewissenlosen „Robbenschlächtern“ mit eisenhakenbewehrten Keulen betäubt wurden, um ihnen bei lebendigem Leibe ihr flauschiges weißes Fell abzuziehen. Die Photos davon gingen 1977 um die Welt. Dahinter stand eine von Brigitte Bardot beförderte Kampagne gegen diese Robbenquäler der Pelzindustrie. Die Schauspielerin wurde damit noch einmal – als Tierschützerin – berühmt. Etliche Staaten beschlossen daraufhin Pelzeinfuhrverbote. Zudem wurde es im Westen generell Konsens: „Pelz ist nicht okay“, wie es auf einer Modeseite heißt. 2017 veröffentlichte Brigitte Bardot ihre Erinnerungen „Tränen des Kampfes“ als E-Book.
Ähnlich war es bei den Walen, die mit zunehmend ausgeklügelter Geschoß- und Verarbeitungstechnik der Walfangflotten an den Rand der Ausrottung gerieten: Hier kam die Rettung durch eine Langspielplatte mit „Walgesängen“, die der Navy-Ingenieur Frank Watlington auf den Bermudas beim Testen eines neuen Unterwassermikrophons zur Ortung von U-Booten aufgenommen und die von der Musikwissenschaftlerin Katy Pane und ihrem Mann, einem Walforscher, als „Lieder“ erkannt wurden. 1970 verkaufte allein „National Geographic“ 11 Millionen Exemplare davon. Seitdem gibt es nicht nur von den besonders gesangsfreudigen Buckelwalen, sondern auch von so ziemlich allen anderen Walen Aufnahmen ihrer „Gesänge“, die man als eine Art „Sprache“ begreift. Für die betroffenen Meeressäuger fielen dabei immer mehr „Walschutzgesetze“ ab. Und Walschützer wie „Greenpeace“ und „Sea Shepherd Global“ jagen inzwischen die letzten Walfangschiffe mit der knappen Ressource Aufmerksamkeit, während immer mehr Walfänger sich zu Guides von „Whale Watchern“ umpositionieren. In den Walschutzzonen sind die großen Meeressäuger inzwischen handzahm geworden, wie der Leiter des Wissenschaftszentrums der Universität Augsburg Jens Soentgen in seinem Buch „Ökologie der Angst“ (2018) berichtet.
Aktuell engagiert sich die „Öko-“ und „Umwelt-Bewegung“ vor allem beim „Klimaschutz“, dabei ist ihr „Symboltier“ der arktische Eisbär, dem durch die Klimaerwärmung und den dadurch verursachten Rückgang des Packeises seine Nahrungsgrundlage, Robben, entzogen wird. Bilder von halbverhungerten Eisbären zirkulieren in den sozialen Medien. Sybille Klenzendorf, Arktisexpertin beim WWF Deutschland, sieht inzwischen mit Zahlen bestätigt, dass die Populationen abnehmen. Die weltweite Klima-Kampagne des WWF heißt „Rettet die Eisbären“. Der Direktor von Zoo und Tierpark in Berlin ließ den junggestorbenen Eisbären „Knut“ ausstopfen und erklärte ihn zum „Artenschutz-Botschafter“. Zuvor hatte die japanische Dichterin Yoko Tawada bereits Knuts Biographie veröffentlicht und der Fake-Journalist Tomm Kummer ein Interview mit dem Zoopublikumsliebling. Ende 2018 wurde im Tierpark ein weiteres Eisbär-Junges geboren.
Eisbären, Wale und Robben ist aber nicht nur gemeinsam, dass sie in der Arktis leben, lange Zeit von Europäern aus Profitinteresse gejagt wurden und nun einen gewissen Schutz genießen, wobei es bei dem für Eisbären um generelle Maßnahmen zum „Klimaschutz“ geht. Aber es gibt außer einer breiten tierschützerischen Abwehr von weißenJägern in die Territorien dieser Tiere, auch noch von der Jagd auf sie lebende Ureinwohner: Inuit vor allem – in Neufundland, Alaska, Nordostsibirien und Grönland.
1951 besuchte der PathologeJohan Hultin das Dorf Brevig in Alaska. Die Inuit (und die Polynesier) hatte die sogenannte „spanische Grippe“ 1918, an der weltweit annähernd 100 Millionen Menschen starben, besonders stark dezimiert. Auf der Suche nach dem Virus war Hultin auf die Idee gekommen, ihn in einem der an der „Influenza“ gestorbenen und im Dauerfrostboden beerdigten Inuit in dessen Lungen zu isolieren. Die in Brevig lebenden Inuit erlaubten ihm, der Leiche auszugraben. Hultin fand im Labor jedoch nur noch Virusfragmente. In den Neuzigerjahren versuchten andere Virusforscher es noch einmal, aber ebenso vergeblich, mit Grippeopfern auf Spitzbergen. Hultin besuchte 1997 erneut das Dorf Brevig, der Wissenschaftsjournalistin Gina Kolata berichtete er (für ihr Buch „Influenza“ 1999): „Das Leben hatte sich dort grundlegend geändert. 1951 hatten sich die Dorfbewohner noch weitgehend selbst versorgt, viele von ihnen hatten noch die alten Walfang- und Jagdtechniken beherrscht. 46 Jahre später gehörte dies alles der Vergangenheit an, die meisten Menschen lebten von der Sozialhilfe, und so war das Dorf, das immer noch einsam über der eisgrauen See lag, mittlerweile ein trauriger, hoffnungsloser Ort. Die Bewohner hatten ihren Stolz verloren.“
Ähnlich war es auf der anderen Seite der Beringstrasse auf den Aleuten und in Nordostsibirien, wo die Berliner Filmemacherin Ulrike Ottinger ihren zwölfstündigen Dokumentarfilm „Chamissos Schatten“ (2016) drehte. Mit der Auflösung der Sowjetunion war die riesige Walfangflotte stillgelegt worden, auf denen die Arbeiter einen Blauwal in 30 Minuten zerlegen konnten, gejagt wurde er mit Kanonenharpunen, die beim Eindringen Luft in seinen Körper pumpten, so dass er nicht unterging. Die dortigen Küstenbewohner mußten ab 1992 wohl oder übel wieder auf ihre alten Jagdtechniken zurückgreifen, wollten sie nicht verhungern, und so gingen sie mit Gewehren und Schlauchbooten mit Außenbordmotor auf Walfang. Ottinger zeigte eine solche Szene, die damit endete, dass sie den Wal zwar töten, aber nicht bergen konnten: Er versank im Meer.
Die als Leiterin von arktischen Tourismusexpeditionen arbeitende Schriftstellerin Birgit Lutz hat mehrmals Inuit-Siedlungen in Ostgrönland besucht, wo an der 2500 Kilometer langen Küste nur noch 2500 Menschen leben und einige Siedlungen völlig verlassen sind, seitdem die Jagd auf Wale und Eisbären fast verboten wurde und die Robbenfelle kaum noch Abnehmer finden. Ihrem Bericht gab die auf Spitzbergen umweltschützerisch engagierte Autorin den provokativen Titel: „Heute gehen wir Wale fangen…“ (2017). Sie interviewte darin u.a. die auf Grönland geborene Dänin Pia Anning Nielsen: „Seitdem die Jagd keine Perspektive mehr für die Menschen hier ist, sind sie nicht mehr stolz. Jetzt können sie sich nicht mehr selbst versorgen, weil der Preis für die Robbenfelle trotz Subventionierung durch die dänische Regierung zusammengebrochen ist.“ Die letzten Jägerschießen zwar weiterhin Robben, 20-30 pro Tag mitunter, aber vor allem zur Versorgung ihrer Schlittenhunde. Ansonsten verfallen immer mehr Inuit dem Alkohol und unter den männlichen Jugendlichen sind Selbstmordeepidemisch geworden: „Für Pia liegt der Hauptgrund dafür in der Erziehung zum Jäger,“ was keine Perspektive mehr hat. Ein dänischer Polizist erzählte: „An der Westküste gibt es Orte, wo man als Däne besser nicht nachts auf die Straße geht.“ Und dennoch wissen alle Grönländer, die weißen Tierschützer, angefangen mit Brigitte Bardot, haben ihnen zwar ihre Erwerbsgrundlage entzogen, aber der Öko-Tourismus der Weißen ist nun ihre einzige „Chance“.
Birgit Lutz zufolge nahm „das Unheil bereits nach dem Zweiten Weltkrieg seinen Lauf mit der Modernisierung Grönlands,“ als die Bevölkerung in die Städte umgesiedelt wurde: 1951 lebten noch fast 70 Prozent der Menschen in Dörfern, 2010 nur noch 15 Prozent. Sie verloren dadurch ihre Jagdgründe, ihres Lebensweise und ihre Dorfgemeinschaften. „Jagdnomade zu sein, wurde verboten, man mußte einen festen Wohnsitz haben.“ Aber das Schlimmste war, dass sie mit Robbenfellen nichts mehr verdienen, „deswegen trinken sie,“ wie eine junge Inuit meint. Im Film der kanadischen Indigenen Alethea Arnaquq-Baril „Angry Inuk“ (2016) ist die entscheidende Abstimmung im Europäischen Parlament über das verschärfte Einfuhrverbot von Robbenprodukten zu sehen: Vor dem Saal standen auf der einen Seite die Tierschützer und verteilten kleine, weiße Robbenbaby-Plüschtiere, auf der anderen standen einige Inuit in ihrer Robbenfellkleidung und versuchten darüber aufzuklären, dass sie gar keine weißen Jungtiere jagen, dass die Robbe für sie das ist, was für die Europäer das Schwein ist, und dass es außer Robben, Wale, Eisbären und Fische keine anderen Nahrungsmittel auf Grönland gibt. Die Inuit ernteten für ihre Aufklärung viele angeekelte Blicke von den EU-Parlamentariern.
Für Wale und Eisbären werden heute auf internationaler Ebene für die Subsistenzjagdder Inuit Quoten zugeteilt: 2014 wurden von neun Walarten in Grönland 3297 erlegt, ein kleiner Teil davon gelangt illegal in skandinavische Feinschmeckerrestaurants. Von den Eisbären wurden im selben Jahr 143 erlegt. Deren Felle werden immer teurer, bis zu 3000 Euro, weil es eine steigende Nachfrage in China gibt. Birgit Lutz findet es unterstützenswert, dass die Inuit weiterhin Robben und Kleinwale jagen, aber da sie sich auf Spitzbergen bei ihrer Sommerarbeit für den Schutz der Eisbären engagiert, fällt es ihr schwer, hier in Ostgrönland nun Sympathie für die letzten Eisbärenjäger aufzubringen.
.

.
Demnächst Eisbären-Jagd?
Auf der riesigen kaum bewohnten Doppelinsel Nowaja Semlja zwischen Barentssee und Karasee lebten schon immer Eisbären. Aber zum einen hat die Klimaerwärmung ihnen inzwischen die auf Robben im Packeis erschwert, weil deren Eislöcher zum Atmen weniger werden. Und zum anderen sind die menschlichen Siedlungen, wo die Bären in den Abfällen Nahrung finden, in letzter Zeit größer geworden. Heute leben rund 2.500 Menschen auf Nowaja Semlja, die meisten gehören der Urbevölkerung, den Nenzen, an. Sie leben von der Fischerei und der Pelzjagd auf Polarfüchse. Daneben wird Kupfer und Steinkohle auf der Doppelinsel abgebaut, und bis 1990 fanden dort 130 Kernwaffenversuche statt. Noch immer sind Teile der Doppelinsel radioaktiv verseucht.
Die Nord- und die Südinsel haben zusammen mit vielen kleineren Inseln eine Fläche von 90.650 Quadratkilometern und eine Länge von 900 Kilometern. Es gibt keine Zählung der dortigen Eisbärenpopulationen aus der Luft, aber allein in der Nähe des Hauptortes Beluschja Guba wurden 52 Eisbären gezählt. Einige Bären würden Menschen „regelrecht jagen“, sagte der Chef der örtlichen Verwaltungsbehörde, Schiganscha Musin. Er lebe seit 1983 auf der Insel, aber so viele Bären habe er noch nie erlebt.
Auf Nowaja Semlja finden sich immer mehr Eisbären ein: „Es sind zu viele Tiere, deshalb haben die Behörden auf der russischen Doppelinsel im Nordpolarmeer den Notstand ausgerufen“, berichtete die „Tagesschau“ vor zwei Tagen. In Kanada nehmen ihre Populationen dagegen dramatisch ab, dennoch treibt der Hunger die Eisbären auch hier immer öfter in die Nähe von Siedlungen. Auf einer WWF-Internetseite heißt es: „Bei den Siedlungen treffen die Eisbären auf Menschen, die mit dem Problem heillos überfordert sind. Gelingt es uns nicht, diese fatale Entwicklung zu stoppen, werden auch die letzten Eisbären bald Geschichte sein.“ In ihrer Not erbeuten sie nun auch Delfine, wie Forscher erstmals beobachtet haben, und gelegentlich fressen sie sich laut „Spiegel Online“ gegenseitig.
In der Beaufordsee in Alaska und im Nordwesten Kanadas ist die Zahl der Eisbären laut WWF seit Beginn des Jahrhunderts um rund 40 Prozent zurückgegangen. 2004 wurden noch 1.500 Eisbären gezählt. Zuletzt waren es nur noch 900. Mit Unterstützung des WWF Deutschlands erhoben Wissenschaftler neue Bestandszahlen in der kanadischen Hudson Bay, indem sie Luftaufnahmen anfertigten und auswerteten. Die im Arctic Journal veröffentlichten Zahlen sind demnach im Vergleich zum Jahr 2014 von 943 auf 780 Individuen gesunken. „Jetzt geht es den Eisbären dort auch zahlenmäßig an den Kragen, da die älteren Tiere sterben und weniger Junge nachkommen,“ sagte die Arktisexpertin beim WWF Deutschland, Sybille Klenzendorf.
In Russland sind Eisbären ganzjährig geschützt, aber auf Nowaja Semlja erwägt man nun, sie durch Abschüsse von den Siedlungen zu vertreiben. Während der WWF fordert, „dass wir das Tempo beim Klimaschutz drastisch erhöhen müssen. Nur dann haben die Eisbären eine Überlebenschance.“
.

.
DDR-Jagd
Bei der modernen Bewirtschaftung des Waldes geht in der BRD Holz vor . In der DDR war es umgekehrt. Das begann damit, dass die Rote Armee im sowjetisch besetzten Sektor 1945 ein absolutes Jagdwaffenverbot anordnete. Ab da jagten fast nur noch Offiziere der Roten Armee. „Die sowjetischen Truppen nutzten diesen rechtsfreien Raum und etablierten einen regen Handel mit Wildbret,“ heißt es in Helmut Suters Jagdgeschichte „ letzter Hirsch – und Macht in der DDR“.
Nachdem die SED alle Wälder zu Volkseigentum erklärt hatte, wurden die sowjetischen Jäger zu „Wilderern“, ihre Abnehmer zu „Hehlern“. Zuvor hatte der Geheimdienst der Roten Armee (SMAD) versucht, die einzudämmen, indem die Zuständigen nur noch „Militärjagdkollektive“ und „Jäger der allrussischen Militärjagdgesellschaft“ zuließen und Schonzeiten festlegten, um „die barbarische Ausrottung seltener Tierarten zu verhindern“.
Die Landbevölkerung klagte derweil über eine „Wildschweinplage“. 1949 wurden deshalb „Jagdkommandos“ aus der Deutschen Bereitschaftspolizei aufgestellt. Im selben Jahr fand laut Suter „die erste Regierungsjagd“ statt. Nach und nach bekamen auch die Förster Waffen, die neuen „Staatsforstbetriebe“ waren für die „Beschaffung, Kontrolle und Verwaltung der volkseigenen Waffen verantwortlich“. Es wurden „Jagdkollektive“ gegründet, theoretisch konnte jeder Jäger werden, aber damit hatte er noch keine Waffe und kein Jagdrevier. Mit einem neuen Jagdgesetz 1953 sicherten sich die Politbüromitglieder interessante Jagdgebiete. Diese 129 „Sonderjagdgebiete“ wurden immer mehr erweitert und immer stärker geschützt. Gleichzeitig wurden bis in die achtziger Jahre die „Jagdhütten“ immer üppiger ausgebaut, zu wahren Jagdschlössern, wo einige Minister allein fünf Köche beschäftigten.
„Für das Geschehen in der Schorfheide war in den fünfziger Jahren Walter Ulbricht verantwortlich.“ Davor war es die SMAD gewesen, davor Hermann Göring und davor die „führenden Würdenträger der Monarchie und der Weimarer Republik“. Bereits die Askanier begründeten dort im 12. Jahrhundert eine Tradition der der Herrschenden. Dass sich in den sozialistischen Ländern fast alle Regierenden der widmeten, geht auf die Tradition der Adels- und der Volksjagd zurück – Letzteres vor allem in Russland und Amerika, wo wenig Menschen auf großem Territorium lebten.
Der Zürcher Ethnopsychoanalytiker Paul Parin schreibt in seinem Buch „Die Leidenschaft des Jägers“: Ein „aufgeklärter Mensch jagt nicht“ und auch ein „Jude jagt nicht“ – das sind „gleichermaßen Gesetze abendländischer Ethik. Ich muss mich zu den Ausnahmen zählen.“
Parin nahm als Arzt am jugoslawischen Partisanenkrieg teil. Über Milovan Djilas, leidenschaftlicher Angler, Mitkämpfer und Vertrauter Titos, schrieb er: „Später, als Dichter, wusste Djilas: Keine Ausübung der Macht über das Volk, über die Schwachen, bleibt ohne verbrecherische Taten. Wäre es nicht besser gewesen, der eigenen Leidenschaft Raum zu geben und den flinken Forellen nachzustellen …?“
Über ihren Dokumentarfilm über deutsche Jäger heute sagte die Regisseurin Alice Agneskirchner der taz: „Jäger wissen viel über den Wald, Wildtiere, Krankheiten.“
Der Zürcher Zoodirektor Heini Hediger meint dagegen, Jäger wüssten wenig über die Tiere, die sie jagen: „Das Jagen bietet wenig Gelegenheit zum Beobachten. Ein Schuss, selbst ein Meisterschuss, ist eben niemals Beginn, sondern stets das Ende einer allzu kurzen und meist nicht sehr vielsagenden Beobachtung.“
Kommt hinzu: Sie jagen nicht wie Raubtiere aus Notwendigkeit, sondern aus Spaß. Und für viele gilt, dass ihnen laut Heiner Müller „das Missgeschick passiert ist, dass sie zwar töten, aber nicht ficken können“.
.

.
Adlige Jäger
Während die Fürstin Daisy ein soziales Projekt nach dem anderen durchführte, hatte ihr Mann, Fürst Hans Heinrich XV. von Pless das Schloß erweitern lassen. Zuletzt hatte es 500 Zimmer und war damit das größte in Schlesien. Und das brauchte der Fürst auch: Wie fast alle schlesischen Adligen war sein Hauptinteresse die Jagd, dazu war er wie fast alle anderen auch höchlichst daran interessiert, dass der Kaiser, Wilhelm II., zu ihm als Jagdgast aufs Schloß kam. Und der kam jedesmal mit einem so großen Gefolge, dass nur die „Magnaten“ mit den größten Schlössern ihn einladen konnten. In einem der gräflichen Schlösser stand in der Halle eine Glasvitrine mit einem Handschuh darin auf einem Kissen, die Gräfin hatte ihn getragen, als der Kaiser dort Jagdgast war und einen Handkuß angedeutet hatte, ihr weißer Handschuh war dadurch zu einer Reliquie geworden. Der Kaiser kam oft in das dem Fürsten von Pless gehörende Schloß „Fürstenstein“, u.a. weil er sich gerne mit der Fürstin Daisy unterhielt, die sich als Engländerin wenig untertänig gab; bei manchen ihrer sozialökonomischen Projekte für die Armen fand sie durchaus Gehör bei ihm. Sie ließ sich 1922 von ihrem Fürsten scheiden und zog in das Gesindehaus des Schlosses, schließlich nach Waldenburg, wo sie 1943 verarmt, aber nicht unglücklich starb. Ihr 1910 geborener Sohn starb 1984 auf Mallorca.
Der Sanierer etlicher heruntergewirtschafteter Güter des schlesischen Adels, Alfred Henrichs, beschreibt in seiner Arbeitsbiographie „Als Landwirt in Schlesien“ (die 2003 von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft DLG veröffentlicht wurde), wie die Kaiserjagd dort vor sich ging: „Zunächst erschienen [z.B. auf dem Schloß des Grafen Johannes von Franken-Stierstorpff, der eine amerikanische „Milliardärstochter“ geheiratet hatte] einige Herren aus der jagdlichen Suite des Kaisers, um die Verhältnisse an Ort und Stelle zu studieren: war das Gelände geeignet, wie war der Wildbestand, wie waren die Schusslisten der letzten Jahre usw.. Auf die Einladung des Kaisers zur Jagd folgten, wenn seine Jagdprüfer ihm positiven Bericht erstatteten, „als nächste Inspizienten kaiserliche Kriminalbeamte, um das Schloss und die Umgebung im Hinblick auf die Sicherheit zu prüfen. Dann rückten Beamte des Hofmarschallamtes an und begutachteten die dem Kaiser im Schloß zugedachten Räume, in unmittelbarer Nähe mußten auch die Zimmer für seine Kammerdiener liegen. Außer seinem Jagdpersonal und den Kriminalbeamten kamen in der Regel auch die Chefs oder deren Vertreter nebst Hilfspersonal der Reichskanzlei, des Zivil-, Militär- und Marinekabinetts mit, die ebenfalls Diener im Gefolge hatten, denn die Regierungsmaschinerie durfte ja nicht stille stehen.
Nun wurden Skizzen vom Jagdgelände angefertigt, in die die einzelnen Treiben, die Stände der Schützen und vor allem die des Kaisers eingetragen wurden. Waren auch diese von Berlin aus genehmigt, dann schickte der Jagdherr seiner Majestät die endgültige Einladung mit Angabe der anderen einzuladenden Gäste. Hierbei behielt sich der Kaiser vor, Streichungen und Änderungen vorzunehmen. Es war auch mitzuteilen, wer die Nachbarstände des kaiserlichen Gastes einnehmen sollte, denn ihre Besetzung galt als besondere Ehre. Am Schluß kam dann noch eine Kommission des kaiserlichen Marstalls, um die Pferde und Wagen zu besichtigen, deren sich der hohe Herr bedienen sollte. Genügten sie nicht, wurden Pferde und Wagen aus Berlin herbeigeschafft. So kam es dann endlich zur definitiven Zusage des Kaisers und zur Festlegung des Jagdtermins. [Woraufhin der „Goldfasanenmeister und der Karnickeldirektor“ informiert wurden, wann und wo sie die mit sehr viel Geld aufgezogenen Tiere frei zu lassen hatten.] Der Fasan spielte in Schlesien eine große Rolle.
Inzwischen setzte sich der Küchenchef des Gastgebers mit der Hofküche in Berlin in Verbindung, um zu erfahren, welche Speisen der Kaiser bevorzuge und wie sie zuzubereiten seien. Der Haus- und Hofmeister erkundigte sich in Berlin, welche speziellen Wünsche der Kaiser für seine Räume habe, die Stellung des Bettes zum Licht, Bettwäsche, Zudecke usw. Dann hatte er zu ermitteln, welche Weine, Zigarren oder Zigaretten der Kaiser bevorzuge usw..
Unmittelbar vor der Jagd waren die Schützenstände, eine Art ebenerdige Kanzeln, für den Kaiser herzurichten, für die es genaue Vorschriften gab. Sie bestanden zunächst aus einer Vorderwand, aus Fichtenzweigen geflochten, und ihre Höhe, breite und Dicke war genau vorgeschrieben. Seitlich schlossen sich zwei Nebenwände an, ebenfalls mit festgelegten Ausmaßen. In die Vorderwand waren zwei Astgabeln einzulassen, auf die der Kaiser die Flinte legen konnte. Auch deren Ausmaße waren genau vorgeschrieben. Sie mußten aus Buchenholz sein, das die sauberste Rinde hat. Der Fußboden der Kanzel war auf einige vorgeschriebene Dezimeter auszuheben, zuunterst mit Schlacke auszufüllen, worauf am Morgen des Jagdtages eine Schicht trockenen Sägemehls kam, damit es keine kalten Füße gab. Die Wege von einem Treiben zum zum anderen wurden mit frischen Fichtenzweigen ausgelegt, und da im dortigen Revier [Buchenhöh des Grafen Johannes] nur wenig Fichten standen, ließ man einige Tage vor dem großen Ereignis mehrere Waggons Fichtenreisig aus dem Riesengebirge kommen.
Wie mir der Wildmeister Urner und der Rentmeister Jendryssek dort sagten, war Wilhelm II., ein Meisterschütze, obwohl er wegen seines verkrüppelten linken Armes nur einarmig schießen konnte. Hinter ihm standen stets zwei Büchsenspanner. Er bekam selbstverständlich den besten Stand und hatte oft die größte Strecke.“ Wenn nicht, korrigierte man die Abschußliste zu seinen Gunsten. Alfred Henrichs erwähnt die Strecke einer fünfköpfigen Jagdgesellschaft des Grafen Schaffgotsch: „2500 Kreaturen“ an einem Tag. Nach seinen Schilderungen der Wirtschaftsweisen des schlesischen Adels kommt er zu dem Schluß: „Diese aristokratische Lebensweise war nur bei einem unendlich niedrigen Lebensstandard der Arbeiterschaft möglich.“
Der schlesische Schriftsteller August Scholtis, der als Jugendlicher zunächst in der Verwaltung des Fürsten Lichnowsky eine Anstellung als Schreiber fand, berichtet in seiner Autobiographie „Ein Herr aus Bolatitz“ (1959), dass „die illustren Gäste des Schlosses sich an späten Nachmittagen auf die Rehbockpirsch zu begeben pflegten“. Der Fürst meinte einmal zu ihm: „Wenn der Kaiser noch mal zur Jagd auf mein Schloß kommt, bin ich bankrott.“
Der Schriftsteller Horst Bienek erwähnt in seinem Buch „Birken und Hochöfen. Eine Kindheit in Oberschlesien“, dass der letzte Kaiser, „der gern zum Fürsten von Pless in das alte Oberschlesien reiste, um dort in den großen weiten einsamen Wäldern zu jagen, einmal mit seinem ganzen Jagdtroß umkehren mußte, weil er durch die aufgeweichten, lehmigen Chausseen nicht durchkam. Verständlich, daß Hitler gleich eine Reichsautobahn quer durch ganz Schlesien bis an die polnische Grenze plante, aber die ist nur bruchstückweise fertig geworden, dann kam der Krieg. Übrigens sagt man vom Fürsten Pless, daß er reicher als der Kaiser gewesen sei.“
.

.
Proletarische Jagd
Es gibt neben diesen absurden Jagden der Reichen auch jagende Arbeiter und Kleinbauern. Der englische Schäfer James Rebanks schreibt – bezogen auf die adlige Fuchsjagd – in seinem Buch „Mein Leben als Schäfer (2016): „Bei uns im Lake District ist die Jagd keine vornehme Angelegenheit, bei der man sich ins rote Jackett wirft wie in den alten Grafschaften. Hier laufen Arbeiter zu Fuß einer Meute ausgebuffter Berghunde hinterher, doch auf unserem zerklüffteten Terrain kommt der Fuchs oft mit dem Leben davon. Auf den nächstgelegenen Straßen verfolgen scharfäugige alte Männer die Jagd vom Auto aus mit dem Fernglas…In meiner Kindheit versammelten sich gegen Ende der Lammzeit die Männer noch einmal und streiften durch die Wälder, um Krähen zu schießen – nach den aufreibenden Arbeitswochen wieder ein gemeinsames, geselliges Unternehmen.“ Seitdem die Krähen als Singvögel ganzjährig geschützt sind und die Region außerdem zu einem Nationalpark erklärt wurde, wird heute die Krähenjagd dort wahrscheinlich nur noch heimlich und durch Einzelne stattfinden.
.

.
Disco-Jagdfieber
„Zählten sie damals zu den Stammgästen der Disco im ‚Stagge’s‘? Besitzen Sie noch Bilder aus dieser Zeit? Erinnern Sie sich an besonders kuriose oder bemerkenswerte Begebenheiten aus der Ära Fritz Stagge?“ Das fragte 2015 der Osterholz-Scharmbecker Regisseur Stefan Malschowsky die Leser des Bremer Weser-Kurier. Vier Jahre brauchte er angeblich, um den Gründer der Discothek Fritz Stagge „zum Interview zu bewegen“ – für einen Film über ihn: sein „Leben und Werk“. Gleich die erste Bemerkung über dieses „Werk“ machte mich stutzig: Es ist da von seiner „Diskothek im Keller des elterlichen Hotels“ die Rede. Das habe ich ganz anders in Erinnerung! Der Regisseur erklärte: „Fritz Stagge personifiziert für mich den sprichwörtlichen ,kleinen Mann‘, der jedoch nicht nur kulturell etwas bewegte, sondern darüber hinaus auch noch Sozialarbeit leistete, wenn auch vielleicht eher unbewusst.“ Auch das habe ich anders in Erinnerung: Für mich personifizierte Fritz Stagge eher den ‚großen Mann‘ – insofern er erfahrener war und Besitzer der ersten richtigen Discothek in der Gegend. Vorher gab es nur an den Wochenenden in den Hochzeitssälen von Osterholz-Scharmbeck und Worpswede nach dem Polka-Schwof der Alten Discomusik für die Jungen.
Fritz Stagges Eltern besaßen ein altes Wirtshaus mit Hotel am Marktplatz, er arbeitete in einer Lackfabrik in Ritterhude. Mitte der Sechzigerjahre fing er an, den Dachboden des Hotels zu einer Discothek auszubauen. Und nicht den Keller – vielleicht kam das später (als ich schon lange wegen der Bundeswehr in Westberlin lebte). Ich lernte Fritz Stagge jedenfalls auf dem Dachboden kennen, da war die Theke schon so gut wie fertig.
Auf „teufelsmoor.eu“ heißt es: „Am 15. Februar 1964 fand bei Stagge‘s der erste ‚Plattenabend‘ und im Mai das erste Livekonzert statt.“ Die Disco unterm Dach muß aber später angelaufen sein. Ich arbeitete damals bei der US Air Force, die auf einem Truppenübungsplatz in der Garlstedter Heide ein „Radio Relay Station“ betrieb – mit 10 Airmen, wovon einer ein Unteroffizier war, die nächsten Offiziere saßen in Bremerhaven und kamen nur alle paar Wochen kurz vorbei. Dann versteckten wir unsere Frank-Zappa-Platten, weil sie verboten waren. Laufend wurde einer aus der Gruppe nach Vietnam versetzt, dann gab es jedesmal eine Abschiedsparty auf der Station, zu der auch Deutsche aus den umliegenden Dörfern und von „Stagges“ kamen. Die Militäreinrichtung war Teil eines US-Warnsystems rund um die Sowjetunion und bestand aus der eigentlichen Radiostation und zwei Bungalows – einen zum Schlafen und einen mit Kino, Billard, Bibliothek, Küche und Bar (die regelmäßig von Haake Beck bestückt wurde). Die Unteroffiziere waren durchweg Afroamerikaner. Sie hatten vorher Elektronik studiert – und waren nun im Herzen mehr oder weniger „Black Panther“. Bis auf eine Ausnahme waren sie alle musik- und tanz-wütig und das war auch der Grund, warum wir, (muß ich jetzt sagen, weil ich nie allein bei Stagges war) dort aufkreuzten: Einer hatte erfahren, dass demnächst eine „Disco in Osterolz-Schrambeck“ aufmachen würde und weil er besonders musikbesessen war wollte er schon mal Plattenwünsche anmelden, Funk- und Soul-Music vor allem. Und Fritz Stagge war dann auch interessiert. Der Sergeant fuhr als einziger einen dicken Amischlitten. Wenn Disco und Bar dicht machten gegen Morgen ließen sich damit die in den Moordörfern vor Bremervörde wohnenden und vom Tanzen und Alkohol müden Mädchen nach Hause bringen. Ich erinnere mich an eine Fahrt, die endlos war, weil ein Hase die ganze Zeit vor dem Auto herlief und sich nicht aus dem Scheinwerferkegel ins Dunkle traute. Der Sergeant war rücksichtsvoll, aber er genoß auch das Schritttempo. Aus der anderen Richtung – Worpswede, Fischerhude, Ottersberg – kamen viele Mädchen, die dort irgendwas mit Kunst machten, u.a. als Lehrling einer Goldschmiedin, Fotografin oder Töpferin, oder die als Schwesterschülerinnen in einem Krankenhaus arbeiteten. Sie wohnten alle nicht mehr bei ihren Eltern und nahmen erstmalig die „Pille“.
Einer der Sergeants mietete für 50 DM monatlich ein leeres Forsthaus ohne Licht und Wasser auf halber Strecke nach Stagges. Der Anlaß war jedoch unangenehmer Art: Es waren zwei weiße Soldaten auf die Station versetzt worden, sie kamen aus Texas, bezeichneten sich als „Deutsche“ und waren Rassisten. Weil es früher oder später mit ihrem schwarzen Vorgesetzten zu einem Zusammenstoß gekommen wäre, bei dem sie den kürzeren gezogen hätten, wollte er sichin den „Barracks“ rar machen. Mit den Deutschen in den Dörfern und in der Disco gab es damals nie einen Konflikt, höchstens, dass einer der Airmen, ein stämmiger Ire namens Dan, im Suff gelegentlich verhaltensauffällig wurde. Aber ich glaube, Fritz Stagge hatte das alles im Griff. Im übrigen fuhren wir, wenn bei ihm nichts mehr los war, auch gerne weiter – nach Bremen oder Hamburg. Für die Amis gab es keine Alkoholkontrollen. Sie waren die Macht.
Die Air-Force-Station wurde jedoch in den Siebzigern geschlossen und die Army rückte ein – in Kasernen, die die Bundesregierung ihnen auf dem Garlstedter Truppenübungsplatz errichtet hatte. Für ihre zuletzt 4000 Zivilisten und die Familien der Armeeangehörigen wurden zudem in Osterholz-Scharmbeck Wohnungen und Sozialeinrichtungen gebaut, zwischen beiden Orten verkehrten Armeebusse, auf denen „O-Beck“ stand. Schon bald konnte man in vielen deutschen Geschäften mit Dollars zahlen und sagte auch „O-Beck“. Die Quantität und Qualität der dort stationierten Amisoldaten, deren Division sich „Hell on Wheels“ nannte, führt jedoch dazu, dass es immer wieder zu „Rangeleien“ kam, auch bei Stagges, wie ich „Wikipedia“ entnehme. Die Disco wurde irgendwann für die Soldaten verboten: „Off Limits“. Bei der Army gab es eine Trennung in Schwarze und Weiße bei ihren Amüsierorten, nicht zuletzt wegen ihrer unterschiedlichen Musikvorlieben.
Schon bald nach der Wiedervereinigung räumte die Armyihren Standort Garlstedt. Die Kasernen, Schulen und Wohnhäuser übergab sie 1993 der Bundeswehr, die daraus z.T. eine „Truppenschule für Logistik“ machte. Bei Stagges kam die Musik der Djs langsam in ein immer unsicheres Trudeln. 2000 verkaufte Fritz den renovierungsbedürftigen Laden, da war er 56. „Das große Herz muss Fritz Stagge schwer geworden sein. schrieb einer seiner DJs im „Weser Kurier“ 2010. „Jahrzehntelang hatte es selbstbewusst geklungen: ‚Wir sind nicht im Ritz, sondern bei Fritz‘.“ Nun gibt es jedoch jede Menge Erinnerungsbemühungen um ihn und seinen Schuppen – wie man diesem Artikel bereits unschwer entnehmen kann.
.

.
Jagd auf vermeintliche Schädlinge
– Wollhandkrabben. Gemeint ist die „chinesische Wollhandkrabbe“ (Eriocheir sinensis), sie wird etwa handtellergroß, ihr runder Panzer ist oben braun, die Unterseite heller bis weiß, die Scheren haben einen dichten Haarpelz, daher der Name Wollhand. Ihre kleinen Augen können rot aufglühen, wenn es darauf ankommt, las ich in einem Kinderbuch. Hierzulande zählt sie zu den invasiven Arten, so wie auch das chinesische Kapital auf dem Berliner Immobilienmarkt. Beide werden scheel angesehen, aber die chinesische Wollhandkrabbe hat sich schon lange vor dem Post-Maoismus in Europa ausgebreitet.
In China war noch Bürgerkrieg, da wurden 1935 in der Elbe schon 500 Tonnen chinesische Krabben gefangen. Auf Befehl der Naziregierung, die den Kampf gegen invasive Arten aus rassistischen Gründen quasi „erfand“, sammelten 1936 die Menschen in Norddeutschland über 20 Millionen Krabben ein. Geholfen hat es wenig, erst die Gewässerverschmutzung nach dem Krieg führte fast zu ihrer Auslöschung. Mit der Deindustrialisierung und den diversen Umweltschutzmaßnahmen erholte sich die Population jedoch wieder. Im Gegensatz zum chinesischen Kapital werden sie hier nun auch wieder bekämpft. Aber nicht überall: In Havel, Spree, Elbe und in den märkischen Seen haben die Fischer zu DDR-Zeiten immer über die vielen Wollhandkrabben in ihren Netzen geklagt, die sie wegwarfen, aber seit der Wende verdienen sie damit nun gelegentlichmehr als mit ihren Fischen, weil die vietnamesischen Asiamärkte sie ihnen gerne abnehmen – für etwa 5 bis 8 Euro das Kilo. Im Berliner „Dong-Xuan-Center“, dem zweitgrößten Asiamarkt Europas, werden sie lebend verkauft.
In den Berliner Gewässern hat sich derweil noch eine andere „invasive Art“ ausgebreitet: der rote amerikanische Sumpfkrebs. In den vergangenen Monaten fing ein Fischer allein in den Teichen zweier städtischer Parkanlagen 38.000 Exemplare. Er darf die Krebse verkaufen. Sie sind begehrt. Die alteingesessenen chinesischen Wollhandkrabben ernähren sich zum Teil von den neuen amerikanischen Sumpfkrebsen.
Ob die chinesischen Wollhandkrabben sich in den asiatischen Plastikwannen der vietnamesischen Händler heimischer fühlen als in den brandenburgischen Gewässern, darf man bezweifeln, denn sie haben, anders als die Sumpfkrebse, eine komplizierte Vermehrungsstrategie: Zwar leben sie im Süßwasser, auf dem Grund von Flüssen, wo sie sich vorwiegend von Pflanzen, Muscheln und Aas ernähren und in die Ufer graben, aber im Frühsommer wandern sie mit der Strömung in Richtung Meer. Im Brackwasser der Flußmündungen warten bereits die zuvor angekommenen Männchen auf die Weibchen, um sich mit ihnen zu verpaaren. Diese suchen danach noch salzhaltigeres Wasser auf, wo sie ablaichen (so halten es im nebenbeibemerkt auch „unsere“ etwas kleineren Strandkrabben, die in der übrigen Welt als invasive Art gelten). Die etwa 500.000 Eier, die sich die weiblichen Wollhandkrabben zwischen ihre Hinterbeine kleben, brauchen vier Monate zur Entwicklung.
„Anschließend laufen die Weibchen zurück in die Brackwasserzone der Flussmündung und geben die schlupfreifen Eier ins Wasser ab. Danach sterben die Muttertiere; sie pflanzen sich also nur einmal fort. Auch die Männchen kehren nicht mehr zurück,“ heißt es auf Wikipedia. Wenn man sie zölibatär hält, leben beide etwas länger. Ihre Larvenmüssen sich fünf Mal häuten, bis sie wie kleine Wollhandkrabben aussehen, im Süßwasser können sie erst als ausgewachsene Tiere leben. Dazu versammeln sie sich im Brackwasser und wandern dann kollektiv die Flüsse hoch – und immer höher.
Wenn die z.B. vor der Elbemündung groß gewordenen Wollhandkrabben nach etwa 600 Kilometern flußaufwärts bei Barby in die dort einmündende Saale krabbeln, sind sie drei Jahre alt. Für 200 Kilometer brauchen sie mithin rund ein Jahr. Hindernisse, wie z.B. Stauwehre, umgehen sie auf dem Land. Sie wandern auch über Land zu Teichen, Gräben und Seen, wo sie sich für einige Zeit ansiedeln –und dabei die „Uferund Deiche unterhöhlen,“ um Schutz zu suchen, solange sie ihren Panzer wechseln und der neue noch nicht wieder hart geworden ist. Dabei werden auch fehlende Gliedmaßen und Scheren ersetzt. Wegen ihrer Paarung und Aufzucht in Salzwasser(die Ostsee ist ihnen bereits zu salzarm) sind ihrem Vorwärtsdrang im Süßwasser flußaufwärtsGrenzen gesetzt, einige schaffen es immerhin bis in die Moldau nach Prag. Mit Beginn der Geschlechtsreife, nach zwei bis drei Jahren, drehen sie wieder um und beginnen ihre sogenannte „Reproduktionswanderung“ zum Meer zurück.
So geht es bei den Wollhandkrabben-Generationen hin und her, wobei ihnen die erheblich verbesserte Wasserqualität in den Flüssen von Nutzen ist, weil sie u.a. zur Vermehrung der Flußmuscheln beigetragen hat, von denen die Wollhandkrabben zum Teil leben. Den Anglern fressen sie auch gerne ihre Köder vom Haken ab oder sie plündern die Aalreusen der Fischer, die sie dabei zerstören.Andersherum fressen Aale aber auch gerne Wollhandkrabben und Angler nutzen das Krabbenfleisch als Köder. Ebenso mögenMöven und Tauchvögel Wollhandkrabben. Die kleinste aller Lummen nennt man sogar „Krabbentaucher“, im Norden heißt er Eisvogel: „Er ist der beweglichste, munterste und gewandteste unter den Flügeltauchern,“ schriebAlfred Brehm. Ähnlich äußerte sich der isländische Autor Gudmundur Andri Thorsson in seinem Roman „In den Wind geflüstert“ (2018) über den Krabbentaucher.
Weniger elegant dezimiert man die Wollhandkrabben in Norddeutschland: Wenn sie dort aus den Gräben und Tümpeln kommen, um in die Flüsse zu gelangen, werden sie zu Tausenden auf den Straßen plattgefahren. Und an der Elbe-Staustufe bei Geesthacht werden sie mit automatischen Fanganlagen zu Millionen eingesammelt (bis zu 125 Tonnen pro Jahr) und zu Viehfutter, Dünger oder Substrat für Biogasanlagenverarbeitet.
Im Stedinger Land gibt es jedoch inzwischen einige Fischer, die sie fangen und nach Asien exportieren, wo ihre Bestände rückläufig sind, weil die Flüsse immer mehr industriell verdreckt werden. Die Wollhandkrabben sind dort jedoch derart beliebt – eine Delikatesse, dass man sie (die in China „Shanghai-Krabben“ genannt werden) in Aquakulturen züchtet: „Der Handelswert einer einzelnen Krabbe kann 40 Euro erreichen,“ berichtet der Weser-Kurier. „Auch in Deutschland finden sich Restaurants, die die Tiere insbesondere zu deren Wanderzeit anbieten. Einige Stedinger Angler hätten das in den vergangenen Jahren wahrgenommen, weißein Fischereivereinsmitglied. Sie hätten Wollhandkrabben gefangen und an einen regionalen Fischhändler verkauft. Sie werden möglichst lebend nach China versandt. Aber das Fangen sei eine hässliche Arbeit, meint einer der Fischer, „die Tiere haben lange scharfe Scheren.“
Auch das Essen von Wollhandkrabben ist für uns gewöhnungsbedürftig. Der taz-Autor Johann Tischewski erwarb ein Kilo – rund 30 handgroße Tiere – von einem Fischer auf dem Kutter „Cux 25 Elvstint“ am Fischmarktanleger, der die Tiere direkt von Bord verkauft. Als Tischewski zu Hause das Netz öffnete, entflohen sie ihm „in alle Richtungen“. Er fing sie ein und warf sie lebend in kochendes Wasser, nach einer Weile wurden sie rot, einige verloren ihre behaarten Beine und die Scherenhände. „Als Beilage mache ich mir Reis und Chinagemüse. Mit einem Messer breche ich die erste Krabbe auf. Mir kommt eine unangenehm riechende, schmierig gelbe Flüssigkeit entgegen. Ich pule das glitschige Fleisch aus dem Panzer und probiere es. Aber ich bekomme es nicht runter. Auch mit Reis und extra viel Sojasoße nicht.“ Am Ende landen alle Wollhandkrabben in seiner Biomülltonne.
Dass man sie lebend kocht, hat in den USA bereits die Tierschützer auf den Plan gerufen, wobei sie sich jedoch erst einmal auf den Großkrebs Hummer konzentriert haben, denn in Rockland im Bundesstaat Maine findet alljährlich die weltgrößte „Hummerparty“ statt, auf der die Tiere zu tausenden lebend in riesige Kochtöpfe geworfen werden. Das rohe Massenvergnügen in der „Hummerhauptstadt“ wurde vom Schriftsteller David Foster Wallace kritisiert – und das ausgerechnet in einer amerikanischen Gourmet-Zeitschrift. Auf Deutsch erschien sein Essay „Am Beispiel des Hummers“ 2009. Argumentationshilfe hatten ihm neben den Tierethikern einige Krebsforscher geliefert, indem sie feststellten, dass Hummer „Nozizeptoren“ besitzen und demzufolge Schmerzen empfinden. Auch die hiesigen Tierschützer fordern deswegen eine Gesetzesänderung: „Die derzeit gültige Verordnung über das Schlachten von Hummern stammt aus dem Jahr 1936, als über die Leidensfähigkeit der Krustentiere noch wenig bekannt war.“
Die Krabben zählen ebenfalls zu den Krustentieren (eine Küchenbezeichnung), man nennt sie auch Kurzschwanzkrebse. Beide, Hummer wie Krabben, gehören zur Ordnung der Zehnfußkrebse, deren erstes Beinpaar zu „Knackscheren“ umgebildet ist. Sie empfinden nicht nur Schmerzen, wenn sie in kochendes Wasser geworfen werden, sondern reagieren auch sensibel auf Stress, wie ich einmal unbeabsichtigt bei einem europäischen Flußkrebs (auch „Edelkrebs“ genannt)herausfand, den ich mir für 1 DM 50 in einem Fischgeschäft gekauft und in mein Kaltwasser-Aquarium gesetzt hatte.
Um ihn, den wir Fritz nannten, gruppierte sich fortan das Geschehen im Becken. Er hockte in einer nach vorne und hinten offenen Steinhöhle in der Mitte des Aquariums und wurde von uns mit Leberwurst gefüttert, die er in kleinen Portionen bekam – zusammen mit einem Kieselstein, damit das Fleisch zu Boden sank. Er brauchte nur wenige Sekunden, um den „Braten“, auch wenn der 40 Zentimeter weg von ihm auf den Beckenboden gesunken war, zu finden. Wenn man mit einem Kescher im Aquarium rumfuchtelte versteckten sich alle Fische hinter ihm, während er vorne tapfer versuchte, das Gerät mit seinen Scheren abzuwehren. Entgegen der Meinung vieler Aquarianer fraß er nicht einmal die kleinsten Fische, sondern beschützte sie eher. Ich fand, dass er, anders als die Fische, Muscheln und Schnecken im Becken, so etwas wie eine Persönlichkeit war. Als ich einmal (und nie wieder) einem Nachbarn zuliebe in unserem Dorfsee angelte, fing ich einen Hecht. Statt ihn zu schlachten setzte ich ihn ins Aquarium, wo er nach und nach alle Fische auffraß, und daß jedesmal so blitzschnell, dass ich nicht mit den Augen folgen konnte. Der Flußkrebs war unter seinem Stein zwar vor ihm sicher, aber die Bedrohung, die Angst, durch diesen großen Raubfisch „stresste“ ihn derart, dass er starb.
Charles Darwin hätte dieses ganze Fressen und Gefressenwerden unter Wasser glatt als eine prima Bestätigung seiner „Übertragung der schlechten Angewohnheiten der englischen Bourgeoisie auf die Natur“ (Marx) empfunden. Aber das Leben besteht nicht nur aus Fressen, Ficken und Fernsehen (Unterwasserfilme). Das gilt auch für die chinesische Wollhandkrabbe, die im Internet als ein „interessanter Pflegling im Aquarium“ bezeichnet wird. „Sie benötigt für eine artgerechte Pflege ein geräumiges Aquaterrarium mit einer Abdeckung, das ihr ausreichend Verstecke unter oder zwischen Steinaufbauten bietet. Bietet das Aquaterrarium nicht ausreichend Platz oder Versteckmöglichkeiten, sind die Tiere untereinander unverträglich. Zum Wohlbefinden der Tiere trägt es außerdem bei, wenn ein Teelöffel Meersalz auf 100 Liter Wasser beigegeben wird. Gefüttert werden Chinesische Wollhandkrabben mit Fischfleisch sowie Insektenlarven und kleinen Krebstieren. Sie sind auch an hochwertiges Flockenfutter gewöhnbar.“
In Delmenhorst lebt ein Aquaterrarianer, der eine Wollhandkrabbe in seinem Becken hält, die „Wolli“ heißt. Er hat an der Bremer Universität ein paar Semester Biologie studiert und dabei an einem „Crustacea Praktikum“ teilgenommen, bei dem es darum ging, die Krebstiere kennen zu lernen im Hinblick auf ihre Extremitäten, die sich im Verlauf der Evolution zu den unterschiedlichsten Werkzeugen entwickelt haben, wobei es konkret um das Präparieren der Extremitäten von Wollhandkrabben ging, die aus Beifängen des Bremer Amtsfischers stammten – zwar nicht gekocht, aber auch tot. Zum Praktikum gehörte eine „Meeresbiologische Exkursion“, auf dieser fing er eine lebende Wollhandkrabbe, die er mit nach Hause nahm und in sein Aquaterrarium tat.
Ihr Verhalten unterschied sich nicht wesentlich von meinem Flusskrebs, glaube ich, außer das „Wolli“ wie alle Krabben seitwärts läuft und dass er es geschafft hat, ihr das Futter mit der Hand zu reichen, anfänglich aus Vorsicht mit einer großen Pinzette. Er hält sie schon ein paar Jahre und meint, dass sie wohl langsam geschlechtsreif wird und sich ihr „Wandertrieb“ in Richtung Meer bemerkbar macht, indem sich ihre Ausbruchsversuche aus dem Becken häufen. „Sie wird immer nervöser.“ Das unterscheidet sie von meinem Flusskrebs, der ein paar Jahre lang relativ gelassen in seiner Steinhöhle hockte. Wollis Besitzer weiß, dass einige Krabbenfischer bereits festgestellt haben, dass ihre Fänge langsam immer geringer ausfallen. Die Ursache ist noch unklar: Werden zu viele gefangen oder werden die Tiere immer schlauer? Er würde gerne irgendwann ein Buch über die Wollhandkrabbe schreiben: „Anders als in China gibt es hierzulande so gut wie keine Verhaltensforschung über sie.“ Und das Gerede über „invasive Arten“ und ihre „Bekämpfung“ findet er typisch deutsch und doof.
.

.
Jagd auf Nützlinge
Neuerdings ist viel vom „Schwarmverhalten“ die Rede, es gibt aber auch einen Schwarmzwang. Man sieht das bei den Heringen: Sie sterben, wenn sie von ihrem Schwarm getrennt werden. Der Hering existiert nur im Schwarm. Und er ist sehr schwierig in Gefangenschaft zu halten, meint der Aquariumspfleger im Bremerhavener Zoo, Werner Marwedel. „Das Schlimmste ist ein Stromausfall. Die sind es gewohnt, dass morgens das Licht angeht und abends aus. Wenn es aber mal tagsüber ausgeht, dann heißt das für sie: Freßfeind von oben! Die sehen einen Schatten und hauen ab, wobei sie hier dann gegen die Scheibe oder die Steine schwimmen und sich mindestens den Kiefer brechen. Die haben relativ schwache Kiefern. Man sieht hier in unserem Becken, dass viele von ihnen einen deformierten Kiefer haben, das hat aber andere Ursachen, wir sind noch am Rätseln: möglicherweise liegt es an der Nahrung, eine Mangelerscheinung also. Heringe verlieren auch sehr leicht ihre Schuppen, die sehr lose aufsitzen und nur durch eine extrem schwache Außenhaut geschützt sind. Wenn man diese Fische anfaßt oder sie erschreckt irgendwo gegenschwimmen, dann rieseln die Schuppen wie Konfetti herunter. Die Stellen, wo die Schuppen fehlen, werden dann leicht von Bakterien und Pilzen befallen. So kostet uns jeder Stromausfall einige Heringe. Wenn so ein Schwarm eine Weile im Aquarium gelebt hat, dann ist die Gefahr mit der Zeit allerdings nicht mehr so groß: sie lernen es, sich darauf einzustellen, dass sie hie nicht mehr derart weitläufig – wie im Meer gewohnt – reagieren können. Dieser Schwarm hier, von ca. 20 Fischen, das waren mal 200. Die kriegen wir aus dem Aquarium in Wilhelmshaven, die haben einen eigenen Kutter mit einer Fangvorrichtung im Jadebusen: Ringwadennetze, die funktionieren mit vertikalen Absperrungen, mit denen die Heringe gewissermaßen in die Kammern reingelotst werden, wo sie dann rausgeschöpft werden, also gar nicht an die Luft kommen. Das ist die schonendste Art des Fangens überhaupt. Bei uns haben einzelne Heringe schon bis zu sieben Jahre überlebt. Sie sind Dauerfresser, die füttert man besser mehrmals am Tag wenig, als einmal viel. Das habe ich aber erst im Laufe der Zeit herausgekriegt.“
Der auf Rügen geborene Theaterregisseur Holger Teschke arbeitete ab 1978 wie sein Vater auch auf einigen Heringskuttern. Dort knietief in Heringen stehend bemerkte er irgendwann, „dass kein Hering dem anderen glich“.
Es gab Zeiten, da umfassten die Heringsschwärme im Atlantik Milliarden Tiere, man konnte sie mit Eimern schöpfen. Zunächst waren sie als Fastenspeise und später, um die bedrohliche „Eiweißlücke“ in der Volksernährung zu schließen, derart begehrt, dass Städte wie Emden damit reich wurden. Aber mit der Zeit wurden die Heringsschwärme immer kleiner. Bereits im 17. Jahrhundert kam es deswegen zwischen England und Holland zu einem „Heringskrieg“.
In den Sechzigerjahren starteten amerikanische Fischforscher ein Experiment mit kleinen Zierfischen, das die Frage der Überfischung im Modell klären sollte. Dazu richteten sie zwei Aquarien mit ähnlichen Populationen ein. Aus einem fischten sie regelmäßig einige der Zierfische ab. Deren Fruchtbarkeit konnte das lange Zeit ausgleichen, aber ab 50% „reichte die Vermehrungsfähigkeit nicht mehr aus“, schreibt H.W.Stürzer, Chefreporter der „Nordsee-Zeitung“, in seinem Buch „Tatort Meer“ (2005). Es ging den Amerikanern bei ihrem Experiment darum, den „sozialistischen Weg zum Reichtum der Fischgewässer zu widerlegen“. Die Sowjetunion hatte 19 Millionen Ostseeheringe im schwach salzhaltigen Aralsee ausgesetzt und dieser relativ kleine Schwarm hatte sich schnell vermehrt, was die sowjetischen Fischforscher auf die größere Freßkonkurrenz in den dichten Schwärmen der Meere zurückführten. Sie folgerten daraus laut Stürzer: „Intensiver Fischfang halte die Schwärme kleiner und begünstige das Wachstum der Überlebenden. Überfischung war damit zu einem Prinzip des immerwährenden Reichtums geworden.“ Die amerikanischen Zierfische hatten nun zwar bewiesen, dass das ein Irrweg war, aber die Bundesforschungsanstalt für Fischerei in Hamburg favorisierte die sowjetische Theorie weiterhin, indem sie 1963 verkündete, dass der Schollenbestand an der deutschen Nordseeküste eine jährliche Abfischrate von 70% klaglos überstehen würde. Die Bremerhavener „Nordsee-Zeitung“ witzelte daraufhin: „Eine optimale Ausnutzung des Meeres macht also eine recht intensive Befischung sogar notwendig.“ Dabei hatte schon die bisherige Ausnutzung dazu geführt, dass die Fänge immer mehr zurückgegangen waren, von 20 westdeutschen Reedereien arbeiteten 18 bereits mit Verlust. Der Verband der Hochseefischerei forderte in dieser Situation: Zinsverbilligung für Schiffs-Neu- und -Umbauten und die Suche nach neuen Fanggebieten. Nur so sei die Katastrophe zu verhindern. Alte Fanggebiete seien ausgefischt oder hinter vorgeschobenen Seegrenzen von Küstenstaaten nationalisiert. Die Sowjetunion machte es vor: „Sie entwickelte eine Flotillenfischerei nach Walfangmuster und ließ in Kiel eine Serie von 24 mittelgroßen Heckfängern bauen, zudem in Leningrad einen Super-Fänger. Für dessen Besatzung waren 582 Kojen vorgesehen, davon 270 für Industriearbeiter. Sie sollten auf einer Reise 10.000 Tonnen Frostfisch oder 10 Millionen Fischkonserven produzieren. Stürzer titelte: „Fischbestände schrumpfen – Flotte wächst“.
Zur besseren Bewirtschaftung der Bestände fand 1971 eine Konferenz in Moskau statt. Die sowjetischen Fischereiexperten drehten dort ihre Fang-Theorie um: „Durch Verminderung des Fischereiaufwands um die Hälfte könnten die Erträge von jährlich neun Millionen Tonnen im Nordostatlantik nicht nur erhalten, sondern noch gesteigert werden…Für Mindestmaschen sei es bereits zu spät, deshalb sollten Gesamtfangmengen und daraus Fangquoten für die einzelnen Länder festgelegt werden.“
Vier Jahre später luden amerikanische Fischereiexperten von der „National Oceanic and Atmospheric Administration“ erfahrene Heringsspezialisten und ihre sowjetischen Kollegen zu einer Expedition an die „Georges Bank“ vor dem Golf von Maine ein, um dort in 32 Metern Tiefe das Ablaichen von Heringen zu verfolgen. Dazu charterten sie vom Helmholtz-Zentrum in Geesthacht das Unterwasserlabor „Helgoland“. U.a. fanden sie heraus, dass es viele auch innerartliche „Larvenräuber“ gibt und dass die kommerziell genutzten Bestände an Kabeljau, Schellfisch und Plattfisch zurückgehen, während die Zahl der Knorpelfische – Rochen und Hundshaie – zugenommen hatte; diese fraßen die letzten Heringsschwärme. „Nur noch ein totaler Fangstopp wie in der Nordsee“ hätte laut Stürzer „die Heringe vielleicht retten können“. Die Amerikaner zogen aus dem Forschungsergebnis jedoch den genau gegenteiligen Schluß: Sie motivierten ihre Fischerei mit zinsgünstigen Darlehen zum weiteren Ausbau ihrer Fangflotte.
Als die Heringsschwärme immer kleiner und seltener wurden verstärkten die Sowjets ihre Propaganda. Nadeschda Mandelstam erzählte in ihren Erinnerungen, wie sie einmal in der Schlange an einem Kiosk stand, wo alte, verschrumpelte Heringe verkauft wurden und eine ältere Frau vor ihr plötzlich voller Mitleid in der Stimme sagte: „Wie gut, dass wir eine Regierung haben, die sich ab und zu um uns kümmert und uns den Hering gibt. Die Armen drüben im Westen haben nicht einmal das!“
Der Arme-Leute-Fisch ist inzwischen überall fast eine Delikatesse geworden. 1997 wurde ein Managementplan aufgestellt, mit dem der Nordseehering in den Gewässern der Europäischen Gemeinschaft nach den Grundsätzen der Vorsorge bewirtschaftet wurde. 2004 erreichten die Heringsbestände wieder das Niveau von 1964. Daraufhin bekam die Nordseeheringsfischerei 2006 das Siegel für eine bestandserhaltende Fischerei. 2016 geht es auch dem Heringsbestand in der Ostsee wieder besser, so dass die Wissenschaftler des Internationalen Rates für Meeresforschung eine Erhöhung der Gesamtfangmenge um 18 Prozent empfahlen. Für Deutschland stieg damit die Quote um circa 2.200 t auf insgesamt 14.496 t jährlich, wie das „Fischmagazin“ berichtete.
.

.
Jagd auf Fuchswissen
„Der Mann mit den Füchsen“ wurde der Verhaltensforscher an der Humbodt-Universität, Günter Tembrock, genannt. Er begann seine Karriere mit Füchsen und habilitierte sich auch über Füchse. In seinem Büro hing ein von ihm gemaltes Porträt seiner Füchsin „Fiffi“. Als er 1948 im Naturkundemuseum das Institut für Tierpsychologie aufbaute, das erste in Deutschland, gab es dort ein „Fuchszimmer“, in dem bis zu sechs Tiere lebten, und draußen ein Fuchsgehege. Die Nachbarn beschwerten sich über den Lärm, den die Tiere vor allem Nachts machten. Aber für Tembrock, den Chorsänger und „Freund der Füchse“, der gegen ihre deutschlandweite Bekämpfung opponierte, war das Musik: In seinem Verhaltenslabor fokussierte er sich auf „Stimmen“ mit dem Sozialverhalten ausgedrückt wird – und unterschied dabei schließlich 40 Fuchslaute. Er beobachtete nicht nur die Füchse, sondern hörte ihnen auch zu. Daraus entstand sein Fach „Bioakustik“, über das er Vorlesungen hielt und ein Lehrbuch veröffentlichte. Bis Mitte der Sechzigerjahre war er ein weltweit anerkannter Experte für Bioakustik, dann überholten ihn die Amerikaner mit neuer Abhör-Technik.
Heute ist nebenbeibemerkt die Phonetikerin der Universität Lund, Susanne Schötz, eine anerkannte Bioakustikerin – aber sie erforscht vor allem die Laute von Katzen. An einer Stelle ihres Buches „Die geheime Sprache der Katzen“ (2017) heißt es: „Katzen benutzen eine Melodie, deren Klang sie variieren, die der Mensch deutet und dabei überraschend oft richtig liegt, wobei Katzenhalter besser abschneiden als Katzenbeobachter.“
Mit Tembrock hat die schwedische Katzenliebhaberin gemein, dass sie aus methodischen Gründen ein Zusammenleben zwischen Forscher und Versuchstier für notwendig hält, um zu brauchbaren Ergebnissen zu kommen. Tembrocks Vorbild war Konrad Lorenz, der engsten Kontakt mit seinen Tieren (Dohlen und Gänse vor allem) hielt, er ging allerdings über dessen Beobachtung von „Verhaltensmustern“ hinaus, indem er nach der Motivation des Verhaltens fragte, mithin nach „dem Leben“, also nach dem, was wir „Bewußtsein“ nennen. Bei der „Organisation des Verhaltens“ unterschied Tembrock zwischen dem „objektiven“ und dem „subjektiven Verhalten – dem, was ich erlebe“. Füchse seien dazu gut geeignet, sie hätten eine „Persönlichkeit“. Aber damit geriet er an der Universität in Konflikt mit den Anhängern der damals herrschenden Konditionierunglehre des sowjetischen Physiologen Iwan Pawlow, der nur Reflexe gelten ließ, was im Westen dann „Behaviorismus“ genannt wurde. Zuvor hatte man Tembrock bereits angegriffen, weil er in seinen Vorlesungen nicht die antigenetische „proletarische Biologie“ des sowjetischen Agrarwissenschaftlers Trofim Denissowitsch Lyssenko behandelte.
1994 und 2008 erschienen zwei Aufsatzbände über Person und Wirken Günter Tembrocks in der Schriftenreihe des interdisziplinären Instituts für Wissenschaftsphilosophie und Humanontogenetik an der Humboldt-Universität. Der erste hat den Titel „Verhalten, Informationswechsel und organismische Evolution“, der zweite „Ohne Bekenntnis keine Erkenntnis“. Tembrocks Fuchsforschung kommt darin leider nur am Rande vor.
Im Juni2018 organisierte die Kulturwissenschaftlerin und Mitarbeiterin der Humboldt-Universität Sophia Gräfe im Zentrum für Literatur- und Kulturforschung eine Konferenz über „Verhaltenswissen“, auf der es erneut um das Lebenswerk des 2011 verstorbenen Tembrock ging. U.a. referierte dort die Biologie-Doktorantin an dem vom TierparkdirektorHeinrich Dathe gegründeten Institut für Zoo- und Wildtierforschung, Sophia Kimmig, dass und wie Tembrocks Fuchsforschung heute weitergeführt wird. Die Biologin untersucht, wie Füchse sich im Stadtleben verhalten. Günter Tembrock hatte die Füchse nicht in ihrem Lebensraum untersucht (um vielleicht die Fuchsjäger nicht auf den Plan zu rufen?).
In Berlin sind von den eingewanderten Wildtieren die Füchse angeblich amBeliebtesten: Sie sind klug, halbwegs diskret und nützlich (indem sie Mäuse und Ratten jagen?). Zuvor, auf dem Land, hatte man sie ganz anders gesehen. Neben dem Ausrüstender Füchse mit Sendern durch Sophia Kimmig setzt ihr Institut auf die Mitarbeit der Bevölkerung: Sie soll über ein App ihre Fuchsbeobachtungen melden. „Bei der Auswertung wird es um die ‚Verstädterung‘ der Art gehen,“ erklärte Sophia Kimmig, „alsounter anderem um die Fragen: Was zieht den Fuchs so sehr in die Stadt? Wo und wie lebt er in der Stadt? Wie geht er mit der Nähe zum Menschen um? Welche Wege nutzt er und wovon ernährt er sich?“
Bevor das Leiniz-Institut an eine Fuchs-App dachte, gab es schon ein „aktionsbuendnis-fuchs.de“ in der Stadt. Es fordert natürlich ein Ende der Fuchsjagd und hat dazu ein „bundesweites Aktionsbündnis“ initiiert: „Auf Basis wissenschaftlicher Studien und positiver Erkenntnisse aus fuchsjagdfreien Gebieten setzen wir uns für eine ganzjährige Schonung des Fuchses ein.“
Seit der erfolgreichen Köderimpfung gegen den Tollwut-Virus und den Fuchsbandwurm, die mit einem Aussetzen vieler Vernichtungsmaßnahmen einherging, haben sich die Bestände erholt, ohne dass mehr Füchse in den Revieren leben. Diese sind in den Städten jedoch sehr viel kleiner als auf dem Land. Manche Experten sagen, die Füchse würden sich in der Stadt selbst domestizieren. Was heißt: Weil sie dort nicht gejagt werden, verlieren sie langsam ihre Scheu. Sie nähern sich damit wieder ihren ursprünglichen Verhaltensweisen an. Der Ökologe Josef Reichholf spricht von einem „Urvertrauen“.
Der Naturforscher Georg Wilhelm Steller, Erforscher von Alaska, hatte über die später nach dem Expeditionsleiter Vitus Bering benannte Insel östlich von Kamtschatka berichtet, wie ihnen die Neugier und Frechheit der furchtlosen „Eisfüchse“ dort zugesetzt hatten, sie stahlen und zerstörten alles: „Wir beschäftigten uns sehr damit, Füchse zu schlagen; Herr Plenisner und ich haben an dem Tag sechzig Stück teils mit der Axt erschlagen, teil mit einer jakutischen Pama erstochen,“ notierte Steller am 8. Dezember 1741. Täglich erschlugen die Überlebenden des Schiffbruchs mehr. Steller starb auf dem Rückweg nach Moskau. Die nach ihm, dem „Entdecker“, benannten Seekühe in der Bering-Straße wurden schon wenig später ausgerottet.
Charles Darwin bemerkte über die Füchse, die er auf den Falkland-Inseln traf: Sie waren „derart zahm, dass sie aus der Hand fraßen“, weil sie die Menschen dort 1833 noch nicht als Feind erlebt hatten. Der Leiter des Wissenschaftszentrums Umwelt der Universität Augsburg, Jens Soentgen, schreibt in seinem Buch „Ökologie der Angst“, dass heute „im Brennpunkt des Emotionslebens der meisten höheren Tiere die Angst vor dem Menschen steht.“ Angst einjagen, darum geht es noch immer. Er spricht deswegen statt vom Anthropozän“ von einem „Phobozän“, einem Zeitalter der Angst. Gleichzeitig geht er jedoch davon aus, dass es nahezu angstfreie „Formen des Zusammenlebens“ gegeben habe, „die unter veränderten Voraussetzungen auch wieder neu entstehen können.“ Eine geht über die (Selbst-) Domestikation. Heute leben weltweit nur noch 40.000 Wölfe, aber 40 Millionen Hunde, rechnete der US-Philosoph Mark Rowlands vor.
Es gibt mehrere Arten, wilde Füchse zu domestizieren und ihnen dabei die Angst „zu nehmen“. Einige berufen sich bei ihren Erfolgen auf die Gene, andere auf gegenseitiges Vertrauen. Schon 1959 hatte der in der Lyssenko-Ära nach Sibirien ausgewichene sowjetische Genetiker Dmitri Beljajew mit Domestikationsversuchen bei Silberfüchsen begonnen – auf Wunsch einer Pelztierfarm, der weniger ängstliche Füchse die Arbeit erleichtern sollten. Nach 35 Generationen und 45.000 Blaufüchsen war Beljajew am Ziel: die Tiere waren zahm! Er hatte stets die zutraulichsten weiter gezüchtet. Zuletzt hatten diese sich – sozusagen im Nebeneffekt – auch wie die Hunde und andere Haustiere körperlich verändert: sie bekamen Schlappohren, bellten, wedelten mit dem Schwanz zur Begrüßung und hatten weiße Fellflecken. Daneben besaßen sie noch ein Merkmal, das bereits Konrad Lorenz bei domestizierten Tieren aufgefallen war, nämlich „niedliche“ Gesichter, runde, wie Teddybären. Auch noch im Erwachsenenalter. Gleichzeitig wurde ihre Bereitschaft zur Verpaarung von der Jahreszeit unabhängig. Da sie gefüttert und freundlich behandelt wurden, also sich als Jäger keinen Gefahren mehr aussetzen mußten, verblieben sie quasi im Kindheitsstadium – auch physiologisch.
Beljajew starb 1985, im Zuge der Auflösung der Sowjetunion geriet seine Fuchszucht in finanzielle Schwierigkeiten. Sie befand sich nicht weit von Beljajews Institut in Akademgorodok (Nowosibirsk) und umfasste mehrere hundert zahme Füchse sowie eine Gruppe auf Aggressionen gezüchteter Füchse und eine „normale“ Kontrollgruppe. Seine älteste Mitarbeiterin, die Genetikerin Ludmila Trut, versuchte das Forschungsprojekt weiter zu führen, was ihr mit amerikanischen Geldern gelang, wenn auch in reduzierter Form. Dafür wurde es international berühmt, 2018 erschien ihr Buch „Füchse zähmen“ auch auf Deutsch. Gleich im Vorwort schreibt sie: „Gern hätte Beljajew sein populärwissenschaftliches Buch ‚Ein neuer Freund für den Menschen‘ geschrieben, das quasi Kern des vorliegenden Buches ist.“ Zwar waren die zahmen Füchse für die Tierpflegerinnen auf der Fuchsversuchsfarm leichter zu „händeln“, aber mit ihren weißen Fellflecken nicht mehr als wertvolles Pelztier zu vernutzen. Dafür wurden die gezähmten russischen Füchse – via USA – zu neuen Modehaustieren und dementsprechend teuer. In einem Clip auf Youtube führt Ludmila Truts Doktorantin Irina Mukhamedshina einen der Füchse an der Leine durch die Stadt und will damit sagen: „This Siberian Fox can be your next pet“. Über die Beljajew-Füchse als Haustiere gibt es in der Anglosphäre des Internets inzwischen hunderte von Werbe- und Ratgeber-Clips. Der Tag ist nicht mehr fern, da die „Hoffnung“ der heute 85jährigen Ludmila Trut wahr wird, „dass sie als neue Haustierart registriert werden können.“
In Deutschland ging es bisher eher um Zähmung als Domestizierung von wilden Füchsen, durchaus unbeabsichtigt mitunter: Im Kreuzberger Prinzenbad z.B.. Dort handelte es sich um den bei Badegästen und Personal beliebten Fuchs „Fuchsi“, dessen Fluchtdistanz immer geringer wurde, er ließ sichsogar streicheln. 2016 wurde er jedoch vor den Augen der Badegäste von einem Förster erschossen. Der Tier war schwer verletzt, so dessen Begründung.
Ähnliches geschah auf dem Schulhof der Kreuzberger Charlotte-Salomon-Grundschule, dort erschien zu den Pausen ein Fuchs. Die Schüler liebten und fütterten ihn mit ihren Schulbroten – bis er von einem Jäger erschossen wurde – mit der Begründung: Dem Tier sei es schlecht gegangen, ihm fehlte der Schwanz und er hätte offene Wunden gehabt.
In Berlin soll es 1600 Reviere von Füchsen bzw. Fuchsfamiliengruppen geben, manche werden gefüttert, u.a. von älteren Damen auf Friedhöfen, wo diese sich vor allem um verwilderte Katzen kümmern. Auf „fuchs-hilfe.de“ heißt es, dass beide Tierarten dort in friedlicher Koexistenz leben.
Die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Humboldt-Universität, Katja Kynast, berichtete: „Gestern früh habe ich auf meiner Gassirunde um den Urbanhafen das traurigste Bild gesehen. Ein Fuchs, der durch den Landwehrkanal schwimmen wollte, um sich auf der anderen Seite eine Ente zu holen, und dabei erfroren ist. Er sah aus wie lebendig. In Schwimmhaltung, Ohren oben, Schwanz auf der Oberfläche, der Blick ans Ufer gerichtet. Aber er hat sich einfach überhaupt nicht bewegt. Und um ihn herum war Eis. Der Technische Hilfsdienst war schon da. Auch wenn dem Fuchs nicht mehr zu helfen war, mussten sie etwas tun, weil sie sonst den ganzen Tag deswegen angerufen würden.“
Die Freiburger Forstwirtin Anna Rummel sah an einem Abend im Mai auf ihrem Hochsitz einen Jungfuchs, der sie beobachtete: „Dieser Moment ist der Beginn einer besonderen Freundschaft zwischen Anna, Förster Klaus und dem jungen Fuchs,“ heißt es auf „geo.de“. „Immer öfter treffen die beiden auf den neugierigen Fuchs im Wald, Treffpunkt ist der Holzstapel an einer Wegbiegung. Sie beschließen bald, dem Fuchs einen Namen zu geben: Sophie.“ Das Autorenteam begleitete die Füchsin Sophie ein halbes Jahr lang, gewann ihr Vertrauen und schloss Freundschaft mit ihr. Ihr Buch „Fuchs ganz nah“ erschien 2013.
Zuvor waren bereits mehrere Bücher von Günther Schumann erschienen, der elf Jahre lang eine Freundschaft mit einer Füchsin im hessischen Reinhardswald hielt. Der pensionierte Mitarbeiter der Hessischen Forstlichen Versuchsanstalt traf Feline ebenfalls als Jungfüchsin an einem Holzstapel. Von da an kam er täglich und brachte immer ein paar Leckerbissen für sie mit. Dafür hatte sie bald nichts mehr gegen sein Photographieren. Der größte Vertrauensbeweis bestand darin, dass sie ihn zu ihrem versteckten Bau führte, wo sie ihre Jungen hatte, und ihn dann sogar mit diesen allein ließ, während sie sich auf Futtersuche für ihre Welpen begab.
Es scheint fast so, dass weibliche Füchse gelegentlich ein Junges aus ihrem Wurf Neues ausprobieren lassen, nämlich der Neugierde auf den Menschen nachzugeben. Bereits ab den Sechzigerjahren bemerkte man in England, dem klassischen Land der „Fuchsjagd“, dass sich in London immer mehr Füchse niederließen. Die englischen Füchse waren tollwut- und bandwurm-frei – und deswegen weniger gefürchtet. 1972 begann eine achtköpfige „Fuchsbande“ bei den Biologen der Oxford-Universität das „Sozialleben von Füchsen“ gründlich zu erforschen – 15 Jahre lang. Sie folgte deren Fährten im Freiland mit Radiotelemetrie, in Oxford auch den Stadtfüchsen und zähmten immer wieder einige, indem sie sie als Haustiere aufzogen. Entgegen der bis dahin geltenden Ansicht waren ihre Füchse, mindestens die in den Randgebieten von Oxford, keine Einzelgänger, sondern lebten in „Familiengruppen“.
Der Gründer der „Fuchsbande“, David Mcdonald, veröffentlichte 1987 eineumfangreiche „Verhaltensstudie“, die nichts zu wünschen übrig ließ: „Unter Füchsen“.Für die deutsche Ausgabe schrieb der Wolfsforscher Erik Zimen ein Vorwort. Beide eint, dass sie ihre Forschungsobjekte liebten und eigentlich beim Studium dieser Raubtiere, denen sie Namen gaben, ihre Erfüllung fanden. Streng wissenschaftlich hofft und leidet man bei der Lektüre mit ihnen und den Tieren mit.
Ähnlich geht es einem aber auch mit dem eher schlichten Photokinderbuch „Drei kleine Füchse“, die von der Engländerin Pat Hill großgezogen und dann freigelassen wurden. Zunächst kamen sie immer wieder zu ihr zurück, wo sie weiter mit allerlei Leckerbissen gefüttert wurden, „doch allmählich werden sie abenteuerlustiger.“ Der scheueste, Fips, blieb dem Haus am nächsten und spielte gelegentlich noch mit einem der Hunde und Kater der Autorin.
In der Schweiz befaßte sich ab 1995 ein „integriertes Fuchsprojekt“ mit den Stadtfüchsen, das u.a. der Frage nachging: „Was bedeutet es für Mensch und Haustier, dass Füchse nun plötzlich in ihrer nächsten Umgebung leben und wie soll der Mensch mit diesen neuen Nachbarn umgehen?“ Zunächst wollte man mehr über die Lebensweise der Füchse in der Stadt wissen, dazu wurden sie in Zürich eingefangen und mit einem Sender ausgerüstet. Dabei lernten die Wissenschaftler um Sandra Gloor schon mal, dass die Telemetrie-Methode in Städten komplizierter ist als in ländlichen Gebieten, wie sie in ihrem Bericht „Stadtfüchse“ (2006) schreiben. Einige der observierten Stadtfüchse schlugen immer wieder neue Wege ein, andere gingen stets ihr Revier ab – meist auf den selben Wegen. Ihre Reviere überlappten sich oft. Da sie Würmer, Kleintiere, Früchte und vor allem Essensabfälle von Menschen suchen, gehen sie meist allein auf Nahrungssuche. Sie werden mithin auch über ihre Ernährung domestiziert. Die Zürcher Forscher meinen, der Siedlungsraum sei für Füchse ein „Schlaraffenland“. Dazu gehören „gut geschützte Orte“, z.B. unter einem Schuppen oder einem Baucontainer, wo sie ungestört die Tagesstunden verbringen und ihre Jungen großziehen können. Diese Verstecke „sind ein zentrales Element im Lebensraum der Füchse.“ Die Forscher waren erstaunt, wieviele solcher Räume es selbst „mitten im Siedlungsraum“ gibt. Einmal überraschten Bauarbeiter auf der dritten Etage ihres Gerüsts morgens zwei Füchse, die dortden Tag verschlafen wollten. Manche Schlafplätze befinden sich nur wenige Meter von vielfrequentierten Fußwegen entfernt.
Es gäbe jedoch in der Stadt „Grenzen des Wachstums“ für die Fuchspopulationen. In genetischer Hinsicht hätten sich bereits „klare Unterschiede“ zwischen den Stadt- und den Land-Füchsen entwickelt, zudem wurden Unterschiede zwischen den Zürcher Populationen nördlich und südlich des Limmat festgestellt. Ebenso ergaben Umfragen, dass es Unterschiede zwischen jungen Stadtmenschen und alten Landbewohnern gibt: Die ersteren sind sehr viel fuchsfreundlicher eingestellt. Man soll diese Tiereaber nicht füttern, weil sie dadurch immer zutraulicher werden – noch gilt in der Schweiz: „Zahme Füchse werden erschossen“.
.

.
Sophia Kimmig:
Heute erforscht man nicht ein Tier, sondern ein Thema. Ich untersuche nicht nur den Berliner Stadtfuchs, sondern auch den Brandenburger. Es geht mir um den Urbanitätsgradienten. Auf welche Lebensbereiche der Füchse hat die Stadt Auswirkungen? Auf dem belebten Alexanderplatz z.B. können die Füchse ihre Fluchtdistanz gar nicht aufrechterhalten.
Ich habe hölzerne Fuchsfallen aufgestellt – mit einer Kamera gegenüber. Auf einen gefangenen Fuchs kommen 2, 3 Waschbären. Zum Anlocken benutze ich Frolic-Trockenfutter. Einmal in der Woche muß ich den Chip in der Kamera auswechseln. Sie ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet, der mit Schwarzlicht blitzt.
An den Fallen-Standorten gibt es neben Füchsen und Waschbären Dachse, Marder, Reiher, Eichhörnchen und Krähen. In Berlin ist der Fuchs überall, sie sind dämmerungsaktiv. Einer hatte seinen Bau auf einer S-Bahntrasse, er wurde irgendwann überfahren. Viele Füchse leben auf Friedhöfen und in Parkanlagen, auch auf dem Tierparkgelände, sie haben dort schon etliche Wasservögel, Enten, Trauerschwände, Flamingos, gerissen. Füchse sind ansonsten eher Sammler als Jäger, sie essen auch viele Früchte. Das Füttern ist in Berlin illegal, wer erwischt wird, muß mit 5000 Euro Bußgeld rechnen. Die Kehrseite ist eine sukzessive Verringerung der Fluchtdistanz von Füchsen, also das sie Grenzen überschreiten, was zur Folge hat, dass man sie auch hierzulande erschießt.
Wenn ein Fuchs in einer meiner Fallen steckt, gehe ich sofort mit zwei, drei Leuten hin und einem Drahtkorb, er bleibt nicht lange in der Falle. Er wird betäubt, auf Gesundheit untersucht und bekommt einen Halsbandsender. Der hat ein Lederstück eingebaut, das mit der Zeit durchscheuert und dann fällt er ab. Bis dahin kann ich den besenderten Fuchs über GPS verfolgen.
Die meisten Sender bekomme ich zurück, weil der Fuchs tot ist, d.h. überfahren wurde. Die Kadaver kommen nach Frankfurt/Oder in die Pathologie des Landeslabors. Ich nehme vorher eine Gewebeprobe ab, um genetische Untersuchungen zu machen, d.h. um Unterschiede zwischen Land- und Stadtstrukturen zu finden. Wir sehen auch hier bereits bei der Genanalyse einen Effekt der Stadt.
Ich habe außerdem den Darminhalt von 600 Tieren im Kühlfach, wobei die DNA von den in Wasser gelösten Proben schon isoliert ist. Es geht mir um die DNA-Ebene, die gescannt wird, DNA-Meta-Barcoding nennt man das. Auf diese Weise kann man jedoch keine quantitative Analyse machen.
Mich interessiert 1. die Genetik, 2. Ernährungsweisen und Krankheiten, 3. die Lebensraum-Nutzung – Reviergröße, Aktivitätsmuster usw.. Außerdem bin ich immer wieder begeistert, was für schöne Tiere Füchse sind.
Und spannend ist daran, was der Fuchs macht, wenn man ihn nicht beobachtet, Nachts z.B.., man wünscht sich so wenig menschlichen Einfluß auf ihn wie möglich.
17 Füchse hatte ich besendert, zwei tragen derzeit noch Sender. Der RBB hat mal über mein Fuchsprojekt berichtet, anschließend konnte man auf deren Webseite mit seinem Handy Fuchsmeldungen unterbringen. Das half mir beim Finden von Standorten für die Fallen. Sie stehen auf Privat- und Firmengelände.
In Zürich hat eine Gruppe um Sandra Gloor Stadtfüchse erforscht. Sie hat ein Buch darüber geschrieben und eine Webseite für Bürger „stadtwildtiere.ch“ eingerichtet mit interaktiven Seiten, man findet dort auch Ratschläge bei Konflikten.
Es wird gesagt, dass die Füchse die Menschen in der Stadt von allen zugezogenen Tieren am meisten faszinieren: Sie sind klug und umsichtig und nicht so gefährlich groß wie die Wölfe, die sich allerdings noch nicht in die Städte trauen. Wenn die Wildtiere einmal weg sind, ausgerottet, dann fällt es schwer, wieder mit ihnen zu leben, man hat Angst davor.
Neben der Ökologie des Fuchses in der Stadt untersuchen wir auch die Haltung der Bevölkerung zum Fuchs. Das ist ein spannendes Thema, da diese Haltung durchaus ambivalent ausfallen kann. Auf der einen Seite wird er als schön, schlau und charismatisch beschrieben, auf der anderen als listig und diebisch. Er ist ein potentieller Übergträger von Krankheiten und ein Konkurrent z.B. für Geflügelhalter und Jäger.
Meine Feldarbeit ist jetzt nach zwei Jahren abgeschlossen, ein weiteres Jahr brauche ich noch zum Schreiben. Davor habe ich mit mexikanischen Präriehunden gearbeitet, eine endemische Art, sie sind zierlicher als die nordamerikanischen und werden, obwohl unter Artenschutz gestellt, massiv vergiftet oder sonstwie verfolgt.
Der Fuchs ist eine Modellart, mit der Evo-Bio-Fragestellungen beantwortet werden können. Sie sind nicht selten, nicht gefährdet, auf der Welt weit verbreitet. Sie passen sich an ein großes Spektrum von Habitaten an, auch bei ihrer Ernährung. Ihre Komplexität und Flexibilität machen sie zu guten Untersuchungsobjekten. Dank ihrer Anpassungsfähigkeit kommen sie inzwischen auch überall in den Städten vor.
Die Zahl der Füchse ist in Berlin relativ konstant. Zwar sind sie anfällig für Staupe, und die grassiert auch immer mal wieder, aber dadurch werden Reviere frei, die wieder neu besiedelt werden. Die rege Bautätigkeit in der Stadt zerstört immer wieder ihre Bauten und Reviere. Sie siedeln dann z.B. vorübergehend auf die Baustelle um. In der Stadt müssen Füchse mit viel Fluktuation zurecht kommen. Die meisten haben mehrere Schlafplätze und einen Bau für die Aufzucht. Sie ziehen oft um in andere Baue. Der Rüde füttert die Jungen in der ersten Zeit mit. Füchse haben Paarbeziehungen, der Rüde füttert auch die Fähe, wenn diese in den letzten Tagen vor der Geburt der Jungtiere im Bau bleibt.
Die Opportunisten und Generalisten unter den Tieren können sich in urbanen Räumen gut behaupten. Berlin hat z.B. das größte Habichtvorkommen. Aber die Lebenserwartung der Füchse ist auf dem Land höher als in der Stadt, d.h. Stadtfüchse werden weniger alt, weil sie früher/jünger sterben. In der Stadt darf nicht gejagt werden, aber deutschlandweit wurden 2017 etwa 435.000 Füchse geschossen.
.

.
Jagd auf Wombats
– Wombats: „flauschige Beutelsäuger“ mit dem Beutel nach hinten, damit ihren Babys beim Höhlengraben kein Dreck ins Gesicht fliegt, zählen zu den Touristenattraktionen Australiens. Auf einer Insel vor Tasmanien will man die Wombats jetzt vor den Touristen schützen – vorerst mit Schildern, auf denen drauf steht: „Ich werde Wombats nicht mit dem Selfie-Stick jagen. Ich werde nicht zu nahe an Babys rangehen. Und ich werde sie auch nicht umzingeln oder gar hochheben.“
Es gibt jedoch bei vielen Menschen einen unwiderstehlichen Drang, Tiere zu berühren, vor allem wenn sie flauschig sind. Diese Leute werden zwecks Streicheln eines Wombats an die „Trowunna Wildlife Sanctuary“ verwiesen: „Dort kann man die niedlichen Tiere anfassen, sie sind inzwischen an Menschen gewöhnt.“
Auf diversen australischen Internetseiten erfährt man zudem mehr über das Leben und Treiben der Pflanzen fressenden Wombats, die bis zu einem Meter groß, 40 Kilogramm schwer werden und die einzige Art weltweit sind, die würfelförmigen Kot ausscheidet. „Die Wissenschaftler sind der Lösung dieses Rätsels näher gekommen,“ schrieb „National Geographic“ kürzlich. Eine schöne Wombat-Geschichte erzählte der Schriftsteller Ralph Giordano 1997 in seinem Buch über „tierische Geschichten: ‚Der Wombat‘“. Bis dahin wußte ich nicht, dass er wie seine Mutter sich sehr für Tiere interessierte, wenn auch etwas exzentrisch: nur für die hässlichsten. Das kann man über den Wombat jedoch nicht sagen, auch wenn man ihn einen „Plumpbeutler“ nennt.
„Ein Leben mit der Liebe zu Wombats ist heutzutage kein leichtes,“ meint Giordano, denn in ganz Europa gibt es nur noch sechs Exemplare – in drei Zoos. Als er ein Foto von Tennis-As Steffi Graf beim Australian Open sieht, die einen Wombat im Arm hielt, wurde seine Neugier auf die Tier geradezu manisch. Mittlerweile wußte er alles über die Lebensgewohnheiten der „Vombatidae“ – Haarnasen-, Breitstirn- und Nacktnasen-Wobats. Alle sind „unermüdliche Wühler“, die Gänge von bis zu 800 Metern Länge graben.
Als er von der Ankunft eines Wombats imWestberliner Zoo erfuhr, hielt ihn nichts mehr. Im Käfig konnte er ihn jedoch nicht sehen. Der Wärter klärte ihn auf: Wombats sind nachtaktive Tiere.“ Giordano gab jedoch nicht klein bei: Er „schnalzte und lockte ihn, flehte und bettelte“. Und pötzlich bewegte sich etwas hinten im Käfig: „Das konnte nichts anderes sein als der Wombat – wenngleich zunächst mit dem Hinterteil voran.“ Giordano hoffte auf eine „Auge-in-Auge-Begegnung“, aber der Wombat zog sich träge so wie er hervorgekrochen war wieder zurück. Am nächsten Tag erschien Giordano erneut vor dem Käfig, um wieder „zu schnalzen, zu gurren, zu turteln und zu keckern.“ Nach einer guten Stunde geschah das Unglaubliche: der Wombat kam heraus und an das Gitter: „Da atmete er wahrhaftig vor mir, schwer, rund, wollig, stark riechend und – phantastisch.“ Und das mitten am Tag!
Als nächstes besuchte der Schriftsteller und TV-Regisseur den Duisburger Zoo, wo er gleich zwei Wombats sah: ein Männchen und ein Weibchen, durch ein Gitter voneinander getrennt. Ihn nannte Giordano sogleich den Dunklen, und sie die Helle. Der Dunkle fing plötzlich an, wie wild ein Loch zu graben. Aber wegen des Käfigfundaments kam er nicht weit. Man hatte ihn in der Gefangenschaft völlig „entwurzelt“, Giordano kommt darüber ins Grübeln, „ob es nicht überhaupt geboten sei, Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu lassen.“ Aber dann hätte er nie einen lebenden Wombat bestaunen können. Der Dunkle gräbt weiter, während die Helle gelassen dasitzt, aber den „ungebärdigen Freier stets scharf im Visier hat.“ Das Männchen gräbt, weil es das Gitter, das ihn vom Weibchen trennt, nicht akzeptieren kann oder will.
Als Giordano erfährt, dass der Berliner Zoo wieder einen Wombat besitzt, ein Männchen namens Bosco, das diesmal im Nachthaus untergebracht ist, geht er erneut dort hin, aber der Käfig ist leer. Am Löwengehege fragt er einen Wärter, wo denn der Wombat sei. Der wäre seit heute im Zoo Hannover, wurde ihm geantwortet. Enttäuscht verläßt Giordano den Zoo, „bis heute fehlt ihm die unerläßliche Berührung eines Wombats.“
Ganz anders die „Wombat Warriors“ in Samantha Wheelers gleichnamigen „Rowohlt-Rotfuchs“-Buch, das mir die Übersetzerin Rusalka Reh schickte. Ein Schulmädchen aus Brisbane namens „Maus“ kommt zu ihrer Tante nach Südaustralien, weil die Eltern für eine Weile nach Europa müssen. Im Haus der Tante rumort es plötzlich im Nebenzimmer laut. Ängstlich öffnet sie die Tür, da springt ein Wombat sie an. Es ist ein Weibchen, es lebt bei der Tante und heißt „Miss Pearl“.
Als Maus sich anderntags der Farm des Nachbarn nähert, sieht sie, wie der mit einem Traktor einen Haufen Steine an einer Weide in lauter fußballgroße Löcher stopft. Etwas abseits steht sein Sohn, dem vor lauter Wut und Trauer die Tränen kommen: Die Löcher stammen von Wombats und der Sohn ist ein heimlicher „Wombat Warrior“. Die Tante, die ihr kleines Haus vom Farmer gepachtet hat, klärt Maus auf: „Die Leute auf dem Land behandeln die Tiere nicht wie wir. Kein Wort über Miss Pearl,“ die quasi illegal bei der Tante lebt, denn die Farmer in der Gegend mögen keine Wombats, die ihre Weidepfähle untergraben. Außerdem hat das Farmer-Ehepaar auch noch was gegen Wichtigtuer aus der Stadt, die keine Ahnung haben, aber alles besser wissen.
Ihr Sohn Harry hilft Maus jedoch beim Eingewöhnen in die neue Schule. Sie freundet sich mit ihm an, die Schule enttäuscht sie jedoch: „Alles war Wettkampf“, selbst der Matheunterricht, und dann haben die Kinder in ihrer neuen Klasse sie auch noch eine „Queensländerin“ genannt.
Maus lernt mehr bei ihrer Tante,z.B. dass Miss Pearl, die mit in ihrem Bett schläft, schnarcht, und das sechs Wombats ungefähr so viel fressen wie ein Schaf. In der Schule entscheidet sie sich bei einem freien „Ologie“-Thema, eine Wombatologie anzufertigen. Dann findet sie auch noch ein verwaistes Wombat-Baby, deren Mutter überfahren wurde, es heißt Willow. Harry hat es ihr quasi vor die Tür gelegt, er ist auf der Seite von Maus und ihrer Tante.
Nachdem die Eingänge der Wombathöhlen mit Steinen und Draht verstopft wurden, starb sein Lieblingswombat, nur einer hat überlebt: „Nepo“. Die anderen hat man erschossen, überfahren und vergiftet. Maus ist entsetzt, weil Wombats doch eine geschützte Tierart sind. Plötzlich ist Harry verschwunden, auf der Suche nach Nepo ist er in dessen Höhle gekrochen und steckt nun fest. Die Feuerwehr muß kommen, um ihn zu befreien, auch Nepo kriechtaus seiner Höhle. Dabei kommen die Campbells dahinter, dass die Tante Wombats schützt, und drohen mit Kündigung, schließlich lassen sie sich aber von ihrem Sohn und von Maus, den beiden Wombatologen,überzeugen, dass man die Wombatlöcher einzäunen und mit kleinen Toren versehen könnte. Die humanen Städter haben sich also am Schluß wieder mal gegen die verrohten Farmer durchgesetzt.
.

.
Jagd auf Waschbären
Mindestens seitdem der Strom der „Wirtschaftsflüchtlinge“ (heute „Refugees“ genannt), nach Lampedusa einsetzte, hat sich der Streit, ob Deutschland ein „Einwanderungsland“ ist oder sein sollte, auf Tiere und Pflanzen ausgedehnt, wenn nicht gar verlagert. Kaum ein Tag, an dem nicht irgendein Massenmedium mit neuen „Erkenntnissen“ über „invasive Arten“ aufwartet und Ratschläge gibt für einen durchaus vernünftigen Umgang mit ihnen. Der TV-Sender Arte schickte mir neulich schon unaufgefordert seinen Film „Invasion der Pflanzen. Gefahr für Umwelt und Mensch“ zu. Das „Neue Deutschland“ veröffentlichte eine ausschließlich der Vernunft verpflichtete Zusammenfassung der Debatte über tierische und pflanzliche Ausländer: „Die Mehrheit der Wissenschaftler ist dabei einer Meinung: Invasive Arten sind in der Summe als kritisch für das Ökosystem anzusehen.“ Dazu scheint für den ND-Autor auch die Menschenwelt zu zählen – ja, vor allem sie, denn als Beispiele erwähnt er einige ausländische Pflanzen, die sich hier, einmal eingeschleppt, unglaublich vermehren – und „Allergien, Hautausschläge“ etc. hervorrufen. Es gibt inzwischen ganze Sondereinheiten – auf Basis von 1-Euro-Jobs, die mit Schutzanzügen angetan ausrücken, um sie auszurotten. Die gleichen, für Menschen unangenehmen Pflanzen sind jedoch bei den Bienen äußerst beliebt, weswegen sie z.B. von den Imkern geschätzt werden: Sie protestieren gegen ihre „sinnlose Vernichtung“.
Bei den Tieren werden u.a. die aus Amerika importierten und ab 1929 in Westdeutschland ausgewilderten bzw. 1945 aus einer zerbombten Zuchtfarm in Ostdeutschland entkommenen Waschbären erwähnt: „Sie dezimieren die hier heimische Vogel- und Amphibienwelt.“ Ihnen treten die Jäger entgegen, indem sie regelmäßig eine sogenannte „Bestandsregulierung“ vornehmen. Der Waschbär darf hierzulande ganzjährig gejagt werden. Allerdings muß man jedes tote Tier amtlich registrieren lassen. 2013 wurden allein in Berlin und Brandenburg 20.300 Waschbären „erlegt“. Das Brandenburger Agrarministerium bilanzierte dies als eine Art wirtschaftspolitischen Erfolg: „In nur vier Jahren verdoppelte sich die Strecke…“ Gemeint ist mit diesem Jägerdeutsch-Euphemismus die Zahl der erlegten Tiere, die nach dem Halali vermüllt werden, denn wer will heute noch mit so einer albernen Waschbärmütze mit Schwanz hintendran oder gar mit einem ganzen Waschbär-Pelzmantel herumlaufen? Ersteres trugen nach dem Krieg die verhinderten Trapper, letzteres die ungehinderten Zuhälter.
Auch in den anderen Bundesländern mußten 2013 zigtausende von Waschbären dran glauben. Dennoch warnte eine Schweizer Zeitung: „Waschbär ist auf dem Vormarsch Richtung Südostschweiz“. Die FAZ titelte: „Die Rasselbande zerstört alles“, der „Spiegel: „Randale unterm Dach“, und die „Welt“: „Terror-Waschbären richten immense Schäden an“. Die „Zeit“ pries gar die unsere Wälder von diesem Schädling befreienden Jäger als verantwortungsvolle Ökologen – mit der Überschrift: „Von wegen Spaß am Tiere-Töten.“ Im „Merkur“ priesen sich daraufhin die Jäger selbst: „Wir sind Naturschützer“. Darüberhinaus finden sich im Internet mittlerweile hunderte von Seiten über (technische) „Schutz- und Abwehrmaßnahmen“, so dass selbst Nichtbewaffnete gegen die Waschbären aktiv werden können. Daneben findet man aber auch anrührende Feuilletons – z.B. von Rentnern, bei denen eine Waschbärfamilie auf dem Dachboden oder im Kamin lebt.
Der „Anti-Jagdblog“ gibt unter der Überschrift „Jäger erlegen so viele Waschbären wie nie zuvor“ zu bedenken, dass noch einmal so viele alljährlich überfahren werden. Die Tierschützerin Marianne schreibt: „Ja, dieses Brandenburg ist landschaftlich schön, nur leider ist es das Land, mit der größten Dichte an Mördertürmen, Fallen, Kirrstellen, Ansitzen und Mörderpack. Am Rande von Berlin und Potsdam sind die Wälder gespickt mit Blutbader [Jägern] und trotzigen Bauwerken [Hochständen], die den Wildtieren den Garaus machen. Der Minister ist selbst Blutbader und Befürworter der Massentierhaltung. Leider sind die Brandenburger nicht sehr aufgeklärt, aber zum Glück werden die Jagdgegner immer mehr.“ Neben den Jägern und den Wirtschaftsförderern sind es vor allem die Singvogel-Freunde und Besitzer von Obstbaumgärten, die etwas gegen Waschbären haben.
Auf der anderen Seite verhält es sich bei den Waschbär-Forschern so wie bei allen Erforschern von Tierarten: Sie sind von ihren im Grunde harmlosen und ebenso rührenden wie klugen Untersuchungsobjekten derart eingenommen, dass sie sich mit der Zeit gradezu zu ihren Sprechern, Waschbärensprechern, aufschwingen. Dies gilt z.B. für den Biologen Ulf Hohmann und den Tierphotographen Ingo Batussek. Für ihren Forschungsbericht „Der Waschbär“ (2011) beobachteten sie im Sollinger Forst bei Höxter jahrelang den nachtaktiven, gerne auf großen Eichen lebenden Kleinbären mit ihren Nachtsichtgeräten, sie fingen sich welche in Fallen und statteten sie mit Sendern aus oder ließen sie von Diplomstudentinnen großziehen, damit sie das Verhalten dieser halbzahm gewordenen Tiere später auch noch in Freiheit bequem, quasi von Nahem, studieren konnten. Diese Mischung aus Zoo- und Feldforschung wandte bereits Konrad Lorenz erfolgreich bei Graugänsen an, von denen eine, Martina, es sogar zur Berühmtheit brachte.
Den Göttinger Waschbärforschern wurde diese etwas aufwändige Methode von der NDR-Redaktion „Expeditionen ins Tierreich“ finanziert. Die Jungtiere dafür erwarben sie bei einem sauerländischen Waschbärzüchter. Ihre „handaufgezogenen“ Waschbären galten den Forschern schon bald als „Botschafter in eigener Sache“. Im Internet werden heute jede Menge Waschbären angeboten: „albino, blonde, elfenbeinfarbene und naturfarbene“. Auf einer Internetseite fand ich den Hinweis: „Zuerst sollten Sie genau wissen, was Sie sich holen, wenn Sie einen Waschbär kaufen. Wussten Sie, dass ein Waschbär Ihr Anwesen zerstören kann, wenn Sie ihn nicht richtig pflegen? Zum Beispiel ist es bekannt, dass Waschbären Kabeldrähte ausgraben. Außerdem sind sie kaum zu zähmen…“ Das ist nicht unbedingt eine Werbung für den Waschbär als Haustier.
Selbst die Waschbärliebhaber Hohmann und Bartussek geben unumwunden zu: „Der Waschbär ist kein Haustier und wird es nie werden. Daran ändern auch die Beteuerungen so mancher Tierhändler nichts.“ Das hält sie jedoch nicht davon ab, im letzten Kapitel ihres Buches „Tipps und Tricks zu Aufzucht und Haltung von Waschbären“ zu geben – und sich sogar zu fragen: „Doch als Haustier?“ Dazu heißt es: „Wenn man sich entschlossen hat, Waschbären im Haus zu halten, muss bedacht werden, dass wir für unseren Pflegling fortan seine ‚Waschbärgruppe‘ sind.“ Und das bedeutet u.a., dass wir als „Sparringpartner“ für seine wilden Beiß- und Kratz-Spiele herhalten müssen, dafür sind wir Menschen aber zu dünnhäutig: „Nur ein robuster, im Haus lebender Hund kann diese Aufgabe übernehmen.“ Mit dem Kauf eines Waschbären sollte man sich also am Besten auch noch gleich einen großen Hund anschaffen. Die beiden Waschbärenforscher haben das selbst ausprobiert – und können deswegen lustige Geschichten darüber erzählen. Einen kastrierten Waschbär namens Willi ließen sie fast ein Jahr lang Nachts raus, das sei in einem bewohnten Gebiet jedoch nicht zu empfehlen, meinen sie, denn „die Tierliebe und Toleranz sämtlicher Nachbarn wurde dabei auf eine harte Probe gestellt.“ Am Stadtrand von Berlin sehen dagegen viele Bewohner rot, wenn sie einen Waschbären in ihrem Garten erblicken: Sofort rufen sie einen Jäger an, der ihnen das Tier mit einer Falle wegfängt – und tötet.
In meiner Familie hatten wir immer viele Tiere, dabei wurde kein großer Unterschied zwischen Mensch und Tier gemacht. Heute würde ich auch die Pflanzen da mit einbeziehen, der Vegetarismus ist also keine Option für mich. Beim Waschbären würde ich auch erst einmal – wie die beiden Waschbärenforscher – eine „Inklusion“ ins Auge fassen, wobei mir bewußt wäre, dass Waschbär nicht gleich Waschbär ist. Das Prinzip „Kennst du einen, kennst du alle“ gilt gerade bei Waschbären nicht: Jeder ist auf eine andere Art gewaschen.
Und im übrigen waschen sie ihre Nahrung gar nicht vorm Verspeisen, sondern suchen gerne unter Wasser nach Eßbarem (kleine Krebse z.B..). Dazu haben sie hypersensible Vorderpfoten: „Der Tastsinn ist die unumstrittene Geheimwaffe des Waschbären,“ schreiben Hohmann/Bartussek, „kein anderes Tier reserviert sich für die Interpretation der taktilen Reizimpulse aus den Handflächen so viel Hirnmasse wie der Waschbär.“ Er hat dafür genau „so viele graue Zellen, wie wir für die Reizverarbeitung unseres wichtigsten Sinnesorgans, des Auges, bereithalten.“ Mit der Folge: Wenn Waschbären im Wasser herumtasten „blicken sie ins Leere und wirken dabei merkwürdig abwesend.“ Neben ihrem Tastsinn ist aber auch ihr Geruchssinn „ausgezeichnet“: zwei Sinne, die wir eher vernachlässigen – seit einigen zigtausend Jahren schon. Ein Waschbär wäre in dieser Hinsicht also eine sinnvolle Ergänzung zu uns. Das wollte ich hier nur mal zu bedenken geben – an die Adresse der Gebildeten unter den Waschbärverächtern.
.

.
Jagd auf weitere invasive Arten
Demnächst wird wieder vor dem Riesen-Bärenklau gewarnt,dessen Saft zu Fieber und Atemnot führen kann, auch wenn man der Pflanze nur nahe kommt. Es ist eine invasive Art. Dieses Thema ist inzwischen derart global geworden, dass es ein neues Fach: „Invasionsbiologie“ hervorgebracht hat. Auch in Berlin wird dazu geforscht. Die Zeitschrift „Siegessäule“ fragte sich kürzlich: „Gehört den Expets die Berliner Nacht?“ Bei den Expets handelt es sich um verwilderte Haustiere – z.B. Katzen, von denen es laut Auskunft des Tierschutzvereins 80.000 in Berlin geben soll. Im Rhein-Main-Gebiet sind es entflogene indische Halsbandsittiche, die sich dort derart vermehrt haben, dass sie z.B. die Düsseldorfer Flaniermeile „Kö“ vollscheißen. Man will sie nun vertreiben.
Die Globalisierung der Haustiere begann mit den (bäuerlichen) Auswanderern nach Amerika, Südafrika, Neuseeland und Australien: Sie brachten Pferde, Kühe, Ziegen, Schafe, Hunde und Bienen, aber auch die europäischen Bäume, Sträucher und Zierpflanzen in die Neue Heimat, wo diese nicht selten die dortige Flora und Fauna verdrängten. Oftmals nicht weniger brutal wie ihre weißen Besitzer mit den Ureinwohnern umgingen. Wobei diese zuvor bereits selbst einige Tier- und Pflanzen-Arten ausgerottet hatten.
In Europa geschah Ähnliches: Immer wieder wildern sich hier z.B. eingeführte Zierpflanzen und -bäume aus, was bisweilen Jahrzehnte dauern kann, bis sie sich akklimatisiert haben und alteingesessene Arten verdrängen. Bei der falschen Akazie (der nordamerikanischen Robinie) war das z.B. der Fall, aber auch beim japanischen Götterbaum, der sich hier 122 Jahre lang nicht vermehrte, aber im Frühjahr 1945, als alles in Trümmer lag, plötzlich heimisch fühlte. Besonders schlimm war es mit der amerikanischen Wasserpest, obwohl es hier nur weibliche Pflanzen gab, die männlichen waren in Amerika geblieben. Aber aus jedem abgebrochenen Stengel wuchs eine neue Wasserpest. Der Heidedichter Hermann Löns schrieb im Hannoverschen Tageblatt 1910: „Es erhub sich überall ein schreckliches Heulen und Zähneklappern, denn der Tag schien nicht mehr fern, da alle Binnengewässer Europas bis zum Rande mit dem Kraute gefüllt waren, so dass kein Schiff mehr fahren, kein Mensch mehr baden, keine Ente mehr gründeln und kein Fisch mehr schwimmen konnte.“ Das Heulen hielt noch bis in die Sechzigerjahre an, aber dann ging die Plage zurück – vielleicht „ganz ohne Grund,“ wie der Berliner Biologie Bernhard Kegel in seinem Buch über die „biologischen Invasionen: Die Ameise als Tramp“ (2013) vermutet.
Jeder kennt das Beispiel Kaninchen, die man in Australien aussetzte. Mit allen Mitteln hat man dort seit 100 Jahren versucht, die Kaninchenplage einzudämmen, zuletzt mit dem Virus einer für Kaninchen tödlichen Krankheit. Aus dem Dokumentarfilm „Darwins Alptraum“ kennt man die Verheerung, die ein Dutzend Nilbarsche anrichteten, nachdem man sie im Viktoriasee ausgesetzt hatte: Sie vernichteten so gut wie alles Leben in diesem größten afrikanischen See – und damit auch ein Großteil der Lebensgrundlage der Menschen, die bis dahin vom See gelebt hatten. Auf den Galapagos-Inseln bedrohen die verwilderten Ziegen die einheimische Flora – und damit auch die Fauna. Auf Neuseeland sind es vor allem eingeschleppte Wespen, Ratten, Wiesel und der Kletterbeutler Fuchskusus, die die großteils flugunfähigen Vögel der Inselgruppe an den Rand des Aussterbens gebracht haben. Auch die verwilderten Pferde sind den neu-seeländischen Naturschützern ein Dorn im Auge. Bernhard Kegel hat sich von ihnen für seine Studie, in der er vor allem die Situation in Deutschland und Neuseeland vergleicht, beeindrucken lassen, deswegen stimmt er deren „hässliche Notwendigkeit“ zu: „Ausrottung von Exoten,“ weil das aber fatal nach „Ausländer raus!“ klingt, spricht man dabei vornehm von „Neozoen“ bzw. „Neophyten“. Aber wie lange ist eine Pflanzen- oder Tierart ein Neuphyt/Neuzoon und ab wann ein Altphyt/Altzoon. Das fragte sich auch der Münchner Ökologe Josef Reichholf, wobei er zu dem selben Schluß wie sein Landsmann Karl Valentin kam: „Praktisch jede Art war irgendwo einmal fremd.“ Den auch von vielen Schweizer Naturschützern befürworteten Kampf gegen eingewanderte „Exoten“ hält Reichholf für einen Ausdruck von „konservativ-anthroponationalistischem Denken“.
Derzeit richtet sich der Bürgerzorn gegen den giftigen Riesen-Bärenklau aus dem Kaukasus und das von Allergikern gefürchtete Traubenkraut Ambrosia – beide gelangten bereits im 19.Jahrhundert als Zierpflanzen zu uns. Nun sind sie plötzlich eine Bedrohung: Es wurden Notruftelefone eingerichtet, damit man neue Vorkommen dieser Pflanzen meldet, den Imkern ist der Bärenklau jedoch als Bienenblume willkommen. Sie fürchten dafür die asiatische Riesenhornisse, die sich schon via Spanien bis nach Belgien ausgebreitet hat. Die hiesigen Bienen haben im Gegensatz zu den asiatischen (noch?) keine Widerstandsform gegen diese Hornissenart entwickelt – und sind ihnen erst einmal hilflos ausgeliefert. Ähnliches gilt für das „Falsche Weiße Stengelbecherchen“, eine aus Asien eingeschleppte Pilzart, die hier die Eschen tötet, während die asiatischen Eschen resistent dagegen sind oder geworden sind. Hier tötet er im übrigen auch Bodenbakterien und andere Mikroorganismen, so dass man hofft, ihn als neues Antibiotikum einsetzen zu können. Den europäischen Eschen hilft das allerdings nicht.
Die Invasionen finden vor allem unter Wasser statt: Immer wieder werden irgendwelche exotischen Fische, Krebse und Muscheln – bis hin zu Schnapppschildkräten in den hiesigen Gewässern ausgesetzt oder sie kommen an der Außenhaut von Überseeschiffen haftend hierher. Zudem erlauben es die mit Kanälen verbundenen europäischen Wasserstraßen sogar Organismen aus dem Schwarzen Meer, sich ohne fremde Hilfe bis nach Norddeutschland auszubreiten. Bernhard Kegel erwähnt daneben das Ballastwasser, das die Handelsschiffe aufnehmen, über den halben Erdball transportieren und dann irgendwo wieder ablassen: „Durchschnittliche Containerschiffe führen teilweise über 10.000 Tonnen Wasser mit sich“ – und darin schwimmen Millionen planktonische Larven. Ein Untersuchung der Ballastwasserproben von 159 japanischen Handelsschiffen ergab, dass sie 367 verschiedene Tier- und Pflanzenarten enthielten. Ausgehend von 35.000 Schiffen, die auf den Weltmeeren unterwegs sind, bedeutet dies, das „mehrere tausend Arten täglich an einer Schiffsreise“ teilnehmen – und sich dann anderswo ausbreiten.
Als einer der ersten, der die Globalisierung einer Tierart und ihre Folgen thematisierte, darf der tschechische Nationaldichter Karel Capek gelten. In seinem Roman „Der Krieg mit den Molchen“ geht es um den ostasiatischen Riesensalamander, denen ein Kapitän in ihrem letzten Rückzugsgebiet bei Sumatra half, sich gegen die Haie zu schützen, wofür diese „Molche“, die von Muscheln leben, sich mit Perlen bedankten. Nach und nach werden sie überall angesiedelt, wobei man sich ihrer auch beim Kanal- und Deichbau bedient. Schließlich sind sie so wehrhaft gemacht worden, dass die Staaten sie als Küstenschutztruppe in Dienst nehmen – und als Hilfstruppen aufeinander hetzen. Sie wenden sich jedoch vereint gegen die Menschen, nicht zuletzt, indem sie immer größere Stücke vom Binnenland in unterspülte Uferzonen verwandeln, weil sie wegen ihrer außerordentlichen Fruchtbarkeit (jedes Salamanderweibchen legt hunderte von Eier jährlich) ständig den Lebensraum erweitern müssen. Man weiß nicht, ob man sich als Leser dieser Kriegsschilderung auf die Seite der Menschen oder der Molche schlagen soll.
So geht es uns auch in Wirklichkeit bei den invasiven Tierarten: Weil z.B. die aus Amerika eingeschleppten Grauhörnchen die europäischen Eichhörnchen verdrängen, planten italienische Bioinvasionsexperten, die Ausländer auszurotten, etliche Tierschützer waren dagegen. Sie klagten vor Gericht – und bekamen Recht.
Anders in der Schweiz, wo man zwei Trauerschwan-Pärchen kurzerhand die Flügel stutzte, um sie zur Standorttreue, d. h. zu Boden, zu zwingen. Die Vögel hatten ihr Brutrevier vom Thunersee in den Wohlensee verlegt. „Anfang Februar ließen sich vier der zehn vom Kanton auf dem Thunersee bewilligten Schwarzschwäne am Wohlensee nieder“, berichtete die Berner Zeitung. Diese vier wurden daraufhin nachts mit Netzen eingefangen. Und nachdem man ihnen die Flügel gestutzt hatte, brachte man sie zum Tuhnersee zurück. Der Jagdaufseher wollte nicht, dass sich diese im Wohlensee nicht heimische Art verbreitet, seine Wildhüter müßten sonst immer wieder deren Gelege zerstören. Als „heimisch“ gelten Arten, die in ihren jeweiligen Habitaten bereits seit etwa 200 Jahre leben, was nicht nur bei Vögeln ziemlich schwachsinnig ist. Aber der Umgang der Schweizer Naturschützer mit den Trauerschwänen, die man dort 2012 sogar alle abschießen wollte, korrespondiert mit dem Schweizer Referendum, auch so gut wie keine menschlichen Ausländer mehr ins Land zu lassen.
Leserbrief:
Die Betrachtungsweise ist etwas schlicht (oder vielleicht auch nur überformt von Überlegungen, die mehr mit der menschlichen Gesellschaft zu tun haben als mit der Natur). Es ist die falsche Frage, nach wie langer Präsenz man aufhören sollte, eine Art als Neophyt oder Neozoe zu bezeichnen. Im Extremfall kann das auch für immer angemessen bleiben, denn ausschlaggebend ist ein anderer Aspekt, nämlich wie schnell die Art wie große Distanzen überwunden hat und v. a., wer sie dabei begleitet hat. Das Problem besteht schließlich nicht darin, dass eine Art irgendwo „fremd“ ist (ein rein menschlicher Begriff), sondern dass beschränkende Faktoren ihres Biotops nicht mehr vorhanden sind und sie sich darum übermäßig vermehrt, andere Arten verdrängt und dadurch die Biodiversität schädigt. Wenn die beschränkenden Faktoren, wie etwa Fressfeinde, die Reise mitmachen, entsteht dieser Effekt dadurch nicht. Natürlich haben auch die Fressfeinde wiederum beschränkende Faktoren, deren Abwesenheit eigene Probleme bergen kann, sodass man insgesamt sagen kann, je größere Teile des ursprünglichen Biotops mitwandern, desto geringer ist die Gefahr für die Biodiversität. Bei der natürlichen Wanderung von Arten ist es ja schließlich auch genau so: Das gesamte Biotop, oder zumindest sehr große Teile davon, wandern gemeinsam. Florian Suittenpointner/Köln
.

.
Jagd auf das sibirische Springkraut
Bei der Begrünung der Ränder der Reichsautobahnen waren auch etliche Ökologen am Werk. Sie kamen überein, nur einheimische Pflanzen zu verwenden. Der schleswig-holsteinische Botaniker Reinhold Tüxen wollte gleich die ganze „deutsche Landschaft von unpassenden Fremdkörpern befreien,“ wie Stephen Jay Gould in seinem Aufsatz über den „Begriff ‚einheimische Pflanzen‘ aus Sicht der Evolution“ schreibt. Heute heißt die „Fachgesellschaft für Vegetationskunde“ nach Tüxen – dem „Vater der deutschen Pflanzensoziologie“. Zusammen mit einer Gruppe von Botanikern forderte er 1942 insbesondere Programme zur Ausrottung des angeblichen Eindringlings „Impatiens parviflora“ und zog dabei ausdrücklich den Vergleich: „Wie beim Kampf gegen den Bolschewismus die gesamte abendländische Kultur auf dem Spiel steht, so steht mit dem Kampf gegen diesen mongolischen Eindringling ein wesentliches Element dieser Kultur, nämlich die Schönheit unserer heimatlichen Wälder, auf dem Spiel.“
Dieser mongolische Killer-Baum Impatiens parviflora erwies sich jedoch beim Googeln als das harmlose Sibirische Springkraut, auch Kleines Springkraut genannt. Ihr lateinischer Name heißt übersetzt so viel wie „Ungeduldige Kleinblüterin“. Von Wikipedia-Deutschland wird sie immer noch als „Neubürger“ (Neophyt) bezeichnet, obwohl sie doch mindestens schon seit der Machtergreifung der Nazis bei uns heimisch ist. Beim Bundesamt für Naturschutz spricht man ebenfalls von einer „invasiven gebietsfremden Pflanze“ , ein Schweizer Pflanzen-Portal von einer „Problempflanze“ und der belgische Natur- und Vogelschutzverband rät, sie im Garten „durch thermische Behandlung unschädlich zu machen“. Das heißt mit einem Flammenwerfen, wie ihn viele Kleingärtner haben. Es geht dem Kleinen Springkraut wie den Flüchtlingen aus dem Osten ab 1945, Übersiedler in der DDR genannt, die im Westen bis heute als unwillkomene „Fremde“ wahrgenommen werden, und eigentlich ja auch selbst lieber heute als morgen wieder in die „verlorene Heimat“ zurückkehren würden, wenn man dem Bund der Heimatvertriebenen glauben darf. Noch etwas hat das Kleine Springkraut mit den Ostflüchtlingen gemeinsam: Es siedelt gerne auf Schutthalden und Trümmerhaufen – und man „findet es zerstreut,“ schreibt die Stadt Langenbach auf ihrer Webpage. Sie zählt dabei diesen Neophyt jedoch – anders als Wikipedia – großzügig zu den „Einheimischen Pflanzen“, an anderer Stelle spricht sie von einer „eingebürgerten Art“, die es mittlerweile „in ganz Deutschland“ gibt. Ihre „Ausbreitung“ erfolgte und erfolgt epizoochor (durch Anheftung der Samen an Menschen und Tieren), hydrochor (durch das Wasser) oder hemerochor (in Kulturfolge des Menschen, im Falle des Springkrauts meist durch verunreinigtes Wildfutter), hauptsächlich aber autochor (durch die Mutterpflanze – mit einem Schleudermechanismus, daher ihr Name: Springkraut, die Schleuderweite beträgt bis zu 3 Meter 50, insgesamt produziert eine Pflanze zwischen 1.000 und 2.000 Samen, in seltenen Fällen bis zu 10.000). Das Kleine Springkraut ist ein Vertreter der Therophyten, also der einjährigen Pflanzen: Es übersteht den Winter nur als Samen, die Mutterpflanze stirbt ab.
Charles Darwin erforschte einmal, wie widerstandsfähig ihre oder ähnliche Samen sind, wobei er auf ein Experiment zurückgriff, das sein achtjähriger Sohn ihm vorschlug: Er legte einen toten Vogel ins Wasser. Später notierte Darwin: „Eine Taube mit Samen im Kropf schwamm 30 Tage in Salzwasser, anschließend keimten die Samen noch ausgezeichnet.“ Im „Langenbach-Info“ heißt es weiter – über das Kleine Springkraut: „Verwendung fand es wohl auch als Heilpflanze gegen Warzen und Vergiftungen, und auch gegen Würmer. Weiterhin soll man einen gelben Farbstoff aus der Pflanze gewinnen können, ebenso ein Haarwasser und ein pilzabtötendes Mittel. Und natürlich findet man es mancherorts auch noch als Zierpflanze in Gärten.“ Der „Blütentherapeut“ Dr. Bach empfiehlt ungeduldigen und leicht gereizten Menschen, die Einnahme eines Springkraut-Konzentrats. Es gilt ihm sogar als „Notfalltropfen“. Und für den Ethnobotaniker Wolf-Dieter Storl ist das Springkraut eine „Merkurpflanze von großer Vitalität“. Die Pflanze ist mithin nicht weniger vielseitig verwendbar als die Ost-Flüchtlinge, die wesentlich zum „Wirtschaftswunder“ beitrugen. Dabei waren sie oftmals „konkurrenzstärker“ als die Einheimischen. Dies sagt man auch dem Kleinen Springkraut nach, denn es verdrängt das quasi hierher gehörende Große Springkraut (Impátiens nóli-tángere, zu Deutsch: Empfindliches Rührmichnichtan!), obwohl dieses seine Samen noch weiter wegschnellt. Am weitesten schafft es seine südeuropäische Abart Spritzgurke: „mit mehr als 12 Meter Schußweite,“ wie das „Natur-Lexikon“ vermerkt.
.

.
Einwanderung von Tausendfüßern in deutschen Gewächshäusern
Wissenschaftler des Senckenberg Forschungsinstitutes in Görlitz haben eine Inventur der in deutschen Gewächshäusern lebenden Tausendfüßer durchgeführt. Dabei fanden sie 18 zugewanderte Arten, die bisher noch nicht in Deutschland entdeckt wurden. Zwei der Tausendfüßer wurden das erste Mal in Europa nachgewiesen. Die zugehörige Studie ist in der Fachzeitschrift Biodiversity Data Journal erschienen. Gewächshäuser sind frei von Frost und Kälte, haben meist konstante Temperaturen und eine regelmäßige Wasserzufuhr: Ideale Lebensbedingungen für wärmeliebende Tiere. „Es ist demnach kein Zufall, dass sich die von uns untersuchten Tausendfüßer dort wohl fühlen.“, sagt Peter Decker, Erstautor der Studie und Biologe am Senckenberg Forschungsinstitut in Görlitz. Er hat gemeinsam mit seinen Kollegen Dr. Hans Reip und Dr. Karin Voigtländer das Vorkommen von Tausenfüßern – Diplopoda (Doppelfüßer) und Chilopoda (Hundertfüßer) – in deutschen Gewächshäusern untersucht. „Wir haben eine intensive Literaturrecherche betrieben und verschiedene Museumssammlungen durchforstet, aber auch selbst in 29 Gewächshäusern in ganz Deutschland vor Ort nach den Tieren gesucht.“, erklärt Decker. Wie in den meisten anderen europäischen Ländern gab es in Deutschland keine aktuelle Bestandsaufnahme: Die letzte Auflistung zum Vorkommen dieses Unterstamms der Gliederfüßer stammte von 1952. „Seit dieser Zeit hat sich aber einiges in Deutschland getan: Der Bau von neuen Tropen- und Schmetterlingshäusern und die vermehrte Einfuhr von exotischen Pflanzen, überwiegend aus den Tropen, begünstigt auch die Zuwanderung verschiedener, nicht-heimischer Tiere.“, ergänzt Decker. Eingeschleppt werden die Tausendfüßer versteckt in der Erde oder sonstigem Pflanzensubstrat, teilweise als Eier oder in juveniler Form. Insgesamt haben die Wissenschaftler mehr als 1800 der vielbeinigen Tiere gesammelt – mit der Hand unter Steinen, Holz oder in der Laubstreu aufgelesen und im Einzelfall Frankfurter Palmengarten auch mit Bodenfallen. „Wir konnten 53 Arten von Tausendfüßern unterscheiden, die in Gewächshäusern in Deutschland leben. 18 dieser Arten sind erstmalig in Deutschland nachgewiesen. Zwei sogar erstmals in Europa!“, erläutert Decker. Insgesamt stammen 34 Prozent der Tausendfüßerarten von anderen Kontinenten – die Einwanderer aus Südamerika machen dabei den größten Anteil aus. 25 Prozent aller gefundener Arten bleiben ausschließlich in ihrem „Ökosystem Gewächshaus“. Im Umkehrschluss heißt dies, dass 75 Prozent der heimischen und der eingewanderten Arten auch außerhalb der Gewächshäuser verbreitet sind. „Doch nur sehr wenige der eingewanderten Arten überleben im städtischen Bereich und stellen deshalb momentan keine Bedrohung für die einheimische Fauna dar.“, resümiert Decker. Kontakt: Peter Decker Abteilung Bodenzoologie, Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz Tel. 03581- 4760-5583.
.

.
Die Jagd auf Bioinvasoren anderswo
Der Spiegel: Warum in Südafrika die Kiefern- und Eukalyptuswälder aus der Kolonialzeit abgeholzt werden
Da sitzt sie, die höchst umstrittene Naturschützerin: Louise Stafford, 52, kleine, hagere Gestalt, weiche Stimme, Bluse in Zartrosa. In ihrem Büro hängen Bilder von bedrohten Tieren, Nashörnern, Elefanten. Warum nur wird diese Frau als Umweltfrevlerin beschimpft? „Weil wir gerade die Wälder rund um Kapstadt abholzen“, sagt sie gelassen.
Louise Stafford leitet seit 2008 die Invasive Species Unit, eine Spezialeinheit, die Bioinvasoren ausrotten will. Das sind gebietsfremde Tier- und Pflanzenarten, Feinde in den Augen von Stafford, Eindringlinge, die die heimische Flora und Fauna verdrängen.
Sie zeigt auf den ausgestopften Vogel auf ihrem Schreibtisch, eine Krähe aus Indien. Das ist auch einer dieser unerwünschten Aliens, die sich mangels natürlicher Feinde massenhaft vermehren. „Wir kämpfen gegen ein weltweites Folgeproblem der Globalisierung“, sagt Stafford, „nicht nur Menschen, Güter, Informationen und Finanzströme bewegen sich zwischen den Kontinenten, sondern auch Tiere und Pflanzen. Und überall bringen eingeschleppte Arten die Ökosysteme aus dem Gleichgewicht.“
Zu den feindlichen Elementen in Kapstadt gehören vor allem die Kiefern- und Eukalyptusplantagen, die europäische Kolonialisten im 19. Jahrhundert angelegt haben. Denn die Pflanzen saugen enorm viel Wasser aus dem Boden, breiten sich aus und verdrängen den Fynbos, jene Vegetation, die rund 9000 Arten umfasst und nur in der Kap-Region vorkommt. Der Fynbos ist unter den sechs Pflanzenreichen der Erde das kleinste und vielfältigste – und die Invasionsbiologen wollen, dass das auch so bleibt. 319 Fynbos-Arten stehen schon auf der Roten Liste bedrohter Pflanzen, 13 sind bereits ausgestorben. Deshalb sollen nun die Kiefern weichen.
Der radikale Plan zur Ausrottung der fremden Gewächse hat neue Gräben geschaffen. Alteingesessene Kapstädter halten Stafford und ihr Team für Ökofundamentalisten, die ihre Wälder zerstören, insbesondere die Pinienhaine, die Kapstadt erst das mediterrane Flair verleihen. Die Verteidiger des Waldes haben auch schon einen Namen für die Übeltäter: Baum-Taliban – radikale, unerbittliche Menschen.
„Wir sind keine Zerstörer, wir wollen nur bedrohte Arten retten“, sagt Stafford. Aber wenn sie den Waldfreunden die komplizierten Sachverhalte zu erklären versucht, wird sie als „hirntote Fynbos-Fanatikerin“ verunglimpft. Einmal, als ihre Mitarbeiter einen von Wasserhyazinthen überwucherten Fluss inspizierten, schoss ein Anwohner sogar in die Luft. „Wir haben definitiv ein Kommunikationsproblem“, sagt Stafford.
„Ökoterroristen!“, knurrt ein Spaziergänger, der im Cecilia Forest auf einer gerodeten Lichtung steht. Der ältere Herr mit britischem Akzent gehört zu den Kapstädtern, die am Wochenende in den Wäldern spazieren gehen, joggen oder wandern, während ihre Riesenhunde durchs Unterholz streunen. „Wir lassen es nicht zu, dass unser Erholungsraum vernichtet wird“, sagt er.
Doch in den kommenden Jahren sollen Hunderttausende Bäume fallen. An den Flanken des Tafelbergs kreischen schon jetzt die Kettensägen, die Holzstapel mit eingeschlagenen Kiefern wachsen. Empörte Bürger pinseln Trauergesichter auf die Schnittflächen der Stämme. Sie reichen Petitionen ein, schreiben Leserbriefe, sammeln Unterschriften.
„Shout for Shade!“, Schrei nach Schatten, lautet eine Losung der Aktivisten. Sie ziehen hinaus in die Forste und beschimpfen die Holzfäller – in der Regel schwarze Arbeiter, die aus den Townships kommen und sich über die Luxusprobleme ihrer hellhäutigen Landsleute nur wundern. „Es gibt eben Extremisten, die in der Natur das koloniale Europa konservieren wollen“, sagt Louise Stafford.
Was darf wo wachsen? Wie hat die ursprüngliche Vegetation ausgesehen? Längst geht der Streit über ökologische Fragen hinaus, ist zum ideologischen Stellvertreterkrieg geworden.
Dabei berufen sich die Verteidiger des Waldes auf den Geist des neuen, demokratischen Südafrika. „Wenn Menschen aller Rassen, Hautfarben und Abstammungen harmonisch zusammenleben, dann sollten das auch die Pflanzen können“, schrieben sie in einer Zeitungsanzeige. Ausgerechnet weiße Wohlstandsbürger, die in ihren Villenvierteln gern unter sich bleiben, preisen die Multikulti-Gesellschaft und erinnern ganz nebenbei an den Irrsinn der Apartheid.
Sie erhalten Unterstützung von den Anthropologen Jean und John Comaroff. Im Feldzug gegen Aliens zeigten sich „unterschwellige Ängste vor der diffusen Bedrohung durch das Fremde“, stellten die Wissenschaftler fest. Die Empörung gegenüber Bioinvasoren sei nur Ausdruck einer xenophobischen Haltung, die sich gegen Migranten, Flüchtlinge und Ausländer richte – ein rassistischer Reflex im Reich der Botanik.
.

.
In der taz schrieb Ulf Schleth über das Angeln von Karpfen:
„Jens1 war in einer wichtigen Phase seines Lebens fanatischer Karpfenfischer gewesen. Er hatte Zehntausende Euro in seine Ausrüstung investiert, deren erstaunlichster Bestandteil aus einem Baitboat bestand; einem ferngesteuerten Futterboot, das der Karpfenangler mit dem Köder belädt, um ihn an einer geeigneten Stelle auszubringen.
Ich lernte, dass es den richtigen Karpfenanglern gar nicht um das Essen der Fische ging. Wenn der Fisch gefangen ist, wird er nicht getötet, sondern gewogen, vermessen und fotografiert. Danach versorgt der Fänger die Wunde, die der Angelhaken gerissen hat, mit Klinik, einer Wundsalbe, und lässt ihn wieder frei. Den besonders widerstandsfähigen Tieren geben sie Namen. Als Benson in Großbritannien starb, ein 30-Kilo-Karpfen, der in 25 Jahren 63-mal gefangen worden war, versammelte sich die Karpfenfischergemeinde zu einer großen Trauerfeier.
In meinem Gaumen breiteten sich Phantomschmerzen aus. Als Jens1 mein Gesicht sah, gab er sich sinnlos Mühe, mir zu erklären, dass der Haken den Karpfen keinen Schmerz bereitet.“
.

.
Diverse Jagden
Dem leidenschaftlichen Falkenjäger Friedrich II., Kaiser des römisch-deutschen Reiches, dessen „bevorzugte Freizeitbeschäftigung“ laut Wikipedia „die Falkenjagd war, standen zeitweilig 50 Falkner in seinen Diensten, die damit u.a. Adler und Kraniche jagten.
Wegen der immer fanatischer werdenden Hinwendung der heute müßigen Saudis zur Falkenjagd wurden die Trappen auf der arabischen Halbinsel und in Marokko ausgerottet. Man sieht im Fernsehen immer wieder große Mengen von Falken in Passagierflugzeugen, gechartert von den Saudis. Sie werden zu ihrem nächsten Einsatzort geflogen – es sind Jagdausflüge in Länder, wo es noch Trappen oder ähnliche Beutetiere für die Falken gibt. .
Früher war der Gepard auch in Indien beheimatet, die Maharadschas hielten sich mitunter hunderte. Sie gingen mit ihnen wie die Araber mit ihren Falken auf die Jagd: Dazu verpaßten sie den Raubkatzen eine Haube, so dass sie nichts mehr sahen, fuhren mit einem Auto nahe z.B. an eine Gazellenherde heran und ließen dann den Gepard auf sie los.
In seiner Autobiographie „Mein Leben für die Vögel“ (2016) erwähnt der Biologe Peter Berthold die „Krähenbeißer“ – „Krajebieter – auf der Kuhrischen Nehrung: So nannte man die Fischer dort, weil sie im Herbst während des Vogelzugs mit ihren Netzen Krähen fingen: „Gefesselte zahme oder frisch gefangene Vögel und ausgeworfene Fischabfälle lockten die Krähenzüge an. Das im Sand getarnte Schlagnetz wurde von einer kleinen Reisighütte aus bedient. An einem guten Zugtag konnten mehr als 60 Krähen gefangen werden. Ein Biss in die Schädeldecke ließ sie sofort verenden. Sie wurden eingepökelt und dienten als Winternahrung. Die sogenannten ‚Nehrungstauben‘ wurden auch an große Gaststätten und Hotels verkauft und erschienen als Delikatesse unter ihrem eigenen Namen auf der Speisekarte. Im Königsberger Hotel ‚Continental‘ gab es noch bis in den Zweiten Weltkrieg hinein Nebelkrähen als Spezialität des Hauses.“
In der Aufsatzsammlung „Alphabet der polnischen Wunder“ (2007) wird unter dem Eintrag „Krähen“ erwähnt, dass die Saatkrähen vor allem in Schlesien ständig und massenhaft von jedem, der eine Knarre besaß, abgeschossen wurden. Ähnliches berichtet Guntram Vesper in seinem Roman „Frohburg“ (2016) aus dem einstigen Wismut-Sperrgebiet im Erzgebirge: Dort waren die deutschen Wachleute, die kurz zuvor noch Wehrmachtssoldaten gewesen waren, froh, als die Russen sie mit Gewehren ausrüsteten und sie endlich wieder schießen durften statt langweilige Berichte zu verfassen – auf Rabenvögel, die sich wegen der vielen Abfälle, die überall herumlagen und in den Bächen und Kloaken angeschwemmt wurden, enorm vermehrt hatten.
Kürzlich waren erneut die Abschüsse von „Rabenvögeln“ – im Nahen Osten diesmal – Thema, da antwortete nämlich der ehemalige US-Drohnenpilot Brandon Bryant vor dem „Geheimdienst-Untersuchungsausschuß“ auf die Frage, ob die bei den Drohneneinsätzen völkerrechtswidrig Ermordeten „Einzelfälle“ waren oder ob das der „Regelfall“ war: „Ziemlich. Drei Kennzeichen: Männer in militärischem Alter. Dann Raben und Krähen. Das waren Frauen und Mädchen. Sonst Männer in militärischem Alter, d.h. über 12 Jahre. Das waren legitime Ziele.“
Der englische Schäfer James Rebanks schreibt in seinem Buch „Mein Leben als Schäfer (2016): „In meiner Kindheit versammelten sich gegen Ende der Lammzeit die Männer und streiften durch die Wälder, um Krähen zu schießen – nach den aufreibenden Arbeitswochen wieder ein gemeinsames, geselliges Unternehmen.“
.

.
Jagd auf Wilderer
Der holländische Tierbuchautor Midas Dekkers fragte einmal den englischen Tierfilmer David Attenborough, ob Dian Fossey, mit der Attenborough befreundet gewesen war, nicht zu weit gegangen sei bei ihrer Jagd auf Wilderer – um die letzten Berggorillas vor ihnen zu schützen: „Ja“, antwortete der, „und sie ging überhaupt zu weit in ihrer Abneigung gegen die Afrikaner. So ließ sie die Bauern in Ruanda wissen, dass sie ihr Vieh nicht im Naturpark weiden lassen durften. Aber es ließ sich kaum sagen, wo der Park begann und endete. Und die armen afrikanischen Bauern hatten nur wenig zu essen. Wenn ihr es doch tut, sagte sie, treffe ich Gegenmaßnahmen. Trotzdem tat es einer von ihnen. Also jagte sie jeder seiner Kühe eine Kugel ins Rückgrat. Sie tötete sie zwar nicht, doch sie lähmte sie und raubte dem Besitzer damit Hab und Gut. Einst verschwand ein Gorillababy. Dian glaubte, zu Recht oder zu Unrecht, dass sie den Täter kannte und kidnappte seinen Sohn. Sie band Afrikaner mit Stacheldraht an einen Baum und prügelte sie durch. Das ist keine Art, um die Unterstützung der ansässigen Bevölkerung zu bekommen.“ Fast systematisch ließ sie nach deren Drahtschlingen-Fallen suchen. In den ersten anderthalb Jahren zerstörten ihre Patrouillen fast 4000 – „Verpflegung und Lohn beliefen sich pro Mann und Tag auf 6 Dollar“. Je mehr Dian Fossey sich in den einen und anderen Gorilla verliebte, desto mehr hasste sie die Menschen, die sie und ihr Territorium bedrohten. Schließlich wurde sie ermordet. „Seit dem Tod von Dian Fossey ist kein einziger Gorilla mehr verschwunden,“ behauptete Attenborough. Das hat sich jedoch inzwischen wieder geändert. Erst kürzlich kam aus ihrem einstigen Urwald-Camp, wo inzwischen andere Gorillaforscher die Arbeit fortsetzen, die Nachricht, dass „drei männliche Gorillas mehrere Fallen von Wilderern zerstört“ hätten – „und zwar äußerst fachmännisch. Die Fallen waren für sie als Erwachsene zwar nicht gefährlich, jedoch war wenige Tage zuvor ein kleiner Gorilla in solch einem ‚Schnappseil‘ zu Tode gekommen, nachdem er sich beim Versuch, daraus zu entkommen, die Schulter gebrochen hatte.“
.

.
Zwei jagende Arschlöcher, die vorgaben zu „sammeln“
In John Steinbecks „Geschichte einer Expedition: Logbuch des Lebens“ (1954) geht es um die Jagd auf Meerestiere. 1944 mietete der Schriftsteller zusammen mit seinem Freund Ed Ricket eine Yacht samt Mannschaft, mit der sie von der Fischverarbeitungsstadt Monterey in den Golf von Kalifornien, auch Cortez-Meer genannt, fuhren. Sein Freund hatte eine Firma, „Pacific Biological Laboratories“ in der Cannery Row, die Steinbeck mit seinem Roman „Die Straße der Ölsardinen“ berühmt machte. Ricket ließ Kinder und Arbeitslose Frösche, Schlangen und vor allem Katzen sammeln, die er dann en gros und einzeln oder sogar en détail an Forschungseinrichtungen verkaufte. Bei ihrer Expedition ging es um Meerestiere. Während der ganzen Fahrt sammelten, fischten, angelten und erschossen sie Fische, Schnecken, Muscheln, Krabben, Krebse – zentnerweise. Es war eine hemingwaysche Abenteuertour: zwei alte Männer und das Meer, dessen Bewohner sie massenweise zur Strecke brachten. Diese „Strecke“ war vollkommen sinnlos. Zwar bemerkt Steinbeck in seinem „Logbuch“ gelegentlich, dass er diese oder jene gefangene Art kannte oder eine andere Art ihm vollkommen unbekannt war, aber viel mehr als die Namen schien die beiden Männer auch nicht zu interessieren. Zum Teil schmissen sie ihren Fang auch wieder über Bord. Kurzum: sie hinterließen im Kielwasser eine Spur der Verwüstung maritimen Lebens, kamen sich dabei aber vor wie Darwin auf der „Beagle“. Zwei schreckliche Kindsköpfe, die nach Sonnenuntergang betrunken über die individuelle „Kreativität“ räsonierten. „Rickets naturwissenschaftliches Denken war ökologisch und aufs Ganze gerichtet“, schreibt Steinbeck über seinen Freund, dessen Credo lautete: „Wir müssen mit dem, was uns zu Gebote steht, so viel Freude wie möglich erringen!“ An anderer Stelle heißt es: „Nach unserer Rückkehr machten wir uns sogleich ans Werk, die Tausende aufgesammelten Tiere wissenschaftlich auszuwerten. Unser Bestreben war weniger auf Entdeckung neuer Arten ausgerichtet als auf eine Geographie der pazifischen Fauna.“ Sie hatten den Fangort der Tiere jedoch ebensowenig auf ihren Transportkisten und -gläsern vermerkt wie Charles Darwin seine Fänge auf den Galapagosinseln. Das immerhin hatten sie mit ihm gemeinsam. Im Gegensatz zu ihm etikettierten sie ihre Tiere nicht einmal: „Etiketten aber, genauer, die Information, die sie enthalten, machen ein gesammeltes Objekt erst zu dem, was es sein soll, nämlich zu einem wissenschaftlichen Gegenstand,“ wie der Insektenforscher Michael Ohl in seinem Taxonomie-Lehrbuch „Die Kunst der Benennung“ (2015) schreibt.
.

.
Jagdkonkurrenz
Inzwischen haben die Naturschützer eine stabile Konkurrenz zu den Jägern geschaffen, indem sie hier Wölfe ansiedelten, die ganzjährig geschützt und von „Wolfmanagement-Plänen“ flankiert werden. Bei den jagenden Wölfen, so argumentieren sie, handelt es sich um eine Art „Gesundheitspolizei“, sie schützen mithin die Natur. Besser als die wölfischen Jäger? Hinzu kommt die von den Grünen geplante „Agrarwende“, die die Jäger vollends „um die Vorherrschaft im deutschen Wald fürchten“ läßt, wie „Die Welt“ schreibt. Das hat bei etlichen dazu geführt, dass sie sich selbst nun allen Ernstes zu „Umweltschützern“ erklärten.
Darüberhinaus haben die jagdlichen Recherchen der Intelligenzpresse ergeben: Es gibt unter den deutschen Jägern einen Generationenwechsel und mit diesem immer mehr Frauen in den Jagdgesellschaften. „Nie war die Jagd weiblicher, nie war sie jünger,“ jubelt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Der ehemalige Jagd-Redakteur der FAZ, Eckhard Fuhr, der jetzt für die „Welt-Gruppe“ blogt, machte kürzlich seinen Frieden mit der Jagdkonkurrenz – in einem Buch über die „Rückkehr der Wölfe“, die er begrüßt. Er kommt dabei noch einmal auf sein Lieblingsthema „Frauen und Wölfe“ zurück: „Früher mußte man, um als richtiger Mann zu gelten, einen Wolf erlegt oder wenigstens eine Gams gewildert haben…Ganz anders bei den Frauen. Sie erlegen den Wolf nicht, Sie lassen sich von ihm küssen.“ Zum Beweis führt Fuhr eine Reihe mehr oder weniger berühmter Frauen an, die über dieses einschneidende Erlebnis ein Buch veröffentlichten. „Der Wolfskuss, so Fuhr, „ist der Stern, der ihnen auf dem Weg zur Selbstfindung leuchtet.“ Aber sie waren nur die Pioniere – inzwischen kann man sogar sagen: „Die Frau scheint zu lernen, den Wolf als Ressource weiblichen Selbstbewußtseins zu nutzen.“
Dies gilt nicht nur für die Frauen, die den Wolf an sich heranließen, und auch nicht für die auf Distanz bleibenden weiblichen Wolfsforscher und -schützer, die er interviewte, sondern auch für jene wachsende Zahl von Frauen, die sich auf die andere Seite schlägt – und in Konkurrenz zum Wolf tritt, indem sie sich eine mehrjährige teure Jägerausbildung leistet: das „grüne Abitur, das laut FAS „angeblich schwerer als die Hochschulreife“ ist und etwa 12.000 Euro kostet. Dass diese „Investition“ für Frauen immer attraktiver wird, auch garderobenmäßig, hat nicht zuletzt mit der Ökonomie zu tun: Bis zur Finanzkrise leisteten sich Großkonzerne wie Siemens, Thyssen-Krupp und die dann „untergegangene“ Landesbank West LB eigene Jagden – bis hin nach Afrika. Dieser Luxus wurde bzw. wird gerade abgeschafft. In anderen Worten: „Es ist“ laut FAS „Bewegung im Markt, das eröffnet Chancen für Einsteiger…Und die werden heute schon früh herangeführt. Die Jagdschule Emsland z.B. verhilft bereits Jugendlichen zum Jagdschein.“
Was da geschult wird, nennt der Biologe und Jäger Roman Wüst „Urinstinkt“. In der Süddeutschen Zeitung führte er dazu aus, dass das Erschießen von Tieren eine ganz „ursprüngliche Leidenschaft“ und „Grenzerfahrung“ ist, die Jagd jedoch immer „nur so gut wie der Mensch“ sei, „der hinter dem Gewehr steht“. In Afrika könne durch die Großwildjagd sogar „Artenschutz betrieben“ werden. Im übrigen jage man nicht, „um zu töten, sondern umgekehrt tötet, um gejagt zu haben.“ Ähnlich kann der Autor Luzius Theler nach dem tödlichen Schuß auf eine Gams in der Neuen Zürcher Zeitung sagen: „Ich bin glücklich, ich habe gejagt.“ Für ihn hat die Jagd wenig mit Naturschutz zu tun: „Das ist eine Mär, die von wohlmeinenden Verbandsleuten und deren Kommunikationsberatern in die Welt gesetzt wurde. Jagd, das ist eine Leidenschaft, eine Sucht gar, die uns beglückt, die uns beherrscht und die uns quält. Und ähnlich wie bei den Verlockungen einer ‚femme fatale‘ können wir nicht davon lassen.“
Der einstige Großwildjäger George Adamson, der dann Wildhüter in einem kenianischen Natgurschutzgebiet wurde, wo er von somalischen Wilderern ermordet wurde, mußte im Ersten Weltkrieg als erstes tausend Zebras und Oryx-Antilopen abschießen, weil die Tiere nach Meinung der dortigen Farmer „das Grasland zu sehr beanspruchten“. Wenig später mußten noch einmal zehntausend Tiere abgeschossen werden, um – wie es hieß, die Kriegsgefangenen zu versorgen. Den Farmern ermöglichte die „Vernichtung des Wildes, tausende von zusätzlichen Quadratkilometern mit Mais zu bepflanzen.“ George Adamson bemerkte beim „Töten von Tieren in diesen Mengen einen beängstigenden Nebeneffekt: Wie sehr ich auch dagegen war und verabscheute, was ich hier tat, so gab es doch eine Seite in mir, die beim eigentlichen Abschießen in eine Art Blutrausch verfiel.“
„Die Leidenschaft des Jägers“, das hat, wenn der Betreffende selbst davon redet, immer etwas von einem Geständnis, einer Beichte. So auch in dem gleichnamigen Buch von Paul Parin – ein leidenschaftlicher Jäger und Angler, der bereits als 13jähriger bei seinem ersten tödlichen Schuß auf ein Haselhuhn einen Orgasmus bekam: „Seither gehören für mich Jagd und Sex zusammen“. Dieser Doppelschuß, wenn man so sagen darf, machte ihn zu einem „Mann: glücklich und gierig“. Der linke Psychoanalytiker Parin weiß, ein „aufgeklärter Mensch jagt nicht“ und auch ein „Jude jagt nicht“ – das sind „gleichermaßen Gesetze abendländischer Ethik. Ich muss mich zu den Ausnahmen zählen.“ Aber er hat von sich selber und vielen anderen erfahren: „Wenn mein Vater nicht seine Jagd gehabt hätte, wären wir Kinder in der strengen und sterilen Familienatmosphäre erstickt.“ Deswegen kann er rückblickend eher genuß- als reuevoll z.B. seine Jagd auf eine Gazelle in der Sahara und das Forellenfischen in Alaska – als Sucht – beschreiben. In einem Nachwort rühmt Christa Wolf Paul Parins „Lebenskunst“.
Nun gibt es aber noch eine erregendere Tätigkeit als die des Jägers: das ist die des Wilderers, „der gleichzeitig Jäger und Gejagter ist“, wie der Sozialforscher Norbert Schindler in seiner wunderbaren Studie über das Salzburger Land: „Wilderer im Zeitalter der Französischen Revolution“ hervorhebt.
Der deutsche Jäger Eckard Fuhr empfindet die hier eingewanderten und heimisch gewordenen Wölfe zwar als eine Bereicherung, aber mit einzelnen „Problemwölfen“ würde er dennoch kurzen Prozeß machen. Es darf nicht so weit kommen, dass sie die „Spielregeln“ bestimmen: „Von allen denkbaren Begründungen für die Wolfsjagd wäre das immerhin diejenige, die am meisten einleuchtet.“ Was aber, wenn die Wölfe so unbelehrbar wie die Jäger sind? Oder noch unbelehrbarer, weil die Jagd für sie keine Freiheit, sondern Notwendigkeit ist?
Zu den Aufgaben des kenianischen Wildhüters George Adamson in Friedenszeiten gehörte es, dass er „Problemlöwen“ und „-elefanten“, die Menschen oder Rinder angefallen hatten, erschoß.
Der Zürcher Zoodirektor und Tierpsychologe Heini Hediger war übrigens der Meinung, dass die Jäger wenig zum Wissen über die Tiere, die sie jagen, beitragen. In einem Text über Kaninchen schrieb er: „Das Freileben dieser interessanten Nager ist erst in den letzten Jahren erforscht worden. Auch hier hat es sich gezeigt, dass das Jagen im Grunde wenig Gelegenheit zum Beobachten bietet, die Kaninchenjagd schon gar keine. Ein Schuß, selbst ein Meisterschuß, ist eben niemals Beginn, sondern stets das Ende einer allzu kurzen und meist nicht sehr vielsagenden Beobachtung.“
George Adamson entwickelte erst ein Verstehen von Tierverhalten, als seine Frau Joy Adamson eine Löwin namens Elsa geschenkt bekam, die sie im Naturschutzgebiet „auswildern“ wollte, was ihr auch gelang. Er tat es ihr später mit drei weiteren Löwen nach. In seinem Buch „Meine Löwen Mein Leben“ (1990) schreibt George Adamson, dass er es sich noch immer nicht erklären kann, „warum ich Löwen soviel Zeit meines Lebens gewidmet habe, ohne zu versuchen, die Tiefe und Vielfalt ihrer Persönlichkeit zu verstehen.“
P.S.: Das vierzehntägige deutsche Jagdmagazin Pirsch sei neu ausgerichtet worden (»revamped«, ein Wort, in dem also ein beachtenswerter »Vamp« steckt), um für mehr Frauen, für jüngere und modernere Menschen, attraktiv zu sein. Dazu wurde der Inhalt verbessert (»revised«). Der Schwerpunkt werde jetzt auf die Frage gelegt: Wie lässt sich ein Ausgleich zwischen Tradition und modernem Leben finden? Die erste Ausgabe versuche sich an einer Balance zwischen Jagd, Job und Familie. Das Wort »Balance« kommt mehrmals vor in der kleinen Pressemitteilung, ich nehme an, darum geht es nun auf der Pirsch.
P.P.S.: Hierzulande gilt das Angeln und Jagen laut taz nun als „das neue Yoga“…2018 bereiteten sich 20.000 zukünftige Hobbyjäger auf die Jagdprüfung vor, ein Viertel davon Frauen, denen das alte Yoga nicht mehr zur Entspannung reichte. Für den Jäger und Angler Paul Parin war der Jagdschein eine „Licence for Sex and Crime“, die taz titelte dagegen: „Wölfe töten mehr Vieh“. Weil sie immer mehr Nutztiere reißen, besteht nun amtlicherseits „Handlungsbedarf“, d.h. es sollen die ersten Wölfe, die sich in Deutschland seit 1999 angesiedelt hatten, erschossen werden. Ein männlicher „Problemwolf“ bei Hannover wurde bereits zum Abschuß freigegeben, er hatte u.a. ein süßes Alpakamädchen gerissen. Die baldige Wolfsjagd kommt dem neuen Yoga „Tiere töten“ gerade recht. Und wenn alle tot sind, importiert man neue.
.

.
Jagdmoden
Auf waidfrau.de heißt es: Ob Drückjagd-Hose (in Signalfarbe) oder gemusterte Drückjagd-Jacken (mit Tarnmuster ap-blaze orange), unsere facettenreiche Auswahl femininer Jagdmode …
Auf keyler-jagd.de heißt es: Sie wollen feine, unaufdringliche Jagdmode, die auch auf der Landpartie oder beim Schüsseltreiben eine gute Figur macht? Dann seien Sie uns herzlich…
Im barth-info.de heißt es: Natürlich lieben und leben wir die Jagd – nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, lieber mit ausgestreckter Hand. Natur, Mode und ein individueller Kleidungsstil sind für uns ein zeitloser Ausdruck von Lebensart, Persönlichkeit, Anspruch und vor allem Lebensfreude.
Auf halalico.com heißt es: Entdecken Sie bei uns die beste Jagdbekleidung und die feinsten Countryside Lifestyle Produkte der exklusivsten Labels aus Europa und der ganzen Welt.
Auf jagdfieber.com heißt es: Unser Firmenname „JagdFIEBER – pure Passion„ ist für uns Programm – wir tun alles dafür, damit Ihre Leidenschaft für die Jagd zu einem besonderen Vergnügen wird. So haben wir uns vorgenommen, ein breites Sortiment von ausgesucht guten Jagd-Produkten zusammenzutragen, die in einem umfassenden Sinne hochwertig, langlebig, praktisch und formschön sind.
Auf frankonia.de heißt es: Herzlich Willkommen im Frankonia Online Shop! Bei Frankonia finden Sie alles für Jagd, Schießsport, Freie Waffen, Selbstschutz, Outdoor, Naturbeobachtung…
Auf amazon.de heißt es: Hier finden sie die aktuellen Trends bei der Jagdbekleidung, auch exklusive Jagdhüte für Damen und Herren.
Auf t-online.de heißt es:
Unter Beteiligung von über 40 Ländern beginnt heute die europaweit größte Jagdmesse. Bis Sonntag zeigen Anbieter auf der ‚Jagd & Hund‘ in Dortmund Ausrüstung, Schutzkleidung, Jagdmode, Zubehör aller Art und auch Dutzende Hunderassen. Unter den 800 Ausstellern sind auch Unternehmen aus den USA und Weißrussland.
.

.
Die ersten Goldschakale sind da
2000 hatte man bereits einen in der Lausitz gefunden – tot: ein Wilderer hatte ihn dort erschossen. Es wird vermutet, dass viele Arten wegen des Klimawandels nach Norden vordringen: In der Uckermark entdeckte ich italienische Grillen und Laubfrösche, chinesische Marienkäfer und spanische Nacktschnecken. Die Goldschakale sind wahrscheinlich aus Südosteuropa eingewandert, bereits 1991 kamen einige Wölfe aus Polen und Marderhunde aus Sibirien. Wiederangesiedelt wurde der Luchs, von denen es im Nationalpark Bayrischer Wald bereits wieder 17 Tiere gibt, eins wurde mutmaßlich von einem Jäger vergiftet: „Vom Mörder der Luchsin Tessa fehlt weiter jede Spur,“ schreibt die Süddeutsche Zeitung.
Jetzt lauern auch noch die Goldschakale vor den Toren Berlins. Das heißt noch nicht ganz, aber in Vorpommern und Brandenburg wurden sie schon gesehen, unhd lauern tun diese mit dem Wolf verwandten Hunde eigentlich auch nicht, sie schleichen eher, und das auch nur, wenn es darauf ankommt. Aber das ist genau das Problem mit dem Schakal und war auch schon das Problem beim gleichnamigen IRA-Actionsthriller aus dem Jahr 1997: Wann kommt es dem Schakal darauf an? Eigentlich ist er ein typisches Balkan-Untier. Heißt das, es findet hier eine Balkanisierung statt – und damit auch eine Schakalisierung? „Hat der Schakal ein Beutetier entdeckt, schleicht er sich geduckt an und versucht, die Beute in einem kurzen Sprint zu erreichen, er jagt für gewöhnlich in geselligen Trupps,“ heißt es auf Wikipedia über diese Balkanesen. Als sein gefährlichster Feind gilt der Wolf, „weswegen die Abwesenheit von Wölfen die weitere Ausbreitung von Schakalen nach Norden begünstigen könnte“. Nun haben wir hier aber Wölfe – und trotzdem Schakale in Brandenburg, oder immerhin einen.
Ein Berliner Künstler hat mal als Kunstaktion einen Schakal in Österreich gefangen und ihn nach Belgrad transportiert, wo er im Vereinsheim von Partizan Belgrad 24 Stunden mit dem Raubtier in einem Raum verbracht hat. Anschließend hat er ihn vor den Toren der Stadt freigelassen. Kein Schwein von der Presse hat versäumt, seine „Human-Animal-Performance“ als billiges Plagiat einer ähnlichen Beuys-Aktion abzutun. Der Künstler hat in Interviews dagegengehalten: Das mit Joseph in New York war ein Kojote. Papperlapp, haben die Jugos gemeint, Kojote oder Schakal, das ist doch Jacke wie Hose.
.

.
Wildlife-Krise
Alle kennen die Midlifekrise, aber sie ist nichts gegen die Wildlife-Krise. Diese besteht in einem umfassenden Verlust an „Lebensqualität“ bei frei lebenden Tieren und Pflanzen – infolge von Ausrottung, Bodenerosion, Wassermangel, Klimawandel, Vertreibung, Land-Grabbing…oder alles zusammen.
Hierzulande bekannt ist der Rückzug der vielen wild lebenden Tiere und Pflanzen aus den industriell bewirtschafteten Agrarflächen in die unnatürlichen Städte.
Der Umweltaktivist Peter Clausing erinnerte daran, dass es neben diesem selbständigen Revierwechsel auch eine aggressive Vertreibung gibt, die bis zu den Menschen in einer Region geht. Der Nationalpark wurde in den USA erfunden und ist eine zutiefst koloniale Idee: „Einer der ersten, der Yellowstone-Nationalpark, erwies sich in mehrfacher Hinsicht als Prototyp: Seine Schaffung war mit der gewaltsamen Vertreibung der dort lebenden Indigenen verbunden, er entsprach von Anbeginn dem Schema ‚Natur als Erlebnis‘ (heute kritisch als Disneyfizierung von Natur bezeichnet.“ Zudem wurde er – ähnlich anderen Schutzgebieten – Ende des 20. Jahrhunderts zum Betätigungsfeld für Biopiraten:
„Für den zu ‚Nutz und Frommen des Volkes‘ geschaffenen Yellowstone Nationalpark schlossen die US-Biotechfirma Diversa und der US National Parks Service 1997 in aller Stille ein Abkommen, in dem der Firma die geistigen Eigentumsrechte an den hitzestabilen Mikroorganismen der Geysire übertragen wurden. Nachdem dieser Fall von Biopiraterie öffentlich bekannt geworden war, wurde der Bioprospektionsvertrag im März 1999 durch ein US-Gericht annulliert.“
Clausing belegt, „dass die verbreitete Annahme, mit der Einrichtung von Naturschutzgebieten ‚unberührte, menschenleere Natur vor dem Eindringen des Menschen geschützt würde, ein Trugschluss ist. In aller Regel lebten dort Menschen, die klar definierbaren westlichen Interessen weichen mussten. Während der Kolonialzeit, waren es Wildschutzgebiete, die eingerichtet wurden, um den Massenabschlachtungen von Nashörnern, Elefanten und anderen ‚Trophäenträgern‘ Refugien entgegenzusetzen. In heutiger Zeit werden Menschen aus den designierten Biosphärenreservaten und Nationalparks gewaltsam entfernt, weil es die Zwänge des ‚freien Marktes‘ erfordern. Schutzgebiete im Süden werden als Ausgleichsflächen für die globale profit- und wachstumsbedingte Naturzerstörung benötigt. Zugleich unterliegt der moderne Naturschutz vielfach dem grundsätzlichen Dogma des Neoliberalismus – der Markt soll es regeln.“
Das sieht dann praktisch so aus, wie die US-Autoren Masson und McCarthy in ihrem Buch „Wie Tiere fühlen“ das alljährliche „Culling“ der Elefanten im „Hwange-Nationalpark“ von Zimbabwe schildern: „Einige Familiengruppen werden von Flugzeugen in die Richtung von Jägern getrieben, die alle Tiere bis auf die jungen Kälber abschießen. Diese werden dann zum Verkauf abtransportiert. Die Kälber irren herum, schreien und suchen nach ihren Müttern.“ In einigen afrikanischen Nationalparks gibt es bereits Schlachthöfe und Weiterverarbeitungsbetriebe, um neben den Einnahmen aus dem Wildlife-Tourismus auch noch die Bestandsregulierung profitabel zu machen – und z.B. das Elfenbein selbst zu verkaufen. Im südafrikanischen „Krüger- Nationalpark“ werden zwischen 500 und 800 Elefanten jährlich abgeschossen und verarbeitet. Im dortigen Touristenladen kann man u.a. Fellmäntel von Ginsterkatzen kaufen. Für die Elefantenforscher Iain und Oria Douglas-Hamilton war dieser eingezäunte Park eine „riesige Wildtierfarm“, die effizient bewirtschaftet wurde, wie sie in ihrem Buch: „Wir kämpfen für die Elefanten“ (1992) schreiben. Manchmal gelingt es Naturschutzorganisationen, eine Herde zu retten, indem sie ihren Abtransport in ein anderes Schutzgebiet organisieren. So meldete z.B. das kanadische Naturschutz-Unternehmen IFAW: „In Malawi müssen mehr als 60 Elefanten ihren Lebensraum verlassen. Heute Morgen wurden die ersten neun von ihnen gefangen. Damit beginnt die gemeinsame Umsiedlungsaktion vom IFAW (Internationaler Tierschutz-Fonds) und der Regierung Malawis. Die Elefanten werden in ein 250 Kilometer entferntes Schutzgebiet transportiert.“ Die Elefanten werden gejagt, betäubt und mit Kränen auf LKWs geladen, als Helfer stehen Tierfreunde aus Europa und Amerika bereit, die diese Mitmachaktion als Wildlife-Urlaub gebucht haben.
Auf einer Veranstaltung „Tötet Armut Elefanten“, die in der taz stattfand, machte der Tierfilmer Hannes Jaenicke deutlich: „Binnen zehn Jahre sind Elefanten in Afrika ausgerottet, wenn die brutale Elfenbeinjagd nicht gestoppt wird.“
Der Ostberliner Elefantenpfleger und -forscher Patric Müller hält dagegen vor allem die asiatischen Elefanten für gefährdet: „In ganz Asien gibt es maximal noch 60.000 Tiere, ungefähr die Hälfte davon wild lebend. Ihr Lebensraum wird da immer mehr eingeengt – und die Konflikte mit den Menschen nehmen zu. Im rückständigen Burma gibt es noch die meisten Elefanten. Sie werden dort auch noch wirklich gebraucht. Das hat aber auch etwas Paradoxes: Die Teakholzwälder werden massiv abgeholzt, das gibt jedoch den Elefanten Arbeit – und somit Schutz. Wenn es aber gelingt, den Handel mit Tropenholz einzudämmen, dann verlieren die Mahuds ihren Arbeitsplatz und die Elefanten ihre Daseinsberechtigung. Der Tourismus kann das nur in ganz begrenztem Maß ausgleichen.“
Zum Einen wollen die afrikanischen und asiatischen Staaten die Kleinbauern und Viehzüchter, die das meiste für sich produzieren, also keine oder kaum Steuern zahlen und nur wenig konsumieren, dazu oft keine Landrechte schriftlich nachweisen können, in die Städte vertreiben – zugunsten von touristischen Großprojekten, zu denen an vorderster Stelle die „Nationalparks“ zählen. Zum Anderen zahlen die internationalen Agrarkonzerne viel Geld für brauchbare Böden und Wälder, die sie roden dürfen, was die dort lebenden Pflanzen und Tiere vertreibt. Oft reicht schon die Ausrottung auch nur einer Art in einer Region, um eine „Trophische Kaskade“ auszulösen. Als Beispiel führen Haie erforschende Biologen den Zusammenbruch der Muschelindustrie in North-Carolina an, nachdem die Haie weggefischt und getötet worden waren: „Ohne ihre Jäger vermehrten sich die Kuhnasenrochen, machten sich gierig über die Muschelbänke her und vernichteten den Bestand.“
In seinem neuen Buch „Die grüne Matrix“ kommt Peter Clausing auf die Vertreibung von Menschen infolge von „Land Grabbing“ für Nationalparks zu sprechen:“Von den Dimensionen her überragt dieses zweite Land Grabbing, das der Biodiversität und dem Klimaschutz dienen soll, den Landraub für die industrielle Landwirtschaft,“ heißt es in einer Rezension seines Buches in den „Beiträgen zu sozialistischer Politik: ‚Widerspruch“‚ (Nr.64).
Beides vertreibt die Menschen, die dort vorher lebten – und stürzt die Tiere und Pflanzen mindestens in eine Wildlife-Krise. Dies gilt auch z.B. für all die Raubtiere, die seit 1991 nach Deutschland eingewandert sind (s.o.).
Es gibt heute über 40 Millionen Hunde auf der Welt, aber nur noch etwa 40.000 Wölfe, rechnete der US-Philosoph und Wolfsbesitzer Mark Rowlands als darwinistischen Beweis dafür vor, dass sich die Unterwerfung des Hundes unter die Dressur der Menschen durchaus gelohnt habe – für den Hund. Während die Strategie der Wölfe, die ihre „Wilderness“ verfeinern, eindeutig gescheitert ist. Die Wildlife-Krise führt zu Identitätsverlust – sonst ist sie keine.
.

.
Eine Adlerschlucht für Charlottenburg
Die Adler kreisen über der Schlucht. Wer kennt dieses Lied nicht, das Luis Trenker immer in den Alpen summte. Der Westberliner Zoo hat sich nun auch eine „Adlerschlucht“ gegönnt – für 3,65 Millionen Euro. Adler gab es dort vorher auch schon, ebenso im Ostberliner Tierpark. Adler, die Greifvögel überhaupt, dazu zählen auch die Geier, leben quasi in der Luft. Sie nutzen die Aufwinde, um sich hochzuschrauben und kreisen dann – stundenlang, ein Leben lang. Diesen Luftraum kann ihnen kein Zoo bieten. Aber wenn man in den zwei Berliner Zoos die Adler, und auch die Eulen, in ihren vielleicht 1000 Kubikmeter großen Volieren trübsinnig auf Stangen sitzen sieht, weiß man, was ihnen fehlt: ihr wesentliches Milieu: die Luft – oft in großer Einsamkeit. Und doch sind wir so beschränkt, dass wir uns mindestens zwei, am Besten ein Weibchen und ein Männchen, in jedem Käfig wünschen.
Im Ostberliner Tierpark haben sie einen „Geierfelsen“ – eine Flugvoliere, in der die Geier etwa sechs Flügelschläge brauchen, um von einem Ende zum anderen zu fliegen, sie ist schon fast das Maximum, was die Aktiengesellschaft Berliner Zoo/Tierpark ihren Greifvögeln an Berliner Luft bieten kann.
Im viel kleineren Zoo haben drei Andenkondore ebenfalls eine große Flugvoliere, sie ist dennoch so klein, dass sie die meiste Zeit auf einem Baumstumpf sitzen müssen. Hier fand man jetzt für die „Adlerschlucht“, in der auch viele Geier untergebracht sind, eine andere Lösung, eigentlich zwei: Eine billige, indem man aus einer Voliere drei machte – durch Entfernung der Trennwände. Und eine teure, indem zwei neue Flugvolieren errichtet wurden, in die das Publikum gehen kann. Man kann sich so den kleinen Luftraum, der darin den Insassen sozusagen zur freien Verfügung steht, leichter vorstellen. Die Schneeeulen, die gerne auf dem Boden sitzen (wenn dort Schnee liegen würde, wären sie gut getarnt), blinzeln noch etwas irritiert: Erst seit drei Monaten befindet sich zwischen ihnen und und uns kein Gitter mehr. Zur Eröffnung ließ der Zoo/Tierpark-Direktor sich a là Grzimek/Dathe lächelnd mit einem kleinen weißen Geier im Arm photographieren. Er sagte, dass neben den ganzen Gitter-Um- und Neubauten auch das Gelände den natürlichen Lebensräumen der Vögel angepaßt worden sei. Es sieht auch alles so aus, als sei gewissermaßen die frische Luft des Kapitals durch diesen Zoo-Bereich geblasen worden. Fraglich ist, ob man so etwas auch für die Volieren-Anlage der Greifvögel im Tierpark plant. Oder soll sie so bleiben wie sie ist – als Mahnmal für die stolzen Raubvögel und ihr bescheidenes Leben im Sozialismus? Dass die im Westberliner Zoo lebenden auf vegetarische Ernährung umgestellt werden sollen, wie es das Ostberliner Regietalent Frank Castorf in seinem Buch „Am Liebsten hätten sie veganes Theater“ insinuiert, hat sich als Gerücht erwiesen.
Zurück zu den endlosen Baureformen der Zoologischen Gärten, um ihren Greifvögeln eine gewisse Lufthoheit wieder zu verschaffen: Inzwischen sind wir über die Klimaerwärmung, die CO2-Kreisläufe und den zunehmenden Wetterkatastrophen zu einer eigenständigen Luftforschung gekommen, die sich gewaschen hat. Von da aus stellt sich bei den gefangen gehaltenen und ausgestellten Greifvögeln nicht mehr nur die Frage der Luft-Quantität, sondern auch die der -Qualität.
Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz veröffentlicht dazu regelmäßig Hiobsbotschaften, wonach die Berliner Luft laut den Messungen ihrer „Belastung“ nicht gut ist (Feinstaub wird weniger, Stickstoffdioxid dafür mehr). Vor allem in der Gegend Kudamm-Gedächtniskirche-Zoo ist die Luft sehr viel schlechter als in Friedrichshain-Tierpark. Und auch akustisch viel anstrengender. Es wäre deswegen tierethisch eigentlich geboten, den kleinen Zoo zu räumen und dafür den riesigen Tierpark auszubauen – u.a. mit großen begehbaren Flugvolieren. Das würde auch ökonomisch Sinn machen, denn die Zoo-Immobilie ist ein „echtes Filetstück“, wie wir Facility Manager zu sagen pflegen. Eine Blitzumfrage bei Deutschlands beliebtesten Maklern und Immobilienhaien über den Wert ergab jüngst – fast einstimmig: „Ohhh, da muß ich erst eine Weile rumrechnen und mich kundig machen. Wer hätte das bis vor kurzem auch nur in Erwägung gezogen…“
Kurzum: Die Greifvögel brauchen mehr und bessere Luft, deswegen müssen die Flugvolieren größer und nicht mehr mitten in der Stadt gebaut werden. Bisher fiel dem Regiermeister Müller zur Frage „Wie dick ist die Berliner Luft“ nur eine politische „Maßnahme“ für den nächsten „Dieselgipfel auf Bundesebene“ ein: „Gemeinsam werden wir dort den Druck erhöhen.“ – Zusammen mit den Adlern in der West-Schlucht und den Geiern am Ost-Felsen? Damit haben diese aber noch keinen Kubikmeter Luft gewonnen, und eigentlich bräuchte es sowieso Kubikkilometer pro Kopf für sie. Man sehe sich nur die traurige Harpyie im Tierpark an, ein großer südamerikanischer Greifvogel; benannt wurde die Art nach den weiblichen Mischwesen in der griechischen Götterwelt, die geflügelt sind und den Sturmwind verkörpern. Dem blinden Seher Phineus schissen sie auf seinen Teller. Angeblich soll er irgendetwas Windkritisches geäußert haben, aber das entschuldigt diesen Mischmädchen-Schabernack natürlich nicht. Im West-Zoo gab es auch mal eine Harpyie, die ebenfalls unglücklich aussah: „Sie war krank und lebte mit einem Kolkraben zusammen“, wie der Berliner Autor Martin Kluger in seinem 1000seitigen Zooroman „Abwesende Tiere“ schreibt.
Die Kolkraben im Ostberlier Tierpark, die mit Geiern in einer Flugvoliere leben können, aber zu zweit in einem Käfig auf dem Berg untergebracht wurden, sind verschwunden. Man wollte sie auswildern, bekam aber keine Genehmigung dafür von der Naturschutzbehörde – vielleicht hat es doch noch geklappt. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass sie an eine andere Tierschau verkauft wurden.
.

.
Amselsterben
„Komplette Straßenzüge in Hamburg liegen voll mit toten Amseln,“ berichtet Renke Lühken vom Institut für Tropenmedizin in Hamburg dem NDR. In Berlin habe ich bisher nur eine Amsel mit den entsprechenden Symptomen – Apathie, geringe Fluchtneigung – gesehen. Der Usutu-Virus wird durch Stechmücken übertragen, auch auf Menschen, was zu einer Hirnhautentzündung führen kann – muß aber nicht, bei Amseln wirkt er dagegen schon nach wenigen Tagen tödlich. „Es gibt kein Gegenmittel gegen das Usutu-Virus und auch keinen Impfstoff. Infizierte Vögel sterben entweder oder aber entwickeln Antikörper. Es sei stets so, dass es in einer Region eine Epidemie gebe, der Vogelbestand werde dort stark reduziert, viele Wirte würden sterben, viele überlebende seien dann aber immun und im kommenden Jahr sei alles wieder normal,“ erklärt Usutu-Experte Lühken. Der Virus wurde 1959 in Südafrika erstmalig identifiziert, 2001, 2005 und 2006 kam es seinetwegen auch in Mittel- und Südeuropa zu einem Wildvogelsterben. Warum seitdem kein Impfstoff gegen Usutu entwickelt wurde, läßt sich wohl mit dem mangelnden Nutzen der Amseln erklären. Bei den Füchsen, die die Tollwut und den Fuchsbandwurm übertragen können (weswegen man sie jahrzehntelang gejagt und vergast hat, ohne sie ausrotten zu können), hat man das getan: Es wurden erfolgreich Schutzimpfungen entwickelt, die ab 2008 mit Fleischködern ausgebracht wurden. Seitdem sind die hiesigen Füchse tollwutfrei und demnächst wohl auch ohne Bandwürmer, die im übrigen nicht ihnen schaden, sondern nur uns – als Zwischenwirte. Diese Entwicklung der Impfstoffe geschah, um die Menschen zu schützen, bei den infizierten Amseln ist das leider nicht nötig, da die Infektion mit dem Usutu-Virus für uns meist symptomfrei oder mit geringen Beschwerden verläuft.
NABU August 2018: Das durch das Usutu-Virus verursachte Amselsterben nimmt offensichtlich immer größere Ausmaße an. Gab es bis vor einer Woche erst 1.500 an den NABU gemeldete Verdachtsfälle, sind es heute bereits über 5.000 Meldungen mit mehr als 10.000 kranken oder verendeten Vögel – meist Amseln, aber in geringen Zahlen auch Singdrosseln, Haussperlinge, Meisen und andere Arten.
Seit 2016 sehe man eine Ausbreitung über Nordrhein-Westfalen nach Norden und in Richtung Bayern, zudem habe es einen Ausbruch im Raum Leipzig und Berlin gegeben. Die Osthälfte Deutschlands blieb ansonsten jedoch weitgehend verschont.
Das Virus wird von Stechmücken übertragen, deshalb ist die Krankheit in Deutschland auf die warme Jahreszeit beschränkt. Nach Beobachtung der Experten verenden immer dann besonders viele Vögel, wenn das Virus erstmals in einer Region vorkommt. Für Menschen, die gestochen werden, besteht laut NABU nach bisherigem Kenntnisstand keine Gefahr. Gegenmittel gibt es bisher nicht.
.

.
Jagd auf Labortiere (1)
Der Gründer des Tierparks, der Biologe Heinrich Dathe, schrieb 1936 seine Doktorarbeit über den Penis der Meerschweinchen; auch das erste Tier in „seinem“ Ostberliner Tierpark war 1955 ein Meerschweinchen: „Hansi“. Der Direktor des Westberliner Zoos, der Veterinär Heinz-Georg Klös, schrieb dagegen seine Doktorarbeit 1953 über den Uterus der Meerschweinchen. Während der Münsteraner Zoologe Norbert Sachser, seine Doktorarbeit über „die erstaunliche Fähigkeit der Hausmeerschweinchen“ schrieb, „zwei unterschiedliche Formen der sozialen Organisation auszubilden“: In kleinen Gruppen (z.B. mit drei Männchen und drei Weibchen) bildet sich bei den zwei Geschlechtern ohne großes „Drohverhalten“ eine „lineare Dominanzhierarchie“ aus, wobei das ranghöchste Männchen die Verpaarung mit den Weibchen beansprucht. In Gruppen „von bis zu 50 Meerschweinchen“ tritt „ein weit komplexeres soziales Muster an ihre Stelle“: Sie „splitten sich in stabile Untergruppen auf, die aus jeweils ein bis fünf Männchen und ein bis sieben Weibchen bestehen“. In jeder bilden sich dominante Männchen heraus, die „feste soziale Bindungen zu den Weibchen ihrer Untergruppe haben, die über Jahre bestehen bleiben können. Sie kümmern sich fast ausschließlich um diese Weibchen; nur ihnen gegenüber tanzen sie Rumba, das für Meerschweinchen typische Balzritual.“
In seinem Buch „Der Mensch im Tier“ (2018) erwähnt Sachser ferner den „roten Emil“, ein Alphamännchen in einer großen Kolonie: Wenn man ihn allein in ein fremdes Gehege setzte, geriet er schnell unter Stress, wenn dies jedoch mit seinem „Lieblingsweibchen“ geschah, „stiegen die Cortisolkonzentrationen lange nicht so stark an.“
In den meisten Forschungslaboren werden Meerschweinchen nicht nur unter Stress gesetzt, sondern komplett vernutzt. In dem Buch „Duell zweier Giganten“ (2015), gemeint sind Robert Koch und Louis Pasteur, geht es darum, wie die zwei Bakteriologen die Entdeckung und Bekämpfung von Bakterien (die Tollwut, Tuberkulose, Pest etc. übertragen), durch ihr feindselig-konkurrentes Verhalten voranbrachten. Durch das ganze „Duell“ ziehen sich Meerschweinchen: Sie sind die eigentlichen Hauptpersonen – diese „Prügelknaben der Physiologen“, wie der Entomologe Fabre sie nennt. Kaum bricht in Kairo die Cholera aus, schon packen die Abgesandten von Koch und Pasteur je hundert Meerschweinchen ein und machen sich auf ins finstere Herz der Epidemie. Einer der Forscher wird dort krank: „Gestorben für die Wissenschaft“. Von den vielen Meerschweinchen kehrt keines mehr in seine Heimatkolonie zurück.
Koch mußte anfänglich seine Meerschweinchen noch selbst kaufen, an ihnen erforschte er den Milzbrand-Erreger, Pasteur dann ebenfalls, beide beanspruchten die Priorität; der russische Immunologe am Pasteur-Institut Ilja Metschnikow versuchte zu vermitteln: „Dank dem Franzosen Pasteur wurde die wahre Bedeutung des Milzbrandbakteriums verstanden und dank dem Deutschen Koch wurde dessen Rolle als alleinige infektiöse Ursache dieser Krankheit bewiesen.“ Auch die Gegenmittel werden an Meerschweinchen erprobt, mit dem man sie gegen den Diphteriebazillus impft: „Einige Tiere überleben. Das ist schon ein Sieg.“ Dann werden neue Meerschweinchen herangeschafft: Ihnen werden tödliche Dosen injiziert und wenig später Injektionen mit Serum gegeben, das von den wenigen Tieren stammt, die der Infektionen widerstanden haben. „Die Meerschweinchen überleben“. Aber es ist ein langer Weg vom Ergebnis im Labor bis zur Marktzulassung des Medikaments: Dafür sind „riesige Mengen an Meerschweinchen nötig“ – es fehlt jedoch an Geld. Der preußische Staat hat kein Interesse, die Diphterie (an der jährlich über 1000 Kinder allein in Berlin sterben) zu bekämpfen, er finanziert stattdessen die Forschung an Tetanus, da dies eine große Gefahr für wertvolle Pferde darstellt. Erst vier Jahre später, 1894, bringt die Firma Hoechst ein Serum gegen Diphterie auf den Markt. Der Immunologe Emil Behring, wird damit der erste, den sein Entdeckung reich macht, außerdem adelt man ihn 1901.
Meerschweinchen „dienen“ auch weiterhin in den Laboren – nicht nur als Versuchstiere, auch als lebende Laborgeräte zur Serumproduktion. Darüberhinaus werden sie auch zu Millionen in Kinderzimmern vernutzt. InIrina Liebmanns Roman „Die freien Frauen“ (2004) heißt es dazu: „Ihre Tochter, die war auf einer Matheschule gewesen und hatte Klavier gespielt wie eine Prinzessin, und ihre Tiere hatte sie geliebt, stundenlang mit dem Meerschweinchen beim Arzt gesessen, und dann, weißt du, was, sie hats in den Bauch getreten!“
In den „Zoogeschichten“ von Carl-Christian Elze, dem Sohn des Leipziger Zootierarztes Karl Elze, ist zu lesen, dass er sich immer wieder aufs Neue und einmal sogar auch alle seine Geburtstagsgäste Meerschweinchen im Zoo aussuchen durften. Sie wurden normalerweise an Reptilien und Raubtiere verfüttert. Den von ihm geretteten Meerschweinchen widmet er in seinem Buch mehrere Kapitel. Wenn sie starben, bekam er ihr Fell oder sie wurden sogar ausgestopft und kamen auf ein Regal in seinem Zimmer. Mit den Meerschweinchen, namentlich mit „Lissi 1, 2, 3 und 4“, begann seine „Prägung“ auf Tiere. Er schrieb sogar ein Drehbuch für einen Kurzfilm über eine „Meerschweinchengeburt“, es wurde in sein Buch „Oda und der ausgestopfte Vater: Zoogeschichten“ (2018) mit aufgenommen.
Die Verhaltensforschung ist von der Beobachtung einer Art zu der von Individuen fortgeschritten. Indem die Bundesverfassung der Schweiz Tieren wie Pflanzen eine Würde zugesteht, hat sie über den Artenschutz hinaus (um den “Gen-Pool” nicht zu reduzieren!) den einzelnen Tieren und Pflanzen so etwas wie „Menschenrechte” (im Sinne der Französischen Revolution) eingeräumt. Es geht dabei um die Verbesserung ihrer Lebens- und Haltungsbedingungen – u.a. auch in den Zoologischen Gärten. So dürfen z.B. keine Herdentiere in der Schweiz mehr einzeln gehalten werden – das gilt auch für Meerschweinchen.
Sie werden jedoch weiterhin für alles Mögliche verwendet: „Von der Krebsforschung, über Infektionskrankheiten bis zu toxikologischen Untersuchungen. 2012 wurden 3.721 Meerschweinchen für Hautsensibilisierungstests verwendet,“ heißt es auf „meerschwein-sein.de. „Auch werden Meerschweinchen zur Aus-, Fort-, und Weiterbildung benutzt sowie zur Qualitätskontrolle und Erforschung von Produkten und Geräten. 2007 wurde auch der stark umstrittene Schwimmtest, bei dem die Tiere bis zur Erschöpfung schwimmen müssen, an Meerschweinchen durchgeführt. Der Test mit dem Schweregrad ‚schwer‘ wurde mit 349 Meerschweinchen gemacht. Der Schwimmtest wird in der Depressionsforschung eingesetzt und dient zum Testen von Antidepressiva.“
Auf „justanswer.de” ist von einem eher harmlosen Meerschweinchen-Versuch die Rede: „Ich habe vor kurzem für meine zwei meeris eine Brücke gekauft, um zwei Käfige zu verbinden. Wie schaffe ich es, sie dazu zu bewegen, rüber zu laufen?“
.

.
Jagd auf Labortiere (2)
Bei den meisten Labortieren (lat. laborare: arbeiten) besteht die Arbeitsleistung darin, dass sie künstlich bei ihnen eingeführte Substanzen (meistens Chemikalien) unter Qualen aushalten müssen. Die kaum 5 Zentimeter groß werdenden Zebrafische aus dem Ganges gelten als die „Laborratten“ unter den Fischen. Es wurden bereits 25.000 wissenschaftliche Studien über sie veröffentlicht, „darunter über 2000 allein im Jahr 2015,“ berichtet der Verhaltensbiologe Jonathan Balcombe in „Was Fische wissen“ (2018).
Die Aquarianerzeitschrift „Koralle“ schreibt in ihrer März-Ausgabe über die Anfänge der Zebrafischforschung: „Seit es zu Beginn der 80er-Jahre gelang, einen Zebrafisch zu klonen, wurden verschiedene genetische Stämme rein gezüchtet.“ Und damit kennt die Forschung an diesen kleinen Bärblingen nun kein Halten mehr. So pflanzten z.B. einige Genetiker in Singapur ihren Zebrafischchen Gene einer Leuchtqualle ein, so dass sie nun ebenfalls im Dunkeln leuchten. Vor allem wurde der Zebrafisch aber ein „Kleintier-Krankheitsmodell“ – für Störungen des Blutkreislaufs, Leberleiden, Nervendegeneration und Krebs. Der „Koralle“-Autor erwähnt ferner, „dass Stämme mit fehlender Pigmentierung Einblicke in das Innenleben eines Zebrafisches gestatten. Spezielle Computersysteme, ausgerüstet mit Videokameras zeichnen Verhaltensänderungen bei epileptischen Anfällen auf und helfen, diese auszuwerten. Neue Arzneimittel können so geprüft werden, indem man testet, ob sie eine Linderung der Symptome erreichen. Aber auch die negativen, toxischen Auswirkungen dieser Substanzen werden mithilfe der Zebrafische erforscht.“ Es sind Millionen jährlich, die dabei draufgehen. Im Dienste unserer Gesundheit.
Es gibt aber auch eine Forschung im Dienste ihrer Gesundheit – indem man ihr Empfindungsvermögen experimentell studiert. Dabei geht es jedoch meist ebenfalls nur um ihre Leidensfähigkeit. In einer der Studien, die Balcombe erwähnt, wurden z.B. 132 Zebrafischen Essigsäure in den Schwanz gespritzt: „Sie schlugen daraufhin auf eine eigenartige Weise mit dem Schwanz.“ Setzte man sie dagegen dem Alarm-Pheromon eines anderen Zebrafisches aus, reagierten sie „normal und schwammen zum Grund“. Die Forscher schlossen daraus: Die Angst der Fische hat Vorrang vor ihrem Schmerz.
Bei einem anderen Experiment wurde einigen Zebrafischen Essigsäure injiziert, anderen ein harmloseres Salzwasser. Beide Gruppen änderten ihr Verhalten nicht und zogen den Teil des Aquariums vor, wo im Gegensatz zu einem anderen Pflanzen wuchsen. Als man jedoch in den ungeliebten Teil ein Schmerzmittel gab, schwammen die Zebrafische, denen man Säure injiziert hatte, sofort dorthin.
Forscher des Max-Planck-Instituts für Neurobiologie untersuchten genetisch veränderte Zebrafische mit einem Cortisolmangel, dabei diagnostizierten sie Anzeichen einer Depression. Als sie jedoch Medikamente gegen Angstzustände, Valium und Prozac, ins Wasser gaben „normalisierte sich ihr Verhalten“. Schon ein Sichtkontakt mit anderen Zebrafischen, die durch eine Scheibe von ihnen getrennt waren, besserte ihre Stimmung.
All diese gemeinen Experimente haben immerhin mitbewirkt, dass das Schmerzempfinden von Fischen in der von Hobbyanglern wimmelnden USA nun quasi amtlich anerkannt ist. Damit sind sie dem Subjektstatus ein Stückchen näher gekommen. Der Wissenssoziologe Bruno Latour ist optimistisch: „Irgendwann wird man es genauso seltsam finden, dass die Tiere und Pflanzen kein Stimmrecht haben – wie nach der Französischen Revolution, dass bis dahin die Menschenrechte nicht auch für Frauen und Schwarze galten“.
Die technowissenschaftlichen Studien über Zebrafische im Internet unterscheiden sich von den dortigen Veröffentlichungen der Aquarianer wie Feuer von Wasser – Zitat: „Der Zebrafisch gehört zu den beliebtesten Zierfische und wird wegen seiner einfachen Haltung besonders Neulingen in der Aquaristik oft zur Haltung und auch zur Zucht empfohlen. Optisch sticht diese Art sofort ins Auge: Über den gesamten schlanken Körper ziehen sich horizontale Streifen in dunkelblau und – je nach Lichteinfall – silbern oder gold.“ Weiter heißt es: „Der Zebrabärbling ist kein wählerischer Fresser. Eine abwechslungsreiche Ernährung beugt aber Mangelerscheinungen vor und trägt zu einer guten Abwehrkraft der Fische bei.“ Bei ihrer Zucht gilt es zu beachten: „Die weiblichen Bärblinge legen in den frühen Morgenstunden den Laich in die Bepflanzung ab. Es empfiehlt sich, die Elterntiere nach dem Ablaichen möglichst schnell aus dem Zuchtbecken zu entfernen, da sie üblicherweise starke Laichräuber sind, selbst dann, wenn sie zuvor gut gefüttert wurden.“ Ein anderes Aquarianer-Forum gibt zu bedenken: „Die meisten Aquarienfische haben zwar Kompatibilität mit Zebrafischen. Es gibt jedoch einige Arten, die sie als Nahrung betrachten.“
Auch die „Zeit“ hob bei den Zebrafischen hervor, dass sie „schön“ aussehen: „Zwar muss man aufgrund der geringen Größe schon genau hingucken, aber dafür wird man mit einem prächtigen Farbenspiel belohnt. Dunkelblau, fast schwarz schimmern die Längsstreifen auf dem silberweißen Fischkörper. Und bei richtigem Lichteinfall, da beginnt der Zebrabärbling sogar ein wenig zu glitzern.“
Wenn es um Verhaltensbeobachtungen von Fischen in Aquarien geht, kooperieren die Wissenschaftler gelegentlich mit Aquarianern, denn von denen verbringen manche tausende von Stunden im Jahr vor ihren Fischbecken, während die Wissenschaftler vor allem mit Schreibarbeiten beschäftigt sind. In der Fachzeitschrift „Animal Behaviour“ veröffentlichten die Biologen Sarah Zala und Dustin Penn von der Veterinärmedizinischen Universität Wien eine eigene Beobachtung an Zebrafischen. Sie wollten herausfinden, ob auch Zebrafische über soziales Lernen Risiken einschätzen. Wie reagieren sie z.B. auf sich bewegende Objekte?Wenn die Fische relativ nahe an das bewegte Objekt heranschwammen, wurden sie als „mutig“ eingestuft, während die Tiere, die sich eher in einiger Entfernung an der Rückseite des Aquariums aufhielten, als „scheu“ bezeichnet wurden. Das Ergebnis: „Wenn die wilden Zebrafische mit den gezähmten Tieren gemeinsam gehalten wurden, schwammen sie näher an das sich bewegende Objekt heran. Dies bestätigte die Annahme der Wissenschaftler, dass Zebrafische tatsächlich von ihren Artgenossen lernen können, Risiken einzuschätzen, ohne sich selbst potenziell gefährlichen Situationen auszusetzen: Sie beobachten das Verhalten der anderen und ändern ihres entsprechend.“
Das Verhalten läßt sich auch von Menschen steuern: Schweizer Wissenschaftler haben einen Roboterfisch entwickelt, der seine „Artgenossen“ beobachten soll. „Mit Hilfe des künstlichen Zebrafisches wollen die Forscher mehr über die Kommunikation und Entscheidungsfindung in Fischschwärmen erfahren. Obwohl der Roboter etwas größer als die lebendigen Zebrafische ist, kann er Fischgruppen erfolgreich unterwandern und sogar ihr Verhalten ändern.“ Ja, sie schwimmen neugierig hinter ihm her. Man sieht geradezu, wie sie ins Grübeln kommen.
.

.
Tiere im Widerstand
Der Berliner Arbeitskreis für Human-Animal-Studies Chimaira hat ein Buch veröffentlicht über „Das Handeln der Tiere“. Zentral ist darin der Begriff „Agency“, was so viel wie Handlungsmacht oder Wirkmacht bedeutet. Über ihre konkreten Widerstandshandlungen findet man darin jedoch wenig. „Die Geschichten über die freiheitsliebenden und gewitzt handelnden Tiere scheinen die Ausnahme zu bilden,“ schreiben die Autoren.
Der Kriegstheoretiker Karl von Clausewitz verglich einst die List mit dem Witz: „Wie der Witz eine Taschenspielerei mit Ideen und Vorstellungen ist, so ist die List eine Taschenspielerei mit Handlungen“.
Insofern hier von tierlichem Widerstand die Rede ist, könnte man auch sagen: „Das Tier ist witzig geworden“. Das wir das registrieren und thematisieren liegt zum Einen an unserem sich ständig erweiternden Wissen über Tiere, nicht zuletzt durch das Internet, in das Millionen Leute Texte, Photos oder Clips über die eine oder andere Gewitzheit der ihnen nahe stehenden Tiere, wie Hunde, Gänse, Schafe, Löwen, Krähen und vor allem Hauskatzen, einstellen. Gleichzeitig nahmen im Übergang von den harten zu den weichen Ideologien die Menschen- und dann auch die Tierrechte an Bedeutung zu. Und in der Verhaltensforschung fing man an, das Verhalten einzelner Tiere statt des vermeintlich angeborenen Artverhaltens zu studieren. Zu den Gewitzheiten der Tiere zählt auch ihre Fähigkeit zu lügen, zu betrügen und sich zu tarnen, einer anderen Art anzuverwandeln. Dazu hier ein Beispiel:
Die in langer Ko-Evolution entstandene Ähnlichkeit der Orchidee mit ihrem Insekt, das sie anlockt, ohne Nektar dafür bereit zu stellen. Die Orchideen sind sogenannte Täuschblumen. Die Blüten z.B. der Orchidee „Ophrys insectifera“ (Fliegen-Ragwurz) haben nicht nur die Form und Farben einer potentiellen Partnerin für Grabwespen-Männchen angenommen, sondern strömen auch noch den weiblichen Sexuallockstoff aus. Bei seinen Kopulationsversuchen bekommt das Männchen zwei Pollenpakete auf die Stirn geklebt. „Dolchwespen fallen gerne auf Blüten der mediterranen Orchidee Ophrys speculum (Spiegel-Ragwurz) herein. Teilweise geht die Täuschung so weit, dass Bienenmännchen der Gattung Andrena die entsprechenden Ophrys-Blüten sogar einem Weibchen vorziehen. Verhaltensforscher nennen das eine überoptimale Atrappe,“ schreibt die Biologin des Berliner Botanischen Gartens Birgit Nordt.
Umgekehrt bieten einige südamerikanische Orchideen, die mit „Prachtbienen“ kooperieren, den Bienenmännchen einen Duft an, der nicht ihnen direkt gilt. Sie nehmen ihn laut dem Biologen Karl Weiß „in ansehnlichen Flakons an den Hinterbeinen“ auf und fliegen damit zu ihren „Balzplätzen“, wo sie „Präsentationsflüge“ unternehmen. „Dabei soll ihr farbenprächtiger Panzer zusammen mit dem betörenden Pflanzenduft die Weibchen anlocken.“
Die Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari gehen von einer wechselseitigen Beeinflussung aus, die eine Angleichung von Pflanze und Tier hervorgebracht hat. Ein solcher Vorgang – „Werden“ von ihnen genannt – gehört „immer einer anderen Ordnung als der der Abstammung an. Werden kommt durch Bündnisse zustande. Es besteht gewiß nicht darin, etwas nachzuahmen oder sich mit etwas zu identifizieren; es ist auch kein Regredieren-Progredieren mehr; es bedeutet nicht mehr, zu korrespondieren oder korrespondierende Beziehungen herzustellen; und es bedeutet auch nicht mehr, zu produzieren, eine Abstammung zu produzieren oder durch Abstammung zu produzieren…Das Werden ist eine Vermehrung, die durch Ansteckung geschieht.“ Affizieren und Affiziert-werden. „Werdet wie die Orchidee und die Wespe!“ raten sie uns.
.

.
Als Mensch kann man sich durch den Witz der Tiere möglicherweise auch bedroht fühlen. Eine solche Situation inszenierte Alfred Hitchcocks 1963 mit seinem Film „Die Vögel“. Ein englischer Landarbeiter sieht, dass sich die See- und Landvögel immer aggressiver verhalten. Er vermutet bald, dass hinter ihrer scheinbar zufälligen Schwarmbildung eine Art kollektive Intelligenz steckt – und sieht darin eine zunehmende Gefahr. Er fängt an, seine Hütte zu befestigen. Aus dem Radio erfährt er von ähnlichen Vorgängen im ganzen Land. Nachdem alle Verbindungen zur Außenwelt unterbrochen und die benachbarten Bauern durch Attacken der Vögel umgekommen sind, entwirft der Landarbeiter für sich und seine Familie einen Überlebensplan.
Hitchcock verwendete für seinen Film neben einer Romanvorlage noch zwei Realereignisse – eine aus dem kalifornischen Ort „La Jolla“: Dort war ein größerer Schwarm Spatzen durch den Kamin in ein Haus eingedrungen. Während der Vorbereitungen für den Film kam es in der nahen Küstenstadt Capitola zu einem weiteren Vorfall: Hunderte „Dunkler Sturmtaucher“ (aus der Familie der „Sturmvögel“) flogen gegen Hausdächer, zerbrachen Fenster und durchtrennten Stromleitungen. Im Film wurde darauf bezug genommen – mit einem Dialog zwischen einer Ornithologin und einem Handelsvertreter in einem Restaurant. Erst Jahrzehnte später stellte sich heraus, dass die Tiere beim Fressen ein bestimmtes von Pflanzen produziertes Nervengift aufgenommen hatten – auch eine Form von Widerstand: gegen ihre Freßfeinde.
So wie die Ornithologin in dem Hitchcock-Film davon überzeugt war, dass den Vögeln das geistige Potential fehlt, Angriffe mit destruktiven Beweggründen zu führen, ist sich auch heute noch der Harvard-Neurologe Marc Hauser sicher, Tiere sind generell nicht in der Lage, sich zu einem Aufstand gegen die Menschen zusammenzurotten. Eine Revolution ist mit Tieren nicht zu machen, schreibt er in seinem Buch „Wild Minds“.
Ein kleiner Aufstand gelang vor einigen Jahren einer Brigade von Arbeitselefanten in einem indischen Forstbetrieb: Wenn sie nach Feierabend in den nahen Wald entlassen wurden, fielen sie immer wieder in Plantagen ein. Ihre Mahuts banden ihnen schließlich Kuhglocken um, damit die Bauern rechtzeitig gewarnt wurden und die Elefanten vertreiben konnten. Das funktionierte auch – bis zu jenem Tag, als die Elefanten das akustische Warnsignal ausschalteten und ungestört eine Bananenplantage abernteten. Sie hatten alle ihre Glocken mit Schlamm verstopft.
Der Elefantenpfleger im Berliner Tierpark, Patric Müller, erzählte mir: „Bei einer Elefantenkuh, bei der Afrikanerin Dashibo, war es besonders schwierig, Leute einzuarbeiten, die ist sehr aggressiv gegenüber Fremden gewesen. Eigentlich nicht mal aggressiv, sie hat ein Spiel mit denen getrieben, um zu testen, wie weit sie gehen kann. Ich war oft früh morgens alleine da, um den Stall auszumisten und dazu musste man nach hinten in die Ställe, wo der Kot und der Urin lag. Und dann war einem dort der Fluchtweg abgeschnitten. Das hat Dashibo hervorragend wahrgenommen – diese Situation, in der sie zeigen kann: ,Ja, jetzt hab ich dich’. In solchen Situationen kommt es mitunter zu Scheinangriffen, wobei man aber nicht weiß, ob das ein Scheinangriff ist oder ein ernster Angriff. Wenn man sich dabei nicht der Gefahr aussetzen will, dass der Elefant einen irgendwann nicht mehr akzeptiert, dann sollte man einfach stehen bleiben. Wenn man Angst hat, kann man den Job sowieso nicht machen. Es gab Elefantenpfleger, die es bei ihr nie geschafft haben, stand zu halten. Einen Kollegen hat sie mal aus dem Gehege geworfen mit dem Rüssel. Der hat noch großes Glück gehabt, dass er nicht unter ihrem Rüssel gelandet ist. Aber der konnte danach nie mehr allein mit der arbeiten, es mußte immer einer mit dabei sein.Solche Situationen kommen immer wieder vor. Auch alten Elefantenpflegern passieren tragische Unfälle.“
Dass Schimpansen sich gelegentlich zu gefürchteten Kampfgruppen zusammentun, weiß man schon lange. Aber auch einzeln sollte man sie nicht unterschätzen. Es gibt nicht wenige Schimpansenforscher, denen ein eingesperrter Affe irgendwann einen oder mehrere Finger abgebissen hat.
Auf dem zweiten Primatologen-Kongreß, 1996 von den amerikanischen Anthropologinnen Shirley C. Strum und Linda M. Fedigan in Teresopolis, Brasilien, organisiert, gehörte zu den eingeladenen Feldforschern die Biologin Thelma Rowell. Ihr Beitrag hatte den Titel: „A Few Peculiar Primates“. Es ging darin jedoch nicht um Affen – die Referentin ist eine Schafforscherin, die mit ihrer kleinen Herde in Kanada lebt. „Ich weiß natürlich, dass meine Schafe keine Schimpansen sind,“ sagte sie, „aber ich will damit ausdrücken, dass es sinnvoller ist, den Schafen die Möglichkeit einzuräumen, sich wie Schimpansen zu benehmen, als davon auszugehen, dass sie langweilig sind im Vergleich zu Schimpansen – dann haben die Schafe nämlich keine Chance.“ Zuletzt unternahm Thelma Rowell bei ihrer Schafherde eine Meinungsforschung. Heraus kam dabei – laut einer kanadischen Schäferzeitung: „Sheeps do have opinions“.
Jeder, der Tiere hält, kennt einige ihrer Widerstandsformen und weiß, dass sie sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Alle Tierpfleger, die ja großenteils mit wilden Tieren arbeiten, haben täglich mit dem Widerstand ihrer Zootiere zu kämpfen. Am interessantesten sind diesbezüglich die so friedlichen Orang-Utans – die in Gefangenschaft für ihre Fluchtversuche berühmt sind.
Freilebende Orang-Utans gebrauchen nur wenige Werkzeuge (Termiten graben sie z.B. mit den Händen aus), in Gefangenschaft entwickeln sie sich dagegen zu wahren Ausbrecherkönigen. Dem im Zoo von Omaha, Nebraska, lebenden männlichen Orang-Utan „Fu Manchu“ gelang mit seiner Familie gleich mehrmals die Flucht aus ihrem Freigehege und ihrem Käfig. Sie wollten jedoch nur auf die Bäume draußen klettern bzw. sich auf dem Dach des Affenhauses sonnen – und ließen sich jedesmal wieder in ihre Unterkunft zurücklocken. Die Wärter waren lange Zeit ratlos. Schließlich kamen sie dahinter, dass „Fu Manchu“ im unbeobachteten Moment in den Graben des Freigeheges schlich, dort eine Tür, die zum Heizungskeller führte, leicht aus den Angeln hob und öffnete. Am Ende eines Ganges tat er das selbe mit einer zweiten Tür, die ins Freie führte. „Dann fingerte er ein Stück Draht aus einer seiner Backen und machte sich am Schnappriegel des Schlosses zu schaffen“ – so lange, bis er es geöffnet hatte. Anfang 2013 brach die Orang-Utan-Dame „Sirih“ im Frankfurter Zoo erneut aus dem neuen Affenhaus aus – ihr Gehege wird seitdem ständig überwacht. Demnächst will man sie in einen anderen Zoo abschieben.
Wenn sie einmal nach draußen gelangt sind, fürchten sich die Orang-Utans meist vor der ungewohnten Umgebung. Die Mitarbeiter am Projekt „Think Tank“ zur Erforschung der geistigen Fähigkeiten von Orang-Utans im Nationalzoo in Washington erzählten von einer Orang-Utan-Gruppe, die mehrere grüne Tonnen, die von ihren Wärtern beim Saubermachen ihres Freigeheges vergessen worden waren, übereinander stapelte und darüber rauskletterte. Eines der Weibchen fand man bei den Verkaufsständen wieder, wo sie ein Brathähnchen aß und Orangensaft trank, beides aus einer Kühlbox, die sie einem Zoobesucher abgenommen hatte. Ein anderer Besucher, der Zeuge ihres Ausbruchs gewesen war, sagte, dass er deswegen nicht die Wärter alarmiert hätte, weil er dachte, die Orang-Utans dürften das, denn sie wären schon den ganzen Vormittag aus ihrem Freigehege raus – und wieder reingegangen. Einer der „Think Tank“-Mitarbeiter meinte: Wenn man einem Schimpansen einen Schraubenzieher gebe, werde dieser versuchen, das Werkzeug für alles zu benutzen, außer für den ihm eigentlich zugedachten Zweck. Gäbe man ihn einem Gorilla, so werde dieser zunächst entsetzt zurückschrecken – ‚O mein Gott, das Ding wird mich verletzen‘ – dann versuchen, ihn zu essen, und ihn schließlich vergessen. Gäbe man den Schraubenzieher aber einem Orang-Utan, werde der ihn zunächst einmal verstecken und ihn dann, wenn man sich entfernt habe, dazu benutzen, seinen Käfig auseinander zu bauen…Und so seien die Tierpfleger und die Orang-Utans in dem Menschenaffenäquivalent eines endlosen Rüstungswettlaufs gefangen, in dessen Verlauf die Zooplaner sich immer wieder Gehege ausdenken, die natürlich wirken und dennoch die Tiere sicher gefangen halten sollen, während die Orang-Utans jede Schwachstelle, die den Planern und Erbauern entgangen sein könnte, auszunützen versuchen.“
Ich habe selbst einmal eine Erfahrung mit dem Orang-Utan-Witz gemacht: Als ich im Bremer Zoo arbeitete, gehörte es zu meinen morgendlichen Aufgaben, zwei halbstarke Orang-Utans aus ihrem Käfig zu lassen und mit ihnen an der Hand zum See der Wasservögel zu gehen, wo wir in ein Schlauchboot stiegen und zu einer kleinen Insel fuhren. Eigentlich war sie für Gibbons, aber die gab es noch nicht. Auf der Insel stand, für den Fall, dass es regnete, ein Pfahlhäuschen, an dem ich die Tür aufmachte und dann mit dem Schlauchboot zurückfuhr. Einmal sprangen die Orang-Utans zurück ins Schlauchboot, während ich die Tür des Häuschens aufmachte und ich stand allein auf der Insel und machte ein blödes Gesicht, während die beiden Affen sich auf dem schnell abtreibenden Schlauchboot halbtot lachten. Vor Vergnügen sprangen sie immer wieder auf dem Wulst des Bootes herum und beschleunigten es dadurch noch mehr.
.

.
Überhaupt ist der Drang nach Freiheit wohl die verbreitetste Form von tierlichem Widerstand. Im Bremer Zoo entfloh mir einmal ein Doppelnashornvogel, den wir allerdings wieder einfangen konnten, und dann ein Ährenträgerpfau, der auf Nimmerwiedersehen verschwand. Wir weinten ihm keine Träne nach. Er war sehr aggressiv und hatte bereits einen Pfleger mit seinen scharfen Sporen krankenhausreif geschlagen.
Die Dingos sind die einzigen verwilderten Hunde, die es zu einer eigenen Art gebracht haben: Canis lupus dingo. Nach Australien kamen mit den Weißen ab 1788 auch deren Schafe. Als die Dingos immer wieder ihre Schafe rissen, schafften sie sich scharfe Hunde an. Von diesen liefen jedoch regelmäßig welche zu den Dingos über, die sie mit Hilfe eines paarungsbereiten Weibchens anlockten. Selbst der längste Zaun der Welt, der 5400 Kilometer lange „Dingo Fence“, der die Schafweiden im Süden Australiens schützen sollte, konnte das nicht verhindern. Inzwischen meinen bereits einige engagierte Dingoschützer, dass die „reinen Dingos“ zum Aussterben verurteilt sind – durch die anhaltende Vermischung mit entflohenen Haushunden.
In „SeaWorld“ Orlando/Kalifornien zog 2010 ein Orca-Zuchtbulle namens „Tilikum“ während der Vorführung seine Trainerin Dawn Brancheau an ihrem Pferdschwanz unter Wasser, wo sie ertrank. „Sie ist schon sein drittes Opfer!“ titelte die Bild-Zeitung. Tilikum bedeutet im Chinook-Pidgin „Freund“. Er wurde 1983 im Alter von etwa zwei Jahren vor Island gefangen. Der tödliche Angriff auf seine Trainerin zahlte sich für den „Killerwal“ nicht aus: Er wurde nicht wie zunächst beabsichtigt, ins Meer frei gelassen. Ab 2014 trat er wieder in den „SeaWorld“-Shows auf.
Der amerikanische Neurophysiologe John C. Lilly wollte sich über ein Computer-Programm mit den „hochintelligenten“ Delphinen verständigen. Seine Versuche, auf diese Weise erst einmal die „Delphin-Sprache“ zu verstehen, scheiterten. Schließlich sollte seine Kollegin Margaret Howe versuchen, einem Delphin namens „Peter“ Englisch beizubringen. Dazu ließ sie sich die oberen Zimmer des halben Unterwasser-Labors „Dolphin House“ auf einer der amerikanischen Jungferninseln mit Nasa- und Navy-Geldern wasserdicht machen und etwas über Kniehöhe mit Seewasser auffüllen, damit sie mit dem Delphin Tag und Nacht üben konnte. Der Spiegel berichtete: „Nach einer Weile zeigte Peter mehr als nur Neugier gegenüber seiner Lehrerin. Immer deutlicher zeigte er seinen Geschlechtstrieb. „‚Es war mir nicht unangenehm‘, erinnerte sich Lovatt. Schließlich beschloss sie, sein sexuelles Verlangen selbst an Ort und Stelle zu befriedigen – mit der Hand.“ Seine Englischkenntnisse konnte sie damit jedoch nicht verbessern. Professor Lilly verordnete den beiden zur Auflockerung der Sprachbarriere LSD, was bei dem Delphin jedoch nicht wirkte.
Die amerikanische Dompteuse Mabel Stark, die mit bis zu 20 Tigern auftrat, lebte mit dem von ihr großgezogenen Tiger „Rajah“ in ihrem Wohnwagen, er schlief bei ihr im Bett. In der Manege bestand ihre berühmteste Nummer darin, dass sie den Tigern den Rücken zukehrte und Rajah sie plötzlich von hinten ansprang, zu Boden warf und mit ihr rang. Mit der Zeit entwickelte sich daraus bei dem Tiger ein Paarungsakt. Weil sein Samen auf ihrem schwarzen Lederkostüm unschön aussah, wechselte sie in ein weißes Kostüm, das sie bis zum Ende ihrer Karriere 1968 trug.
Es gibt Schlimmeres: Viele Raubtierdompteure wurden irgendwann in einem günstigen Moment von einem ihrer Tiger, Löwen oder Bären getötet. In einem französischen Zirkus wurde einer sogar von acht dressierten Hauskatzen angefallen und getötet.
Die DDR-Dompteuse Ursula Böttcher, die mit 12 Eisbären arbeitete, erzählte in ihrer Biographie, dass sie einmal mit dem Zirkus „Aeros“ in Friedrichshain gastierte. Dort ging sie gelegentlich mit ihrem Eisbären Alaska an der Leine durch den Park, wo es ihm plötzlich ein Wallnußbaum besonders angetan hatte. Als es wieder zurück zum Zirkus ging und er in den Käfig sollte, riß er sich los und lief durch den Park – zum Nußbaum. Erst nachdem er sich satt gefressen hatte, ließ er sich zurück zum Zirkus führen.
Hierbei geht es weniger um Widerstand gegen den Dompteur als um Lust – um Appetit auf Nüsse. Ähnliches passierte Ursula Böttcher wenig später mit gleich sechs Eisbären: sie rissen aus, weil sie ein Faß mit Lebertran rochen, das auf dem Zirkusgelände stand. Sie kippten das Faß um und schlabberten den Tran auf, danach ließen sie sich jedoch wieder willig in ihren Käfigwagen zurückbringen. In Florida hatten sie ein derart komfortables großes Wasserbecken zur Verfügung, dass sie die ganze Nacht herumschwammen – und dann bei der Vorstellung aber so müde waren, dass sie unmöglich auch noch wilde Eisbären spielen konnten oder wollten.
.

.
Die darwinistische Biologie hat sich um die Lust wenig Gedanken gemacht. Nietzsche forderte einst: „Werdet selten!“ Ein Mückenschwarm kreist über einen Teich; aus dem Off raunt Heinz Sielmann: „Sie haben nur ein Interesse – sich zu vermehren.“ Der holländische Biologe Midas Dekkers sieht das anders: „Im Grunde sind Tiere gar nicht auf Elternschaft aus. Es ist nicht ihr Anliegen, die Art zu erhalten, sondern das von Mutter Natur. Läge es an den Tieren selbst, führten sie ewig ein lustiges Junggesellenleben.“ Zumal die Weibchen vieler niederer Tiere nach dem Eierlegen bzw. Gebären sterben, oder – wie z.B. die australische Krabbenspinne – von ihrer Brut aufgefressen werden? Einige Embryologinnen am Pariser Institut Pasteur sind gar davon überzeugt, dass das Austragen eines Kindes und das Wachsen eines bösartigen Tumors identische Vorgänge sind: Der Fötus ist ein fremdes Stück Fleisch, ein Pfropf, den der Körper der Mutter abzustoßen versucht. Aber dem Fötus wie dem Krebs gelingt es, das Immunsystem seines Wirts erfolgreich zu blockieren. Zwischen ihnen gibt es laut den Embryologinnen nur einen wesentlichen Unterschied: „Aus der befruchteten Eizelle entwickelt sich ein neuer Staat, mit dem Krebs bricht dagegen die Anarchie aus.“
In der Biologie hat man nie einen Unterschied zwischen Verpaarung und Vermehrung gemacht. Am ganzen mehr oder weniger subtilen Spiel der Anbahnung einer Beziehung (und darüberhinaus) interessiert die Naturwissenschaften bloß die materielle Seite: Fakten über die Anzahl der männlichen Spermien, mit denen die Befruchtung erfolgt, Fakten über die Zahl der Jungen, die dabei entstehen, Fakten über die unterschiedlichen Penis- und Hodenformen, Fakten über die Gene, die weitergegeben werden…
Die meisten Fach- und Sachbücher über die Sexualität der Tiere gehen so weit, dass sie dem Spatz ebenso wie dem Löwen unterstellen, sie wollen partout, dass die Söhne und Töchter auch ganz sicher ihre eigenen sind. Dabei gibt es sogar unter den Menschen nicht wenige, ganze indigene Völker, die einen Zusammenhang zwischen Geschlechtsakt und Schwangerschaft nicht nur leugnen, sondern geradezu absurd finden. Aber die männlichen Tiere sollen es angeblich besser wissen. Deswegen tun sie alles, bis hin zur Ausbildung von Penissen mit denen sie vor dem Akt die eventuell schon vorhandenen Spermien in der Scheide ihrer „Partnerin“ gleichsam raussaugen können. Die US-Biologin Olivia Judson erklärt dazu in ihrem Buch „Die raffinierten Sexpraktiken der Tiere“: „Ein Männchen, das es schafft, seine Partnerin so zu stimulieren, dass sie mehr von seinen Spermien als von denen seiner Nebenbuhler aufnimmt, oder das die Spermien seiner Konkurrenten irgendwie beseitigen kann, gibt eine größere Anzahl seiner Gene weiter als seine weniger kunstfertigen Rivalen. Folglich ist die erste Konsequenz weiblicher Promiskuität, dass Männchen unter einem stärkeren Druck stehen, sich untereinander in allen Aspekten der Liebe auszustechen.“
Aber auch die weiblichen Tiere besitzen anscheinend genügend abgesichertes Vererbungswissen, indem sie nämlich nur die Männchen mit den besten (gesündesten) Spermien „wählen“. Und das sind immer die Farbenprächtigsten, Lautesten, Stärksten, Schnellsten usw… Dabei geht es stets um ihren Nachwuchs, denn der ist z.B. für den Münchner Biologen Josef Reichholf „die eigentliche ‚Währung der Evolution‘.“ Ihre Anzahl ergibt zusammen mit der Zeit „die Leistung“. Die wilde Natur ist wie der Kapitalismus eine Leistungsgesellschaft. Wenn man dem Verhaltensforscher Konrad Lorenz folgt, dann ist es nicht nur im Nazistaat, sondern auch in der Gänsegesellschaft so, dass das „Ehepaaar“ das höchste Ansehen hat, das die meisten Jungen großzog.
Nehmen wir einen Moment an, dass all diese dummen Projektionen nur allzu wahr sind („Gänse sind schließlich auch nur Menschen,“ wie Konrad Lorenz einmal sagte), dann gilt aber immer noch, was sich die Tiersexforscherin Olivia Judson eingesteht, dass bei all den „Fakten“ etwas Wesentliches fehlt: die Lust! Aber leider „wissen wir so gut wie gar nichts über die Evolution der Lust,“ schreibt sie. Zur Lust gehört zuvörderst eine gewisse Verständigung, jedenfalls in den meisten Fällen. Aber wie soll man das z.B. bei den Elefanten erforschen, die sich über mehrere Kilometer im Infraschallbereich „verständigen“, was jedoch für uns nicht vernehmbar ist. Oder wenn doch – mit Hilfe von Audiotechnik, wie es Professor John Lilly bei den noch viel weiter reichenden Lautäußerungen von Delphinen tat, dann weiß man immer noch nicht, was sie damit sagen wollen. Stattdessen zu erforschen, wie eine Art sich vermehrt, führt jedoch bloß dazu, dass man „unterhalb der Schafarten nur noch die Schafe zählen kann“, wie der Philosoph Michel Foucault einmal meinte, für den die animalische Liebe ein Fest war, das ihn traurig und glücklich zugleich machte.
Um die „animalische Liebe“ studieren zu können, bedarf die „bisherige Nutzphysiologie“ (des Darwinismus) mithin einer „lustbiologischen Ergänzung“; eine solche veröffentlichte der ungarische Psychoanalytiker Sandor Ferenczi. Darin ist von „Brückenbildungen des Küssens, des Umarmens“ und von der „großen Eintrocknungskatastrophe“ als Ur- und Geburtstrauma die Rede. Weswegen für ihn nicht das Meer die Mutter symbolisiert, sondern die Mutter das Meer. Das „Ziel“ (im Feuchten) war einmal die „Verschmelzung“. Bei den Vielzellern, auf dem Trockenen zumal, gibt es nur noch eine „Distanzliebe“ – mit der „Haut als Vermittlerin“ (aus der einst auch die Sinnesorgane hervorgingen): Sie (Wir) kennen keinen „Mischakt“ mehr, sondern bloß einen „Berührungs-Akt“. Ferenczi konnte sich auf das 1000seitige Werk „Liebesleben in der Natur. Entwicklungsgeschichte der Liebe“ stützen. Diesen Biologie-Bestseller veröffentlichte 1898 der „Naturalist“, Gründer des „Friedrichshagener Dichterkreises“ und der Berliner Volksbühne Wilhelm Bölsche. Er begann darin ganz von vorne: „Wir haben keine Ahnung davon, was eine einzellige Amöbe, was eine Bakterie empfinden, wenn sie sich in zwei Stücke teilen. Es ist ihr Liebesakt. Warum soll sie nicht etwas dabei fühlen? Es ist nach allen Analogien selbstverständlich. Zugleich ist es der Urakt aller Liebe. Die Wollust wäre hier bei ihrem Urphänomen.“ Man ahnt das nur, aber wirklich „gewußt wird die Sache ganz sicher innerhalb unserer Leiber.“
Bölsche war anders als Ferenczi ein Propagandist des Darwinismus, die animalische Liebe bestand für ihn in der Verquickung von Lust und Fortpflanzung und damit Arterhaltung. Mindestens bei den Rindern soll das aber ganz anders sein, wie der französische Schriftsteller Mehdi Belhaj Kacem in seiner „Philosophie im Kuhstall“ nahelegt: „Die Brunst ist ein Genuss für das Weibchen, nicht für das Männchen. Das Weibchen scheint ganze Tage lang einen quasi natürlichen Genuss zu empfinden, beim Koitus selbst empfindet es jedoch keine Lust. Umgekehrt zeigt das Männchen in der Brunstzeit kein Begehren wie das Weibchen… Soweit ein guter Kleinbauer wie ich das beobachten konnte.“
.

.
„Alle guten Dinge haben etwas Lässiges und liegen wie Kühe auf der Wiese,“ meinte Friedrich Nietzsche. Der Verhaltensforscher Bert Tolkamp bekam bei seiner Kuhforschung bloß heraus, dass eine Kuh, die schon lange liegt, wahrscheinlich bald wieder aufstehen wird – aber wenn sie erst mal aufgestanden ist, ist es nicht mehr so leicht vorhersagbar, wann sie sich wieder hinlegen wird. „Ich beobachte Kühe seit vielen Jahren“, sagte der Wissenschaftler, „deswegen kann ich mit einiger Kompetenz sagen: Kühe können wirklich langweilig sein.“ Das Verhalten seiner Untersuchungsobjekte sei „äußerst enttäuschend gewesen“. Aber die Kühe können auch anders:
Im Dezember riß sie sich am Irschenberg beim Entladen aus einem Viehtransporter vor der Metzgerei Walch los und entkam. Sie floh ins Wallberg-Setzbergmassiv und überlebte dort bei Minus 15 Grad Celsius, weil sie sich an einer Futterstelle gegen ein Dutzend Berghirsche durchsetzen konnte. Statt sie abzuschießen wurde sie narkotisiert und auf das „Gut Aiderbichl“ gebracht – einen Gnadenhof für vernutzte Wild- und Haustiere bei Salzburg.
Ähnliches geschah im Landkreis Mühldorf, wo eine wegen nachlassender Milchleistung für den Schlachthof bestimmte Kuh flüchtete und sich im bayrischen Wald versteckte. Der Jagd auf sie schlossen sich auch Reporter an, die jedoch eher auf der Seite der Entflohenen waren. Die Kuh wurde von ihnen „Yvonne“ getauft, in der Hoffnung, dass die alte Bauernregel – Tiere mit Namen tötet man nicht! – ihr Überleben sichern würde. Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs hatte man sie zum Abschuss freigegeben. Als sie sich wieder „ihren Artgenossen auf einer Weide anschloss“ konnte sie dort eingefangen werden, worauf einige Tierschützer sie freikauften und auf das „Gut Aiderbichl“ brachten. Der Spiegel berichtete, dass Yvonne dort „nun mit ihrem Sohn Friesi, ihrer Schwester Waltraut und dem Kälbchen Waldi zusammen lebt.“
Auf dem „Gut Aiderbichl“ brachte man auch eine junge „Mutterkuh“ aus Greifenstein unter: Sie war von einer Weide ausgebrochen und hatte eine Spaziergängerin angegriffen und dabei tödlich verletzt. Danach war sie mit ihrem Kalb in einen Wald geflüchtet. Nachdem man die beiden eingefangen hatte, kamen sie ebenfalls in das Tierasyl. Ihre Besitzerin mußte sich wegen „fahrlässiger Tötung“ vor Gericht verantworten. „Jährlich werden mehr Menschen von Kühen als von Haien getötet,“ titelte eine Zeitung. Der Kuh aus Greifenstein wurde ihr „Mutterinstinkt“ zugute gehalten, der ihr den Angriff zum Schutze ihr Kalbes gebot. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe Regionalkrimis, die im Milchbauernmilieu spielen, einer der Autoren, Thomas Morgenstern, ist sogar Milchbauer – und der Ermittler seiner fiktiven Verbrechen im Kehdinger Land ein gemütlicher Milchkontrolleur.
Die taz sprach vor einiger Zeit von einem „kurzen Sommer der Anarchokühe“. Am Mittelrhein legten fünf entlaufene Kühe den Zugverkehr lahm. In Kleinmürbisch wurde ein 75-jähriger Landwirt von einer seiner Kühe mehrmals gestoßen und dabei schwer verletzt. Im Salzburger Flachgau biß eine Kuh einer Bäuerin eine Fingerkuppe ab und verschluckte sie. In Südtirol wurde eine Frau von einem Stier angefallen. Die Altbäuerin erlag kurz darauf ihren Verletzungen. Wenig später wurde eine 27-Jährige Frau unterhalb der Alm Sattlerhütte von einer Kuh angegriffen und erlitt dabei ebenfalls erhebliche Verletzungen. In Bad Wurzbach brachte ein Bauer seine bisher im Stall gehaltenen Kühe erstmalig auf die Weide. „Von dort liefen mehrere zum Hof und randalierten“, wie der nordbayrische Kurier berichtete: „Sechs Kühe liefen auf die Tenne des Wirtschaftsgebäudes, eine rannte zum Heulager und stürzte ein Stockwerk tiefer. Drei Kühe durchbrachen eine Tür von der Tenne zum alten Wohnhaus. Dort hielt das Gebälk im Treppenhaus dem Gewicht nicht stand, so dass die Kühe zwei Etagen tief ins Erdgeschoss stürzten. Ein Tier durchbrach gar eine alte Holzdecke und fiel in den ehemaligen Schweinestall. Zwei Kühe wurden verletzt. Das alte Wohnhaus wurde erheblich beschädigt.“
In einer Polizeimeldung aus Jockrim heißt es: „Die Kühe einer Herde in Rheinland-Pfalz haben in der Nacht zum Mittwoch laut rumgetobt und damit Verwirrung unter Menschen gestiftet. Beunruhigte Ohrenzeugen riefen die Polizei wegen starken Lärms. Die Beamten trafen vor Ort auf 20 ausgelassen muhende Kühe. Die Polizisten ermittelten ihre Besitzerin. Diese erklärte, bei der Umsiedlung auf eine neue Weide seien die Jungtiere zunächst von den alten Tieren getrennt worden. Das anschließende Wiedersehen feierten die Rinder laut Polizei bis tief in die Nacht.“
Noch vor Beendigung der Weidesaison resümierte der „Spiegel“: „Vermehrte Kuhangriffe sorgen für Schlagzeilen“. Das „Neue Deutschland“ schrieb: „In jüngster Zeit machten Rinderattacken auf Menschen Schlagzeilen,“ was sich die Zeitung mit dem zunehmenden „Stress des Rindviehs“ erklärte. Aber dann erschoß in München umgekehrt ein Polizistentrupp eine „wild gewordene Kuh“, die sich auf dem Schlachthof losgerissen und eine Joggergruppe auf dem Bavariaring über den Haufen gerannt hatte. Die Beamte hatten das Tier zuerst mit ihren Pistolen bewegungsunfähig geschossen – und anschließend mit zwei Gewehrschüssen erlegt. Der Spiegel sprach von einem „Kugelhagel“, in dem die „Amok-Kuh“ (n24) starb. Schon am nächsten Tag wurden am Tatort Blumen hinterlegt, sowie Grablichter in Milchflaschen angezündet und mit einem Zettel „an das Kuh-Drama erinnert,“ wie die Süddeutsche Zeitung berichtete. „’Sie wollte leben und floh vor dem Schlachthof,’“ stand auf dem Zettel.
Noch weiter ging die Tierrechtsorganisation „Animal Peace“, als sie auf ihrer Internetseite „viva-vegan.info“ frohlockte: „Ein dreijähriger Bulle hat nahe Köln seinen Sklavenhalter angegriffen und tödlich verletzt. Der 61-jährige Landwirt wollte eine Schiebetür im Stall reparieren. Als am Abend der Sohn den Stall betrat, um die Kühe zu melken, entdeckte er die Leiche seines Vaters. Wir verneigen uns vor dem Held der Freiheit. Mögen ihm viele weitere Rinder in den Aufstand der Geknechteten folgen.“ Es folgten erst einmal heftige Kritik von allen Seiten und sogar eine Strafanzeige, so dass die radikalen Veganer sich gezwungen sahen, ihre Äußerung zu verteidigen: „Wir haben mit keinem einzigen Wort den getöteten Bauern verhöhnt.“ Man habe sich nur über den „Aufstand eines Geknechteten“ gefreut. „Es ist eine politische und keine persönliche Botschaft.“ Rinder seien Subjekte, „die fühlen und denken können und mit diesen Gefühlen und Gedanken ein freies und unversehrtes Leben führen wollen. Wie wir.“ Die Vegetarier/Veganer sind nicht nur gegen die Bio-Bauern, weil auch sie ihre Tiere töten, neuerdings bemühen sie sich auch um den Nachweis, dass Milch nicht gut für uns ist, sie ist für das Kalb da. Zudem sei auch die Milch „Produkt eines Gewaltverhältnisses“.
.

.
Das Verständnis für das „Nein!“ von Tieren wächst – in welcher Form auch immer sie es äußern. In vielen asiatischen Despotien fällt es noch heute den Menschen selbst im Alltag schwer, „Nein!“ zu sagen. In Indonesien zum Beispiel gibt es sieben Worte für „Ja!“, von denen zwei auch ein Nein bedeuten können. Wenn mein vietnamesischer Bekannter etwas im Gespräch verneinte, nickte er und sagte: „same same but different“.
Muss man sich das „Nein!“ nun aber (mühsam) erwerben oder wird man damit schon geboren? Solche Fragen stellen sich Lebenswissenschaftler. Im Jahr 2007 starb Alex, die Intelligenzbestie unter den Papageien. Er hatte in seinen 31 Jahren bei seiner Besitzerin, der Psychologiedozentin Irene Pepperberg, die ihm unentwegt Worte und Zahlen beibrachte, gelernt, auf verschiedene Weise „Nein!“ zu sagen. In Pepperbergs Buch „Alex und ich“, das sie ein Jahr nach seinem Tod veröffentlichte, heißt es: „Während unserer Arbeit lernte Alex, Nein zu sagen. Und Nein hieß dann auch Nein.“
Bis es so weit war, hatte er es erst einmal auf die unter afrikanischen Papageien übliche Weise zu „sagen“ versucht: laut kreischen, beißen oder, „wenn er keine Lust mehr hatte, auf die Fragen eines Trainers zu antworten, die betreffende Person ignorieren“, ihr den Rücken zukehren, sich ausgiebig putzen …
Meist kam er damit durch, seine „Trainer“ verstanden ihn: „Subtil war unser Alex nicht gerade“, meint Irene Pepperberg. Aber dann reichte ihm diese „Sprache“ nicht mehr im Umgang mit seinen Betreuern. Diese sagten häufig „Nein [bzw. No], wenn er etwas falsch identifizierte oder etwas anstellte.“ Irgendwann bemerkten sie, „dass Alex in Situationen, in denen ein ,No‘ angemessen gewesen wäre, ein Laut wie ,Nuu‘ hervorbrachte“. Irene Pepperberg, sagte daraufhin zu ihm: „Gut, dann können wir dir auch gleich beibringen, das richtig schön zu sagen.“ Schon bald verwendete Alex „diese Bezeichnung, um uns zu signalisieren: ,Nein, das mag ich nicht!‘“
In einem Dialog mit seiner Sprachtrainerin Kandia Morton hörte sich das folgendermaßen an: „K: Alex, was ist das? [ein quadratisches Holzstück hochhaltend] – A: Nein! – K: Ja. Was ist das? – A: Vier Ecken Holz [undeutlich, aber richtig] – K: Vier. Sag es schöner! – A: Nein! – K: Ja! – A: Drei … Papier [völlig falsch] – K: Alex. Vier, sag vier. – A: Nein. – K: Komm schon. – A: Nein.“
Laut Irene Pepperberg genoss Alex seine wachsende Publicity immer mehr: Kameras, Mikrofone, staunendes Personal, freudige Trainer und Fans: „Er stand nun mal gerne im Mittelpunkt. Dann trat ein gewisses Glitzern in seine Augen, er plusterte sich auf – im übertragenen Sinne – und nahm die Pose des Stars an.“
Irgendwann war er jedoch das ewige Sprachtraining und auch die wachsende Aufmerksamkeit leid: „In puncto Verweigerung wurde er umso kreativer, je älter er wurde“, schreibt die Autorin, dann freute sie sich aber doch: „Alex versteht die Bedeutung des Begriffs ,Nein‘.“ Sie folgerte daraus sofort positiv – ganz im Sinne ihrer Projektbeschreibung: „Sein Ausdruck eines negativen Konzepts war durchaus schon als fortgeschrittenes Stadium sprachlicher Entwicklung zu betrachten.“
Ein Einbruch bei der Entwicklung des menschlichen Sprach- und Denk-Vermögens ihres Papageis kam, als Irene Pepperberg mit Alex noch am MIT arbeitete, das wegen seiner Pionierrolle bei der Algorithmisierung unserer Lebenswelt im Geld nur so schwamm, aber nach dem Platzen der „Dotcom-Blase“ war damit erst einmal Schluss. Die Universität sagte Nein. „Nun hatte ich weder einen Job noch einen Ort, an dem ich meine Arbeit mit Alex und seinen Freunden fortführen konnte.“ Aber irgendwie ging es dann doch weiter – an einer anderen Universität, bis Alex im Herbst 2007 endgültig Nein sagte und starb. Seine Besitzerin brach darüber fast zusammen.
.

.
Die englische Musikerin und Hobbyornithologin Clare Kipps veröffentlichte 1953 ein Buch über die Aufzucht eines Sperlings, der dann – auf sie „geprägt“ – zwölf Jahre bei ihr lebte. Die Autorin, die allein in London lebte, entwickelte währenddessen ein besonderes Verhältnis zu „Clarence“ – ihrem Spatz, der in den Kriegsjahren, da Clare Kipps im Luftschutz eingesetzt war, in ganz England berühmt wurde, weil er die im Luftschutzbunker sich Versammelnden unterhielt, so dass sie vorübergehend ihrer Sorgen und Ängste vergaßen. Es gibt einen eigenen Wikipedia-Eintrag über „Clarence“:
„Neben einigen anderen Tricks war die Luftschutzkellernummer sehr beliebt: Clarence rannte auf den Ruf „Fliegeralarm!“ hin in einen Bunker, den Mrs. Kipps mit ihren Händen bildete, und verharrte dort reglos, bis man „Entwarnung!“ rief. Noch beliebter waren indes seine Hitlerreden: Der Spatz stellte sich auf eine Konservendose, hob den rechten, durch ein Jugendunglück leicht lädierten Flügel zum Hitlergruß und begann zunächst leise zu tschilpen. Er steigerte dann seine Lautstärke und Furiosität bis zu einem heftigen Gezeter, verlor dann scheinbar den Halt, ließ sich von der Dose fallen und mimte eine Ohnmacht. Clarence wurde zu einer Symbolfigur der von Hitlers Luftangriffen geplagten Londoner und ihres Durchhaltewillens. Er wurde in Presseberichten gefeiert, und sein Bild zierte Postkarten, die zu Gunsten des Britischen Rotes Kreuzes verkauft wurden.“
In ihrem Buch über „Clarence“ schreibt sie: „Wenn er es satt hatte, das Publikum im Luftschutzbunker mit Tricks zu unterhalten], „nahm er eine Patiencekarte in den Schnabel und dreht sie darin zehn- oder zwölfmal herum. Das war glaube ich sein Lieblingstrick, denn er hatte ihn selbst erfunden und vergnügte sich noch jahrelang damit…“
„Leider begann er im Frühjahr 1941 des Lebens in der Öffentlichkeit mit all seinem Glanze überdrüssig zu werden…“
„…Er nahm mir ansonsten nie etwas übel und betrachtete mich von klein auf als seine Erretterin aus jeder Schwierigkeit und Klemme.“
Clarence schlief im Bett der Autorin, an ihren Hals geschmiegt. Einmal wollte eine Freundin von Clare Kipps im Bett übernachten: „Er lief das Kissen auf und ab, schalt und drohte und griff schließlich meine Freundin so wütend an, dass sie als Eindringling gezwungen war, aufzustehen…“
Außerdem war Clarence „sehr heftig dagegen, daß ich in einem neuen Kleid erschien, und selbst ein neuer Hut oder neue Handschuhe riefen scharfen Protest bei ihm hervor.“
In der Amphibien- und Reptilien-Zeitschrift „Rana“ (17/2016) wurde von einem Augenzeugen das Verhalten eines ungewöhnlich mutigen Grasfrosches im Kreis Nordfriesland geschildert: Er greift Vögel, Rötelmäuse und Menschen an, indem er sich aufrichtet, sie lange fixiert und dann mit „schnappendem Maul“ auf sie zuhüpft. Mit diesem artuntypischen Artverhalten kommt er überraschenderweise durch.
.

.
Bei meinem Freund Bruno, der in Norddeutschland lebt, erwarb ich erste Imkerkenntnisse. Er besaß sechs Bienenvölker, deren Kästen hinter seinem Haus an einem riesigen Rapsfeld standen. Ein mit ihm befreundeter Imker stellte dann noch zehn weitere Bienenkästen daneben auf. Bald wurden alle Bienen dort aggressiv, jeden Tag mehr. Man mußte einen immer größeren Abstand zu ihren Stöclen halten. Die beiden Imker waren ratlos, bis der Bauer kam, dem das Feld gehörte: Er gestand ihnen, dass er, eigentlich aus Versehen, eine Hybridsorte Raps ausgesät hatte, die keinen Nektar bildet. Bei zigmillionen Rapsblüten gleich neben ihren Stöcken, die sie allesamt täuschten, waren die Bienen irgendwann aggressiv geworden.
Ähnliches erfuhr ich später in Island, als ich einen kundigen Bauern fragte, „Gibt es auch Bienen hier?“ – nachdem ich in Rejkjavik nur Hummeln auf den Blütenpflanzen gesehen hatte: „Die Bienenexperimente auf Island begannen in den Dreißigerjahren, als man einige Völker aus Norwegen importierte. Sie produzierten zwar Honig, überlebten aber den langen und harten isländischen Winter nicht. Anfang der Fünfzigerjahre versuchte es eine Australierin in Reykjavik noch einmal – wieder mit norwegischen Bienen. Diesmal waren es ihre Nachbarn, die sie zwangen, die Bienen zu töten. Seit 1975 bis heute wird immer wieder versucht, aus Norwegen importierte Völker auf Island heimisch werden zu lassen, wobei man auch mit verschiedenen Standorten experimentiert, aber die meisten Völker überleben den Winter noch immer nicht und sie werden auf Island sehr aggressiv. Wahrscheinlich, weil sie wütend sind, dass man sie an einen Ort verschleppt hat, wo sie als Volk keine Überlebenschance haben.“
In Südamerika sind einmal – quasi aus Versehen – „Killerbienen“ entstanden. So nennt man eine Kreuzung aus italienischen Bienen mit afrikanischen, die auch als „afrikanisierte Honigbienen“ bezeichnet werden. Sie liefern hohe Erträge, sind aber gefährlich, weil sie schnell aggressiv werden und mit vielen zugleich angreifen. In Brasilien entkamen den Bienenforschern 23 Schwärme dieser afrikanisierten Honigbienen, die sich danach über den Kontinent verbreiteten. Nachdem ihre Stiche einige Menschen getötet hatten, wurden sie in den USA „Killerbienen“ genannt und Hollywood drehte mehrere Horrorfilme über sie.
.
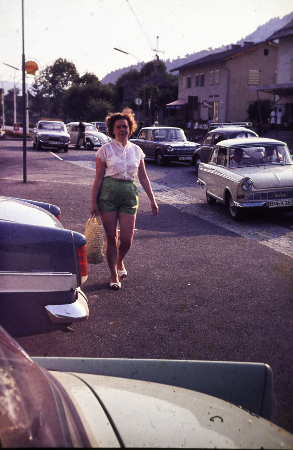
.
Über den Widerstand von Katzen erfährt man viel auf den Katzenforen im Internet, im Falle diese neben ihrer Besitzerin plötzlich auch noch mit einem Mann zusammenleben sollen. Wenn ich das richtig übersehe, dann sind ihre Protestformen in der Mehrzahl erfolgreich.
Eine Teilnehmerin schrieb: „Wenn ich daran denke, wie viele Jahre ich mit einem ausgemachten Volldeppen zusammen war, den mein Kater Sky von Anfang an nicht mochte.“
Eine andere Frau meinte: „Mein damaliger ‚Traummann‘, mit dem ich über 5 Jahre eine Wochenendbeziehung geführt hatte, entpuppte sich nach dem Zusammenziehen als „Alptraummann“. Er kam mit den Katzen absolut nicht klar. Sie durften weder ins Schlafzimmer, noch auf die ‚gute‘ Couch (die übrigens 15 Jahre alt war.) Ausserdem stank ihm das Katzenfutter und am Ende hat er von mir verlangt: entweder ich oder die Katzen. Die Katzen haben natürlich gemerkt, dass er sie nicht leiden konnte und haben protestgepinkelt und die Tapeten und Teppiche zerstört, was sie vorher noch NIE gemacht hatten…Ich hab dann meine Katzen geschnappt und bin ausgezogen. In meiner neuen Wohnung – ohne diesen Mann – waren dann die Katzen wieder ganz die alten und sichtlich glücklicher.“
Eine dritte Frau schrieb: „Ich hab damals meinen Traumtypen in den Wind geschossen, als ich gemerkt habe, dass ALLE unglücklich waren. Ich – weil ich es ihm nicht recht machen konnte und meine Katzen immer unglücklicher gesehen habe. Er – weil er es mit den Katzen nicht konnte. Und meine Katzen – weil sie gemerkt haben, dass sie bei ihm nicht willkommen waren. Natürlich durfte ich mir danach noch wochenlang anhören, dass ich meine Katzen mehr lieben würde als ihn. Aber für mich war es einfach die richtige Entscheidung und nie und nimmer hätte ich meine Katzen ins Tierheim geben können, wie er es am Ende von mir verlangte.“
Die Schriftstellerin Doris Lessing veröffentlichte mehrere Bücher über ihre Katzen. In einem heißt es: „Jeder aufmerksame, sorgsame Katzenbesitzer weiß mehr über Katzen als die Leute, die sie beruflich studieren. Ernsthafte Informationen über das Verhalten von Katzen und anderen Tieren findet man oft in Zeitschriften, die ‚Geliebte Katze‘ oder ‚Katze und Du“ heißen, und kein Wissenschaftler würde im Traum daran denken, sie zu lesen.“ Sie lesen wahrscheinlich auch nicht die Einträge von zumeist Frau in den diversen Katzenforen des Internets.
Die männlichen Wissenschaftler geben aber immerhin zu, dass Katzen schwierig sind: „Was die Forschung an der Katze problematisch macht, ist gleichzeitig das, was viele so an ihr lieben: die Eigensinnigkeit“, meint der Verhaltensforscher und Katzenexperte Dennis Turner vom Schweizer Institut für angewandte Ethologie und Tierpsychologie. Eigensinn ist eigentlich nur ein anderes Wort für Widerständigkeit.
Am Rande sei auch noch erwähnt, dass in der Inszenierung von Elfriede Jelineks neuem Theaterstück „Wut“ eine dhihadistische Selbstmordkatze auftritt.
„Die Erfolgskarriere der Katze ist im Vergleich zum Hund etwas höchst Erstaunliches“, betont Turner. Hunde sind soziale Rudeltiere – ihr natürliches Verhalten übertragen sie einfach auf uns Menschen. Die Vorfahren der Hauskatze waren dagegen einzelgängerische Eigenbrötler. Mit ihrer enormen Anpassungsfähigkeit haben sie ihr Sozialverhalten an uns Menschen angepasst – „eine faszinierende Fähigkeit, die sich weiter zu erforschen lohnt.“ Die Wissenschaft gibt also nicht auf. Auf Youtube gibt es einen Sampler mit widerständigen Katzen, mit denen ihre Besitzer an der Leine draußen spazieren gehen wollten, aber sie warfen sich einfach auf die Erde und ließen sich nicht aus dem Haus ziehen, womit sie sich schließlich durchsetzen konnten. Mit den Millionen Katzen-Clips im Internet ließe sich nebenbeibemerkt eine prima Katzenforschung betreiben
An der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle im österreichischen Grünau blicken die Katzenforscher gezielt auf die Persönlichkeit des Katzenhalters und das daraus resultierende Verhalten der Katze: „Je emotional instabiler der Mensch, desto mehr beansprucht er die Katze als Unterstützer“, berichtete der Forschungsleiter Kurt Kotrschal. Diese Abhängigkeit weiß die Katze raffiniert für sich zu nutzen: „Die Katzen labiler Menschen waren bei den Untersuchungen die wählerischsten, was das Futter angeht.“ Durch theatralisches Verhalten und jammervolles Miauen versuchen sie ihre Bezugsperson dazu zu bewegen, ihnen etwas Besseres zu geben. „Katzen machen soziale Spielchen, um den Menschen zu kontrollieren, damit er ihnen quasi gehorcht“.
Viele Katzenbesitzer können kuriose Geschichte erzählen, die zeigen, wieviel Verstand in diesen Tieren steckt. Sie machen sich nicht nur ihren Menschen durch gezieltes Manipulationsverhalten gefügig, sie begreifen viele Zusammenhänge in ihrer Umwelt und können ihre Erfahrungen gezielt für ihre Zwecke nutzen.
Ähnliches gilt auch für Hunde: Der US-Psychologe Kenneth Shapiro erwarb in einem Tierheim einen herrenlosen Mischlingswelpen, den er Sabaka nannte. Dieser Rüde schaffte es z.B., mit seiner „offensichtlichen Überzeugung“, dass Shapiro „ihn ausführen werde“, dass genau „diese Absicht“ bei dem Autor „ausgelöst“ wurde.
Der Zürcher Zoodirektor Heini Hediger kam bereits 1954 zu der Überzeugung: „Bei Säugetieren besteht eine weitverbreitete und überraschend hoch entwickelte Fähigkeit, menschliche Ausdrucksweisen ganz allgemein aufs feinste zu interpretieren. Das Tier, und besonders vielleicht das Haustier, ist oft der bessere Beobachter und der präzisere Ausdrucksinterpret als der Mensch.“
.

.
In einem Waldstück nahe Saarbrücken lebt ein „aggressives Eichhörnchen“, das ahnungslose Spaziergänger anfällt und sie kratzt und beißt, berichtet dpa. In Ungarn bissen im Mai zwei Esel einen Mann tot: „Die Tiere rissen einen 65-jährigen Rentner von seinem Motorrad und griffen den am Boden Liegenden an, bis er kein Lebenszeichen mehr von sich gab,“ meldete die ungarischen Nachrichtenagentur. Ende Oktober attackierte ein „wildgewordener Marder“ eine 62 Jahre alte Frau, als diese gerade aus einem Bekleidungsgeschäft im pfälzischen Maikammer trat. Ein 63jähriger Passant konnte das Tier laut dpa in die Flucht schlagen. Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt griff ein Rothirsch eine Spaziergängerin an indem er sie mit seinem Geweih in einen Zaun drückte. Und im thüringischen Oettersdorf krallte sich ein Bussard so fest in den Arm eines 59jährigen, dass die Feuerwehr den Greifvogel von ihm lösen mußte. Im US-Staat Oregon wurde nach Angaben der Behörden ein Farmer von seinen Schweinen getötet und aufgefressen.
Von Raubtieren bis hin zu Stadthunden, vor allem, wenn sie verwildert sind, weiß man um ihre Gefährlichkeit. Trotzdem passieren bisweilen ähnliche „Unfälle: „Tiger tötete Tierpfleger im Zoo Münster“ titelte vor einigen Wochen die Bild-Zeitung: „Der Pfleger hatte vergessen, die Käfigluke zum Außengehege zu schließen, woraufhin die Raubkatze ihn von hinten ansprang.“ Am selben Tage titelte die BZ: „Meine Katze hat mich in die Klinik gebissen“: Die Frau hatte „ihre Katze ‚Habibi‘ (10) im Nacken gepackt. Das Tier rastete aus und biss mit ihren scharfen Zähnen wild um sich“. In Bukarest fiel jüngst ein Rudel herrenloser Hunde ein Kleinkind an und tötete es. Die Stadtverwaltung erwog daraufhin, alle 30.000 herrenlosen Hunde umzubringen. In Berlin kam es deswegen zu einer Protestdemonstration von Tierschützern vor der rumänischen Botschaft, während gleichzeitig in Bukarest hunderte auf die Straße gingen, um das Töten „ihrer“ Hunde zu fordern. Angeblich begann die Geschichte mit einem französischen Zeitungsbericht, in dem den verwilderten Hunden von Bukarest vorgeworfen wurde, dass sie leichtsinnigerweise „die Sicherheit von Ausländern gefährden“ würden.
Auch mit den großen Pflanzenfressern ist nicht immer zu spaßen: Auf jeden im Zoo gehaltenen Elefantenbullen kommt ein toter Elefantenpfleger. Noch mehr Pfleger werden irgendwann von Elefantenkühen angegriffen. Kürzlich wurde eine Spaziergängerin in Hessen sogar von einer Milchkuh verfolgt und getötet. Sie, „Verona (8)“, hatte gerade gekalbt, weswegen man ihr quasi mildernde Umstände zubilligte. Sie kam in ein Tier-Altersheim – und wurde nicht getötet, wie man es meist klammheimlich mit Elefanten macht, die einen Pfleger angegriffen haben. Berühmt wurde die Exekution des New Yorker Elefanten „Topsy“, der drei Männer zerquetschte und dafür von Thomas Alva Edison öffentlich mit Strom hingerichtet wurde. Aus den Aufnahmen der „Electrocution“ machte Edison seinen ersten Werbefilm für Elektrizität.
Anders nun bei einem „Killerwal“, der jüngst während einer „SeaWorld-Show“ in Florida seine Trainerin ertränkte, er wurde anschließend im Meer frei gelassen. Hier nahm man zu seinen Gunsten Unwissenheit an: Er dachte vielleicht, dass die Trainerin genauso lange die Luft unter Wasser anhalten könnte wie er.
Auch den Krähen gesteht man „Fehler“ bzw. „Überreaktionen“ zu – wenn sie z.B. während der ersten Flugversuche ihrer Jungen besonders nervös sind und sich auf Radfahrer und Hunde stürzen. Ebenso den Schwänen und Gänsen, wenn sie in Verteidigung ihrer Brut plötzlich aggressiv auf Menschen reagieren. Rechte und Darwinisten vermögen sie sogar ob dieser ihrer mutigen „Instinktfestigkeit“ zu loben.
Auch als unlängst ein 71jähriger Jäger bei Potsdam von einem Wildschwein angegriffen und getötet wurde, hatte man durchaus Verständnis für diese Tat, da der Jäger zuvor auf den Keiler geschossen und ihn schwer verwundet hatte. Überhaupt werden solche Jagd- und Safari-„Unfälle“ gern mit einer Art von „Geschieht ihnen recht!“-Haltung quittiert. Und wenn Verhaltensforscher im Feld von einem der Tiere, die sie beobachten, angegriffen werden, bedauert man sie höchstens. Zu makabrer Berühmtheit gelangte in diesem Zusammenhang der von einem Grizzlybär in Alaska getötete Tierschützer Timothy Treadwell, dessen Kamera die Tat aufnahm, und woraus der Filmemacher Werner Herzog dann einen „kritischen Dokumentarfilm“ machte – mit dem Titel: „Grizzly Man“.
Eher Mitgefühl mit den Wildtieren hat man mit solchen, die in Gefangenschaft wenig „artgerecht“ permanent unterfordert werden und dementsprechend frustriert sind, wie z.B. Schimpansen. Berühmt wurde „Petermann“. Er kam 1949 als junger Schimpanse in den Kölner Zoo, wo er bald so beliebt wurde, dass er ständig bei öffentlichen Veranstaltungen – Modeschauen, Prominentenpartys, Karnevalssitzungen etc. – auftrat. Als er alt und mißmutig, sogar gefährlich wurde, vergaß man ihn einfach und er dämmerte fortan in einem Zookäfig vor sich hin – 25 Jahre lang. Bis er 1985 zusammen mit einer jungen Schimpansin namens Susi ausbrach, den Zoodirektor angriff, ihn schwer verletzte und dann auf ein Hausdach flüchtete, wo er aufrecht stehend und angeblich mit erhobener Faust zusammen mit Susi von Polizisten erschossen wurde. Seitdem ist er ein imaginärer Führer der Kölner Anarchisten, die „Petermann geh du voran!“ auf ihren Demonstrationen rufen. Als dem Berliner Zoodirektor vor einiger Zeit ein Finger von einem Schimpansen namens „Pedro“ abgebissen wurde, erinnerte die Presse noch einmal hämisch an Petermann. Es gibt daneben auch mehrere Primatenforscherinnen, u. a. Angelique Todd und Sue Savage- Rumbaugh, denen gefangen gehaltene Schimpansen einen Finger abbissen und in Hoppegarten einen Schimpansentrainer, dem schon zwei Finger abgebissen wurden.
Anders liegt der Fall, wenn sich eine ganze – für gewöhnlich scheu und versteckt lebende – Art plötzlich erhebt: wie z.B. die Welse, die seit zwei Jahren in mehreren europäischen Gewässern Badende beißen und kleine Hunde in die Tiefe zerren – „Killerwelse“ nennt die Presse sie. In Weissrussland hat der Präsident den Biber zum Nationaltier erklärt, und prompt sprang dort ein Biber einen Angler an, der ihn photographieren wollte und tötete ihn laut dpa mit einem Biss in die Oberschenkelschlagader.
Noch rätselhafter sind mehrere auf „youtube“ dokumentierte Fälle von kleinen „Kampfhamstern“, die sich mutig auf Menschen stürzen. Dort findet man auch Angriffe von Schwalben, Rebhühnern, Ziegen, Schafen, Kängurus und Kraken dokumentiert. Alles an sich harmlose Tierarten, die bisher höchstens von uns gejagt – und gegessen wurden. Am beeindruckensten ist ein Clip, auf dem ein Pony einen Mann fast totschlägt und -beißt: „Horse Attacks Guy in Retaliation“ heißt das TV-Video von diesem Widerstands- bzw. Verzweiflungsakt eines an sich friedlichen Pflanzenfressers. Das kleine Pferd wurde in Bombay von einem Mob durch die Straßen gejagt und dabei von einem Mann schwer mißhandelt. In seiner Not stürzte es sich auf ihn und ließ nicht mehr von ihm ab.
Aber nicht nur die bedrängte Tierwelt fängt hier und da, noch unorganisiert, an, sich zu wehren, auch die Tierschützer werden immer rabiater. In der Schweiz, in Italien, aber auch in Deutschland häufen sich ihre Angriffe auf Tierhalter, die ihre Schutzbefohlenen quälen. Inzwischen gelten die Tierschützer in den USA schon als „die größte Terrorgefahr: US-Wissenschaftler verweisen etwa darauf, dass von 26 Anschlägen, die zwischen dem 11. September 2001 und Ende 2005 in den USA ausgeführt wurden, nur ein einziger einen islamistischen Hintergrund hatte. Fast der gesamte Rest ging auf das Konto militanter Tierschützer,“ heißt es in der Berliner Zeitung.
Auf seinem zweiten Hundekongreß, der Ende Oktober in der Kreuzberger „Denkerei“ der Lüneburger Universität stattfand, ging der Tierfreund und Kunsttheoretiker Bazon Brock schon so weit, die Tiere als „historisches Subjekt“ zu begreifen: Seit dem Christentum gehe es um „eine Revolution des Niederen. Wenn der Künstler Kippenberger einen Frosch ans Kreuz nagelt, dann stimmt das.“ Brocks Einschätzung trifft sich mit der des Wissenschaftssoziologen Bruno Latour, der in einer Rede an der Münchner Universität meinte: Irgendwann werde man es „genauso seltsam finden, dass die Tiere und Pflanzen kein Stimmrecht haben – wie nach der Französischen Revolution, dass bis dahin die Menschenrechte nicht auch für Frauen und Schwarze galten.“
.

Hier sollte noch ein längerer Beitrag über die „Karteikartenkultur der Freiredner“ folgen, aber außer dieser Überschrift fiel mir nichts dazu ein, deswegen habe ich erst einmal Abstand von dem Vorhaben genommen.



