Weil die Autos eine ausrollende „Erscheinung“ sind, auch in ihrer elektrisierten und elektronisierten Form, fahren vielleicht bald nur noch SUV-Köppe herum. Nach dem Unattraktiv-Werden der Uniformen geriet auch das „Auto und Frau“-Motiv außer Konjunktur.
.

Ironischerweise wird die Urlaubsreise nicht mehr mit dem Auto oder dem Zug, sondern mit dem Billigflieger absolviert, und ist damit keine Reise, sondern nur noch ein Zielerreichen.
.
Details
„Gott steckt im Detail,“ behauptete Aby Warburg, ähnlich auch Spinoza, für den Gott in jeder (holländischen) Tomate steckte. Die autistische Nutztierexpertin Temple Grandin versucht in ihren Büchern zu beweisen, dass Autisten und Tiere ähnlich denken, nämlich in Bildern, die sie wie Videos abspielen können, zur Erinnerung, wobei sie das Außen in Details wahrnehmen, während wir – Normalos – zur abstrakten Wahrnehmung gedrängt wurden. Vielleicht gehört auch Greta Temple in diesen Reigen autistischer Feministinnen
„Sich ein Bild von jemanden machen heißt eine lebendige Beziehung zerstören,“ meinte der Semiologe Roland Barthes. Ich nehme an, nachdem er unter Einfluß von LSD seiner „lebendigen Beziehung“ ins Gesicht geblickt hatte, woraufhin das (schöne) Bild von seinem Gegenüber einem hässlichen, aber lebendigeren und gar nicht unangenehmen wich. Ein „wahres Gesicht“ quasi. Mykologen der John-Hopkins-Universität, die mit „Magic Mushrooms“ (psilozybinhaltigen Pilzen) experimentieren, sprechen von einer „Offenheit“, die sie bewirken.
Autisten fangen laut Temple Grandin beim Betrachten eines Baumes bei den Blättern an, dann den Zweigen, den Ästen, ein Vogel, wieder Blätter – und diese ganzen Bilder setzen sie dann zu einem Baum zusammen. Wir verfahren normalerweise umgekehrt. Erst ist da der Baum, der unsere Aufmerksamkeit erregt, und dann schauen wir vielleicht genauer hin.
Beim Betrachten eines Sonnenuntergangs im Gebirge, sagte Temple Grandin zu dem sie begleitenden Neurologen Oliver Sacks, sie verstehe zwar, dass er den Ausblick „schön“ fände, aber sie könne das nicht empfinden. Sacks berichtete darüber in seinem Buch „Eine Anthropologin auf dem Mars“, als solche hatte sich Temple Grandin bezeichnet. In ihrem Buch „Ich sehe die Welt wie ein frohes Tier“ schreibt die amerikanische Nutztierexpertin, „normale Menschen zeichnen keinen Hund, sie zeichnen das Konzept eines Hundes. Autisten zeichnen den Hund.“
Das ist eigentlich eine in ihrem Sinne unstatthafte Verallgemeinerung; sie leidet unter dem Asperger-Syndrom, die nur eine „Variante“ des Autismus darstellt, sie leidet aber gar nicht, im Gegenteil, gerade ihre Unnormalität ermöglichte ihr, die Perspektive von Rindern und Schweinen z.B. einzunehmen. Berühmt wurde sie mit einer Neukonstruktion des Tötungsablaufs in den Schlachthöfen der USA und Kanadas. Auch auf den großen Farmen führte sie eine Reihe von Verbesserungen ein – im Hinblick auf eine „respektvolle Behandlung“ des Schlachtviehs. U.a. evaluierte sie im Auftrag von McDonald‘s 50 Zulieferer-Farmen.
Der berühmte russische Tierdresseur Wladimir Durow kam ihrer Tierwahrnehmung vielleicht nahe, er hat sie nur anders genutzt. Durow besaß einen eigenen Zirkus in Moskau, der heute noch existiert. Neben einigen bis dahin als nichtdressierbar geltenden Tieren – wie Igel und Dachsen – arbeitete er immer wieder mit Hunden – zuvor herrenlos gewesenen. Bei Durows Dressur von Pikki, einem Foxterrier, war der Neurologe Wladimir Bechterew anwesend; er ging davon aus, dass der Hund auf die „mentalen Befehle seines Trainers reagiert“. Durow hatte ihm zuvor seine „Methode“ erklärt: sie bestehe darin, „die Aufgabe, die der Hund ausführen solle, zu visualisieren – also zum Beispiel ein Buch von einem Tisch zu holen und dann den Kopf des Hundes zwischen seinen Händen zu halten und ihm in die Augen zu sehen. ‚Ich präge in sein Gehirn ein, was ich mir zuvor in mein eigenes eingeprägt habe. Ich stelle ihm mental den Teil des Fußbodens vor, der zum Tisch führt, dann die Beine des Tisches, dann das Tischtuch und schließlich das Buch. Dann gebe ich ihm den Befehl oder vielmehr den mentalen Anstoß: Geh! Er reißt sich wie ein Automat los, nähert sich dem Tisch und packt das Buch mit den Zähnen. Damit ist die Aufgabe ausgeführt.‘“ Bechterew merkte dazu an – in der „Zeitschrift für Psychologie“ 1924: „Es wäre wichtig, nicht nur die Bedingungen zu untersuchen, die die Übertragung des mentalen Einflusses vom Übermittler zum Empfänger regeln, sondern auch die Umstände, die bei der Hemmung wie der Ausführung derartiger [bildlichgedanklicher] Suggestionen von Belang sind. Dies wäre notwendigerweise von theoretischem ebenso wie von praktischem Interesse.“ Der Gehirnforscher kam jedoch nicht mehr dazu, weitere Forschungen mit Durow durchzuführen, 1927 wurde er – angeblich auf Befehl Stalins – vergiftet, weil er bei dem eine schwere Paranoia diagnostiziert hatte.
.

Rastplatz (1)
.
Alter und neuer Dorfsozialismus
Zwei Literaturwissenschaftler der Humboldtuniversität, Hißnauer und Stockinger, haben mit ihrem Buch „Provinz erzählen“ ein „allgemeines Modell medialer Raumproduktion“ vorgestellt – konkret gemacht an der „Uckermark, die zu einem Raum des guten Lebens wird“. Die Münchner Filmemacherin Lola Randl, die ihre Kindheit in einer bayrischen Ökokommune verbrachte, ist dort hingezogen: „Und ja, es war genauso menschenleer, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber es war auch unfassbar schön. Hach, dachte ich mir, hier ein Häuschen, einen Garten und ein paar Schafe.“
Zwar sind ihr die Schafe später weggelaufen und nicht wiedergekommen, aber sie selbst lebt nach zehn Jahre noch immer dort mit ihrem Mann, ihrem Liebhaber, zwei Kindern, ihrer Mutter, einigen Legehennen und Sattelschweinen, interessanten Bienen und weniger interessanten Besuchern sowie einem Psychotherapeuten und einer Psychotherapeutin in der Hauptstadt. Und sie hat sowohl einen Dokumentarfilm als auch ein Buch über diese biosoziale Idylle veröffentlicht. Beides handelt von ihr als ein „Projektmensch“, der auf der Suche nach Sinn in die Uckermark nach Gerswalde zieht, aber „das nicht wirklich durchdacht hat“.
Jetzt gibt es dort aber schon einen Gemeinschaftsgarten, ein Café von Japanerinnen, einen Kreuzberger Räucherimbiss, eine „Dorfmitte-Galerie“ und man trifft sich abends in der Bar „Paradieschen“. Lola Randl erwarb im Ort zunächst das ehemalige Wirtshaus „Zum Löwen“ und begärtnerte mit ihrer Mutter, einer Landschaftsgärtnerin, den Schlossgarten derer von Arnim. Derzeit nimmt sie ein weiteres „Projekt“ in Angriff: den Ausbau eines Gästehauses. Hinzu kommt später noch „ein Proberaum, ein Ensemble soll gegründet, eine Bühne gebaut werden und eine Akademie und noch eine Halle und ein Teehaus. Nur das Nötigste eben. Es dauert alles, weil wir kein Geld haben und viel selber machen.“
„Die Zeit nennt“ sie die „Königin von Gerswalde“ und ihren Roman „eine essayistisch-aphoristische Dorfgeschichte in Form einer Gartenenzyklopädie mit einem autobiografischen Erzählstrang, einer jahreszeitlichen Rahmung und einer regionalen Chronistenfunktion, die das Schicksal der Dorfgemeinschaft vom preußischen Landadel über die Zeit der LPGs und deren Abwicklung in den Nachwendejahren begleitet.“
Ihre Erzählweise erinnerte mich ein bißchen an die verstörenden Mädchengeschichten in den Romanen der ehemaligen DDR-Melkerin Angelika Klüssendorf, die zuletzt ein Buch über ihre Ehe mit dem Herausgeber der FAZ veröffentlichte.
Nach Gerswalde aufs Land zieht es inzwischen viele. Das Dorf hat laut taz, die Lola Randl vor Ort interviewte, im Gegensatz zu den meisten anderen brandenburgischen Dörfern „eine Apotheke, eine Sparkasse und die zehn Sachen, die unser Dorf hat, die man zum Leben braucht. Ich fand es sowieso unverschämt, dass es diesen Ort so gibt. Dieser Ort musste einfach geteilt werden. Jetzt halt mit vielen.“
Bevor sie nach Gerswalde zog, wohnte sie in Berlin-Mitte: „Da waren alle Kreative, die etwas mit Medien oder Kunst gemacht haben, alle im gleichen Alter mit ähnlichem Geschmack, alle so dicht aufeinander. Das hat mich fast in die Depression getrieben.“ Die taz-Autorin sieht allerdings auch im Gerswalder Café inzwischen nur „Kreative“: „Gerswalde ist längst ein Symbol: ein Ort auf dem Land, aber mit einer bestimmten Berliner Crowd,“ sagt sie. Für das Dorf bedeutet das laut Lola Randl: „Der Wohnraum wird hier schon knapp. Die Häuserpreise steigen immens. Manche können sie sich schon nicht mehr leisten. Das ist sehr schade. Wenn jemand Neues kommt, fragt man sich schon, ob das nur Wochenendler sind. Die kommen mit ihrem voll gefüllten Kofferraum und machen Erholung. Wenn man an Häusern vorbeifährt, wo nie jemand da ist, ist das sehr schade.“
Für die alteingesessenen Gerswalder, die Ostler, ist das umso mehr gewöhnungsbedürftig, „aber das hier ist auch eine offenere Heimat als anderswo. Etwa weil nach dem Krieg Flüchtlinge kamen. In dem oberpfälzischen Dorf, aus dem ich komme, gelten Werte, die nicht so leicht anders zu besetzen gewesen wären. Dass so ein paar Dahergelaufene gegenüber der Kirche einziehen, wäre dort nie passiert. Zehn Neue haben nun fest ihr Leben im Dorfmitte-Universum, sie haben ihren Beruf hierhin verlegt oder so neu erfunden, dass er hierher passt. Die Gemeindevertreter sehen das durchaus positiv. Aufhalten kann man das ja sowieso nicht.“
Im Prignitz-Dorf Rosenwinkel findet die Geselligkeit der Projektemacher in „Maikel‘s Taverne“ statt – oft bis spät in die Nacht. In Gerswalde ist es die „Paradieschenbar“: „Die ist jetzt die einzige Bar im Dorf und solche Orte braucht ein Dorf. Die ist oft rappelvoll, und jetzt, nach zwei Jahren, kommen auch viele Alt-Dörfler. Da werden dann auch mal Schlager gesungen. Häufig ist da bis zwei, drei, vier Uhr was los – und nicht wegen der Ausflügler.“
In ihrem Buch „Der grosse Garten“ nimmt sie gegenüber dem Dorf, ihrem Liebesleben und dem der Pflanzen und Tiere eine „ironische Distanz“ ein, wie man so sagt. Die Ironie erhebt sich und ist subversiv, der Humor läßt sich fallen, bis auf das Schwarze unter dem Fingernagel. Lola Randls „Roman“ ist etwas Seltenes: ironisch und humorig, wobei schwarze Fingernägel ja für Gärtner sowieso obligatorisch sind. „Und mit der Distanz bin ich schon geboren. Es ist für mich schwierig, wenn ich nicht einen Beobachterstandpunkt haben kann. Die Distanz braucht es, um überhaupt so offen sein zu können.“ Statt der „Empathie“ widmete sie aber der „Entropie“ ein Kapitel. Für sie ist deswegen „eine Gartentherapie nicht das Schlechteste. Nimm die Brombeeren hier. Man kann sagen: Ich will nicht, dass die da wachsen. Man kann auch einfach sagen: Hier will eine Brombeere wachsen. Man kann sagen: Löwenzahn ist Unkraut und muss raus. Oder: Löwenzahn wächst hier prächtig, was kann man damit machen?“ Aber „das Tolle an meinem Beet ist, dass sich die Kiwis, die meine Mutter niemals zulassen wollte, an diesem Standort super machen.“
Es geht ihr in Gerswalde nicht um ihre „Wurzeln“, sondern um die ihrer Kinder. „Meine Wurzeln gehen nicht so irrsinnig tief in den Boden rein, egal wo ich bin. Ich bin keine Wurzelpflanze, eher eine Geflechtpflanze oder doch eine Flugsamenpflanze. Auch wenn man als Kurzwurzler natürlich auch mal umgeweht werden kann.“
Und doch versucht sie in ihrem wenig fiktiven Roman an die Wurzeln der Dinge wenigstens in ihrer Umgebung zu gelangen – und geht dazu dem Woher und Wohin von Fröschen, Kohlweisslingen, Apfelbäumenund den Nachbarn nach, aber auch relativ abstrakten Begriffen: wie Internet, Evolution und Libido z.B.. Dieseübersetzt sie sich sehr sehr stimmig von Wikipedia und Max-Planck-Gesellschaftin Gerswalder Selbstgedachtes. Über das Internet schreibt sie: „Dort steht, dass Pflanzen eine Seele haben. Aber im Internet steht auch, dass Pflanzen keine Seele haben. Im Internet kann man eigentlich alles lesen, was man lesen möchte, wenn man nur lange genug sucht. Man muss nur aufpassen, dass man nicht liest, was man nicht lesen möchte.“
Über die Evolution sagt sie, dass „sie eine vom Menschen erdachte Theorie ist, die ihn selbst nur noch wenig angeht, weil er von der natürlichen Auslese gar nicht mehr direkt betroffen ist. Trotzdem denkt er immer wieder gerne an seine Theorie, zum Beispiel wenn er eine besondere Farbkombination an Tieren oder Pflanzen betrachtet und er sich fragt, wie ein solch herrliches Muster bloß entstanden sein kann.“
Über die Libido läßt sie ihren „Liebhaber“ klagen, dass sie „nicht mehr so ist wie früher“. Die Icherzählerin erwidert ihm, dass es eher, „am Weltuntergang liegt“. Der Zug aufs Land ist auch ein Symptom des Misanthropozäns!
Inzwischen gibt es mehrere Dörfer, die ähnlich von „Berlinern“ heimgesucht wurden und werden: Strohdehne an der Elbe z.B. oder Kuhlmühle bei Wittstock und der Ulenhof in Mecklenburg oder die Agrarkulturstiftung im märkischen Reichenow. Ebenfalls um nicht-kommerzielle Grundversorgungsmöglichkeiten ging es auch im uckermärkischen Kollektiv der „Lokomotive Karlshof“, sie zerstritten sich jedoch nach einigen Ernten und gaben auf. In Mecklenburg gibt es ferner ein Elefantendorf, ein Tigerdorf, einen Bärenwald, ein Wisentreservat, einen Vogel- und mehrere Schmetterlingsparks.
Lola Randls Roman und Film flankieren gewissermaßen ihr Gerswalde-Projekt. Überzeugender als das des Schweizer Fernsehmoderators und Buchautors Max Moor, der zusammen mit seiner Frau aus dem märkischen Ort Hirschfelde partout ein „Modelldorf“ machen will.
Lola Randls „autofiktionale“ Filmdokumentation „Von Bienen und Blumen“, die kürzlich Premiere hatte, ist für den Rezensenten der „literaturkritik.de“: „Ein Film von Hipstern über Hipster für Hipster. Der Inhalt rankt sich um mehrere hippe Berliner Stadtmenschen, die in der Uckermark eine brachliegende Gartenanlage aufarbeiten wollen, um hier autark leben zu können. Diese Stadtflucht wird im Film begleitet von einer vermeintlich fiktiven Doktorarbeit, die immer wieder aus dem Off vorgelesen wird. Sie trägt den Titel: „Die Sinnsuche des postkapitalistischen Individuums. Diese sowie die verschiedenen Jahreszeiten bilden – wie auch in ihrem Roman – den Rahmen, in dem die Arbeit der Städter auf dem Land gezeigt wird. Nach und nach kristallisiert sich noch ein anderes zentrales Thema heraus: die Polyamorie.“
Dabei zeigt sich, dass die „freie Liebe“ nicht einfach ist. Aber „der Film ‚Von Blumen und Menschen‘ nimmt sich durchaus nicht ernst. „Auf trockene Art und Weise werden die Macken der einzelnen Personen dokumentiert und so entsteht nicht selten grotesker Witz.“ Der Stil ist konstant dokumentarisch, „für den Zuschauer ist nicht erkennbar, ob die Szenen gespielt sind, einem Skript folgen oder echt sind.“ Die „literaturkritik“ bemängelt aber vor allem: „Der Film hätte eine witzige Kritik am ‚Hipstertum‘ werden können. So ist er nun leider ein Porträt von Menschen geworden, die sich selbst toll und außergewöhnlich finden und lediglich kleine Macken haben.“
Dazu fällt mir sofort München ein und Rainer Langhans mit seinem WG-„Harem“, die seit Jahrzehnten Filme mit einem ähnlichen Gestus drehen. Hier wie dort soll dabei durchaus etwas „Weltrettendes“ bei rauskommen. Es ist, wenn man so will, Agitprop. In Lola Randls Dorf fing es damit vor etwa zehn Jahren an, dass die Icherzählerin die ersten aus der Erde kommenden Keimblätter photographierte. „Ich weiß noch nicht, was aus dem Fotoprojekt werden soll,“ schreibt sie, „aber irgendetwas kann man bestimmt daraus machen. Der Projektmensch geht davon aus, dass in allem ein Projekt steckt.“ Aus den Fotos wurde ein Roman mit 400 kurzen Kapiteln, in dem sie sich wie auch im Film die Frage stellt, „wie man leben will. Wie es anders gehen kann, als in Städten zu wohnen, sich um sich selbst zu drehen, im System von Wachstum und Optimierung festzusitzen?“
An dieser Frage – als Projekt – arbeitete sich zur gleichen Zeit auch die in Leipzig psychologisch feingeschliffene Schriftstellerin Anke Stelling in ihren Romanen „Bodentiefe Fenster“ und „Schäfchen im Trockenen“ ab. Bloß das ihr Dorf ein Mehrgenerationenhaus in Prenzlauer Berg ist, ein Burgbauprojekt von Hipstern, das der Icherzählerin nachhaltig zu denken gibt. Lola Randl hat aber glaube ich bessere Nerven als Anke Stelling, die sich ihre „Distanz“ zum „Wohnprojekt“ ergrübelte. In Interviews äußert die Filmemacherin jedoch auch bereits erste Befürchtungen. Die taz-Journalistin fragte sie deswegen erstaunt, ob dann nicht die Projektwerbung für Gerswalde mittels Roman und Film quasi kontraproduktiv sei? Ja, irgendwann wird die Autorin wahrscheinlich sagen: Es war schön – aber anstrengend! Zum Glück leben wir in „nachgesellschaftlichen Projektwelten“. Und ein „Projekt“ ist kein Schicksal, eher schon, dass der ganze Lebenssinn in der Gesellschaft steckte. Lola Randl entbirgt das Soziale nun in Tieren und Pflanzen. Sechs Kapitel ihres Buches widmete sie allein dem Maulwurf und einer Schmucklilie, der Agapanthus, fünf; dem „neuen Menschen“ hingegen nur drei.
.

.
Sie schreibt im Übrigen lieber ein Buch als im Garten zu arbeiten, sagt sie in einem TV-Porträt. Ihre „Dorfchronik“ (was bisher geschah und gedacht wurde) hat am Ende praktischerweise ein alphabetisches Verzeichnis der „Inhalte“.
Zwei handeln von Mäusen – Haus und Feldmäuse. Die Ich-Erzählerin in Lola Randls „Grossen Garten“ ist im Haus des „Liebhabers“, der im selben Dorf wohnt, als dieser plötzlich aufspringt und mit seinem Pantoffel eine Maus erschlägt. Es ist Winter, er hat gut geheizt und die Mäuse sind ins Haus gekommen. Sie hat „noch nie gesehen, wie ein Mensch ein Tier mit einem Pantoffel tothaut“ und ist „kurz erschrocken“, springt auf, sagt, „mir ist es hier einfach zu warm“ und geht nach Hause.
Im Roman folgt darauf eine Beschäftigung mit Mäusen: „Die Feldmaus ist – anders als die Hausmaus – im Sommer lieber draußen, also eigentlich ist sie meistens lieber draußen, nur im Winter, wenn es echt kalt wird, dann kommt sie gerne ins warme Haus. Aber sie hat ja ihr Winterfell und dann ist es ihr mit der neuen Heizung [des Liebhabers] schnell etwas zu warm. Dann muß sie sich entscheiden, ob sie jetzt ihr Winterfell abwirft oder ob sie vielleicht doch besser in den Stall geht, ein guter Kompromiß eigentlich für die Feldmaus.“
Über die Hausmaus erwähnt die Autorin nur, dass man sie „nicht mit der Feldmaus verwechseln darf“, Das Kapitel über die Feldmaus beginnt mit dem Satz: „Die Feldmaus ist ein Säugetier aus der Wühlmausfamilie. Sie ist ein typischer r-Statege.“ „r“ wie Reproduktion, das heißt: die Feldmäuse setzen zum Überleben auf „hohe Reproduktionsraten“. Sie setzen natürlich auf Nichts, aber „damit die Kinderaufzucht noch effizienter wird, bilden mehrere Feldmausfrauen Nestgemeinschaften.“
Anke Stelling handelt die Mäuse in ihren letzten drei Romanen kurz und knapp ab. In „Fürsorge“ (2017) erwähnt sie einen Jungen, der ein Terrarium hat, „in dem knopfäugige Rennmäuse rascheln“. Sein Vater fragt ihn oft: „Hast du die Mäuse gefüttert?“ Der Junge sagt jedesmal „Ja, klar“. Ob er sie tatsächlich gefüttert hat, geht daraus nicht hervor.
In ihrem zwei Jahre zuvor erschienenen Roman „Bodentiefe Fenster“ hatte die Icherzählerin über die nach Mäusen benannten Kita-Gruppen gelästert: „ein Nest soll das hier sein, mit knopfäugigen Säugetierchen, die darin herumwuseln und niedlich vor sich hin fiepsen, dass ich nicht lache. Ein warmes Nest in warmen Farben, aber in Wahrheit sind Mäuse doch einfach nur eine Plage, fressen, nagen und nutzen niemandem, taugen allenfalls noch als Labortiere, denen man Krankheiten injiziert, um zu sehen, wie sie damit fertig werden.“ Diese „armen kleinen Mäuse“ werden ihr daraufhin zu einer Metapher für all jene Kinder, „die die Behandlung nicht überleben,“ was „ab sofort“ auf ihr – der Mütter – „Konto“ geht.
.

Schnappschuß
.
Tanz- und Rennmäuse
Der Tierpathologe Achim Gruber berichtet (in: „Das Kuscheltierdrama“ – 2019), dass er als Kind Tanzmäuse besaß: Die waren sehr niedlich, sie drehten sich den ganzen Tag im Kreis – weil sie einen angezüchteten Innenohrdefekt hatten. Daraus resultierte ein Gleichgewichtsproblem: Sie konnten nicht geradeaus laufen. Ein eindeutiger Fall von „Qualzucht“. Heute gibt es sie nicht mehr im Handel: „Zumindest bei den Tanzmäusen hat sich was bewegt,“ schreibt er. Bei Ebay werden jedoch noch immer jede Menge Tanzkostüme für diese Mäuse angeboten.
Die Rennmäuse kann man in jeder Tierhandlung kaufen, sie rennen aber nicht ständig. Der Sohn meiner Freundin war in einer Kita gewesen, in denen die Gruppen „Feldmäuse“, „Wühlmäuse“, „Spitzmäuse“ und „Rennmäuse“ hießen. Später fragte er in einer Tierhandlung den Verkäufer: „Haben Sie Mäuse?“ Dieser fragte zurück: „Zum Spielen oder zum Verfüttern?“ Und fügte hinzu: „Die zum Verfüttern sind billiger,“ Er meinte weiße Mäuse. Der Sohn meiner Freundin wollte aber zwei Rennmäuse, sie kosteten 16 Euro, dazu kaufte er noch für 10 Euro das Buch „Mongolische Rennmäuse: Haltung, Pflege, Beschäftigung“. Einen Käfig hatte er bereits, von einem Cousin. Seine Mutter googelte sogleich, was die Tiere für eine „artgerechte Einrichtung“ bräuchten. Auf der Internetseite einer Tierschutzorganisation, hieß es : „In der Natur leben mongolische Rennmäuse in Steppen und Halbwüsten, wo sie ihren enormen Bewegungsdrang ausleben und den größten Teil ihres Lebens unterirdisch mit Graben von Gangsystemen verbringen. Diese Voraussetzungen kann man den Tieren in Gefangenschaft kaum bieten. VIER PFOTEN rät deswegen von der Anschaffung mongolischer Rennmäuse ab!“ Außerdem ist „das Skelett der Mäuse zart und zerbrechlich, daher sind die Tiere für Kinder ungeeignet.“
Im Forum „rennmaus.de“, das 32.580 Mitglieder hat, erfuhr sie, „keine Rennmaus gleicht charakterlich der anderen“. Was man ja von den Menschen nicht sagen kann. „Manche Rennmäuse können schnell zahm werden, andere wiederum bleiben eher scheu. Es gibt etwa 100 verschiedene Rennmausarten auf der Welt, die hauptsächlich in Afrika und Asien beheimatet sind“ – z.B. Fettschwanzrennmäuse undKurzschwanzrennmäuse sowie die großen und die kleinen indischen Nacktsohlenrennmäuse. „Als Heimtier am meisten verbreitet ist jedoch die Mongolische Rennmaus. Ihr lateinischer Name ‚Meriones Unguiculatus‘ wird – fälschlich – gerne als ‚Krieger mit Krallen‘ übersetzt, womit Bezug genommen wird auf zum Teil aggressiv ausgetragene Revierkämpfe, die mitunter tödlich enden.“ Deswegen, aber auch wegen der großen Fruchtbarkeit der Rennmaus-Weibchen (sie bekommen ein bis drei mal im Jahr bis zu zwölf Junge) raten Tierschützer, Männchen zu kastrieren.
Es gibt mehr Rennmausforen für den poussierlichen kleinen Nager im Internet als man für möglich hält. Eins hebt hervor, wenn eines der Tiere stirbt (sie werden maximal zwei Jahre alt) und man nur zwei hatte, sollte man ein Tier dazukaufen, denn Rennmäuse lieben und leben gesellig. In der Schweiz ist es sogar gesetzlich verboten, die in Herden oder sozialen Verbänden lebenden kleinen Nager und großen Wiederkäuer einzeln zu halten. Wikipedia weiß jedoch über die Wüstenmäuse zu berichten, „die Rennmausarten in heißen Wüsten sind meist Einzelgänger.“Gilt das auch für überheizte Kinderzimmer?
Der Sohn meiner Freundin baute aus Leim, Pappe und Plastikröhren ein ansprechendes Tunnelsystem für die zwei Rennmäuse im Käfig. Die amerikanische Verhaltensforscherin Temple Grandin hat darüber in ihrem Buch „Making Animals Happy. How to Create the Best Life for Pets and Other Animals“ (2009) nachgedacht. Zwar ist die autistische „Animal Science“-Professorin eher für Großvieheinheiten zuständig, insofern sie die Situation von Rindern, Schweinen und Mastgeflügel auf Schlachthöfen und Zuliefererfarmen, u.a. für McDonald‘s, verbessert, aber in ihrem Buch schreibt sie über die Rennmäuse: Gefangen gehaltene Tiere entwickeln mangels aufregender Umwelt leicht „stereotype Verhaltensweisen“ (man spricht auch von Hospitalismus, wenn ein Elefant sich z.B. den ganzen Tag „wiegt“ – mit dem Kopf wackelt oder ein Tiger immer am Gitter entlang wandert.). In Käfigen lebende Rennmäuse haben eine „In-den-Ecken- graben-Stereotypie“, sie verbringen 30 Prozent ihrer „aktiven Zeit“ damit. Zwar meinen viele Forscher, dass sie im biologischen Sinne graben müssen, aber das ist laut Temple Grandin falsch: „In Freiheit graben die Rennmäuse nicht, um bloß zu graben. Sie graben, um Tunnel und Nester zu schaffen. Wenn sie das geschafft haben, hören sie auf zu graben.“ Die Rennmäuse graben also ergebnisorientiert.
Der schwedische Neurobiologe Christoph Wiedenmayer hat das getestet: Er setzte einen Wurf Jungtiere in einen Käfig mit viel trockenem Sand, und einen anderen Wurf in einen Käfig, in dem sich bereits fertige Gräben und Gänge befanden. Die Rennmäuse im Sand entwickelten sofort eine „Grab-Stereotypie“, die anderen fingen gar nicht erst an zu graben. Das zeigte laut Temple Grandin: Die Motivation für die „Grab-Stereotypie“ ist die Notwendigkeit, sich in einem sicheren Raum zu verstecken. Rennmäuse haben in Freiheit viele Feinde, in Laboren und Kinderzimmern nur die Menschen. So oder so: „Die Rennmaus braucht das Gefühl, sich sicher zu fühlen“, nicht weil sie quasi von Natur aus ein „Wühler“ ist. Inzwischen zählen die Biologen sie auch schonnicht mehr zu den „altweltlichen Wühlern“, sondern zu den „Mäuseartigen“. Für Temple Grandin zeigen Rennmäuse in Käfigen ein normales Verhalten in einer unnormalen Umgebung: „Eine Rennmaus, die 30 Prozent ihrer Zeit mit Graben verbringt, ohne in der Lage zu sein, einen Tunnel zu graben, ist in keinen guten Händen.“ In Freiheit wäre eine Rennmaus, die sich keinen Tunnel gräbt, schnell Beute eines Raubtiers.
Die beiden jungen Rennmäuse, die der Sohn meiner Freundin sich gekauft hatte, waren geschlechtlich noch schwer zu bestimmen, deswegen ließ er die Frage, wer ist was? einstweilen auf sich beruhen. Und damit auch die Namensgebung. Dafür baute er ihnen den Käfig immer „artgemäßer“ aus.
Eine Rennmaus ließ sich von ihm bald den Bauch kraulen, wobei sie in eine Art Koma fiel. Erfreute sich über so viel Vertrauen, aber im Forum „Meine Rennmauswelt“ las er, dass viele Nagerarten sich quasi tot stellen, wenn sie Angst haben, ähnlich auch beim Streicheln,so dass man nicht wisse, ob dies eine Angstreaktion oder Wohlbehagen sei.
In ihrem Roman „Fürsorge“ (2017) erwähnt Anke Stelling einen Jungen, der ein Terrarium hat, „in dem knopfäugige Rennmäuse rascheln“. Sein Vater fragt ihn oft: „Hast du die Mäuse gefüttert?“ Der Junge sagt jedesmal „Ja, klar“. Auch meine Freundin erinnerte ihren Sohn ständig, die Mäuse zu füttern. Als sie es leid war, übernahm sie deren Versorgung. Aber als sie einmal verreisen mußte, vergaß sie es und als sie zurückkam, waren die Mäuse tot.
.

Schlangenverkäufer
.
Rennkuckucke
Den kennt man – aus Zeichentrickfilmen: Den „Road-Runner“, der mit einem Affenzahn durch die mexikanischen Halbwüsten saust und dabei von einem Kojoten verfolgt wird. So ähnlich wie bei Tom und Jerry. Der kürzlich verstorbene Zoologe Vitus Dröscher hat den Rennkuckuck in Mexiko genauso erlebt: Schon von weitem sah er ihn bzw. eine Staubfahne. „Der 60 Zentimeter große Vogel mit langen Beinen, einem noch längeren Schwanz und einem Federbusch auf dem Kopf schoß auf uns zu, schlug um unseren Wagen einen Haken, sprang flatternd fünf Meter hoch an einem Kaktusstamm empor und ‚hupte‘ zweimal.“ Das macht er auch im Film immer. Und wie im Film galt das Hupen auch bei dem, den Dröscher sah, einem Kojoten, der hinter ihm her gewesen war. Es war ein triumphierendes Hupen.
Bei der Brautwerbung hupt er jedoch genauso, da ist es aber eher schmachtend gemeint. Außerdem gehört zum Werberitual, dass das Männchen dem Weibchen z.B. eine Eidechse anbietet, dabei läuft es „im Höchsttempo auf der Stelle“ und wedelt wild mit dem Schwanz. Auf der Flucht kann der Vogel bis zu 50 km/h laufen, aber der Kojote bis zu 60, dennoch läuft dieser „Pfeil mit Federn“ seinen Freßfeinden zunächst hakenschlagend davon. Erst wenn sie ihn fast eingeholt haben, schwingt er sich in die Luft – und hupt von oben. Laut Dröscher nutzte er früher gerne die Wege der Pferdekutschen als „halbwegs eingeebnete Renn- und Fluchtpisten. Mitunter ärgerte er die Postreiter, wenn er sie überholte. Damals bekam der Roadrunner auch seinen Namen.“ Er lebt von Insekten, Mäuse und Eidechsen, schreckt jedoch auch vor Skorpionen und Klapperschlangen nicht zurück. Und weil er ziemlich neugierig ist, läuft er auch gerne in menschliche Siedlungen und läßt sich sogar auf kleine Rennen mit Autos ein.
Die Rennkuckucke sind nicht wie die europäischen Kuckucke „Brutschmarotzer“, sondern brüten ihre oft sechs Eier selbst aus, d.h. Männchen und Weibchen abwechselnd. Für das Nest sucht das Männchen das Baumaterial zusammen und das Weibchen verbaut es. Gelegentlich finden sich 12 Eier im Nest, dann hat das Männchen Bigamie betrieben, worauf beide Weibchen ihm ihre Eier ins Nest gelegt – und sich dann „aus dem Staub“ gemacht haben, er muß sie nun alleine ausbrüten und die Jungen füttern. Dröscher meint, dass dieses Verhalten der „Anfang zum Brutschmarotzertum“ sein könnte, also dass die Weibchen, um auch das Männchen vom Brutgeschäft zu entlasten oder weil es dies verweigert, ihre Eier in fremde Nester legen.
Mann kann sich diesen schnell zutraulich werdenden Vogel im Westberliner Zoo ansehen. Dort kann er traurigerweise weder lange Strecken laufen noch groß fliegen.
Vitus Dröscher hat ihn nicht nur in Mexiko, sondern auch in der Mojavewüste der USA beobachtet. Dort wachsen ebenfalls große Kakteen mit langen Dornen. Diese nutzt der Rennkuckuck, um Beute zu machen: „Entdeckt er in aller Morgenfrühe eine an der Wüstenoberfläche schlafende Klapperschlange, pflückt er dutzendweise diese Stachelableger und legt sie als geschlossenen Stachelzaun rings um das Opfer. Dann flattert er hoch – Virginia Donglas, Zoologin an der Universität von San Diego, kann es bezeugen -, und bombardiert das Reptil mit mehreren Kakteenstückchen, weckt es dadurch auf und versetzt es in Panik. Die Schlange versucht zu fliehen und spießt sich selbst dabei am Zaun auf. Je mehr sie tobt, desto öfter wird sie durchbohrt. Der Tod tritt nach etwa einer halben Stunde ein. Dann kann er sie fressen. Einzigartig in der gesamten Tierwelt!“
Sind die Rennkuckucke zu zweit haben sie laut Dröscher noch eine andere Technik, um eine Schlange zu erbeuten: Sie fliegen hoch und werfen ihr Sand in die Augen. Da diese nicht durch Lider geschützt sind, wird das Reptil in der Sicht behindert. Im rechten Moment stoßen die Vögel von oben zu, und fangen die Gegenangriffe des Feindes mit den Flügeln als Schutzschilde so lange ab, bis ihnen mit dem langen kräftigen Schnabel ein Volltreffer in den Kopf gelingt. Anschließend verschlingen sie die ganze, bis zu einem Meter lange Schlange. Sind sie doch einmal vom Giftzahn geritzt worden,fressen sie gleich darauf ein paar Blätter vom Huacokraut, die auch die Indios gegen Schlangenbisse benutzen.
„Gegen Skorpione geht der Vogel anders vor. Im Abstand von etwa zehn Metern spreizt er seinen Federschopf wie ein Kakadu, entblößt den rot-weißen Schläfenstreifen, streckt den Kopf am langen Hals waagerecht nach vorn, während der lange, dünne Schwanz wie ein Scheibenwischer hin und her pendelt, und flitzt dann wie ein Pfeil blitzartig nach vorn. Aus vollem Lauf schnappt er nach dem Giftstachelschwanz des kurzsichtigen Skorpions, reißt ihn mit einem Ruck ab und verspeist das Tier.“
Zu den Feinden, die hinter dem Rennkuckuck her sind, zählen neben Kojoten noch Rotluchs, Katzenfrett und verwilderte Hauskatzen. Letzteren kann er leicht davonlaufen, er tut aber was anderes: „Mit unnachahmlicher Kurventechnik setzt er sich gleich hinter den Verfolger und hackt ihn in sein Arschloch. Das wirkt durchschlagend.“
Bedrohlicher ist für ihn ein Rotschwanzbussard oder ein Steinadler. Wenn ein solcher am Himmel auftaucht, flieht er unter einen Dornbusch. Dröscher beobachtete einmal, wie ihn ein Schwarzflügel-Gleitaar angriff: „Der Sturzflug in den Busch wäre ihm schlecht bekommen. So landete er daneben und wollte zu Fuß eindringen. Doch das war sein Fehler. Am Boden war der viel kleinere Rennkuckuck dem großen Greif haushoch überlegen. Sogleich flitzte er hervor und malträtierte den Räuber von allen Seiten gleichzeitig mit Schnabelhieben. Nur mit Mühe konnte sich der Gleitaar wieder in die Lüfte retten.“
Neben diesen Feinden haben die Rennkuckucke in ihren Revieren aber auch Freunde: die kleinen Schopfwachteln z.B., auch sie laufen lieber als dass sie fliegen: Mit Leichtigkeit könnte der Roadrunnerdie Wachtel töten, ihre Eier und Küken verschlingen. „Aber er tut es seltsamerweise nicht.“ Dröscher erklärt sich das damit, dass es bei ihnen keine „Interessenüberschneidungen“ gibt: Der eine ist Fleischfresser, der andere Vegetarier. In der Mojavewüste nutzen sie auch die selben Wasserquellen: Einrichtungen des US-Militärs, wo es immer genug zu trinken gibt, denn die Soldaten waschen dort aus Langeweile ständig ihre Autos.
Und noch eine Besonderheit weist der „Wundervogel“, wie Dröscher ihn nennt, auf: In den Wüsten wird es Nachts empfindlich kalt. Um nicht zum Aufheizen zu viel Energie zu verbrauchen, senkt er seine Körpertemperatur von 37 auf 30 Grad ab. Das hat allerdings zur Folge, dass er bei Sonnenaufgang steifgefroren ist. Um schnell wieder fit zu sein, hebt er seine Flügel an: Auf der rosafarbenen Haut seines Rückens hat er schwarze, federlose Flächen die die Sonnenwärme schnell absorbieren, indem sich der Vogel mit dem Rücken in die Sonnenstrahlen stellt. „Binnen 20 Minuten und eher als Feind oder Beute ist der Rennkuckuck wieder zu Rennhöchstleistungen bereit.“
.

Italoeis
.
Maulwurf
„Wenn ihr also den Maulwurf recht fleißig verfolgt, und mit Stumpf und Stiel vertilgen wollt, so thut ihr euch selbst den grösten Schaden und den Engerlingen den grösten Gefallen,“ schrieb der alemannische Pädagoge Johann Peter Hebel. Nun hat sich aber die Situation völlig umgedreht: Es gibt so gut wie keine Engerlinge mehr (die Larven des nahezu ausgerotteten Maikäfers), so dass sich die Maulwürfe an den äußerst nützlichen Regenwürmern schadlos halten, was die Gärtner noch mehr erbost als die Maulwurfshaufen auf ihrem Rasen, aber es nützt ihnen nichts, denn in Deutschland sind laut Bundesartenschutzverordnung fast alle heimischen Säugetierarten besonders geschützt. Dazu zählt natürlich auch der „europäische Maulwurf“. Das Weibchen bringt im Juni drei bis vier nackte, anfangs blinde Jungen zur Welt, die sie vier bis sechs Wochen säugt.
Maulwürfe werden selten in Zoos gehalten. Wikipedia berichtet, dass man im Osnabrücker Zoo „Unter der Erde“ welche hielt, aber nachdem mehrere Tiere gestorben waren, wurde die Haltung von Maulwürfen beendet. Ich hielt auch einmal einen Maulwurf, den unsere Katze gefangen hatte, in einem Terrarium mit Erde und Regenwürmern, aber auch er starb nach kurzer Zeit. Zum Trost schenkte mir jemand ein Stofftier: „Der kleine Maulwurf“, der durch eine tschechoslowakische Zeichentrickserie berühmt geworden war. Sie lief später auch im deutschen Fernsehen, für das dann auch das überaus beliebte Kinderbuch „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ filmisch animiert wurde: Auf der Suche nach dem Übeltäter fragt der Maulwurf sich bei allen möglichen Tieren durch: Doch Taube, Kaninchen, Kuh und Schwein beweisen ihm, dass ihre Kothaufen ganz anders aussehen. Den richtigen Tipp bekommt er schließlich von zwei Fliegen, die sich mit der Materie bestens auskennen: Es war der Hund des Metzgers mit Namen „Hans-Heinerich“, der dann auch die Rache des kleinen Maulwurfs zu spüren bekommt.
Dann gibt es ferner eine Maulwurfgeschichte von einem Soldaten im Ersten Weltkrieg, dem ein Maulwurf im Schützengraben das Leben rettete. Franz Kafka machte daraus eine Erzählung mit dem Titel „Der Riesenmaulwurf“. Dieser bleibt jedoch unsichtbar, obwohl ein Dorfschullehrer versichert, ihn gesehen zu haben. Von Primo Levi stammt ein Loblied auf den Maulwurf in Form eines Gedichts. Und von dem ebenfalls aus Turin stammenden Leiter der dortigen Buchmesse Ernesto Ferrero eine Erzählung über das Leben eines Maulwurfs und den aussichtslosen Kampf des Menschen gegen das unterirdisch lebende Tier.
Von Kant verspottet, erfährt der Maulwurf bei Hegel eine erste politische Metaphorisierung: „Bisweilen erscheint der Geist nicht offenbar, sondern treibt sich, wie der Franzose sagt ‚sous terre‘ herum. Hamlet sagt vom Geiste, der ihn bald hier- und bald dorthin ruft: ‚Du bist ein wackerer Maulwurf‘, denn der Geist gräbt unter der Erde fort und vollendet sein Werk.“ So heißt es in Hegels „Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte“. Marx vergleicht dann die Revolution mit einem alten Maulwurf, „der umsichtig unter der Erde das Terrain vorbereitet, um eines Tages ans Licht zu kommen und den Sieg zu erringen“. Auf „deutschlandfunkkultur“ heißt es über diese unterirdische Wühlarbeit des Maulwurfs der Revolutionweitaus pessimistischer: „Beharrlich gräbt er seine Wege durch die Finsternis. Vergeblich, aber mit Zuversicht.“ Angesichts der sich erneut weltweit durchsetzenden völkischen Reaktion hat das Berliner Theater „Hau“ jüngst ein trotziges Festival „Der Maulwurf macht weiter“ organisiert. Zuvor hatte man einer historischen Aufarbeitung des bundesdeutschen Buchhandels den Untertitel „Von Marx zum Maulwurf“ gegeben, was sich so anhörte als seien die linken Buchläden und Verlage, bedrängt von Internet und Amazon, für die „Revolution“ bereits so weit, wieder in den Untergrund zu gehen, um „Raubdrucke“ unters Volk zu bringen. Aber was diesmal raubdrucken? „Brehms Thierleben“?
Der Maulwurf ist für die Wühlarbeit bestens ausgestattet. Das Tierlexikon zählt acht Merkmale auf: „Der Schwanz dient als Tastorgan zur Orientierung in dunklen Gängen. Durch die zylinderförmige Körperform kommt er gut durch die Gänge. Beim Graben schiebt er die Erde mit der Stirn an die Seite. Die rüsselartig verlängerte Nase wird wegen der starken Beanspruchung bei der Wühlarbeit durch einen länglichen Nasenknorpel geschützt. Mit den Ohren kann er jede Erschüterung im Boden und an der Oberfläche hören. Die starken Vordergliedmaßen sind ein hilfreiches Werkzeug für die Wühlarbeit. Das Fell besteht aus überaus dicht stehenden Haaren, die herabfallende Erde wird vom Körper fern gehalten. Die Augen braucht er im Dunkeln seines Lebensraums nicht.“Wir sagen deswegen auch, jemand sei „blind wie ein Maulwurf“, dabei „ahnen“ wir laut Tagesspiegel nicht einmal, dass Maulwürfe „die Welt farbig sehen und sogar ultraviolettes Licht wahrnehmen, wozu kein Mensch imstande ist.“
Früher hat man sie massenhaft erschlagen, vergiftet, in Fallen gefangen und ihnen das seidenweiche schwarze Fell abgezogen. Jacken, Krägen und Schlafröcke aus Maulwurfsfellen waren lange Zeit schick. Auch und gerade bei den Revolutionären. Heute untersuchen z.B. Leo Peichl und seine Kollegen vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt die Netzhäute von Maulwürfen und anderen unterirdisch lebenden Säugetieren. Diese sterben dabei vermutlich auch, aber heraus kommt am Ende: „Es ist nicht so, dass sich ihre Augen als Anpassung an das unterirdische Leben völlig zurückgebildet haben“, sagt Peichl. „Ihre Netzhaut enthält Stäbchen und zwei verschiedene Zapfentypen wie bei anderen Säugetieren auch.“
Auf „Youtube“ findet manzigClips, die zeigen, wie Maulwürfe durchs Gras laufen, sich eingraben, dabei Regenwürmer entdecken und fressen; wie sie in einem künstlichen Substrat Gänge graben; wie die Maulwurfsgrillen es ihnen im Kleinen nachtun, mit ebenfalls sehr großen Grabklauen ausgerüstet; wie sie aus einer kaputten Hausecke herauskommen, in allen Löchern am Haus Insekten findet und anschließend nicht mehr in ihre Höhle reinpassen, woraufhin sie immer nervöser und hektischerwerden und versuchen, im Garten ein neues Loch zu graben. Ein Clip hat den Titel: „Maulwurf findet ein neues Zuhause“, ein anderer: „Die besten Mittel um Maulwürfe endgültig zu vertreiben“. Eine Anleitung zu ihrer Ausrottung also, die 35.000 Mal aufgerufen wurde. Dagegen steht mit 128.000 Aufrufen ein Clip mit der pazifistischen Frohbotschaft „Maulwürfe gehören nun mal zur Naturlandschaft. Anstatt sie zu bekämpfen, sollte man sich freuen, dass sie die Böden lockern.“
Egal für welches Tier man sich interessiert, man kommt im Internet immer auf diese Meinungs-Pole zwischen Ökologie und Ökonomie. Alfred Brehm erinnerte bereits daran, „daß die Naturforscher einen großen Theil ihres Wissens alten, erprobten Maulwurfsfängern verdanken.“
.

Rastplatz (2)
.
Misanthropozän-News (1)
„Michel Foucault auf LSD,“ diese bestimmt nicht neue Nachricht (auf Facebook) stammte vom Deutschlandfunk Kultur, ab da schaute ich genauer hin auf die via Internet verbreiteten Schlagzeilen, hier die aus den letzten Tagen: „Unsere Landwirtschaft wurde total vergiftet“ (deutschlandfunk); „Unsere letzte und beste Chance. UN-Biodiversitätsbericht“ (der Freitag); „Ein Drittel der Berliner Pflanzen und Tiere ist vom Aussterben bedroht“ (BZ); „Viel Milch, viel Tierleid: Deutschlands kranke Kühe“ (Bayrischer Rundfunk); „Der Untergang der Fleischindustrie: Die Grüne Revolution“ (focus); „Katastrophe: Frankreichs Vogelpopulation bricht wegen Pestiziden ein“ (The Guardian); „Super!! Frankreich stellt Verwendung von Glyphosat ein“ (netzfrauen.de); „Luxemburg bereitet Cannabis-Legalisierung vor“ (welt.de); „Jetzt wird Bayer/Monsanto auch in Australien verklagt“ (FAZ); „100 Pestizide sollen von der Bundesregierung ungeprüft zugelassen werden“ (oekotest); „Im Urin von 93 Prozent aller getesteten Amerikaner fand sich Glyphosat“ (ecowatch.com); „Antibiotika: Werte für Donau sind erschreckend“ (meinbezirk.at); „Die Nennung irreführender oder falscher Statistiken ist ein Verstoß gegen den Rundfunkstaatsvertrag“ und könnte bald bestraft werden (FAZ); „Bericht des Weltbiodiversitätsrats der UNO: Der gefährliche Niedergang der Natur ist beispiellos“ (Drucksache); „Vor San Francsico starben 9 Grauwale aufgrund von Unterernährung“ (huffpost); „Bauern fürchten Biotope auf Streuobstwiesen – und fällen ihre Bäume“ (sueddeutsche zeitung); „Der erste Schritt zur Rettung des Klimas? Das Bevölkerungswachstum drosseln!“ (Die Welt); „Bienenstädte: Liegt die Zukunft der Bestäuber im urbanen Raum?“ (Der Spiegel); „Honigbienen tragen zum Insektensterben bei: Weil sie zu viele sind und die blühenden Flächen zu wenig, verdrängen sie die anderen Bestäuber – u.a. Hummeln und Wildbienen“ (taz); „Windräder töten 5,3 Milliarden Insekten pro Tag“ (ostsee-zeitung); „Die Hauptstadt summt“ (tagesspiegel); „Arbeitslose Bergarbeiter in den Apalachen werden zu Imkern umgeschult“ (returntonow.net); „Viehhändler aus Murnau: Glückliche Tiere sind Lügen am Konsumenten“ (kleine zeitung steiermark); „Landwirtschaft: Es wurde ein System aufgebaut, das gegen die Natur kämpft“ (sueddeutsche zeitung); „Merkel erklärt Wölfe zur Chefsache“ (Der Spiegel); „Der Wolf auf der Abschußliste“ (Sekretariat Tierschutzpartei); „Wir müssen wieder lernen, mit dem Wolf zu leben“ (nationalgeographic); „Union lehnt neues Klimaschutzgesetz ab“ (deutschlandfunk.de); „Goldgräberstimmung auf dem Acker: Mit dem Anbau von Wildblumen und Gräsern“ (FAZ); „Ein paar hundert Nandus leben östlich von Lübeck: Sie sollen jetzt erschossen werden“ (taz); „Orchideenjäger überfielen Naturschutztgebiet in Südbaden. Schäden in sechsstelliger Höhe“ (FAZ); „Tschernobyl: Als die Menschen verschwanden, entwickelte sich beeindruckendes Wildtier-Leben“ (theguardian); „Die kommerziellen Bedürfnisse der Schifffahrt zerstören die Lebengrundlagen der Fische und des gesamten Ökosystems in den Mündungsgebieten von Elbe, Weser und Ems“ (sueddeutsche zeitung); „Neue wissenschaftliche Förderprogramme sollen dem zunehmenden Verlust von Pflanzen- und Tierarten entgegenwirken“ (taz); „Haben Kraken eine Seele: Über tierisches Bewußtsein“ (3quarksdaily); „Den Müll könnt ihr wiederhaben: Malaysia schickt Container mit Abfall wieder zurück nach Europa“ (Der Spiegel); „Marienplatz: Am Rathaus blüht es nun bienenfreundlich“ (sueddeutsche zeitung); „Das Klima kippt und die soziale Balance kippt mit“ (FAZ) „Kein Anspruch auf tödliches Mittel: Gericht verweigerte Ehepaar, das sterben wollte, Recht auf Medikament“ (taz); „Nach sexuellem Missbrauch: Niederländerin (†17) nimmt Sterbehilfe in Anspruch und setzt ihrem Leben ein Ende“ (newsner.com); „Jetzt sprechen die Frauen der Schießstand-Opfer“ (BILD); „Kopf abgebissen: Löwen zerfleischen Zoobesucher“ (news.de); „Klimawandel läßt die Tiere kleiner werden“ (ecowatch.com); „Landwirte empört über Auflagen für ‚Cannabisanbau“ (agrarheute); „Arbeitszeit und Löhne sind wichtiger als Klimaschutz“ (taz); „Es ist nicht zu fassen – soeben haben wir aus internen Quellen erfahren, dass das giftige Pestizid Thiacloprid erneut in der EU zugelassen werden soll. Die EU beugt sich damit dem Druck der Lobbyisten von Bayer-Monsanto“ (simofus.org); „Schwarzenegger und Thunberg sagen: ‚Eure Zeit ist bald abgelaufen‘ (tagesspiegel); „Ernährung und Klimaschutz: Jeder Veganer spart jährlich zwei Tonnen an Treibausgasen“ (Der Spiegel); „Cannabis reduziert deutlich Depression“ (medizin-heute.net); „Nordpol bereits in fünf Jahren eisfrei“ (Die Welt); „Gletscher in Grönland wächst plötzlich wieder“ (Der Spiegel); „Kachelmann über Dürre-Warnungen: ‚Über 90 Prozent aller Geschichten zu Wetter und Klima sind falsch oder erfunden‘“ (meedia.de); „Berlins Grundwasser heizt sich immer mehr auf“ (tagesspiegel); „Schallende Ohrfeige: Deutsche Wohnen kassiert erneut Niederlage vor Gericht“ (berliner-zeitung) „Stefan Aust hat ne gute Idee! ‚Warten wir doch, bis der Klimahype abgeklungen ist‘“ (zaronews.world); „Energiewende richtet größeren Schaden an als die Klimaveränderung“ (focus); „Zwölf Millionen Hektar Tropenwald sind weg“ (mdr.de); „Fast ausgestorben: 128 Feldhamster in NRW ausgesetzt“ (Rheinische Post), „Ferkel flüchtet aus Tiertransporter und findet ein neues Zuhause“ (der stern).
.

Die Aussicht genießen (1)
.
Dichter Nebel
„Eigentlich ist der Nebel (lat. nebula) nichts anderes als eine Wolke in Bodennähe,“ heißt es auf Wikipedia. Als Realia gibt er nicht viel her, aber als Metapher. Immer mehr Menschen sehen z.B. laut einer Umfrage „ihre Zukunft im Nebel“. Die Jüdische Allgemeine beklagt: „Russland liegt im Nebel“. Die Süddeutsche Zeitung meint, dass die Bundeswehr im afghanischen Kunduz einen „Krieg im Nebel“ führt, während die Rheinische Post den „Krieg im Nebel“ im Jemen ausgemacht hat. Vom „Nebel der Liebe“ sprechen dagegen 17.500 Eheberater im Internet.
Ständig wird im Staat etwas „vernebelt“, um Klarsicht bemühte Journalisten „stochern oft im Nebel“. Nebel kann aber auch Naturgegenstand und Metapher sein. Von Schlachtfeld zu Schlachtfeld, angefangen in Königgrätz 1866 fahren die zwei Protagonisten, ein alter Mann und ein Altenpfleger, in dem Roman von Jaroslav Rudis „Winterbergs letzte Reise“ durch „Österreich-Ungarn“:mit dem Zug, einmal auch im Schienenersatzverkehr mit dem Bus. Auf fast jedem Schlachtfeld liegt Nebel (in Austerlitz lichtete er sich allerdings).
Der Altenpfleger ist als Jugendlicher aus der CSSR geflüchtet. Er kommt aus Winterberg (heute Vinperk) im Böhmerwald. Der alte Mann kommt aus der ehemaligen Hauptstadt der Sudetendeutschen Reichenberg (heute Liberec), im Krieg war er Lokführer in Peenemünde, später Straßenbahnfahrer in Westberlin. Er hat „historische Anfälle“, dann redet er ununterbrochen, wobei er sich auf den Baedeker von 1913 bezieht. Dieses großteils auswendig gelernte Wissen durchdringt den „Nebel“, der schon gleich zu Beginn über dem Schlachtfeld von Königgrätz liegt, aber es klärt ihn „nicht wirklich“ auf. Dafür erklären sich die beiden während ihrer Zugfahrten durch Mitteleuropa.
Der Autor, Jaroslav Rudis, wurde mit einer Graphic Novel bekannt, die nicht zufällig „Alois Nebel“ heißt, sie wurde verfilmt und filmisch nachgezeichnet. Es geht darin um einen Bahnbeamten, der im Altvatergebirge Vorsteher eines kleinen Bahnhofs ist: Alois Nebel erschließt sich durch einen Fremden ein Mord während der Vertreibung der Deutschen aus der CSSR im Altvatergebirge. Seine Erinnerungen kommen ihm wieder.
Jaroslav Rudis hat es ohne Zweifel mit dem Nebel und seiner Durchdringung. In „Winterbergs letzte Reise“ geht es dem alten Mann u.a. um seine Jugendliebe, die er nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Reichenberg als „Jüdin“ in Stich ließ – „verriet“. Im heutigen Liberec gibt es eine Gruppe: „Antikomplex“, die sich mit solchen Geschichten befasst, und darüber auch ein Buch veröffentlicht hat.
In beiden Geschichten – „Alois Nebel“ und „Winterberg..“ geht es um das Lichten vernebelter Kriegs-Erlebnisses. Der Autor hatte zuletzteine Gastprofessur an der Humboldt-Universität und der Roman ist der erste, den er auf Deutsch schrieb. Für seine „zeitgemäße Auseinandersetzung mit der jüngeren Geschichte des Sudetengebiets“ erhielt Rudis 2015 den Ehrenpreis des „Georg-Dehio-Kulturpreises des Deutschen Kulturforums östliches Europa“. Dehio war ein Kunsthistoriker, der die heute „dominierende Konzeption des Denkmalschutzes“ durchsetzte. Sein „Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler“ nennt man „den Dehio, er wird bis heute aktualisiert. Auch die Zugfahrt des alten Mannes und seines Altenpflegers führt sie zu einem Kunstdenkmal: dem „beautiful landscape of battlefields, cemetries and ruins“, wie ein Engländer die böhmische Landschaft und drumherum bezeichnete, als er den alten Mann traf, der ihm erzählte und „wie er sich im Nebel der Geschichte verlor“.
Alois Nebel hat als Vorsteher eines winzigen Bahnhofs ein Vorbild – in Wirklichkeit und im Roman: Bohumil Hrabal, der Schriftsteller, und seine Geschichte „Reise nach Sondervorschrift. Zuglauf überwacht“. Er war von den Deutschen als Zugabfertiger auf dem kleinen Bahnhof Kostomlaty zwangsverpflichtet worden, nachdem Heydrich die tschechischen Universitäten geschlossen hatte und Hrabal sein Jurastudium abbrechen mußte.
In Reichenberg/Liberec gibt es einen „Hausberg“, den Jested, auf dem sich ein Berghotel und eine Wetterstation befinden, in dieser betreibt der Hausmeister Wolkenforschung. Wenn der Berg nicht ständig im Nebel liegen würde, hätte man eine großartige Ausschicht von dort. Der Wolkenforscher ist der Protagonist des Romans und des Films „Grand-Hotel“ von Jaroslav Rudis. Er möchte mit einem selbstgebauten Heißluftballon weg – den Nebel und Liberec hinter sich lassen. Er scheitert aber schon beim Abflug. Das ist ziemlich romantisch – unpolitisch gedacht. Es ging damals dem Autor noch nicht darum, „historisch durchzuschauen wie seinem „Winterberg“ dann – im längst vom Nebel verschluckten Schlachtenlärm.
Anders der „O-Ton“ des Großvaters in dem Roman „Kohlenhund“ (2018) des saaländischen Autors Andreas H. Drescher: „Orel [1943]. Unter Beschuss. Am Anfang zuckt man zusammen bei jedem Einschlag. Dann stumpft man ab, einfach davon, in den Nebel zu starren und immer Russen auf sich zukommen zu sehen. Nebel, das ist das Schlimmste. Bei Nebel braucht man sich nur die Füße zu vertreten im Schnee und schon hört man sie hinter sich.“ Und wenn dann zu Hause auf dem Dorf der Enkel mit dem Großvater „in den dunstigen Schwaden übers Feld“ geht. „Dann lag Orel um uns. Sich nicht mehr auf seine Augen verlassen können.Allein sein mit den Schemen. Und mit dem, was in den Ohren passiert. Weil im Nebel, in einem wirklichen, dichten Nebel die Geräusche von überall gleichzeitig zu kommen scheinen…“
Andere „Kämpfe“ kennen noch einen ganz anderen Nebel – die der ukrainischen Intelligenz um Eigenstaatlichkeit z.B.. So verbrachte Wjatscheslaw Lypynskyj den Winter 1906 „wie in einem leichten, wohligen Nebel“. Er fühlte sich „in diesem Nebel sicher. Seine Sehnsucht nach dem Unerreichbaren löste sich in nichts auf,“ schreibt Tanja Maljartschuk in ihrem Roman „Blauwal der Erinnerung“ (2019).
P.S.: Erwähnt sei noch das Buch „Der Meteorologe“ des ausgezeichneten französischen Schriftstellers Olivier Rolin, der viele Recherchereisen, vor allem nach Russland unternahm und unternimmt. Mit dem Meteorologen ist Alexej Wangenheim gemeint, über den es im Klappentext heißt: „Alexei Wangenheims Fachgebiet waren die Wolken. Überall in der UdSSR war man auf seine Vorhersagen angewiesen, damit Flugzeuge sicher landeten, Schiffe ihren Weg durchs Polarmeer fanden und die Kolchosen rechtzeitig die Ernte einfahren konnten. Bei der einsetzenden Eroberung des Weltraums erforschten seine Messinstrumente die Stratosphäre, er träumte von der Nutzung von Wind- und Sonnenenergie und glaubte an die Zukunft des Sozialismus – auch noch, als er aus unerfindlichen Gründen als ‚Saboteur‘ verhaftet wurde und sein Leben fortan dem Tod geweiht war.“ Wangenheim war auf der Solowski-Insel interniert, u.a. mit dem Universalgenie Pawel Florenski, mit dem zusammen er auch erschossen wurde.
.

Die Aussicht genießen (2)
.
Geldbeschaffungsmaßnahmen (GBM)
Seit es keine ABM – Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen – mehr gibt, aber jede Menge Idiotenkurse vom Jobcenter für Computerkenntnisse, denken sich immer mehr Leute weltweit GBM – Geldbeschaffungsmaßnahmen – aus. Man ist inzwischen schon froh, wenn die nicht mit Handfeuerwaffen in Angriff genommen werden, sondern mit IT – intelligenter Technik. Um aber über das Internet auf betrügerische Weise an Geld ranzukommen, braucht es eine Geschichte – und diese Geschichten müssen auch noch ständig verbessert werden. Das ist so ähnlich wie mit dem Hacken von fremden Daten, dabei muß man immer mehr Programmierintelligenz entwickeln. Hier wie dort ist es ein Ratrace. Bei den Geschichten, um Geld reinzukriegen, heißt das, dass sie nicht nur immer wieder neu sein müssen, sondern auch immer länger werden. Hier die letzte Betrugsmail:
„Guten Morgen, mit Tränen schreibe ich Ihnen heute, Bitte ignoriere meine Nachricht nicht. Ich bete darum, dass meine Entscheidung, Sie zu kontaktieren, echte Zustimmung findet. Mein Name ist Naomi Andre, ich möchte eine Investition und eine vertrauliche Geschäftsbeziehung mit Ihnen haben. Aufgrund meiner Situation und der Probleme, die ich heute habe, habe ich beschlossen, mich Ihnen als meinen ausländischen Geschäftspartner anzuvertrauen, weil ich es nicht weiß Viel über Investitionen, ich brauche jemanden, der mir hilft, dieses Geld in eine rentable Investition zu investieren, aber bevor wir weitermachen, müssen wir uns sehr gut kennen, um mehr Vertrauen aufzubauen. Ich möchte nicht, dass Sie mich betrügen, nachdem Sie das Geld auf Ihrem Konto erhalten haben. Lass mich dir mehr über mich erzählen und wie ich das Geld bekommen habe, um zu beweisen, dass das Geld echt und echt ist. Als ich klein war, verlor ich meine Mutter und lebte seitdem mit meinem Vater und seiner zweiten Frau zusammen. Vor ein paar Monaten wurde mein Vater ermordet. Nach dem Tod meines verstorbenen Vaters Meine Stiefmutter (die zweite Frau) war an Brustkrebs erkrankt und der Arzt sagte, dass sie sofort eine schwere / tödliche Krebsoperation durchführen werden, da die Krankheit schlimmer geworden ist und tief in ihren Körper eingedrungen ist. Vor der Operation war ich im Krankenhaus und sie erzählte mir, dass mein verstorbener Vater den Betrag von 4,5 Millionen US-Dollar bei der Bank hinterlegt und meinen Namen als Angehöriger verwendet hatte, damit das Geld für die Erdölgesellschaft bestimmt war, die mein Vater wollte im Ausland zu bauen, aber seine Verwandten ermordeten ihn und übernehmen alle seine Eigenschaften. Sie sagte, wenn ihr während der Operation etwas passiert, werden die Verwandten, die meinen Vater ermordet haben, mich angreifen, um das Geld von mir zu fordern. Ich bin nicht gerettet in diesem Land. Sie riet mir, eine ehrliche Person zu suchen, die mir hilft, das Geld für Investitionen ins Ausland zu überweisen. Ich sollte dieses Land verlassen, um ein neues Leben zu beginnen und auch meine Ausbildung fortzusetzen. Sie starb vor einer Motte, weil sie überlebte die Operation nicht.
Ich bin der einzige in der Familie, und die Verwandten meines Vaters sind nach meinem Leben. Meine einzige Möglichkeit ist, dieses Geld zu überweisen und dieses Land zu verlassen und mit Ihnen in Ihrem Land ein neues Leben zu beginnen und meine Ausbildung fortzusetzen. Die Bank hat zugestimmt, das Geld zu überweisen. Dies ist der Grund, warum ich Sie kontaktiert habe, um mir zu helfen, das Geld zu erhalten. Die Dinge waren sehr schwierig für mich, die Verwandten haben alle Besitztümer meines verstorbenen Vaters beschlagnahmt und sie haben meine Schulgebühren nicht mehr bezahlt, weil ich mich geweigert habe, ihnen die Hinterlegungsurkunde meines verstorbenen Vaters zu geben. Das Leid und die Demütigung waren zu groß und ich entschied mich, in einem lokalen Hotel zu übernachten, wo ich eine Unterkunft für meine Sicherheit fand. Ich habe die Dokumente bei mir und bin bereit, Ihnen alle Informationen zu geben, die Sie brauchen. Ich gebe Ihnen 20% und die restlichen 80% für meine Investition. Es fällt mir nicht schwer, mir zu helfen. Ich bin bereit, Sie der Bank als meinen ausländischen Partner vorzustellen, der das Geld für Investitionen erhält. Sie können in unser Land kommen und ich werde Sie dann zur Bank bringen Die Überweisung gehen wir gemeinsam in Ihr Land zurück. Bitte erzähle mir mehr über dich selbst und wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du mich gerne fragen und ich werde dir antworten. Ich schreibe Ihnen mit gebührendem Respekt, Vertrauen und Menschlichkeit und ich warte darauf, von Ihnen zu hören. Freundliche Grüße, Naomi.
Bitte antworten Sie auf meine E-Mail (naomiandrem@gmail.com).“
.

Picknickpause (1)
.
Misanthropozän-News (2)
„Katze mit vier Ohren Geboren. Sie heißt Yoda“ (twistedsifter.com); „Öko-Strom-Irrsinn Dieser Windpark an der Nordsee wird mit Diesel betrieben!“ (bild.de); „Alarm: Studie findet krebserregende Chemikalien in Budweiser-, Miller-, Heineken- und anderen Biersorten“ (theepochtimes.com); „Wenn wir erregt, aber nicht feucht sind, ist das keine Katastrophe. Gleitgel lässt sich spielerisch ins Liebesspiel einbauen. Lasst uns offen reden!“ (brigitte.de); Sozialunternehmerin über Altkleider: ‚Berlin hat ein Textilproblem‘“ (taz); „Die AfD ist nicht übermächtig“ (tagesspiegel); „Warum heute keine Revolution mehr möglich ist“ (sueddeutsche zeitung); „Ein Erotikmodel sammelt 20.000 Unterschriften gegen altbackene Kleiderregeln in japanischen Unternehmen“ (taz); „ARD-Doku: Bau einer E-Auto-Batterie erzeugt 17 Tonnen CO2“ (focus.de); „Forscher: Stille ist viel wichtiger für Dein Gehirn als Du denkst“ (mymonkde); „Deutsche Bank beschlagnahmt 20 Tonnen Gold von Venezuela“ (deutsche-wirtschafts-nachrichten.de); „Eine Studie legt nahe, dass ein genveränderter Pilz 99 Prozent aller Malariamücken tötet“ (bbc.com); „Ende der Menschheit ab 2050: In nur 30 Jahren könnte uns die Auslöschung drohen“ (futurezone.de); „Glaubt ihr, dass es einen 3. Weltkrieg geben wird?“ (stern.de); „Warum interessiert sich niemand für den Mord an Walter Lübcke?“ (perspektive-online.net); „Ausgerechnet in der Heimat von Greta Thunberg rutschen die Grünen ab“ (focus.de); „Globale Erwärmung : Ist der Klimawandel nichts als Schwindel?“ (FAZ)„Spektakuläre Idee: Eine Seilbahn von Elmshorn nach Hamburg“ (Hamburger Abendblatt); „Plumploris – ETN startet Kampagne zur Rettung der bedrohten Primaten“ (etnev.de); „Wasserstoff wird Antrieb der Zukunft“ (Hamburger Abendblatt); „Schwimmunterricht:
Wernigerode stockt Kurse für Kinder auf“ (volksstimme.de); „Nobelpreisträger Joe Stiglitz: ‚Der Klimawandel ist unser Dritter Weltkrieg‘“ (welt.de); „In 50 Jahren droht der stumme Frühling“ (merkur.de); „Neues Gesetz: US-Bundesstaat will Kinderschänder zukünftig kastrieren“ (bild.de); „Forscher: So kämpften Grüne jahrelang für freien Kinder-Sex“ (focus.de); „Grüne Welle: Im Deutschen Bundestag gibt es fast nur noch Klima-Retter“ (Neue Zürcher Zeitung); „Oberhausener ISI-Oma stirbt bei Schlacht in Syrien“ (BILD); „Verfassungsschützerin: Islamismus bleibt größte Bedrohung“ (n-tv), „Trump über Migranten : „Das sind keine Menschen, das sind Tiere“ (FAZ), „Asylverschärfung 22 Organisationen warnen in einem offenen Brief“ (spiegel.de); „Nordstrom verkauft schmutzige Jeans für 425 Dollar das Stück“ (wideopencountry.com); „Adolf Hitlers Unterhose versteigert (seit 1938 ungewaschen) für 6700 Dollar“ (Hessisch-Niedersächsische Allgemeine); „Rettungseinsatz in Leipzig: Vermieter lässt Küken lebendig einmauern“ (t-online.de); „Anschlag auf Moschee in Dresden: Täter auf der Flucht“ (tag24.de); „Pfarrer fordert Gratis-Prostituierte für Asylbewerber“ (focus.de); Ministerium will Mutter und Vater durch Elternteil 1 und 2 ersetzen“ (bz-berlin); „Weltrekord erreicht: Binz hat die höchste Sandburg der Welt (ostsee-Zeitung.de); „Bundestag stimmt Abgabe des Dragonerpferdeställe an Berlin zu“ (rbb24.de); „Polizei fixiert Unschuldige in Köln: Rennende Muslime? Gefährlich!“ (taz); „Bekenntnisse einer Klimaleugnerin“ (Rotary-Magazin); „Streit über Erderwärmung Angesehener: Meteorologe wechselt zu den Klimaskeptikern“ (spiegel.de); „Klima-Prognose 2050: ‚Hohe Wahrscheinlichkeit, dass die menschliche Zivilisation endet‘“ (utopia.de); „Alles beginnt mit Herkunft – weshalb Ostdeutschland sich zur Provokation entwickelt“ (nzz.ch); „Die jungen Superreichen im Silicon Valley fürchten den Aufstand der Armen“ (stern.de); „Sie hat drei Stard des Silicon Valley großgezogen. Jetzt erzählt sie, wie das geht“ (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung); „Neues Gesetz in Kanada verbietet Gefangenschaft von Walen und Delfinen“ (bewusst-vegan-froh.de); „Horst Seehofer: ‚Man muss Gesetze kompliziert machen, dann fällt das nicht so auf““ (stern.de); „Temperatur des Monds ist gestiegen – nun ist klar, dass Apollo-Missionen schuld sind“ (focus.de); „Saudi-Arabien richtet fünf schwule Männer hin“ (mena-watch.com); „Trump kritisiert NASA und behauptet, der Mond ist ein Teil vom Mars“ (theguardian.com); „Greta Thunberg`s Eltern-‘Knallharte Geschäftemacherei mit dem Klimaschutz‘“ (fischundfleisch.com); „Lidl verramscht Grillfleisch aus Südamerika: Jetzt reicht’s deutschen Bauern“ (focus.de); „Ratingagentur stuft Mexikos staatlichen Öl-Konzern Pemex auf Ramsch herunter“ (handelsblatt.com); „Angriff auf Aldi und Co.: Russischer Ramsch-Discounter kommt nach Deutschland“ (tag24.de); „Todes-Stau am Mount Everest“ (BILD); „Start-Up: Kölner Unternehmen setzt Millionen mit Cannabis um“ (Kölner Stadt-Anzeiger); ‚“Kamerun ließ 55.000 Hektar Regenwald fällen“ (greenworldwarriors.com).
.

Skiurlaub
.
Bücher
In meiner JW-Kolumne „Wirtschaft als das Leben selbst“ gestand ich: Viel zu oft ist hier von Büchern die Rede und nicht vom „Leben selbst“, das läßt sich mit einem Satz des amerikanischen Kommunikationsforschers an der Pariser Universität Jim Haynes erklären: „A book a Day Keeps Reality away.“ Der Semiologe Roland Barthes, der ebenfalls in Paris lehrte,meinte, der Schriftsteller ist zum Sinn verurteilt, auch wenn er selbst von Sinnen sein sollte. Wenn einem also „draußen“ alles zunehmend unsinniger, um nicht zu sagen sinnloser vorkommt, der „Sinn des Lebens“ schwindet, dann flüchtet man sich ins Buch. Die Lesewut: Zu erinnern sei nur an all die adligen jungen Damen, die zu Hause hockten und quasi auf Erlösung durch einen Prinzen warteten. Sie lasen und bildeten den ersten wirtschaftlich interessanten Markt für Romane. Auch viele Pfarrerstöchter waren darunter. Als Goethe seinen Briefroman „Die Leiden des jungen Werther“ veröffentlichte, identifizierten sich derart viele junge Leute mit dem Romanhelden, dass man vom Ausbruch eines „Werther-Fiebers“ sprach. Der Dichter erlaubte sich das Geständnis: „Ich schreibe eigentlich nur für jungeFrauen!“
Inzwischen schreiben die Frauen längst zurück. Ein Buch im Jahr veröffentlichen hält die Realität fern, wobei die meisten Bücher natürlich über Bücher geschrieben werden, wie der Pariser Philosoph Michel Foucault anmerkte. Eine amerikanische Eliteuniversität hatte bereits in den Siebzigerjahren ihr Ausleihsystem elektronisiert. Quasi blitzschnell gelangte das gewünschte Buch vom Magazin in den Lesesaal, wo ein Diener es dem „Nutzer“ auf einem silbernen Tablett an den Platz brachte. Der Kulturwissenschaftler Markus Krajewski hat diesen „Service“ nach Inaugenscheinnahme in sein Buch „Der Diener: Mediengeschichte einer Figur zwischen König und Client“ (2010) eingearbeitet. Sein Dienerbegriff zielt auf den „Server“ ab.
Viele Berliner Bibliotheken geben oder gaben eigene Zeitungen heraus. Wir lasen früher gerne die der FU-Bibliothek (wo gelegentlich auch die Privatbibliotheken von Gelehrten landen) und in der u.a. der jüngst verstorbene Widerstandshistoriker Hans-Dieter Heilmann längere Artikel veröffentlichte. Heute gibt es sie wahrscheinlich nur noch „online“. Lesesüchtige und solche, die auf dem besten Wege dahin sind, brauchen jedoch den „Stoff“ in fester Form – zum Anfassen, Umblättern und Mitnehmen. „Unter dem Schlagwort der Lesesucht wurde im ausgehenden 18. Jahrhundert die Debatte um falsche Lektüre und gefährliche Literatur geführt,“ heißt es auf Wikipedia. „Den ersten Beleg für das Wort ‚Lesesucht‘ fand man in Rudolf Wilhelm Zobels ‚Briefen über die Erziehung der Frauenzimmer‘ 1773. Später wurde der Begriff fester Bestandteil aufklärerischer sowie gegenaufklärerischer Schriften. Die Vertreter der Aufklärung bemängelten, dass die Roman-Lektüre bloß dazu missbraucht werden würde, Langeweile zu verhindern.“ In Russland wußten die „Frauenzimmer“ beim Aufkommen von interessanten Gefühlen oft nicht, ob es wahre Gefühle waren oder bei Puschkin angelesene. Der Hamburger Dichter Peter Rühmkorf seufzte: „Ach könnte man doch seine angelesenen Gedanken vererben“ – mit dem Samen und nicht nur mit den hinterlassenen Büchern.
Die Literaturkritikerin Sabine Vogel hat sich in den Stadtbibliotheken Berlins umgesehen: Mal gucken, wer dort alles so am Buch arbeitet. In der wunderschönen Bibliothek in Schöneweide sieht sie „einen dünnen jungen Mann, der vor einem Bildschirm kauert: Sein Hab und Gut quillt aus einem Rucksack, den er irgendwie hereingeschmuggelt hat. Vielleicht kennt man ihn hier, er schreibt an seinen Blog über das Leben auf der Straße. Die Bibliothek ist sein Büro, sein Denkraum, sein Wohnzimmer, der Rückzugsort für sein Selbst. Hier hat er einer Weile Ruhe vor den Zumutungen der Welt.“
In der Kreuzberger Amerika-Gedenkbibliothek sieht sie ein tuschelndes Liebespaar: „Blicke und Beine haben sie fest ineinander verflochten. Sie himmeln sich an, die Außenwelt existiert nicht mehr. Sie tun nicht mal so, als seien sie hierher gekommen, um irgendeine der Millionen ‚Medieneinheiten‘ zu nutzen.
Die Vielleserin Sabine Vogel ist selbst eine Nutzerin von Stadtbibliotheken, sie schreibt: „So wie die Stadtbibliotheken manch Unbehaustem als Wärmestube dienen, sind sie mir Wärmestuben der Seele. Hört sich kitschig an, aber Bücher, besonders jene, die so schön Belletristik heißen, sind eben auch Schatztruhen der Gefühle.“
Ich bin meistens schneller mit dem Erwerb von bestimmten Büchern als es die Anschaffungspolitik der Stadt- und Staatsbibliotheken schafft, höchstens, dass ich deren Kataloge im Internet nutze. Die Stabi-West am Kulturforum hat übrigens auch elektronisch aufgerüstet, mindestens am Schalter für die Neuausstellung eines abgelaufenen Nutzerausweises: Dort wird man dazu sogleich von links oben fotografiert und das Bild in den neuen Leseausweis kopiert, für den man dann bezahlen muß. Denn, wie die Kulturpolitikerin Johanna Rumschöttel in dem Reader „Bibliotheken strategisch steuern“ (2011) schreibt: „Mit Investitionen sieht es in den deutschen Bibliotheken vergleichsweise düster aus. Während in Finnland im Jahr 2009 54,55 Euro und in den USA umgerechnet rund 27 Euro pro Kopf für Bibliotheken ausgegeben wurden, so waren es in Deutschland gerade einmal 8,21 Euro.“ Und die wurden vornehmlich für die Elektronisierung ihrer internen Abläufe ausgegeben – also den Hightech-Konzernen angedient.
.

Die Aussicht genießen (3)
.
Wälder
Der Bestsellerautor Peter Wohlleben, Förster im Revier des Gemeindewaldes von Hümmel in der Eifel, arbeitet daran, aus den unter steigendem Verwertungsdruck stehenden Nutzforsten hier und überall einen „Urwald“ wieder zu machen. Er hat den Bürgermeister hinter sich und bereits zwei Teile des Reviers der Vernutzung entzogen: mit einem von der Industrie gesponsorten Rehabilitationswald und einem „Ruhewald“ – für Bestattungen. JedesBaumgrab ersetzt rein rechnerisch den Verkaufswert einer über 250 Jahre alten Buche.
Wohlleben war zunächst in der staatlichen Forstbürokratie aufgestiegen, hatte dann aber gekündigt und war von der Gemeinde Hümmel als Förster angestellt worden. In seinem Buch „Der Wald“ kritisiert er seine Kollegen, die Förster, und vor allem die Jäger scharf. Dieser durchaus mutige Kampf, der auch körperlich anstrengend für ihn war, bedeutete genaugenommen einen Bruch mit der herkömmlichen Forstwirtschaft bei laufenden Erntemaschinen.
Ihm kam der „Zeitgeist“ zu Hilfe, mindestens insofern sein erstes Buch „Das geheime Leben der Bäume“ jahrelang auf der Bestsellerliste „Sachbuch“ stand und immer wieder neu aufgelegt wird, also reißenden Absatz fand und findet, flankiert inzwischen von mindestens vier weiteren Bestsellern von ihm über den „Superorganismus“ Wald und seine Sicht auf das Neben- und Miteinander der Pflanzen und Tiere dort. Hinzu kommen Hörbücher, Bildbände und TV-Auftritte.
Sein anhaltender Publikumserfolg verdankt sich auch einer genetikmüden Biologie, welche kurz davor ist, sich algorithmisch in Chemie und Physik aufzulösen, schon allein indem laufend Institute der organismischen Biologie aufgelöst werden zugunsten molekulargenetischer Studiengänge. Die Universitäten wollen sogar ihre überflüssig werdenden Botanischen Gärten abstoßen. Als die Uni Saarbrücken das tat, buddelten die darob empörten Bürger quasi über Nacht sämtliche Pflanzen aus, um sie privat zu retten.
Peter Wohlleben ist inzwischen auch Herausgeber einer „Geo“-Zeitschrift mit dem Titel „Wohllebens Welt“. Zum Zeitgeist gehört wesentlich auch ein Gedanke des Meeresbiologen und Regierungsberaters für Meeressäuger, Karsten Brensing: „Um Tiere besser zu verstehen, ist es notwendig, sie zu vermenschlichen,“ schreibt er. Der Erfurter Verhaltensforscher war selbst erschrocken, als er ihn das erste Mal öffentlich äußerte. Peter Wohlleben könnte ihm zustimmen, er argumentiert dabei vor allem aus seiner Praxis als Förster heraus – und dabei soziologisiert und popularisiert er. Er arbeitet an einer Biosoziologie. Dem gegenüber steht die Soziobiologie – eine amerikanische Verhaltensforschung, der die Nazi-Biologie vorausging: Beiden geht es um die Tierforschung als Menschenforschung. Ihnen lösen sich die Sozialwissenschaften in Biologie auf, während Wohlleben umgekehrt verfährt.
Man hat ihm eine „romantische“ Sicht auf Tiere und Pflanzen und eine völlig utopische auf den Wald vorgeworfen. Seine Gegner, allen voran die deutschen Jäger und die postpreußischen Forstbehörden mit ihren Forstwissenschaftlern im Troß, werden parallel zu seinen Buchauflagen auch immer mehr. Seine Waldsicht ist auf furchtlose Weise antidarwinistisch, bzw. lamarckistisch oder – mit den Worten eines ganzen transatlantischen „Netzwerks“ von Tierphilosophen: auf „Companion Species“ hinaus. Das heißt für „sein“ Revier: „Urwald“.
Seine „Romantik“ erinnerte mich an einen Dreizeiler von Nazim Hikmet: „Leben einzeln und frei wie ein Baum/ Und dabei brüderlich wie ein Wald/Diese Sehnsucht ist alt.“ Seine „Utopie“ berührt sich mit der forstwissenschaftlichen Sicht sowjetischer Biologen, die sich statt auf den dortigen Konkurrenzkampf eher auf (symbiotisches) Zusammenwirken konzentrierten: „Es klingt paradox, aber der Wald braucht den Wald,“ so sagte es einer von ihnen, ein Dendrologe, (Baumforscher), er fügte hinzu: „Sonst stünden viel mehr Bäume einzeln, wo sie sich doch angeblich besser entfalten können.“ Der in den Dreißiger und Vierzigerjahren führende Agrarbiologe der UDSSR Trofim D.Lyssenko empfahl bei der Wiederaufforstung gleich die Anpflanzung von Bäumen in „Nestern“. Er begründete dies revolutionsromantisch: „Erst schützen sie sich gegenseitig und dann opfern sich einige für die Gemeinschaft“. Der Forstwissenschaftler G.N. Wyssozki ging nicht ganz so weit, aber auch er unterschied zwischen vegetativem Freund und Feind: Damit z.B. die Eiche gut wachse, dürfe man sie nicht zusammen mit Eschen und Birken anpflanzen, sondern sollte sie „von Freunden umgeben“: Weißdorn, gelbe Akazie und Geißblatt z.B.. Laut dem Wissenschaftsjournalisten M. Iljin lehrte uns bereits der Gärtner Iwan W. Mitschurin, „dass sich im Wald nur die verschiedenen Baumarten bekämpfen, aber nie die gleichen“. Und jetzt lehrt es uns Wohlleben erneut mit seinen Buchen. Anders als die Wälder bei uns wird der russische Wald von der Steppe bedroht, deswegen riet Lyssenko: aus Eiche (Wald) und Weizen (Feld) Verbündete gegen sie zu machen. Seinen Vorschlag begründete er quasi partisanisch: „Wenn einer zwei andere stört, dann lassen sich diese beiden stets, mindestens für einige Zeit, gegen ihren gemeinsamen Feind verbünden.“ Auch für Wohlleben ist der Wald eine „Gesellschaft“ – mit Feinden zuhauf. Ich befürchte jedoch, Ökologie und Ökonomie stehen sich in einem „unversöhnlichen gesellschaftlichen Gegensatz“ gegenüber.
P.S.: In philosophischer Hinsicht wird Wohlleben vom Agrarexperten und Philosophen Emanuele Coccia mit dessen Buch „Die Wurzeln der Welt. Eine Philosophie der Pflanzen“ überboten. Die beiden verbindet jedoch die Zugehörigkeit zu einem „Netzwerk“ engagierter Pflanzenforscher. Dahinter entsteht in sozialer Hinsicht die Angst, das Raus ins Grüne zu verlieren. Island pflanzt jedes Jahr eine Millionen Bäume, in Indien wurden in 12 Stunden 66 Millionen Bäume gepflanzt, in China sogar 6 Milliarden, auf den Philipinen muß jeder, der studieren will, erst mal 10 Bäume pflanzen.
.

Neue Bekanntschaften machen
.
Die Ostdeutschen an sich und für sich
Der Soziologe und Rektor der Berliner Schauspielhochschule „Ernst Busch“, Wolfgang Engler, hat seit der Wende immer wieder Bücher über die Arbeit und die Ostdeutschen veröffentlicht. Ähnliches gilt für die in Berlin lebende Schriftstellerin Jana Hensel. Jetzt haben die beiden Dialoge über ihre „Erfahrung, ostdeutsch zu sein“ geführt, die als Buch unter dem Titel „Wer wir sind“ erschienen.
Wenn man von den „Befindlichkeiten“ der Ostdeutschen redet, dann ist selten von dem die Rede, was ihnen in den 29 Jahren nach der Wende alles widerfuhr, im Gegenteil: „Die Probleme“, die laut Engler „nach einer gemeinsamen Bestandsaufnahme und Analyse riefen, mutierten unter westdeutscher Diskurshegemonie zu immer neuen Indizien für die Rückständigkeit des Ostens.“ Dabei findet „der überdurchschnittliche Erfolg der AfD in den ‚neuen Ländern‘ seine so gut wie vollständige Erklärung in den Erfahrungen, die die Ostdeutschen nach 1990 sammelten und eben nicht im Rekurs auf ihren vermeintlich obrigkeitsstaatlichen, führerorientierten DDR-Habitus.“
„Wir wurden als Täter und Opfer eingeteilt,“ so sagte es einer während einer Diskussion in Dresden, wo es nun eine „neue Offenheit“ gäbe – dank Pegida. Die FAZ spricht gar von einer „Debattenstadt“, wo zuvor noch das Gefühl herrschte, in der eigenen Stadt nichts zu sagen zu haben, was einen „kollektiven Kränkungszustand“ hervorgerufen habe. Für Wolfgang Engler stand dahinter ein millionenfach vollzogener „Rollenwechsel vom Staatsbürger zum Klienten des Transferstaats“. Hensel liefert dazu Zahlen aus dem Grundstücksmarktbericht 2016: „In Leipzig besitzen nur 10 Prozent der Einwohner eine Immobilie. 60 Prozent aller Neubauten und 94 Prozent der sanierten Altbauten wurden an Menschen verkauft, die nicht aus Leipzig kamen.“ Engler erwähnt Potsdam, wo sich „eine Handvoll westdeutscher Oligarchen der Stadt und ihrer Geschichte bemächtigt hat.“
Wenn man diese Befunde ernst nimmt, so Hensel weiter, „dann muß man leider konstatieren, dass wir es bei Pegida und der AfD auch mit einer Emanzipationsbewegung zu tun haben.“ Deren Parolen allerdings um Nationalismus und Rassismus kreisen.
Vorher gab es das Volkseigentum, Enteignung und Verstaatlichung: die Marktwirtschaft wurde durch die Planwirtschaft ersetzt und die Konkurrenz durch „sozialistischen Wettbewerb“. „Hinfort waren weder Betriebe, die Verluste einfuhren, mit Schließung bedroht, noch mussten Arbeiter und Angestellte um ihre Stellung bangen. In ihrer Gesamtheit waren sie die neuen Herren, kollektive Eigentümer,“ so Wolfgang Engler.
In der ostdeutschen Betriebsräteinitiative, die sich nach der Wende gegen die Abwicklung der Betriebe gründete, entstand die Einschätzung: Die DDR war nicht an zu viel Unfreiheit zugrunde gegangen, sondern an zu viel Freiheit – im Produktionsbereich nämlich. Ersteres bezog sich auf die Partei, letzteres auf die aus Westsicht zu geringe Akkordhetze (in unserem LPG-Bereich z.B. arbeiteten zehn Leute, wir hätten die Aufgaben auch mit der Hälfte erledigen können). Die Treuhandpräsidentin Birgit Breuel nannte diese Brigadegemütlichkeit in den Betrieben des Arbeiter- und Bauernstaates eine „versteckte Arbeitslosigkeit“. Für Engler förderte das „herrenloses Eigentum“ dagegen etwas Neues zu Tage: Geschlechter-, Standes- und Klassengrenzen wurden abgeschliffen, jeder und jedem wurde aufgrund der unantastbaren Stelle ein eigenes Leben ermöglicht und das „Gefühlsleben aus seiner Einbettung in Nützlichkeitserwägungen“ gelöst. Mit dem „Supergau Deutsche Einheit“, wie der Journalist Uwe Müller es nannte, galt all das aber plötzlich nicht mehr, stattdessen wurde ein „prekäres Leben Realität“, dem nun laut Jana Hensel eine „Rebellion von rechts“ folgt.
.

Mit Führer unterwegs
.
Rechnen ist nicht Denken
„Entschuldigen Sie, junger Mann, sind Sie schon umgestellt von analog auf digital?“ fragte mich die junge Frau einer Drückerkolonne auf der Straße. Aber ich fand keine passende Antwort auf ihre unverschämte Anmache. Grübelnd ging ich weiter: Was hat es mit analog und digital eigentlich auf sich? Letzteres kommt von lateinisch digiti, Abzählen mit Fingern, es ist eine Zählpraktik, wie ich einem FAZ-Artikel des Medienwissenschaftlers Markus Krajewski entnahm, der darin die neue Fachrichtung „Digital Humanities“ als ein Bildschirm-Oberflächenforschung kritisierte, insofern sie sich auf die „Anwendung computergestützter Verfahren in der Geistes- und Kulturwissenschaft“ beschränkt, statt sich die Programmiersprache selbst vorzunehmen. Wir werden den Geist nicht los, so lange wir noch an die Kultur glauben, um es mit einem verdrehten Nietzschesatz zu sagen. Hier ist noch ein solcher Satz: „Nichts in der Evolution macht Sinn außer im Licht der Biologie,“ vom Biologen Theodosius Dobzhansky. In der Biologie hat die Digitalisierung über die Gentechnik bereits zu einer profitablen Reduktion auf Chemie und Physik geführt – mit mehr Technikern als Wissenschaftlern. Überhaupt ist ein „Gen“ nichts anderes „als ein Konstrukt für die leichtere Organisation von Daten, es ist nichts mehr als ein X in einem Algorithmus einem Kalkül,“ wie es die Bremer GenEthikerin Silja Samerski in einem Interview sagte. Für Krajewski ist das Ersetzen des Begriffs „industrieller Fortschritt“ durch „digitale Transformation“ Hochstapelei. Mit der sogenannten „digitalen Revolution“ wird also viel Schindluder getrieben und Bauernfängerei. Beides ist bereits eine Analogie (z.B. zu der eingangs erwähnten Drückerkolonne).
Der Frühsozialist Charles Fourier liebte die Analogien. Er schrieb einen Aufsatz über sie, 2011 haben ihn die „Berliner Beiträge zur Kulturwissenschaft ‚Ilinx'“ auf Deutsch veröffentlicht. In den westlichen Romane sind Analogien „rhetorische Figuren“. Aber auch viele Indigene benutzen z.B. statt ein Wort für „Rot“ ein Bild von etwas, das so aussieht „wie eine bestimmte Blüte im Herbst“: Sie haben keine Wörter für Farben. Systematisch hat das der sowjetische Psychologe Alexander Lurija bei den kollektivierten Kleinbauern in einer asiatischen Sowjetrepublik erforscht. Er sah im Fehlen der Farbworte jedoch keine „Differenz“, sondern mangelnde Bildung.
In der Zoologie mag man auch analoge Entwicklungen – wie z.B. bei den Augen, die sich mehrmals bei unterschiedlichen Arten auf ähnliche Weise herausgebildet haben. „Wenn ich an die Augen denke, wird mir ganz schwindlig,“ stöhnte Charles Darwin. Kürzlich schenkte mir jemand einen Band mit Fotos von allen möglichen Augen – es geht darin um ihre „Differenzen“.
Der französische Ethnologe Philippe Descola unterscheidet bei den Gesellschaftsformationen: animistische, totemistische, naturalistische (unsere Gesellschaft) und analogische. Die „Analogie“, so wie er sie versteht, „gründet auf der Idee, dass die Welt aus Unterschieden besteht, die man irgendwie zueinander in Beziehung setzen muß, um Stabilität zu erzeugen. Das Ziel der Analogie ist es, eine Serie von Korrespondenzen zwischen disparaten Elementen der Welt zu etablieren.“
Ist das Entdecken von Analogien nun abendfüllend oder lebensnotwendig? Eine Methode oder eine Lebensweise? Descola interessiert sich zusammen mit dem brasilianischen Ethnologen Eduardo Viveiro de Castro für die „Differenzen“ – nicht innerhalb der Analogie sondern der zwischen „naturalistischen“ und „analogischen“ Weltbildern. In einem Interview erzählte er: „De Castro hat versucht, den Kannibalismus als philosophische und politische Idee zu denken“ – d.h. mit Äußerungen brasilianischer Indigener ein „alternatives philosophisches Modell“ zu erarbeiten: „Eine Kriegsmaschine gegen die westliche Metaphhysik. Eduardo ist da sehr militant.“ Der westliche „Naturalismus“ ist für Descola den anderen drei „Weltanschauungen“ nicht überlegen: „Das ist meine Art, die westliche Metaphysik zu desakralisieren.“
Für den nordamerikanischen Schriftsteller Thomas Pynchon gilt eine andere „Differenz“, wenn er rückblickend meint: „Analog war besser!“ In der New York Times Book Review“ setzte er 1984 jedoch eher auf die Digitalisierung – als er die Frage „Is it o.k. to be a Luddit?“ (so nannten sich einst die englischen Maschinenstürmer) folgendermaßen beantwortete: „Wir leben jetzt, so wird uns gesagt, im Computer-Zeitalter. Wie steht es um das Gespür der Ludditen? Werden Zentraleinheiten dieselbe feindliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen wie einst die Webmaschinen? Ich bezweifle es sehr, aber wenn die Kurven der Erforschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz, Robotern und der Molekularbiologie konvergieren…Jungejunge! Es wird unglaublich und nicht vorherzusagen sein, und selbst die höchsten Tiere wird es, so wollen wir demütig hoffen, die Beine wegschlagen. Es ist bestimmt etwas, worauf sich alle guten Ludditen freuen dürfen, wenn Gott will, dass wir so lange leben sollten.“
Man sollte den Prozeß vielleicht beschleunigen. Kürzlich warnte die Bundeskanzlerin bereits, dass Deutschland den Anschluss an die Digitalisierung verpassen könnte. Während ein Autor in der Neuen Zürcher Zeitung davon überzeugt war, dass es sich dabei um eine neue „Religion“ handelt. Das galt allerdings auch schon für die Analogisierung – erinnert sei nur an den Gedanken „Wie im Himmel und also auch auf Erden“.
.

Autofähre
.
Waldnutzungen
Für die Schriftstellerin Thea Dorn wurzelt Ernst Jüngers Aufsatz „Der Waldgang“ (1951) im Mythosdeutscher Wald; er entwarf darin die „radikalste Verknüpfung von Wald und Freiheit“ in der deutschen Literatur. Das ist zu viel des Guten: Der Offiziersliterat wehrte damit bloß die Amerikanisierung der BRD ab, indem er verbal auf einem Holzweg verschwand. Er lebte in einem oberschwäbischen Forsthaus. Wohingegen der mit ihm geistig verwandte Philosoph Martin Heidegger im Schwarzwald lebte und 1949 einen Aufsatz mit dem Titel „Der Feldweg“ veröffentlichte, auf dem er jedoch einen ähnlichen Gedanken faßte: „Die Gefahr droht, daß, was einmal Heimat hieß, sich auflöst und verfällt.“ In den Zwanzigerjahren bekam er das Angebot, in Japan zu lehren, er entschied sich jedoch, in Deutschland zu bleiben, weil er hier als einer der „geistigen Führer“ gebraucht werde. Immerhin beschäftigte er sich dann mit japanischer Poesie und kommentierte Akira Kurosawas Film „Rashomon“ (Das Lustwäldchen – 1950).
Umgekehrt hat sich die in Bayern lebende japanische Kulturanthropologin Miki Sakamoto mit dem deutschen Wald beschäftigt, indem sie eine ganze Serie von „Waldgängen“ unternahm, die sie nun unter dem Titel „Eintauchen in den Wald“ veröffentlichte. Ihr Eintauchen ist eine „nach außen gerichtete Meditation“, die aus den japanischen Wäldern kommt und dort „Shinrinyoku“ genannt wird. Die Autorin hatte bereits 2007 mit ihrem Mann, dem Ökologen Josef Reichholf, das Buch „Waldzeiten“ veröffentlicht. Sie lebt auf einem Hof nahe Altötting, bei ihren fast täglichen Waldspaziergängen kann sie zwischen verschiedenen Wäldern wählen: „Es gibt Fichtenhochwald, Buchenhochwald und Mischwald im Staatsforst und in Privatwäldern. Hinzu kommen wildwüchsige Hang- und Schluchtwälder und die Auwälder am Fluss“ (der Inn). Sie werden unterschiedlich genutzt, ihr dienen sie zum Wiederfinden eines Gleichgewichts zwischen Körper und Geist oder Bewußtsein, das ist das Meditative an ihren Waldgängen, das nach außen Gerichtete ist eine immer genauere Wahrnehmung der Umgebung – über die Jahreszeiten hinweg. Im Wald lassen sich Zeit und Raum nicht voneinander trennen. Miki Sakamotos Buch ist voll von solchen Wahrnehmungen. Meistens hat sie ihren Hund dabei, wenn sie in den Wald geht, und der ist ebenfalls voll von Wahrnehmungen. Einige kann sie verstehen oder nachvollziehen und teilt sie mit. Ihre eigenen zeugen von einem großen botanischen und zoologischen Waldwissen. Für mich, der ich im Moor groß geworden bin und über kein solches Wissen verfüge, war allein das schon ein Gewinn, hinzu kommt ihre sehr schöne Erzählweise, ein Beispiel: „Eigentlich hatte ich mich nur erfreuen wollen an den ersten Kuckucksrufen. Aber dann kam doch das Wissen um sein Wesen hinzu und erzwang das Nachdenken. Im Weiterdenken finde ich das Gleichgewicht zwischen Hörgenuss und emotionaler Anteilnahme am Schicksal der kleinen Wirtsvögel“ (die das Kuckuckskind auf Kosten ihrer eigenen Brut aufziehen).
Zwischendurch denkt die Autorin auch immer wieder über die menschlichen Nutzer des Waldes nach: „Die freie Zugänglichkeit der Wälder in Deutschland ist etwas Großartiges. Sie bedeutet aber, dass höchst unterschiedliche Lebensstile und Vorstellungen von Nutzung und Erholung in der Natur – etwa von Förstern, Jägern und Radfahrern – mit unter ganz heftig aufeinanderprallen.“ Nicht zu vergessen die völlig auf sich bezogenen Jogger und die mit riesigen lauten Geräten ausgerüsteten Waldarbeiter der Holzkonzerne, die dazu noch überflüssigerweise die blühenden Ränder der Waldwege abmähen. Einerseits schätzt Miki Sakamoto es sehr, in Deutschland „als Individuum zu leben“, andererseits lassen die nicht zu vereinbaren Waldnutzungen sie „manchmal am Individualismus, wie er in Europa herrscht, doch ein wenig zweifeln. Aus diesen Konflikten heraus verstehe ich, warum der Waldgang der Japaner, ihr Shinrinyoku, anders ist als seine Übertragung auf die europäischen Verhältnisse. Am Liebsten hätte ich natürlich das Beste von beidem. Doch das ist ein unrealistischer Wunschtraum.“ Obwohl Shinrinyoku „gesund ist und der Gesellschaft nützt“.
Immerhin rückt der Wald immer mehr in die allgemeine Wahrnehmung. Nicht nur, dass sich Veränderungen in der Forstwirtschaft und -wissenschaft bemerkbar machen (das nicht mehr komplette Entsorgen von Totholz, das Anpflanzen von Mischwäldern und das Lebenlassen von Biber, Füchsen und Wölfen z.B.), es mehren sich auch die Bücher über den Wald. Gerade erschien von Richard Powers ein Buch über „Die Wurzeln des Lebens“ – darüber „wie man sich durch die Schönheit der Wälder radikalisiert“. Zu nennen wären hier außerdem die Bücher des Waldforschers Hans-Jörg Küster und die Bestseller des Forstwirtschaftlers Peter Wohlleben. Letzterer veröffentlichte 2017 eine „Gebrauchsanweisung für den Wald“ – basierend auf seinen „Waldwanderungen“.
Solche und ähnliche „Anweisungen“ liegen Miki Sakamoto fern. Eher könnte man ihr Shinrinyoku (Waldbaden wörtlich übersetzt) als taghelle Waldwahrnehmungen von Tieren, Pflanzen, Geräuschen, Gerüchen, Farben, Überraschungen, Zerstörungen durch Holzkonzerne usw. dem Buch des englischen Anglers Chris Yates „Nachtwandern“ (2019) zur Seite stellen. Es handelt von nächtlichen Wald- und Feld-Spaziergängen. Zum Shinrinyoku gehört, „die Welt der Menschenstimmen“ auszublenden – sie stören. Nachts dagegen nimmt man als Mensch alles vor allem hörend wahr, man muß keine Menschenstimmen ausblenden, man möchte oder muß jedoch Tierstimmen und andere Geräusche identifizieren. Miki Sakamoto schreibt am Ende über den deutschen Wald: „Zu sehr wird überall an ihm herumgewirtschaftet.“ Und sie fragt sich: „Vielleicht passe ich mit meiner japanischen Art gar nicht so gut in die deutschen Wälder.“
.

Waldspaziergang
.
Linum und Drumrum
Analog war besser! Früher, ja früher war alles besser. Da hat die Arbeiter- und Bauern-Republik z.B. die Industrie in die märkischen Ackerbürgerstädtchen und Gutsdörfer geholt, heute müssen die standortverbundenen Bürger morgens zu weit entfernten Autobahnkreuzen fahren, um sich in einem der Dienstleistungszentren zu verdingen, die sich dort verkehrsgünstig angesiedelt haben. Es gibt aber auch, vor allem in den dekollektivierten Dörfern, eine Art kollektive Selbsthilfe: „Sich und sein Pferd am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen – wird zum Schema jeder Erkenntnis, die mehr sein will als bloßer Entwurf,“ wie es Theodor Wiesengrund Adorno so schön sagte.
Nehmen wir das Dorf Linum – in der einstigen Moorlandschaft des Oberen Rhinluchs. Der preußische König beglückte es mit der Anlage von Fischteichen. Aber nach 1989 wurde es eng. Da saß einmal in der Linumer Dorfkneipe „Storchenklause“ ein Frührentner aus Kremmen, wo die Ackerbürger gerade ihr „Scheunenviertel“ gewinnbringend in einen Öko-Künstlerdorf umwandeln ließen. Er meinte: „Die Seen und eure Störche auf den Dächern – mehr Öko hab ich hier erst mal nicht gesehen, aber Öko wäre ne reale Chance.“
Heute gibt es am Orts-ein und am -ausgang Storchennester, die aussehen wie die harmlos-horizontale Alternative zu den senkrecht-säbelnden Windkraftrotoren. Und die immer mehr gewordenen Störche sowie die nicht mehr wirtschaftlich genutzten Fischteiche werden vom deutschen Naturschutzbund NABU „genutzt“, d.h. es gibt auf der Dorfstrasse ein NABU-“Naturschutzzentrum“ namens „Storchenschmiede“, das Exkursionen veranstaltet, mit Bussen von Berlin aus. Vor ihrer Storchenschmiede stehen Holzplastiken von den Vögeln, die man in Linum und Drumherum sehen kann – mit einem guten Fernglas: Störche sowie etliche mehr oder weniger seltene Enten- und Gänsearten. Letztere zu tausenden. Hinzu kommen noch bis zu 100.000 Kraniche, die auf ihrem Zug hier in den Feuchtwiesen Rast machen und ringsum die Felder mit Wintergetreide abernten, d.h. die Blättchen abbeißen und den Boden nach Insekten und Würmern absuchen. Dem Getreide tut das gut (anderswo läßt man Schafherden die Äcker kurz überweiden). Als ich mir am Mittwoch-Abend anschaute, wie die Gänse und Kraniche in riesigen V-Formationen, sich laut unterhaltend zu ihren Schlafplätzen in den Feuchtwiesen zurückkehrten (die Kraniche segelten weite Strecken), und von der untergehenden Sonne am Horizont kommend zur Landung ansetzten, war ich so beeindruckt, dass ich gerne eine Einladung zu einem Obstbrand in der 2. Linumer Kneipe „Kleines Haus“ annahm.
Das Restaurant war brechendvoll mit „Birdwatchern“, an den Wochenenden findet man im ganzen Umkreis keinen Parkplatz. Das muß man sich mal vorstellen! Es gibt als 3. Kneipe noch die ebenfalls empfehlenswerte „Fischerhütte“ – nicht weit von den Teichen. Man kann von dort aus mit kleinen Yachten Wasservögel-Exkursionen unternehmen. Und dann ist da noch „Rixmanns Hofladen im Storchendorf“.
Das Stadtportal „berlin.de“ bewirbt Linum als „das zweitgrößte Storchendorf Brandenburgs“. Im Vorfeld gab es Gerangel um den ersten Platz, bis eine genaue, quasi „objektive“ Zählung ergab, dass im Prignitzdorf Rühstädt noch mehr („über 30 Paare“) brüten, es darf sich nun zu Recht als „Europäisches Storchendorf“ bezeichnen – in seinen Tourismusanzeigen.
Ja, heute steht jedes Dorf, das aus dem Kreislauf des Werdens und Vergehens ausbrechen und „nach vorne schauen“ will, in Konkurrenz zu Millionen anderen Dörfern (weltweit), die um Alleinstehungsmerkmale ringen, um Authentizität – eine, die mehr als eine ansprechende Gebietskulisse ist. Das Problem haben heute selbst Dschungeldörfer am Amazonas, die sich ebenfalls gegen das Vergehen stemmen. Linum ist gut dafür aufgestellt: Es hat nicht nur im Frühjahr eine Storchensaison, sondern im Herbst auch noch eine Kranichsaison, Das Brutgeschehen der Störche kann man über Webcams im Internet verfolgen, über die täglich wechselnde Zahl der zigtausend Kraniche über Linum informiert „vogel.komitee.de“.
Auf dem Hinweg nach Linum hatten wir auf der Straußenfarm von Bauer Winkler im Ruppiner Seenland Rast gemacht. Als ich das letzte Mal dort war, erklärte er gerade einer Bus-Reisegruppe mit Rentnern aus Berlin, wie er einen ausgewachsenen Strauß dazu „überredet“, sich von ihm zum nächsten Schlachthof bringen zu lassen. Jetzt besaß er bereits einen eigenen „Straußenschlachthof“ und ein schönes Café mit Blick auf fast 100 kleine Strauße in mehreren Gehegen. Die größten, pubertierenden, tanzten, indem sie sich umeinander und um sich selbst drehten. Sie machten einen glücklichen Eindruck, oder wir jedenfalls – ihnen bei Kaffee und Kuchen zuguckend. Bauer Winkler hat auch noch einen „Hofladen“, in dem „Täschnerwaren und modische Accesoirs aus Straußenleder, Straußenfedern und Staubwedel, Eier- und Federschmuck oder Lampen aus Straußeneiern“ angeboten werden. Er besitzt darüberhinaus fünf Islandponys und offeriert „Kutsch-Kremserfahrten“. Sein Hof ist eine sich diversifizierende Existenzgründung für immer mehr „Marktlücken“.
Es war ansonsten ein Tag der Großvögel. Nachts auf dem Rückweg kamen wir an einigen hell erleuchteten Protzneubauten vorbei – Spezialkliniken sowie Reha- und Kurhotels, die trotz ihrer nächtlichen Ausstrahlung alle wie Investitionsruinen wirkten. Meine Begleiter, passionierte Spinnenforscher, schimpften: „In der BRD gibt es allein 7 Millionen Straßenlaternen, eine Milliarde Insekten sterben daran jede Nacht. Müssen die hier mitten im Wald auch noch so einen Lichtzauber veranstalten…“
.

Schattiges Plätzchen
.
Oberschöneweide
Auch das bis 1989 größte Berliner Industriegebiet Oberschöneweide, von Rathenau einst gegründet, dann von der Treuhandanstalt „abgewickelt“, soll nun touristisch erschlossen werden, nachdem das Gros der Neonazis das zu Köpenick gehörende Viertel verlassen hat. Es gibt dort schon ein paar kleine Öko-Cafés und seit einigen Jahren einen „Industriesalon“, der zugleich ein Industriemuseum ist. Dorthin gelangten die materiellen Reste von den DDR-Großbetrieben ringsum als Exponate. Vor allem die des Werks für Fernsehelektronik (WF), das einige seiner Produkte bereits zu DDR-Zeiten selbst musealisiert hatte (z.B. einen großen Mikrowellenherd aus dem Jahr 1968 und einige Störsender). Neben dem WF gab es in Oberschöneweide noch das Transformatorenwerk (TRO), das Kabelwerk Oberspree (KWO) und das Batteriewerk (BAE). Letzteres wurde nach 1989 zu Teilen von seinen Geschäftsführern privatisiert und produziert noch heute. Die anderen Großbetriebe wurden erst von Westkonzernen „übernommen“ und dann „abgewickelt“. Zuletzt hatten dort über 30.000 Menschen gearbeitet.
Beim letzten „Salongespräch“ (am 11.April), veranstaltet vom Unternehmerkreis Schöneweide und dem Regionalmanagement Berlin Südost ging es um drei Ausgründungen – von zwei Ingenieuren und einer Chemikerin aus dem WF. Sie schilderten sehr schön ihren Weg seit 1991 „vom Umbruch zum Aufbruch“, ebenso ein Physiker des WF, er beschäftigt sich heute in einem staatlichen Forschungslabor in Adlershof mit Leuchtdioden, die ultraviolettes Licht abstrahlen (z.B. zum Härten von Kunststoff). Die Firmen der anderen drei WF-Intelligenzler sind mit ähnlicher Technologie befaßt – mit Lichtsensoren z.B. zur Fahrgastzählung (im WF waren sie in der Halbleiterentwicklung tätig, konkret mit Infrarot-Dioden). Zusammen beschäftigen sie heute wieder 300 Mitarbeiter; in der Firma der Chemikerin sind von sieben Führungskräften fünf Frauen, sie selbst sitzt noch in einem Beratergremium der Bundeskanzlerin.
Die drei Unternehmen sind „Staat-Ups“, ihre Entstehung verlief ähnlich: „Kurzarbeit Null“, ABM, Vereinsgründung, Fördermittel vom Ministerium für Forschung, Bank-Kredite, Grundstück erschließen, Firmengebäude mit Reinraum errichten, europäische Projekte angehen…
Irgendwann waren sie so erfolgreich, dass z.B. die Dresdner Bank sie nicht weiter finanzieren wollte: In der „Halbleiterei“ kostet jede Maschine über eine Million. Aber der Mark ist groß und global und „optische Sensoren stecken überall mit drin“. Einer der drei Unternehmer brachte seine Firma 1999 zusammen mit einem Investor an die Börse. Als es gut lief (160 Mitarbeiter, einen Umsatz von 180 Millionen und mehrere zugekaufte Firmen), schmiss der Aufsichtsrat ihn raus. Er ist also heute ein „ehemaliger Geschäftsführer“. Lange konnte er sich mit diesem persönlichen „Umbruch“ zehn Jahre nach dem gesellschaftlichen nicht abfinden.
Die drei Unternehmer waren sich einig, dass ein Teil ihres Erfolgs in der früher engen Verbindung zwischen Wissenschaft und Industrie begründet ist. Diese besteht nach Meinung des Physikers auch in seinem BRD-Institut, insofern es Teil eines Konsortiums von 50 Firmen ist, und in dem es ebenfalls zu Ausgründungen kommt. Im übrigen gab es auch schon im WF „unternehmerisches Denken in Hülle und Fülle“: Alle hatten Projekte, Ideen, „Themen nannte man das“, und die mußten „bis zum Ministerrat hochgeboxt werden, das war auch ein Unternehmerdenken“. Einer der Ingenieure erinnerte sich, das sie zunächst mit der Humboldt-Universität (HUB) zusammengearbeitet hätten. „Es wollte nach der Wende keiner mit uns was zu tun haben, die aus dem Westen wollten nur ihre eigenen Sachen bei uns loswerden.“
Die Kooperation mit der HUB und der TU betrifft heute vor allem die Mathematiker, es geht dabei um Softwareentwicklung. Daneben arbeitet man zunehmend mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) zusammen, die von Karlshorst nach Oberschöneweide in die Gebäude des KWO umgesiedelt wurde, um das devastierte Industriegebiet von staatlicher Seite zu revitalisieren und um nicht alle Hallen und Gebäude den Künstlern zu überlassen. Der neue Campus der HTW wurde mit Zigmillionen aufgemöbelt, dazu die ehemalige Poliklinik in ein schickes Studentenwohnheim umgebaut und eine neue Brücke über die Spree gespannt, so dass die Radfahrer nun wie vor dem Krieg geradewegs zum S-Bahnhof Schöneweide gelangen können. Für die zukünftigen Intelligenzler (die leider heute mit dem unselig-amerikanischen Bachelor-Master-Ausbildungssystem gehandicapt sind, wie einer der Unternehmer meinte, der sich jedoch sicher ist, dass die Diplomingenieur-Studiengänge wiederkommen) gibt es inzwischen auch statt der früheren Schichtarbeiterkneipen, die schon um fünf Uhr morgens aufmachten, einige vegetarische Cafés, sie öffnen um neun.
Nach dem „Salongespräch“ wurde im Industriemuseum eine Ausstellung über die Oberschöneweider Formblatt-Druckerei „Paragon“ gezeigt, die 1911 gegründet wurde und 2019 einem Supermarkt weichen mußte. In einer der Fabrikhallen neben dem Industriesalon eröffnete am selben Abend noch eine zweite Ausstellung mit Fotografien von Roger Melis: „Die Ostdeutschen“. Da tauchten sie noch einmal auf: die Arbeiter. Sogar mit Namen.
.

Busreise (1)
.
Scheiß-Mais
In Schleswig-Holstein wurde gerade die diesjährige Maissaat in den Boden gebracht. Und während die dortige Landbevölkerung bald wieder klagt, dass man, wenn der Mais hoch steht, nichts mehr von derLandschaft sieht – quasi nur noch durch Maistunnel fährt, prüfen die Börsenspekulanten, ob der Turbo-Optionsschein für Mais-Future hält, was er verspricht. Die Daten des US-Landwirtschaftsministeriums legen laut „topagrar“ nahe: „Die weltweite Versorgungslage mit Mais könnte im kommenden Wirtschaftsjahr die knappste seit fast 50 Jahren sein.“ Das freut die Mais-Spekulanten. An den wichtigsten Börsen der Welt wird vorwiegend Körnermais gehandelt, in Frankfurt wurdenletzte Wochefür ein Scheffel (25,4 kg) 3 Dollar 61gezahlt.
In Deutschland wird auf 2,66 Millionen Hektar Mais angebaut, davon sind nur wenige für Körnermais vorgesehen, berichtet „agrarheute“. Auf den meisten Flächen wird Silomais angebaut – für Silagefutter und zur Biogaserzeugung. Das von Bayer produzierte Schädlingsgift „Mesurol“ – zum Beizen von Maissaatgut soll eventuell im Juli verboten werden, „agrarheute“ rät deswegen, das damit imprägnierte Saatgut jetzt schnell „aufzubrauchen“. Ähnliches gilt für das Bayer/Monsanto-Gift Glyphosat, von dem die Bauern weltweit 8,6 Milliarden Kilogramm seit 1974 auf die Raps, Soja- und Mais-Felder sprühten, die Pflanzen wurden gentechnisch gegen das Mittel resistent gemacht. Allein in den USA haben über 1200 Bauern Monsanto angeklagt, dass sie davon Krebs bekommen haben – zwei haben bisher damit Erfolg gehabt, auch je einer in Frankreich und Luxemburg. Man geht in den USA davon aus, dass Bayer/Monsanto an den vielen Schadensersatzklagen zugrunde gehen wird – und das ist auch beabsichtigt, wobei die Bundesregierung die Leverkusener Giftbude aber wohl mit Milliardensummen retten wird. Erst mal nicht zu retten sind die kontaminierten Böden.
Im schleswig-holsteinischen Wacken legt ein Maisbauer zum Vergnügen der Heavy-Metal-Festivalbesucher jedesmal ein „Maislybyrinth“ an. In der UDSSR wurde der „flächendeckende Maisanbau“ vom Bauernsohn Chruschtschow nach seinem Amerikabesuch 1960 forciert, aber bereits im Zweiten Weltkrieg ließ der DDR-Dramatiker Heiner Müller in seinem Stück über die Kollektivierung der Landwirtschaft „Traktor“, das während der Maisaussaat 1975 entstand, deutsche Soldaten einen russischen Bauern als vermeintlichen Partisan durch ein „riesiges Maisfeld“ jagen.
In Ostdeutschland, wo der Maisanbau (von Westlern) noch zunimmt, während er im Westen abnimmt, gibt es nun auch ein „Maislabyrinth“, wenn man der aus Köthen stammenden Schriftstellerin Kathrin Gerlos glauben darf. In ihrem Roman „Nenn mich November“ (2018) befindet sich dies bei einemdahinsiechenden Dorf, das von Maisfeldern umgeben ist, die einem von zwei Wendegewinnern gehören, er füttert damit seine Biogasanlagen („250 Hektar Mais ernähren eine Anlage“). Mit der Gründung einer „Energiegenossenschaft“ hat es nicht geklappt. Nachdem er das Dorfgasthaus gekauft und wiedereröffnet hat, legte er für die möglicherweise zu erwartenden Touristen ein „Maislabyrinth“ an. Der andere Wendegewinner, ein Schweinemäster, kauft ein Stück Land nach dem anderen auf, auch verwaiste Gebäude, und betreibt einen illegalen „Konsum“. Der Rest der schrumpfenden Bevölkerung ist von diesen zwei Großbauern und sogenannten Transferzahlungen abhängig, zum Teil auch alkoholabhängig. Die Väter der zwei hatten das Land einst kollektiviert.
Das Leben im Dorf ging inzwischen „an Krücken oder am Rollator.“ Da der Weitblick seiner Bewohner durch den Mais rundum eingeschränkt wurde, beseelen sie sich die „Maiswüste“. Die Felder werden sowieso gelegentlich belebt: nächtens von Rehen und Wildschweinen z.B. – und einem Arbeitslosen aus dem Dorf, der sie wildert. Bei Wind rascheln die Maisblätter ununterbrochen. DenStimmenhörer, „dessen Stimmen sich ununterbrochen streiten,“ stört das nicht. Ihm hatte der landhungrige Großbauer zwar ein Zimmer in einer Baracke zur Verfügung gestellt, die einst für Zwangsarbeiter errichtet worden war und dann von den Erntehelfern der FDJgenutzt wurde, aber er schlief lieber auf seinem „zweiten Schlaflager im Maislabyrinth“.
Am Anfang sind die Leute aus dem Dorf „oft ins Labyrinth gegangen. Sie haben sich benommen wie kleine Kinder.“ Davor hat ein Kind mit seiner Mutter manchmal im Mais Verstecken gespielt. Aber dann hat es eine Horrorgeschichte von Stephen King gelesen, in dem „das Verderben durch die Maisfelder kommt.“ Seitdem haben die Felder für ihn etwas Bedrohliches. Der Bürgermeister vernichtete das Unkraut auf seinem Hof mit Unmengen Glyphosat („Roundup“) und hat seit drei Wochen Hautausschlag.
Und dann gibt es da noch den „Maismörder“, mancher will ihn gesehen haben, seinen Schatten zumindest. Ein Gruppe Jugendlicher hat ihn in einem leerstehenden Haus laut rumoren gehört. Es wurde viel über ihn geredet, „eine Frau sei verschwunden,“ hieß es, „keine von hier, sondern eine Urlauberin…Am Ende wußte niemand etwas Genaues. Aber der Maismörder war in ihre kleine Welt gekommen und seitdem gab es ihn.“ Mindestens als Maisgespenst.
Der Bauer mit den Biogasanlagenglaubt nicht an sowas, er träumt Nachts von ganz anderen Maismördern, die über seine Felder, über ihn, herfallen: Maiszünsler und Westliche Maiswurzelbohrer – in Massen. Sie haben sich genetisch angepaßt, sich selbst „neu erfunden“, um der neuen Zeit, die mit der „rounduptoleranten Maissorte NK603“ begann, gewachsen zu sein. Das steht nicht in Gerlofs Roman, das weiß ich von erfahrenen Maisanbauern, die noch ganz andere Maisalpträume haben, seit dem um sich greifenden „Ökoquatsch“ und dem sich verdichtenden Krebsgespenst „Glyphosat“.
.

Unser Fahrer (1)
.
Professionelle Obhut
Von „professioneller Obhut“ spricht der Tagesspiegel gerne im Zusammenhang mit exotischen Haustieren wie Flughunde (und andere „Wildtiere“): Sie gehören nicht ins Haus, sondern in „professionelle Obhut“. Z.B. in das Alfred-Brehm Haus des Ostberliner Tierparks, wo eine kleine Kolonie von Flughunden tagsüber in den Bäumen hängt und schläft. Zur professionellen Obhut zählen die dortigen Tierpfleger und der Kurator ebenso wie eine „artgerechte Haltung“, die in diesem Fall aus einer riesigen Halle mit exotischen Pflanzen und Vögeln besteht.
Eine Tierrechtsorganisation teilt mit, sie habe quasi das Gegenteil aufgedeckt, „dass die Betreiber eines Bio-Bauernhofes im baden-württembergischen Ettlingen ihre Tiere unter katastrophalen Umständen und quasi unversorgt halten. Die Landwirte haben seit Juli 2017 zwei Kühe, einen Bullen und sieben Esel auf einer Koppel im benachbarten Malsch-Völkersbach eingesperrt, ohne sie ausreichend zu versorgen.“
Die Obhut ist so viel wie ein „fürsorglicher Schutz“ für jemanden, der kein Angehöriger ist. In Amerika spricht man auch von Adoption (z.B. eines Tieres aus dem Tierheim). Bei den eingefangenen und in Zoos zur Schau gestellten Tieren würde man besser von einer Als-Obhut sprechen. Zumal wenn beim Einfangen einer jungen Raubkatze oder eines Menschenaffen, zunächst die Mutter oder gleich die ganze Familie getötet wurde. Die professionelle Obhut (für exotische Tiere), von der der realvernünftelnde Tagesspiegel gedankenlos spricht, mußte zudem auch erst mühsam von Laien gelernt werden: In Wien fütterte man z.B. Elefanten anfänglich mit Bier und gekochtem Fleisch (zu Tode). Nicht ohne Grund nannte man die Zoos lange Zeit „Sterbezimmer der Museen“, wo die Tiere ausgestopft dann noch einmal zur Schau gestellt wurden.
Der jetzige Direktor des Berliner Naturkundemuseums Johannes Vogel berichtete am „Tag der Insekten“ in seinem Haus: Pro Jahr sterben 58.000 Tierarten aus. Sie, als „Haus des Todes“, in dem viele Millionen tote Tiere liegen, und jährlich 300- bis 400.000 neue hinzukommen, hätten da eine besondere Verantwortung. Die Insektensammlung des Museums, die allein 30 Millionen Tiere umfaßt, soll zukünftig auf Webseiten präsent sein. Hierbei soll das „junge Publikum“ in Obhut genommen werden.
„Die Welt titelte: „Jugendämter: Immer mehr Kinder landen in der Obhut des Staates“. Das gilt auch für Wildtiere: Es gibt bereits mehr Tiger in Gefangenschaft als in Freiheit. Einige Arten gibt es sogar nur noch in Zoologischen Gärten, diese befinden sich allerdings oft in privatem Besitz.
Anders sieht es mit den staatlich ausgewiesenen und unterhaltenen Naturschutzgebieten aus. Hier besteht die Obhut darin, die dort lebenden Tiere vor Wilderern zu schützen und gleichzeitig durch Abschüsse immer wieder ein gewisses Gleichgewicht zwischen den Tierarten herzustellen. Den Naturschützern geht es im Gegensatz zu den Tierschützern nicht um einzelne Tiere, sondern um den „Artenschutz“. So wurden 1996 im Yellowstone-Nationalpark des ökologischen Gleichgewichts wegen 31 Wölfe ausgesetzt, die die Zahl der Wapatihirsche niedrig halten sollten. Die Wölfen rissen zwar gelegentlich auch Nutztiere außerhalb des Nationalparks, aber sie zogen auch viele Touristen an. Die „Yellowstone Science“ rechnete 2008 vor: Die 94.000 Parkbesucher gaben in den drei umliegenden Bundesstaaten rund 35,5 Millionen Dollar im Jahr aus, der Marktwert der von den Wölfen getöteten Nutztiere betrug etwa 65.000 Dollar. Wenn man beides gegeneinander rechnet, „dann führte die Erholung des Wolfsbestandes zu einem Nettogewinn und unmittelbaren Einnahmen in Höhe von 34 Millionen Dollar.“ Ähnliche Güterabwägungen erlauben sich auch die afrikanischen Nationalparks.
Der Philosoph Fahim Amir erwähnt in seinem Buch „Schwein und Zeit‘“ (2018) den „ironischen Artenschutz“: Dabei geht es um große Gebiete, die hochgradig radioaktiv oder chemisch vergiftet sind: Allein in den USA gibt es 3000 solcher „verseuchten Gebiete“, die z.T. hunderte von Quadratkilometer umfassen. Ihre Entgiftung ist unfinanzierbar, Biologen entdeckten dann aber, dass sich gerade in diesen für Menschen offiziell gesperrten Gebieten jede Menge Tiere und Pflanzen ansiedelten – und flugs machte man daraus die „ironischsten Naturparks der Nation“, indem einige Ranger und Wissenschaftler dafür angestellt wurden. Die im „Denver Rocky Mountain Arsenal“ der US-Army (dem giftigsten Ort der USA), auf einem Areal von 69 Quadratkilometern arbeitenden Naturschützer prägten in ihren Broschüren über das dort seit 1984 sich entwickelnde „Wildlife“ diesen Begriff.
Auch das 1986 entstandene riesige Sperrgebiet, die „Todeszone“ um das sowjetische Atomkraftwerk Tschernobyl, ist heute ein „ironischer Naturpark“ – und was für einer: Das Leben dort wird von Biologen aus aller Welt geradezu zerforscht, und daneben werden immer mehr Touristenreisen nach Tschernobyl angeboten, denen man dort „unvergessliche Erlebnisse“ verspricht.
In beiden Fällen kostet die Einrichten und Betreiben eines „Bioreservats“ auf vergifteten Böden nur einen Bruchteil von dem, was ihre Dekontaminierung kosten würde, die zudem die Tiere und Pflanzen wieder daraus vertreiben würde. Für Fahir Amin ist inzwischen erwiesen: „Urbane Natur, radioaktiv verstrahlte Sperrgebiete und Standorte zur Giftgasherstellung weisen eine vielfältigere Natur auf als viele Naturschutzgebiete und Nationalparks.“
.

Busreise (2)
.
Konkret – Abstrakt
Autisten und Tiere – beide haben keine „Zentralperspektive“. In einer Diskussion der Akademie der Wissenschaften in Potsdam über Gemeinsamkeiten zwischen Kunst und Wissenschaft, intervenierte eine Physikerin mit dem „Satz der Identität in der Logik – A gleich A: „Da raus zu kommen“, das sei doch „die wirkliche Aufgabe der Kunst.“ Sie wollte damit sagen, dass Kunst und Wissenschaft ihre Erkenntnisse auf verschiedenen Wegen erreichen – einem der der sinnlichen Intuition nahekommt, und einem, der ihr ferner liegt. Diese Unterscheidung traf bereits Claude Lévi-Strauss in seinem Buch „Das wilde Denken“ – in bezug auf eine indianische „Wissenschaft des Konkreten“ und „unserer Wissenschaft des Abstrakten“.
Für letztere gilt als gesichert, dass die Entstehung und Entwicklung der modernen Naturwissenschaft historisch der Entstehung und Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise zuzuordnen ist. Die moderne Naturwissenschaft bildet die intellektuelle Vorbedingung zur Schaffung der modernen Technik, vornehmlich der Produktionsapparatur. Für den Erkenntnistheoretiker Alfred Sohn-Rethel finden sich die „Vorstadien“ des Frühkapitalismus (im 16. und 17.) schon in der Renaissance: „Gestalten wie Leonardo da Vinci und Albrecht Dürer scheinen geradezu auf der Schwelle beider Zeitalter zu stehen. Auf der einen Seite sind sie noch Handwerker und Künstler, die die Natur sinnlich studieren und sinnlich darstellen durch das Geschick ihrer Hände in der Handhabung ihrer Werkzeuge und Materialien; auf der anderen Seite sind die selben Männer konstruktive Ingenieure, die für ihre Aufgaben Lösungen in abstrakten Begriffen und im unsinnlichen Medium der Mathematik suchen. Die Verbindung von Mathematik und Experiment ist hier jedoch noch tastend und wenig wirksam…“
Lévi-Strauss sieht den Gegensatz zwischen einer neolithischen (konkreten) und einer modernen (abstrakten) „Wissenschaft“ personifiziert im Bastler (Bricolleur) und im Ingenieur. Albrecht Dürer verkörperte noch beides, wollte jedoch die absolute Trennung von Hand- und Kopfarbeitern nicht mitmachen, deswegen verfaßte er für seine Handwerks-Lehrlinge zwei Lehrbücher, in denen er das praktische Wissen und die Mathematik zusammenführte. Sie machen sein eigentliches Genie aus. Aber Dürer scheiterte damit nach zwei Seiten hin: 1. waren seinen Lehrlingen und Gesellen die Berechnungen zu kompliziert, und 2. lobten zwar die italienischen Kollegen von Dürer, Festungsbauer vielfach, seine zwei „Vermessungslehren“ über alle Maßen, mitnichten verrieten sie aber deren Inhalt an die Arbeiter und Handwerker, denn sie wurden fortan für dieses Wissen bezahlt.
In der Renaissance-Kunst selbst bahnte sich damals die Verbindung bzw. der Übergang zur Mathematik an – mit der Zentralperspektive. Dürer hat sie in seinem Holzstich „Der Zeichner der Perspektive/Der Zeichner des liegenden Weibes“ mitsamt den dazugehörigen Arbeitsgeräten zur perspektivischen Aufrasterung (Verpixelung) des Frauenkörpers thematisiert – und in seinem Buch „Underweysung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheyt“ (1525) als Illustration veröffentlicht.
.

.
300 Jahre später wird die künstlerische Zentralperspektive zur Herrschaftsabsicherung in die Stadtplanung überführt – in Form von „Sichtachsen“, die man durch die Pariser Innenstadt schlägt, was dann nach ihrem Planer „Haussmannisierung“ genannt wird, man nennt diese Erleichterung für reguläre Truppen beim Niederschlagen von städtischen Aufständen auch die „Artillerieperspektive“ – ein Begriff aus den Vierzigerjahren, der von Straßenplanungsbehörden noch heute verwendet wird, wenn auch immer öfter kritisch. Schon während der Entdeckung der Zentralperspektive durch die Renaissancemaler ging es um die Artillerie: um Ballistik und Festungsbauten, die wegen der sich verbessernden Durchschlagskraft der Waffen ständig ausgebaut und verstärkt werden (mußten), was den italienischen Künstlern/Architekten/Ingenieuren/Mathematikern Ruhm und Reichtum einbrachte. Der venezianische Mathematiker Nicolo Tartaglia (1499 -1557) wird als „Vater der Ballistik“ bezeichnet.
In den Zwanzigerjahren dieses Jahrhunderts kritisierte der russisch-orthodoxe Priester Pawel Florenski die Zentralperspektive, die er zugunsten der Ikonenmalerei verwarf, denn jene sei „eine Maschine zur Vernichtung der Wirklichkeit“.
Das könnte auch auf die Politik des Zentralkommittes (der Bolschewiki) gemünzt sein. Dafür spricht, dass Florenski, der als Häftling auf den Solowski-Inseln die Nutzung von Algen erforschte – bis er 1937 erschossen wurde, gegen deren (post)monarchistische Zentralperspektive ein „synarchisches Feld“ setzte. Grund für seine „Liquidierung“ war sein 1922 veröffentlichtes Hauptwerk „Imaginäre Größen in der Geometrie“, in dem insbesondere das Schlußkapitel beanstandet wurde, weil er darin Dantes „Göttliche Komödie“ mit Hilfe der Relativitätstheorie interpretiert hatte.
Der Ästhetikprofessor Bazon Brock führte kürzlich auf einer Veranstaltung in der Kreuzberger „Denkerei“ Evolution und Mathematik bis hin zur Quantenphysik zusammen: „Der Urknall war physikalisch-chemisch – naturgesetzlich. Erst die Bakterien gehen raus aus Physik und Mathematik – sie emanzipieren sich quasi von den Naturgesetzen. Der Mensch geht dann aber wieder rein – und weitet sie aus: auf eine künstliche Natur. Das beginnt mit Pythagoras…Und endet mit 1 Punkt 1 Pixel. Aber mit der Quantenphysik ändert sich wieder alles.“
Es muß eine Wiedervereinigung von Hand- und Kopfarbeit geben, aber erst einmal müssen wir all den Verblödungen nachgehen, die aus ihrer Trennung erfolgten. Man könnte auch von „Scheidewegen des Sozialen“ sprechen.
Michel Foucault unterschied 1977 den „universellen Intellektuellen“, dessen Ursprünge er bei Voltaire ansetzte und der vor allem von gebildeten Juristen verkörpert wurde, vom „spezifischen Intellektuellen“, der in seiner besonderen Stellung zur Macht, durch seine berufliche Tätigkeit selbst zum moralischen Widerstand gelangt. Das „Scharnier“ zwischen diesen beiden Intellektuellentypen war für ihn Robert Oppenheimer. Der Atomphysiker blieb quasi unpolitisch bei seiner speziellen beruflichen Tätigkeit, aber ihre vermeintlichen Auswirkungen waren universell – und das mußte er in seiner Arbeit, ähnlich wie später auf der anderen Seite Andrej Sacharow, berücksichtigen. Ich möchte hier auf ein anderes „Scharnier“ zu sprechen kommen – aus der Zeit der Zerstörung der handwerklichen und bäuerlichen Einheit von Kopf und Hand am Vorabend des Großen Deutschen Bauernkriegs, das sich nicht zuletzt gegen diese Entwicklung stemmte – vergeblich.
.
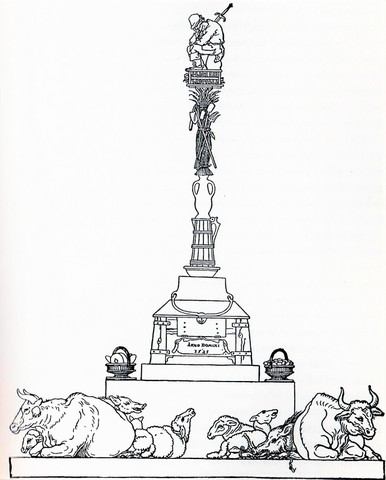
.
Laut Alfred Sohn-Rethel kann die Trennung von Hand- und Kopfarbeit am Vordringen der Mathematik in der Produktionstechnik (vor allem in der Bautätigkeit und speziell der Militärarchiktektur) gemessen werden. Die Durchsetzung der „Methoden der mathematischen Naturwissenschaft“ bewirkte, dass sich das Handwerk spaltete: zu großen Teilen sank es in Lohnarbeit und Schuldknechtschaft herab, ein kleiner Teil raffte sich jedoch zu „experimentierenden Meistern“ auf, zu selbständigen Ingenieuren und Künstlern. In diesem Prozeß tritt, vermittelt über die langsam sich radikalisierenden Bauern und Handwerker, Albrecht Dürer als „Scharnier“ dazwischen. Er ist Handwerker, Meister und Künstler und hat bei dem Humanisten Pirckheimer Mathematik gelernt. Zwischen 1525 und 1527 veröffentlicht er eine „Unterweisung der Messung mit Richtscheit und Zirkel“ und den „Unterricht zur Befestigung von Stadt, Schloß und Flecken“. Hierin gebraucht er die Mathematik jedoch nicht mehr in ihrer „gelehrten griechischen und arabischen Form“, sondern formt sie um zur „Unterrichtung von Lehrlingen und Werkleuten der Baukunst, Metallgießerei, Tischlerei und Goldschmiedekunst“. Dabei geht es ihm nicht um die reine Mathematik, sondern um eine praktische „Näherungskonstruktion“. Dürer ist damit laut Cantor „der erste“. Gemessen an seinem Ziel, damit den Handwerkern zu dienen, ist er gleichzeitig aber auch der letzte, denn er scheitert: Weder haben seine Lehrlinge genügend mathematisches Verständnis dafür, noch nehmen die führenden Mathematiker in Italien seine soziale bzw. politische Idee dabei auf – im Gegenteil: Sie, die sich gerade selbständig machen, schätzen zwar Dürers Werke sehr, aber sie trennen ihr Wissen desungeachtet nur noch mehr von den Handwerkern, denn diese müssen sie nun bezahlen – für ihre Kopfarbeit. Es ist bald ihre Haupteinnahmequelle, meint Sohn-Rethel: „Sie arbeiten auf ständige Vertiefung der Scheidung zwischen Kopf und Hand hin und tasten nach der Wissenschaft, welche die vollendete Kluft beider zur methodologischen Grundlage hat“.
Der Aufstand der Bauern unter der Führung von Thomas Müntzer wird in Frankenhausen niedergeschlagen und überall werden seine Parteigänger verfolgt und hingerichtet. Auch Dürer fürchtet um sein Leben und versteckt sich eine zeitlang. Er entwirft währenddessen ein großartiges Denkmal zu Ehren all der wegen ihres Aufstands ermordeten Bauern. Nicht einmal die DDR, die immerhin mit dem größten Gemälde der Welt des Bauernkriegs in Frankenhausen gedachte, traute sich, die „Bauern-Säule“ von Dürer aufzustellen, denn sie hatte auch noch die letzten freien Bauern zu (LPG-)Lohnarbeitern gemacht – und gleichzeitig in der Landwirtschaft einen den Handwerkern analogen Prozeß der Trennung von Hand und Kopf durchgesetzt: Fürderhin gab es dort spezialisierte Landarbeiter, die auf Weisung von wissenschaftlich gebildeten LPG-Leitern und Parteikadern handelten. Deren „proletarische Wissenschaft“ war zwar anfänglich auf die (revolutionäre) Praxis der Kolchosen ausgerichtet, aber schon bald scheiterte ihr Vordenker Trofim Lyssenko damit noch kläglicher als Dürer, so daß man auch dort zur nunmehr universell gültigen „bürgerlichen Wissenschaft“ zurückkehrte. Im Westen wurde der „Lyssenkismus“ von einigen Wissenschaftlern aufgegriffen, in Frankreich z.B. von Jacques Monod, aber als die USA anfingen, Druck auf ihn auszuüben und De Gaulle ihm ein neues Institut versprach, verabschiedete auch er sich schnell von der „proletarischen Biologie“, die dann in Anspielung auf eine Monodkritik von Louis Althusser höchstens noch als „spontane Philosophie eines Gärtners“ durchging.
.

Unser Fahrer (2)
.
Kunstscheiße
Noch in der Kulturrevolution galt Maos Diktum „Mist ist wichtiger als Dogmen“. Zusammen mit Ho Chi Minh setzte Mao Tse Tung anders als die sowjetischen Genossen auf die Bauern statt auf die Arbeiter. Das änderte sich, wie ich dem interessanten JW-Vorabdruck von Felix Wernheuers Buch „Chinas große Umwälzung“ entnehme, 1978 mit Deng Xiaopings Parole „Bereichert euch!“ Seitdem geht die Politik der KPCh dahin, das mit der Auflösung der Kommunen entstandene Kleinbauerntum sukzessive abzuschaffen zugunsten von „agroindustriellen Konzernen“, deren „Manager“ in Größenordnungen Feldfrüchte für in- und ausländische Märkte anbauen lassen. Einige Wissenschaftler nennen das Wernheuer zufolge eine „versteckte Revolution“. Ich würde eher von einer schleichenden Reaktion sprechen – und dies am Beispiel der Felddüngung verdeutlichen – worauf sich Maos o.e. Machtwort bezog. Vor der Revolution mussten Landarbeiter sich verpflichten, die Toilette des Gutsbesitzers zu benutzen. An den Landstraßen standen Töpfe. Sie wurden regelmäßig geleert. Fäkalien waren ein Handelsgut, man konnte sie portionsweise auf dem Markt kaufen. Unternehmer zahlten viel Geld, um die Exkremente ganzer Städte einzusammeln und an die Bauern zu verkaufen. Der Leiter der Abteilung für Bodenbearbeitung im US-Landwirtschaftsministerium, Franklin H. King, bereiste 1909 mit einem Team von Mitarbeitern China, Korea und Japan, sein begeisterter Bericht darüber: „4000 Jahre Landbau“ erschien 1911 (auf Deutsch wurde er zuletzt 1984 veröffentlicht). Der Autor kommt darin zu der Überzeugung, dass die amerikanische Landwirtschaft unbedingt von der in China, Korea und Japan lernen muss. „In Amerika verbrennen wir ungeheure Mengen Stroh und Maisstrünke: weg damit! Kein Gedanke daran, dass damit wertvolle Pflanzennährstoffe in alle Winde zerstreut werden. Leichtsinnige Verschwendung bei uns, dagegen Fleiß und Bedächtigkeit, ja fast Ehrfurcht dort beim Sparen und Bewahren.“ Noch mehr galt das für den Umgang mit Fäkalien. Er wird auf Schiffen zusammen mit Schlamm aus Kanälen transportiert, an Land gelagert, dann in Gruben an den Äckern geschüttet, wobei man dazwischen Lagen mit geschnittenem Klee packt und „das Ganze immer wieder mit Kanalwasser ansättigt. Dies lässt man nun 20 oder 30 Tage fermentieren, dann wird das mit Schlamm vergorene Material über den Acker verteilt.“ Die US-Agrarforscher hielten die „landbaulichen Verfahren“ der Chinesen, Koreaner und Japaner, mit denen sie „jahrhundertelang, praktisch lückenlos, alle Abfälle gesammelt und in bewundernswerter Art zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und Erzeugung von Nahrungsmitteln verwertet haben, für die bedeutendste Leistung der drei Kulturvölker.“ Wenn man sie studieren will, „dann muss man auf das achten, was uns die Hauptsache zu sein scheint, dass nämlich unter den Bauern, die die dortigen dichten Bevölkerungen jetzt ernähren und früher ernährt haben, richtiges, klares und hartes Denken Brauch ist.“
Bereits 2862 hatte Victor Hugo in „Die Elenden“ geschrieben, dass die Lebensverhältnisse der Bevölkerung durch die Verwendung von „Menschenscheiße“ (Olivier Rolin) verbessert werden könnten.
Seit der „Kommerzialisierung der Bodenrechte“ (Wernheuer) passiert jedoch mit dem falschen, gierigen und dummen Denken von Agrarmanagern das Gegenteil! Eine Nachricht auf „pflanzenforschung.de“ 2010: „Aufgrund des übermäßigen Einsatzes von Stickstoffdünger werden Chinas landwirtschaftliche Flächen immer saurer und bringen immer weniger Ertrag. Laut Experten könnte das in Zukunft die Lebensmittelproduktion Chinas gefährden.“ Greenpeace erklärte dazu: „Das Land hat seine Landwirtschaft mit großem Aufwand industrialisiert und mittlerweile einen Anteil von 34 Prozent am weltweiten Bedarf für Phosphor-Düngemittel. Die meisten werden im Land selber produziert.“ Die chinesische Landwirtschaft verbraucht heute 36,7 Millionen Tonnen jährlich. Flankierend dazu eine Wirtschaftsmeldung von 2013: „Schlechte Nachrichten für die Kali+Salz AG“ (Wir erinnern uns: das ist der Schweinekonzern, der die Kaligrube in Bischofferode stillegen ließ und von der Treuhand noch über eine Milliarde DM obendrauf bekam). Die schlechte Nachricht für den Kasseler Konzern: „China steigt beim russischen Düngemittelriesen Uralkali ein und schürt damit neue Spekulationen über die Machtverteilung in der Branche. Da die Volksrepublik zu den größten Konsumenten von Kali-Düngern gehört, wird es aus Sicht von Experten wahrscheinlicher, dass Uralkali die Preise wie angekündigt drückt und dies durch größere Verkaufsmengen wettmacht – unter anderem in China.“ Also während man in Europa versucht, vom Kunstdünger wegzukommen, weil er auf Dauer die Böden versaut, passiert in China jetzt genau das Gegenteil: Jahrhundertelang haben die Bauern dort mühsam die Bodenfruchtbarkeit erhalten, aber nun wird auch dort aus Profitgier die selbe fatale „industrielle Landwirtschaft“ betrieben. Am Beispiel eines Gemüses hat der Journalist Jean-Baptiste Malet dies in „Das Tomatenimperium“ recherchiert: Vor allem in Xinjiang werden Zigmilliarden Tomaten jedes Jahr produziert, die man in Form von dehydrierter und und anderswo wieder rehydrierter Tomatenpampe exportiert, und damit vornehmlich Afrika zumüllt, aber auch alle unsere Pizzen belegt und in Soßendosen bzw. Ketchupflaschen füllt. Die von ihrem Land vertriebenen Uiguren bekommen als Landarbeiter etwas mehr als einen Cent pro gepflücktem Kilo Tomaten.
.

Busreise (3)
.
Petrolfiction
Mitte der Achtzigerjahre ventilierten Die Grünen eine zeitlang ihre absolut unsoziale Forderung, dass das Benzin mindestens 5 DM der Liter kosten müsse. Während die „Ölexperten“ einen drohenden „Oil Peak“ in Sicht sahen. Durch neue Lagerfunde trat jedoch das Gegenteil ein: Mindestens das Flugzeugbenzin wurde immer billiger. Die umschwärmten Piloten sind heute (Air-)Busfahrer. Gleichzeitig wurden jedoch an vielen Ecken auch energiesparende Maßnahmen eingeleitet. Statt von einem „Peak“ ist jetzt von einer drohenden „Klimakatastrophe“ die Rede, die sich nicht zuletzt bereits in einer zunehmenden Zahl von Tsunamis und Zyklonen zeigt. Einst waren die Nationalökonomen davon ausgegangen, dass sich die Verknappung einer Ware über den Preis regeln würde. Gleichzeitig kam jedoch auch das Wort „Nachhaltigkeit“ auf, das man heute schon fast nicht mehr hören kann.
Lea Haller, Sabine Höhler und Andrea Westermann erinnerten in ihrem Bericht zur Wissenschaftsgeschichte „Rechnen mit der Natur“ daran: „Der deutsche Kameralist Hans Carl von Carlowitz machte in seiner Arbeit Sylvicultura Oeconomica von 1713 erstmals das Prinzip der Nachhaltigkeit zur Pflege des Waldbestandes geltend. Als ‚nachhaltende Nutzung‘ wollte er die Maßnahme verstanden wissen, in einem Zeitintervall nur so viele Bäume zu fällen, wie aufgeforstet werden konnten, ohne den Baumbestand langfristig zu schädigen. Carlowitz’ Überlegungen zu den selbsterneuernden Kräften der Natur entsprachen der Idee des vorsorgenden Staates, der sein Vermögen für nachkommende Generationen zu sichern und mehren suchte. Die Vorgabe des nachhaltigen forstwirtschaftlichen Ertrages machte die Wälder zugleich zu Inventarien, die als nationales Gut verzeichnet und monetär veranschlagt werden konnten. Im 19. Jahrhundert wurde der nachwachsende Rohstoff Holz zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Forstwirtschaft unter Staatsmonopol.“
Im Anschluß an die erste „Ölkriese“ im November 1974 gründete eine Reihe erdölimportierender Länder das Kartell „International Energy Agency“ – mit Hauptsitz in Paris – als Krisenmanagement-Gegenorganisation zum Kartell der erdölexportierenden Länder OPEC. Frankreich hielt sich zunächst abseits, man begriff dort die IEA als „Machine de Guerre“. Weil die Gas- und Erdöl- Branche in den meisten westlichen Ländern immer noch Staatsmonopol ist, dreht sich der Kampf nun auch dort um die Privatisierung. Es geht dabei u.a. um Durchleitungsrechte, Gebietsmonopole, Entflechtung, Veräußerung von Kommunalanteilen etc. An immer mehr städtischen Versorgungsbetrieben sind die Strom-, Öl- und Gaskonzerne beteiligt, zudem fusionieren sie noch laufend untereinander.
In dem o.e. Aufsatz heißt es: „Die in der Umweltpolitik der 1980er und 1990er Jahre geschaffenen neuen Märkte setzen nicht auf Knappheit, sondern auf Fülle – eine Entwicklung, die als Neoliberalisierung der Natur bezeichnet worden ist. Der ‚Stern-Report‘ empfahl 2006 die Ausarbeitung neuer Wohlstandsmodelle, um den Umgang mit der irdischen Natur unter Bedingungen des globalen Klimawandels zu organisieren. Die Studie deutete den Klimawandel als eine Folge von Marktversagen, könnten doch wenige Verursacher dessen Kosten als negative Externalität auf viele Betroffene abwälzen.“
Das war den auf der Pariser Klimaschutzkonferenz 2015 vertretenen Industrieländern dann auch das Wichtigste im Abkommen: Dass sie für die von ihnen in „Rückständigkeit“ gehaltenen Länder des Südens keine Kompensationsgelder zum Aufholen zahlen müssen. Der jetzige US-Präsident Trump hat das Abkommen natürlich aus anderen Gründen als guten gekündigt: Weil er zur weltweiten „Front“ der sogenannten „Klimaleugner“ gehört (zurück zu den guten alten Fünfzigerjahren) und alle staatlichen Umweltschutzinstitutionen erst einmal die Mittel gekürzt hat. Im Gegensatz zum US-Militär und den Geheimdiensten, die ihre diesbezüglichen Forschungen aufgestockt haben. Sie sind qua Amt verpflichtet, alle möglichen Bedrohungspotentiale einzuschätzen. Es geht um die „Sicherheit“ – und die könnte z.B. durch Migrationsströme infolge der „Klimaveränderung“, eine Reihe von Maßnahmen notwendig machen. Hierzulande setzt man dies politisch durch – mit Milliarden Euro für „Pufferländer“ oder „Länderpoller“.
.

Autofähre (2)
.
Dingwelt
Die Designforscherin Dagmar Steffen erwähnt in ihrem Buch „Welche Dinge braucht der Mensch“ (1995), dass der durchschnittliche Westdeutsche 10.000 Gegenstände besitzt, bei den Massai sind es 30. „Gegenstände sind die eigentlich menschliche Heimat des Menschen,“ behauptete Hannah Arendt. Ich nehme an, dass sie damit keine Pflanzen und Tiere meinte, die aber ja vom Gesetz her auch „Sachen“ (also Privateigentum) sind und dementsprechend, wie Gegenstände wirtschaftlich behandelt, d.h. verdinglicht werden. Ich möchte sie jedoch unterscheiden, ebenso muß man einen Unterschied zwischen individuell und industriell hergestellten Gegenständen machen. Erstere gibt es bei uns kaum noch im täglichen Gebrauch, aber auf burmesischen Wochenmärkten waren 1999 noch alle Küchen- und Agrarwerkzeuge Unikate. Am Liebsten hätte ich alle gekauft.
Es gibt jedoch auch Westler, die industrielle Dinge wertschätzen – die Schriftstellerin Tina Stroheker z.B.. Sie hat einigen in ihrem demnächst erscheinenden Buch „Inventarium“ eine späte Huldigung nachgetragen. Dazu heißt es: „Für die Autorin gilt, was Mallarmé einmal befand: ‚Alles in der Welt ist dazu da, in einem Buch zu landen.“ Bücher sind natürlich auch Gegenstände – für Leute wie mich sind sie sogar „die eigentlich menschliche Heimat“. Es gibt jedoch immerhin noch einige Leute, die darin einen erheblichen Verlust an Menschlichkeit sehen. Ein Indianerhäuptling, der als Bremser auf einer Strecke der Union Pacific arbeitete, sollte einmal von einem deutschen Ethnologen interviewt werden, er verwies ihn jedoch an die Nationalbibliothek in Washington: „Dort steht alles über Indianer!“ Heute gibt es in den USA eine spezielle „First Nations“- Bibliothek. Auch in Kanada, wo ein Indianer einmal zu einem Ethnologen, der ihn über die Büffeljagd ausfragte, meinte: „Unsere Vorfahren haben die Tiere geheiratet, sie haben ihre Lebensweise kennengelernt, und sie haben diese Kenntnisse von Generation zu Generation weitergegeben. Die Weißen schreiben alles in ein Buch, um es nicht zu vergessen.“ Viele Weiße, sogenannte „White Indians“, die „unsere“ Gesellschaft ablehnten, liefen einst zu den Indigenen über – so lange deren Lebensweise noch nicht völlig zerstört war.
Es gibt aber auch einige Indigene, die sich „uns“ anpassten – freiwillig. Der Journalist Patrick Tierney berichtet in seinem Buch „Verrat am Paradies: Journalisten und Wissenschaftler zerstören das Leben am Amazonas“ (2002) von einer Yanomami-Indianerin, Yarima, die den Ethnologen Kenneth Good heiratete und mit ihm nach New Jersey zog, wo sie als Hausfrau mit drei Kindern in einem Reihenhaus lebte. Ihr Ehemann verschaffte sich „durch die Heirat mit ihr einen einzigartigen Zugang zur Gesellschaft der Yanomami“. Seine Frau verließ ihn und ihre Kinder jedoch nach einigen Jahren – und ging zurück an den Orinoko. Sie hielt es in den USA nicht aus: „Das einzige, was sie lieben, sind Fernsehen und Einkaufszentren. Das ist doch kein Leben“, erklärte sie Patrick Tierney, dem sie gestand, dass sie inzwischen sogar wieder das Zählen verlernt habe, und dass sie ihren Mann in New Jersey als zu wenig kriegerisch empfand. Das mit dem Zählen lernen und dem Zahlen vergessen ist quasi der zivilisatorische Knackpunkt: Alles um uns herum – alle Dinge: Straßen, Häuser, Anziehsachen, Medien, Verkehrsmittel, Lebensmittel, Regierungen etc. – basieren auf Mathematik.
Nicht die warenproduzierende Gesellschaft und die Demokratie bzw. der Kapitalismus/Imperialismus sind das Übel, sondern die Pythagoreer mit ihrer Verheiligung der Zahlen! Das Übel deswegen, weil wir – und nicht nur das Meer am Plastikmüll – an diesem ganzen mathematikbasierten Mist ersticken werden, die wild lebenden Tiere und Urwälder als erstes. „Es gibt keine ökonomische Utopie mehr, nur noch eine ökologische,“ meint Bruno Latour, aber auch diese wird eine Utopie bleiben – und die Gemüter höchstens als „Lifestyle“ noch eine Weile bewegen. Denn auch die ökologischen Probleme will man technisch (d.h. mathematisch) lösen – nur solche Lösungen sind profitabel, im Gegensatz zu sozialen Erfindungen, die sich nicht vermarkten lassen. Der Berliner Medienwissenschaftler Gustav Roßler hat 2016 den „Anteil der Dinge an der Gesellschaft“ untersucht. Haben nicht die ersteren die „Gesellschaft“ längst geschluckt? Dafür spricht, dass für Roßler die Dinge „soziale Akteure“ sind und andererseits die „globale Gesellschaft“ laut Claude Levi-Strauss „auf Menschenstaub beruht“.
.

Busreise (4)
.
Autoethnologie
Die Schriftstellerin Annie Ernaux bezeichnete sich einmal als Autoethnologin. Sie hat mit ihren Büchern eine alte Tür wieder aufgestoßen. Auf Deutsch erscheint seit 2017 jedes Jahr eineautobiographische Erzählung von ihr, in der sie gleichzeitig die Klassenfrage stellt, die spätestens seit Auflösung der sozialistischen Staaten der Vergessenheit anheimgefallen war: „Marx ist tot, Jesus lebt!“ wie der Arbeitsminister Norbert Blüm nach dem Fall der Mauer jubelte.
In ihrem Buch „Woher ich kam“ (2019) erzählte die kalifornische Journalistin Joan Didion, dass sie als 13jährige ihre Mutter einmal fragte, „welcher Klasse wir angehören. ‚Dieses Wort gebrauchen wir nicht,‘ sagte sie. ‚So denken wir nicht‘.“ Und in der Tat, meint die Autorin: „So dachten wir in Kalifornien nicht. Wir glauben an Neuanfänge. Wir glauben an das Glück.“ Und dass dort eine „scheinbar unendlich erweiterbare Mittelschicht geschaffen“ wird. Aber um 1989 herum wurde ein Werke der Luft- und Raumfahrtindustrie nach dem anderen geschlossen: Offiziellen Angaben zufolge gingen zwischen 1988 und 1993 rund 800.000 Arbeitsplätze verloren. 2000 betraf die Armutsquote im San Joaquin Valley bei San Francisco 22 Prozent der Bevölkerung. Zur Schaffung neuer Arbeitsplätze wurden von vielen Gemeinden neue Gefängnisse und psychiatrische Anstalten gebaut. Daneben fing man in einigen Countys an, „Sozialhilfeempfänger die Kosten für einen Umzug in andere Bundessaaten zu bezahlen“ (2300 Dollar).
Mitte des 19. Jahrhunderts machte man in umgekehrter Richtung Ähnliches in Ostfriesland mit mißliebigen oder unsittlich sich verhaltenden Personen: Sie bekamen ein One-Way-Ticket nach Amerika. Dort, in Kalifornien, entstand etwa zur selben Zeit, 1853, die erste staatliche Irrenanstalt: für verrückt gewordene Goldsucher.
In „Die Jahre“ vergegenwärtigt die bei Paris lebende Annie Ernaux sich ihre vergangenen Jahre von ihrer Kindheit in der Nachkriegszeit bis zu den Verheißungen der Nullerjahre – „Und dabei schreibt sie ihr Leben – unser Leben, das Leben – in eine völlig neuartige Erzählform ein, in eine kollektive, ‚unpersönliche Autobiographie‘,“ wie es heißt. Die Eltern von Annie Ernaux hatten sich als Arbeiter mit einem kleinen Laden für Waren des täglichen Bedarfs selbständig gemacht – und eine „Krämerseele“ entwickelt, ähnlich wie die Mutter von Erwin Strittmatter in seiner Lausitzer Trilogie „Der Laden“. Annie Ernaux schreibt: „Mittlerweile sieht sie ihr Studium als die Zeit ihrer intellektuellen Verbürgerlichung, als Bruch mit ihrer Herkunft. Ihr Gedächtnis ist nicht mehr romantisch, sondern kritisch.“ Was auf eine Art von Klassenverrat hinausläuft. Eine Erinnerung: „Die Stahlarbeiter verbrannten auf den Schienen Autoreifen, während sie [die Lehrerin] in dem Schnellzug [TGV], der auf freier Strecke gehalten hatte, ‚Die Ordnung der Dinge‘ [von Michel Foucault] las.“
Einige Jahre später ist sie geschieden, hat einen jugendlichen Liebhaber, lebt allein mit einer Katze, ihre Kinder sind erwachsen…Auch draußen hat sich einiges verändert: „Die Wohnungslosen gehörten zum Stadtbild./ Zur allgemeinen Erleichterung fand sich eine überflüssige Betätigung für die vielen Obdachlosen, nämlich der Verkauf von Obdachlosenzeitschriften. Überall auf der Welt herrschten weiterhin Kriege./ Die Leute wünschten sich den Krieg regelrecht herbei, es war, als hätten sie schon lange nichts Aufregendes mehr erlebt, als wären sie neidisch auf das, was sie im Fernsehen sahen. Sie sehnten sich nach einer antiken Tragödie. Eine moralisch legitimierte Kriegslust wehte durchs Land. Man wollte ‚Saddam eins auf die Mütze‘ geben. Die Libération sprach sogar von einem ‚zivilisierten Krieg‘.“
„Wettbewerb, Prekariat, Erwerbsfähigkeit, Flexibilität waren die neuen Kampfbegriffe./ Aber das Wort ‚Kampf‘ wurde als Überbleibsel des Marxismus entsorgt.“
„Wenn man seine mittlerweile erwachsenen Kinder beobachtete und ihnen zuhörte, fragte man sich, was einen eigentlich verband, weder das Blut noch die Gene, nur eine Gegenwart aus Tausenden gemeinsam verbrachten Tagen, aus Worten und Gesten, aus Mahlzeiten, Autofahrten, unzähligen geteilten Erfahrungen, deren man sich nicht bewußt war. Im nächsten Jahr wird sie in Rente gehen.“
Dieser lakonisch-melancholische Ton, der Intimstes zur Sprache bringt, sich aber gleichzeitig in der dritten Person davon distanziert und mit den gesellschaftlichen Entwicklungen synchronisiert, setzt sich in der „Erinnerung eines Mädchens“ fort. Dieses Buch beginnt mit dem Sommer 1958, als sie 18 wird und das erste Mal mit einem Jungen schläft, was nicht gut ausgeht. Sie spricht von einer „Erinnerung der Scham“.
Und jetzt erschien gerade „Der Platz“ auf Deutsch, in dem sie das Leben ihres Vaters erzählt. „Es ist auch die Geschichte vom gesellschaftlichen Aufstieg der Eltern und der gleichzeitigen Angst, wieder in die Unterschicht abzurutschen…Dass seine Tochter eine höhere Schule besucht, macht ihn stolz, trotzdem entfernen sich beide dabei voneinander.“
Dieses Buch aus dem Jahr 2010 inspirierte den Soziologen Didier Eribon (von dem man auf Deutsch bisher nur eine Foucault-Biographie kannte), sich ebenfalls mit seiner Herkunft, aus einer armen Arbeiterfamilie in Reims, auseinanderzusetzen, wobei er „autobiografisches Schreiben mit soziologischer Reflexion verknüpfte“. In der „Rückkehr nach Reims“ (2009) geht es um seine Homosexualität und seinen Anschluß an die Elite der Pariser Intellektuellen – vor dem Hintergrund der Homophobie seines Herkunftsmilieus, in dem man einst die Kommunisten wählte und nun die Rechten. Er fragt sich, warum er bisher zwar über viele Fragen als Soziologe geschrieben hat, auch als politischer Aktivist, aber nie über die Arbeiter, über seine eigene Herkunft. Sein Buch ist dem Tagesspiegel zufolge der „Versuch, die populistische Wut der ‚Abgehängten‘ zu verstehen.“ Eribon wurde daraufhin auf viele linke Veranstaltungenim In- und Ausland eingeladen und seine „Rückkehr nach Reims“ Gegenstand von Bachelorarbeiten.
Fast noch erfolgreicher war dann der „Roman“ des 1992 geborenen Schriftstellers Édouard Louis „Das Ende von Eddy“, der 2015 für großes Aufsehen sorgte und ein internationaler Bestseller wurde, in 30 Sprachen übersetzt. 2018 erhielt er eine Gastprofessur an der FU, wo er über „konfrontative Literatur“ sprach. Louis wuchs in einem nordfranzösischen Dorf auf, er entstammte laut Wikipedia „einfachen, schwierigen Verhältnissen. Schon als Kind erfuhr er aufgrund seiner Homosexualität Diskriminierung, Mobbing und Gewalt, was ihn schließlich dazu brachte, nach Paris zu ziehen und seinen Namen zu ändern. Dort studierte er beiDidier Eribon Soziologie und beschäftigte sich mit dem Werk von Pierre Bourdieu, über den er ein Buch schrieb. Seinen ersten Roman „Das Ende von Eddy“, womit er sich selbst meint, widmete er Eribon.
Sein zweiter Roman „Im Herzen der Gewalt“ (2016) wurde verfilmt und 2018 von der Berliner Schaubühne aufgeführt. Im selben Jahr veröffentlichte Louis auf „zeit online“ einen Artikel über die „Gelbwesten“, in dem er auf die rassistischen und homophoben Äußerungen der Protestler zu sprechen kam. Dennoch hält er diese Bewegung für notwendig, nicht zuletzt, weil sie „endlich die Gesichter und Stimmen sichtbar und vernehmbar macht, die normalerweise in die Unsichtbarkeit gebannt werden“. Dadurch würde sie auf die Nöte des Prekariats unter dem Klassensystem aufmerksam machen.
2019 erschien auf Deutsch auch noch sein Buch „Wer hat meinen Vater umgebracht“ Darin gehe es um die „Zerstörungsmacht der Politik, beispielsweise darum, wie sie einen Körper zerstören kann,“ erklärte er. „Je stärker die soziale Klasse, der Sie angehören, den Herrschaftsverhältnissen unterworfen ist, desto unmittelbarer sind die Auswirkungen der Politik auf Ihr Leben. Für jemanden wie meinen Vater sind Entscheidungen, die Sarkozy, Hollande oder Macron gefällt haben, etwas fast so Intimes wie der erste Kuss oder das erste Mal, als er Sex hatte, weil sie ihn ganz unmittelbar und existenziell betreffen. Solche Entscheidungen bestimmen, was Sie sich zu essen kaufen können, ob Ihnen die notwendigen Medikamente und Ihre medizinischen Therapien bezahlt werden, welche Maßnahmen zur Arbeitsmarktreintegration Ihnen aufgezwungen werden. Ob sie ein glückliches oder ein unglückliches Leben haben.“ Man kann sagen, in seinem ersten Roman richtete sich seine Wut gegen seine Eltern, vor allem gegen seinen brutalen Vater, in seinem dritten Roman entwickelt er ein Mitgefühl für ihn.
Didier Eribon äußerte sich ebenfalls über die aktuellen „Klassenkämpfe“: „Auch der Brexit ist eine Form der Revolte von unten. Die Gelbwesten sind die französische Variante dieser Revolte, also ein Aufstand der Straße,“ meinte er in einem Interview. „Diese Revolte ist in ihrem Kern nicht reaktionär. Befragungen haben ergeben, dass eine Mehrheit der Protestierenden sich selber als eher links oder auch als linksextrem definiert, ein großer Anteil bezeichnet sich als apolitisch, ein drittes Segment ist eher rechts oder auch rechtsextrem. Da kann man schwer von einer reaktionären Revolte sprechen, nur die Medien tun dies ohne Unterlass. Wenn man mit den Leuten direkt redet, sagen sie, dass sie den politischen Parteien misstrauen – was man ja auch verstehen kann. Es handelt sich um eine Revolte gegen das politische und ökonomische System, so wie es heute funktioniert. Die unteren Schichten wollen nicht weiter so behandelt werden.“
Die von Annie Ernauxs Buch „Der Platz“ inspirierte „Rückkehr nach Reims“ von Eribon war nicht nur ein Vorbild für den Roman seines Studenten Édouard Louis, sondern auch für den im vergangenen Jahr erschienenen Essay „Zeige deine Klasse“ der 1977 geborenen Schriftstellerin Daniela Dröscher. Die in einem Eifeldorf aufgewachsene Medienwissenschaftlerin nennt ihr autobiographisches Buch im Untertitel „Die Geschichte meiner sozialen Herkunft“. Es handelt von ihrerScham, die sie immer wieder empfunden hat – über die dörfliche Herkunft, über ihren Dialekt, ihre dicke Mutter und überhaupt „die Kleinbürgerlichkeit der Eltern“, wie Deutschlandfunkkultur das nennt. Über Eribons „Rückkehr nach Reims“ sagte die Autorin: „Es hat mir erst mal überhaupt ein Sprechen darüber ermöglicht, über soziale Herkunft, oder auch eine Sprache untereinander. Es hat uns allen das ermöglicht, würde ich sagen, im Freundeskreis, oder überhaupt mit Menschen, mit denen ich zuvor nie über diese Dimension ihrer Biografie oder Identität gesprochen hätte – es kam ein Diskurs in Gang.“
Und der wurde noch im selben Jahr von der Schriftstellerin Anke Stelling in ihrem Buch „Schäfchen im Trockenen“ literarisch ambitioniert weitergetrieben, indem sie darin die „Brasilifizierung“ der Mittelschicht, ihre Spaltung in einige wenige Aufsteiger und viele Absteiger (ins Prekariat) in Ichform quasi durchlitt, d.h. als freiberuflich tätige Mutter mit vier Kindern, die kurz davor ist, ihre Wohnung im Prenzlauer Berg räumen zu müssen. Ebendort und sich direkt auf Didier Eribon beziehend beginnt auch der Doppelroman von Jan Brandt „Eine Wohnung in der Stadt“, die sich für den nach Berlin gezogenen Schriftsteller zunehmend als unbezahlbar erweist. Akribisch schildert er seine frustrierende Suche nach einer Bleibe und den vergeblichen Versuch, seinen letzten Wohnungseigentümer, der Eigenbedarf angemeldet hat, auszumanövrieren. In seinem ostfriesischen Dorf steht unterdes das Haus seines Urgroßvaters leer, es hat einen neuen Besitzer, der es abreißen will: Obwohl der Icherzähler einst von dort in die Großstadt geflüchtet ist, möchte er es nun „retten“ und eine Art Kulturzentrum daraus machen. Im zweiten Teil seines Doppelromans „Ein Haus auf dem Land“ schildert er sein Scheitern: Ein Foto vom Abriß ist dem Buch beigegeben.
.

Pinkelpause
.
Kommunikationsbranche
Im Vogelsberg erschien jedes Jahr ein Hausierer, so nannte dieser Firmenvertreter sich noch, der bei den Buch- und Schreibwarenläden Bestellungen für Papierwaren aller Art aufnahm. Auf dem Hoherodskopf angekommen parkte er, rauchte eine und sah die Karteikarten seiner Kunden in der Region durch: Was für Bestellungen hatten sie beim letzten Mal getätigt, worüber hatte er mit ihnen gesprochen – über die Schwägerin, die in den Laden mit einsteigen wollte, über ihren Sohn, ihre Großmutter, den Garten, ihre Geranien…
Er hieß Lambertz, kam aus Frankfurt, und löste erst einmal sein aktuelles „Travelling-Salesman-Problem“, d.h. er suchte die günstigste Strecke, um alle Läden nacheinander aufzusuchen (mathematisch gelöst wurde dieses Problem erst später von einem irakischen Mathematiker, der damit reich wurde, denn für Spediteure und Öltanker-Flotten war seine Formel Gold wert).
Wenn Herr Lambertz in die Läden kam mit seinen neuesten Angeboten, wurde er regelmäßig mit den Worten empfangen: „Schön das sie wieder da sind. Grad haben wir von Ihnen geredet.“ Das überzeugte ihn davon, dass er sich vom höchsten Berg aus aus mit Empathie als eine Art sechster Sinn auf die Kunden in den Tälern eingetunt hatte, was wesentlich zu seinen Verkaufserfolgen beitrage, denn wenn man z.B. zu einer Ladenbesitzerin komme und sie frage, ob ihr Wellensittich wieder gesund sei, dann bekomme das Geschäft gleich ein viel menschlicheres Gesicht. Lambertz hatte auch eine Theorie, die ihm seine beruflich entwickelten Empathieerfolge wissenschaftlich erklärte. Sie stammte von dem englischen Botaniker Rupert Sheldrake und war eine „morphologische Feldtheorie“, die kurz gesagt, davon ausging, dass es eine immaterielle „morphische Resonanz“ gibt, die als formbildende Kraft quasi über uns schwebt, nicht etwa als Gedächtnis in unserem Kopf, und sie wirke auch auf andere. Eine „spukhafte Fernwirkung“, wie der Physiker Niels Bohr das nannte. Daneben gibt es auch noch eine „spukhafte Nahwirkung“, wie sie mir einmal bei einem Vertreter für Wasserfilter begegnete – und mich überrumpelte.
Ich ahnte, was Lambertz mit „morphischer Resonanz“ meinte. In den Sechzigerjahren war ich in Delmenhorst selbst einmal Hausierer gewesen, genauer gesagt: für vier Wochen Assistent eines Vertreters (Klinkenputzers) von Bertelsmann. Jede Woche zahlte mir der „Kommunikationskonzern“ 100 Mark, dafür mußte ich den „alten Fuchs“ nur begleiten und ihm verkaufen lernen. Er hatte durch ein Bertelsmann-Preisausschreiben Adressen dabei, dummerweise in einem Arbeiterviertel, in dem alle arbeitslos waren. Denen sollte er ein 12bändiges Lexikon verkaufen. Kein Witz! Das konnte nur in einem beidseitigen Akt der Verzweiflung geschehen, d.h. der Meister mußte immer tiefer in seine Verkaufstrick-Kiste greifen. Beispielsweise lauschte er an der Wohnungstür, bevor er klingelte. Wenn er drinne Kanarienvogel-Gesang hörte, sagte er: „Ach wie schön, Sie haben einen Kanarienvogel. Ich auch, was ist es denn – ein Männchen oder ein hübsches Weibchen?“ Ähnlich war es bei einem Kind oder Hund. Nach vier Wochen hatte ich genug von ihm gelernt und verschwand (auf eine Stelle im Bremer Zoo). Meine Mutter hatte mir sowieso geraten, die Finger vom Vertreterjob zu lassen, nachdem sie den traurigen Film „Tod eines Handlungsreisenden“ gesehen hatte.
Hinterher erfuhr ich, dass man seine Verkaufsakte als Versuche bezeichnen könnte, aus einer „kalten“ oder „warmen Acquise“ eine „heiße“ zu machen. 1993 erzählgte mir ein NVA-Marineoffizier, der nicht in die Bundesmarine übergetreten war, dass der Allianz-Konzern sehr viele seiner Kollegen als Versicherungsvertreter eingestellt hatte. Sie wurden für die „warme Acquise“ eingestellt, meinte er – bei ihren Verwandten und Freunden, denen sie Policen andrehen sollten. Was auch vielfach geschah. Als sie alle durch hatten, wurden sie entlassen.
Von einer anderen Acquise-Tätigkeit, bei der es um „Investitionen“ ging, erzählte mir die Weissenseer Sparkassenangestellte Ramona: „Mit den Investmentfonds, von denen es hunderte gibt, war es folgendermaßen: Wenn man einmal begriffen hatte, wie die aufgebaut sind und funktionieren, dann hat jeder von uns seine drei oder vier Favoriten im Dauerangebot gehabt, wobei man jedem Kunden das Selbe erzählt hat. Man muß sich das so vorstellen, dass jeder Banker drei Platten im Kopf gehabt hat – über Giro- bzw. Sparkonten sowie über Kredite und Investmentfonds, die er täglich mehrmals abgespult hat.“
Gegen das Verschwinden der Kunden durchs „Home-Banking“ entwickelte die Sparkassen-Führung „ein tolles Rezept: Die Angestellten bekamen Computerlisten aus der Zentrale mit den Daten von hunderten von Kunden – denen sie dann in der einen Woche telefonisch z.B. Bausparverträge verkaufen sollten. In der nächsten Woche war es ein anderes, angeblich wieder besonders auf die jeweiligen Kunden zugeschnittenes Produkt – z.B. Lebensversicherungen. „Mir war das peinlich und unangenehm, diese armen Menschen noch nach Feierabend zu Hause zu belästigen. Deswegen habe ich irgendwann die Listen einfach so ausgefüllt: ‚Kunde will nicht‘ oder ‚Kunde hat schon‘. Irgendwann hatte ich aber so gut wie gar keine realen Kunden mehr – und hatte nichts zu tun.“
Die Hausierer/Firmenvertreter/Handelsreisenden sind heute meist „Call-Center“. Sie haben sich in den USA nicht selten in Gefängnissen etabliert, wo sie die Knackis für sich arbeiten lassen. Diese bekommen natürlich kein Erfolgshonorar wie die Call-Center-Mitarbeiter draußen im Freien. Nur noch wenige Firmen trauen sich hierzulande „Face-to-Face-Geschäfte“ in Fußgängerzonen z.B. zu – meist sind es Studenten, die dafür bezahlt werden, für Tier- und Kinderschützer oder Amnesty International Spendenabos zu acquirieren. Darunter befanden sich lange Zeit auch die Drückenkolonnen des „Klenk-Firmengeflechts“, in denen flotte Mädels den Jungs und nette Jungs den Mädels auf der Straße Video-Abos aufschwatzen, die man nicht so schnell kündigen kann.
Ich erinnere mich außerdem, dass sich nach der Wende in der Oranienstrasse eine Truppe einmietete, die von einer wuchtigen Blondine angeführt wurde. Sie schwärmten jeden Morgen als Vertreter mir unbekannter Firmen ins Umland aus und nannten sich „Dialog Direct“. Heute wirbt auf den Kneipentoiletten eine Werbefirma namens „Ambient Media“ um neue Mitarbeiter – mit dem Spruch: „Kohle fürs Quatschen (M/W)“.
Als ich eine Zeitlang in Mitte wohnte, gab es unter mir in der Wohnung noch so eine Hausierer-Gruppe, die mit zwei VW-Bussen morgens auf Tour ging, ebenfalls von einer strengen Frau angeführt. Die Firma gehörte einem Bordellbesitzer, dessen Büro sich im Erdgeschoß befand, u.a. besaß er einen Swingerclub in Karlshorst, der mit dem Spruch warb „Wir haben Verständnis für Toleranz“. Das erfuhr ich aber erst später. Erst einmal setzte man mich um in eine andere Wohnung eine Straße weiter – wegen Heizungsumbauarbeiten. Der Postbote legte meine Briefe auf die verbliebenen Kästen, weil mein Name auf keinem mehr stand. Dort fand ein Mitarbeiter der Bordellverwaltung einen Brief, in dem ein Verrechnungsscheck der VG Wort über 860 D-Mark steckte. Den ließ sein Chef durch ihn einlösen.
Die VG Wort schickte mir dann zum Glück einen neuen Scheck und bekam gleichzeitig von der Deutschen Bank mitgeteilt, wer den ersten eingelöst hatte, woraufhin sie ihn verklagte. Ich bekam dann heraus, dass dessen Haus in Lichtenberg inzwischen seinem Chef gehörte, der es als Herberge für tschechische Bauarbeiter nutzte, ferner dass seine Frau mit Krebs im Sterben lag und dass seine alte Mutter in Hellersdorf für ihn die Post erledigte, denn er befand sich in Spanien, wo er am Umbau der Villa seines Chefs beteiligt war. Er erschien dann ohne seinen Chef vor Gericht, dafür mit einer äußerst mondänen russischen Prostituierte und ihrem kleinen Sohn. Ich trug dem Richter meine Version vor. Der Angeklagte versicherte danach dem Gericht, dass ich mit dem Scheck eine Frau im Bordell „Apollo“ bezahlt hätte (dabei drehte er sich zur Besucherbank um) und er, als er die Tageseinnahmen zur Bank brachte, sich nichts dabei gedacht habe, denn das Bezahlen mit Verrechnungsschecks käme oft vor. Was eine Lüge war. Diese Version überzeugte aber den jungen Richter und den noch jüngeren Staatsanwalt derart, dass sie ihn sogleich freisprachen. Mich bedachten sie dafür mit Blicken, die extreme Mißbilligung ausdrückten: War ich nicht nur zu feige gewesen, meinen teuren Bordellbesuch zuzugeben, und hatte auch noch schändlicherweise alles mögliche getan (was ich ja selbst lang und breit ausgeführt hatte), um den Scheck wieder zu bekommen, wobei ich auch noch eine Frau um ihren redlich verdienten Liebeslohn gebracht hatte. Ein umgedrehter Beischlaf-Diebstahl quasi. Eigentlich gehörte ich angeklagt, und nicht der Hiwi des Bordellbesitzers, der nicht einmal was von dem Scheck hatte – aber so war eben die Welt: ungerecht, trotz unseres schönen Rechtsstaates.
Zuletzt erwischte mich an der Raststätte Michendorf ein italienischer Textilvertreter, der mir für 100 Euro eine Plastikjacke als Lederjacke verkaufte. Bei diesem betrügerischen Handelsreisenden handelte es sich um einen Angehörigen der berühmten „Magliari“, wie ich kürzlich erfuhr – ein ganzes süditalienisches „Netzwerk“. Dieses hat nach der Wende vor allem den Osten heimgesucht. Gleichzeitig versuchten US-Kosmetikkonzerne und Global Player wie „Tupperware“, „Amway“ und ähnliche mit Werbeveranstaltungen massenhaft ostdeutsche Vertreterinnen zu gewinnen. Inzwischen gibt es schon Firmen, die einem helfen, solche „Verkaufspartys“ unter Gleichgesinntinnen zu organisieren – für Billigschmuck und Edeldessous u.a.. Die Firma „Strukturvertrieb“ versichert auf youtube, dass die Konsumpartys derzeit „boomen“. Zudem gibt es immer mehr TV-Sender, die nichts Anderes als warenzentrierte Geselligkeiten inszenieren – und das über Stunden, Tage, Jahre.
.

Ausländische Polizisten
.
Hans-Dieter Heilmann
Am 15. Mai starb Hans-Dieter Heilmann an Krebs, der 1943 geborene Stuttgarter studierte an der FU Politik und Geschichte und arbeitete bis zuletzt als autonomer Widerstandsforscher in einer großen Nichtraucherwohnung in Charlottenburg, die mit Büchern und Dokumenten vollgestopft war. Er meinte einmal (inspiriert vom Psychoanalytiker Wilhelm Reich?): Ein richtiger Revolutionär stirbt nicht an Krebs. Ich erwiderte: Und wenn doch, dann war er kein richtiger? Heilmann dachte aber wohl an einen Ausruf von Eugen Leviné „Wir Kommunisten sind alle Tote auf Urlaub“ (bevor er wegen Beteiligung an der Münchner Räterepublik erschossen wurde).
1961 trat Heilmann dem SDS bei – und blieb bis zuletzt dem Antiautoritarismus verbunden. 1991 meinte er: „Wir waren am Anfang zu zwölft und jetzt sind wir es wieder“. Er veröffentlichte zunächst in der „Sozialistischen Politik“, in „883“ und in den „Schwarzen Protokollen“. Später gelegentlichen in Publikationen der FU-Bibliothek, von ostdeutschen KZ-Gedenkstätten und vom Hamburger Reemtsma-Institut.
Als die Studentenbewegung Ende der Sechzigerjahre autoritär wurde und Parteien gründete, beteiligte er sich an einem Band mit Kritiken u.a. an führenden SDS-Genossen wie Bernd Rabehl: „Hiebe unter die Haut“, dessen Motiv lautete „Warum denn gleich sachlich werden, wenn es auch persönlich geht“. Es folgte eine Mitarbeit an der Zeitschrift „Die soziale Revolution ist keine Parteisache“, und ab 1979 gelegentlich an der taz. Seine Archivrecherchen sind im Gedächtnis geblieben, weil sie jedesmal einen Mythos ankratzten: Kurt Tucholsky, der einst im Schlesienkonflikt antipolnische, nationalistische Töne spuckte; Hilmar Pabel – einerder laut Wikipedia „wichtigsten deutschen Vertreter einer humanistisch-aufklärerischen Pressefotografie“, den Heilmann als üblen „Ghetto-Fotografen“ porträtierte; dann über den Zeitpunkt der Ermordung von Ernst Thälmann im KZ Buchenwald (der 1988 im Prozeß gegen den ehemaligen KZ–Wächter Wolfgang Otto eine wichtige Rolle spielte); über den Prozeß gegen Erich Mielke, den man 1992 mit Aussagen von zwei SA-Leuten verurteilte („Unvermutet tauchten die Ermittlungsakten aus dem Jahre 1934 auf,“ schrieb die Frankfurter Rundschau, sie lagen natürlich für den Fall der Wiedervereinigung bereit). Erwähnt sei auch ein taz-Artikel von Heilmann, in dem er den in der Alternativscene beliebten „Papalagi“ von Erich Scheurmann mit dem fast unbekannten „Lukanga Mukara“ von Hans Paasche verglich: Bei beiden handelt es sich um sogenannte Wilde, die nach Deutschland kommen und sich hier gesellschaftskritisch äußern. Die beiden Autoren haben sich ihre Helden vor Ort ausgedacht: Der Maler und Schriftsteller Scheurmann wurde nach dem Ersten Weltkrieg ein strammer Nazi und der ehemalige Marine- und Kolonialoffizier Paasche ein Linker, der dann von den Rechten ermordet wurde.
Heilmann nahm von der taz kein Honorar, sondern ließ es an den inhaftierten RAF-Genossen Klaus Jünschke überweisen. Ich weiß nicht, wovon er lebte. 1991 interviewte ich ihn und seinen Freund Gernot Kunze für einen Band über die Wendewirren – mit dem Titel „Babelsberg“. Heilmann war Ehrenmitglied und Kunze ehemaliger Präsident der Donaldisten, deren zentrale Losung lautete: „Wahrer Donaldismus ist Scheitern, es wieder versuchen, nochmal versuchen, wieder scheitern, scheitern, scheitern und nochmal scheitern, doch niemals unterliegen oder gar aufgeben.“ Heilmann und Kunze hielten das Verschwinden der DDR für das gescheiterte Projekt einer Partei, und waren, wiewohl Westberliner, nicht ganz ostunkundig. Auf ihrem Berliner Kongreß 1984 hatten die Donaldisten mithilfe einer Windmaschine und Tausenden von gasgefüllten Luftballons „Aufrufe zur Gründung Donaldistischer Zirkel und Zellen“ auf das Territorium der DDR losgelassen. Heilmann hatte zudem mit mir im Dezember 1989 in der LPG-Tierproduktion „Florian Geyer“ als Rinderpfleger gearbeitet und wenig später als Wehrmachtskundiger in der Kneipe „Torpedokäfer“ der Prenzlauer Berg Anarchos mit mir einen Diavortrag über die Deutschen an der Ukrainischen Front gehalten. Die Farbdias stammten vom tazler Christian Uhle, dessen Vater sie 1943 in einer rückwärtigen Pioniereinheit geknipst hatte. Christian verkaufte sie anschließend an den Spiegel. Die Kneipe gibt es nicht mehr, ihr Name „Torpedokäfer“ ging auf den Titel der Autobiographie des Dadaisten, Rätekommunisten und Schiffsentführers Franz Jung zurück, der sowohl für die West-Antiautoritären im SDS und danach als auch für die Anarchisten in Prenzlauer Berg eine Art Vorbild war. Auch er im Übrigen aus Sicht von systemangepaßten Arschlöchern ein Gescheiterter.
.

Amerika
.
Handwerker
Ein Fliesenleger in Riedenburg, Michael Schmiedl,der viele Kunden im nahen Audi-Zentrum Ingolstadt bediente, hat die Schnauze voll und eine gelbe Weste angezogen: Seine Firma arbeite „nicht mehr für Besserwisser“, heißt es auf seiner Internetseite (schmiedl.net/ausschluss). „Wie jeder andere Handwerksbetrieb auch, haben wir in der Vergangenheit, was Zahlungsmoral und Problemkunden betrifft, unsere Erfahrungen gesammelt. Wir möchten zufriedene Kunden, die uns gerne weiterempfehlen, und auch unsere Arbeit schätzen.“
Da die Handwerksbetriebe meist über zu wenig Kunden klagen, griff der „Donaukurier“ diese ebenso seltene wie mutige Annonce auf und berichtete, dass die Firma von Schmiedl aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten eine „Ausschlussliste“ erstellt habe.In ihr ist festgelegt, von wem erzukünftig keine Aufträge mehr annimmt.Zu diesen gegenüber Handwerkern allzu arroganten „Problemkunden“ scheint er neben den Audi-Kadern auch die Siemens-Dozenten der örtlichen Universität zu zählen, denn „wir arbeiten nicht für Ingenieure, Doktoranden und Professoren der Firmen Audi und Siemens. Sollten sie zur o. g. Personengruppe gehören, sparen Sie sich (und uns) das Verfassen von E-Mails. Ausschluss bedeutet Ausschluss.“
Schmiedl will sie aber nicht ganz im Regen stehen lassen, denn am Schluß schreibt er auf seiner Internetseite: „Vielleicht werden sie hier fündig“. Wer das „hier“ anklickt, gerät auf eine Seite mit einer Liste von „Fliesenlegern, die noch für Audi oder Siemens Ingenieure arbeiten“. Dort sollen die leitenden Angestellten der beiden Ingolstädter Großkotzkonzerne also andere Fliesenverleger-Adressen im Raum Altmühltal finden, die es um eines lukrativen Auftrags willen vielleicht noch hinnehmen, sich dafür demütigen zu lassen – aber weit gefehlt: Auf dieser Internetseite findet man nur ein vom „Fliesenstudio Salvia & Käser“ gesponsertes „Eishockey-Magazin“, in dem es vornehmlich um den ERC Eishockeyclub Ingolstadt geht – mit den Highlights des Spiels seiner Mannschaft gegen die der Krefelder im Herbst 2017 und einem spannenden Interview mit dem Ingolstädter Spieler Dennis Swinnen, der nach einer Verletzung „wieder voll dabei“ ist. Ansonsten steht auf den zwei Seiten nur Wissenswertes über die Ingenieur-Gehälter bei Audi und Siemens und eine Rangliste der beliebtesten Arbeitgeber von Ingenieur- und Informatikstudenten (vorneweg Audi).
.

Wohnwagen-Besuch
.
Kamerunschafe
Das Kamerunschaf wurde aus dem Westafrikanischen Zwergschaf gezüchtet, es ist das einzige Nutztier, das gegenüber dem von der Tsetsefliege übertragenen Erreger der Naganseuche tolerant ist. Laut Wikipedia soll es als „Provianttier“ auf Schiffen nach Europa gelangt sein. Der BZ zufolge wurde es als Futter für Zoo-Tiere importiert. „Hobbyhalter“ konnten einige Vertreter dieser inzwischen „anerkannten Haarschafrasse“ retten. Heute gibt es bereits einen Verband der Deutschen Kamerunschafzüchter, deren Vorsitzender, der in Neudrossenfeld (Bayern) lebende Thomas Kilian ist. Der Halter von 39 rehbraunen Kamerunschafen, der es sich zusammen mit seiner Frau „seit 2012 zur Aufgabe gemacht hat, überwiegend den sehr seltenen schwarzmarken Farbschlag zu züchten“, meint: „Das Fleisch ist reines Muskelfleisch – wie beim Reh.“
Das Kamerunschaf erfreut sich auch in den deutschen mohammedanischen Kreisen zunehmender Beliebtheit. In Kreuzberg stand in den Siebzigerjahren vor dem islamischen Opferfest bei den Türken und Kurden mitunter ein lebendes Schaf auf ihrem Balkon, das dann in der Badewanne geschächtet wurde. Nach dem Fest hing sein Fell über dem Balkongeländer. Das waren jedoch durchweg westdeutsche, nach dem Mauerfall auch ostdeutsche Merinofleischschafe.
In Alt-Glienicke gibt es eine Schlachterei, in der Schafe geschächtet (d.h. ohne Betäubung getötet) werden dürfen. Dem Tagesspiegel erzählte der Besitzer: „‘Zu DDR-Zeiten wurden bei uns Tausende von Tieren geschächtet.‘ Diplomaten aus allen islamischen Ländern seien mit Familienangehörigen und Freunden das ganze Jahr über in der Schlachterei seines Vaters vorgefahren, hätten Schafe und Lämmer gekauft, die sie anschließend geschächtet hätten. In der DDR sei das nicht verboten gewesen. ‚Jetzt haben wir nur noch die jüdische Gemeinde als Kunden‘, sagt er. Warum die muslimischen Kunden seit dem Fall der Mauer nicht mehr kommen, kann er nur vermuten: ‚Ich bin zu teuer‘. Viele türkische Händler, aber auch Privatkunden fahren deshalb ins Umland und lassen Tiere ganz legal mit Betäubung schlachten“ – zur Freude der Tierschützer. Daneben kommt es angeblich auch zu „unerlaubtem Schächten“.
Die Schäferin Ruth Häckh verkaufte zum Opferfest einige Jahre Schafe an Türken. Als aber nach einer einzigenSchächtung auf ihrem Hof das Veterinäramt eine „Großrazzia“ veranstaltete, stieg sie „aus dem nervenaufreibenden Opfertagstrubel“ aus, wie sie in ihrem Buch „Einer für alle“ (2018) schreibt.
Die märkische Schriftstellerin Karen Duve begleitete einmal die „Animal Angels“ in die spanische Marokko-Exklave Melilla, wo zum Opferfest jedes Jahr 2000 Schafe geschächtet werden. Die Tierschutzgruppe geht dort hin, um kleine Verbesserungen des brutalen Rituals zu erreichen: „Sie sind sehr pragmatisch. Der Leiter von den ‚Animal Angels‘ litt jedoch derart mit den Tieren, dass es ihm immer schlechter ging. Das sich Identifizieren mit einem Tier können die nicht wählen, im Gegensatz zu mir. Sie fahren aber jedes Jahr dort hin: Einer muß dabei sein, um hinzuschauen, sagen sie.“
Karen Duve arbeitete ihr Erlebnis in Melilla in ihren Roman „Macht“ (2016) ein. Es gibt darin einen Dialog zwischen einer Tierschützerin und zwei Kindern, die sich immer dort drängten, wo gerade einem Schaf- oder Ziegenbock der Hals durchschnitten wurde. Die zwei Kinder standen an einer Zeltwand, wo man mehrere gefesselte Schafe abgelegt hatte: „Ihre Augen sind weit aufgerissen, die großen Körper pumpen schwer, die Wolle hebt und senkt sich.“ Dann wird ein zusammengeschnürter Ziegenbock neben sie gelegt: „Das Böckchen reckt den Kopf und schreit. Es meckert nicht, es schreit. Unglaublich laut. Wie ein Mensch, der in einen Abgrund fällt.“ Eins der Kinder beugt sich zu ihm herunter und macht sein Schreien höhnisch nach, sein Freund stellt sich ebenfalls vor das Tier, „als das Böckchen das nächste Mal seinen Kopf reckt, um zu schreien, gibt er ihm eine Ohrfeige.“ Die Tierschützerin kann nicht mehr an sich halten und schimpft: „Dieser Ziegenbock muß gleich den Kopf dafür hinhalten, dass Rotzlöffel wie ihr verschont werden könnt. Ist euch das eigentlich klar?“ Die beiden Jungs schauen sie verständnislos an, sie erklärt: „Sobald hier die Schafe und Ziegenböcke ausgehen, nimmt euer Gott nämlich auch kleine Jungs. Eigentlich findet er kleine Jungs sogar viel besser als Schafe.“
In Berlin, genauer gesagt in Neukölln, sind Ende Mai vier weibliche Kamerunschafe, die mutmaßlich am Ende des Fastenmonats Ramadan zum Opferfest (vom 11.-19. August) geschlachtet werden sollten, von der Polizei von ihren Kabelbinder-Fesseln befreit, beschlagnahmt und an einem geheim gehaltenen Ort in Sicherheit gebracht worden. Mit einem Audi hatte man die Tiere am 24.Mai aus dem Kofferraum geholt und auf einen „Autoplatz“ in Alt-Buckow angebunden. Laut Einsatzprotokoll standen sie „auf Split, hatten kein Heu, nur ein bißchen Wasser. In einem Bauwagen lagen Grillanzünder“. Die Hauptstadtpresse vermutete sofort, dass sie dem berühmt-berüchtigten Issa Remmo (51) gehören, den sie stets als „Clanchef“ libanesischer Herkunft bezeichnet und gegen den die Abteilung „Organisierte Kriminalität“ schon seit langem ein Kompromat zusammenstellt. „Ich bin nicht Oberhaupt von einem Clan oder für meine Brüder und deren Familien,“ beteuerte er in der Berliner Zeitung, nachdem ein Jahr zuvor, 2017, drei Angehörige des laut taz „arabischstämmigen Remmoclans“ in Moabit angeklagt worden waren, im Bodemuseum eine zwei Zentner schwere Goldmünze geklaut zu haben. Ein anderer, entfernterer, Angehöriger, Houssam Remmo, kämpft allerdings auf Seiten des Gesetzes – und trat in Bremen aus der SPD aus, weil die sich „zu wenig für die Polizei stark macht“.
Issa Remmo hat 15 Kinder, laut Berliner Kurier soll „der Araber-Clan Remmo Kleingärtner ins Visier genommen und sie von ihren Grundstücken vertrieben haben“. Die Polizei beschlagnahmte in Berlin 77 Immobilien von ihnen, später dann auch noch die Mieteinnahmen daraus. Issa Remmo bestritt, damit etwas zu tun zu haben, er mache nur im Libanon Immobiliengeschäfte.
Der „Autoplatz“-Besitzer soll schon mehrmals wegen Betrugs verurteilt worden sein. Nachdem die vier Kamerunschafe bei ihm beschlagnahmt wurden, meldete sich „ein Mitglied der Großfamilie Remmo“ bei den Behörden und verlangte – vergeblich – die Herausgabe der Tiere. Issa Remmo versicherte der BZ sogleich: „Mir gehört weder ein Autoplatz noch lasse ich einen betreiben. Ich kenne auch keine Schafe und kenne auch niemanden, der Schafe besitzt.“ Die BZ behauptet, dass der „Remmo-Clan“ dem Züchter, bei dem die vier Kamerunschafe versteckt wurden, „auf der Spur“ ist, weswegen der „inkognito bleiben“ muß.
Ich finde die Berichterstattung der Hauptstadtpresse in diesem Fall ziemlich antisemitisch. Aber weniger anthropozentrisch gedacht begrüße ich natürlich die Rettung der Kamerunschafe, d.h. der „Vier vom Autoplatz“.
.

In der Wüste
.
Versuchstiere
Eine Parole an der FU hieß: „Schluß mit den Quälereien im Mäusebunker!“ Gemeint war das Tierversuchslaboratorium. Nach der Wende übernahm die Charité den Steglitzer Mäusebunker und leerte ihn langsam, da sie in Buch einen schöneren und größeren errichtet hatte. Bis 2020 werden im alten nur noch einige Kleintiere gehalten (früher waren es auch Pferde und Schweine). Damals demonstrierten auch immer mal wieder junge Tierschützer vor dem Gebäude. Heute fordern sie auf BVG-Bussen „Tierversuchsfrei forschen“ – und zwar am Computer, das sei billiger und besser. Aber ob an Lebewesen oder an Rechnern, es bleibt das Problem, „dass keine experimentell gewonnene Erkenntnis ohne ausdrückliche Vorbehalte verallgemeinert werden kann,“ wie der Philosoph Georges Canguilhem in „Das Experimentieren in der Tierbiologie“ schreibt. Egal, ob es sich um die Erforschung der bedingten Reflexe beim Hund, des Gleichgewichtssinns bei der Taube, der Regeneration beim Polypen, des mütterlichen Verhaltens bei der Ratte, der Befruchtung beim Seeigel, der Muskelreflexe beim Frosch, der Vererbung bei der Fruchtfliege oder des Blutkreislaufs beim Pferd handelt. Der wohl größte aller Tiertöter für den Fortschritt, der Mediziner Claude Bernard, stellte fest, „dass nicht nur kein Tier einem anderen derselben Art absolut vergleichbar ist, sondern dass ein und dasselbe Tier je nach dem Zeitpunkt, zu dem man es untersucht, auch mit sich selbst nicht vergleichbar ist.“
Die angehende russische Biologin Tanja Kukotski, Tochter eines berühmten Mediziners, begann ein Praktikum in einem Moskauer Gehirnforschungslabor. Eine Assistentin leitete sie an: „Meine kleinen Ratten“, gurrte sie, nahm mit zwei Fingern ein Rattenbaby, streichelte das schmale Rückrat und trennte mit einer Schere sauber und präzise den Kopf ab. Den Körper, der leicht zusammengezuckt war, warf sie in eine Schale, das Köpfchen legte sie liebevoll auf den Objektträger. Danach sah sie Tanja prüfend an und fragte mit einem sonderbaren Anflug von Stolz: „Na, schaffst du das auch?“ „Ja“, sagte Tanja.
Aber nach zwei Jahren bat sie ihren Vater um ein Gespräch. Es geht um „Professionalität“, verstand er. „Professionellist der, der Verantwortung auf sich nimmt, aus den vorhandenen Möglichkeiten die akzeptabelste auswählt, und manchmal ist das eine Entscheidung über Leben und Tod. Aber dein Problem ist rein spekulativ. Du hast einen Augenblick lang geglaubt, du könntest zur Mörderin werden.“
„Papa, das habe ich nicht nur geglaubt,“ sagte sie. „Was habe ich denn zwei Jahre lang gemacht? Ratten getötet. Einen ganzen Berg habe ich abgestochen. Und das war ganz einfach. Schrapps, schrapps. Aber am Ende, da ist eine Barriere gefallen.“ „Es gibt eine Hierarchie der Werte,“ wandte der Vater ein, „und da steht das Menschenleben ganz an der Spitze.“ Du verstehst mich nicht, klagte seine Tochter, „ich steche am laufenden Band Ratten ab,“ und auf dem Weg zu irgendeiner „Erkenntnis“ ist es mir passiert, „dass ich den Unterschied zwischen einem Ratten- und einem Menschenleben nicht mehr sehe. Ich will nicht länger ein gutes Mädchen sein, das Ratten absticht.“ Ihr Vater sah sie ratlos an. „Ich will ein schlechtes Mädchen sein, das niemanden absticht“ – ein ungehorsames. Diesen Dialog entnahm ich dem Roman der Genetikerin Ljudmila Ulitzkaja „Reise in den siebenten Himmel“, die folgende „story“ der Autobiographie des US-Psychologen Ralph Metzner.
Er schreibt über seine wissenschaftlichen Anfänge an der Harvard-Universität: „Am Ende des ersten Jahres sollten wir auch eine experimentelle Studie anfertigen, und ich machte ein Labyrinth-Lernexperiment mit Ratten, das sich als traumatisch für mich erwies. Ich baute dieses Labyrinth mit den Ratten im Keller eines der Harvard-Gebäude auf. Ich machte das während der Weihnachtsferien, als alle die Universität verlassen hatten. Das Experiment bewies genau das, was es beweisen sollte, und ich schrieb einen Aufsatz für das Seminar darüber. Aber am Ende des Experiments hatte ich diese Ratten und wusste nicht, was ich jetzt mit ihnen anfangen sollte? Ich musste den Raum aufräumen und die Ratten loswerden. Ich weiß noch, dass ich verschiedene Professoren aufsuchte und sie fragte, was ich mit den Ratten machen sollte. Ich bekam lauter ziemlich gruselige Antworten: „Pack sie am Schwanz und schlag sie auf eine Tischkante oder erschlage sie mit einem Hammer.“ Ich war entsetzt. Ich hatte keine Ahnung, dass man von mir erwarten würde, die Ratten umzubringen. Sie nannten es, die Tiere ‚opfern‘. Ich rief sogar professionelle Kammerjäger zur Hilfe. Als ich ihnen erzählte, die Ratten, die getötet werden sollten, befänden sich in Käfigen, weigerten sie sich, sich darum zu kümmern. So etwas machen wir nicht, sagten sie. Schließlich riet mir ein älterer Doktorand: ‚Du musst dir Chloroform besorgen und es mit den Ratten in große zylindrische Pappröhren tun – du musst sie vergasen‘. Ich musste es tun. Also gab ich Chloroform in den Behälter mit 20 oder 30 Ratten. Sie zappelten darin eine Weile herum und waren dann still. Als ich aufstand, stieß ich mit dem Kopf gegen eine Stahlstrebe und schlug mich selbst K.O. Ich weiß nicht, wie lange ich bewusstlos war. Einige Jahre später bat ich den Großen Rattengeist für dieses Vergehen um Vergebung. Zu jener Zeit wusste ich nur, dass ich nie wieder irgendein Experiment mit Tieren machen würde.“
Ähnlich ging es der amerikanischen Nutztierexpertin und Konstrukteurin von humaneren Schlachtmethoden Temple Grandin. Sie schrieb ihre Dissertation über die „Auswirkungen einer angereichertenim Vergleich zu einer verarmten Umwelt auf die Gehirnentwicklung von Schweinen – wie gesellig und gutmütig sich die ‚angereicherten‘ Schweine entwickelt hätten, wie übererregbar und aggressiv (und fast ‚autistisch‘) dagegen ihre ‚verarmten‘ Artgenossen gewesen seien. „Ich habe meine angereicherten Schweine schließlich richtig geliebt“, sagte sie. „Ich habe sehr an ihnen gehangen. So sehr, dass ich sie nicht töten konnte.“ Sie hatte die Tiere nach Abschluß des Experiments opfern müssen, um ihre Gehirne untersuchen zu können. Sie schilderte, wie die Schweine ihr voller Vertrauen gefolgt seien, als sie sie auf ihrem letzten Gang begleitete, und wie sie die Tiere beruhigend gestreichelt und zu ihnen gesprochen habe, während man sie tötete. Sie sei sehr unglücklich über den Tod der Tiere gewesen – „Ich habe geweint und geweint“. – So schildert der Neurologe Oliver Sacks die Geschichte, die Temple Grandin ihm während eines Besuchs erzählte (in: „Eine Anthropologin auf dem Mars“ – 1997).
Anders die DDR-Biologin Carmen Rohrbach. Sie arbeitete vom Westen freigekauft als Verhaltensforscherin am Max Planck Institut für Verhaltensphysiologie in Seewiesen. Im Auftrag des Instituts erforschte Carmen Rohrbach ein Jahr lang das Verhalten der Meerechsen auf einer der Galapagosinseln. Bei der Abreise war sie sich sicher: „In meinem Beruf als Biologin werde ich nicht weiterarbeiten. Zu deutlich ist mir meine fragwürdige Rolle geworden, die ich als Wissenschaftlerin gespielt habe.“ Sie erlebte zwar ein wunderbares Forschungsjahr auf „ihrer“ kleinen unbewohnten Insel, „doch ich habe es auf Kosten der Meerechsen getan, gerade dieser Tiere, die die Friedfertigkeit und das zeitlos paradiesische Leben am vollkommensten verkörpern. Ausgerechnet diese Tiere mußte ich mit meinen Fang- und Messaktionen verstören und belästigen. Da ich nun einmal diese vielen Daten gesammelt habe, werde ich sie auch auswerten und zu einer Arbeit zusammenstellen. Diese Arbeit wird zugleich der Abschluss meiner Tätigkeit als Biologin sein, denn ich kann nicht länger etwas tun, dessen Sinn und Nutzen ich nicht sehe. Und erst recht könnte ich es nicht mehr verantworten, Tiere in Gefangenschaft zu halten und womöglich sogar mit ihnen zu experimentieren…Ich werde nach Deutschland zurückkehren und versuchen, eine Aufgabe zu finden, die mir sinnvoll erscheint.“ Diese selbstgestellte „Aufgabe“ bestand dann darin, dass sie eine Reiseschriftstellerin wurde, die extremtouristische „Destinations“ aufsucht und anschließend darüber berichtet.
.

Camping am Waldrand
.
Der Riesenalk
In den Naturkundemuseen herrscht kein Mangel an diesen pinguinähnlichen großen Vögeln, die zu den Alken zählen, und mit den Papageientauchern und den Trottellumen verwandt sind, d.h. sie waren es, denn sie sind ausgestorben. Es git sie also nur noch in Museen. Zu Millionen brüteten diese flugunfähigen Vögel einst an den Küsten und auf den menschenleeren Inseln des Nordatlantiks, wo sie von Seeleuten nach und nach alle erschlagen wurden. Der französische Kapitän Jacques Cartier berichtete über seine Expedition durch die Inselwelt Neufundlands 1534, dass sich dort im Frühjahr auf einer kleinen Insel Tausende brütender Vögel regelrecht auf den Füßen standen. Ein paar kräftige Schläge mit dem Ruder hätten genügt, um eine ganze Schiffsmannschaft mit Fleisch zu versorgen. „Generationen von Seeleuten folgten Cartiers Beispiel. Manche Besatzungen wollten länger als nur für einen Tag frisches Fleisch bekommen, also nagelten sie die Vögel mit den Füßen auf die Schiffsplanken, so dass sie noch einige Tage qualvoll weiterlebten. Auch bot der Alltag an Bord wenig Abwechslung und erzeugte viele Spannungen – da war eine ‚Jagdpartie‘, ein Massaker unter wehrlosen Vögeln, eine willkommene Abwechslung,“ schreibt „Die Zeit“.
Das letzte brütende Paar wurde von drei isländischen Fischern 1844 im Auftrag eines dänischen Naturforschers auf der Felseninsel Eldey getötet, ihre Eingeweide befinden sich heute in einem Formalingefäß im Kopenhagener Naturkundemuseum, die Bälger sind verschwunden. Schon vorher, als die Riesenalke selten wurden, zahlten die Museen immer höhere Preise für einen Balg. Man kann also sagen, dass diese Art von Ornithologen ausgerottet wurde.
Seit es 2003 einigen Embryologen gelang, mit Hilfe einer Hausziege aus einigen Zellen des letzten – ebenfalls erschlagenen – Pyrenäensteinbocks einen Klon für zehn Minuten am Leben zu erhalten, versichern uns jedoch Biologen und Gentechniker, dass sie bald auch den Riesenalk wiederauferstehen lassen können. So wie es im Film „Jurassic Park“ mit den Dinosauriern geschah. „Zweiflern sage ich immer: Wenn wir es gar nicht erst versuchen, woher sollen wir dann wissen, dass es unmöglich ist?“ meint der Klonexperte Hwang In Sung. Ökologen halten das für reine Geldverschwendung. Es ist das Geld von US-Millionären, mit dem die „Long Now Foundation“ Projekte zur „De-Extinction“ finanziert. Die Stiftung wurde 1996 von Stewart Brand, dem Gründer des „Whole Earth Catalogue“, ins Leben gerufen, um die Biodiversität und genetische Vielfalt zu bewahren bzw. wiederherzustellen.
Bis es so weit ist werden wir über den Riesenalk nur Museumsgeschichten erfahren. 78 Präparate und fast ebensoviele Eier gibt es weltweit. Hamburgs Zoologisches Museum hat seltsamerweise keinen Riesenalk (das nächste Präparat staubt in Kiel vor sich hin), dafür aber einen künstlerisch tätigen Biologen, Jochen Lempert, der wissenschaftshistorisch unterwegs ist: Seit 1990 fotografiert er „The Skins of Alca Impennis“, d.h. die Präparate des ausgestorbenen Riesenalks in den Naturkundemuseen der Welt, bis jetzt 45, jedesmal den Kopf im Profil. Der ausgestopfte Riesenalk im Berliner Naturkundemuseum wird dort als ein „Top-Präparat und absolut unersetzbar“ bezeichnet. Während das in der Zoologischen Staatssammlung München ein Fake ist: ein aus verschiedenen Vogelarten zusammengesetzter Riesenspaßalk. Da jedoch im Katalog zwei Riesenalke verzeichnet waren, gab man die Hoffnung nicht auf – und fand die echten Präparate schließlich auch: in der Besenkammer, wo sie in einer mit „Eulen“ beschrifteten Sammlungskiste lagen. Auch dort zählt man sie nun zu den „wertvollsten, absolut unersetzbaren Stücken der Sammlung“. Der sächsische Riesenalk gilt gar als „Leipzigs heimliche Mona Lisa“, man weiß nur noch nicht, wo man mit ihm hin soll, denn es muß erst noch ein neuer Standort für das Naturkundemuseum gefunden werden, wobei die Stadtverwaltung den DDR-„Bowlingtreff“ favorisiert, der seit über 20 Jahren leer steht. 2000 veröffentlichte der britische Wissenschaftshistoriker Jeremy Gaskell ein Buch über die Ausrottung und Musealisierung des Riesenalks: „Who Killed the Great Auk?“
.

Havanna
.
Mopsfledermaus
Einmal habe ich diese winzige Fledermaus, die nur 6 bis 13 Gramm wiegen soll, selbst gesehen. Da huschte etwas über eine Straßenlampe. Das war bei Siegen, ein Freund machte mich darauf aufmerksam: „Eine Mopsfledermaus“, sagte er, „sehr selten.“ Inzwischen ist sie in ganz Nordrhein-Westfalen „praktisch ausgestorben“, meinen die dortigen Naturschützer. In anderen Bundesländern sieht es nicht viel besser aus. Dabei war Deutschland einmal ihr Hauptverbreitungsgebiet. Im Osten und vor allem in Berlin machte ihnen die energetische Fassadenverdämmung der Plattenbauten den Garaus, da sie ihnen ihre Schlafplätze nahm.
Hinzu kam das flächendeckende Insektensterben und dann wie überall die effiziente Bewirtschaftung der deutschen Wälder, die kein Totholz duldet. Da will nun das Bundesumweltministerium mit 5,4 Millionen Euro gegensteuern und zumindest die bundeseigenen Wälder „naturnäher bewirtschaften“ sowie einige „Kerngebiete“ aus der forstwirschaftlichen Nutzung herausnehmen. Entscheidend für den effektiven Schutz der Mopsfledermaus sei „eine nachhaltige Waldbewirtschaftung, durch die ihr genügend Quartiere und Insekten als Nahrung zur Verfügung stehen“, erklärte Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz, gegenüber der Zeit. Dazu käme das Aufhängen von Fledermausquartieren an Bäumen und Häusern.
Hoffen wir das Beste, liebe Mopsfledermaus. Ihre Rettung wird nicht einfach sein, denn wir haben nicht nur eine sozialdemokratische Umweltministerin, die allerlei vom Aussterben bedrohten Arten mit Millionensummen wieder eine gewisse Lebenslust verschaffen will, sondern auch eine Agrarministerin, die auf keinen Fall das Ausbringen von Pestiziden und damit das Insektensterben reduzieren will. Die Mopsfledermaus lebt aber nun mal gerade von Insekten. Der globale Widerspruch zwischen Ökologie und Ökonomie wird hierzulande also zwischen zwei gewichtigen Frauen ausgetragen. Die beiden Ministerinnen senden unterschiedliche Laute: die eine, um den Chemiekonzernen verständlich zu bleiben, und die andere, um sich Gehör bei den Naturfreunden zu verschaffen. Das haben sie witzigerweise mit der Mopsfledermaus gemeinsam, die als „stumme Art“ bezeichnet wird, was sie aber gar nicht ist, denn die Forschung hat ergeben, dass sie sogar zwei verschiedene – für uns allerdings unhörbare – Ortungslaute senden kann: aus dem Mund und aus der Nase. Das Signal aus der Nase dient ihr zum Insektenfang. Das Signal aus dem Mund zur allgemeinen Orientierung und zur Kommunikation. Ihre Wochenstube, die 15 bis 20 quasselnde Weibchen umfassen kann, befindet sich laut Wikipedia meist im Wald oder in der Nähe eines Waldes.
Der Harvard-Philosoph Thomas Nagel fragte sich 1979, „Wie es ist, eine Fledermaus zu sein?“. Er meinte, das werden wir nie wissen, da wir uns zu fremd sind. „Come on“, entgegneten ihm daraufhin die Verhaltensforscher, es sind Säugetiere, sie haben Hunger, Durst, Sex, unterhalten sich, freuen sich, leiden usw. „Also gib dir ein bisschen Mühe, Nagel!“
.

Ton-in-Ton
.
Petplayer
Das sind Leute, die sich als Haustiere verkleiden. So etwas lappt außerhalb der Karnevals- und Kostümpartys in die SM-Scene und in die Aktionskunst. Jene tragen z.B. teure Hunde- oder Pferdemasken aus Latex- oder Leder, und diese lassen sich z.B. nackt an der Leine herumführen, berühmt dafür ist der russische Künstler Oleg Kulik und die Greifswalder Künstlerin Pauline Popp, er als Jund und sie als Ratte.
Petplayer treten in internationalen Galerien auf oder sie treffen sich als Fetischgruppe in ländlich-unsittlichen Clubs. Die „Welt“ hat herausgefunden: „Von den Beteiligten wird allein schon die strenge Hierarchie zwischen den selbst ernannten Pets und ihren Haltern als erotisch empfunden – sowohl von denen, die Befehle erteilen, als auch von jenen, die sie ausführen.“ Die meisten Teilnehmer sind Männer – entweder „Herrchen“ oder „Dogplayer“, von den letzteren sind einige nackt „mit einem Requisit, das wie ein Hundeschwanz aussieht. Mittels eines Plugs – einer Art Pfropfen – ist er im Anus befestigt“. Sie essen nicht am Tisch, sondern vom Boden: „Schlabbernd machen sich ein Softwareentwickler, ein Möbeltischler und ein Rechtsanwalt über das Putengeschnetzelte in ihren Näpfen her.“ Von den Petplayern lassen sich die Zoomimiker unterscheiden: erstere werden gedemütigt, letztere geschätzt.
Zoomimiker treffen sich u.a. auf „Furry Conventions“: mit Masken und Kostümen von allen möglichen Tieren. Man glaubt es kaum, aber auf dem „Furry Convention Calendar 2019“ sind 64 solcher Treffen weltweit aufgeführt – von Indonesien, Neuseeland und Taiwan über Madrid und Mexiko bis nach Schweden, die Ukraine und vor allem natürlich die USA. In Deutschland finden sie heuer in Reutlingen und Suhl statt, 2018 fand ein großes Treffen im Berliner Hotel Estrel statt, wo regelmäßig auch „Look Alike Contests“ veranstaltet werden: Wettbewerbe von Leuten, die so aussehen und auch so singen wie z.B. Elvis Presley oder Heino. Die „Furrys“ sehen z.B. so aus wie ein Wolf oder eine große Katze, beide Verkleidungen werden gerne von Frauen gewählt. Bei Amazon und Ebay und in zig Online-Shops kann man sich diesbezüglich ausstatten. Männer nehmen gerne eine Tigermaske und Pranken aus Stoff und tragen dazu Schlips und Anzug. Sie haben wahrscheinlich alle „Die Tiger-Strategie“ von „Deutschlands führendem Zeitmanagement-Experten“ Lothar Seiwert gelesen, sein Buch handelt davon: „Wer für seine Erfolge nicht selber sorgt, hat sie nicht verdient“. Seiwert sieht zwar im Vergleich zu Tigern grottenhässlich aus, aber dafür kann er seine „Erfolgsstrategie“ bestimmt überzeugend „rüberbringen“. Ansonsten gibt es auch noch das Hörbuch „Der Weg des Tigers: Erkenne und nutze deine innere Kraft“ vom Wiener Vortragsredner Bernhard Moestl, der ebenfalls ziemlich Scheiße aussieht, unddas Buch „Führen mit der T.I.G.E.R.-Methode“ des Schweizer „Leadership Partners“ und Motorsportlers Martin Buerki.
Die Chinesen haben es eher mit dem Wolf: In dem absoluten Ratgeber-Bestseller „Der Zorn der Wölfe“ von Jiang Rong geht es darum, dass die Chinesen alle dumme Schafe sind, jetzt im Neoliberalismus unter kommunistischer Führung sollen und müssen sie aber alle zu Wölfen werden. Heraus kommen dabei wahrscheinlich lauter „Problemwölfe“. Die amerikanisch verblödeten, wie die Yale-Professorin Amy Chua, bleiben jedoch beim Tiger: Sie schrieb den Erziehungs-Bestseller „Tiger Mom“, in dem sie z.B. rät, wenn die Kinder nicht spuren, Druck auszuüben – und ihnen u.a. damit zu drohen, ihre Kuscheltiere zu verbrennen. Das Gegenteil ist der Erziehungsbestseller der Amerikanerin Esther Wojcicki „Panda Mama“: ruhig und gelassen bleiben, rät sie.
Je weniger Tiere es auf der Welt gibt, desto mehr werden sie zu Vorbildern für die „Zivilisierten“, und sei es nur als Party-Gag oder SM-Rolemodel.
.
Auf der letzten „Eurofurence“ im Berliner Estrel-Hotelliefen viele „Tiger“ herum,es war das weltweit älteste Treffen, „das jährlich in- und ausländische Fans von vermenschlichtenTiergestalten zusammenbringt.“ Einige der „Tiger“ sahen jedoch eher wie Comictiere aus, desgleichen viele „Bären“, „Wölfe“, „Papageien“, „Mäuse“, „Schakale“ und „Füchse“. Die „Märkische Allgemeine Zeitung“ interviewte einen „Saurier“: „Ich mache das seit 2004 – es ist mir eigentlich egal, was die Leute denken,“ sagte er. „Auch sein Kumpel, der Wolf, lässt sich von den Urteilen der anderen nicht verunsichern. ‚Ich habe als Furry gelernt, nicht mehr scheu zu sein‘.“ Maximilian Nitschke-Stockmann, Mitorganisator der „Eurofurence“ 2018, an derüber 3000 „Furrys“ teilnahmen, meint: „Wir sind ein großer, verkuschelter Haufen“. Der MAZ-Reporter hat herausbekommen: „Die meisten Kostüme kosten Tausende Euro, in ihnen stecken Hunderte Arbeitsstunden. Manche sind mit 3D-Augen und Belüftungssystemen ausgestattet, eins mit integrierter Videokamera. Kostenpunkt? So teuer wie ein Kleinwagen.“
Die Vermenschlichung von Tiergestalten begann mit den Fabeln von Äsop und Lafontaine. Davon ausgehend liegen solchen Fabeln Zuschreibungen von bestimmten dominierenden Charakterzügen zugrunde – wie Neid, Geiz, Eitelkeit, die mit Tieren identifiziert werden: der listige Fuchs, die kluge Eule, der tapsige Bär, der eitle Pfau usw.. Und diese wurden dann – auch zeichnerisch – auf bestimmte Menschen übertragen: Geschäftsleute, Bürgermeister, Marktfrauen, Offiziere…
Dieses Fabel-Prinzip gilt auch noch für die „Furry Conventions“ insofern die Leute dort sich als ein Tier verkleiden, von dem sie meinen, dass sie sich damit identifizieren können, also dass es Charaktereigenschaften hat, die man selber auch hat oder haben möchte. Der „stern“ veröffentlichte unlängst einen „Persönlichkeitstest: Welches Tier entspricht ihrem Charakter?“ Ende Juni vergewaltigte ein „Mann mit Wolfsmaske“ in einem Münchner Park ein Mädchen. Die Soko „Wolf“ ermittelt.
.

Einsame Strände
.
Speckkäfer
Mit Inkarnation ist die Fleischwerdung gemeint, mit Reinkarnation also die Wiederfleischwerdung. Ein komplizierter metaphysisch-moralischer Vorgang, denkt man. In naturwissenschaftlicher Hinsicht ist die Reinkarnation allerdings ziemlich einfach. Nehmen wir an, ein Mensch ist erschlagen worden, oder noch besser: ein Maulwurf, von einem Schrebergärtner mit dem Spaten. Wie geht es nun weiter mit seiner Reinkarnation, die primär ein Umwandlungsprozeß ist? Der Insektenforscher Jean-Henri Fabre hat sich mit den Umwandlern beschäftigt, „welche die Überreste des Abgelebten wieder in die Schätze des Lebens überführen.“
Als erstes entdeckt eine Ameise das tote Tier, „und sie geht als Letzte“. Dann kommen Fliegen unterschiedlichster Arten, u.a. Gold- und Fleischfliegen. Sie kriechen unter den Kadaver und legen ihre Eier dort ab: Mehrere Gelege mit je 150 Eiern von jedem Weibchen. Dazu brauchen sie einige Tage. Etliche Eier werden von den Ameisen geraubt. Nach 24 Stunden schlüpfen die Jungen, sie sondern ein Sekret ab und verflüssigen Teile des Fleisches, das sie aufsaugen. Sie haben Atemlöcher, wenn sie zu viele sind und zu viel verflüssigen ersticken einige Goldfliegenmaden darin. Anders die Fleischfliegen, die ihre Maden lebend gebären: Diese haben ihre Atemlöcher am Hinterleib, der verdickt ist, und damit als „Schwimmer fungiert“. Vom verflüssigten Fleisch tropft viel in die Erde ab, „wenn die Maden dick genug sind, kriechen auch sie in die Erde, um sich zu verpuppen“.
Dann kommen die Schmeißfliegen – in „Kolonnen“, jedes Weibchen hat an die 20.000 Eier im Leib. Sie „riechen Tote über Hunderte von Metern,“ heißt es auf „wissenschaft.de“. Die Schmeißfliegeneltern leben zwar von Nektar und Pollen, aber ihre Maden brauchen tierisches Eiweiß. Sie fressen eng zusammengedrängt – mit einer „Atemrosette“ am Hinterleib, „die sich auf der Flüssigkeit entfaltet“. Drumherum warten immer mehr Stutzkäfer darauf, dass die Madenmassen sich fett gefressen haben, dann verzehren sie diese – nur wenige überleben. Wenn die Stutzkäfer fertig sind, fallen die Speckkäfer über das inzwischen „mumifizierte Aas“ her. Sie verzehren den Kadaver bis auf die Knochen.
Speckkäfer können daneben große Schäden an Wollstoffen, Fellen, und in Insekten- und Tiersammlungen anrichten. Weil sie in der Nähe des Menschen auch in der kalten Jahreszeit ununterbrochen Generationen hervorbringen, kommt es in den Naturkundemuseen immer wieder zum „Speckkäfer-Alarm“, wie es auf „kammerjäger.de“ heißt. Speckkäfer werden aber laut Wikipedia auch gezielt von Museen eingesetzt, um Tierskelette von Weichteilen zu reinigen. Die Speckkäferweibchen legen ihre Eier u.a. in Fellreste und in dunkle und warme Bereiche.
Am Verzehr der letzten Aasreste beteiligen sich auch noch Aas- und Raubkäfer, ebenso ihre Maden, wobei die der Raubkäfer sich auch gegenseitig töten und verzehren. Speck- und Aaskäfer feilen „mit ihrem geduldigen Zahn“ Knochenteilchen heraus.
Noch ist das Fell übrig, darauf stürzen sich die Motten mit ihren Raupen. Ebenso der Geperlte Erdkäfer. „Kein Atom darf verloren gehen“. Gilt auch: Kein Gen darf verloren gehen? Im Inneren des verwesenden Kadavers ist unterdes längst das Immunsystem des Maulwurfs zusammengebrochen, so dass auch die Bakterien beginnen konnten, ihn zu verdauen. Von außen kommen weitere dazu sowie auch Pilze.
Wir verabscheuen die Aasfliegen, es gab jedoch Kulturen, in denen diese Fliegen willkommen waren – wie die Moche, die bis zum achten Jahrhundert an der Küste Perus lebten. Sie boten den Aasfressern ihre Verstorbenen an. Deren Seelen werden von den Fliegen befreit und wieder in der Welt ausgesetzt, glaubten die Moche. Ihnen zufolge ist die Reinkarnation mithin eine Angelegenheit der Seele, die sich dazu der Fliegen bedient. Für die Naturwissenschaft funktioniert die Reinkarnation dagegen fast nur mit den Insekten – aber ohne die Seele, weswegen man unter Gläubigen auch gerne von seelenloser Wissenschaft spricht.
Die Insekten, im Verein mit Bakterien und Pilzen, vertilgen den erschlagenen Maulwurf jedenfalls restlos. Er hat sich irgendwann vollständig in Nahrung für sie aufgelöst. Gleichzeitig werden diese Aasvertilger jedoch auch zur Nahrung von anderen Tieren, und sogar von (fleischfressenden) Pflanzen. Die Insekten werden in Massen von Vögeln verzehrt, aber auch von Maulwürfen, die zur Ordnung der Insektenfresser zählen, und von Würmern und Insektenmaden leben. Sie verpaaren sich im Frühjahr, ihre Weibchen bekommen nach etwa 35 Tagen bis zu neun nackte Junge.
Mit gutem Gewissen kann man nun eins oder sogar mehrere von ihnen als Reinkarnation des erschlagenen Maulwurfs bezeichnen, und nicht nur bezeichnen, sondern auch nahezu lückenlos chemisch-physikalisch nachvollziehen. Dies würde ebenso der Fall sein, wenn der Maulwurf ein erschlagener Mensch gewesen wäre, nur hätte man dessen Reinkarnation, seine „Wiedergeburt“, nicht so leicht beobachten können, weil die Entwicklung dahin, da man ihn schnell begraben hätte, vollständig unter der Erde stattfände, wo etliche der erwähnten Aasvertilger nicht hinkommen, dafür jedoch andere.
Dies hätte auch bei dem erschlagenen Maulwurf der Fall sein können, wenn nämlich eine weitere Käferart, die Totengräber, rechtzeitig von seinem Ableben erfahren hätte – über den Aasgeruch, den die freigesetzten Stoffe Cadaverin und Putrescin verbreiten. Die Totengräber rücken in kleinen Gruppen an, „ein Weibchen und drei Männchen“ bei Fabre. Sie machen sich unter dem Kadaver zu schaffen und buddeln ihn ein: möglichst so schnell, dass sie den Fliegen zuvorkommen. Nach zwei Tagen unter der Erde ist aus dem Maulwurf eine „grünliche Abscheulichkeit“ geworden, „enthaart und geschrumpft zu einem molligen Balg“. Dieser ist für die Totengräber-Kinder gedacht. Sie verzehren ihn eilig in zwei Wochen, dann verpuppen sie sich, bevor die Mikroorganismen im Boden den Maulwurfrest in Humus verwandeln, wie Fabre meint. Während die farbenprächtigen Totengräber-Eltern von Käfermilben langsam zerfressen werden und sich überdies auch noch gegenseitig verzehren.
Ein Team von Wissenschaftlern aus vier deutschen Forschungsinstituten hat die Rolle des Schwarzhörnigen Totengräbers und seiner symbiontischen Mikroorganismen bei der Verdauung und chemischen Konservierung von Aas während der Brutzeit untersucht: Der von den Totengräbern unter der Erde geformte „Fleischball“, die Nahrung für ihren Nachwuchs, ist von dort lebenden Bakterien und Pilzen gefährdet, die auch an diesem Fleisch interessiert sind. Deswegen produzieren die Totengräbereltern „Verdauungsenzyme und antimikrobielle Proteine, die sie als Sekret auf das Fleisch übertragen“, das sie damit für ihre Maden „chemisch reinigen“. Die natürliche oder ökologische Reinkarnation ist nichts anderes als eine „ewige Wiederkehr“, weswegen so viele unserer Gene z.B. mit denen der Aasfliegen identisch geworden sind: bereits über 60%.
.

Sehenswürdigkeiten
.
Wiederbelebung
An der Yale-Universität haben Hirnforscher die Stoffwechselaktivitäten der Gehirne von 32 jungen Schweine vier Stunden nach ihrem Tod wiederhergestellt, indem sie einen sauerstoffhaltigen Blutersatz durch die Gefäße gepumpt haben.
Das gibt der Debatte des bundesdeutschen Gesundheitsministers über Organspenden, deren Ausgangspunkt der Gehirntod ist, neue Argumente, meint die FAZ, denn bisher „gelten beim Menschen schon wenige Minuten ohne Sauerstoff als fatal“.
Mich interessieren die anthropozentrischen Perspektiven der Schweineforscher nicht, bei acht Milliarden Menschen muß man nicht auch noch die gehirntoten Menschen auf deubel komm raus reanimieren, aber die armen Schweine sind aller Mühen wert, denn nicht nur verdanken wir ihnen Schnitzel und Blutwurst, sondern auch noch so manches Organ, dass in Menschen transplantiert wird – Herzklappen, Haut und Bauchspeicheldrüsen z.B.. Man spricht vom „Ersatzteillager Schwein“. Deswegen ist die Reanimierung der jungen Schweine nach ihrem Gehirntod eine kleine Wiedergutmachung, wenn auch nur in symbolischer Hinsicht, denn sie wurden natürlich nach diesem erfolgreichen Versuch der US-Hirnforscher entsorgt.
Die Debatte darüber wird jedoch nicht von Schweinezüchtern und Schweineliebhabern geführt, sondern von Humanethikern und Medizinern. Erstere schimpfen: „Aus einer wissenschaftliche höchst anspruchsvollen Studie zum ‚Aufflackern von Lebensspuren‘ auf zellulärer Ebene bastelt die Redaktion von ‚Nature‘ – pünktlich zum Fest der Auferstehung – eine sensationsheischende Story, die den Eindruck erwecken soll: Wir haben den ersten Schritt getätigt, Säugetiere und damit auch Menschen aus dem Tod zurückholen zu können.“ Letzter, die Mediziner, befürchten, dass fortan Patienten länger intensivmedizinisch behandelt werden müssen, bevor man sie für tot erklären darf.
Zurück zu den Schweinen, von denen ein Deutscher durchschnittlich 46 im Laufe seines Lebens verzehrt, der Schweinekulturforscher Thomas Macho sagt über sie: „Schweine sind uns nah und fern zugleich. Sie sind intelligent, neugierig, verspielt. Sie sind wild, gefährlich und mutig. Wenn sie umgebracht werden, schreien sie wie wir. Der Geschmack ihres Fleisches ähnelt dem von Menschenfleisch. Im Mittelalter hat man Schweinen den Prozess gemacht.“
Kurzum: Mit ihren vielen Organen und Schnitzeln in unseren Körpern über die Jahrtausende werden wir ihnen immer ähnlicher, irgendwann werden wir hoffentlich auch unsere Organe in ihre Körper transplantieren.
.

Picknick im Wald (2)
.
Springbohnen
Gemeint ist die „mexikanische Springbohne“, die auch „Teufelsbohne“ genannt wird. Sie gab Europa lange Zeit Rätsel auf. 1934 kam es darüber zu einem für die Pariser Mandarins folgenschweren Streit – zunächst unter den Surrealisten: Ihr „geistiger Kompaß“, der Philosoph Roger Caillois, und ihr Vormann, der Dichter André Breton, gerieten darüber auseinander: Die Bohne lag zwar auf dem Tisch – und sprang, wie ihr Name „Springbohne“ schon sagt, aber wer oder was sprang da? Caillois schlug vor, sie aufzuschneiden. Woraufhin Breton „vor Zorn explodierte“, wie Stephan Moebius schreibt (in: „Zur Konkurrenz im Gebiete des Geistigen“, abgedruckt in „Logik des Imaginären“ Band 1 – 2018). Breton war von der Bohne noch „ganz eingenommen,“ er wollte erst einmal „alle möglichen Ursachen der Zuckungen“ diskutieren, bevor man sie einer „kalten Erforschung“ unterzog. Caillois war dagegen an „mehr wissenschaftlicher Strenge“ interessiert.
Enttäuscht, dass die „experimentellen Erfahrungspraktiken“ der Surrealisten ins Literarische und nicht ins Wissenschaftliche führten, gründete er in Paris das „Collège de Sociologie“, das besonders Vertreter der strukturalen Anthropologie wie Claude Lévi-Strauss anzog, die davon ausgingen, dass die von ihnen als Ethnographen beobachteten Gesellschaften „nicht primitiver als alle anderen“ sind. Caillois ging 1939 ins Exil nach Argentinien und Lévi-Strauss, der mit André Breton zunächst nach New York geflüchtet war, nach Brasilien. Ihm warf Caillois später ebenfalls vor, quasi zu unwissenschaftlich vorzugehen, weil er eine „komplexe Struktur“ per se schon für gut befinde. Sie blieben aber Freunde.
Die Zeugen Jehovas, die selben, die zugegeben haben, in Mexiko den heidnischen Tempel der indigenen Volksgruppe der Otomi beschädigt zu haben, erklären auf ihrem Online-“Wachtturm“ nun, dass die mexikanischen Springbohnen faszinierend seien: Es würde sich dabei um die Früchte eines Wolfsmilchgewächses handeln, dessen Samenkapseln je drei Bohnen enthalten:jede nicht einmal einen Zentimeter lang. Der Strauch wächst in den Bergen von Alamos. Die Bevölkerung kennt die Bohnen schon lange. 1921 kaufte ein Amerikaner den Einheimischen dort alle Bohnen ab. Heute ist das Bohnengeschäft monopolisiert und 50 Prozent der Ernte werden in die USA exportiert, 40 Prozent nach Europa und 8 Prozent nach Japan, der Rest bleibt in Mexiko. Jede Bohne wird von einer winzigen gelben Raupe eines Kleinschmetterlings bewohnt. Das Schmetterlingsweibchen legt ein Ei in die Blüte des Wolfsmilchstrauches, wenn die Raupen ausschlüpfen, bohren sie sich tief in die Blüte hinein und lassen sich im Samen einkapseln.
Um die von ihr ausgehöhlte Bohne zum Hüpfen zu bringen, klammert sich das Räupchen an die seidigen Wände mit den Füßen fest und schnellt den Körper hoch, wobei es mit dem Kopf gegen das andere Ende der Bohne stößt und die Bohne vorwärts bewegt. Die Bohne kommt mit wackelnden Bewegungen mehrere Zentimeter voran und springt mehrere Zentimeter hoch. Platzt das Gehäuse, beginnt die Raupe sofort mit Seide, die sie absondert, die Stelle zu reparieren. Nach etwa 6 Monaten in dieser Unruhe, das den Insektenforschern zufolge daher rührt, dass die Raupe mit ihrer Bohne damit aus der prallen Sonne gelangen will, verpuppt sie sich schließlich – und heraus kommt ein Kleinschmetterling der Art „Enarmonia sebastianae“. Bei der Pflanze, die sie „parasitierte“, handelt es sich um „Sebastiania pavoniana“.
Die Springbohnen werden im Juni/Juli geerntet, jede einzelne wird von Mädchen registriert und geschüttelt, ob da ein Wurm drin ist. Das ist die ganze Qualitätskontrolle beim Verkauf der Springbohnen. Hierzulande kann man sie dann z.B. bei beim Vertrieb von Adriana Schall in Paderborn als „besondere Überraschung und Geschenkidee“ bestellen. Aber wie könnte es anders sein: Amazon bietet sogar „Extreme Springbohnen“ an – für 3 Euro 49 das Stück und kostenloser Lieferung. Die nicht so extremen „Jumping Beans“ kosten im „experimentis-shop“ 2 Euro 20.
Für die Zeugen Jehovas läßt bereits die Existenz der Raupe des kleinen Schmetterlings in der nicht-extremen Springbohne nur allzu „deutlich erkennen, daß die eigentümlichen Bewegungen dieser mexikanischen Springbohnen nichts mit Zauberei oder Spiritismus zu tun haben.“ Was aber auch niemand behauptet hat! „Sie sind lediglich ein Teil der bewunderungswürdigen Schöpfung Jehovas Gottes, die den Menschen immer wieder fesselt.“ Business as usual also. So sehen das glaube ich auch die Neodarwinisten (die als gute Protestanten bloß Gott nach innen – in das Genom als primären Beweger – verlegt haben).
Den Schmetterlingsforscher interessiert, wie die Raupe vor ihrer Verpuppung den Ausgang aus der Bohne vorbereitet, denn als Schmetterling hat sie kein „Werkzeug“ mehr dafür. Die botanisch Interessierten, wie z.B. Anne-France Dautheville (in: „Alles über Pflanzen“ 2018), gehen natürlich von „Sebastiania pavoniana“ aus – und erwähnen dann bloß noch Larve und Schmetterling, wobei sie sich nicht groß fragen, warum die Larve springt: „Das weiß niemand so genau“. Als Wirt könnte die Pflanze aber vielleicht im Stillen bereits wirksame Abwehrmitteln gegen die in ihren Blüten und zuletzt in ihren Früchten heranwachsenden Raupen ersinnen. Oder andersherum: Der Raupenbefall kommt ihr zupass!
Im Darwinismus geht man stets vom Nutzen aus: Wäre danach der Schmetterling für die Pflanze ebenso nützlich wie sie für den Schmetterling? Der Philosoph Michel Serres hat beizeiten darauf hingewiesen: „Die besten Wirte sind manchmal auch die besten Parasiten.“ Auf „wissen.de“ heißt es, dass auch „Raupen des Wickler-Schmetterlings Carpocapsa salticans in den Fruchtkapseln mexikanischer Wolfsmilchgewächse der Gattung Sebastiana leben,“ heißt das vielleicht, das sie gerne Raupen in ihren Blüten hat, die sie einkapselt?
Aber die Frage nach der Nützlichkeit hilft eventuell gar nicht weiter, zumal die Tatsache, dass noch eine zweite Schmetterlingsart sich des Strauches bei ihrer Vermehrung bedient, nicht dazu geführt hat, dass „Sebastiania pavoniana“ nun zu den gefährdeten Arten zählt, im Gegenteil: Beginnend 1921 mit dem geschäftstüchtigen Ami hat sich aus Geschäftsgründen eine stabile Bohnenkultur entwickelt: Die Sträucher werden gedüngt, gepflegt und ihre Freßfeinde, bis auf die beiden Schmetterlingsarten, vernichtet. Ihre Raupen haben der Pflanze also sogar zu einigen „Wohlstand“ verholfen. Statt mit Parasiten haben wir es mit kleinen Mädchen zu tun, zwar werden alle Bohnen abgepflückt, aber erst sie trennen die Ernte in gute und schlechte, wobei die für sie schlechten (ohne Wurm) für die Pflanze eventuell die guten sind, d.h. es könnte sein, dass auch die Bohnen mit Wurm für die Pflanze nützlich sind. Dahinter steckt die Frage, die ich nicht beantworten konnte, ob der Wurm, der das Fruchtfleisch im Inneren der Bohne nach und nach auffrißt, den Keim vielleicht unangetastet läßt, ihm durch das Raumschaffen im Inneren und vor allem durch das schließliche Schlüpfen als Schmetterling durch einen Spalt in der Schale das Anwachsen in Erde erleichtert.
Je weiter man nebenbeibemerkt in Deutschland nach Norden kommt, desto häufiger, so haben Volkskundler festgestellt, hat die Bohne bei der Bevölkerung Eingang in ihren erzieherischen Wortschatz gefunden – mit Sätzen wie „Nun tob hier nicht rum wie ne mexikanische Springbohne!“
Sehr geehrter Herr Höge,
ich beziehe mich auf Ihren Beitrag „Als Surrealisten Zuckungen bedienten“ auf taz.de. Sie erwähnten, dass die Zeugen Jehovas in Mexiko den Tempel der indigenen Volksgruppe der Otomi beschädigt hätten. Hier haben Sie offensichtlich einer Falschmeldung aufgesessen. Siehe: https://amerika21.de/2016/07/156484/mexiko-tempel-verwuestung-indig: „Es ist wichtig festzustellen, dass die Verantwortlichen für die Zerstörungen nicht der Gruppe der Zeugen Jehovas angehörten“, sagte Pérez Lugo nun, um diese Gruppe für die falsche Anschuldigung um Verzeihung zu bitten. Die Verwechslung sei dadurch zu erklären, dass die verantwortliche „Splittergruppe der katholischen Kirche einen ähnlichen Namen benutzte“. Den Zeugen Jehovas sei man dafür dankbar, dass sie die Jahrtausende alten Riten der indigenen Gruppen in Wort und Tat respektieren, stellte Pérez Lugo klar.
Ich bitte um sorgfältige Recherchen, bevor in einem Nebensatz Behauptungen aufgestellt werden, die dazu geeignet sind, Vorurteile gegen Minderheiten zu bedienen.
.

.

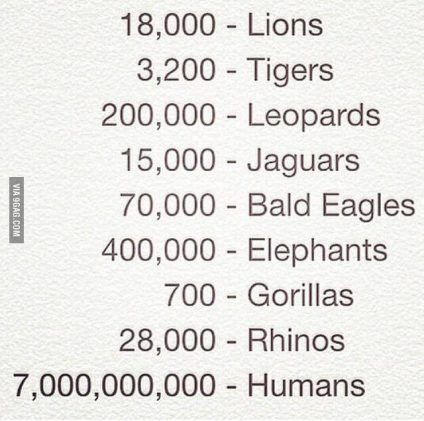



Die Geschichte von Dürer und den Lehrlingen aus der Tischlerei und Metallgießerei finde ich spannend. Ja, früher waren die Reisen wirklich noch Reisen. Ich erinnere mich, dass wir nach Frankreich 15 Stunden mit dem Auto gefahren sind.