Die Saudi rauslassen
Die im Oktober 2017 entstandene #MeToo-Bewegung bewirkt, dass immer mehr Fälle von Misshandlungen und Vergewaltigungen veröffentlicht und ernsthaft gerichtlich verfolgt werden.
Noch im selben Jahr wurde bekannt, dass Saudi Arabien aus Somalia 10.000 Mädchen und Frauen rekrutierte, über deren Verbleib im Land nichts bekannt ist.
Jüngst wurden 300 Arbeiterinnen, die meisten aus West-Nusa Tenggara, missbraucht. Einige sollen getötet und ihre Körper einfach weggeworfen worden sein.
Frauen aus Bangladesch berichteten in den dortigen Medien von Misshandlungen durch ihre Saudi-Arbeitgeber. Manchmal hätten diese sogar Freunde eingeladen, an der Vergewaltigung teilzunehmen.
Mehrere Länder, darunter Indonesien, verweigern Saudi-Arabien inzwischen, ihnen weibliche Arbeitskräfte zu schicken.
Unterdes hat das saudische Innenministerium eine Behörden-App veröffentlicht, das den Bürgern Verwaltungsvorgänge erleichtern soll, aber auch den Männern die Möglichkeit gibt, ihre Ehefrauen zu überwachen.
Der einundfünfzigjährige Saudi-Prinz Kahtani heiratete eine Sechsjährige namens Nawaf.
Der saudische Kronprinz und Verteidigungsminister Mohamad Bin Salman bot dem Rapper Kanye West 10 Millionen Dollar, wenn der ihm für eine Nacht seine Frau Kim Kardashian überlassen würde. Er besitzt bei Paris die weltweit teuerste Residenz und die größte Yacht der Welt.
Die CIA und ein UN-Bericht halten den saudischen Kronprinz für verantwortlich, die Ermordung des saudischen Journalisten Khashoggi angeordnet zu haben. In Genf musste sich Saudi-Arabien bei den UN zur Situation der Menschenrechte im Land äußern. „Wir werden die Schuldigen verurteilen,“ sagte Bandar al-Aiban, der Vorsitzende der saudischen Menschenrechtskommision. Damit ist nicht der Kronprinz gemeint, mit dem US-Präsidenten Trump befreundet ist. Er hatte Anfang Juli Trumps Bitte zugestimmt, die Ölproduktion „vielleicht um bis zu zwei Millionen Barrel“ zu steigern, wie Trump erklärte. Damit sollen Lieferausfälle durch Sanktionen gegen den Iran und Venezuela aufgefangen werden.
Mohamad Bin Salman und Donald Trump hatten beide beste Beziehungen zum Finanzberater Jeffrey Epstein, der vor einigen Wochen in Untersuchungshaft genommen wurde und dort ermordet wurde bzw. Selbstmord beging, nachdem er sein Vermögen per Testament in eine Stiftung überführt hatte. Dem 66jährigen drohten 45 Jahre Gefängnis. Er soll von 2002 bis mindestens 2005 Dutzende von minderjährigen Mädchen, einige waren erst 14 Jahre alt, sexuell ausgebeutet und prominente Reiche und Politiker dazu eingeladen haben. US-Medien sprechen gar von 500 Mädchen, zumeist aus der Unterschicht. Der ehemalige US-Präsident Clinton war der erste, der abstritt, 26-mal an Bord eines Epstein-Jets gewesen zu sein, der „Lolita Express“ hieß. Er sei nur viermal mit Epstein geflogen, meist wegen „humanitärer Missionen“. Epstein hatte außerdem Verbindungen zu Prinz Andrew (dem Duke of York), zum Ex-Premierminister Israels Ehud Barak und dem Harvard-Juristen Alan Dershowitz. Dieser und Prinz Andrew werden von zwei mutmaßlichen Opfern Epsteins der Vergewaltigung beschuldigt.
Trump wurde 2016 von einer Frau verklagt, sie als 13-Jährige bei Epstein vergewaltigt zu haben. Sie zog die Klage jedoch zurück, weil sie laut ihrer Anwältin Morddrohungen bekommen habe. Ein Video zeigt Epstein auf einer Feier in Trumps Golfclub Mar-a-Lago in Florida. 2002 erzählte Trump dem „New York Magazine“: „Ich kenne Jeff seit fünfzehn Jahren. Toller Typ. Es macht viel Spaß, mit ihm zusammen zu sein. Es wird sogar gesagt, dass er schöne Frauen genauso mag wie ich und viele von ihnen sind auf der jüngeren Seite. Kein Zweifel – Jeffrey genießt sein soziales Leben.“
Als Epsteins Zuhälterin fungierte die schwerreiche Sozialistin Ghislaine Maxwell, Sie wird nun beschuldigt, die Mädchen für Epstein rekrutiert und in die Sexsklaverei eingewiesen zu haben, ist aber untergetaucht, ihr Haus in Manhattan hat sie für 15 Mio Dollar verkauft und ihre Meeresrettungsstiftung ‚Terramar‘ aufgelöst.
Der Schweizer „Blick“ schreibt: „In einer Klage gegen Epstein beschuldigt Virginia Roberts Giuffre, dass sowohl Epstein als auch Maxwell sie ab ihrem 16. Lebensjahr sexuell missbraucht hätten. Sie sei als Garderobiere von Maxwell in deren Haus gelockt worden – mit dem Versprechen, eine Massagetherapie zu lernen und viel Geld zu verdienen. Im Haus aber sei sie für 200 Dollar zu sexuellen Handlungen gezwungen und fotografiert worden. Dies sei der Beginn eines mehrjährigen Arrangements gewesen. Sie wisse, dass die Behörden Videomaterial hätten, das sie als Minderjährige zeige, „having sex with Epstein and some of his powerful friends“. Maxwell warf sie vor, dass sie sie dem britischen Prinzen Andrew in ihrem Londoner Haus, in New York und in der Karibik als „Sexsklavin“ ausgeliefert habe. Ähnliche Aussagen gibt es von weiteren Frauen, die Epstein an einflußreiche Geschäftspartner verlieh. Virginia Roberts Giuffre beschreibt Ghislaine Maxwell „als Spinne im Netz der Verruchtheit.“
Sie ist die Tochter des ehemaligen britischen Medienmoguls und Parlamentsabgeordneten der Labour Party Robert Maxwell. Der britische Spionageabwehrdienst behauptet, dass Maxwell für den KGB arbeitete, gleichzeitig soll er aber auch für Mossad tätig gewesen sein. In der Presse wird er heute als „entehrt“ bezeichnet: Als sein Verlagsimperium überschuldet war, fälschte er Bilanzen und vergriff sich am Pensionsfonds seiner Mitarbeiter. 1991 wurde er auf seiner Yacht „Lady Gishlaine“ vor Teneriffa ermordet und auf dem Ölberg in Jerusalem bestattet. Über vieles, was er für Israel getan hat, kann man nicht sprechen, sagte der Regierungssprecher bei der Beerdigung.
Jeffrey Epstein stand 2005 schon einmal in Florida vor Gericht: Die Eltern eines 14-jährigen Mädchens hatten ihn angezeigt, weil er es in seiner Villa in Miami vergewaltigt hatte. Daraufhin meldeten sich 50 weitere Opfer bei der Polizei, Epstein ließ der Behörde sofort eine dicke Spende zukommen. Ihm drohte eine lebenslängliche Haftstrafe, aber der damalige Oberstaatsanwaltschaft Alexander Acosta erreichte bei dem „gut vernetzten“ Angeklagten eine außergerichtliche Einigung: Epstein mußte nur für 18 Monate ins Gefängnis, und dass auch nur Nachts, bereits nach 13 Monaten kam er wegen guter Führung wieder frei. Acosta, gewährte auch Immunität gegen Mitverschwörer, die geholfen haben sollen, immer neue Mädchen zu rekrutieren, mit Ghislaine Maxwell insgesamt fünf.
Am 6. Juli 2019 wurde Epstein in New York erneut verhaftet, nachdem die Reporterin des „Miami Herald“ Julie Brown zwei Jahre lang belastendes Material gegen ihn zusammengetragen und der New Yorker Staatsanwaltschaft übergeben hatte. Bei einer Durchsuchung seiner Anwesen wurde neben Geld, Diamanten und vielen Karteien mit Mädchen ein gefälschter österreichischer Pass gefunden, der ihn als gebürtigen Saudi auswies.
Der Oberstaatsanwalt Acosta, den Trump inzwischen zum Arbeitsminister ernannt hatte, verteidigte sein mildes Strafmaß für Epstein 2005: „Mir wurde gesagt, er sei von der Intelligence und weit oben.“ Das mochte stimmen, nichtsdestotrotz mußte Acosta als Minister zurücktreten. Der Observer schreibt: „Es war aber wahrscheinlich kein amerikanischer Geheimdienst. Die U.S. Intelligence Community ist zwar nachsichtig mit den privaten Gewohnheiten von hochwertigen Agenten oder Informanten, aber sie werde nicht jahrelang Sexschlepperringe für Minderjährige auf amerikanischem Boden tolerieren.“ Zu dem „Deal“ mit Epstein gehörte, dass er Informationen zur Verfügung stellte, die von der Regierung als „wertvolle Gegenleistung“ bezeichnet wurden, berichtete der „Miami Herald“, dessen Anwälten es erreichten, dass die damalige FBI-Akte über Epstein, die über 1000 Dokumente enthält, freigegeben wird.
Die amerikanische Öffentlichkeit interessiert zur Zeit vor allem, wo dieser ehemalige Mathematiklehrer aus der Bronx sein Vermögen her hat und was er als „Finanzberater“ überhaupt für Kunden hatte: Epstein hat an den Finanzmärkten keine Spuren hinterlassen, sagen Händler. Er arbeitete einmal mit Steven Hoffenberg zusammen, der später als Betreiber eines Finanz-Schneeballsystems verurteilt wurde. Epstein ließ stets verlauten, er würde nur Kunden beraten, die über eine Milliarde Dollar verfügten, einen Interessenten mit 750 Millionen wies er ab. Das Magazin „Forbes“ schreibt: „Die erste Referenz von Epstein als Milliardär erschien 2001 im ‚Daily Mirror‘.“ Sie wurde ungeprüft von allen Zeitungen übernommen. Als Forbes diese Behauptung in den Jahren 2004 und 2005 untersuchte und Näheres über Epsteins Geschäft herausbekommen wollte, „sagten uns zwei Milliardäre, die Epstein kannten, dass sie nicht dachten, dass er in der Nähe eines Milliardärsstatus sei. Einer behauptete auch, dass das Geld, das er verwaltete, nur Wexner gehörte.“
Der Milliardär Leslie Wexner besitzt das Unternehmen „L Brands“, zu dem die exklusive Dessous-Marke „Victoria‘s Secret“ gehört. Er ließ sich tatsächlich von Epstein beraten, und soll ihm das größte Stadthaus in Manhattan für 0 Dollar verkauft haben. Für Forbes spiegeln die Werte von Epsteins Immobilien „eindeutig einen Mann mit großem Reichtum wider: Seine 21.000 Quadratmeter große Villa Manhattan (77 Millionen Dollar), das Palm Beach Haus (12,4 Millionen Dollar), die 7.500 Hektar große New Mexico Ranch namens „Zorro“ (12 Millionen Dollar), die karibische Privatinsel Little Saint James, „Paedo-Island“ genannt (8 Millionen Dollar) und die Pariser Pied-à-terre (4 Millionen Dollar).“ Hinzu kommen noch ein Kleinflugzeug und eine Boeing 727 sowie ein Hubschrauber und eine Luxuslimousinenflotte. Zudem zahlte Epstein 21 seiner Ankläger Vergleichssummen zwischen 50.000 bis 1 Million Dollar. Über 100 Anklägerinnen wurden jedoch in dem Prozeß in Florida genannt, so dass der Betrag, den Epstein letztendlich zahlen musste, um diese Fälle zu regeln, in die Millionen gegangen sein könnte.“ Daneben bestach er zwei Zeugen mit insgesamt 350.000 Dollar, so dass sie ihre Anklage zurückzogen.
Über all die Jahre war Leslie Wexner Epsteins einziger bekannt gewordener Klient. Wenn sein Vermögen jedoch in der Lage war, sich aus diesen Fällen herauszuwinden, ist unklar, wie weit es noch reichen könnte, um neue Fälle abzudecken. Der Miami Herald berichtet nun, dass zwölf Frauen inzwischen neue Anschuldigungen gegen Epstein vorgebracht haben.“
Gerüchte über Erpressung umgeben Epstein seit Jahren. In ihrer Klage vor Gericht im Jahr 2015 erklärte Virginia Roberts Giuffre. dass Epstein sie zu „vielen einflußreichen Männern, darunter Politiker und mächtige Geschäftsführer, verschleppt“ habe. „Epstein verlangte von mir, die sexuellen Erlebnisse, die ich mit diesen Männern hatte, zu dokumentieren, vermutlich, damit er sie erpressen konnte.“ Epstein selbst soll gesagt haben, dass er solche Partys veranstalte, damit diese Männer ihm anschließend Gefälligkeiten schuldig seien.
In den sozialen Medien fragen sich die Kommentatoren, ob diese einflußreichen Männer sich nicht eher selbst gefällig sind, indem sie Epstein im Gefängnis umbringen ließen. Am 24.Juli fanden ihn die Wärter schon einmal fast bewußtlos mit Blutergüssen am Hals in seiner Zelle, die er sich wohl kaum selbst beigebracht haben konnte. Am 15. August soll es ihm gelungen sein, sich wirklich zu erhängen – die Wärter schliefen, die Videoüberwachungsanlage lieferte nur „unbrauchbare Bilder“.
Sein Mädchen-Netzwerk, das Ghislaine Maxwell quasi verwaltete, war ebenso umfangreich wie das seiner Freunde: „von der Welt der Politik und Diplomatie (Clinton, Barr, Mohammad bin Salman und Prinz Andrew), Hollywood (Kevin Spacey, Woody Allen, Chris Tucker und David Copperfield), Wirtschaft (Hoffenberg, Wexner, Ron Burkle, Mort Zuckerman, Ronald Perelman, John Pritzker), Recht (Alan Dershowitz, Kenneth Starr, Jay Lefkowitz) und Wissenschaft (Mathematiker und Biologe Martin Nowak, Physiker Murray Gell-Mann, Biologe Gerald Edelman).“ Und das ist laut Forbes „nur die Spitze des Eisbergs. Eine anhängige Klage gegen Epsteins Mitarbeiterin Ghislaine Maxwell droht bereits damit, einige große Namen in Politik und Wirtschaft einer öffentlichen Prüfung zu unterziehen.“
In Epsteins Kautionsantrag, der abgelehnt und dann veröffentlicht wurde, wird angedeutet, dass er mindestens 10 Millionen Dollar jährlich verdienen würde und 500 Millionen Dollar an ein einziges, unbenanntes Finanzinstitut gebunden hat. Laut Handelsblatt vom 24.Juli war das die Deutsche Bank. Die „Hausbank von US-Präsident Trump“ hat nun mit noch einem „Skandal“ mehr zu kämpfen. Das FBI könnte z.B. wissen wollen, ob die Bank nicht gegen „Geldwäsche-Richtlinien“ verstoßen habe. Sowohl Trump als auch Epstein waren zuvor „von anderen Banken abgewiesen worden“.
Seit 2017 erheben immer mehr Frauen Anklage gegen Männer, die sie vergewaltigt oder sexuell belästigt haben. Noch im selben Jahr wurde z.B. der Top-Moderator von Fox News, Bill O‘Reilly, von einer Sekretärin des Senders beschuldigt und verlor seinen Job, zuvor war bereits der Fox News Gründer Roger Ailes aus den selben Gründen ausgeschieden.
Im Mai 2018 wurde Clay Johnson, Abteilungsleiter von Sunlight, einer NGO für Politiktechnologien, wegen sexueller Aufdringlichkeiten entlassen. Er sagte: „I had never been through any training in sexual harassment. I had no idea how to treat women in the workplace.“
Im Juli 2019 wurde der zweiundfünfzigjährige Sänger R. Kelly wegen sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen angeklagt. Die meisten Opfer waren zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt minderjährig. Für jeden Missbrauchsfall könnte Kelly zu bis zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt werden. Da die Strafen aufsummiert werden können, drohen ihm bis zu 70 Jahre Gefängnis.
Weil die Missbrauchsvorwürfe gegen den Popstar nicht abreißen, wird die Doku-Serie „Surviving R. Kelly“ nun fortgesetzt. In den bisherigen sechs Folgen berichten darin verschiedene Frauen, wie sie von dem R&B-Sänger systematisch unterdrückt und sexuell missbraucht wurden. Zu Wort kommen Jerhonda Pace und Kitti Jones sowie die Ex-Frau des Sängers, Andrea Kelly. Auch die R&B-Künstlerin Sparkle, die ihre Laufbahn 1998 als Protegé Kellys begann, spricht ausführlich über ihr Verhältnis zu ihm. Die Erzählungen ähneln sich, schreibt der Spiegel, „demnach sei es Kelly stets darum gegangen, Macht über die Frauen auszuüben, sie systematisch abzuschotten und komplett seinem Willen zu unterwerfen. Viele der Frauen waren zu der Zeit ihrer Verbindung mit dem Popstar minderjährig, stets hatte dieser sich zuvor als Mentor angedient. Bereits 1994 – da war er 27 Jahre alt – heiratete er die damals 15-jährige Sängerin Aaliyah.“
Die taz berichtete: „Nach der Veröffentlichung der Doku sprachen viele Medien von einem #MeToo-Moment der schwarzen Frauen. Denn fast alle Frauen, die gegenüber Kelly Vorwürfe erheben, sind junge Women of Color.“ Eine meinte, weil wir Schwarze sind, hat man sich nicht besonders um unsere Anklagen gekümmert. Ehemalige Freunde von Kelly gaben dem Opferanwalt Gerald Griggs 20 Videokassetten mit Aufnahmen sexuellen Kindesmissbrauchs. Kellys Anwalt argumentierte vergeblich, dass der Sänger keine Gefahr für die Öffentlichkeit darstelle und kein Fluchtrisiko bestehe, wenn er auf Kaution entlassen werde. Die Anklage beschrieb ihn dagegen als „extreme Gefahr“.
Der US-Kabelsender „Lifetime“ will eine ähnliche Dokumentation wie „Surviving R.Kelly“ über Jeffrey Epstein produzieren.
Auch in Europa werden Vergewaltiger-Netzwerke noch einmal neu und gründlicher aufgerollt. Wobei es scheint, dass hier die Täter nicht so reich sind wie in den USA und deswegenihre Opfer lieber ermorden lassen als ihnen Schweigegeld zu zahlen…
Bis in die 1990er Jahren tötete der belgische Serienmörder und Pädophile Marc Dutroux mindestens fünf junge Mädchen und hat eventuell noch viel mehr getötet. Nach seiner Verhaftung im Jahr 1996 behaupteten Dutroux und sein Rechtsteam, dass er minderjährige Mädchen an wohlhabende Kunden in Belgien und Frankreich vermittelt habe.
Die belgische Justiz hielt ihn jedoch nicht für ein Mitglied eines internationalen Kinderschänderrings. Dennoch gibt es zahlreiche Hinweise, wonach Dutroux und seine Komplizen keine Einzeltäter waren. Wichtige Zeugen wurden nicht gehört. Einige erklärte das Gericht für unzurechnungsfähig. Mindestens wichtige 27 Zeugen kamen auf mysteriöse Weise ums Leben.
Aber eine Zeugin lebt: Regina Louf. Sie war die erste von 11 Personen, die über ihre erschütternden Erfahrungen in den Händen des belgischen Pädophilennetzwerks sprach: „Es war ein großes Geschäft – Erpressung – es ging um viel Geld.“ Sie wusste, sagte sie, dass die Sitzungen heimlich ohne das Wissen der Klienten gefilmt wurden. Sie benannte und beschrieb detailliert die Personen und Orte, die am Pädophilenring beteiligt waren.
Einer der Organisatoren dieser Partys sei Jean Michel Nihoul. Die Sitzungen betrafen nicht nur Sex, sondern auch Sadismus und Folter. Einige Mädchen – sie habe es selbst gesehen, seien danach ermordet worden, damit sie nichts erzählen konnten: Christine Van Hees, Katrien de Cuyper, Carine Dellaert u.a.. Der arbeitslose Marc Dutroux sei nur eine Randfigur in einem großen „Netzwerk“ von Pädophilen und sadistischen Mördern gewesen. Abgeschirmt von Polizisten und verflochten mit kriminellen Politikern. Der Geschäftsmann Michel Nihoul rühmte sich stets seiner Kontakte zu „Parteibonzen“. Er habe auf von ihm organisierten „Sexparties“ Geschäftsfreunde mit jungen Mädchen „belohnt“. Die Zeugin spricht von einem „harten Kern“ prominenter Gäste, die häufig auf seinen „Feiern“ erschienen: ein Brüsseler Jurist, ein flämischer Bürgermeister, ein früherer Premierminister…
Ein Prozess in Toulouse 2003 hatte Ähnlichkeiten mit dem Fall Dutroux: Sado-masochistische Orgien wurden von Richtern, Polizisten und Politikern frequentiert. Der Sohn eines Polizisten, Patrice Alègre, galt als Organisator eines florierenden Prostitutionsgeschäfts, das minderjährige Mädchen für die Orgien in einem Gerichtsgebäude in der Stadt und auf einem Schloss des Stadtrates versorgte. Eine ehemalige Prostituierte behauptete, dass zwei junge Frauen bei den von Alègre organisierten Orgien ermordet wurden, auf denen Vergewaltigungen und andere Formen extremer sexueller Gewalt stattfanden.
Inzwischen führte das Verschwinden von 115 jungen Frauen im Raum Toulouse seit 1992 (parallel zum Verschwinden von Hunderten von Kindern in Belgien) zu einer Wiederaufnahme aller Fälle, die mit früheren Behauptungen zusammenhängen, dass Alègre für den Aufbau eines Prostitutionsnetzes durch angesehene lokale Führungskräfte bezahlt wurde. Alègre selbst erklärte sich vor Gericht für 30 Morde an Frauen verantwortlich.
2003 sagte die in Toulouse lebende Prostituierte namens „Patricia“ der Zeitung Le Figaro, dass Alègre es geschafft habe, so viele Verbrechen zu begehen, weil er Polizeischutz habe. Er werde von zwei Polizisten und mehreren Richtern geschützt. Diese Männer wollten Alègres Verbrechen geheim halten, weil er Mitglied eines Kreises von Zuhältern, Drogendealern und Erpressern war. Patricia behauptete außerdem, dass Alègre angeheuert wurde, um minderjährige Mädchen für die Verwendung als Modelle für die Produktion von Kinderpornografie zu beschaffen. Sie sagte, dass Alègre den Transvestiten Claude Martinez getötet habe, weil seine Beschützer befürchteten, dass die von Martinez aufgenommenen Bilder in die Hände von unkorrupten Ermittlern fallen könnten.
Und dann ist da noch der Sozialist Dominique Strauss-Kahn. Der ehemalige IWF-Chef war 2011 vom Zimmermädchen eines New Yorker Luxushotels beschuldigt worden, sie zum Oralsex gezwungen zu haben. Er mußte ihr 1,5 Millionen Dollar „Entschädigung“ zahlen. Wenig später wurde ihm in Lille vorgeworfen, an mehreren illegalen Sexpartys teilgenommen und sich der organisierten Zuhälterei strafbar gemacht zu haben. Und dann machten noch etliche Frauen öffentlich, wie der ehemaliger Wirtschaftsminister ihnen nachgestellt und sie sexuell bedrängt hatte.
Wenn er nicht gerade Verleumdungsprozesse führt, tourt er heute als Finanzberater durch die Welt. Im Südsudan hat er eine Bank eröffnet und in Russland hat er sich in die Aufsichtsräte der Russischen Bank für Regionalentwicklung und des Staatsfonds RDIF berufen lassen. Hauptberuflich ist er Verwaltungsratschef von Leyne Strauss-Kahn & Partners (LSK), einer Finanzfirma mit Sitz in Luxemburg, die zuvor Anatevka hieß, einen „raketenhaften Aufstieg“ ihrer Aktie erlebte – und dann jäh abstürzte.
.

Zu den Sternen (Deutschland)
.

Zu den Sternen (USA)
.

Zu den Sternen (UDSSR)
.
Das Medium ist die Massage
Für den „Wahrig“ ist das „Massageinstitut“ Synonym für ein Bordell. Als man dem KGB-Spion im Bundesnachrichtendienst Heinz Felfe 1961 die „St.-Georgs-Medaille“ des BND verlieh und ihn dreißig Minuten später verhaftete, verlangte man von ihm zuletzt auch noch die Rückzahlung seines Gehalts, dass ihm der BND zehn Jahre lang gezahlt hatte. Dagegen konnte er sich erfolgreich wehren mit der Begründung, dass er neben seiner „Kundschaftertätigkeit“ für die Sowjetunion ja auch „durchaus erfolgreiche Arbeit für den Bundesnachrichtendienst geleistet hätte“. Dazu heißt es in seiner Autobiographie „Im Dienst des Gegners“ (1988), dass er u.a. „im Auftrag des BND-Chefs Gehlen in Bad Godesberg eine ‚Fremdenpension‘ einrichten sollte (die Bezeichnung Massagesalon wandte man damals nur für physiotherapeutische Einrichtungen an).“
In Westberlin gab es rund 900 Bordelle (so viele wie Banken in Frankfurt), seltsamerweise wichen die meisten nach der Wende „Massagesalons“, von denen viele nun keine sexuellen Dienstleistungen anbieten, dafür massieren einige auf Krankenschein. Eine russische Masseurin, die wegen einer Sehnenscheidenentzündung ihren Arm in einer Schlinge trug, erzählte mir, dass sie zu geldgierig gewesen sei und im Weihnachtsgeschäft zu viele Männer gewichst hätte. Die meisten bekämen keinen hoch, so dass viele Bordelle eigentlich sowieso Massagesalons seien. Die Thai-Bordelle, von denen es noch immer einige in Berlin gibt, bieten ebenso wie die „Swinger-Clubs“ nach dem „Sex“ physiotherapeutische Massagen an.
Seit 2017 dreht sich nun die ganze feministische #MeToo-Kampagne um Massagen, um erzwungene, die bis zu Vergewaltigungen gehen. Losgetreten wurde sie durch fast 150 Filmschauspielerinnen, die den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein beschuldigten, er hätte sie zu Rollenbesprechungen eingeladen und sie dabei aufgefordert, ihn zu massieren bzw. mit Hand oder Mund sexuell zu befriedigen. Sein Prozeß beginnt Anfang 2010.
Inzwischen wird dieser „Massage-Fall“ noch übertroffen von dem des angeblichen Investmentbankers Jeffrey Epstein, der über 500 meist minderjährige Mädchen aus armen Verhältnissen dazu gebracht hat, ihn zu massieren, nicht wenige wurden auch von ihm vergewaltigt. Er brauchte täglich drei solcher Massagen, die Mädchen wurden ihm von Ghislaine Maxwell, der Tochter des ehemaligen englischen Zeitungstycoons Robert Maxwell, sowie von drei weiteren jungen Frauen zugeführt. Epstein bekam zudem Mädchen von der Modellagentur „MC 2“, der er dafür eine Million Dollar spendete, und von der Dessous-Firma „Victoria‘s Secret“, die seinem alten Förderer, dem Milliardär Leslie Wexner gehört, Epstein war Geschäftsführer und „Talentsucher“ für dessen Models.
All diesen Mädchen wurde von Ghislaine Maxwell gezeigt, wie sie Epstein „immer lächelnd“ zu befriedigen hatten. Epstein führte sie anschließend seinen reichen und mächtigen Freunden zu, u.a. dem englischen Prinzen Andrew. „Den Prinzen beherbergte Epstein mehrfach in seinen Villen, wo sich Andrew gern massieren ließ,“ schreibt der Wiener „Standard“. Zum einen soll er 2011 in Epsteins Florida-Anwesen eine Ganzkörpermassage bekommen haben, dann sollen er und Epstein in dessen New Yorker Villa Fußmassagen von zwei Russinnen bekommen haben und dort, so sagte die zur Tatzeit 17jährige Zeugin Virginia Roberts aus, hätte Andrew sie zum „Sex“ gezwungen.Anschließend bekam sie 10.000 Dollar dafür von Epstein. Die Neue Zürcher Zeitung erklärte gerade, „Was es mit Prinz Andrews Fussmassage im Hause Epstein auf sich hat“. Dabei ging es wohl darum, dass sein Promi-Netzwerk, das sich auf Konferenzen, Galadiners, Parties (von Heidi Klum und Naomi Campbell z.B.), auf Flügen in Epsteins Privatjets und in seinen fünf Luxus-Anwesen (in New York, Miami, New Mexico, in Paris und auf seiner Karibikinsel) traf, eine „Massage der Egos“ gönnte, wie die NZZ das mit den Worten des weissrussischen Journalisten Evgeny Morozov nennt.
Ob Epstein sie dabei filmte, um sie erpressbar zu machen und ob er dabei mit der CIA und/oder dem Mossad zusammenarbeitete, ist noch unklar. Auch in Frankreich wird gegen ihn jetzt ermittelt, denn dort in seinem Luxusapartment soll er u.a. 12jährige Drillinge aus armen Verhältnissen (ein Geburtstagsgeschenk des Modelscouts Jean-Luc Brunel) „mißbraucht“ haben.
Weil Jeffrey Epstein am 10.August im New Yorker Sicherheitsgefängnis Selbstmord begangen hat oder ermordet wurde, wird nun gegen seine „Ko-Zuhälterin“ Ghislaine Maxwell ermittelt. Sie war zunächst untergetaucht, ließ sich dann aber für die Presse in einem Hamburger-Lokal in San Francisco fotografieren, wo sie ein Buch las über CIA-Agenten und ihre Geheimdienstoperationen, die sie überlebt hatten oder auch nicht. Man kann dieses bearbeitete Foto von ihr als einen Hinweis auf die Hintermänner von Epsteins Mädchenmassagen deuten. Zumal Ghislaine Maxwell das CIA-Buch am 15. August auch noch auf Amazon rezensierte – mit folgenden Worten: „Ein guter Freund von mir ist vor kurzem unter sehr tragischen Umständen gestorben. Einige von uns sahen es eine ganze Weile kommen, aber es war immer noch ein großer Schock, als es endlich passierte. Ich habe dieses Buch auf Anraten eines Freundes gekauft und konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Es half mir zu erkennen, dass mein Freund wirklich an etwas glaubte, und dass es wirklich eine höhere Berufung ist, dein Leben für die CIA, NSA, FBI, Mossad oder andere Geheimdienste zu geben und kein Grund zu trauern. Dieses Buch kann ich von ganzem Herzen empfehlen.“
.

Ghislaine Maxwell in besagtem Schnellimbiß
.
trumping
Im Internet blühen die US-Foren und -blogs derzeit auf: Der Pädophilen-Fall „Jeffrey Epstein“ und seine Milliardärs-Kumpel hat eine Vielzahl von „Analysten“ auf den Plan gerufen, die nun jüdische, homosexuelle, geheimdienstliche und mafiöse Verschwörungen aufdecken. Bei manchen hängen auch alle vier zusammen, es geht dabei um Kindervergewaltigung und Erpressung, um Mord und Rechtsbeugung.
Die in Chile lebende Journalistin Whitney Webb schreibt auf den Webseiten von „Minit Press News“ und „informationclearinghouse“, dass die Verbrechen von Epstein und seinen „Freunden“ nur die Spitze des Eisbergs von Pädophilen seien, die mit dem Berater von FBI-Chef Edgar Hoover und US-Präsident Ronald Reagan, dem New Yorker Anwalt Roy Cohn, begannen, zu dessen Mandanten Donald Trump zählte, der wiederum ein gern gesehener Partygast von Epstein war. Mit Epsteins Prozeß werde all das rauskommen.
Roy Cohn war zunächst der Ideologe von Senator Joseph McCarthy, nicht selten führte er in McCarthys „Ausschuß für unamerikanische Umtriebe“ die Vernehmungen mit prominenten Intellektuellen, Künstlern und hohen Staatsbediensteten, die verdächtigt wurden, Sympathien für den Kommunismus zu haben. Als 1955 McCarthys „Hexenjagd“ (wie Arthur Miller sein Theaterstück über ihn und Cohn nannte), gestoppt wurde, nachdem der CIA-Chef Allen Dulles den Mitarbeitern seiner Organisation verboten hatte, einer Vorladung von McCarthy Folge zu leisten, machte Cohn sich selbständig.
Für die Webautorin Whitney Webb reicht der Epstein-Fall von den „Prohibitionsjahren“ bis zum „Zeitalter Trump“, wie sie die letzten drei Jahre nennt. Wir leben also quasi im Trumpozän. Bereits in den Sechzigerjahren war sich der Dichter Kenneth Patchen sicher: „An Elephant is trumping upon my Heart“. Roy Cohn, der 1986 an Aids starb, hatte sich, als ihm und McCarthy die Kommunisten ausgingen, auf Homosexuelle konzentriert. Der Internetmagazingründer David Talbot veröffentlichte 2016 ein dickes Buch über die CIA und ihre vielen Mordkommandos unter Allen Dulles: „Das Schachbrett des Teufels“. Der geharnischte Antikommunist Dulles begann während des Zweiten Weltkriegs von der Schweiz aus erst einmal hochrangige SS-Offiziere für seinen Kampf gegen die damals noch verbündeten Sowjets zu rekrutieren (u.a. Karl Wolff und Reinhard Gehlen). In seinem „McCarthy“-Kapitel erwähnt Talbot auch Roy Cohn und dass er ein Verhältnis mit seinem Assistenten hatte, mit dem er nach getaner Homosexuellen-Denunziation händchenhaltend in Urlaub fuhr.
Wikipedia schreibt, dass Roy Cohns „social life“ neben historischen Aufarbeitungen auch immer wieder künstlerisch bearbeitet wurde: „Die bekannteste Erwähnung von Cohn findet sich in der Rolle des Dramas „Angels in America: A Gay Fantasia on National Themes“ von Tony Kushner. 2003 wurde das Stück unter dem Titel „Engel in Amerika“ von Kushner verfilmt. Cohn wurde 1992 von James Wood in seinem Werk „Citizen Cohn“ und von Joe Pantoliano in seinem Werk „Robert Kennedy and His Times“ porträtiert. Cohn wird auch in der Fernsehserie „Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI“ erwähnt. In den frühen 1990ern stand die Figur des Cohn im Theaterstück „Roy Cohn/Jack Smith“ im Zentrum. Kurt Vonnegut thematisiert Cohn in dem Roman „Jailbird“. Roy Cohn, Rock Hudson und Michel Foucault sind die Hauptcharaktere in dem Werk „Twilight of the Gods“, wo sich die drei Charaktere im HIV-Behandlungszentrum des American Hospital of Paris treffen. In dem Film „Good Night and Good Luck“ wird Roy Cohn bei der Durchführung einer (für den McCarthy-Ausschuss charakteristischen) Zeugenvernehmung gezeigt.“
Auf Youtube finden sich noch weitere Bearbeitungen der Schreckensfigur Cohn, u.a. eine CNN-Dokumentation mit dem Titel „Was Trump von Roy Cohn lernte.“ In Whitney Webbs Dossier bildet die Cohn-Geschichte nur einen zweiten Teil, im ersten hatte sie zunächst den „Mentor“ von Cohn, Lewis Rosenstiel, thematisiert – ein Spirituosenproduzent und laut Wikipedia ein „Mobster“ (Mitglied) der „Kosher Nostra“ von Meyer Lansky . Auf Rosenstiels Geburtstagsfeiern traf sich – ebenso wie später auf denen von Cohn – die amerikanische Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur.
Whitney Webbs dritter Teil wird sich mit Marc Rich und Adnan Khashoggi befassen. Letzerer, ein saudischer Waffenhändler, nannte seine Yacht nach seiner Tochter „Nabila“, sie wurde später von Donald Trump erworben. Auch der Medienmogul Robert Maxwell nannte seine Yacht, auf der er ermordet wurde, nach seiner Tochter „Ghislaine“, die jetzt als Mittäterin von Jeffrey Epstein gesucht wird. Marc Rich war ein Finanzinvestor und laut Wikipedia ein „umstrittener Rohstoffhändler“, der zeitweilig bis zu 90% des Rohölbedarfs von Israel lieferte. Als ihm wegen Steuerhinterziehung ein Prozeß in New York drohte, wurde er 2001 von US-Präsident Clinton begnadigt, nachdem er der „Clinton Library“ 450.000 Dollar gespendet hatte. Clinton entschied seinen Fall jedoch „aufgrund der Faktenlage“. Epstein war laut einer FBI-Dokumentation ein „FBI-Informant“. Zu seinen Anklägern gehört Maurene Comey, die Tochter des FBI-Chefs James Comey, den US-Präsident Trump 2017 entlassen hatte.
.
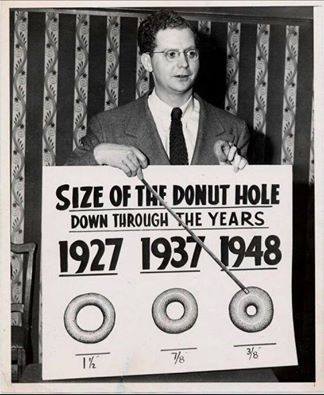
.
Das Gegenteil von solchen verschwörungsversessenen Amibloggern ist mittlerweile „Der Spiegel“, der sich in seinen Anfängen gar nicht genug mit Geheimdiensten und Verschwörungen gut tun konnte. Der Verlagsdirektor Hans Detlev Becker war sogar ernsthaft als Stellvertreter des neuen BND-Chefs Wessel im Gespräch. Der BND-Brigadegeneral Adolf Wicht wechselte zum „Spiegel“. Der Zeitschrift „konkret“, die von einem ehemaligen „Spiegel“-Redakteur herausgegeben wird, gilt „als zentrale Figur zwischen den Spinnen [des Bundesnachrichtendienstes] und dem ‚Spiegel‘ der Magazin-Redakteur Horst Mahnke, einst SS-Hauptsturmführer, und ab 1950 im Nebenjob für die Org [die „Organisation Gehlen“, später der „BND“] tätig, und Hans Heinrich Worgitzky, bei der Org Leiter des ‚Außenstelle im Nordraum‘.“ Den Berichten Worgitzkys (zitiert im Band 10 „Geheime Dienste“ von Klaus-Dietmar Henke in der Schriftenreihe der „Unabhängigen Historikerkommission des BND“) ließe sich entnehmen, „wie dieser gemeinsam mit ‚Dr. Mahnke‘ die Verbreitung von für die Org unschönen Nachrichten und Einschätzungen verhinderte.“
In seinem jetzt veröffentlichten (ausgedruckt 12seitigen) Dossier über „Das System Epstein“ verliert der Spiegel-Reporter jedoch keine Wort über FBI,CIA und Mossad in dem „System“ und auch die Selbstmordthese hinterfragt er an keiner Stelle. Dafür zitiert er noch einmal Prinz Andrew: „Die Annahme, dass ich dies dulden, daran teilhaben oder es unterstützen würde, ist abscheulich.“ Also das jemand überhaupt davon überzeugt sein könnte, dass er ein abscheulich verlogener Päderast ist, ist das Abscheuliche.
Der Spiegelreporter hat sich in Amerika umgetan – und u.a. Epsteins Ranch in New Mexico besichtigt: Bis auf einen Amijournalisten war „der Ort menschenleer. Drückt man die Klingel neben dem Tor, meldet sich niemand. Nicht einmal ein Rauschen.“ Das hat ungefähr die Qualität von Meldungen, die auch der Bundesnachrichtendienst millionenfach „verarbeitete“. Ebenso diese – als der Spiegelreporter den wie Prinz Andrew verdächtigen Harvard-Juristen Alan Dershowitz aufsucht – in seinem „Ferienhaus mit Blick auf den Atlantik“. So ein Blick ist ja nicht verboten. Auch nicht, dass über dem Sofa dort „ein Bild von Roy Lichtenstein hängt, das Dershowitz in Miami ersteigert hat.“ Dass er es dort auf der „Art Basel“ erwarb, wo auch Epstein und seine Komplizin Ghislaine Maxwell regelmäßig auftauchten, erwähnt der „Epstein-System“-Analytiker nicht, obwohl Dershowitz über Ghislaine sagt: „Lynn verkuppelte Epstein im ganzen Land. Sie stellte ihn Bill Clinton vor. Sie bürgte für ihn.“ Gershowitz wurde allerdings von „Lady de Rothschild“ mit Epstein verkuppelt: „Ich bin stinksauer auf die,“ sagte er dem Spiegel-Reporter, jetzt „hängt ihm der Fall wie ein Betonklotz am Fuß“ (nicht am Bein?), denn auch er hat eine Massage in Epsteins New Yorker Haus geschenkt bekommen – allerdings war die Masseurin kein Teenagermodel, sondern eine „Russin“, nicht 15 sondern 50 Jahre alt und „ich behielt meine Unterwäsche an“. In Epsteins Villa in Palm Beach fand die Polizei eine Notiz von einer 15jährigen für Epstein: „Sie fragt, ob 14 Uhr 30 ok ist. Sie muss noch in der Schule bleiben.“ In New York rekrutierte Epstein junge Mädchen in Tanzstudios, anscheinend auch noch während seiner „Gefängniszeit“ in Florida.
.

Mißwahl bei der National Security Agency (NSA).
.

Ostberlin. Photo: Achim Frenz
.
Mani und Pedi
„Schaffe ich es jetzt noch zur Mani…“ steht auf großen Plakaten in den U-Bahnhöfen. Das Start-Up „treatwell“ wirbt damit für eine „Beauty-App“, mit der man Termine in einem Maniküre-Salon verabreden kann. Die Berliner Firma ist eine „Plattform“ (für Nagel-, Fußpflege- und Waxing-Studios in mehreren Städten).
Das mußte ja kommen, dass bei dem Überangebot an Nagelstudios, die sich in der Stadt fast so schnell ausgebreitet haben wie die Touristen, irgendwann jemand damit ins Virtuelle streben würde. Eben „treatwell“ in der Greifswalder Strasse. Ich hatte mich schon lange gefragt, was es mit diesen ganzen Nagelstudios auf sich hat. 60.000 sollen es inzwischen in Deutschland geben, in Berlin an fast jeder postproletarischen Ecke. Meistens sieht man junge Asiatinnen in diesen Läden, die hinter weißen Behandlungstischen sitzen mit Mundschutz und Gummihandschuhen. „Die Zeit“ schreibt: „Asiatische Ketten bieten Billigpreise“. Die taz interviewte die Besitzerin des Nagelstudios im „Internationalen Handelszentrum“, sie nennt ihr Geschäft „Nails and more“ und heißt Jacqueline Müller-Trumschke.
Neben solchen legalen deutschen Läden und asiatischen Ketten gibt es auch noch eine riesige Menge von quasi illegalen Maniküren – „mobile Studios“ von Frauen, die zu Hause arbeiten und Hausbesuche machen oder Untermieter in Bräunungsstudios und Friseursalons sind. „Die Nagelverschönerung ist ein Markt für Kleinstexistenzgründerinnen,“ schreibt die taz. „Es gibt zu viele schwarze Schafe in der Branche,“ findet Müller-Trumschke, die deswegen niemandem empfehlen würde, „sich in Berlin selbständig zu machen“.
Das hängt aber doch vielleicht zusammen: Die Arbeitslosigkeit, das Aussterben der Handarbeit und der boomende Handpflegerinnenberuf. Man sieht auf der Straße jedenfalls immer mehr Frauen mit phantasievoll gestalteten Fingernägeln, nicht selten mehrfarbig. Selbst die vor der Wende zumeist nur von Prostituierten getragenen künstlich verlängerten und geweißten Fingernägel erfreuen sich mittlerweile auch bei der weiblichen Jugend großer Beliebtheit.
Der Pediküre haftet dagegen der Geruch stinkender Füße an, zumal alte Leute oft nicht mehr selbst ihre zerbeulten Füße pflegen können, ihre Pediküre wird deswegen von den Krankenkassen bezahlt. Für unzerbeulte Füße gibt es „Wellness-Studios“, wo die Pediküre oft verbunden ist mit Massagen und anderen Schönheitspflegeofferten. Die Fußpflege-Studios, die die Arbeit kleinen Fischen überlassen, denen das Abknabbern von abgestorbenen Hautresten obliegt, scheinen eine temporäre Geschäftsidee zu sein. Die Nagelpflege für Männer ist nur insofern bemerkenswert, dass einige ihre Fingernägel einfach nicht schneiden. Neben dem Philosophen Gilles Deleuze waren das u.a. die chinesischen Intellektuellen, die bis zum Ende der Kaiserzeit alle Beamte waren und mit ihren langen Fingernägeln signalisierten, dass sie für keinerlei Handarbeit zu gebrauchen waren. Ein Rudiment finden wir noch bei den Hollywooddiven, die immer grad nichts tun können, weil ihr Nagellack noch nicht trocken ist.
Aus aktuellem Anlaß will ich hier auf ein Pediküre-Studio in Marzahn zu sprechen kommen bzw. auf die „Geschichten einer Fußpflegerin. Marzahn mon Amour“ der Schriftstellerin Katja Oskamp, die soeben im „Hanser Berlin“-Verlag erschienen sind. Die Autorin erlebte einige Manuskript-Absagen und beschloss, fürderhin ihr Geld als Fußpflegerin zu verdienen. Dazu mußte sie erst einmal einen Kursus „Fußpflege A“ in einer Schule für Heilberufe und Kosmetik absolvieren. Mit dieser Schulung und den Kursteilnehmerinnen, meist wie sie Frauen im mittleren Alter, beginnt auch ihre Erzählung.
Das Buch besteht aber im Wesentlichen aus Schilderungen ihrer Kunden und deren Füße – nichts weiter, und das ist gerade das Schöne daran. Eine „Empathie von unten“, nennt Katja Lange-Müller das (ich nehme an, weil Fußpflegerinnen auf Fußhöhe mit ihren Kunden verkehren). „Die einen erzählen, auch mit ihren Füßen, die andere hört zu, auch mit ihren Händen.“ Ein anderer Rezensent, Bov Bjerg, schreibt: „Die Geschichten, die hier entstehen, sind spektakulär.“ Vor allem sind sie sehr liebevoll erzählt. Und wie es scheint, haben Katja Ostkamps Marzahner Kunden, die jahrzehntelang in einem Geh- und Stehberuf ihre Füße überanstrengt haben, das auch verdient. Quasi als Zugabe zur fast zärtlichen Fußbehandlung der Autorin. Leider muß man wohl davon ausgehen, dass sich ihr Buch nicht halb so lange in der Spiegel-Bestsellerliste halten wird wie z.B. der überflüssige Sex-Quatsch von Michelle Obama („Becoming“ – Ich komme).
.

.

.
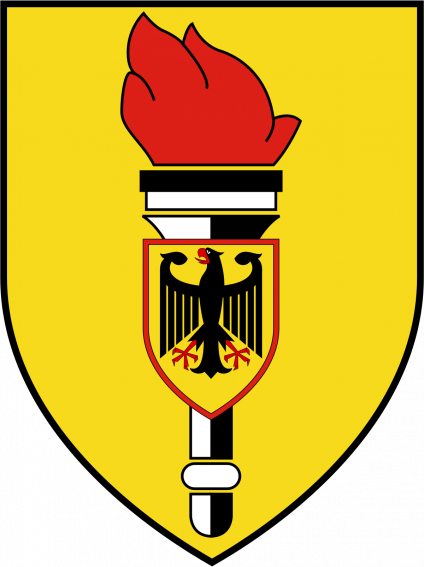
.

Anders gesagt: „Wir haben Verständnis für Toleranz“, wie es in der Werbung des Swingerclubs in Karlshorst (!) heißt. Für Nichtberliner: Karlshorst war der Bezirk, wo sich das Hauptquartier der Roten Armee befand, das von Gehlens Bundesnachrichtendienst (BND), d.h. von dessen „Agenten“, geradezu umzingelt wurde, aber alles vergeblich, denn der KGB hatte in der Spitze des BND einen Doppelagenten, Felfe, eingeschleust, der den Überblick behielt.Laut Reinhard Gehlens Führungsoffizier bei der CIA, James Critchfield, beschäftigte der ehemalige Generalstabsoffizier Gehlen in seinem BND keine „Ex-Nazis“, Felfe sei der Einzige in der Zentrale gewesen, die anderen hätte man bei den Außenstellen beschäftigt. Was natürlich gelogen ist, eher könnte man sagen, Gehlen beschäftigte keinen Nicht-Ex-Nazis in seiner Organisation.
Das Wappen über dem Foto vom bunten Buwe-Shop am Bahnhof Friedrichstrasse, der inzwischen wieder geschlossen wurde, ist das des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), dessen Agenten einst ebenfalls wie magisch von „Karlshorst“ angezogen wurden.
.

Brigitte Helm während einer Drehpause beim Film „Metropolis“
.
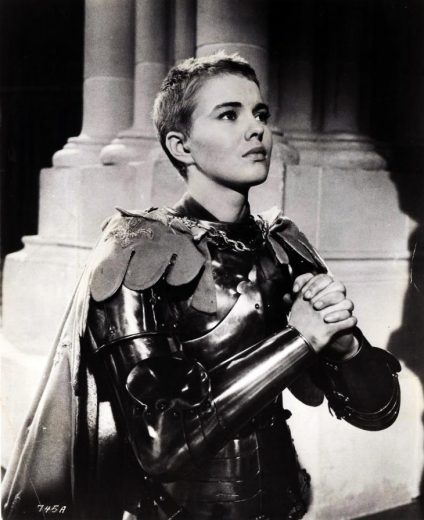
Jean-Seberg-d’Arc
.

.

Französische Polizistin
.

Deutsche Polizistinnen
.

Russischer Polizeisergeant Lenotschka
.
Rote Kapellen
Die Gestapo faßte ihre Ermittlungen über ein Netzwerk von Regimegegnern unter dem Namen „Rote Kapelle“ zusammen, die angeblich für die Sowjetunion spionierten. Laut Wikipedia war „ein Funker, der mit seinen Fingern Morsecodezeichen klopfte, in der Geheimdienstsprache ein Pianist. Eine Gruppe von ‚Pianisten‘ bildete eine ‚Kapelle‘, und da die Morsezeichen aus Moskau gekommen waren, war die ‚Kapelle‘ kommunistisch und damit rot.“
Es handelte sich dabei um etwa 400 Personen, die sich teilweise unabhängig voneinander in kleinen Zirkeln trafen. „Unter Rote Kapelle werden heute in Deutschland vor allem die Widerstandsgruppen um den Luftwaffenoffizier Harro Schulze-Boysen, den Schriftsteller Adam Kuckhoff und den Ökonomen Arvid Harnack genannt, denen Historiker über 100 Personen zuordnen,“ heißt es auf Wikipedia. Mindestens die Mitkämpferin und Ehefrau von Harro Schulze-Boysen, Libertas Haas-Heye, sollte auch zu dieser Gruppe gezählt werden. Sie wurde zusammen mit etlichen anderen vermeintlichen Mitgliedern der „Roten Kapelle“ in Plötzsensee hingerichtet.
Ich erfuhr von ihr erst als die Treuhandanstalt 1996 ihr „märkisches Sorgenkind“ – ein Rittergut samt den dazugehörigen Bewohnern des Dorfes Liebenberg – zum Verkauf anbot. Weil das Schloß mit Kapelle, Post, Sägewerk und Gutshof aber nie ein Rittergut war und weil man heute nicht mehr einfach irgendwelche Dorfbewohner verkaufen darf, organisierte die Treuhand einen „Shuttle“, um die aufgebrachten Journalisten vor Ort üppig zu verköstigen und in angenehm ländlicher Atmosphäre zu besänftigen. Anschließend faxte der Treuhand-Pressesprecher an alle Medien: „Wer jetzt Angst schürt – und sei es nur durch flotte Überschriften in den Medien – geht an der Wahrheit vorbei und handelt unredlich.“
Im Schloß war die 1913 in Paris geborene Dichterin Libertas Haas-Heye aufgewachsen, es gehörte den Eulenburgs, ihre Mutter war das jüngste von acht Kindern des preußischen Diplomaten Philip zu Eulenburg. Als Opfer des Antihitler-Widerstands ist ihr heute die Schloßkapelle mit einer Sonderausstellung über die „Rote Kapelle“ gewidmet. Das Schloß wurde als Hotel verpachtet. Den Gutshof, der zuletzt ein Staatsgestüt zur Serumproduktion war, bewirtschaftete nach der Wende die „Agrar GmbH Bergsdorf“ des Dorfes Liebenberg.
Zum Schloß gehört auch noch ein Seeschloß. Dort im Kaminzimmer veranstaltete der Fürst zu Eulenburg einst schwule Ritterspiele mit dem Kaiser (Wilhelm II.). Nach einer Veröffentlichung des Journalisten Maximilian Harden entwickelte sich daraus einer der größten Skandale des deutschen Kaiserreiches. Betroffen waren laut Wikipedia „prominente Mitglieder des Kabinetts in den Jahren 1907 bis 1909“. Ihr homoerotischer Zirkel um den Kaiser wurde „Liebenberger Kreis“ genannt.
An diese preußisch-militärische Verschwörung erinnert heute nur noch der Name der Berliner Schwulenmagazins: „Siegessäule“. Diese Schandsäule wollten Anarchisten in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts mehrmals in die Luft sprengen, und dann die alliierten Bomberpiloten, aber es war nie soch richtig dazu gekommen. Das Schwulenmagazin wählte den etwas unglücklichen Namen auch, weil sich an der Siegessäule eine öffentliche Toilette befindet, die Treffpunkt der Westberliner Schwulen war – und bis zur Abschaffung des Schwulen-Paragraphen von der Polizei überwacht wurde. Bis dahin – 1994 (!) – hatte man 64.000 Menschen mit diesem Paragraphen (175) verurteilt.
Das Seeschlößchen erwarb zuletzt die Deutsche Kreditbank (DKB): Die bayerischen Banker ließen alles gründlich renovieren und hängten über 100 Geweihe in der Eingangshalle ab. Auf fast allen stand „Erlegt: A.Neumann“ – ein zusammen mit Walter Ulbricht in Ungnade gefallenes ZK-Mitglied, ehemaliger Spanienkämpfer, der sich dorthin verbittert zurückgezogen hatte die letzten Jahrzehnte – und das SED-Gästehaus quasi besetzt hatte. Von wo aus er anscheinend täglich jagen gegangen ist. Ähnlich war es dann nach der Wende mit dem „One-Dollar-Man“, den die Treuhand dort als Verwalter einsetzte: Er krallte sich in das Seeschlößchen und als man ihn endlich rausgeklagt hatte, fehlten etliche Gemälde. Die bayrischen Banker, die daraus dann ein Hotel mit Partypavillon am Seeufer machten, hatten nicht gedacht, dass die Vergangenheit des Ortes diesen bis heute prägt – insofern das Seeschlößchen-Hotel schon bald nach der Eröffnung zu einem Hide-Away für Berliner Schwule wurde.
Im dazugehörigen „Kutscherhaus“ hatte sich nach der Wende ein westdeutscher Hubschrauber-Testpilot im Ruhestand: Baron von Engelhardt, Neffe der Widerstandskämpferin Libertas, mit seiner Frau eingemietet: Ihm ging es um seine bewußten Erinnerungen. Einmal, so berichtete er dem Rundfunk, habe Hermann Göring ihn auf seinen Schoß gezerrt und er, der damals Siebenjährige, habe dem Reichsmarschall eine runtergehauen. Auch Libertas wurde mehrmals auf den Schoß des Reichsjägermeisters gesetzt. Später trat sie für kurze Zeit der NSDAP bei, ab 1942 sammelte sie jedoch heimlich und gemeinsam mit dem Schriftsteller Alexander Spoerl in der Kulturfilmzentrale Bildmaterial über Gewaltverbrechen an der Ostfront. Diese Informationen wurden zum Ausgangspunkt für ein Flugblatt. Nach der Entschlüsselung geheimer Funksprüche des Nachrichtendienstes der Roten Armee konnte die Gestapo sie und ihren Mann verhaften.
Die von Harro Schultze-Boysen bis 1933 herausgegebene Monatszeitschrift „Der Gegner“ wurde ab 1999 von den Prenzlauer Berg Anarchisten des Basisdruck-Verlags neu herausgegeben, sie erscheint unter mehrmals verändertem Titel noch heute als Vierteljahreszeitschrift.
Die „Rote Kapelle“ gab es bis 1979 – bis zum Tod von Reinhard Gehlen. Der BND-Gründer und -Chef glaubte fest an ihre Weiterexistenz nach ihrer Zerschlagung und steckte mit seiner Paranoia auch seine Umgebung im Nachrichtendienst an. So gab eine seiner Mitarbeiterinnen, Rosemarie Beyer, im Rang einer Oberregierungsrätin, Ende 1967 im Bundespräsidialamt zu Protokoll, dass in der Führungsspitze des BND eine „Rote Kapelle“ existiere, die nun den Dienst ihrerseits systematisch zerschlage. Recherchen ergaben dann jedoch, dass sie ein Rad ab hatte. Rolf-Dieter Müller schreibt in seiner Gehlen-Biographie (siehe unten): „Mit großer Genugtuung wird Gehlen in diesen Tagen [1972] im Fernsehen verfolgt haben, wie an sieben aufeinanderfolgenden Sonntagen ein Dokumentarspiel über die ‚Rote Kapelle‘ ausgestrahlt wurde, das Franzosen und Italiener produziert hatten und auf eine ‚Spiegel‘-Serie von Heinz Höhne aus dem Jahr 1968 zurückging. Der Mythos lebte!“
Damals nahm die internationale Studentenbewegung gerade an Radikalität und Einfluß zu. Ein „Stasi-Spitzel“, wie die Gehlen-Biographen ihn nennen, der nach Felfe Zugang zur BND-Führungsspitze gefunden hatte, berichtete, dass Gehlen im kleinen Kreis vor den „Dutschkes und Hippies“ warnte, die gefährlicher seien als allgemein angenommen werde. Nur solche effektiven „Nachrichtendienste“, die wie im Kommunismus ohne Verzögerung durch Technokraten und Politiker sofort die richtigen Maßnahmen ergreifen, könne deren Einfluß stoppen – und die westliche Welt erhielte wieder eine Chance. Im Jahr darauf, 1968, nahm Gehlen an den Beratungen der BRD-Regierung über die „Studentenunruhen“ teil. Diese waren seiner Meinung nach natürlich durch den „Osten“ verursacht.
Am 30. Mai 1968 äußerte Gehlen laut einem Stasi-Spitzel: Die Hauptschuldigen seien jedoch die Alliierten. Sie seien bestrebt, die Demokratie Amerikas einfach auf die Bundesrepublik zu übertragen, was nicht gehe. Die Mentalität der Deutschen wäre so geartet, dass sie keine Demokratie gebrauchten. Sie benötigen lediglich eine starke Regierung. Er, Gehlen, hoffe, dass die NPD diese starke Regierung eines Tages bilden werde und sich zu der Partei entwickle, die die jetzige Demokratie abbaut und hart durchgreift.
Gehlens Cousin, der Philosoph Arnold Gehlen, der von den linken Studenten scharf angegriffen wurde und dessen Lehrstuhlbewerbung nach Heidelberg Adorno und Horkheimer verhindert hatten, äußerte zur selben Zeit die gleichen „rechtskonservativen“ politischen Vorstellungen. (Wie aktuell „68“ doch ist! Für die rechte „Junge Freiheit“ ist Arnold Gehlen heute fast schon wieder ein Hausphilosoph.)
.

.

Neues Russland
.
Das Hamburger Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, der von Anfang an engen Kontakt zum BND hielt, berichtete 2003: „Als der CIA-Agent Milt Bearden im Sommer 1988 in Berlin eintraf, verfügte die CIA über keinen einzigen Agenten im internen Sicherheitsapparat des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) oder in der Hauptverwaltung Aufklärung (HVA), der für die Auslandsspionage zuständigen Abteilung von Markus Wolf. Nicht etwa, weil die Amerikaner es nicht versucht hätten. Aber alle Männer, die zu einem Seitenwechsel bereit zu sein schienen, entpuppten sich schnell als Doppelagenten.“
Eine CIA-Aktion hatte z.B. darin bestanden, ganz normale DDR-Bürger, jüngere Arbeiter und Angestellte, gegen geringe Bezahlung für Spionagetätigkeiten zu gewinnen. Sie sollten alltägliche Beobachtungen melden, u.a. über Aktivitäten der Volkspolizei und der NVA, über russische Panzer und sonstige Vorkommnisse. Fast alle wurden schon nach kurzer Zeit verhaftet und zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.
Als die Mauer fiel, gelang es den CIA-Agenten dann doch, so wie 1945 die Generalstabsoffiziere von „Fremde Heere Ost“ und der „Abwehr“ von Canaris zu rekrutieren, auch den einen oder andere MfS-Offizier „einzusammeln“, indem sie dazu übergingen, aktive wie ehemalige Mitarbeiter von HVA und MfS direkt in ihren Wohnungen aufzusuchen und sie dort persönlich anzusprechen. „Bald hatten sich so viele ostdeutsche Agenten zur Zusammenarbeit bereit erklärt, dass wir uns in Langley [dem CIA-Hauptquartier in Virginia] fragten, wie wir ein solch weit gespanntes Agentennetz aufrechterhalten konnten. Wir mussten eine eigene Arbeitsgruppe für Ostdeutschland einrichten, die ausschließlich damit befasst war, den Strom geheimdienstlicher Erkenntnisse aus Ost-Berlin zu bearbeiten. Ein Agent stach alle übrigen aus: Er brachte einen kompletten Raum voller Daten an sich, bevor er seinen Dienst quittierte und für den Westen arbeitete.“
Die CIA gab später die sogenannten „Rosenholz-Dateien“ häppchenweise an die Deutschen weiter, wo die Gauck-Behörde, die da schon Birthler-Behörde hieß, sie weiter bearbeitete. „Seit Monaten summen die Computer, noch vier Wochen, dann werden sie auch singen: die Klarnamen von Spitzeln und Spionen, von Zigtausenden, die für die Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) der Stasi gespäht haben – als Agenten im Ausland und als Helfer des Geheimdienstes in der DDR. 280 000 Namen, die der amerikanische Geheimdienst CIA in den Wendewirren erbeutet hatte…So dankbar war die Bundesregierung, dass sie den US-Agenten Bundesverdienstkreuze umhängte. Die Deutschen stießen u.a. auf ‚Topas‘ – die Topquelle Rainer Rupp, der die Stasi aus dem Brüsseler Nato-Hauptquartier beliefert hatte.“ Inzwischen war er Redakteur bei der Jungen Welt geworden.
Die CIA hatte es vor allem auf Markus Wolf abgesehen: Ihre Emissäre aus Washington trafen Wolf in seiner Datscha in Prenden, bei Berlin. „Sie trafen auf einen Wolf, der sich alles anhören wollte, aber nicht daran interessiert war, zur CIA überzulaufen. Er betrachtete das Gespräch als amüsante Unterhaltung und konterte ihr Angebot einer Übersiedlung nach Kalifornien mit dem Hinweis, das Leben in Sibirien sei auch nicht übel.“
Das Münchner Magazin „Focus“ berichtete dagegen 2007, dass die CIA seit 1957 mehrere Offiziere des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) erfolgreich als Informanten angeworben hatte: „Die US-Spionagetruppe hat ihre Erkenntnisse aus den Ostberliner Topquellen strikt für sich behalten. Informationen über ernste Verratsfälle in der Bundesrepublik wurden dem Bundesnachrichtendienst (BND), dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) sowie dem Militärischen Abschirmdienst (MAD) erst nach dem Fall der Berliner Mauer mitgeteilt. Die CIA erfuhr den Dokumenten zufolge durch einen Offizier der Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) bereits 1988 von einem schwerwiegenden Verratsfall in den Reihen des BND. Erst im Juli 1990 teilten die Amerikaner ihrem Partnerdienst Hinweise auf die Quelle der Stasi mit. Ende September 1990 wurde daraufhin die BND-Regierungsdirektorin Gabriele Gast wegen Landesverrats festgenommen. Sie erhielt eine Gefängnisstrafe von sechs Jahren und neun Monaten.
Eine Stasi-Agentin in der Zentrale von Daimler Benz kannte die CIA seit 1983 mit Namen und genauer Personenbeschreibung. Aber erst im Dezember 1990 wurde das Kölner Bundesamt für Verfassungschutz über die undichte Stelle beim schwäbischen Autokonzern verständigt. Einige Tipps der CIA stießen bei den deutschen Sicherheitsbehörden sogar auf Ablehnung. Den Hinweisen auf eine weitere Stasi-Agentin beim BND, die seit 20 Jahren für den Osten spionierte, ging der BND im Herbst 1992 nur zögerlich nach. Nach FOCUS-Recherchen wurde die verdächtige Frau identifiziert. Zur Vermeidung eines weiteren Skandals nach dem Fall Gabriele Gast wurde der Vorgang intern als unerheblich eingestuft und nicht der Bundesanwaltschaft gemeldet. Die verdächtige Spionin ging vorzeitig in den Ruhestand.“
Reinhard Gehlens Karriere begann als Leiter der Aufklärung über die Rote Armee, der Abteilung „Fremde Heere Ost“ (FHO) im Generalstab des Oberkommandos des deutschen Heeres (OKH). Bereits 1945 hatte er mit 20 Stahlkisten voller Akten, die er rechtzeitig in den Alpen vergraben hatte, von der CIA den Auftrag und das Geld erhalten, einen neuen deutschen Spionagedienst aufzubauen – gegen die in der DDR stationierte Rote Armee, des weiteren gegen die Sowjetunion und überhaupt gegen die Ausbreitung des Kommunismus in der ganzen Welt. Als Gehlen 1968 in den Ruhestand ging, versteckte er auf seinem Grundstück am Starnberger See (wo sich nach der Wende auch der KoKo-Chef des MfS, Schalck-Goloskowski niederließ) noch einmal „geheime Akten“ (10 Regalmeter) – diesmal aus „seinem“ BND. Aus Sicherheitsgründen sollte die CIA sie ihm dann kopieren und bunkern.
Beim Aufbau seiner „Organisation“ stellte Gehlen dann so viele von seinen Offizierskollegen aus dem Generalstab des OKH wie möglich ein, zudem insgesamt 17 Angehörige seiner Familie, inklusive der FHO-Sekretärin Annelore Krüger, die ab 1947 seine Geliebte war und zu einer der wichtigsten Leute in der BND-Zentrale wurde. Gehlen stellte allerdings auch, ohne es freilich zu wissen, einen fähigen Doppelagenten der DDR ein: Heinz Felfe. Heute hat der BND 6500 Mitarbeiter und residiert im zweitgrößten Gebäude Berlins, sein Jahresbudget liegt bei fast einer Milliarde Euro, er übermittelt monatlich 1,3 Milliarden Metadaten an die „National Security Agency“ (NSA).
Als 1971 fast zeitgleich ein mehrteiliger „Spiegel“-Bericht über den BND und die Memoiren von Gehlen „Der Dienst“ erschienen, meldete die „New York Times“schnell, Gehlen habe darin Martin Bormann, den Chef der Parteikanzlei der NSDAP, als Agenten Stalins enthüllt, wobei es eine Verbindung zwischen Bormann und der „Roten Kapelle“ gab oder geben würde. Der ehemalige Mossad-Chef Isser Harel schätzte Gehlens Enthüllungen als sehr wichtig ein, man müsse ihnen nachgehen. Weil dann die englische Ausgabe der Memoiren mehr Material als die deutsche enthielt, ergänzte „Publishers Weekly“: Es stünde darin so viel Neues vom „German Spymaster“, dass die Geschichte des Zweiten Weltkriegs neu geschrieben werden müsse, z.B. dass Gehlen als Freund von General Mosche Dajan diesem half, den israelischen Geheimdienst aufzubauen.
Gehlen glaubte bis zuletzt, dass die Gestapo die „Rote Kapelle“ nicht vollständig zerschlagen habe, dass die, die unentdeckt geblieben waren, nach 1945, (so wie auch seine Generalstabsoffiziere in der Abteilung „Fremde Heere Ost“ weiter machten) d.h. dass diese Antifaschisten den Westen weiterhin kommunistisch unterwanderten und womöglich auch für die Sowjets/ die Russen weiter spionierten. Außerdem ging Gehlen davon aus, dass Hitlers Kanzleichef Martin Bormann, in dessen ehemaligem Büro er saß, nicht gestorben sei, nach seiner Flucht aus dem Führerbunker am 2.Mai 1945, sondern zur Roten Armee übergelaufen sei. Und weil CIA und Bundesregierung das alles nicht recht glauben wollten, deswegen sei der Westen über kurz oder lang dem Ansturm des Kommunismus nicht mehr gewachsen.
Gehlen hätte jedoch wissen können, dass man Bormanns Leiche 1973 zweifelsfrei identifiziert hatte. Eine Woche nach der Ermordung der sechzehn „20.Juli“-Gefangenen im Zellengefängnis Lehrter Strasse am 23. April 1945 hatte man bereits Martin Bormann und dem SS-Arzt Stumpfegger auf dem Gelände des Universum-Landesausstellungsparks (ULAP), ungefähr dort, wo heute der Hauptbahnhof steht, tot aufgefunden, sie waren zunächst von russischen Soldaten an Ort und Stelle verscharrt worden, aber nach dem Ausgraben ihrer Überreste 28 Jahre später obduziert worden.
Andererseits, wenn man es genau bedenkt, dann hatten die antikommunistischen Paranoiker in Pullach (bei München) gar nicht so unrecht: Vor allem seit der Auflösung der Sowjetunion und des Ostblocks gibt es nun Rote Kapellen schier überall.
.

.
Spitzel
Spione, die nicht auf die Mächtigen und Einflußreichen, auf die da oben, angesetzt werden, sondern auf die Ohnmächtigen und Einflußlosen, auf die da unten, nennt man Spitzel. Vor einiger Zeit traf ich in der Prenzlauer-Berg-Anarchokneipe „Baiz“, die zu Recht von einem der Wirte als „Spitzelzentrale“ bezeichnet wurde, einen Rechercheur in dieser Richtung. Anschließend gab ich Folgendes zu Protokoll, wie man so sagt:
Der Spitzel, Spion, Verräter, V-Mann, Agent provocateur ist der lichtscheue Tatzeuge des Überwachungsapparates. Das Frontschwein der Herrschenden, das sie vor den Gefahren eines Umsturzes von unten warnt und sogar schützt. Die Chroniken seines schändlichen Tuns reichen für gewöhnlich bis auf den „Urspitzel Judas“ zurück, und enden bei den jeweils aktuell enttarnten „Undercover Agenten“. Dies gilt auch für die vorläufig letzte Chronik, die 2004 von Markus Mohr und Klaus Viehmann veröffentlichte „Kleine Sozialgeschichte“ des Spitzels. Sie endet bei den „Verrätern“ der Westberliner Vorwende-Linken Peter Urbach und Ulrich Schmücker. Ersterer tauchte im Zeugenschutzprogramm unter, letzterer wurde umgebracht. Beide waren laut Wikipedia „Agents Provocateur des Verfassungsschutzes“ (VS).
An die zigtausend als „Spione“ im Ostblock hingerichteten bzw. in Arbeitslager weggesperrten Kommunisten haben sich die beiden Historiker nicht herangewagt: Diese waren oft, wenn überhaupt, dann nur „objektiv“ Verräter – und ihre subjektiven Geständnisse meist unter der Folter zustandegekommen, wobei in Osteuropa genaugenommen jedes Verbrechen als Verrat (am Sozialismus und am ganzen Volk) galt. (1) Dafür haben die beiden Autoren die „IM“s und „OibE“s in der DDR und die inzwischen hüben wie drüben aktiv gewordenen „V-Leute des Verfassungsschutzes“ in der NPD nicht vergessen. „Die aktuellen Beispiele wirken durch ihre reine Lebensfrische“, lobte der Rezensent Ulrich Enzensberger, insgesamt fehle jedoch der Mut zur Zusammenfassung. Wenn nicht sogar eine Theorie des Spitzel.
Es gibt eine „Schwache Dörfer – Starke Wölfe“-Theorie, die hier vielleicht helfen kann. Auf das Thema bezogen würde das heißen, dass eine schwache Linke das Spitzelwesen stark macht, wobei mit „schwach“ hier die Freundschaft innerhalb der Gruppen gemeint ist, die sich in gemeinsamen Aktivitäten langsam entwickeln muß – oder auch nicht. So konnten die „Agents Provocateur“ des Westens schon kurz nach der Wiedervereinigung bei den neuentstandenen Protesten im Osten unangenehm in Erscheinung treten – u.a. bei den Streikdemonstrationen der Kalibergarbeiter aus Bischofferode. Der für die Stillegung der DDR-Bergbaubetriebe verantwortliche Treuhandmanager Klaus Schucht hatte zuvor verkündet: „Wenn man den Widerstand der Bischofferöder nicht bricht, wie will man dann überhaupt noch Veränderungen in der Arbeitswelt durchsetzen?“
Der linke Aktivist und Historiker Markus Mohr veröffentlichte 2010 zusammen mit dem Politologen Hartmut Rübner eine weitere „Gegnerbestimmung“. In dieser Studie ging es um die „Sozialwissenschaft im Dienst der ‚inneren Sicherheit‘“. Zuvor hatte bereits der Leipziger Philosoph Peer Pasternak im Rahmen seiner Doktorarbeit über die Wende in den ostdeutschen Universitäten festgestellt, dass die West-68er mit einer Anstellung dort üppig „Drittmittel“ aus Westdeutschland, insbesondere für ihre „Transformationsforschung“, akquirieren konnten, in der sie „ohne Hemmungen sogar konkrete Handlungsanleitungen für die Politik in Form von Aufruhrpräventions-Konzepten bei Betriebsschließungen lieferten“.
Als der einstige FHO-Generalstabsoffizier Gerhard Wessel am 1.Mai 1968 (!) die Leitung des BND übernahm, hieß es in einer der unzähligen internen Kritiken: „Keine wissenschaftliche Abteilung des BND werde von einem Wissenschaftler geführt. Hier seien nur Generalstäbler oder Managertypen gefragt.“
(Das Zitat findet sich wie auch andere hier verwendete Zitate in der zweibändigen, vom BND abgesegneten Gehlen-Biographie der „Unabhängigen Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes“, die vom Politologen Rolf-Dieter Müller 2017 im „Ch.Links Verlag“ veröffentlicht wurde. Wieviel der BND bzw. die Historikerkommission dem linken Berliner Verlag wohl dafür bezahlt haben… Zum Gehlen-Doppelband zählen noch weitere dicke Bände über den BND (insgesamt sollen es 13 werden). Wenn sie so langweilig sind wie die 1372 Seiten der Biographie, d.h. nur aus zur Verfügung gestellten Akten, Memoranden, Briefen, Gutachten, Dossiers, Gedächtnisprotokollen und Stellungsnahmen bestehen und kein Wort über die von Gehlen verantworteten konkreten Aktivitäten (Informations-Beschaffung und -Auswertung) der Sowjetunion, in der SBZ/DDR, im Nahen Osten und sonstwo verlieren, dann sollte der Verleger den Lesern dieser elf Bände für ihre Mühe wenigstens was zahlen. Man muß schon „Der amerikanische Bumerang – NS-Kriegsverbrecher im Sold der USA“ von Christopher Simpson lesen, um daran erinnert zu werden, dass die fabelhaften Feind-Informationen, über die Gehlens Abteilung „Fremde Heere Ost“ im Generalstab des OKH verfügte, dadurch zustande kamen, dass die gefangenen sowjetischen Soldaten, Partisanen und Zivilisten gefoltert wurden: „In Wirklichkeit war Gehlen zu einem Großteil seiner Informationen durch die schrecklichen Scheußlichkeiten des Krieges gelangt: Folterung, Verhör und Hungertod von Millionen sowjetischer Kriegsgefangener. Sogar Gehlens Verteidiger – die in den USA und Deutschland zahlreich vertreten sind – geben zu, dass er eine wichtige Rolle bei der Organisation der Kriegsgefangenenverhöre gespielt hat. Der Erfolg, den diese Verhörmethoden vom deutschen Standpunkt aus hatten, war die Grundlage von Gehlens Karriere. Er begründete seinen Ruf als Geheimdienstoffizier und brachte ihm den Rang eines Generalmajors ein.“
Einige konkrete Informationsbeschaffungs-Beispiele finden sich auch in der Familiengeschichte von Wibke Bruhns „Meines Vaters Land“: Ihr Vater war bei der „Abwehr“ und wurde im Zusammenhang des Stauffenberg-Attentats hingerichtet. Seiner Frau schrieb er am 1.11.1942: Ich habe innerhalb von drei Tagen drei gründliche Verhöre von 12,15 und 18 Stunden Dauer durchführen müssen.“ Die meisten wurden, nachdem er sie „ausgeschöpft“ hatte, erschossen. Einmal kam ihm ein Mädchen aus Leningrad unter, „wieder ein Studentin von einem uns nun schon sattsam bekannten Spezial-Institut, die mit ganz neuartigen Aufgaben per Fallschirm zu uns gekommen war [d.h. von den Deutschen geschnappt worden war]. Sie spricht fließend Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch, kann große Stücke von Geothe, Schiller, Shakespeare, Byron us. auswendig, ist sehr musikalisch, 22 Jahre alt, ganz appetitlich anzusehen – und stockkommunistisch. Es reizt mich zu versuchen, ob man hier nicht mal an einem vielleicht doch ganz wertvollen Objekt aus einer ‚Saula‘ eine ‚Paula‘ machen könnte. Erschießen ist eine verhältnismäßig einfache und schnelle Lösung.“ Er hält es jedoch für falsch, solche „dünn gesäten Vertreter der russischen Intelligenz“, also „die vereinzelten Pflanzen dieser höher entwickelten Gattung, selbst wenn sie zur Zeit noch giftig sind, ohne weiteres auszujäten, sondern möchte versuchen, sie durch Fremdbestäubung zur ‚Mutation‘ zu bringen…Dieser Saula ist vorläufig klar, dass sie ihr junges Leben – ebenfalls vorläufig – mir verdankt, und reagiert auf meine ‚Fremdbestäubung‘ einstweilen offensichtlich positiv.“ Sie schreibt nun für ihn Aufsätze, die von der Propaganda-Kompanie zu Flugblättern umgearbeitet werden. „Dass sie mir nebenbei, nicht ohne erhebliche Gewissensqualen, eine stattliche Anzahl von ihrer roten Dienststelle hierher entsandter Bomben-Attentäter ans Messer lieferte, ist auch immerhin ein Plus für meine Theorie.“ Als er nach Berlin ins Amt Ausland/Abwehr III beim Oberkommando der Wehrmacht (OKW) versetzt wird, erschießt sein Nachfolger diese umgedrehte „Paula“ jedoch, weil sie sich ihm sexuell verweigerte.
Er hat sich derweil einen 18jährigen Russen „aus seinem Pleskauer Reservoir“ (ein Männer- und ein Frauengefängnis), als seinen „persönlichen Burschen“ geschnappt, den er als „Leibeigenen“ mit nach Hause, in die Halberstädter Villa seiner Eltern, nimmt. Seiner Frau besorgt er 1944 ein russisches Hausmädchen, „eine von den Fallschirmspringerinnen in Pleskau, die hierdurch der Erschießung entgeht, sie weint sich anfangs die Augen aus dem Kopf vor Heimweh.“ Aber dann hat sie sich in Halberstadt so eingewöhnt, „dass sie von einem Urlaub in Russland tatsächlich zurückkommt“. Als der Vater der Autorin gehängt wird, dehnt die Gestapo die Sippenhaft auch auf das russische Hausmädchen aus: Sie wird zur Zwangsarbeit in eine Munitionsfabrik geschickt.
Erwähnt sei hier auch noch der lange im Prenzlauer Berg lebende US-Englischübersetzer Phil Hill, der 2015 an einem Herzinfarkt starb. Er war Spezialist für die Hermannschlacht, wobei er sich konkret für die Ausgrabungen der Reste dieser Schlacht interessierte und auch selber Grabungen plante. Phil Hill wurde 1949 als Sohn eines US-Offiziers in Paris geboren, er lebte bis 1963 in Deutschland, anschließend besuchte er eine Highschool in Washington DC, von 1967-70 war er in der US-Armee – und u.a. in Vietnam stationiert, wo er gefangene Vietkong verhörte.
Dazu führte er 2006 auf einem „Vietnamkongreß“ in der Berliner Volksbühne aus: „In Vietnam diente ich bei der Nachrichtentruppe des Heeres als Kriegsgefangenenverhörer. Ich habe dazu in den USA die vietnamesische Sprache gelernt und wurde dann 1969 nach Vietnam geschickt. Ich diente also bei der gleichen Truppe, die in unseren Tagen durch ihre Folterpraktiken im Irak zu traurigen Ruhm gelangt ist, wobei ich sagen muß, dass wir damals organisatorisch nicht in der Lage gewesen wären, ein solches System zu betreiben. Das heißt, die US-Armee hat aus unserer Erfahrung in Vietnam, die eben darin bestand, dass sie unfähig war, die von den Nachrichteneinheiten gelieferten Informationen sinnvoll zu bearbeiten, nicht etwa gelernt, ihre Informationsbeschaffung zu verbessern, sondern sie hat den Schluß gezogen, das wir eine Folterorganisation bräuchten.“
Wie kam und kommt denn nun aber der BND an Informationen ran. In der Gehlen-Biographie der unabhängigen Historikerkommission steht darüber nichts, sondern ausschließlich über die Scharaden, Kungeleien, Kompromisse und Tricks der BND-Leitungsebene mit Politikern, Parteien, fremden Geheimdiensten etc.. Wir erfahren kein Wort über die „Basisaktivitäten“ des BND, sondern nur über seine Überbaupolitiken. Erstere haben Gehlen anscheinend in seinen letzten Jahren auch überhaupt nicht mehr interessiert, er wollte die Einflußreichen oder vermeintlich Einflußreichen mit seinem Geheimdienstwissen beraten, aber dieses Wissen wurde immer weniger und unaktueller.)
.
Forschung im Dienste der Zersetzung
Es war eben von den im BND einst fehlenden Wissenschaftlern die Rede. Inzwischen gibt es schon fast einen ständigen Austausch zwischen Sozialforschern und Geheimdienstlern (2). Von diesen lehren immer mehr an den Hochschulen und unter jenen finden sich immer öfter willige Zuträger. Der Historiker Markus Mohr hat selbst erlebt, „wie leicht es einem linken Wissenschaftler passieren kann, gegen seinen Willen mit einem VS-Wissenschaftler zu publizieren (mit VS ist der Inlands-Geheimdienst: das „Bundesamt für Verfassungsschutz“ gemeint, während der BND eine dem Kanzleramt nachgeordnete „Oberbehörde“ ist). Dem Historiker Mohr blieb dieses Schicksal nur deshalb erspart, weil er seinen Text für einen von Dieter Rucht und Roland Roth herausgegebenen Sammelband zu den sozialen Bewegungen in Deutschland rechtzeitig zurückzog,“ heißt es dazu in der Wochenzeitung „Freitag“. Bei einem Hamburger taz-Autor, der in der Antifa aktiv ist, und den die Autoren ebenfalls der Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst bezichtigten, waren sie jedoch zu vorschnell: Auf einer Veranstaltung der Berliner Antifas im Mehringhof wurde der Betroffene rehabilitiert – und die Autoren kritisiert.
In der Prenzlauer Berg Monatszeitschrift „Konnektör“ kam kürzlich der einst vom IM/Dichter Schedlinsky bespitzelte Autor Henryk Gericke auf eine „Enzyklopädie des Verrats“ zu sprechen, verfaßt von Laszlo Toth. Sie beginnt ebenfalls mit dem Verräter Judas, und vergißt auch nicht Arminius und Stauffenberg, endet jedoch mit dem Zweiten Weltkrieg. Dies traf auch schon für die große Studie der Journalistin Margret Boveri: „Der Verrat im XX. Jahrhundert“ zu. Gericke bedauert diese „Unvollständigkeit“, da der Verrat sich laufend weiterentwickelt – und sein ohnehin labilisierter Gegen-Begriff – die „Loyalität“ – sich „verlagert“ hat. Als Beispiel erwähnt er die „öffentliche Verratsbibliothek WikiLeaks“. Wenn die Unternehmen, bis hin zu den Verkehrsbetrieben und Krankenhäusern, einseitig den „Vertrag“ mit ihren Mitarbeitern aufkündigen, die „eiserne Reisschüssel zerbrechen“, wie man in China sagt, dann bleibt diesen nur noch wenig mehr, als ihr Wissen um Betriebs-Interna auszupacken, was sogar bald per Gesetz noch forciert werden soll. Im Endeffekt ist jeder Mitarbeiter ein potentieller „Whistleblower“ und jeder Penner ein „Schläfer“! Damit wird der bisher zumeist noch auf heterosexuelle Liebesbeziehungen und Ehen beschränkte Verrat vollends epidemisch. Und der „Agents Provocateurs“ vielleicht schon bald ein anständiger Beruf, so wie einst in den US-Klassenkämpfen die Streikbrecher der Agentur Pinkerton.
Neuerdings sind drei dieser „Lumpen“, wie Karl Marx sie kurz und schmerzlos nannte, aufgeflogen, d.h. in der Scene, die sie an die Staatsmacht „verraten“ sollten, enttarnt worden: In der Heidelberger Linken ein „verdeckter Ermittler des LKA“, der sich nach einem Wiener Krimiroman-Kommissar Simon Brenner nannte (sein richtiger Name ist Bromma). In der europäischen Umweltschutzbewegung, ausgehend von England, der „Agent provocateur“ des Scotland Yard: Mark Kennedy alias Stone, auch „Flash“ genannt, weil er so großzügig mit seinem Geld umging und äußerst umtriebig war: Er verfaßte während seiner siebenjährigen Spitzeltätigkeit rund 2000 Dossiers über linke Aktivisten und Gruppen in 22 Ländern. Und in der österreichischen Tierschutzbewegung eine „verdeckte Ermittlerin“ des Bundeskriminalamts (BK) mit dem Decknamen Danielle Durand, die derzeit als Zeugin vor Gericht aussagen muß, wo sie abstritt, mit dem oder den von ihr Bespitzelten Geschlechtsverkehr gehabt zu haben.
Die ersten beiden Staatsspitzel waren vor ihrer Enttarnung als „verräterische Genossen“ auch in der Berliner Linken aktiv. Der „Engländer“ sogar recht häufig, aber angeblich nur zur „Legendenpflege“, dazu gehörte auch das Anzünden einer Barrikade aus Müllcontainern. Der „Heidelberger“ wohnte um den 1.Mai 2010 bei einem Studenten aus der „linksjugend – solid“: Meas, in dessen Küche er auch photographiert wurde. Meas schätzte ihn als jemand ein, „der gerade politisch eingestiegen und neugierig ist“. Er kannte „Simon Brenner“ bereits aus Heidelberg. Meas hatte dort die SDS-Gruppe mit aufgebaut und der verdeckte Ermittler war als einer der ersten bei ihnen aufgetaucht. Seine Tätigkeit als Provokateur übte er nach zwei Richtungen hin aus: Einmal, indem er in den Berichten an seine LKA-Führungsoffiziere die „Gefährlichkeit“ der Gruppen und Individuen, die er bespitzelte, übertrieb, und zum anderen, indem er versuchte, letztere zu „kriminellen Handlungen“ zu bewegen. Als Meas z.B. in einer SDS-Sitzung erwähnte, dass er ein Fahrrad bräuchte, riet „Simon Brenner“ ihm, sich doch eins am Bahnhof zu klauen, das wäre am Ungefährlichsten. Und als er von einem besonders pazifistisch eingestellten Genossen erfuhr, er studiere Chemie, erreichte Simon Brenner, dass die Polizei bei dem „Chemiker“ eine Hausdurchsuchung durchführte – auf den Verdacht hin, dass er Bomben bauen würde. Zur Rückendeckung seines verdeckten Ermittlers ließ der Innenminister von Baden-Württemberg am 18.1. verlauten, dass dieser „tatsächliche Anhaltspunkte“ dafür geliefert habe, dass die von ihm Ausspionierten „künftig Straftaten begehen“.
„Und dies alles trotz der verfassungsrechtlich garantierten Trennung von Geheimdienst und Polizei,“ schimpft Meas, der den Spitzel im übrigen als einen „übermotivierten jungen Typen“ bezeichnet, „mit dem man sich viel und gut unterhalten konnte und der sich für die Probleme interessierte. Er war total sympathisch.“ Später tauchte er auch in der „Kritischen Initiative Heidelberg“ auf. „Er hat sich ohne Skrupel in das Privatleben eingemischt, sich auf Basis von Freundschaften eingeschlichen.“
Einer der Linken, der nach Simon Brenners Enttarnung bei seinem „Verhör“ im Café „Orange“ dabei war, Mathias, wunderte sich, „dass einer so entfremdet von sich leben kann – und das ist dann sein Beruf. Im Grunde tut er mir leid.“ Die FAZ berichtete von einer Heidelberger Kommilitonin Brenners, die mit ihm zu Demonstrationen nach Berlin gefahren war, und sich nun selbst leid tut: Sie fühlt sich von ihm „belogen und betrogen“. Im Nachhinein will allerdings seine spießige Wohnungseinrichtung und sein Musikgeschmack sie bereits stutzig gemacht haben.
Den vom „Engländer“ – Mark Kennedy – bespitzelten Berliner Genossen Wolf, der ihn ebenfalls, zusammen mit dessen Freundin, in seiner WG beherbergt hatte, „mindestens fünf mal“, traf ich, wie zuvor auch Meas, in der sogenannten „Spitzelzentrale“ – der Anarcho-Kneipe „Baiz“. Auch Wolf, der ein Tattoostudio betrieb, wo sein Spitzel sich jedesmal, wenn er ihn besuchte „behandeln“ ließ, bezeichnet ihn als eine „liebenswerten Menschen“. Als dieser Mensch 40 wurde, lud er Wolf nach England ein – zu einer großen dreitägigen Geburtstagsparty in Herfordshire mit 250 Leuten und vielen Entertainern.
Mark Kennedy bekam für seinen Spitzeleinsatz insgesamt 2 Millionen Euro von seiner „Firma“, der er dafür mehrmals täglich Bericht erstatten mußte. Außerdem wußten die Führungsoffiziere über sein Blackberry-Handy zu jeder Zeit, wo er sich aufhielt. Sein ganzes Equipment und seine „szenetypischen Accessoires“ waren vom Feinsten, er besaß darüberhinaus ein Boot und ein Haus in Nottingham, wo er mit seiner Freundin wohnte. Verheiratet war er mit einer Frau in Irland, mit der er zwei Kinder hat. Sie wußte von seiner Tätigkeit als „Undercover Agent“ in England. Nach seiner Enttarnung gab er der Daily Mail für eine „sechsstellige Summe“ ein Interview, in dem er u.a. verriet, das es neben ihm 15 weitere Spitzel in der Anarcho- und Öko-Scene gab, von denen vier noch immer aktiv seien. Und weil er sich in dem „activist movement“ durch sein Engagement (die sich jetzt als „Agent Provocateurs“-Taten darstellen) sowie durch allerlei Hilfsdienste – von Transporten über Zugblockaden bis zum Anbringen von Protesttransparenten an Kränen – äußerst beliebt machte, stand er nach seinem Ausscheiden aus dem Polizeidienst und seiner Enttarnung plötzlich ohne Freunde (und Freundin) dar. Er flüchtete nach Amerika und lebt dort nun in einem „verbarrikadierten Versteck“ – aus Angst vor seinen Polizeivorgesetzten und den „angry Eco-Activists“. Die englische Presse sieht in ihm eher ein „Opfer“ als einen „Täter“. Er tut ihnen leid.
Nachdem er aufgeflogen war, „switschte“ er nach einer Schrecksekunde sofort vom „Scene-Jargon“ zur „Polizeisprache“, das galt auch für Simon Brenner. Die „Polizeisprache“ beherrschte er sowieso besser, denn seine „linke Ideologie“ war, ebenso wie die von Brenner, eher „unterentwickelt“. Anders bei den Spitzeln in leitenden Funktionen bei den Neonazi-Organisationen (in Deutschland u.a. bei der NPD), die keine doppelte Denkweise für ihren Einsatz brauchen – und deswegen so gut wie keine Probleme haben, ihre „zwei Identitäten auszubalancieren“, wie der englische „Guardian“ das nennt. Schon die Gründung der NPD – durch den Junker Adolf von Thadden – war eine Spitzelaktion, initiiert und finanziert vom englischen Geheimdienst M16. Analog dazu wurde der vormalige Wehrmachts-Geheimdienstler Arnold Gehlen von der CIA beauftragt, einen bundesdeutschen Geheimdienst, den BND, aufzubauen.
Den Beamten von Scotland Yard und vom BKA ist es ausdrücklich verboten, bei ihrer Arbeit als „Undercover Agent“ in der Linken mit den Aktivistinnen ein intimes Verhältnis („taktische Liebesbeziehungen“ genannt) einzugehen. Der Guardian fand heraus, dass von „vier kürzlich identifizierten Spitzeln drei Sex mit Aktivistinnen hatten“. Simon Brenner und Mark Kennedy flogen genau deswegen auf, weil ihre Freundinnen hinter ihre Doppelexistenz kamen – und sie dann ihrerseits verrieten.
Anders der englische Staatsspitzel Jim Boyling alias Sutton, der sich in eine „Öko-Aktivistin“ verliebte, sie heiratete – und über seine Arbeit als „Agent Provocateur“ aufklärte. Das Ehepaar hat zwei Kinder, lebt jedoch inzwischen getrennt. Boyling versuchte, seine Frau zum Rückzug aus der linken Bewegung zu überreden und in seine „Kunst der Täuschung“ einzuweisen, wie sie dem Guardian in einem Interview verriet.
Es sollte uns in der Linken zu denken geben, dass ausgerechnet die Spitzel als die besten und engagiertesten Genossen galten. Ein englischer Freund von Mark Kennedy, der Öko-Aktivist Alex Long, meint sogar – allerdings im Nachhinein: „Er war zu gut, um wahr zu sein!“ Keiner hatte einen Verdacht. Sein Berliner Freund Wolf äußerte sich ähnlich: „Er fiel durch seine große Hilfsbereitschaft auf. Obwohl ich enttäuscht von ihm bin, glaube ich doch nach wie vor, dass seine Freundschaft mit einigen Leuten ernst gemeint war.“ Die Frau des Spitzels Jim Boyling erinnert sich, dass er seine Arbeit großartig fand: „Er fühlte sich wie Gott, weil er die Geheimnisse aller auf beiden Seiten kannte, selbst entschied, was er wem erzählte und dadurch über das Schicksal der Leute bestimmen konnte.“ Seitdem er nicht mehr als „verdeckter Ermittler“ tätig ist, vermißt er – ebenso wie Mark Kennedy und wahrscheinlich auch Simon Brenner – das „Aktivisten-Leben“ – sowie die Anerkennung und die Freundschaft der Genossen.
Michel Foucault definierte die Freundschaft einmal als „die Summe all der Dinge, über die man einander Freude und Lust bereiten kann“. Das Problem, auf das die linke Bewegung ziele, sei „das der Freundschaft“. Dieses „Problem“ stellte er in den Horizont eine „Ethik – als einer Form, die man seinem Verhalten und seinem Leben zu geben hat“. An anderer Stelle spricht er – ähnlich wie neuerdings die französische Gruppe „Tiqqun“ – von der „notwendigen Suche nach Existenzstilen – mit möglichst großen Unterschieden untereinander“. Notwendig deswegen, weil die bisherige „Suche nach einer Form von Moral, die für alle annehmbar wäre – in dem Sinne, dass alle sich ihr zu unterwerfen hätten“, sich als eine „Katastrophe“ erwiesen hat. Obwohl mit Foucault hierbei einig, plädiert Tiqqun im Kollektiv für eine größtmögliche Annäherung der Existenzstile – „formes de vie“ genannt in ihrem Pamphlet „Einführung in den Bürgerkrieg“. Statt diesen Widerspruch aufzulösen, der sich für die Gruppen im Horizont einer Ethik der Freundschaft auftut, bleiben die deutschen Antifas bei ihrer „Moral“. (3)
Zu dem englischen Spitzelfall erklärten sie auf „indymedia“: „Wir möchte alle Genossen aufrufen, keinerlei Informationen über Mark preis zu geben! Die Aufarbeitung dieses Falles ist den GenossInnen überlassen, die mit ihm zu tun haben, niemand anders geht so etwas an, den Medien schon gar nicht!“
Eine solche linke „Moral“ läuft im Endeffekt auf das hinaus, was die Psychotherapeutin Angelika Holderberg in dem Aufsatzband „Nach dem bewaffneten Kampf“ schrieb: In einer Diskussion mit ehemaligen RAF-Leuten fiel irgendwann „der bedeutsame Satz ‚In der RAF hat es keine wirklichen Freundschaften gegeben‘.“ Dies ist das Einfallstor für Spitzel!
Im Falle der drei aufgeflogenen Polizeispitzel kommt aber noch etwas hinzu: Sie haben Gruppen der „Öko-Bewegung“ ausspioniert. Und dabei handelt es sich durchweg um „Single Issue Movements“, also um Kollektive von Tierschützern, „Klimakämpfern“, Anti-AKWlern, Genkritikern/Feldbefreiern etc.. Und diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie zum Einen unkritisch die diesbezüglich herrschende Wissenschaft sich aneignen – also Darwinismus, Atomphysik, Geochemie, Genetik, die sie freilich gegen ihre praktischen Anwender richten, und zum Anderen, dass sie sich um der Effektivität ihres Engagements willen auf jeweils ein „Issue“ konzentrieren. Dies ist ein weiteres Einfallstor für Spitzel, die bloß das dafür notwendige Grundwissen, bestehend aus borniertester Naturwissenschaft, auswendig lernen müssen, um einigermaßen mitreden und dann auch -handeln zu können.
Das Wissen, die Erfahrungen aus der Geschichte der Arbeiterbewegung und vor allem die (Marxsche) Warenanalyse stehen in diesen Gruppen nicht (mehr) zur Diskussion. Das macht es den Spitzeln leicht, die als Polizisten sowieso mit naturwissenschaftlichen Versatzstücken („harten Fakten“) geschult werden, während sie in soziologischer Hinsicht Analphabeten sind. Nicht umsonst schimpfte die Bild-Zeitung einst über das „Soziologenchinesisch“ der 68er-Aktivisten: Ihre Einschleichjournalisten, aber auch die Verfassungsschützer und verdeckten Ermittler (Zivis) der Polizei verstanden kein Wort in den studentischen Debatten, die sich in immer abstraktere Gedankenwelten hochschraubten. Wer sich da als Bulle bzw. Staatsschützer einarbeitete – und gleichzeitig sein „Beamtendenken“ beibehalten wollte, der war verloren, d.h. der wurde gegen seinen Willen zu einem „Schizo“ – im deleuzianischen Sinne. Auch die späteren militanten Gruppen – RAF und 2.Juni – wurden erst unterwandert, als ihre theoretische Arbeit mehr und mehr der praktischen des bewaffneten Kampfes wich: Banküberfälle, Autos klauen, Flugzeuge entführen, Waffen besorgen, sie bunkern, damit schießen üben, konspirative Wohnungen anmieten etc. – alles Aktivitäten, die jeder Bulle besser kann, weswegen diese auch gleich mitreden und sich nützlich machen konnten, z.B. indem sie Sprengstoff besorgten, u.a. um damit das Haus der jüdischen Gemeinde in der Fasanenstrasse in die Luft zu sprengen.
Jede „Single Issue“-Gruppe, und dazu gehören auch alle anarchistischen Zarenmörder z.B., vernachlässigt sträflich die Notwendigkeit, den Bürgerkrieg „in Richtung seiner erhabensten Erscheinungsweisen auf sich zu nehmen.“ (Tiqqun) Im Gegenteil brechen sie ihn runter auf das handwerkliche Geschick von Kriminellen und Sportlern, deren soziales Bewußtsein mit dem von Polizisten nahezu identisch ist. Es versteht sich von selbst, dass dies kein Plädoyer für eine Beschränkung auf legale Aktionen oder gar „Projekte“ sein soll. Die Unzufriedenheit mit den gesellschaftlichen Zuständen und der eigenen Ohnmacht muß zur Triebkraft werden, um dem Leben und den Dingen auf den Grund zu gehen. Die „Unzufriedenheit“ mit den gesellschaftlichen Zuständen, die an allen Enden und Ecken aufflackern kann, sollte dabei kollektiv elaboriert werden – und auf keinen Fall in ein „Projekt“ münden, sondern in Experimente, die Erfahrung (experience) liefern. Das ist das sicherste Mittel zur Abwehr von Spitzeln, denen diese Unzufriedenheit für immer verschlossen bleibt, sonst wären sie keine Staatsdiener und Agent provocateurs geworden. Diese „Lumpen“ sind im Gegenteil höchst zufrieden mit ihrem (hochdotierten) Job – oder wie die Frau des Spitzels Jim Boyling es ausdrückte: „Er fühlte sich wie Gott“. Und seitdem er nicht mehr als „verdeckter Ermittler“ tätig ist, vermißt er dieses Doppelleben ganz schrecklich. Was er dabei ohne Zweifel besaß, war Mut – und nur das. Deswegen müssen wir auch die Glorifizierung des Mutes bei den „Streetfightern“ ernsthaft problematisieren. Die bloße Existenz von Spitzeln in linken Gruppen ist ein Indiz dafür, dass die Einzelnen darin ebenfalls eine Doppelexistenz führen: Einerseits nehmen sie ein kritische Haltung gegenüber dem ganzen „Scheißsystem“ an, andererseits halten sie sich die Möglichkeit offen, darin auf erhöhter Stufenleiter irgendwann wieder einzusteigen – und sei es als Welterfahrene in dem Kaff, von wo sie einst hergekommen sind. Es scheint, dass „attac“ besonders viele dieser Doppelexistenzen angezogen hat, die ihr linkes Engagement im Kollektiv elegant mit individuellem Karriere-„Networking“ über NGOs verbinden. Der Soziologe Jean Baudrillard hat diese neuen Single-Issue-Aktivisten folgendermaßen charakterisiert:
„Die Menschenrechte, die Dissidenz, der Antirassismus, die Ökologie, das sind die weichen Ideologien, easy, post coitum historicum, zum Gebrauch für eine leichtlebige Generation, die weder harte Ideologien noch radikale Philosophien kennt. Die Ideologie einer auch politisch neosentimentalen Generation, die den Altruismus, die Geselligkeit, die internationale Caritas und das individuelle Tremolo wiederentdeckt. Herzlichkeit, Solidarität, kosmopolitische Bewegtheit, pathetisches Multimedia: lauter weiche Werte, die man im Nietzscheanischen, marxistisch-freudianistischen (aber auch Rimbaudschen, Jarryschen und Situationistischen) Zeitalter verwarf. Diese neue Generation ist die der behüteten Kinder der Krise, während die vorangegangene die der verdammten Kinder der Geschichte war. Diese jungen, romantischen, herrischen und sentimentalen Leute finden gleichzeitig den Weg zur poetischen Pose des Herzens und zum Geschäft. Sie sind Zeitgenossen der neuen Unternehmer, sie sind wunderbare Medien-Idioten: transzendentaler Werbeidealismus. Dem Geld, den Modeströmungen, den Leistungskarrieren nahestehend, lauter von den harten Generationen verachtete Dinge. Weiche Immoralität, Sensibilität auf niedrigstem Niveau. Auch softer Ehrgeiz: eine Generation, der alles gelungen ist, die schon alles hat, die spielerisch Solidarität praktiziert, die nicht mehr die Stigmata der Klassenverwünschung an sich trägt. Das sind die europäischen Yuppies.“
.

.
Anmerkungen:
(1) Der Berliner Basidruck-Verlag, dessen erste Veröffentlichung 1990 die Stasi-Protokolle von Erich Mielke waren, hat die bisher wohl dickste Dokumentation über einen einzigen vermeintlichen „Verräter“ bzw. „Spion“ im Ostblock veröffentlicht: „Der Fall Noel Field“ von Bernd-Rainer Barth und Werner Schweizer. Zu den zwei Bänden mit insgesamt 1800 Seiten gehört auch eine DVD sowie die ebenfalls im Basisdruck-Verlag veröffentlichte Autobiographie „Liebe im Exil“ von Edith Anderson. Die junge US-Kommunistin folgte 1945 ihrem Mann Max Schroeder, dem Cheflektor des Aufbau-Verlags, in die Ostzone, wo sie bis 1999 lebte. Sie war u.a. mit Noel Field und seiner Frau befreundet.
(2) Erwähnen könnte man in diesem Zusammenhang auch noch die kürzlich erschienene Biographie des KGB-Agenten Heinz Felfe „Spion ohne Grenzen“ von Bodo von Hechelhammer. Der Autor ist der Chefhistoriker des BND. Die Herausgeber der 13bändigen BND-Geschichte von „Fremde Heere Ost“ bis 1968 (!) sind dagegen Universitätsprofessoren – mit BND-Auftrag, Honorarkräfte also – seine wahrscheinlich. Man merkt dem Buch von Hechelhammer an, dass ihn Felfe sieben Jahre lang beschäftigt hat, und er sich auch durch „Lebenskrisen, Widerstände und Einschüchterungen“ nicht vom Thema abbringen. Es ist mehr als nur eine Fleißarbeit. „Felfes Biographie ist nicht nur eine Parabel für die Unwägbarkeiten eines Lebens im 20. Jahrhundert, bei dem sich die Geheimdienstarbeit wie ein roter Faden als eigentliche Lebenskonstante erweist. Sondern sie ist auch ein – allerdings extremes – Beispiel für das Ausbalancieren von moralischen und rechtlichen Ideen, von Loyalität und Verrat, in sich verändernden gegensätzlichen politischen Systemen und in der Schattenwelt der Geheimdienste.“
Schon im Vorwort kommt der Autor bei seinem Helden zu dem Schluß: „Felfe arbeitete als Agent für die Nazis, die Briten, die Amerikaner, die Sowjets und die West- ebenso wie die Ostdeutschen. Vor allem aber arbeitete er immer für sich selbst.“ Gibt es letzteres überhaupt? Wie bei allen Biographen gibt es eine fast zwangsläufige Überschätzung der Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte. Wobei die bürgerliche Wissenschaft, vor allem die Psychologie, das sowieso nahelegen, aber mir scheint, dass die linke Journalistin Wibke Bruhns das bei ihrer Biographie über ihren Vater, der fast aus Versehen zum „20.Juli“-Widerständler“ wurde, das besser verbunden hat: das Große mit dem ganz Kleinen (dem Abwehroffizier und unbekannten Vater). In der Moderne werden einem auch die freiwilligen Handlungen aufgezwungen. Der Agent ist vielleicht nichts anderes als ein halbstaatlicher oder verbeamteter Hochstapler.
Für Felfe galt das noch ein letztes Mal als Rentner und „Held der Sowjetunion“ in Ostberlin, wo er mit einem halbgoldenen 280-Mercedes herumfuhr, eine Villa mit Swimmingpool in Weissensee besaß, eine neue Frau heiratete, eine Ärztin – mit der er ständig die Sowjetunion bereiste, auf der Krim urlaubte und in der Tschoslowakei kurte. Den Doktortitel und einen Lehrstuhl an der Humboldt-Universität schenkte ihm der KGB und das MfS auch noch. Fürwahr ein „erfüllter Lebensabend“. Er mußte dafür eigentlich nur eine Autobiographie schreiben. In Moskau hatte gerade der englische „Topspion“ des KGB, Kim Philby, seine Autobiographie veröffentlicht. Felfe sollte es ihm nachtun, aber trotz Stasi-Ghostwriter ähnelte sie dann mehr den zuvor erschienenen Memoiren seines einstigen Förderers im BND: Gehlen.
Beider Werke verdanken sich einer Reduzierung der antikommunistischen Naziweltsicht auf eine preußisch-karge. Sie sind quasi von Aufsteigern aus Not geschrieben, während Philby als Oberschichtsangehöriger fast ironisch (heute würde man sagen: „cool“) sein Leben erzählt – und dabei immer wieder zu verstehen gibt, wie aufgeblasen alles um ihn herum war. Wenn Felfes literarisches Vorbild Gehlen war, schon in der Schlichtheit ihrer komplementären Ideologien, dann war Philbys Vorbild T.E. Lawrence (von Arabien) mit seinem zu Recht weltberühmten Agentenbericht „Die sieben Säulen der Weisheit.“ Lawrence war schwul und starb bei einem Motorradunfall, Philby bekam einen Leninorden und heiratete eine Moskauerin, Rufina Pukhova, die nach seinem Tod 1988 ebenfalls eine Autobiographie veröffentlichte, einige Kapitel darin stammen von ihm.
Der BND-Historiker Hechelhammer nennt diese Spezies „Maulwürfe“. Heute ist das die Technik und ihre Wetware besteht vorwiegend aus Nerds, Hipster und unangenehmen Karrieristen – auf der einen Seite, und auf Geistes- und Sozialwissenschaftler, Juristen und Betriebswirtschafter auf der anderen Seite. Nicht zu vergessen Pressesprecher, Leiter für Kommunikation etc. – dazu Internetauftritte, Apps, blogs, mails usw.. Gehlen mit seinen gelegentlichen Presseinterviews und seinen Redakteuren im „Spiegel“ war vielleicht in Deutschland ein Vorreiter im Hinblick auf den „gläsernen Geheimdienst“, obwohl er das Gegenteil mit dem BND erreichen wollte: bloß keine Struktur, die ausspioniert werden könnte, maximaler Kompetenzwirrwar stattdessen. Aber zum Einen war er der Meinung, dass ein moderner „Nachrichtendienst“, als Spionage- oder Spitzelorganisation wie der BND, bereits voll „wissenschaftlich arbeite“ und zum Anderen erhoffte er sich neben verbesserter Abhörtechnik vor allem von „Satelliten“ einen großen Sprung nach vorne. In gewisser Weise ist der damit ausgerüstete Geheimdienstler das Gegenteil von einem Maulwurf.
(3) Mit einem Vortrag über den historischen Wandel freundschaftlicher Beziehungen eröffnete der Direktor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung Axel Honneth die Frankfurter Positionen 2011. Er sprach über „Den langen Schatten der Romantik“: Was unter Freundschaft zu verstehen ist, unterliegt ihm zufolge einem historischen Wandel. Von der Antike bis ins 18. Jahrhundert war Freundschaft eine Sache unter Männern und beruhte auf ständischen Prinzipien. Freundschaft zwischen Herren und Knechten war ebenso undenkbar wie die zwischen einem verheirateten Mann und einer verheirateten Frau. Solcherlei galt als standes- oder sittenwidrig. Freundschaften unter Männern hatten, wie Honneth betonte, „zeremoniellen Charakter“, ihr Zweck war ein gemeinsamer Nutzen. Gefühle spielten dabei keine Rolle, es ging um den gemeinsamen Ehrenkodex, etwa unter Kaufleuten, oder um Netzwerke zur Verfolgung gemeinsamer Interessen, zum Beispiel unter Zunftgenossen Eine „durchgreifende Entkrampfung des Subjekts“ für Frauen und Männer gleichermaßen wurde erst nach 1945 und verstärkt nach 1968 möglich. Honneth widerspricht dem beliebten zeitdiagnostischen Gerücht, wonach Individualisierung, Leistungsfanatismus und Karrierezwänge Räume für Freundschaft zerstörten Den kulturpessimistischen Schluss, wonach steigende Scheidungszahlen und die Zahl von Singlehaushalten das Ende von Liebe und Freundschaft anzeigten, hält Honneth für voreilig. Die zitierten Trends zeigten auch, dass Frauen wie Männer selbstbewusst geworden sind und persönliche Beziehungen aufkündigen, wenn die erlernten normativen Grundlagen wie Offenheit, Gleichheit, Vertrauen und Solidarität verraten werden. Das läßt zwei Schlüsse zu: Entweder ist der Verrat dank „Pille“, „Pornos“ und „Sexwerbung“ epidemisch geworden (Amazon bietet z.B. 8000 Bücher zum Thema „Verrat“ an) oder man ist selbstbewußt genug inzwischen, um immer weniger gewillt zu sein, über ihn – den Verrat – hinwegzusehen.
.

Maulwurf. Photo: Knofo (Norbert Kröcher) kein Agent oder Spitzel, sondern ein ehrliches „deutsches Mitglied der terroristischen Vereinigung Bewegung 2.Juni“ (Wikipedia) und zuletzt Feuerwehrhauptmann einer freiwilligen Feuerwehr-Einheit in Brandenburg. Bevor er sich erschoß, hat er seine Memoiren Bert Papenfuß zum Veröffentlichen gegeben, was dieser auch getan hat – im Basisdruck-Verlag.
.
Maulwürfe
„Wenn ihr also den Maulwurf recht fleißig verfolgt, und mit Stumpf und Stiel vertilgen wollt, so thut ihr euch selbst den grösten Schaden und den Engerlingen den grösten Gefallen,“ schrieb der alemannische Pädagoge Johann Peter Hebel. Nun hat sich aber die Situation völlig umgedreht: Es gibt so gut wie keine Engerlinge mehr (die Larven des nahezu ausgerotteten Maikäfers), so dass sich die Maulwürfe an den äußerst nützlichen Regenwürmern schadlos halten, was die Gärtner noch mehr erbost als die Maulwurfshaufen auf ihrem Rasen, aber es nützt ihnen nichts, denn in Deutschland sind laut Bundesartenschutzverordnung fast alle heimischen Säugetierarten besonders geschützt. Dazu zählt natürlich auch der „europäische Maulwurf“. Das Weibchen bringt im Juni drei bis vier nackte, anfangs blinde Jungen zur Welt, die sie vier bis sechs Wochen säugt.
Maulwürfe werden selten in Zoos gehalten. Wikipedia berichtet, dass man im Osnabrücker Zoo „Unter der Erde“ welche hielt, aber nachdem mehrere Tiere gestorben waren, wurde die Haltung von Maulwürfen beendet. Ich hielt auch einmal einen Maulwurf, den unsere Katze gefangen hatte, in einem Terrarium mit Erde und Regenwürmern, aber auch er starb nach kurzer Zeit. Zum Trost schenkte mir jemand ein Stofftier: „Der kleine Maulwurf“, der durch eine tschechoslowakische Zeichentrickserie berühmt geworden war. Sie lief später auch im deutschen Fernsehen, für das dann auch das überaus beliebte Kinderbuch „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ filmisch animiert wurde: Auf der Suche nach dem Übeltäter fragt der Maulwurf sich bei allen möglichen Tieren durch: Doch Taube, Kaninchen, Kuh und Schwein beweisen ihm, dass ihre Kothaufen ganz anders aussehen. Den richtigen Tipp bekommt er schließlich von zwei Fliegen, die sich mit der Materie bestens auskennen: Es war der Hund des Metzgers mit Namen „Hans-Heinerich“, der dann auch die Rache des kleinen Maulwurfs zu spüren bekommt.
Dann gibt es ferner eine Maulwurfgeschichte von einem Soldaten im Ersten Weltkrieg, dem ein Maulwurf im Schützengraben das Leben rettete. Franz Kafka machte daraus eine Erzählung mit dem Titel „Der Riesenmaulwurf“. Dieser bleibt jedoch unsichtbar, obwohl ein Dorfschullehrer versichert, ihn gesehen zu haben. Von Primo Levi stammt ein Loblied auf den Maulwurf in Form eines Gedichts. Und von dem ebenfalls aus Turin stammenden Leiter der dortigen Buchmesse Ernesto Ferrero eine Erzählung über das Leben eines Maulwurfs und den aussichtslosen Kampf des Menschen gegen das unterirdisch lebende Tier.
Von Kant verspottet, erfährt der Maulwurf bei Hegel eine erste politische Metaphorisierung: „Bisweilen erscheint der Geist nicht offenbar, sondern treibt sich, wie der Franzose sagt ‚sous terre‘ herum. Hamlet sagt vom Geiste, der ihn bald hier- und bald dorthin ruft: ‚Du bist ein wackerer Maulwurf‘, denn der Geist gräbt unter der Erde fort und vollendet sein Werk.“ So heißt es in Hegels „Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte“. Marx vergleicht dann die Revolution mit einem alten Maulwurf, „der umsichtig unter der Erde das Terrain vorbereitet, um eines Tages ans Licht zu kommen und den Sieg zu erringen“. Auf „deutschlandfunkkultur“ heißt es über diese unterirdische Wühlarbeit des Maulwurfs der Revolutionweitaus pessimistischer: „Beharrlich gräbt er seine Wege durch die Finsternis. Vergeblich, aber mit Zuversicht.“ Angesichts der sich erneut weltweit durchsetzenden völkischen Reaktion hat das Berliner Theater „Hau“ jüngst ein trotziges Festival „Der Maulwurf macht weiter“ organisiert. Zuvor hatte man einer historischen Aufarbeitung des bundesdeutschen Buchhandels den Untertitel „Von Marx zum Maulwurf“ gegeben, was sich so anhörte als seien die linken Buchläden und Verlage, bedrängt von Internet und Amazon, für die „Revolution“ bereits so weit, wieder in den Untergrund zu gehen, um „Raubdrucke“ unters Volk zu bringen. Aber was diesmal raubdrucken? „Brehms Thierleben“?
Der Maulwurf ist für die Wühlarbeit bestens ausgestattet. Das Tierlexikon zählt acht Merkmale auf: „Der Schwanz dient als Tastorgan zur Orientierung in dunklen Gängen. Durch die zylinderförmige Körperform kommt er gut durch die Gänge. Beim Graben schiebt er die Erde mit der Stirn an die Seite. Die rüsselartig verlängerte Nase wird wegen der starken Beanspruchung bei der Wühlarbeit durch einen länglichen Nasenknorpel geschützt. Mit den Ohren kann er jede Erschüterung im Boden und an der Oberfläche hören. Die starken Vordergliedmaßen sind ein hilfreiches Werkzeug für die Wühlarbeit. Das Fell besteht aus überaus dicht stehenden Haaren, die herabfallende Erde wird vom Körper fern gehalten. Die Augen braucht er im Dunkeln seines Lebensraums nicht.“Wir sagen deswegen auch, jemand sei „blind wie ein Maulwurf“, dabei „ahnen“ wir laut Tagesspiegel nicht einmal, dass Maulwürfe „die Welt farbig sehen und sogar ultraviolettes Licht wahrnehmen, wozu kein Mensch imstande ist.“
Früher hat man sie massenhaft erschlagen, vergiftet, in Fallen gefangen und ihnen das seidenweiche schwarze Fell abgezogen. Jacken, Krägen und Schlafröcke aus Maulwurfsfellen waren lange Zeit schick. Auch und gerade bei den Revolutionären. Heute untersuchen z.B. Leo Peichl und seine Kollegen vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt die Netzhäute von Maulwürfen und anderen unterirdisch lebenden Säugetieren. Diese sterben dabei vermutlich auch, aber heraus kommt am Ende: „Es ist nicht so, dass sich ihre Augen als Anpassung an das unterirdische Leben völlig zurückgebildet haben“, sagt Peichl. „Ihre Netzhaut enthält Stäbchen und zwei verschiedene Zapfentypen wie bei anderen Säugetieren auch.“
Auf „Youtube“ findet man zig Clips, die zeigen, wie Maulwürfe durchs Gras laufen, sich eingraben, dabei Regenwürmer entdecken und fressen; wie sie in einem künstlichen Substrat Gänge graben; wie die Maulwurfsgrillen es ihnen im Kleinen nachtun, mit ebenfalls sehr großen Grabklauen ausgerüstet; wie sie aus einer kaputten Hausecke herauskommen, in allen Löchern am Haus Insekten findet und anschließend nicht mehr in ihre Höhle reinpassen, woraufhin sie immer nervöser und hektischerwerden und versuchen, im Garten ein neues Loch zu graben. Ein Clip hat den Titel: „Maulwurf findet ein neues Zuhause“, ein anderer: „Die besten Mittel um Maulwürfe endgültig zu vertreiben“. Eine Anleitung zu ihrer Ausrottung also, die 35.000 Mal aufgerufen wurde. Dagegen steht mit 128.000 Aufrufen ein Clip mit der pazifistischen Frohbotschaft „Maulwürfe gehören nun mal zur Naturlandschaft. Anstatt sie zu bekämpfen, sollte man sich freuen, dass sie die Böden lockern.“
Egal für welches Tier man sich interessiert, man kommt im Internet immer auf diese Meinungs-Pole zwischen Ökologie und Ökonomie. Alfred Brehm erinnerte bereits daran, „daß die Naturforscher einen großen Theil ihres Wissens alten, erprobten Maulwurfsfängern verdanken.“
.
Wassermaulwürfe
Der Desman, wie er eigentlich genannt wird, in Russland auch Wychochol, ist ein im Wasser lebender Maulwurf mit einer langen dünnen Schnauze, die er als Schnorchel benutzen kann. Das auch als „Wassermaulwurf“ bezeichnete Tier ist sehr selten geworden, für das Magazin Focus ist der schon „fast ein Fabelwesen“, aber für Kreuzworträtsellöser ist diese Maulwurfsart mit sechs Buchstaben ziemlich real.
Das deutsche Fernsehen finanzierte im Frühjahr ein Naturfilmteam, um einen lebenden Desman im Wolgagebiet aufzuspüren und zu filmen. Als Sprecher wollten sie den Schriftsteller Wladimir Kaminer verpflichten. Der fragte den Redakteur verwundert: „Haben Sie etwa so wenig gute Sprecher, dass sie einen Laien mit starkem russischen Akzent anheuern müssen?“ Er nahm dann aber den Job doch gern an.
Anschließend erzählte er: „Die Landschaft ist wunderschön, die Aufnahmen sind spektakulär, doch exotische Tiere kann die mittelrussische Ebene nicht bieten. Die Fauna an der Wolga ist den Deutschen gut vertraut, Wildschweine und Elche, Biber und Schildkröten, Adler, Mäuse und jede Menge Mücken. Das einzige Tier, das es nur an der Wolga und sonst nirgends auf der Welt gibt, heißt Wychochol.“
Es gibt dieses Tier allerdings auch noch – etwas kleiner und mit längerem Rüssel – in den Pyrenäen, wo es ebenfalls immer seltener wird. Die BBC drehte einmal einen Film über diesen „Galemys pyrenaicus“, der sich gern an schnell fließenden Gebirgsbächen aufhält, während der russische „Desmana moschata“ eher an Seen und Teichen zu finden ist. Beide haben Schwimmhäute zwischen den Zehen, können mit ihren Krallen aber auch gut klettern. Ihre Augen sind winzig, wirken jedoch durch eine weiße Umrandung sehr viel größer.
Kaminer bekam vom Sender weitere Informationen über dieses selten gewordene Tier, das einst über ganz Europa verbreitet war: „Es soll ein Millionen Jahre altes Relikt sein, ein Überlebenskünstler, es hat die Mammuts überlebt und Waldbrände und Weltkriege, es hat die Eiszeit und den Kommunismus überlebt und den Niedergang der Sowjetunion ebenfalls, der in meiner Heimat nach wie vor als GGKJ, ‚größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts‘ bezeichnet wird. Die besondere Wehrhaftigkeit des Wychochol, das Geheimnis seines langen Lebens, ist im Schwanz des Tierchens versteckt. Es sind Drüsen, die einen dermaßen stark riechenden Duft produzieren, dass die Kühe das Wasser nicht mehr aus dem Fluss trinken, wenn dort zuvor ein Wychochol vorbeigeschwommen ist.“
Wegen ihres Fells und des Drüsensekrets, das man für die Parfümherstellung verwendete, hat man die Tiere intensiv verfolgt, sodass sie an den Rand der Ausrottung gerieten, 1957 wurde die Jagd auf sie deswegen verboten, zuvor gab es bereits einige regionale Schutzzonen für sie, deren Fell an der Oberseite rotbraun und an der Unterseite aschgrau gefärbt ist.
1933 hieß es in einer Zusammenfassung über den Stand der russischen Wychochol-Forschung: „In den letzten Jahren wurde eine Reihe sehr interessanter Arbeiten über die Lebensweise des Desman, dieses kostbaren Pelztieres, veröffentlicht. Während der nun fast zehnjährigen Schutzperiode wuchs der Bestand der Art merklich, sodass wir sie nicht mehr als aussterbendes Tier, sondern nur als leicht ausrottbares bezeichnen können.“
Es gab wiederholt Versuche, die Wassermaulwürfe in Gefangenschaft zu halten und zu züchten – aber ohne großen Erfolg, weil es sich als zu schwierig erwies, sie richtig zu ernähren. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte den Tieren neben der Jagd mehr und mehr die Gewässerverschmutzung zu. Laut Wikipedia richteten die sowjetischen Naturschutzbehörden daraufhin mehrere Schutzgebiete ein und initiierten Umsiedlungsprogramme, neben dem Wolgagebiet auch am Ob und am Dnepr, wo die früher nicht heimisch waren.
Gelegentlich werden heute noch Umsiedlungsprogramme durchgeführt: 1983 wurde eine Städtepartnerschaft zwischen Erlangen und Wladimir, einer Stadt am Fluss Kljasma, vereinbart. Im Internetblog „erlangenwladimir“ wird berichtet, dass 2019 die Arbeiten an der neuen Bahnstrecke für Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Moskau und Kasan begonnen haben. Es ist ein chinesisch-russisches Gemeinschaftsprojekt. Die Züge sollen in Wladimir halten – die Hauptstadt des gleichnamigen Oblast liegt an der Kljasma, einem Nebenfluss der Oka, die in die Wolga mündet.
Bei den Planungsarbeiten ging es darum, einen Ausgleich zwischen Verkehr und Umwelt zu finden: „So will man etwa 20 Wassermaulwürfe – der Blog berichtete schon öfter über diese fast ausgestorbenen Kleinsäuger – aus einer Zone im Becken der Kljasma umsiedeln, weil man befürchtet, die in der Nähe verlaufende Trasse könnte den Russischen Desman stören.“
An der Wolga musste das Filmteam das kleine, etwa rattengroße Tier lange suchen: „Es folgte seinem Geruch am Fluss, verlief sich beinahe im Wald und wurde dann aber doch fündig: 20 Sekunden lang tauchte der Wychochol aus dem Wasser auf, winkte mit dem Rüssel dem deutschen Zuschauer und verschwand wieder. Schon schön, sagte die Redaktion bei der Abnahme des Films, aber etwas zu wenig Exotik. Deswegen wurde ich als Sprecher mit russischem Akzent angeheuert“, so Kaminer.
Dem Film ist nicht zu entnehmen, dass die im Gegensatz zu den Maulwürfen sozial leben, das heißt, dass sie sich oft zu mehreren einen Bau am Ufer teilen, dessen Eingänge unter der Wasseroberfläche liegen und den sie mit Pflanzenmaterial auspolstern. Gelegentlich legen sie ihre Baue auch in Biberburgen an.
Biber ebenso wie Bisamratten sind Nagetiere und fressen Pflanzen, sind also keine Nahrungskonkurrenten für die Desmane, die man gelegentlich auch als Bisamrüssler bezeichnet. Sie zählen zur Ordnung der Insektenfresser, jagen nachts und haben es dabei auf kleine Fische ebenso wie auf Krebstiere und Amphibien abgesehen, auch Insekten verschmähen sie nicht, das gilt noch mehr für den Pyrenäen-Desman, der sich hauptsächlich von Wasserinsekten und deren Larven sowie von Blutegeln, Ringelwürmern und Schnecken ernährt.
„Er lebt in monogamer Einehe“, behaupten jedenfalls die Autoren von „tierdoku.de“, die an anderer Stelle jedoch schreiben: „Über das Fortpflanzungsverhalten der Pyrenäen-Desmane ist nur sehr wenig bekannt“, gleiches gilt für die Lebenserwartung in ihren natürlichen Lebensräumen. Sie graben keine Baue, sondern nutzen Felsspalten und -höhlen.
Über den Russischen , von dem es noch etwa 30.000 Exemplare geben soll, schrieb Alfred Brehm: „Oft steckt er seinen Rüssel in das Maul und läßt dann schnatternde Töne hören, welche denen einer Ente ähneln. Reizt man ihn oder greift man ihn an, so pfeift und quiekt er wie eine Spitzmaus.“
.
Maulwurfsjäger
2019 gab es noch 300 offiziell registrierte Maulwurfsfänger in England. Bei der Gartenliebe der Engländer gibt es daneben natürlich noch Millionen, die quasi inoffiziell Maulwürfe vernichten. Sie töten mit Gift, Gas, Feuer, Benzin oder mit einem Spaten. Man darf sich wundern, dass es überhaupt noch Maulwürfe in England gibt.
„Denn die Hacke der Gärtner ist ein Opfermesser mit dem alles kurz und klein geschlagen wird, die ganze chaotische Vielfalt, um hernach auf dem sauber geeggten Geviert die Homogenität zu zelebrieren, zu züchten,“ wie Michel Serres schreibt. „Wenn die Wut des Messers sich gelegt hat, ist alles bearbeitet: zu feinem Staub geeggt. Auf die Elemente zurückgeführt. Analyse oder: Nichts ändert sich, wenn man von der Praxis zur Theorie übergeht. Agrikultur und Kultur haben denselben Ursprung oder dieselbe Grundfläche, ein leeres Feld, das einen Bruch des Gleichgewichts herbeiführt, eine saubere, durch Vertreibung, Vernichtung geschaffene Fläche. Eine Fläche der Reinheit, eine Fläche der Zugehörigkeit…Der Gärtner, der Priester, der Philosoph. Drei Ursprünge in drei Personen in einer einzigen Verrichtung im selben Augenblick. Es ging nicht darum, die Erde durch Bearbeitung fruchtbar zu machen, es ging um Ausmerzen, Unterdrücken, Vertreiben, es ging um Zerstören, die Hacke des Gärtners ist ein Opfermesser.“
Der englische Maulwurfsjäger Marc Hamer hat ein Buch über seine Arbeit geschrieben: „Wie man einen Maulwurf fängt“ (2019). Der Vegetarier war eine zeitlang arbeits- und obdachlos, arbeitete dann bei der Bahn, studierte Kunst und gab eine Zeitschrift heraus. Dann wurde er Gärtner und mußte sich mit Maulwürfen „auseinandersetzen“. Er wollte sie so human wie möglich töten, aber er tötete sie eben. „Um sie wirklich los zu werden, muß man sie töten. Maulwurffänger können eine Population nur eindämmen.“ Es ist mit dem Maulwurfsjäger ein bißchen so wie mit der autistischen US-Nutztierexpertin Temple Grandin, die laufend Verbesserungen auf Schlachthöfen entwickelt und durchsetzt – zum Wohle der Rinder und Schweine, deren Leben dort allerdings endet.
Marc Hamers Buch beginnt mit dem Satz „Ich habe viele Jahre lang in Gärten und auf Bauernhöfen Maulwürfe gefangen. Maulwurfsfang ist eine alte Kunst, die mir ein gutes Leben beschwert hat, doch nun bin ich alt und das Jagen, Fallenstellen und Töten leid.“ Er ist verheiratet, hat Kinder, wohnt in einem Haus mit Garten, wo er sich vom Saulus zum Paulus wandelte: „Wir freuen uns für die Maulwürfe, die dort leben.“
Vielleicht war es der Einfluß seiner Frau. Ich erinnere an den Gartenbesitzer Helmut Salzinger, der in seinem Buch „Der Gärtner im Dschungel“ (1992) schrieb: „Wenn meine Frau sah, dass fünf Erdkröten groß geworden waren, dann war das eine gute Gartensaison gewesen.“
Sei es, wie es ist, Marc Hamer gesteht gleich zu Anfang: „Die gesamte Lebensgeschichte eines Maulwurfs zu erzählen, ist unmöglich,“ weil sie ja die meiste Zeit unter der Erde im Dunkeln leben. Deswegen erzählt er vor allem von seiner Jagd auf die Tiere – im Auftrag von Gartenbesitzern. „Maulwurfsfänger erstellen Werbeflyer und Webseiten.“ Am Anfang experimentierte er noch: Seine „Methode sollte effizient, schnell, von Emotionen losgelöst und technisch sein.“ Zwar fing er die poussierlichen Tierchen, weil er damit sein Geld verdiente, „aber natürlich gibt es auch persönliche Gründe, weshalb man einen solchen Beruf wählt,“ schreibt er – und erzählt dann sein Leben (woraus seine „persönlichen Gründe“ allerdings nicht hervorgehen).
Das Gärtnern ist für ihn auch eine Kunst, nur dass er dabei nicht mit Pinsel und Bleistift arbeitet, seine Hände sind eher „dafür gemacht, ein Gewehr, eine Axt oder einen Spaten zu halten.“ Seine liebste Freizeitbeschäftigung ist dann auch Holzhacken und Wandern. Als Maulwurfsjäger ist man sowieso viel unterwegs. „Als Gärtner arbeite ich in gepflegten Gärten, die für Menschen gedacht sind, nicht für Tiere und Pflanzen, und die beeindrucken sollen. Aber dort bin ich nie mit dem Herzen dabei. Mein Herz ist in den Wäldern und auf den Wiesen.“
In einem Kapitel erklärt er, was es alles an Maulwurfsarten auf der Welt gibt, sogar weiße (selten), er aber jagt nur den „Europäischen Maulwurf“. Die englischen Archäologen sind an dessen Maulwurfshügeln interessiert: Oft findet man darin Ton- und Glasscherben, die der Maulwurf von unter der Erde heraufgebracht hat. „Sie nennen das Maulwurfologie“. Obwohl Marc Hamer nicht in ihre unterirdischen Gänge gucken kann, ist er sich sicher: „Maulwürfe haben weder Freunde noch Familie, sie statten einander keine Besuche ab, sie hassen Gesellschaft.“ Sie legen Vorräte mit Regenwürmern an, die sie so verletzen, dass sie zwar weiterleben, aber nicht wegkriechen können. Die Psychiater haben das modifiziert übernommen, indem sie ihren Patienten haufenweise hospitalisieren und unter Drogen setzen.
Der Maulwurfsjäger trägt aber keinen weißen Kittel, sondern einen Wachsbaumwollhut mit breiter Krempe. „Auf alten Fotos tragen Maulwurfsjäger immer solche ramponierten, breitkrampigen Hüte“ Jetzt steht er auf seinem Einsatzfeld: „Ich stelle meinen Blick auf unscharf, versuche jegliche voreilige Schlüsse zu vermeiden und scanne das Feld auf Muster und die Entfernungen zwischen den einzelnen Hügeln ab.“ Dort können etwa 12 Maulwürfe leben, schätzt er. Seine erste Jägerlist: „Ich wasche mir die Hände mit Erde aus einem Maulwurfshügel, um meinen Geruch zu überdecken.“
Ein Maulwurf kann pro Tag etwa 20 Meter „Tunnelsystem“ graben. „Dabei verbaut er kontinuierlich Erde in die Decke und die Wände. Einen Teil schiebt er vor sich her, bis es irgendwann zu viel ist. Dann hält er kurz an und schiebt die Erde hinaus an die Oberfläche. Manchmal sehe ich ganz kurz einen, wie er gerade die riesigen rosa Hände aus dem Maulwurfshügel streckt…Seine Berechenbarkeit, sein Bedürfnis nach einem festen Revier und seine Abneigung gegenüer Veränderungen sind die Schwächen, dank derer man ihn fangen kann. Ich beginne die Jagd, indem ich die frischesten Hügel suche, die erst wenige Stunden alt sind.“
Gegen Ende des Jahres, wenn das Wetter ungemütlich wird, beginnt die Maulwurfsfänger-Saison, denn „sobald es kälter wird und die Würmer sich tiefer in die Erde eingraben, Futter also schwerer zu finden ist, erweitern die Maulwürfe ihr Reich und plötzlich tauchen Hügel auf, wo vorher keine waren. Dann werde ich gerufen.“
Junge Maulwürfe, die das mütterliche Tunnelsystem verlassen müssen, kommen an die Oberfläche. „Sie taumeln blind über die Wiese und suchen nach Futter. Die meisten werden dabei von Vögeln gefressen. Die Obdachlosen einer jeden Spezies sind stets die leichtesten Opfer.“ Deswegen versuchen die jungen Maulwürfe so schnell wie möglich einen eigenen Tunnel zu graben oder in einen leerstehenden einzuziehen, „dessen früherer Besitzer letztes Jahr einer Falle zum Opfer gefallen ist. Sie beginnen ihr eigenes Leben, und dann werde ich gerufen und soll sie fangen.“
Ein bißchen Artwissen: Maulwürfe werden durchschnittlich vier Jahre alt. Sie können quieken und Fiepen, „aber das hört man als Mensch selten.“ Ihr Geschlecht ist schwierig zu bestimmen, „da die äußeren Geschlechtsmerkmale beim Männchen und beim Weibchen fast identisch sind. Die Klitoris des Weibchens ist genauso groß wie der Penis des Männchens.“ Bei den Hyänen ist die Klitoris ebenfalls derart verlängert. „Das Hämoglobin im Blut eines Maulwurfs kann viel mehr Sauerstoff binden als das anderer Tiere, und außerdem haben Maulwürfe die besondere Gabe, ihren Atem noch einmal einzuatmen und somit so viel Leben wie möglich daraus zu ziehen. Der Nachteil dabei ist, dass ihr Blut schlecht gerinnt und sie schnell verbluten.“
Vor etwa 60 Jahren wurden Maulwurfsjäger von Maulwurfstötern bedroht, schreibt Marc Hamer. Sie töteten mit Würmern, die voller Strychnin waren, diese legten sie in die Tunnel und zerstörten damit den Maulwurfsjägern das Geschäft. „Sie konnten nicht nachweisen, ob sie die Maulwürfe wirklich erwischt hatten und ihre Methode barg außerdem das Risiko, eine gesamte Maulwurfspopulation umzubringen.“ 2006 wurde der Einsatz dieses Gifts jedoch trotz Proteste der britischen Regierung von der EU aufgrund einer Gefahr für die Umwelt verboten. „Seitdem haben die Maulwurfsjäger wieder Arbeit bei den Bauern und Gartenbesitzern und das Mächtegleichgewicht ist wiederhergestellt,“ meint Marc Hamer. Die Maulwurfsfänger wurden immer gut bezahlt, früher erhielten sie sogar jährlich ein festes Gehalt. Er hat gehört, „die Maulwurfspopulation in Großbritannien liege aktuell zwischen 30 und 40 Millionen Tiere und steige stetig weiter, weil die Bauern sie nicht mehr wegfangen lassen müssen.“ Demnach scheint es früher Pflicht gewesen zu sein, wenn man Maulwurfshügel sah, einen Maulwurfsfänger kommen zu lassen.
Marc Hamer versenkt mitunter über 100 Fallen (aus rostfreiem Edelstahl) in das Tunnelsystem eines Maulwurfs, die er täglich kontrollieren muß: Er umzingelt ihn mit Fallen. „Früher habe ich mehrere Maulwürfe gehäutet und das Fell gegerbt, ich wollte einfach wissen, ob ich das könnte.“
Obwohl Marc Hamer sich quasi schon zur Ruhe gesetzt hat und sowieso keine Maulwürfe mehr töten will, rufen immer noch alte Kunden von ihm gelegentlich an, er rät ihnen, „selbst zu lernen, wie man Maulwürfe los wird, oder eine Wildblumenwiese anzulegen, wobei ich ihnen gerne helfe. Gegen Bezahlung, versteht sich. Man muß Maulwürfe ja nicht töten. In Deutschland und Österreich steht der Europäische Maulwurf unter Naturschutz, dort leben die Gartenbesitzer einfach mit ihm.“ Schön wärs!
.

Photo: Guillaume Paoli
.
Fluchthelfer
Wenn sich nach 1990 in der Kneipe „Baiz“ die Spitzel trafen, die es im Auftrag der Geheimdienste auf militante Ökos, Tierbefreier und Naturschützer abgesehen hatten, dann war das vor dem Mauerfall das „Mauer-Museum“ am Check Point Charly, das als Treffpunkt von kommunistischen und antikommunistischen Agenten und Fluchthelfern aus Ost und West galt. In der taz gab es nicht nur einige Stasi-Spitzel sondern auch einen (ehemaligen) Fluchthelfer, Christian Uhle, er machte mich auf Wolfgang Welsch aufmerksam, der seine Memoiren veröffentlicht hatte – über seine Haftzeit in der DDR und seine anschließende Tätigkeit als Fluchthelfer, auf den das Ministerium für Staatssicherheit gleich ein ganzes Dutzend Mitarbeiter ansetzte – einige gar mit dem Auftrag, ihn umzubringen. Titel: „Ich war Staatsfeind Nr. 1“ (München 2003). Auch über seinen einstigen Gegner Michael Sievert veröffentlichte er wenig später neue Details, nachdem er bei der Birthlerbehörde Näheres über dessen IM-Tätigkeit erfahren hatte.
Bei der Darstellung der Fluchthilfeaktivitäten bekommt man leicht den Eindruck, es handele sich bei Welsch um einen ebenso verbohrten wie größenwahnsinnigen Antikommunisten, dem alle möglichen CDU-Organisationen und -Politiker zuarbeiteten.
Welschs fast hundert DDR-Kunden, meistens Ärzte, schleuste er mit nagelneuen BRD-Pässen über Bulgarien per Kurier und Flugzeug aus dem Ostblock. Darüber hinaus bezahlte er einen arabisch aussehenden Diplomaten, der die Republikflüchtlinge per Mercedes von Berlin-Friedrichshain (Ost) nach Berlin-Kreuzberg (West) schleuste.
Das alles verschlang zigtausende von Mark. Welsch will dabei jedoch nur seine Unkosten ersetzt bekommen haben, obwohl er einen enorm aufwändigen Lebensstil im Westen entwickelte – Immobilien in Gießen und Weinheim, Antiquitäten, ein Domizil in Griechenland und ein Privatflugzeug.
Seine anfängliche Politisierung beginnt jedoch mit seinem eigenen vergeblichen Fluchtversuch sowie mit den sich daran anschließenden Verhören, dem Gerichtsprozess und den Haftbedingungen in DDR-Knästen. Welschs Schilderung der Praktiken seiner MfS-Ermittler und Gefängniswärter, die auch vor Foltermethoden nicht zurückschrecken, macht all seine späteren Macken – als Fluchthelfer im Westen – verständlich und relativiert sie auch, denn er kämpfte dabei quasi gegen einen ganzen Staat, mehr noch: gegen den Sozialismus weltweit. Man muss dabei ja zwangsläufig durchdrehen und paranoid werden!
Schon einer seiner ersten Vernehmer sagte ihm: „Mir gefällt, dass Sie ein richtiger Feind sind.“ Die Richterin in Welschs erstem Prozess befand: Seine Flucht aus der DDR bei Boizenburg hätte leicht einen dritten Weltkrieg auslösen können – zwei Jahre Knast seien deshalb das Mindeste.
Beim ersten Versuch, aus dem Gefängnis einen Kassiber nach draußen zu schmuggeln, fällt er auf einen Spitzel herein – was einen weiteren Prozess zur Folge hatte. Diesmal wirft man ihm Spionage für die CIA vor. Seinem Rechtsanwalt Wolfgang Vogel gelingt es, diesen Strafvorwurf in „staatsgefährdende Hetze“ umzuwandeln. Dafür bekommt Welsch noch einmal zwei Jahre und drei Monate aufgebrummt – in Bautzen.
Bei seiner Entlassung 1967 stellt man ihn vor die Wahl: „BRD oder DDR?“ Welsch entscheidet sich heroisch gegen die Ausreise, weil er an Ort und Stelle Widerstand leisten will: Seine geheimen Knastaufzeichnungen sollen ihm als Grundlage für einen Dokumentarfilm dienen, der die DDR endgültig als Staat von „rot lackierten Nazis“ entlarvt. Bereits kurz nach Drehbeginn gerät Welsch jedoch erneut an einen Spitzel – und wird wieder verhaftet.
Das Gericht klagt ihn wenig später wegen Planung eines „hetzerischen Films“ an, auch Rechtsanwalt Vogel ist wieder dabei: Welsch bekommt weitere fünf Jahre. Während der Haft im Zuchthaus Brandenburg muss er Elektromotoren für die Rote Armee zusammenbauen. Mit einem anderen Häftling betreibt er dabei systematisch Sabotage.
1971 wird er mit 41 anderen Häftlingen von der BRD freigekauft. In Gießen beginnt er den Kampf gegen die DDR von außen, indem er ein „Otto-Institut“ für Fluchthilfe gründet. An der dortigen Uni wird er RCDS-Aktivist, Franz Josef Strauß bietet ihm Hilfe an. Nach jeder gelungenen Fluchthilfe merkt Welsch an: „Wieder war ich der Sieger.“
Beim MfS legt man derweil eine Akte „Skorpion“ über ihn an. Den ersten auf ihn angesetzten IM (Peter Haack) trifft Welsch während eines Griechenlandurlaubs: „Zwischen uns entwickelte sich eine echte Freundschaft.“ Eine fatale Freundschaft: Denn erst explodiert eine kleine Bombe während der Fahrt im Auto von Welsch, dann wird in England auf ihn geschossen, und schließlich versucht Peter Haack, die ganze Familie Welsch (Hilde und Wolfgang Welsch und deren Tochter) während eines Urlaubs in Israel mit vergifteten Buletten umzubringen.
Haack wird 1994 für diesen Mordversuch zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, sein Chef, der Leiter der Operation „Skorpion“, MfS-General Fiedler, erhängt sich in seiner Moabiter Zelle. Der hatte erwogen, die namibische Befreiungsorganisation Swapo auf Welsch anzusetzen, weil der angeblich „Kontakte nach Südafrika“ besaß und so als „politischer Provokateur und Waffenhändler im Dienst der südafrikanischen Rassisten“ dargestellt werden konnte. So weit kam’s aber nicht mehr, denn 1989/90 löste sich die DDR auf.
Bei Durchsicht seiner Akte in der Gauckbehörde entdeckte Welsch, dass auch seine Frau Hilde ihn verraten hatte. Überhaupt war die Szene der republikflüchtigen und freigekauften DDRler durchsetzt von Spitzeln. Und nicht nur bester Freund Haack wollte ihn umbringen, sondern auch das wohl übelste Subjekt dieses Milieus: Michael Sievert alias Manuel Leria de la Rosa.
Während der eine IM in Welschs Haus die Elektroleitungen als Freundschaftsdienst installierte, wobei er eine Wanze einbaute, besaß der andere IM die Schlüssel zu Welschs Haus. Sievert hatte sich dem MfS 1976 sogar freiwillig vom Westen aus als Spitzel angeboten. Weil man ihm anfänglich nicht traute, ging er in Vorleistung – und verriet eine Flucht nach der anderen (insgesamt etwa zwanzig), bis er schließlich doch noch Geld vom MfS für diese Jobs bekam. Von ihm kam auch der Vorschlag, Welsch zu ermorden, das MfS ging jedoch nicht darauf ein.
Zu Sieverts besten Freunden gehörte der ebenfalls aus der DDR stammende Fotograf Rolf Kersten. Der urteilt heute über ihn: „Er war sehr hilfsbereit und half allen Neuankömmlingen aus der DDR, die Hälfte von denen waren ja potenzielle Fluchthelfer, die sich rächen wollten, das war natürlich interessant für ihn als Spitzel.“ Sievert wurde dann Patenonkel für Rolf Kerstens Sohn. Und obwohl dessen Patentante durch Sievert in den Knast kam, wurde Rolf Kerstens Frau Sieverts Lebensgefährtin.
Sie lebt noch immer mit ihm zusammen in einer Finca in Spanien – und hält den Spitzel natürlich für einen feinen Menschen. Sievert fungierte später auch als Trauzeuge bei der Hochzeit von Wolfgang Welsch, als dieser seine spätere Verräterin Hilde heiratete. Als die „Super-Illu“ 2002 ausführlich über diesen „Judas aus Leidenschaft“ berichtete, bekam der Redakteur anschließend tagelang Morddrohungen.
Neben Welsch und Kersten gehörte auch der Fotograf Christian Uhle zu Sieverts Freundeskreis. Uhle versuchte 1968 von Rumänien aus über die Donau zu fliehen, wurde aber geschnappt und zu 28 Monaten Haft verknackt. Im Cottbuser Knast lernte er Sievert kennen. Beide Häftlinge freundeten sich an. Uhle kam 1970 frei, stellte dann neun Ausreiseanträge und wurde 1974 endlich ausgesiedelt. Sievert war bereits 1972 von der BRD freigekauft worden. In Gießen trafen sie sich wieder, zogen aber dann nach Westberlin.
1975 wurde Uhle als Fluchtkurier in Ostberlin tätig: „Das reichte für mich, um die DDR zu schädigen und damit mein Gewissen zu beruhigen.“ Einen Spitzelverdacht gegenüber Sievert hegte er nie, „obwohl mir immer unklar war, woher er sein vieles Geld hatte. Gewundert hat mich auch, dass er wegen der antiquarischen Bücher ständig in die DDR und CSSR fuhr, zu einer Zeit, als die Ausgesiedelten eigentlich nicht mehr ins Land durften. In der Wende fuhr er oft nach Spanien, wo sein Vater lebte – ein seinerzeit bei Franco untergeschlüpfter alter Nazi, dessen Namen de la Rosa er später annahm.“ Als der Sachbearbeiter bei der Gauckbehörde kurz nach der Wende Sieverts Akte herausgab, murmelte er: „So’n dicker Hund ist mir noch nicht untergekommen!“
Wolfgang Welsch, der ihn in seiner überarbeiteten Biografie wenigstens erwähnen wollte, weil er wie Christian Uhle und Rolf Kersten daran interessiert ist, das ganze Ausmaß der Spitzeltätigkeit des „IM Alexander“ aufzuklären, hat inzwischen noch weiteren Stoff über Michael Sievert alias Manuel Leria de la Rosa gefunden: fünfhundert Aktenseiten, mit denen er neue Attacken gegen ihn plant.
Hat das alles noch irgendeinen bezug zu „Roten Kapellen“? Oder dieses vielleicht: „Liebe Kolleg*innen, momentan ist auf Facebook ein Fake-Profil von Andreas Speit aktiv: https://twitter.com/DanijelMajic/status/1167739333933223936 Solltet ihr eine Freundschaftsanfrage von dem Profil bekommen, nehmt sie nicht an. Viele Grüße, Belinda“
.

.

.

.

.
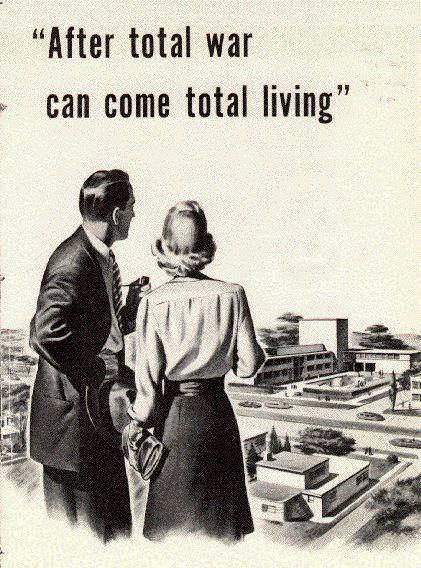
.
Wir Achtsamen
Zur Achtsamkeit, die demnächst in skandinavischen Schulen gelehrt werden soll, gehört die Umsichtigkeit – nicht nur im Hinblick auf „Schnäppchen“, sondern auch z.B. beim Gebrauch des Wortes „Wir“. „Wir müssen die Vermüllung der Meere stoppen!“ „Wir müssen den Waffenexport nach Saudi-Arabien unterbinden!“, „Wir wissen zu wenig über die Klitoris“, „…Wer, wenn nicht wir“ usw. Besonders absurd ist das in den „sozialen Netzwerken“, auf Facebook z.B., wenn dort das „Wir“ („…müssen was gegen den Elfenbeinhandel tun“) mit der Aufforderung zur Unterstützung verbunden wird – die darin besteht, dass man sie anklickt. Und gut is!
Ich verstehe: Es gibt viele „Wirs“ – ein Fußballvereins-Wir, ein „Partei- und Gewerkschafts-Wir „Wir Opelaner“, Schlesiertreffen, „Wir Motorradfahrer“, „Wir Friesen“ – Apropos: Als dieses „Wir“ Theodor Storm gepackt hatte, zieh ihn Theodor Fontane der „Husumerei“. Trotzdem sollte man nicht den Husumer Nationalökonomen Ferdinand Tönnies und seine Unterscheidung von Gemeinschaft und Gesellschaft dabei vergessen. „Gemeinschaften“ gibt es viele, sie können sich an den unmöglichsten Orten, auch geistigen, entwickeln: So gibt es z.B. in Ost- und in Westdeutschland je einen Kreis von Leuten, die Tausendfüßer züchten („Tausi“ von ihnen genannt) und die sogar je eine eigene Zeitschrift herausgeben. Eine Gesellschaft gibt es aber schon lange nicht mehr, höchstens Nationen, Staaten. Also zielt das politische oder sozial engagierte „Wir“ auf die Weltbevölkerung, mindestens auf die in den industrialisierten Ländern. Der Autor Thomas Steinfeld schreibt in der SZ, dass viele Themen heute „oft ins Große zielen“ – und damit letztlich „Ohnmacht“ anzeigen. Ebenso oft aber würden die Argumente auch ins Kleine,“ auf den Einzelnen, „den verantwortungsvollen Bürger“ zielen. Er denkt dabei an die „Flugscham“, die nicht bis zu den „Kampfliegern“ denkt. Stattdessen wird es immer kleinteiliger – bis hin zu einer „Ideologie privater Verantwortung“. Diese debattiert dann z.B., inwieweit die Segelschiffstour mit Eskorte von Greta Thunberg noch „klimaneutral“ ist. Alles Private ist politisch – das hatte einmal eine andere Bedeutung: von sozial determiniert, es war also analytisch gemeint. Jetzt ist das Wir Teil einer Konsumentendemokratie, in der das Gesetz der großen Zahl gilt, das auch der vereinzelte Konsument für sich nutzen kann, indem er z.B., dem Vorbild Ralph Naders folgend, eine bestimmte Ware nicht kauft, um den Hersteller, wenn das viele Konsumenten machen, zu etwas zu zwingen.
Das war u.a. bei der „Anti-Shell-Kampagne“ Mitte der Neunzigerjahre der Fall, die von „Greenpeace“ mitgetragen wurde. Dieser Global NGO-Player spricht im übrigen auch gerne von „Wir“. Im Falle des „Glühbirnenverbots“ umfaßte dies sogar den Osram- und den Philips-Konzern, mit denen zusammen „Greenpeace“ am EU-Parlament vorbei die Ersetzung der Glühbirne durch quecksilberhaltige „Energiesparlampen“ durchsetzte. Derzeit ist die Organisation bei der „Anti-Nestlé-Kampagne“ aktiv: Ein Boykott wegen der auf Privatisierung drängenden „Wasserpolitik“ des weltgrößten Nahrungsmittelkonzerns und seiner Palmölimporte, für die in Indonesien der Urwald seinen Palmölplantagen weichen muß.
Und „Wir“ sollen deswegen keine Nestlé-Produkte mehr kaufen! Schon heißt es in den sozialen Medien, dass dadurch der Konzern bereits starke Umsatzeinbußen hinnehmen mußte. Die ersten Supermärkte hätten sich schon dem Boykott angeschlossen. So eine konsumistische Boykottaktion ist eine Art Heerschau: Man sieht, wie groß das „Wir“ ist – wenigstens in diesem einen Knoten im weltumspannenden Netz des Kapitals: Nestlé. Man geht bereits ins Detail: Die einen konzentrieren sich auf das in Flaschen verkaufte Raubwasser des Konzerns, andere haben sein Katzenfutter „Kitkat“ im Visier. Es kommt zu Überschneidungen – zwischen dem „Wir“ der Nestlé-Gegner und dem „Wir“ der Katzenliebhaber.
.

Global denken
.

Lokal danebengreifen.
.

Lokal strafverfolgen (1)
.

Lokal strafverfolgen (2)
.

Lokal strafverfolgen (3)
.
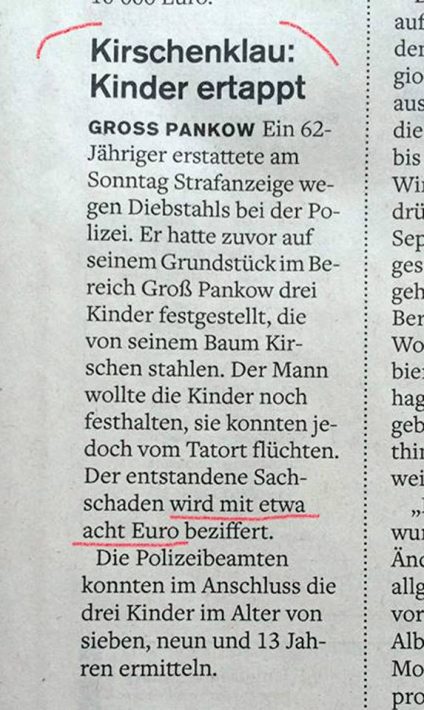
Lokal strafverfolgen (4)
.

Lokal strafverfolgen (5)
.

Lokal strafverfolgen (6)
.
Blattläuse
Früher waren es die Stare, dann die Mücken- und danach die Wespen, zuletzt die Nacktschnecken und nun die Blattläuse. Den Klein- und Großgärtnern, Planzenzüchtern und -liebhabern bleibt keine dieser Plagen erspart. Nur dass einige es gelassen hinnehmen, und die Blattläuse z.B. einzeln abpflücken oder gar nichts tun und abwarten oder Marienkäfer bzw. Junikäfer erwarten. Einige Ahnunglose sehen mit Freude auch Ameisen auf die Blattläuse an ihren Nutzpflanzen losmarschieren. Nur vertilgen diese sie nicht, sondern im Gegenteil schützen sie, um ihre Ausscheidungen abzusaugen. Den sogenannten „Honigtau“, den wir selbst als „Waldhonig“ schätzen, allerdings nicht den von Ameisen, sondern von Bienen gesammelten.
Wenn keine Insekten kommen, um die Blattläuse von ihren Honigtautropfen am After, zu säubern, setzten sich nach kurzer Zeit Rußtaupilze dort fest, deren Schwärze die von den Blattläusen befallenen Blätter und Stengel an der Photosynthese hindert. Mit ihren Saugrüsselnentnehmen die Blattläuse den Pflanzen nicht nur Nährstoffe, „sie können die Einstichwunden auch mit Viren infizieren, was vor allem in der Landwirtschaft erhebliche Schäden anrichten kann. Der NABU erwähnt als Beispiele „die Strichelkrankheit der Kartoffel und der Gerstengelbverzwergungsvirus, der Weizen und Gerste schwächt“.
Wikipedia erwähnt auch noch: „Auf Fahrzeugen, die in der warmen Jahreszeit unter stark von Blattläusen besiedelten Straßenbäumen parken, ist Honigtau nach einigen Stunden als klebriger Film erkennbar.“ Das erinnert mich an die Barbesitzerin Erika Mayr; sie ist Vorsitzende des Imkervereins Charlottenburg/Wilmersdorf und hat ein Buch über „Stadtbienen“ geschrieben. Darin heißt es, dass sie Mitarbeitern aus den Berliner Grünflächenämtern erzählt habe, dass die Straßenbäume in Berlin nach dem Zeitpunkt und der Dauer ihrer Blütentracht gepflanzt wurden nach 45 – vom Gärtner und Imker Karl Förster. Anschließend erzählten die für die städtischen Grünanlagen Verantwortlichen ihr, dass sie mittlerweile nur noch wüßten: „Birken verursachen Schmutz und Autos werden von den Blattläusen der Linden ganz klebrig.“
Es ist also klar: Gegen Blattlausbefall muß man was machen. Wenn man „Blattläuse“ googelt, kommen hunderte von Mittel zu ihrer Vernichtung, meistens handelsübliche Gifte, die mit einem Wirksamkeitsversprechen verbunden sind – z.B.: „Damit werden auch alle Nissen und Eier der Blattläuse vernichtet. Ansonsten hat man schneller wieder Läuse als man denkt.“ Ein anderes Mittel gibt hingegen zu bedenken: Passen Sie auf, dass Sie nicht nur diese „artenreichste Schädlingsfamilie“, sondern auch „viele ‚Nützlinge‘ vernichten, verwenden sie die minimalste Dosis „Pflanzenschutzmittel“ – wie dieses Gift auch beschönigend genannt wird. Der taz-Ökoshop verkauft ein Mittel namens „Blattlausfrei“, das ich für einige Zierpflanzen auf der taz-Dachterrasse verwende. Deswegen halte ich es für relativ harmlos, jedoch zugleich stark genug, um die Blattläuse auf den jungen Trieben kurz und nahezu schmerzlos umzubringen. Vielleicht eine Unmöglichkeit. Will man die Läuse ganz biologisch statt chemisch bekämpfen, kann man neben Marien- und Junikäfern auch Ohrwürmer online bestellen, denn „Ohrwürmer lieben Blattläuse“, wie es da heißt – und zwar nicht wie die sie „melkenden“ Ameisen und Honigbienen, sondern eher wie wir Schweine lieben.
Die Blattläuse haben viele natürliche Feinde, oder andersherum gesagt: Viele Insekten, Spinnen und Vögel leben von Blattläusen, die wieder von Pflanzen leben, die wir essen wollen. Der südfranzösische Insektenforscher Jean-Henri Fabre, der sich ein halbes Leben lang mit den Insekten in seinem Garten und in der Umgebung beschäftigte, hat sich in so einem Konflikt immer für die Insekten, also für die Blattläuse, entschieden und gegen seinen Salat oder Fenchel.
„Die Blattlaus ist wichtiger als der Hirsch“: Das hätte auch ein Gedanke aus seinen zehnbändigen „Erinnerungen eines Insektenforschers“ sein können, es ist aber ein Titel aus der Neuen Zürcher Zeitung. IhrText handelt davon, dass die Blattlaus im Verein mit anderen Kleininsekten fast wichtiger für ein funktionierendes Ökosystem ist als ein Wegfall der großen Tiere. Es ist ein Artikel, der auf die Notwendigkeit des „Kampfes“ gegen das „Insektensterben“ abzielt. Bewiesen wurde die Wichtigkeit der Blattlaus mit einem Experiment der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) im Schweizerischen Nationalpark. Dazu zäunte man ein Gebiet mit mehreren Zäunen bis zur Mitte hin ein, wobei einweitmaschiger Zaun ganz außen nur große Tiere wie Hirsche abhielt, und der innerste sogar Blattläuse und ähnlich winzige Tiere – und das vierzehn Jahre lang. Im Ergebnis kam dabei heraus, „dass auch die kleinen wirbellosen Tiere sehr wichtig sind für das Funktionieren des Systems.“
Schön und gut, aber es wäre übertrieben, von den vor zwei Monaten dorthin verpflanzten Zierbäumen und -sträuchern auf der taz-Terrasse, die automatisch bewässert werden, von einem Öko-System zu reden, es sei denn, man nimmt mich dazu – mit der taz-„Blattlausfrei“-Sprühdose in der Hand, mit der man übrigens auch Zikaden, Weiße Fliegen und Spinnmilben umbringen kann, laut Etikett. Weil die von Blattläusen befallenen Pflanzen noch nicht so lange auf der Terrasse in einem Topf stehen und es sehr windig oben ist, sind dort noch keine Marien- oder Junikäfer gelandet.
Von der diesjährigen Blattlausfront auf den Balkonen wird berichtet, dass eine Hanfpflanze von Blattläusen befallen wurde, aber allein zwei Marienkäfer, die chinesischen (mit bis zu 19 Punkten), hätten sie in kürzester Zeit alle aufgefressen. Der NABU berichtete im Frühjahr: Wo der deutsche 50 Blattläuse am Tag schafft, frißt der chinesische „locker das Fünffache“. „Und wo der Siebenpunkt einmal im Jahr Nachwuchs zeugt, sind es bei dem Biszuneunzehnpunkt wenigstens zwei neue Generationen, je nach Witterung und Nahrungsangebot auch drei bis vier. Dabei stößt und zittert das asiatische Männchen beim Liebesakt nach Phasen der Ruhe immer wieder mal heftig, als sei es in einem früheren Leben ein Hase gewesen.“ Ein seltsamer Koitusvergleich. Bei Blattläusen gibt es übrigens keine zitternden Männchen, nur Weibchen, die sich selbst befruchten.
Auf die Geschichte mit der blattlausbefallenen Hanfpflanze folgte auf der tazterrasse eine kurze Diskussion, in der die Hanf-Propagandisten gegenüber den Nichtrauchern behaupteten, Blattläuse mögen keine Hanfpflanzen. Das sei ja gerade das Großartige an dieser Pflanze, sie wird nicht von Schädlingen befallen. Um so erstaunter waren sie, als der Spiegel anderntags aus dem Landgericht Wien berichtete: „580 Kilo Cannabis soll eine mutmaßliche Drogenbande [bestehend aus 19 Männern, eine Frau auf elf Plantagen] in Österreich angebaut haben“. Ihr Verteidiger zog sofort die auf Hochrechnungen beruhende Erntemenge in Zweifel. Es habe immer wieder schädlingsbedingte Ernteausfälle gegeben: „Der wirkliche Feind des Hanfbauern ist die gemeine Blattlaus“. So lautete dann auch die Überschrift des Prozeßberichts, der darauf hinauslief, dass die Angeklagten nun mindestens ein schlechtes Gewissen haben müßten.
Den hat nämlich fast jeder Besitzer einer oder mehrerer Pflanzen, egal, welcher Art, die von Blattläusen befallen sind – man fühlt sich deswegen schuldig. Der Sprecher des Bundesverbandes Einzelhandelsgärtner, Olaf Beier, sagt es ganz unverblümt so: „Läuse sind immer ein Zeichen dafür, dass eine Pflanze schwächelt.“ Und warum schwächelt sie: Weil wir nicht gut genug aufgepaßt haben – und prompt haben sich die Blattläuse „explosionsartig vermehrt“. Der Besitzer einer Pflanze mit Blattläusen hat keinen grünen, sondern einen braunen Daumen, denn sie bekommt von ihm laut Beier zu viel oder zu wenig Düngung, Licht oder Wasser oder es ist ihr zu kalt oder zu warm – auf jeden Fall schwächelt sie und Ausdruck davon ist der Blattlausbefall. Oder andersherum: Wenn man sie gesund und stark erhält, bleibt sie „Blattlausfrei“. Die japanische Blattlausforschung geht in eine andere Richtung: „Blattläuse können ihre Farbe [von rot auf grün z.B.] ändern, indem sie eine Lebensgemeinschaft mit bestimmten Bakterien eingehen,“ heißt es auf „wissenschaft.de“.Ja, sagt da der NABU, „von Nahem betrachtet, sind Blattläuse zweifellos faszinierende Tiere…“ Und recht hat er.
.
Schildläuse
Vor einiger Zeit interessierte ich mich für Schildläuse und ärgerte mich, dass man im Internet fast nur Informationen über ihre Vernichtung findet, woran ich aber nicht interessiert war. Dann kränkelte eine Zierbirne und der Gärtner von „Hofgrün“ kam. Er sah sich gleich alle Pflanzen auf den zwei Terrassen an. Dabei entdeckte er, dass es sich auf den Blättern eines Oleander nicht um Sommersprossen, sondern um Schildläuse handelte. Der arme Busch war derart voll mit diesen Schnabelkerfen, dass wir ihn bis auf einen Strunk runterschnitten, weil es das Abkratzen mit dem Fingernagel nicht mehr brachte und das Abwischen jedes einzelnen Blattes auf beiden Seiten zu mühsam wurde. Die Weibchen legten quasi über Nacht weitere „riesige Mengen Eier unter ihrem Schild“ (Wikipedia) und die Junglarven, die dann in der Sonne schlüpften, eroberten sofort neue Blätter und Triebe.
Da es sich bei dieser Art von Schildläusen auch nicht um eine handelte, aus der man roten Farbstoff (Kermes/Cochenille/Schellack) gewinnen kann, lohnte sich das Absammeln sowieso nicht. Einige Schildlausarten sind auch noch in anderer Hinsicht nützlich, aber wir hatten erst einmal das Problem, dass noch ein weiterer Oleander-Strauch von den gemeinen Schildläusen befallen war. Statt auch ihn runterzuschneiden, holten ich mir im taz-shop eine Spritzflasche mit dem als ökologisch etikettierten Insektizid „Blattlausfrei“, das auch gegen eine Reihe anderer Pflanzensaftsauger helfen sollte. Die natürlichen Feinde der Schildläuse – Florfliegen, Schwebfliegen, Schlupfwespen, Raubwanzen und Gallmücken – hatte der taz-shop leider noch nicht im Angebot.Und das „Blattlausfrei“ brachte es nicht bei den Schildläusen, so dass ich dann doch jedes Blatt täglich mit einem rauhen Schwamm beidseitig abrieb, inzwischen ist mir das sogar zu einer angenehmen Beschäftigung geworden, weil ich dadurch dem Oleander näher gekommen bin, ohne dass ich das angestrebt habe.
.

.

.

.
Waldkrise
Um die Wald-Verluste zu kompensieren pflanzt Island schon seit langem jährlich 1 Million Bäume, China pflanzte kürzlich 6 Milliarden Bäume, in Indien wurden in 12 Stunden 66 Millionen Bäume gepflanzt, Australien will 1 Milliarde pflanzen, Äthiopien 4 Milliarden (mit 354 Setzlingen in 12 Stunden hat das Land schon mal laut Spiegel einen „Weltrekord im Bäumepflanzen“ aufgestellt), und auf den Philipinen muß jeder Student in Zukunft vor seiner Immatrikulation 10 Bäume pflanzen.
Schön und gut, aber mit dem Einpflanzen ist es nicht getan, die Bäumchen müssen auch gegossen, vor Schädlingen und Pflanzenfressern bewahrt und dann vor Holzdieben geschützt werden.
Zu den von Staat bzw. Kapital initiierten Pflanzaktions-Spektakel kommen noch viele kleine Waldrettungs-NGOs, quasi von unten – wie z.B. „Plant for the Planet (Wie pflanzen Bäume für eine bessere Welt)“. Auf „utopia.de“ werden 12 weitere „Organisationen, die Bäume pflanzen fürs Klima“ empfohlen. Und dann gibt es natürlich linke Waldbesetzungen, wie im Hambacher Forst, die Bäume vor dem Gefälltwerden durch Braunkohlekonzerne oder Windenergiepark-Betreiber retten wollen. Eine Mädchengruppe verbrachte ihr ökologisches Jahr in Nordindien, wo sie sich zusammen mit indigenen Waldbewohnern an deren Bäume kettete, um sie vor der „Nutzholzmafia“ zu schützen.
Dem allen steht die anhaltende Wald-Vernichtung durch Abholzung entgegen, vor allem in Südostasien und Lateinamerika. In Brasilien erreichte dieser „Raubau an der Natur“ (Spiegel) 2018 den höchsten Stand: 7900 Quadratkilometer Wald mußte dort der Landwirtschaft weichen. Der Umweltminister sprach von „illegaler Abholzung“ und machte „gestiegene organisierte Kriminalität“ dafür verantwortlich.
Die Klimaerwärmung läßt sich nur durch Aufforstung mindern, meinen viele Wissenschaftler. Wie das? Die Bäume versorgen sich mit Kohlendioxid, indem sie Luft durch winzige Spalten in ihren Blättern eintreten lassen. Durch die Atemporen „schwitzen“ sie gleichzeitig Wasser aus, das verdunstet, nach oben steigt und dort Wolken bildet, die dann abregnen. Dies geschieht aber nur bei größeren Waldflächen. Das Gegenteil passiert bei unseren, riesigen kahlen Gebirgen, ähnelnden Städten und sonstwo versiegelten Flächen: Sie speichern die Sonnenwärme und strahlen sie ab, dadurch kommt es Nachts z.B. nur zu einer geringen Abkühlung. Hinzu kommen die Auto-, Heizungs- und Industrieabgase
In Mitteleuropa war deswegen ab 1980 vom „Waldsterben“ die Rede, das besonders bei den waldliebenden Deutschen leicht hysterisch klang. Aber die Hysterie ist der Anfang jeder Wissenschaft, und schon bald bewirkten Entschwefelungsanlagen, Gesetze und forstwissenschaftliche Anstrengungen eine Entwarnung. „Gesund“ war der Nutzwald aber noch nicht, wie der Eifel-Förster Peter Wohlleben mit seinen Bestsellern über Bäume unermüdlich kritisiert.
Inzwischen bewirken Hitze, Dürre, Insekten und Schadstoffe eine „Waldkrise“, wie der BUND und die Industriegewerkschaft Bauen, Umwelt, Agrar (IG BAU) das nennen. Rund 300 Millionen Bäume müssen bereits nachgepflanzt werden. Zwar hat der „Waldumbau“ – weg von den „Nadelholz-Monokulturen“ und zurück zu den Mischwäldern – schon seit einige Jahrzehnten begonnen, aber nach Meinung der Experten nicht umfassend genug. Das liegt auch an den wirtschaftlichen Interessen. In Deutschland haben Nadelbäume (außer in den Alpen) nichts zu suchen, dies ist ein Buchenland, aber Buchen darf man eigentlich erst nach 250 Jahren fällen (sie können 500 Jahre alt werden), Fichten und Kiefern liefern dagegen schon nach 60 bis 80 Jahren Papier, Bretter und Spanplatten.
Die nicht gerade für ihr ökologisches Denken berühmte CDU-Agrarministerin Julia Klöckner hat sich jetzt von Wohlleben, dem BUND und der IG BAU oder doch wohl eher von den Klagen der meist adligen Waldbesitzer anrühren lassen, ihren ministeriellen Mitarbeitern einen Ruck gegeben und einen Vier-Punkteplan zur Rettung des Deutschen Waldes vorgestellt: 1. ihn „Aufräumen“, 2. ihm „pragmatisch helfen“, 3. ihn „mit passenden Bäumen aufforsten“, 4. „nicht kleckern sondern klotzen“. 500 Millionen Euro will sie dafür locker machen und den Forstbetrieben mit der Einkommenssteuer entgegenkommen.
.
Nutzholz
Der Bestsellerautor Peter Wohlleben, Förster im Revier des Gemeindewaldes von Hümmel in der Eifel, arbeitet daran, aus den unter steigendem Verwertungsdruck stehenden Nutzforsten hier und überall einen „Urwald“ wieder zu machen. Er hat den Bürgermeister hinter sich und bereits zwei Teile des Reviers der Vernutzung entzogen: mit einem von der Industrie gesponsorten Rehabilitationswald und einem „Ruhewald“ – für Bestattungen. JedesBaumgrab ersetzt rein rechnerisch den Verkaufswert einer über 250 Jahre alten Buche.
Wohlleben war zunächst in der staatlichen Forstbürokratie aufgestiegen, hatte dann aber gekündigt und war von der Gemeinde Hümmel als Förster angestellt worden. In seinem Buch „Der Wald“ kritisiert er seine Kollegen, die Förster, und vor allem die Jäger scharf. Dieser durchaus mutige Kampf, der auch körperlich anstrengend für ihn war, bedeutete genaugenommen einen Bruch mit der herkömmlichen Forstwirtschaft bei laufenden Erntemaschinen.
Ihm kam der „Zeitgeist“ zu Hilfe, mindestens insofern sein erstes Buch „Das geheime Leben der Bäume“ jahrelang auf der Bestsellerliste „Sachbuch“ stand und immer wieder neu aufgelegt wird, also reißenden Absatz fand und findet, flankiert inzwischen von mindestens vier weiteren Bestsellern von ihm über den „Superorganismus“ Wald und seine Sicht auf das Neben- und Miteinander der Pflanzen und Tiere dort. Hinzu kommen Hörbücher, Bildbände und TV-Auftritte.
Sein anhaltender Publikumserfolg verdankt sich auch einer genetikmüden Biologie, welche kurz davor ist, sich algorithmisch in Chemie und Physik aufzulösen, schon allein indem laufend Institute der organismischen Biologie aufgelöst werden zugunsten molekulargenetischer Studiengänge. Die Universitäten wollen sogar ihre überflüssig werdenden Botanischen Gärten abstoßen. Als die Uni Saarbrücken das tat, buddelten die darob empörten Bürger quasi über Nacht sämtliche Pflanzen aus, um sie privat zu retten.
Peter Wohlleben ist inzwischen auch Herausgeber einer „Geo“-Zeitschrift mit dem Titel „Wohllebens Welt“. Zum Zeitgeist gehört wesentlich auch ein Gedanke des Meeresbiologen und Regierungsberaters für Meeressäuger, Karsten Brensing: „Um Tiere besser zu verstehen, ist es notwendig, sie zu vermenschlichen,“ schreibt er. Der Erfurter Verhaltensforscher war selbst erschrocken, als er ihn das erste Mal öffentlich äußerte. Peter Wohlleben könnte ihm zustimmen, er argumentiert dabei vor allem aus seiner Praxis als Förster heraus – und dabei soziologisiert und popularisiert er. Er arbeitet an einer Biosoziologie. Dem gegenüber steht die Soziobiologie – eine amerikanische Verhaltensforschung, der die Nazi-Biologie vorausging: Beiden geht es um die Tierforschung als Menschenforschung. Ihnen lösen sich die Sozialwissenschaften in Biologie auf, während Wohlleben umgekehrt verfährt.
Man hat ihm eine „romantische“ Sicht auf Tiere und Pflanzen und eine völlig utopische auf den Wald vorgeworfen. Seine Gegner, allen voran die deutschen Jäger und die postpreußischen Forstbehörden mit ihren Forstwissenschaftlern im Troß, werden parallel zu seinen Buchauflagen auch immer mehr. Seine Waldsicht ist auf furchtlose Weise antidarwinistisch, bzw. lamarckistisch oder – mit den Worten eines ganzen transatlantischen „Netzwerks“ von Tierphilosophen: läuft auf „Companion Species“ hinaus. Das heißt konkret für „sein“ Revier: „Urwald“.
Seine „Romantik“ erinnerte mich an einen Dreizeiler von Nazim Hikmet: „Leben einzeln und frei wie ein Baum/ Und dabei brüderlich wie ein Wald/Diese Sehnsucht ist alt.“ Seine „Utopie“ berührt sich mit der forstwissenschaftlichen Sicht sowjetischer Biologen, die sich statt auf den dortigen Konkurrenzkampf eher auf (symbiotisches) Zusammenwirken konzentrierten: „Es klingt paradox, aber der Wald braucht den Wald,“ so sagte es einer von ihnen, ein Dendrologe, (Baumforscher), er fügte hinzu: „Sonst stünden viel mehr Bäume einzeln, wo sie sich doch angeblich besser entfalten können.“ Der in den Dreißiger und Vierzigerjahren führende Agrarbiologe der UDSSR Trofim D.Lyssenko empfahl bei der Wiederaufforstung gleich die Anpflanzung von Bäumen in „Nestern“. Er begründete dies revolutionsromantisch: „Erst schützen sie sich gegenseitig und dann opfern sich einige für die Gemeinschaft“. Der Forstwissenschaftler G.N. Wyssozki ging nicht ganz so weit, aber auch er unterschied zwischen vegetativem Freund und Feind: Damit z.B. die Eiche gut wachse, dürfe man sie nicht zusammen mit Eschen und Birken anpflanzen, sondern sollte sie „von Freunden umgeben“: Weißdorn, gelbe Akazie und Geißblatt z.B.. Laut dem Wissenschaftsjournalisten M. Iljin lehrte uns bereits der Gärtner Iwan W. Mitschurin, „dass sich im Wald nur die verschiedenen Baumarten bekämpfen, aber nie die gleichen“. Und jetzt lehrt es uns Wohlleben erneut mit seinen Buchen. Anders als die Wälder bei uns wird der russische Wald von der Steppe bedroht, deswegen riet Lyssenko: aus Eiche (Wald) und Weizen (Feld) Verbündete gegen sie zu machen. Seinen Vorschlag begründete er quasi partisanisch: „Wenn einer zwei andere stört, dann lassen sich diese beiden stets, mindestens für einige Zeit, gegen ihren gemeinsamen Feind verbünden.“ Auch für Wohlleben ist der Wald eine „Gesellschaft“ – mit Feinden zuhauf. Ich befürchte jedoch, Ökologie und Ökonomie stehen sich noch lange in einem „unversöhnlichen gesellschaftlichen Gegensatz“ gegenüber.
.

.

Der turkmenische und der weissrussische Präsident pflanzen mit Hilfe eines turkmenischen und eines weissrussischen Schirmherrn einen kleinen Nadelbaum.
.

Eine Berliner Politikerin bringt ihren Müllcontainer weg.
.

Berliner Bürger äußern sich auf einem Müllcontainer.
.
Anthroposophische Netzwerke
Der Gründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner, hat mich schwer beeindruckt, weil er Anfang der Zwanzigerjahre den Rinderwahnsinn und das Bienensterben voraussagte, und zwar mit den richtigen Begründungen. Die damals von ihm auf einem schlesischen Gutshof gedanklich entwickelte „biologisch-dynamische Landwirtschaft“ (mit dem Gütesiegel „Demeter“) hat sich inzwischen über viele Länder ausgebreitet. Der älteste „Demeter“-Betrieb, Hof Marienhöhe, befindet sich bei Bad Saarow. Daneben gibt es eine Vielzahl von anthroposophischen Bildungseinrichtungen („Waldorfschulen“, Hochschulen, Kunst- und Musikschulen) sowie Krankenhäuser (in Berlin z.B. „Havelhöhe“) und sozialtherapeutische Einrichtungen. Die meisten dieser Institutionen, wie die Gemeinschaftbank Leihen und Schenken „GLS“, sind Genossenschaften.
Aus meiner Kenntnis der „Demeter“-Betriebe, der anthroposophischen Ärzte bzw. Krankeneinrichtungen und der „Waldorfschulen“ kann ich nur Gutes über diese von Rudolf Steiner einst inspirierten Bereiche sagen. Besonders beeindrucken mich immer wieder die aus den „Waldorfschulen“ hervorgegangenen Schüler. Im Vergleich dazu produzieren die staatlichen Schulen vor allem unglückliche Mainstream-Folger: Unterworfene. Eine Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen bescheinigt denn auch den Waldorfschülern besonders geringe Neigungen zu Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Allerdings sind die „Waldorfschulen“ vor allem Bildungsanstalten der oberen Mittelschicht, weil sie pro Kind durchschnittlich 200 Euro im Monat kosten.
Die bürgerlichen Mainstream-Medien, allen voran der Spiegel, kritisieren an den anthroposophischen Projekten, vor allem in der Landwirtschaft, auf überheblich-dümmliche Weise das „Esoterische“, den „Geistigen Impuls“ daran. Als ein Professor an der Universität in Kassel die Wirkungsweise einiger der daraus hervorgegangenen Agrartechniken erforschen wollte, erdreisteten diese Hamburger Arschlöcher sich, die Uni zu warnen, sie würde mit solchen Forschungen ihren guten Ruf gefährden. Ähnlich ist es in der taz: Wenn dort einmal im Jahr eine Beilage „Anthroposophie“ erscheint, sind jedesmal viele Mitarbeiter entsetzt: Rudolf Steiner war doch ein Deutschnationaler, er nannte Afrikaner Neger, seine Evolutionslehre ist rassistisch usw.. Das hätte in der politisch korrekten taz nichts zu suchen, Bundeswehranzeigen sind dagegen weniger umstritten.
Derzeit wird nebenan in der Berliner Friedrichstrasse 23 eine Art Leistungsschau der anthroposophischen Bewegung gezeigt, „Anthro Global“ genannt. Zu meiner Überraschung entdeckte ich dort etliche Betriebe, die sich auf den ersten Blick wohl kaum einer Idee von Rudolf Steiner verdanken (obwohl ich das nicht wissen kann, seine gesammelten Werke umfassen über 120 Bände und ich habe keinen einzigen gelesen, selbst mit den ausgekoppelten Einzeldarstellungen, über Tiere z.B., kann ich wenig anfangen).
Man kennt vielleicht die bekannten anthroposophischen Marken – wie „Weleda“ (Medizin und Kosmetika), „Dr. Hauschka“ (Heilmittel und Kosmetika), Sonett (Waschmittel), „Speick“ (Seifen) und „Rapunzel“ (Lebensmittel). Aber das z.B. ein Motorkolbenhersteller wie die „Mahle GmbH“ auch dazugehört, wunderte mich. Das galt auch bei der Firma „Sono Motors Sion“, die Elektroautos mit Solarenergiezusatz herstellt, sowie bei dem österreichischen Wasserturbinenhersteller „Voith“ und der Wetzlarer „Leica Camera AG“. Bei diesen metallverarbeitenden Betrieben ist wahrscheinlich nicht so sehr das Produkt, sondern eher die Geschäftsfüherung anthroposophisch inspiriert.
Bei dem „Demeterhof Brodowin“ nahe Berlin, den ein Adliger aus dem Westen erwarb, finden seine Nachbarn, dass dort zwar die Möhren, aber nicht die Mitarbeiter „artgerecht“ gehalten werden, ich solle das mal recherchieren, habe ich aber noch nicht. Bis dahin reicht ein Gedanke von Rudolf Steiner: Bei den Menschen gibt es einen sozialen und einen asozialen Impuls. Bei der Ware Arbeitskraft, also bei den Geld-Beziehungen, habe ich überhaupt keine Erfahrung mit Anthroposophen als Chefs (es gibt bestimmt sone und solche), dafür habe ich jedoch ausgesprochen gute Erfahrungen mit ganz normal, also ganz schrecklich, geradezu verbrecherisch wirtschaftenden Bauern – von Norddeutschland bis Italien. Vielleicht kann man es so sagen: Während diese zum Handfesten neigen, tendiere jene zum Geistigen, das macht mich nervös.
Erwähnt sei abschließend noch, dass zu den vielen anthroposophischen Weiterbildungseinrichtungen (neben Verlagen und Zeitschriften) die Unternehmensberatung „Likedeeler“ und das Betriebsführungsinstitut NPI in Holland zählen. Dort gibt es auch noch die anthroposophische „Triodos Bank“, die vor allem Windkraftanlagen finanziert. So weit die in der Berliner Ausstellung vorgestellten Knoten im anthroposophischen Netzwerk.
Dazu gehört auch eine Initiative für „bedingungsloses Grundeinkommen“, die mich ebenfalls verwundert hat, denn bislang war ich der Meinung, dass die Anthros vor allem auf Gemeinschaften bzw. Genossenschaften setzen, das „blGe“ würde jedoch den Staat, den es doch abzuschaffen gilt, erheblich stärken. Schon 100 Jahre nach Durchsetzung eines demokratischen Staates wußten die Athener, dass das gleiche Recht für alle ohne gleichen Besitz für alle die reinste Idiotie ist, es müßte also eher eine „bedingungslose Umverteilung“ durchgesetzt werden. Aber die Anthroposophen haben sich einst durch Distanzierung vom indisch-buddhistischen „Impuls“ getrennt, ebenso von der klassenkämpferischen und antikolonialistischen Annie Besant und stattdessen christlich gutbürgerlich grundiert. Daher der Almosen-Gedanke und nun die Idee „Almosen für alle“.
.
Normopathien
Von Normopathie spricht man bei Personen, die sich vor ihrer Neurose schützen, indem sie sich als „normal“ begreifen, es bezeichnet also eine „zwanghafte Anpassung“. Mit diesem Begriff lassen sich vielleicht auch die ganzen „Start-Upper“ verstehen. Berlin wird als „Start Up Hauptstadt“ bezeichnet. Hinter jeder neuen App steht ein Start-Up, auch hinter jedem neuen „Delivery Service“, der einem Fast Food – eine Pizza oder einen Hamburger – noch fast warm ins Haus oder an den „Co-Working Space“ bringt. Meistens handelt es sich bei den Start-Uppern und ihren Kunden um „Hipster“, die gepflegte Bärte tragen, dazu teure Turnschuhe und T-Shirts und manchmal einen Haarknoten.
Auch die vielen aufdringlich bunten Fahrräder und E-Roller, die überall in den Straßen herumstehen oder -liegen sind insofern Start-Ups als die multinationalen Konzerne, denen sie gehören, ihre dafür extra in Steueroasen gegründeten GmbHs als solche bezeichnen. Früher mußte man bloß in einem der Cafés am Kreuzberger Paul-Linke-Ufer sitzen, dann dauerte es nicht lange bis ein Araberjunge einem fürs selbe Geld ein Fahrrad anbot – mit dem sozial beruhigenden Hinweis: „Garantiert in Zehlendorf geklaut“.
In den U-Bahnhöfen wirbt jetzt ein Start-Up mit einer Internetadresse (fiverr. com) unter der man von „Freelancern“ (Selbständigen) „Content“ (Inhalte) für seinen „blog“ oder seine Firmenwebpage bekommen (kaufen) kann. Nehmen wir an, ich hätte als alter weißer Mann einen Internetblog, in dem es um Demenz geht, also alles rund um den Gedächtnisschwund. Aber mir fällt schon nach dem 18 Eintrag nichts mehr ein – dann wende ich mich in meiner Not im Internet an diese Start-Up-Adresse und suche mir in ihrer Datenbank einen passenden „Content“-Lieferanten aus…Möglichst eine junge Frau, die noch einen klaren Kopf hat. Der sage ich: Schreib mir doch bitte einen blog-eintrag zum Thema Demenz, aber nichts, was schon in den vorangegangenen 48 Einträgen drin steht. Sie wird pro blogeintrag bezahlt (von fiverr.com) und verlangt vielleicht noch einen Aufschlag verlangt, wenn ich ihren „Content“ unter meinem Namen veröffentliche, sie also quasi als Ghostwriter fungiert. Ich nehme weiter an, dass sie, um diese „Contents“ für mich zu verfassen, im Internet unter dem Stichwort „Demenz“ googelt und dann das, was sie dort interessant findet copied and pasted, so machen es jedenfalls die meisten Studenten für den „Content“ ihrer Hausarbeiten. Die „Freelancer“, die sich für den „Content“ von anderen anbieten, arbeiten ja auch meist Zuhause oder in einem Co-Working-Space, wenn sie sich die 300 Euro leisten können, die so ein „Space“ (ein Schreibtisch mit Computer, Internetanschluß und Telefon) monatlich kostet.
Das Schöne an diesem ganzen Ringelrein rund um die neue Start-Up-Internetadresse ist, dass wir dabei alles richtig machen: Der Start Up sammelt Freelancer (und kassiert Gebühren), der Freelancer hat Aufträge, der Demenzblogautor einen fortlaufenden „Content“ und der Co-Working-Space-Betreiber hat seine Großraumbüros ausgelastet. Eine runde Sache. Jedenfalls dann, wenn so viele Leute den blog „anklicken“, das immer mehr Pharmafirmen neben oder unter dem „Content“ Anzeigen für ihre Medikamente gegen Demenz platzieren und ordentlich dafür zahlen. Dann kann ich den „Freelancer“ zahlen und der oder die ihren Co-Working-Space sowie falls nötig auch das Start-Up-Unternehmen, das uns zusammengebracht hat. Man erkennt darin leicht das Modell einer gelungenen „Kommunikation“, ein Netzwerk geradezu, ausgehend von einer innovativen Schwarmintelligenz (und nicht von bloß gedankenlosen Nachahmern).
Zum Vergleich ein „Kommunikations“-Beispiel aus der vorlektronischen Zeit: 1962 veröffentlichte der revolutionäre schwarze Psychoanalytiker Frantz Fanon, dem ein befreundeter weißer Kritiker übrigens vorwarf, dass er keine Lehranalyse absolvierte, um sich von seiner „Normopathie“ zu heilen, einen Beitrag zum algerischen Befreiungskampf, der ihn berühmt machte: „Die Verdammten dieser Erde“. Der von Frankreichs Präsident De Gaulle als neuen „Voltaire“ charakterisierte Schriftsteller Jean-Paul Sartre schrieb in einem Vorwort dazu: „Einen Europäer erschlagen, heißt zwei Fliegen auf einmal treffen, nämlich gleichzeitig einen Unterdrücker und einen Unterdrückten aus der Welt schaffen. Was übrigbleibt ist ein toter Mensch und ein freier Mensch.“
Letzterer, ein vielleicht noch junger Algerier, lebt heute in einem freien (entkolonisierten) Land, das den Islam als Staatsreligion in seiner Verfassung festgeschrieben hat und am Export seines Erdöls und Erdgas so viel verdient, dass es alle jungen Algerier halbwegs bei Laune halten kann. Diese sitzen nun in ihren Internet-Cafés und suchen nach einem befriedigenden „Content“ (meistens „algerian free porno videos“). Man könnte das glatt für eine „Revolution in der Kommunikation“ halten.
.
Umweltpolitik mit Drogen
Der Biologe Cord Riechelmann kam kürzlich in einem FAS-Artikel über Mississippi-Allgatore (die in ihren „Nestern“ abhängig von der Außentemperatur entweder Weibchen oder Männchen hervorbringen) umstandslos vom Marxschen Gedanken über den „Stoffwechsel des Menschen mit der Natur“ auf eine Polizeimeldung aus Tennessee zu sprechen: Dort hatte die Polizei im Internet dringend davor gewarnt, illegale Drogen und verschreibungspflichtige Medikamente im Klo zu entsorgen, weil deren Rückstände nicht geklärt werden können.
Das können auch die Berliner Wasserbetriebe in Europas modernstem Klärwerk Schönerlinde nicht. Zu allem Überfluß ist Deutschland auch noch Weltmeister beim Entsorgen von Medikamenten im Klo. In Tennessee hat diese Einfältigkeit gefährliche „meth gators“ hervorgebracht: Alligatoren auf Speed bzw. Chrystal Meth. „Von Gänsen, Enten und anderen Wasservögeln wussten die Polizisten offensichtlich schon,“ schreibt Riechelmann, „dass sie über Drogen im Wasser hyperaktiv und merkwürdig werden können.“
In Berlin geschieht Ähnliches, aber der Wiener Künstler/Philosoph Fahim Amir sieht das ganz anders als die Polizei in Tennessee. In seinem Buch „Schwein und Zeit. Tiere, Politik, Revolte“ (2018) schreibt er, dass es unter dem Clubuntergrund, des „Berghain“ in Friedrichshain z.B., noch einen weiteren Untergrund gäbe – den „echten“. Nämlich die Kanalisation
Sie verläuft immer noch vom und zum „Kunstraum Radialsystem “. Dieses „Abwasserpumpwerk 5“ an der Spree sammelte einst bis hin zur Schönhauser Allee die Abwasser in weitem Umkreis, um sie auf die Rieselfelder in Falkenberg zu pumpen. Heute sammelt man im Radialsystem Tanzensembles aus der ganzen Welt und es wird dort der „Deutsche Engagementpreis“ vergeben. Das aber nur nebenbei.
Fahim Amir geht davon aus, dass all die Drogen, die im Berghain genommen werden, ja auch wieder raus müssen – und dann eben in die Kanalisation fließen, „wo die dort lebenden Tiere in wahren Duschen von Hormonen und anderen potenten Molekülen gebadet werden.“
2016 hatte Amir das Nachwort für die Merve-Ausgabe des „Manifests für Gefährten“ der feministischen Biologiehistorikerin Donna Haraway geschrieben. Für sein Buch über „Tiere, Politik, Revolte“ geht er nun von ihrem Begriff „Agency“ aus, um den Widerstand von Tieren wahrzunehmen und sie nicht immer nur als Opfer zu sehen. Auch will er kein Spielverderber sein, deswegen kann er sich durchaus vorstellen, dass es da in der Kanalisation unter dem Berghain „Amphetamingedopte Ratten gibt, die vor sich hinraven, hochfrequent kopulierende Kakerlaken auf Kokain [wobei laut Wikipedia Trommelsignale des Männchens eine Rolle spielen], kuscheltrunken aneinander abrutschende Kröten auf MDMA oder Ketamin-Mäuse in psycho-aktiver Dissoziation.“
In der Kanalisation schwimmen aber noch ganz andere Drogen, die in die offenen Gewässer gelangen: In vielen nordamerikanischen Seen finden die Chemiker z.B. Östrogene in erheblichen Mengen. Die männlichen Fische entwickeln sich dadurch zu Weibchen. Ähnliches passiert auch umgekehrt: „Die Welt“ berichtete, chinesische Biologenhätten festgestellt, dass das Abbauprodukt DHT des Hormons Testosteron, das von Bodybuildern eingenommen wird, um ihr Muskelwachstum zu forcieren, bewirke, wenn es mit ihrem Urin in Flüsse und Seen gelangt, das „Froschweibchen vermännlichen“.
„Spektrum der Wissenschaft“ berichtete über die Arbeit von Zoologen der schwedischen Universität Umea. Sie hatten die Wirkung von Medikamenten-Rückständen in Gewässern untersucht, konkret: den Effekt des angstlösenden Wirkstoffs Oxazepam auf Flußbarsche. Sie beobachteten deren Verhalten vor und nach Zugabe dieses Medikaments zum Wasser und stellten fest, dass die Fische durch das Präparat aktiver wurden, schneller fraßen und forscher waren. „Normalerweise sind Barsche scheu und jagen in Schwärmen. Das ist eine bewährte Überlebensstrategie. Doch diejenigen, die in Oxazepam schwimmen, sind wesentlich mutiger“, erklärte einer der Wissenschaftler.
Fahim Amir erwähnt einen positiven Effekt der weltweiten Vermarktung des potenzsteigernden Mittels Viagra: „Die Umsatzzahlen von Robbengenitalien aus Kanada und Rentier-Bastgeweihen aus Alaska brachen nach Einführung von Viagra durch den Pharmakonzern Pfizer im Mai 1998 massiv ein. Ähnliches gilt für Seegurken, Seepferdchen, Geckos und die Grüne Meeresschildkröte.“ Den Grund sieht Amir zum Einen in der schnell überprüfbaren Wirkung des chemischen Mittels und der Unsicherheit bei der Einnahme der magischen Mittel; zum Anderen im Preis: „Viagra, gerade als Generikum, ist oft günstiger als die entsprechenden Pendants aus Tierkörpern.“ Dem Autor kam darob die Idee, „dass ‚Chemie‘ nicht nur Bestandteil ökologischer Probleme ist, sondern auch Teil der Lösung sein könnte.“
.

Abforstung in Amerika
.

Abforstung in der Sowjetunion 1940
.

Lachende Rhön
.

Patriotisch gestalteter Restwald in Italien. Photo: Gerd Ott
.

Weltwaldbrandkarte August 2019
.
„Mission grüne Vielfalt“
Drei Ausstellungen mit Öko-Kunst und -Wissenschaft auf einen Schlag: im Botanischen Museum/Botanischen Garten (BMBG), in der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst (NGBK) und im Prinzessinengarten (PG). Ihr gemeinsames Projekt heißt „Licht Luft Scheiße, Perspektiven auf Ökologie und Moderne“. Dazu teilt ihre Pressestelle mit: „Diese drei, von Veranstaltungen und Publikationen begleiteten Projektteile behandeln die Geschichte und Gegenwart der Umweltbewegung, der sozialökologischen Stadtentwicklung, der Gartenkultur sowie der Pflanzen- und Bodenforschung.“
Vorweg: Auf dem letzten Weltkongreß der Botaniker in Melbourne 2011, an der 500 Biologen teilnahmen, faßte der letzte Redner den Stand ihrer Forschung zusammen und wagte eine Vorausschau über den Erhalt der Biodiversität von Pflanzen weltweit. Ein Journalist fragte ihn daraufhin, ob er noch Hoffnung habe. Der Botaniker überlegte lange und sagte dann: „Das ist eine unfaire Frage“. Ich fragte nun eine der Ausstellungsmacherinnen des Museums nach dem Stand der Berliner Botanik und erfuhr: „Es gibt keine Botaniker mehr.“ Vor einigen Jahren wollte die Freie Universität auch noch den Botanischen Garten (mit seinen 200 Ober- und Unter-Gärtnern) loswerden und das Geld statt für die organismische Biologie für die Genetik verwenden. Nach Protesten bekamen Museum und Garten stattdessen 40 Millionen Euro, um sich bis 2020 zu modernisieren, damit vor allem die Touristen zentrifugal von der überforderten Mitte Berlins zu anderen Sehenswürdigkeiten gelockt werden. Und der Botanische Garten kann sich sehen lassen!
Wir sahen aber diesmal nur die Ausstellung im Botanischen Museum. In den schon vom Umbau betroffenen Hallen u.a. ein Video über eine Gärtnerin des Botanischen Gartens, die während der Arbeit über ihr Verhältnis zu Pflanzen sprach. Ein schwedischer Film, aufgenommen mit einer Kamera, „die mehr als das menschliche Auge sieht“, zeigte einige Insekten, die eine Hecke zwischen Äckern und Feldwegen nutzen. An einer Wand hingen 120 Fotos von Berliner Grünflächen und ihre Nutzung durch die Bürger. Vom einst an der kalifornischen Universität lehrenden Ehepaar Harrison, das bereits in den Achtzigerjahren den Beweis für die Notwendigkeit, sich künstlerisch mit der Ökologie zu beschäftigen, auch in Westberlin führte, zeigte man nun im Botanischen Museum drei Landkarten, auf denen die Harrisons darstellten, dass man infolge des Klimawandels von einer eine Million Quadratkilometer umfassenden Dürreregion zwischen Portugal und Mitteleuropa ausgehen müsse.
Bevor wir noch ihr Kleingedrucktes entziffern konnten, drängte die Führung vorwärts. Wir gelangten in den „Lichterfelder Club of Hope“ mit vielen insektoiden Formen und Fotos auf Tischen und an den Wänden. Einer der Künstler bezeichnete ihre Rauminstallation als eine Sammlung „verblasener Erlösungsphantasien – mit vielen kleinen Ideen zur Vergeblichkeit.“ Das half uns beim Verstehen ihrer Arbeit.
Der nächste schon im Umbau halb demolierte Raum war mit Texten der ersten deutschen Naturschutzgesetze 1933/34/35 tapeziert. Es wurde dort ferner ein Film über einen asiatischen Obst- und Gemüsemarkt gezeigt. Nebenan standen zwei Vitrinen mit Beispielen aus dem riesigen Herbarium des Museums, das einst Adelbert von Chamisso betreut hatte, dazu mehrere Beispiele einer „postindustriellen Botanik“: Pflanzen aus einem uranverseuchten Gebiet (der Bergbaufolgelandschaft der Wismut im Erzgebirge).
Am Ausgang befand sich eine Installation des Museums selbst: Sechs Vitrinen, die mit Objekten, Porträts und Texten zeigen sollten, „inwieweit die Modernisten die Wissenschaft, Biologie, beeinflußt haben“. U.a. handelte es sich dabei um den Gründer des Botanischen Gartens, Adolf Engler, den Gründer der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise Rudolf Steiner und den Begründer des deutschen und europäischen Naturschutzes Hugo Conwentz. Mit dem Botanischen Museum und Garten will man eine „Brücke herstellen zwischen Mensch und Pflanze“ – und das „ohne eine eigene App“, man wolle kein Science-Center sein und setze – als „Sehschulung der Botaniker“ – weiter auf „Botanische Modelle“, wiewohl die letzte Modellbauerin des Museums vor einigen Jahren in Rente gegangen sei.
Die nächste Ausstellungsstation, in den Hallen der NGBK, nannte sich „Archäologien der Nachhaltigkeit“ und erinnerte mit Dokumenten und Exponaten an alternatives Wohnen und Wirtschaften in den Zwanzigerjahren – mit Konzepten für die Abfallwirtschaft wie die des Biosophen Ernst Fuhrmann („Der Mensch und die Fäkalie“), an die Lebensreform-Projekte und die Selbstversorgungs-Ideen des Landschaftsarchitekten Leberecht Migge („Freiheit unter dem Humusgesetz“), dessen „Zeltlaube“ wir als Nachbau bereits im Museum sahen. Wichtig war den Ausstellungsmachern auch die Forschung des Ehepaars Francé-Harrar über die humusbildenden Mikroorganismen im Boden. Annie Francé-Harrar argumentierte schon in den Fünfzigerjahren gegen die Waldvernutzung.
Ausgehend von diesen Pionieren zeigte die Ausstellung eine Kontinuität bis zu den vielfältigen Stadtumbauprojekten unter ökologischem Vorzeichen in den Achtzigerjahren, zu dem bereits ein „Artenschutzprogramm“ für Westberlin gehörte. Alles „Fragmente einer Geschichte der Nachhaltigkeit“ – mehr oder weniger der Forderung Kropotkins zur „Eroberung des Brotes“ verpflichtet.
Dazu vier DDR-Naturfilme und einer über Möven auf der Vogelschutzinsel Mellum, das Porträt eines „Ornithologen der Arbeiterbewegung“, einige Erinnerungen an Joseph Beuys und ein filmisches Interview mit Gilles Clément. Auf Deutsch kennt man u.a. seine „Fröhliche Wissenschaft“ eines Entomologen und Gärtners (was für den Insektenforscher Jean-Henri Fabre noch zwei gegensätzliche Bestrebungen waren).
Auf ging es in den Prinzessinnengarten, wo man uns an eine große Tafel bat und mit üppigem Essen aus eigenem Anbau bewirtete, während der Gartengründer Marco Clausen und die dänische Kartoffelforscherin Asa Sonjasdotter uns das Konzept ihres ökologischen „Nachbarschafts-Gartens mit -Akademie“ erklärten, wobei ihre Gedanken bis hin zu einer zukünftigen „Ernährung und Landwirtschaft in der Bioregion Berlin-Brandenburg“ schweiften. Dazu finden bis zum Gartensaisonende am 18.September Workshops, Spaziergänge, Diskussionen und Filmabende statt. Das Ganze unter der Überschrift „Aus den Ruinen der Moderne wachsen“, was auf den Prinzessinnengarten konkret zutrifft, denn er blüht und gedeiht auf den Fundamentresten des erst enteigneten und dann zerbombten Wertheim-Kaufhauses.
(Ich habe hier nur einen kleinen Teil der ausgestellten Arbeiten, Dokumente und Objekte erwähnt und den hervorragenden 420seitigen NGBK-Katalog leider so gut wie gar nicht.)
.
Boden und Scheiße:
Lange Zeit galten die Mikroben vor allem als Krankheitserreger. „Keime“ waren auf jeden Fall Schmutz. Jetzt gesteht man ihnen sogar die Fähigkeit zum “quorum sensing” zu: einen Sinn, mittels dessen sie untereinander Beschlußfähigkeit herstellen (eine Art „Vollversammlung“). Ihre Umwertung verdanken sie u.a. den sowjetischen Bodenforschern, beginnend mit Sergej N. Winogradsky sowie dem ungarischen Humusforscher Raoul Heinrich Francé und seinen „Untersuchungen zur Oekologie der bodenbewohnenden Mikroorganismen“ (1913) sowie zum „Leben im Ackerboden“ (1922). Als er 1943 starb, führte seine Frau, die Biologin Annie Francé-Harrar, seine Forschung weiter. Neben einem „Handbuch des Bodenlebens“ veröffentlichte sie 1950 „Die letzte Chance – für eine Zukunft ohne Not“, beide Bücher wurden 2011 von der „Gesellschaft für Boden, Technik, Qualität“ (BTQ) neu herausgegeben.
„Die letzte Chance“, damit meint die Autorin: Wenn wir nicht schleunigst den Wald retten und die Humusschicht auf unseren Böden verbessern, dann ist es um das Leben auf der Erde geschehen: „Wir, unsere ganze Generation, stehen vor einem Abgrund, denn Humus war und ist nicht nur der Urernährer der ganzen Welt, sondern auch der alles Irdische umfassende Lebensraum, auf den alles Lebende angewiesen ist.“ Um den Humus zu erhalten, müssen wir die Mikroorganismen im Boden, die ihn schaffen und von denen die Pflanzen abhängen, von denen wiederum wir abhängen, studieren und kennen, um sie bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen und nicht – wie jetzt noch – permanent behindern: „Seit Jahrhunderten haben wir unsere Böden kaputt gemacht.“
Sodann meldete sich 1991 der Biophysiker James Lovelock mit einer „Gaia“-Theorie zu Wort, nach der „die Erde ein Lebewesen ist“. Um sie zu erhalten, und vor allem den Kohlendioxid- und Methananteil der Luft nicht weiter ansteigen zu lassen (wegen der Klimaerwärmung), „sollten wir die drei tödlichen Dinge für unseren Planeten immer im Kopf behalten: Autos, Rinder und Motorsägen.“ Nachdem der Autor sich mit der Mikrobiologin Lynn Margulis zusammengetan hatte, bekam seine chemisch-physikalische Erdentwicklungstheorie ebenfalls eine bakterielle Basis, d.h. die Mikroorganismen wurden für ihn das Alpha und Omega irdischer Lebensbedingungen. Wir können laut Lovelock nicht die Erde „managen“, aber vielleicht so etwas wie ihre „gewerkschaftliche Vertrauensperson“ sein, die „die Bakterien, die Pilze, die Fische, Vögel und Säugetiere, die höheren und niederen Pflanzen auf dem Festland und im Wasser vertritt.“
Die „Humus“- Forscherin ebenso wie der „Gaia“-Theoretiker wendeten sich an die Wissenschaft und die Politik. Es gibt noch einen weiteren Mahner: den japanischen Gartenbauprofessor Teruo Higa. Er verkauft seine „Effektiven Mikroorganismen“ (in handlichen EM-Kanistern) direkt an die Praktiker (Bauern, Gärtner, Imker usw.) und schuf damit eine ganze internationale Bewegung – mit Zeitungen, Stammtischen, Kongressen etc.. Auch er geht wie die anderen beiden davon aus, dass sich unsere Böden inzwischen „im Endstadium äußerster Minderwertigkeit“ befinden und unser „Planet krank und dahinsiechend“ ist, wie er in seinem Buch „Eine Revolution zur Rettung der Erde“ (2009) schreibt. Die Rettung besteht darin, bei den Mikroorganismen „die Kräfte der Regeneration“ und der „Degeneration“ zu unterscheiden, um sodann erstere zu unterstützen… Das hört sich allerdings einfacher an als es ist.
Allein in Deutschland gehen in der Landwirtschaft im Durchschnitt pro Jahr und Hektar zehn Tonnen fruchtbarer Boden durch Erosion und Humusabbau verloren. Dem gegenüber steht ein jährlicher natürlicher Bodenzuwachs von nur etwa einer halben Tonne pro Hektar. Der Boden wird also rund 20-mal schneller zerstört, als er nachwächst, warnt die Naturschutzorganisation WWF zum Start des internationalen UN-„Jahr der Böden 2015“. Insgesamt gehen der deutschen Landwirtschaft damit 120 Millionen Tonnen fruchtbarer Boden pro Jahr verloren. Weltweit sind es mehr als 24 Milliarden Tonnen, die jährlich durch Erosion verschwinden. Nur zwölf Prozent der Erdoberfläche bestehen aus landwirtschaftlich nutzbarem Boden – und dieser wird immer weniger, während die Weltbevölkerung wächst. Derzeit stehen theoretisch für jeden Menschen noch 2000 Quadratmeter zur Verfügung. Am Rande von Berlin startete im Frühjahr 2015 ein Projekt, das zeigen will, wie man sich damit übers Jahr ernähren kann.
Mancher Biobauer meint, Kuhdung statt Kunstdünger wäre schon Bio – der kurze Weg vom Dung zum Erhabenen („de fimo ad excelsa“ – wie der Naturforscher Jean-Henri Fabre zu sagen beliebte). Zur „Humifizierung“ biologischer Abfälle gehört jedoch weitaus mehr, schreibt der Bodenforscher Siegfried Lübke im Vorwort zu Annie Francé-Harrars „Handbuch des Bodenlebens“ (2011), und erwähnt dabei sein Entsetzen, „als 2003 eine Praktikantin berichtete, wie sie von dem Bodenleben ihrem landwirtschaftlichen Lehrer erzählte. Daraufhin schnauzte der sie an: ‚Was? Bakterien, was haben denn die im Boden zu tun?’“
Während die Mikrobiologin Annie Francé-Harrar die Ursache des zunehmenden Humusverlustes vor allem im Rückgang der Wälder und der damit zusammenhängenden Bodenerosion sah, hält die Tierärztin Anita Idel die Reduzierung von Weideland und damit die Zerstörung der Verbindung (der „Ko-Evolution“) von Gras und Grasfresser für die Ursache. Die Erhaltung der Graslandschaften – Steppen, Savannen, Prärien, Tundren und Pampas – durch nachhaltige Beweidung erhalte deren noch weltweit größte CO2-Speicherkapazität und trage wesentlich zur Humusbildung bei. Deswegen würde Anita Idel wohl eine Rückkehr zur Viehzucht mit Wanderhirten als optimal für das Grasland halten (wovon auch einige westafrikanische Regierungen inzwischen überzeugt sind), während Annie Francé-Harrar die Wiederaufforstung vieler für die Landwirtschaft gerodeter Flächen forderte. Erstere erforscht die Humusbildung quasi von oben – über die Kuh, letztere gelangte von unten über die Untersuchung der Bodenorganismen zur „Humuskatastrophe“.
Es gibt dazu eine Studie – mittlerweile ein Klassiker: Der Leiter der Abteilung für Bodenbearbeitung im US-Landwirtschaftsministerium, Franklin H. King, bereiste 1909 mit einem Team von Mitarbeitern China, Korea und Japan, sein begeisterter Bericht darüber: „4000 Jahre Landbau“ erschien 1911 (auf Deutsch wurde er zuletzt 1984 veröffentlicht). Der Autor kommt darin zu der Überzeugung, dass die amerikanische Landwirtschaft unbedingt von der in China, Korea und Japan lernen muß. „In Amerika verbrennen wir ungeheure Mengen Stroh und Maisstrünke: weg damit! Kein Gedanke daran, dass damit wertvolle Pflanzennährstoffe in alle Winde zerstreut werden. Leichtsinnige Verschwendung bei uns, dagegen Fleiß und Bedächtigkeit, ja fast Ehrfurcht dort beim Sparen und Bewahren.“ Noch mehr gilt das für den Umgang mit Fäkalien. Er wird auf Schiffen zusammen mit Schlamm aus Kanälen transportiert, an Land gelagert, dann in Gruben an den Äckern geschüttet, wobei man dazwischen Lagen mit geschnittenem Klee packt und „das Ganze immer wieder mit Kanalwasser ansättigt. Dies läßt man nun 20 oder 30 Tage fermentieren, dann wird das mit Schlamm vergorene Material über den Acker verteilt.“ Die US-Agrarforscher halten die „landbaulichen Verfahren“ der Chinesen, Koreaner und Japaner, mit denen sie „jahrhundertelang, praktisch lückenlos, alle Abfälle gesammelt und in bewundernswerter Art zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und Erzeugung von Nahrungsmitteln verwertet haben, für die bedeutendste Leistung der drei Kulturvölker.“ Wenn man sie studieren will, „dann muß man auf das achten, was uns die Hauptsache zu sein scheint, dass nämlich unter den Bauern, die die dortigen dichten Bevölkerungen jetzt ernähren und früher ernährt haben, richtiges, klares und hartes Denken Brauch ist.“
.

.
Eine Meldung auf „pflanzenforschung.de“ 2010: „Aufgrund des übermäßigen Einsatzes von Stickstoffdünger werden Chinas landwirtschaftliche Flächen immer saurer und bringen immer weniger Ertrag. Laut Experten könnte das in Zukunft die Lebensmittelproduktion Chinas gefährden.“ Greenpeace erklärte dazu: „Das Land hat seine Landwirtschaft mit großem Aufwand industrialisiert und mittlerweile einen Anteil von 34 Prozent am weltweiten Bedarf für Phosphor-Düngemittel. Die meisten werden im Land selber produziert.“ Die chinesische Landwirtschaft verbraucht heute 36,7 Millionen Tonnen jährlich. Flankierend dazu eine Wirtschaftsmeldung von 2013: „Schlechte Nachrichten für die Kali+Salz AG. China steigt beim russischen Düngemittelriesen Uralkali ein und schürt damit neue Spekulationen über die Machtverteilung in der Branche. Da die Volksrepublik zu den größten Konsumenten von Kali-Düngern gehört, wird es aus Sicht von Experten wahrscheinlicher, dass Uralkali die Preise wie angekündigt drückt und dies durch größere Verkaufsmengen wettmacht – unter anderem in China.“
Eine weitere Meldung aus China – auf „netzwelt.de“ – führt vom Kali zurück zur Kuh: „Huishan Dairy, ein chinesischer Milchhof, hat die weltweit größte Anlage installiert, mit dem Strom durch Methangase aus Kuhmist hergestellt wird. Darüber hinaus ist das System auch gut für die Umwelt. Die Anlage von Huishan ist etwa zehnmal so groß wie ein normalerweise übliches System das zur Strom-Gewinnung aus Kuhmist eingesetzt wird. Der Dung von 60.000 Kühen wird in Huishan verwendet und stammt von 20 Höfen in der Nähe von Shenyang. Dadurch können 5,6 Megawatt an Strom erzeugt werden.“
Es scheint, dass die chinesische Landwirtschaft spätestens seit Deng Xiaopings Privatisierungsparole „Bereichert Euch!“ (1983) kein Vorbild mehr für Amerika ist, sondern umgekehrt. Ein Machtwort von Mao tse Tung lautete einst: „Mist ist wichtiger als Dogmen!“ Das bezog sich auf die Düngung der Felder. Vor der Revolution mußten Landarbeiter sich verpflichten, die Toilette des Gutsbesitzers zu benutzen. An den Straßen standen Töpfe. Sie wurden regelmäßig geleert. Fäkalien waren ein Handelsgut, man konnte sie portionsweise auf dem Markt kaufen. Unternehmer zahlten viel Geld, um die Fäkalien ganzer Städte einzusammeln und an die Bauern zu verkaufen. Man weiß dort, da jede Pflanze Humus verbraucht, muß vor allem in der Landwirtschaft der Humus immer wieder ersetzt werden.
(Peter Berz legt mir dazu immer wieder Bruno Latours „Terrestrisches Manifest“ ans Herz.)
.

Die Karstadtverkäuferin Emily Meier im Urlaub
.
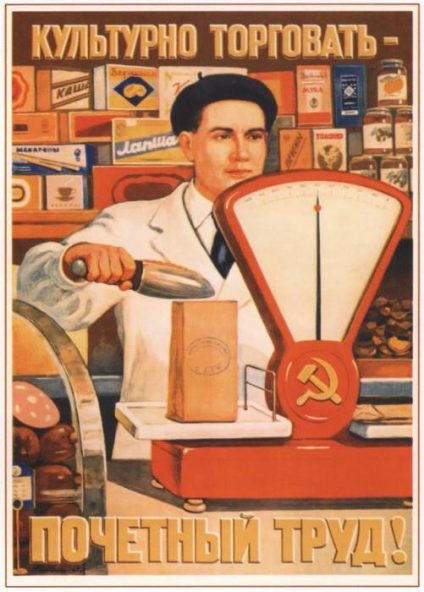
Kampf für Motivation am Arbeitsplatz (1)
.

Kampf für Motivation am Arbeitsplatz (2)
.

Erwischt!
.
Hoch- und Runterwirtschaften
Die mit Gen-Mutationen und Selektion argumentierende „Evolution“, also die Entwicklung vom „Urschleim“ bis den heute lebenden Tier- und Pflanzenarten, ist inzwischen eher ärgerlich als hilfreich. Anders die „Geschichte“ – die der Menschen, die den damit befaßten, Historikern, Archäologen, Anthropologen etc., immer wieder neu zu denken gibt. „Unsere Geschichte“ fängt ziemlich lustig an – mit den Frauen. Die englische Anthropologin Elaine Morganschreibt in ihrem Buch „The Aquatic Ape“ (1982), dass es die Frauen waren, die einst, nach Verlassen der Bäume, erstmalig Schutz vor ihren Feinden im Wasser gesucht hätten. Dort lernten sie den aufrechten Gang, die Schmackhaftigkeit der Meeresfrüchte, bekamen eine glatte, unbehaarte Haut, veränderten sogar ihre weibliche Anatomie und wurden intelligent und verspielt. So wie im übrigen alle Säugetiere, die wieder zurück ins Wasser gingen: Delphine, Wale, Seekühe, Robben, Otter… Während die Menschenmänner dagegen quasi auf dem Trockenen hocken blieben – und jede Menge Jäger-Idiotismen ausbildeten. Elaine Morgans feministische Studie endet versöhnlich: „Wir brauchen weiter nichts zu tun, als liebevoll die Arme auszubreiten und ihnen zu sagen: ‚Kommt nur herein! Das Wasser ist herrlich!’“ – Und die Meerestiere sind auch nicht zu verachten.
In Japan und Korea, wo man sie besonders gerne ißt, gibt es noch heute Muscheltaucherinnen. Sie sind dort wegen ihrer Tauchkunst hochangesehen, trotzdem werden es immer weniger. Über die koreanischen Muscheltaucherinnen – Haenyeos – findet man auf Youtube fast 2000 Clips, u.a. eine vierteilige Über- und Unterwasser-Dokumentation von Melissa Struben: „Haenjeo – Koreas Meerjungfrauen“. Auf der südkoreanischen Insel Jejudo haben sie quasi ein Matriachat geschaffen. Die Männer, die meist zur See fahren, sind dort nur Besucher; auch wenn sie Väter sind, werden sie Onkel genannt. Laut Wikipedia haben die Haenjeos ein erweitertes Lungenvolumen und wie Wedellrobben nutzen sie die Milz als Sauerstoffreservoir. Beim Tauchen zieht sich das Organ zusammen, wodurch sauerstoffreiche rote Blutkörperchen in den Kreislauf gelangen und einen längeren Tauchgang ermöglichen. Hier kippt die Geschichte in Evolution um. Aber so ründet sich die Erzählung von den ersten Frauen, die ins Wasser gingen und dort auch ihre Kinder bekamen, bis zu diesen letzten Muscheltaucherinnen und ihrer sukzessiv veränderten Anatomie. Im Wasser geborene Kinder können schon vom ersten Augenblick an schwimmen. In Oldenburg, der „Stadt der Spaßbäder“, bietet eine Klinik Unterwassergeburten an.
Die aquatischen Anfänge des aufrechten Gangs spielten sich in einer „Jäger- und Sammlergesellschaft“ ab, bestehend aus kleinen nomadischen Gruppen/Horden. Noch heute gilt in den kleinen Völkern der arktischen Länder dass der Mann jagt bzw. angelt und die Frau Beeren, Vogeleier etc. sammelt, und daneben die Beute verarbeitet. Infolge der strengen Artenschutzgesetze sind die immer noch zu Jägern erzogenen und nun quasi arbeitslose gewordenen jungen Männer auf Grönland in eine schwere Identitätskrise geraten. Die auf Spitzbergen lebende Leiterin nordischer Expeditionen Birgit Lutz hat über sie ein Buch geschrieben: „Heute gehen wir Wale fangen“ (2017). Die umgekehrte Situation, aber mit ähnlichen Auswirkungen auf die Männer, hat sich mit der Auflösung der Sowjetunion in Nordost-Sibirien ergeben, dass alle Sibirien-Privilegien und der größte Teil der Infrastruktur buchstäblich wegfielen. Die Hamburger Programmiererin Karin Haß, die dort seit 2003 mit einem nenzischen „Taigajäger“ verheiratet ist, hat darüber in mehreren Büchern über ihre „Fremde Heimat Sibirien“ berichtet. Ebenso auch der russische Autor Wassili Golowanow, der zwar nur ein Jahr auf der Insel Kolgujew in der Barentssee verbrachte, aber 2012 ein sehr schönes und dickes Buch darüber veröffentlicht hat: „Die Insel“.
Wie ging es weiter? Gewöhnlich folgt auf diese der Natur ausgesetzte bzw. sie ausnutzende oder mit ihr verbundene Nomadenexistenz der Fortschritt im Hinblick auf Seßhaftigkeit, darauf folgen Stadtgründungen, Staatsbildungen, Arbeitsteilung, Abgaben/Steuern.
Noch der Präsident der USA Theodore Roosevelt nannte den Kampf der eingewanderten Seßhaften gegen die Indianer einen gerechten Krieg – mit der Begründung: „Dieser großartige Kontinent konnte nicht einfach als Jagdgebiet für elende Wilde erhalten werden“
Die Archäologen sind sich laut FAZ inzwischen sicher, dass die „sesshafte Lebensweise“ kein Honigschlecken war, „auch kein eindeutiger Fortschritt“ – das Domestizieren und Züchten von Tieren und Pflanzen brauchte lange, es gab Epidemien, Hunger, Kriege, Rückschritte. Der sowjetische Schriftsteller Andrej Platonow hat das 1933 am Beispiel eines kleinen Wüstenvolks in „Dshan oder Die erste sozialistische Tragödie“ erzählt.
Der US-Politologe James C. Scott veröffentlichte kürzlich eine „Tiefengeschichte“ der Staatenentstehung: „Die Mühlen der Zivilisation“. Darin begreift er die Zusammenbrüche von Seßhaften-Gemeinschaften nicht (mehr) als ein Scheitern, sondern als eine Befreiung – nicht von Planwirtschaft, sondern von „Palastwirtschaft“.
.
Plüschtiere
„Spielzeug wird im Himmel gemacht, aber die Batterien in der Hölle.“ (Tom Robbins)
„Zoo Moskau“ heißt eine Ausstellung im „me Collectors Room“ in Berlin Mitte. Die Kuratoren Sebastian Köpcke und Volker Weinhold zeigen dort zusammen mit der Restauratorin und Pädagogin am Museum der Kindheit in Leningrad, Daria Soboleva 400 sowjetische Spielzeugtiere aus Zelluloid und Polyethylen, die zwischen 1950 und 1980 hergestellt wurden – von Absolventen der Leningrader Kunsthochschule: „Sie wagten ab Mitte der 1950er Jahre den Aufbruch in die Moderne. In der sowjetischen Spielzeugindustrie boten sich gestalterische Freiräume, um Neues auszuprobieren und eine eigene Formsprache zu entwickeln, in der Zeitgeist und ein neues Lebensgefühl ihren selbstbewussten Ausdruck fanden. Viele ihrer bunten Spielfiguren sind große Kunst für kleine Kinder.“
Mir, der ich mit Plüschtieren von Steiff (mit Knopf im Ohr) groß geworden bin, sind diese sowjetischen Spielzeugtiere viel zu modernistisch und überhaupt nicht geeignet, sie Abends mit ins Bett zu nehmen. Sie haben zu wenig Realismus, um sich mit ihnen vorm Einschlafen oder bei Kummer auszusprechen – und das ausgerechnet im Land des sozialistischen Realismus. Aber diese einstigen Proletarierverherrlicher wollten wahrscheinlich gar nicht, dass man mit Tieren, realen oder künstlichen, redete, geschweige denn sich mit ihnen solidarisierte.
Nun hadern aber einige Naturwissenschaftler auch im kapitalistischen Realismus mit den hiesigen Kuscheltieren. In der renommierten Online-Zeitschrift „plos biology“ veröffentlichte eine Gruppe französischer Biologen eine Studie mit dem alarmistischen Titel: „Das paradoxe Aussterben der charimatischsten Tiere.“ Diese Großtiere hatten sie mit einer Umfrage ermittelt: Danach standen die Tiger und die Löwen an erster Stelle, gefolgt von Elefanten, Giraffen, Leoparden, Pandas, Geparden, Eisbären, Wölfen und Gorillas. „Abgesehen vom Wolf gelten sie alle in unterschiedlichem Ausmaß als bedroht,“ erklärte dazu die Süddeutsche Zeitung.
Die von den Wissenschaftlern der Universität Paris-Sud Befragten begegneten täglich mindestens vier Darstellungen von Löwen auf ihren Wegen. „Und die Zahl der im Jahr 2010 in Frankreich verkauften Spielgiraffe ‚Sophie‘ war mehr als acht Mal so hoch wie die der in Afrika lebenden Giraffen.“ Die „Omnipräsenz dieser Tiere in Büchern, Filmen, Spielzeugläden und in der Werbung“ stehe in „starkem Kontrast zur Anzahl ihrer tatsächlich noch lebenden Vertreter.“
Die Biologen befürchten, dass diese überbordende Masse an Dingen und Bildern von bestimmten Tieren die abnehmende Zahl dieser lebenden Tiere, ihr akutes Gefährdetsein, in den Hintergrund drängt. Sie fordern deswegen von den Herstellern dieser Dinge und Bilder eine Abgabe, „eine Art Lizenzgebühr“, die dem Schutz dieser Tierarten zugute kommen soll.
Hier und da geschieht das bereits, ohne Umweg über Staat und Gesetz, indem z.B. Verlag und Autor eines Tierbuches verkünden, dass der Gewinn aus dem Verkauf für den Schutz der jeweiligen Art eingesetzt werden soll.
Im übrigen waren mir als Kind Spieltiere und lebende Tiere gleich lieb, sie schaukelten sich gleichsam gegenseitig hoch in meinem Gefühlsleben – bis ich den „Kleinen Tierfreund“ abonnierte und überhaupt mehr über die einen wie die anderen Tiere wissen wollte.
Anders als von den französischen Biologen dargestellt gibt es auch eine massenhafte Hinwendung zu den lebenden charismatischen Tieren, dieses Interesse ist allerdings Moden unterworfen. So gerieten z.B. der „New Age“-Bewegung die Delphine zu Totemtiere, die dann auch entsprechend studiert wurden. Ja, man versuchte sogar ihre Sprache zu entschlüsseln, um sich mit ihnen unterhalten zu können. Danach führte die Walbeobachtung, u.a. in den Gewässern um Vancouver, die 1980 mit einem einzigen Boot von zwei Naturschützern begonnen hatte, dazu, dass sie sich in den Neunzigerjahren zu einer „Industrie mit Dutzenden von Schiffen aller Größen und Formen“ entwickelte, so dass ihr Motorlärm langsam für die Wale unerträglich wurde. In Kanada wurden daraufhin „Walbeobachtungs-Gesetze“ erlassen. Man sollte sich darüber klar sein, schreibt die Schwertwalforscherin Alexandra Morton (in: „Die Sinfonie der Wale“ 2002), „dass selbst ‚Zuschauen‘ allzuoft gerade für das Geschöpf, das zu sehen wir gekommen sind, eine unwiderrufliche Veränderung bewirken kann.“ Aber wie sie auch weiß, „besteht heute die größte Hoffnung für jede Spezies auf Erden darin, dass irgendeine Gruppe von Menschen sie liebt.“
Deren Interesse an einem Tier bewirkt, wenn es andere Menschen begeistert, eine wachsende Nachfrage nach authentischen Zeugnissen von dieser Tierart. Besonders Tierfilme und Tiersendungen im Fernsehen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, diese spezielle Bilderflut wird inzwischen auch bereits wissenschaftlich erforscht.
Nach dem Animationsfilm „Findet Nemo“ über einen kleinen Clownfisch wollten derart viele Aquariumsbesitzer weltweit einen besitzen, dass die Fischer am Korallenmeer ihn fast zum Aussterben gebracht hätten. Derzeit scheinen in den USA neben Katzen auch Eulen, Waschbären und Eichhörnchen zu den charismatischen Tieren der Amerikaner zu gehören, die man sich als „Pets“ ins Haus holt.
Der Tierfilmer Horst Stern gab einmal in einem Interview zu bedenken: „Wie ich denn überhaupt sagen muß, dass nicht selten passionierte Tierfreunde, insbesondere Tierfotografen, mehr Schaden in der Tierwelt anrichten als dass ihre Beobachtungen und Bilder ihr nützen.“
Wenn sie vorsichtiger vorgehen, ist es oft auch nicht recht. Der für seine Tierdokumentationen geadelte Regisseur David Attenborough verursachte einen kleinen „Skandal“, als herauskam, dass er die im Zoo gefilmte Geburt eines Eisbären in eine Sendung eingebaut hatte, die Eisbären in der arktischen Wildnis zeigte. Der des Betrugs Bezichtigte verteidigte jedoch nicht nur seine Täuschung, sondern gab gleich noch weitere zu. Die Tierfilmproduzenten sprangen ihm bei: Seine „Eisbären-Methode“ entspreche den „Redaktionsanforderungen“, sie sei „Standard“ bei der Produktion von „Natural History Programmen“. Daraufhin beruhigte die Öffentlichkeit sich wieder.
Ärgerlicher ist sowieso eher die wachsende Zahl von Tierdarstellungen und Tiertiteln auf Büchern, weil meist weder das eine noch das andere Tier darin vorkommen oder wenn, dann nur kurz und lieblos, weil es den Autoren darin doch wieder nur um sexuell konnotiertes Menscheln geht, wenn man so sagen darf. Auch dass plötzlich – z.B. auf der Kölner Kunstmesse im vergangenen Jahr – lauter Tierbilder und -plastiken ausgestellt wurden, gibt zu denken auf – insofern es den meisten Künstlern dabei nur wie den Buchumschlaggestaltern und Autoren um das Bedienen eines Trends ging (was selten ist, wird kostbar), zudem darf man sich heute kein Fell eines vom Aussterben bedrohten Schneeleoparden mehr an die Wand nageln, wenn man in den Augen seiner Mitmenschen nicht als ein Riesenarschloch dastehen will, aber mit einem Schneeleoparden in Öl auf Leinwand von Vroni Graf an der Wohnzimmerwand kann man schon noch Bewunderung einheimsen (allein das „kunstnet.de“ offeriert 84 Schneeleoparden-Bilder – Preise auf Anfrage).
Die französischen Biologen wollen zunächst die großen Firmen um „conservation intensification“ angehen, die ein Tier in ihrem Logo haben, (wie z.B. die Lufthansa einen Kranich und Shell eine Jacobsmuschel). Als Naturschützer mahnen sie am Ende ihres Artikels zur Eile – bevor es zu spät ist. Der Philosoph Hans Blumenberg, der Texte und Bilder von Löwen sammelte (sie wurden 2010 veröffentlicht) meinte dagegen: „Auch ohne naturschützerische Gebärde muß gesagt werden, dass eine Welt ohne lebende Löwen trostlos wäre.“
(Die Galerie „me Collectors Room“ wurde 2010 vom Erben des Haarpflegeprodukteherstellers Wella gegründet, nachdem er sein Unternehmen an den US-Kosmetikkonzern Coty Inc. verkauft hatte. Deswegen ihr amerikanischer Name.)
.
Pandaspiele
Der Medien- und Besucherrummel um die zwei Pandas im Westberliner Zoo ist peinlich und peinigend. Und das nicht erst seit der neue Direktor den alten Pandaglaskäfig abreißen und für 250.000 Euro eine ganze „Panda-Landschaft“ bauen ließ, um sodann für eine Million Euro jährlich das Pärchen „Meng-Meng und „Jiao Quing“ zu leasen. Dazu gehört auch ihr möglicher Nachwuchs, von dessen gedeihlicher Entwicklung im Mutterleib die Zootierärzte sich nun quasi täglich überzeugen. Ich weiß nicht, ob das im Leasingvertrag steht, aber es wurde jetzt auch noch eine „Expertin für Hormonanalysen“, Pairi Daiza, hinzugezogen, die bereits die Geburt von Pandazwillingen in Belgien begleitet hatte, ferner ein „Fortpflanzungsexperte aus Chengdu“. Schon bei der Befruchtung von „Meng-Meng“ hatte man einen enormen Aufwand getrieben: Zwar besprang „Jiao Quing“ sie mehrmals und auch artgerecht, aber Dr. Thomas Hildebrandt, „Spezialist für Reproduktionsmanagement am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung“, dem einstigen „Think-Tank“ des Ostberliner Tierparks, ließ das Weibchen überdies auch noch künstlich besamen (Besame mucho).
Ach, das ist alles so widerlich und nicht erst seit dieser Woche, in der Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller erklärte, „das schlagende Herz des Panda-Embryos auf dem Ultraschall“ sei „ein gutes Zeichen“.
Als Bundeskanzler Helmut Schmidt 1980 im Rahmen der chinesischen „Panda-Diplomatie“ eine Pandabärin, „Tjen-Tjen“, bekam, die er dem Westberliner Zoo übergab, intervenierte Moskau, „weil Westberlin nicht Teil der BRD war“. Die Bärin starb 1984 und wurde ausgestopft. Dem Ostberliner Tierpark hatte Moskau zuvor kostenlos einen Pandabären geliehen, der dann durch westeuropäische Zoos tourte. Der Tierparkdirektor Heinrich Dathe machte hemmungslos Werbung mit dem armen Reisepanda: Eine junge passionierte Tierfreundin, die von einer unheilbaren Krankheit befallen war, bat ihn, vor ihrem Tod den Panda sehen zu dürfen: „Wir transportierten ‚Chi-Chi‘ daraufhin in einer Kiste und trugen ihn die vier Treppen eines Wohnhauses hoch. Im Krankenzimmer ließen wir ihn frei. Die geistig noch rege Frau war glücklich. Wir legten ihre Hand auf das Fell des kostbaren Tieres [12.000 Pfund!], das sich nicht manierlicher hätte benehmen können,“ erzählte er der Hauptstadtpresse. In den Westzoo kamen als nächstes „Bao-Bao“ und „Yan-Yan“. Sie lebten nicht lange – und wurden dann vom Chefpräparator des Naturkundemuseums Detlef Matzke ausgestopft: „Wenn die Luftfeuchtigkeit stimmt und die Vitrine dicht ist, dann können die beiden locker mehrere hundert Jahre alt werden,“ erklärte er der Presse.
.
Petplayer
Das sind Leute, die sich als Haustiere verkleiden. So etwas lappt außerhalb der Karnevals- und Kostümpartys in die SM-Scene und in die Aktionskunst. Jene tragen z.B. teure Hunde- oder Pferdemasken aus Latex- oder Leder, und diese lassen sich z.B. nackt an der Leine herumführen, berühmt dafür ist der russische Künstler Oleg Kulik und die Greifswalder Künstlerin Pauline Popp, er als Jund und sie als Ratte.
Petplayer treten in internationalen Galerien auf oder sie treffen sich als Fetischgruppe in ländlichen Clubs. Die „Welt“ hat herausgefunden: „Von den Beteiligten wird allein schon die strenge Hierarchie zwischen den selbst ernannten Pets und ihren Haltern als erotisch empfunden – sowohl von denen, die Befehle erteilen, als auch von jenen, die sie ausführen.“ Die meisten Teilnehmer sind Männer – entweder „Herrchen“ oder „Dogplayer“, von den letzteren sind einige nackt „mit einem Requisit, das wie ein Hundeschwanz aussieht. Mittels eines Plugs – einer Art Pfropfen – ist er im Anus befestigt“. Sie essen nicht am Tisch, sondern vom Boden: „Schlabbernd machen sich ein Softwareentwickler, ein Möbeltischler und ein Rechtsanwalt über das Putengeschnetzelte in ihren Näpfen her.“ Von den Petplayern lassen sich die Zoomimiker unterscheiden: erstere werden gedemütigt, letztere geschätzt.
Zoomimiker treffen sich u.a. auf „Furry Conventions“: mit Masken und Kostümen von allen möglichen Tieren. Man glaubt es kaum, aber auf dem „Furry Convention Calendar 2019“ sind 64 solcher Treffen weltweit aufgeführt – von Indonesien, Neuseeland und Taiwan über Madrid und Mexiko bis nach Schweden, die Ukraine und vor allem natürlich die USA. In Deutschland finden sie heuer in Reutlingen und Suhl statt, 2018 fand ein großes Treffen im Berliner Hotel Estrel statt, wo regelmäßig auch „Look Alike Contests“ veranstaltet werden: Wettbewerbe von Leuten, die so aussehen und auch so singen wie z.B. Elvis Presley oder Heino. Die „Furrys“ sehen z.B. so aus wie ein Wolf oder eine große Katze, beide Verkleidungen werden gerne von Frauen gewählt. Bei Amazon und Ebay und in zig Online-Shops kann man sich diesbezüglich ausstatten. Männer nehmen gerne eine Tigermaske und Pranken aus Stoff und tragen dazu Schlips und Anzug. Sie haben wahrscheinlich alle „Die Tiger-Strategie“ von „Deutschlands führendem Zeitmanagement-Experten“ Lothar Seiwert gelesen, sein Buch handelt davon: „Wer für seine Erfolge nicht selber sorgt, hat sie nicht verdient“. Seiwert sieht zwar im Vergleich zu Tigern grottenhässlich aus, aber dafür kann er seine „Erfolgsstrategie“ bestimmt überzeugend „rüberbringen“. Ansonsten gibt es auch noch das Hörbuch „Der Weg des Tigers: Erkenne und nutze deine innere Kraft“ vom Wiener Vortragsredner Bernhard Moestl, der ebenfalls ziemlich Scheiße aussieht, unddas Buch „Führen mit der T.I.G.E.R.-Methode“ des Schweizer „Leadership Partners“ und Motorsportlers Martin Buerki.
Die Chinesen haben es eher mit dem Wolf: In dem absoluten Ratgeber-Bestseller „Der Zorn der Wölfe“ von Jiang Rong geht es darum, dass die Chinesen alle dumme Schafe sind, jetzt im Neoliberalismus unter kommunistischer Führung sollen und müssen sie aber alle zu Wölfen werden. Heraus kommen dabei wahrscheinlich lauter „Problemwölfe“. Die amerikanisch verblödeten, wie die Yale-Professorin Amy Chua, bleiben jedoch beim Tiger: Sie schrieb den Erziehungs-Bestseller „Tiger Mom“, in dem sie z.B. rät, wenn die Kinder nicht spuren, Druck auszuüben – und ihnen u.a. damit drohen, ihre Kuscheltiere zu verbrennen. Das Gegenteil ist der Erziehungsbestseller der Amerikanerin Esther Wojcicki „Panda Mama“: ruhig und gelassen bleiben, rät sie. Je weniger Tiere es auf der Welt gibt, desto mehr werden sie zu Vorbildern für die „Zivilisierten“, und sei es nur als Party-Gag oder SM-Rolemodel.
Auf der letzten „Eurofurence“ im Berliner Estrel-Hotelliefen viele „Tiger“ herum,es war das weltweit älteste Treffen, „das jährlich in- und ausländische Fans von vermenschlichtenTiergestalten zusammenbringt.“ Einige der „Tiger“ sahen jedoch eher wie Comictiere aus, desgleichen viele „Bären“, „Wölfe“, „Papageien“, „Mäuse“, „Schakale“ und „Füchse“. Die „Märkische Allgemeine Zeitung“ interviewte einen „Saurier“: „Ich mache das seit 2004 – es ist mir eigentlich egal, was die Leute denken,“ sagte er. „Auch sein Kumpel, der Wolf, lässt sich von den Urteilen der anderen nicht verunsichern. ‚Ich habe als Furry gelernt, nicht mehr scheu zu sein‘.“ Maximilian Nitschke-Stockmann, Mitorganisator der „Eurofurence“ 2018, an derüber 3000 „Furrys“ teilnahmen, meint: „Wir sind ein großer, verkuschelter Haufen“. Der MAZ-Reporter hat herausbekommen: „Die meisten Kostüme kosten Tausende Euro, in ihnen stecken Hunderte Arbeitsstunden. Manche sind mit 3D-Augen und Belüftungssystemen ausgestattet, eins mit integrierter Videokamera. Kostenpunkt? So teuer wie ein Kleinwagen.“
Die Vermenschlichung von Tiergestalten begann mit den Fabeln von Äsop und Lafontaine. Davon ausgehend liegen solchen Fabeln Zuschreibungen von bestimmten dominierenden Charakterzügen zugrunde – wie Neid, Geiz, Eitelkeit, die mit Tieren identifiziert werden: der listige Fuchs, die kluge Eule, der tapsige Bär, der eitle Pfau usw.. Und diese wurden dann – auch zeichnerisch – auf bestimmte Menschen übertragen: Geschäftsleute, Bürgermeister, Marktfrauen, Offiziere…
Dieses Fabel-Prinzip gilt auch noch für die „Furry Conventions“ insofern die Leute dort sich als ein Tier verkleiden, von dem sie meinen, dass sie sich damit identifizieren können, also dass es Charaktereigenschaften hat, die man selber auch hat oder haben möchte. Der „stern“ veröffentlichte unlängst einen „Persönlichkeitstest: Welches Tier entspricht ihrem Charakter?“ Ende Juni vergewaltigte ein „Mann mit Wolfsmaske“ in einem Münchner Park ein Mädchen. Die Soko „Wolf“ ermittelt.
.

So fing die Petplayerei an: Mit Biene und Blume im Sexualkundeunterricht, Schottland 1954
.

Und so ging es weiter: mit Esel auf der Bühne.
.

Im Film: mit Gorilla im Studio.
.

Im Privaten: mit Elefanten als Pärchen.
.

Auf der Strasse: als weißes Kaninchen.
.

Und in Zukunft: als Interspecies Marriage.
.
Tier- und Pflanzenberichterstattung
Die Bemühungen der taz, mehr über Tiere zu berichten, scheint langsam Wirkung zu zeigen. Die Arbeitsagenturen meldeten, dass Ende Juli deutschlandweit nur noch 66 freie Lehrstellen in der Tierpflege übrig waren, aber 881 jugendliche Bewerber dafür noch keine Stelle hatten. Während es umgekehrt bei den Schlachtern noch 4.000 unbesetzte Lehrstellen gab – bei etwa 800 Bewerbern.
Die FAZ schrieb am 8. August unter der Überschrift „Zu viele Tierpfleger, zu wenig Metzger“: „Nicht immer ist die Kluft zwischen Berufswünschen und Bedarf so tief wie im Umgang mit Tieren.
Denn bei den Bäumen ist das anders: Während im Bereich Holzbearbeitung für 3.200 Bewerber weniger als 2.100 unbesetzte Lehrstellen übrig sind, ist es bei den Gärtnern, Baumpflegern (Treeworker) fast umgekehrt. Bei der Pflanzen-Berichterstattung müsste die taz also in Zukunft noch zulegen.
Allerdings ist auch im Umgang mit Tieren – pflegen oder töten – noch vieles im Argen: So meldete die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel: „13 Millionen Schweine landen jährlich im Müll.“
Beim Pflegen beziehungsweise dem Töten von Pflanzen ist es oft genug noch ausgerechnet das Arbeitsamt, das völlig versagt: So arbeitete der Ostberliner Philosoph Lothar Feix gelegentlich als Aushilfskellner. Er war arbeitslos gemeldet und ein dezidierter Pflanzenverächter. Dennoch drängte ihn das Arbeitsamt, sich zum Gärtner umschulen zu lassen. Er brauchte fast ein Jahr, mit Eingaben, Gutachten, ärztlichen Bescheinigungen usw., um dieses Ansinnen erfolgreich zurückzuweisen.
Umgekehrt erging es dem Heidelberger Percussionisten Arno Behrens, der in gleich mehreren „Urban Gardening“-Projekten mitarbeitete: Als arbeitsloser Musiker wollte er zum Gärtner umgeschult werden, er brauchte jedoch ein Jahr, um endlich die Umschulung vom Arbeitsamt genehmigt zu bekommen.
P.S.: Über die quasi tägliche Tier- und Pflanzenberichterstattung hinaus möchte ich jedoch noch etwas anderes: Im Anthropozän scheint es mir dringend geboten, dass wir in der Literatur aufhören zu menscheln – und stattdessen z.B. Romane über einzelne Tiere oder gar Pflanzen produzieren. Der Erfurter Meeresbiologe und Regierungsberater für Meeressäuger, Karsten Brensing sagt es so: „Um Tiere besser zu verstehen, ist es notwendig, sie zu vermenschlichen.“
Einen ähnlichen Anthropomorphismus gegen den Anthropozentrismus sehen die Ethnologen Tania Stolze Lima und Eduardo Viveiros de Castro im „Perspektivismus“ des indigenen Amerika, „nach der jede Lebensform sich selbst als menschlich (an)sieht – sowohl anatomisch als auch kulturell – da das, was sie von sich selbst sieht, ihre Seele ausmacht, ein inneres Bild gleich dem Schatten oder dem Echo des humanoiden Urzustandes aller Existierenden…Demzufolge sieht ein Jaguar, wenn er einen anderen Jaguar anschaut, einen Menschen, einen Indio, aber wenn er einen Menschen anschaut – sprich denjenigen, den die Indios als einen Menschen betrachten-, sieht er ein Pekari (ein Nabelschwein) oder einen Affen, da dies das von den amazonischen Indianern anm meisten geschätzte Wild ist.“ (Zitat aus: „In welcher Welt leben?“ 2019)
Ich will damit sagen, dass wir statt über die Evolution nachzudenken mehr über die Geschichte – von Populationen, Gruppen, Rudeln, Paaren, Individuen – wissen sollten. Hierzu sehe ich Ansätze bei den Frauen mit doppeltem Nachnamen, die für Konrad Lorenz Prokolle ihrer Gänsebeobachtungen anfertigten. Ferner Clare Kipps „Clarence der Wunderspatz“ (1956), Gwendolen „Len“ Howards „Alle Vögel meines Gartens“ (1954) und „Die Salzberger Schwalbengeschichten“ (1942) von Else Thomé.

.
Vegetarische Raubtiere
Außer bei den Pandas, die sich auch in Freiheit gerne von Bambussprossen ernähren, ist eine vegetarische Ernährung für Raubtiere ein frustrierender Gedanke.Aber wenn Hunde- oder Katzenhalter anfangen, sich vegetarisch zu ernähren, möchten sie nicht gerne weiterhin täglich ekelhaft riechenden Pansen, blutige Leberstücke oder glitschige Lammlachsstreifen für ihre Lieblinge zubereiten. Sie entwickeln einen Ekel vor Fleisch und Fisch, während ihre Hunde und Katzen sich umgekehrt vor vegetarischem Essen ekeln, wie ich selbst herausfand und immer wieder teste.
Ich weiß jedoch von einem Hund, der sich, in einem schwedischen Ashram lebend, primär von Gurken ernährt. Allerdings entwickelt er gelegentlich einen Heißhunger auf Maulwürfe und überfahrene Füchse. Andere Hunde kompensieren ihren Fleischmangel, indem sie menschliche Scheiße fressen.
Der Spandauer Fischzüchter Benjamin Wohlfeld hat einmal junge fleischfressende Piranhas auf pflanzliche Ernährung umerzogen, indem er sie zu erwachsenen pflanzenfressenden Pirahas ins Becken setzte, wo sie sich notgedrungen von deren Scheiße ernähren mußten. Irgendwann hatten sie genug Pflanzen verdauende Bakterien im Magen, so dass sie halbwegs zufriedenals Vegetarier leben konnten. Ähnliches gelang amerikanischen Offiziersbarschforschern und Forellenzüchtern, die ihre Fische mit Pellets ernähren, die komplett aus Pflanzen – Soja, Leinsamen, Pistazien und Algen – bestehen.
Allerdings gilt dabei: „Je weniger tierische Zusätze im Futter sind, desto komplexer müssen die Mischungen sein,“ sagtBert Wecker vom Aquakultur-Anlagenbauer Neomar. Die Tierärztin Britta Dobenecker vom Lehrstuhl für Tierernährung an der Universität München meint, das gelte auch für die Landraubtiere Katze und Hund: Ihre Versorgung mit allen Nährstoffen bei vegetarischem Futter sei weitaus schwieriger und aufwendiger als mit Fleisch. Und eine vegane Ernährung ohne Milch und Eier ginge gar nicht. Hunde würden manchmal von einer Umstellung auf vegetarisches Futter „sogar profitieren“, weil sie zwar „Fleischfresser“ aber mit einer „Tendenz zum Allesfresser“ seien, während Katzen „Fleischfresser“ geblieben sind und „eine vegetarische Ernährung keinesfalls vertragen“.
Der Süddeutschen Zeitung gegenüber zeigte sich die Tierernährungsspezialistin skeptisch gegenüber den bisherigen Studien über vegetarisch ernährte Haustiere, weil nur wenige Tiere dabei untersucht wurden, zudem komme es bei den Haltern von vegetarisch ernährten Tieren möglicherweise zu einem Placeboeffekt: „Wer davon überzeugt ist, dass fleischloses Futter seinem Hund besser bekommt, auf den wirkt das Fell des Tieres womöglich dichter und glänzender.“
Bei Katzen hilft manchmal ein anderer Selbstbetrug, angefangen bei ihren Besitzern, indem sie speziell das Feuchtfutter „Multifit Ragout“ von Fressnapf kaufen, das eine Zubereitung mit Kaninchen auf der Verpackung anpreist, aber, wie die Tester der Stiftung Warentest herausfanden, gar kein Kaninchenfleisch enthält. Dennoch scheinen es die Katzen zu fressen, sonst würden ihre Besitzer es nicht kaufen.
25 Futterdosen für Katzen wurden von der Stiftung analysiert, dazu heißt es auf der ihrer Internetseite: „Gleich sechs Feuchtfutter im Test sind mangelhaft. Sie enthalten zu wenig oder zu viel der Schlüsselnährstoffe für Katzen wie Fett, Eiweiß, Vitamine und Mineralstoffe. Jedes zweite Produkt enthält zu viel Phosphor. Das kann möglicherweise den Nieren der Katze schaden. Chronische Nierenerkrankungen sind häufig und nicht heilbar. Eine günstige Kalziummenge kann zu viel Phosphor ausgleichen, doch nur fünf der phosphorreichen Produkte bieten sie. Fünf Futter überschreiten die Höchstmenge an Natrium.“
In anderen Worten: Auch das den Katzen angebotene Fleisch in Dosen ist selten gesund für sie. Meine zwei Katzen sehen das glaube ich auch so. Wirklich scharf sind sie nur auf Fliegen oder Motten. Wobei es natürlich sein kann, dass der Witz an diesen lebenden Fluginsekten darin besteht, dass sie nicht in einer Schale liegen, sondern mit einiger Ausdauer über Tische und Schränke gejagt werden müssen. Da leuchten ihre Augen. Katzen und Hunde sind Jäger. Sie freuen sich über jede Jagd, auch wenn sie erfolglos war, wie der US-Autor Mark Rowlands in seinem schönen Buch „Der Philosoph und der Wolf“ (2009) berichtet.
Ernährungsphysiologisch hat die lange Domestikation des Hundes laut Britta Dobenecker Spuren in seinem Verdauungsapparat hinterlassen: „So stellt Stärke einen wesentlichen Bestandteil der menschlichen Ernährung dar, und Hunde können sie deutlich besser verdauen als Wölfe.“ Desungeachtet gelte für Hunde aber noch immer, dass sie „in vielen Fällen Nährstoffe aus pflanzlichen Quellen schlechter verwerten als aus tierischen.“
In Franz Kafkas „Forschungen eines Hundes” macht der Hund sich komplizierte Gedanken über die Ursprünge seiner Nahrung, wobei er stets davon ausgeht, dass die Lebensmittel von oben – aus der Luft gewissermaßen – kommen (so wie es bereits die alte Menschheitsidee nahelegte, dass alle guten Dinge von Gott kommen – was ebenfalls wieder und wieder wissenschaftlich begründet wurde). Obwohl die „Forschungen” also nur angestellt wurden, um die Herkunft des Hundefutters vom Herrn (Herrchen) auszudeuten, wird der darin jedoch ausgeklammert.
Vielleicht kann eine Geschichte des Marxisten Alfred-Sohn-Rethel diese Forschung erhellen: „Gesetzt den Fall, wir gehen mit unserem Hund in einen Fleischerladen, alles was dort geschieht, versteht auch der Hund. Das Deuten auf dieses oder jenes Fleischstück, dass und wie der Schlachter die Portionen abwiegt, einpackt, uns rüberreicht usw. Aber wenn wir dann das Geld aus dem Portemonnaie nehmen, es abzählen und die Ware damit ‚bezahlen‘ – das versteht der Hund nicht. Da beginnt die ‚Realabstraktion‘ des Kapitalismus, in der der Warenverkehr den nexus rerum der Gesellschaft bildet, der ein rein abstrakter Zusammenhang ist.“ – Und für den Hund deswegen nicht (jedenfalls bis jetzt noch nicht) zu ergrübeln ist.
Ganz anders ist es, wenn wir mit unserem Hund in einen Gemüseladen gehen. Der selbe Vorgang: Der Händler packt den gewünschten Salat und die Tomaten ein und reicht sie dem Herrchen über den Tresen. An diesem Punkt denkt der Hund: Warum kauft der denn so einen Scheiß?!“ Oder, wenn er bereits vegetarisch umerzogen wurde: „Warum denn schon wieder dieser Scheiß?!“ (Da nützt auch keine wissenschaftliche Erkenntnis, dass die Unterschiede zwischen Pflanzen und Tieren nur wenig ins Gewicht fallen und das Erbgut z.B. von Bananen und Menschen zur Hälfte identisch ist.)
„Gesetzt den Fall,“ schreibt die feministische US-Biologiehistorikerin Donna Haraway, „eine Wildkatze hinterlässt Junge, die von einem Haushalt bestehend aus überqualifizierten, wissenschaftlich ausgebildeten Kriegsgegnern mittleren Alters aufgenommen werden, oder von einer Tierwohlfahrtsorganisation, die eine Ideologie zum Schutz des Wilden und Tierrechte propagiert: Wird das Tier bei ihnen garantiert glücklich werden? – Wo die Wildheit doch unsere ganze Hoffnung ist?“ Ja, das ist die eigentliche Frage bei diesem Thema, und die läßt sich zufriedenstellend nur individuell beantworten. Es gibt ja die seltsamsten Geschmäcker – auch bei Hunden und Katzen.
.

.

Robbe begrüßt den Robbenpfleger. Foto: Val Pom
.

Fidel Castro mit Bär, Irkutsk 1963.
.

Taubenangriff auf die Ornithologin Marieluise Dankert.
.

Affenaffendespektierlichkeit gegenüber dem Playgirl Sarah McLean.
.

Känguruh wehrt sich gegen indiskreten Paparazzo.
.
Arktis
Der Tierfilmer Andreas Kieling wurde gefragt, warum er so an der arktischen Fauna, vor allem an Eisbären, interessiert sei: „Ganz einfach – ich mußte mir sehr genau überlegen, wo es eine Marktlücke gab,“ antwortete er. „Nur Millionäre und Fernsehteams“ können sich heute eine „Shooting-Permission“, z.B. auf Spitzbergen, leisten.
Jeder erinnert sich noch an die süßen kleinen Robbenbabys auf dem Packeis vor Neufundland, die alljährlich zu tausenden von verrohten „Robbenschlächtern“ mit Keulen betäubt wurden, um ihnen bei lebendigem Leibe ihr flauschiges weißes Fell abzuziehen. Die Photos davon gingen 1977 um die Welt. Dahinter stand eine von Brigitte Bardot beförderte Kampagne gegen die Pelzindustrie. Etliche Staaten beschlossen daraufhin Pelzeinfuhrverbote. Zudem wurde es im Westen generell Konsens: „Pelz ist nicht okay“.
Ähnlich war es bei den Walen, die mit zunehmend ausgeklügelter Geschoß- und Verarbeitungstechnik der Walfangflotten an den Rand der Ausrottung gerieten: Hier kam die Rettung durch eine Langspielplatte mit „Walgesängen“, die der Navy-Ingenieur Frank Watlington auf den Bermudas beim Testen eines neuen Unterwassermikrophons zur Ortung von U-Booten aufgenommen und die von der Musikwissenschaftlerin Katy Pane und ihrem Mann, einem Walforscher, als „Lieder“ erkannt wurden. 1970 verkaufte allein „National Geographic“ 11 Millionen Exemplare davon. Seitdem gibt es nicht nur von den besonders gesangsfreudigen Buckelwalen, sondern auch von anderen Walarten Aufnahmen ihrer „Gesänge“, die als eine Art „Sprache“ gelten. Für die Meeressäuger fielen dabei immer mehr „Walschutzgesetze“ ab. Und Walschützer wie „Greenpeace“ und „Sea Shepherd Global“ jagen inzwischen die letzten Walfangschiffe mit der knappen Ressource Aufmerksamkeit, während immer mehr Walfänger sich zu Guides von „Whale Watchern“ umpositionieren. In den Walschutzzonen sind die großen Meeressäuger inzwischen handzahm geworden, wie der Leiter des Wissenschaftszentrums der Universität Augsburg Jens Soentgen in seinem Buch „Ökologie der Angst“ (2018) berichtet.
Aktuell engagiert sich die „Ökologie“ und „Umwelt-Bewegung“ vor allem beim „Klimaschutz“, dabei ist ihr „Symboltier“ der arktische Eisbär, dem durch die Klimaerwärmung und den dadurch verursachten Rückgang des Packeises seine Nahrungsgrundlage, Robben, entzogen wird. In der kanadischen Hudson-Bay nehmen die Populationen bereits ab, sie kommen bis in die dortige Hafenstadt Churchill, wo es für besonders aufdringliche Eisbären sogar ein Gefängnis gibt. In den sozialen Medien zirkulieren Bilder von halbverhungerten Eisbären. Die Klima-Kampagne des WWF heißt „Rettet die Eisbären“. Der Direktor von Zoo und Tierpark in Berlin ließ den junggestorbenen Eisbären „Knut“ ausstopfen und erklärte ihn zum „Artenschutz-Botschafter“. Zuvor hatte die Dichterin Yoko Tawada bereits Knuts Biographie veröffentlicht und der Fake-Journalist Tom Kummer ein Interview mit ihm.
Eisbären, Walen und Robben ist nicht nur gemeinsam, dass sie in der Arktis leben, lange Zeit von Europäern aus Profitinteresse gejagt wurden und nun einen gewissen Schutz genießen, es gibt dort auch noch die von der Jagd auf sie lebenden Ureinwohner: Inuit vor allem – in Neufundland, Alaska, Nordostsibirien und Grönland.
1951 besuchte der MedizinerJohan Hultin das Dorf Brevig in Alaska, 1997 flog er noch einmal in den Ort, der Wissenschaftsjournalistin Gina Kolata berichtete er: „Das Leben hatte sich dort grundlegend geändert. 1951 hatten sich die Dorfbewohner noch weitgehend selbst versorgt, viele von ihnen hatten noch die alten Walfang- und Jagdtechniken beherrscht. 46 Jahre später gehörte dies alles der Vergangenheit an, die meisten Menschen lebten von der Sozialhilfe, und so war das Dorf, das immer noch einsam über der eisgrauen See lag, mittlerweile ein trauriger, hoffnungsloser Ort. Die Bewohner hatten ihren Stolz verloren.“
Ähnlich war es auf der anderen Seite der Beringstrasse auf den Aleuten und in Nordostsibirien, wo die Berliner Filmemacherin Ulrike Ottinger ihren zwölfstündigen Dokumentarfilm „Chamissos Schatten“ (2016) drehte. Mit der Auflösung der Sowjetunion war dort die riesige Walfangflotte stillgelegt worden, auf denen die Arbeiter einen Blauwal in 30 Minuten zerlegen konnten, gejagt wurde er mit Kanonenharpunen, die beim Eindringen Luft in seinen Körper pumpten, so dass er nicht unterging. Die dortigen Küstenbewohner mußten ab 1992 wohl oder übel wieder auf ihre alten Jagdtechniken zurückgreifen, wollten sie nicht verhungern, und so gingen sie mit Gewehren und Ruderbooten mit Außenbordmotor auf Walfang. Ottinger zeigte eine solche Szene, die damit endete, dass die Jäger den Wal zwar töten, aber nicht bergen konnten: Er versank im Meer.
Die als Leiterin von arktischen Tourismusexpeditionen arbeitende Schriftstellerin Birgit Lutz hat mehrmals Inuit-Siedlungen in Ostgrönland besucht, wo an der 2500 Kilometer langen Küste nur noch 2500 Menschen leben und einige Siedlungen völlig verlassen sind, seitdem die Jagd auf Wale und Eisbären fast verboten wurde und die Robbenfelle kaum noch etwas einbringen. Ihrem Bericht gab die auf Spitzbergen umweltschützerisch engagierte Autorin den provokativen Titel: „Heute gehen wir Wale fangen…“ (2017). Sie interviewte darin u.a. die auf Grönland geborene dänische Reiseorganisatorin Pia Anning Nielsen: „Seitdem die Jagd keine Perspektive mehr für die Menschen hier ist, sind sie nicht mehr stolz. Jetzt können sie sich nicht mehr selbst versorgen, weil der Preis für die Robbenfelle trotz Subventionierung durch die dänische Regierung zusammengebrochen ist.“ Die letzten Jägerschießen zwar weiterhin Robben, 20-30 pro Tag mitunter, aber vor allem zur Versorgung ihrer Schlittenhunde. Ansonsten verfallen immer mehr Inuit dem Alkohol und von den männlichen Jugendlichen verüben immer mehr Selbstmorde: „Für Pia liegt der Hauptgrund dafür in der Erziehung zum Jäger,“ das kein Auskommen mehr bietet. Ein dänischer Polizist erzählte: „An der Westküste gibt es Orte, wo man als Däne besser nicht nachts auf die Straße geht.“ Und dennoch wissen alle Grönländer, die weißen Tierschützer, angefangen mit Brigitte Bardot, haben ihnen zwar ihre Erwerbsgrundlage entzogen, aber deren Öko-Tourismus ist nun ihre einzige „Chance“.
Birgit Lutz zufolge nahm „das Unheil bereits nach dem Zweiten Weltkrieg seinen Lauf mit der Modernisierung Grönlands,“ als die Bevölkerung in die Städte umgesiedelt wurde: 1951 lebten noch fast 70 Prozent der Menschen in Dörfern, 2010 nur noch 15 Prozent. Sie verloren dadurch ihre Jagdgründe, ihres Lebensweise und ihre Dorfgemeinschaften. „Jagdnomade zu sein, wurde verboten, man mußte einen festen Wohnsitz haben.“ Aber das Schlimmste war, dass sie mit Robbenfellen nichts mehr verdienten, „deswegen trinken sie,“ wie eine junge Inuit meint. Im Film der kanadischen Indigenen Alethea Arnaquq-Baril „Angry Inuk“ (2016) ist die entscheidende Abstimmung im Europäischen Parlament über das verschärfte Einfuhrverbot von Robbenprodukten zu sehen: Vor dem Saal standen auf der einen Seite die Tierschützer und verteilten kleine, weiße Robbenbaby-Plüschtiere, auf der anderen standen einige Inuit in ihrer Robbenfellkleidung und versuchten darüber aufzuklären, dass sie gar keine weißen Jungtiere jagen, dass die Robbe für sie das ist, was für die Europäer das Schwein ist, und dass es außer Robben, Wale, Eisbären und Fische keine anderen Nahrungsmittel auf Grönland gibt. Die Inuit ernteten für ihre Aufklärung viele angeekelte Blicke von den EU-Parlamentariern.
Für Wale und Eisbären werden heute auf internationaler Ebene für die Subsistenzjagd der Inuit Quoten zugeteilt: 2014 wurden von neun Walarten in Grönland 3297 erlegt. Von den Eisbären wurden im selben Jahr 143 erlegt. Deren Felle werden immer teurer, bis zu 3000 Euro, weil es eine steigende Nachfrage in China gibt. Birgit Lutz findet es unterstützenswert, dass die Inuit weiterhin Robben und Kleinwale jagen, aber weil sie sich auf Spitzbergen bei ihrer Sommerarbeit für den Schutz der Eisbären engagiert, fällt es ihr schwer, hier in Ostgrönland nun Sympathie für die letzten Eisbärenjäger aufzubringen.
Durch Trumps angeberisches Angebot, Grönland zu kaufen, sind die Inuit plötzlich im Fokus der Medien. Da trifft es sich, dass gerade der Südostgrönland-Bericht aus den Dreißigerjahren des holländischen Verhaltensforschers Niko Tinbergen „Eskimoland“ erneut veröffentlicht wurde. Der spätere Nobelpreisträger hat seine Grönlandforschung, die übrigens wie alle damals von der dänischen Carlsberg-Brauerei finanziert wurde, als eine „teilnehmende Beobachtung“ begriffen, wie sie neuerdings der schottische Sozialanthropologe Tim Ingold in seinem Buch „Anthropologie – Was sie bedeutet und warum sich wichtig ist“ vertritt.
Und dann gibt es da noch das 2012 erschienende Buch „Die Untreue der Grönländer“ des dänischen Schriftstellers Kim Leine, der einige Zeit als Krankenpfleger in einer Siedlung auf Grönland arbeitete. Im Original hat sein Bericht den Titel „Tunu“, was Ostgrönland heißt: Eine sehr dünn besiedelte Region, die 1931 von Norwegen besetzt wurde, mit der Begründung, dass Dänemark diesen Teil seiner Kolonie zivilisatorisch vernachlässigt habe. 1935 gaben die Norweger jedoch klein bei, seitdem halten sie sich an Spitzbergen. Große Reichtümer kann man auf beiden Inseln (noch) nicht erwerben, zumal aufgrund eines internationalen Artenschutzabkommens mit dem Erlegen von Robben, Eisbären und Walen kein Geschäft mehr zu machen ist, aber das erwähnte ich oben bereits.
.
Staat-Ups
Grob gesagt kann man bei den Existenzgründern zwischen sich verwirklichen und verwirken unterscheiden. Das kann man auch auf Grönland. Erstere werden zumeist vom Arbeitsamt gefördert und mit einem Coach versehen, man spricht deswegen auch von „Staat-Ups“. Letztere suchen sich Investoren, die ihnen einen Projektmanager vor die Nase setzen, der sie auf marktwirtschaftlichem Kurs hält (so machen es z.B. die Zalando-Brüder). Von allen „Start-Ups“ gelangt höchstens einer von zehn in die Gewinnzone.
Unsere Kneipe in Neukölln war ein Staat-Up, das immer wieder in die Arktis gereiste Wirtsehepaar Uschi und Ansgar war arbeitslos gewesen und hatte beim Jobcenter einen Projektantrag gestellt, der genehmigt worden war. Normalerweise muss sich jeder irgendwann entscheiden, ob er vor oder hinter der Theke stehen will, für unseren „Fuchsbau“ hinterm Comenius-Garten traf das nicht zu, d.h. Gäste und Wirte waren nicht unterscheidbar. Weswegen die Einnahmen nicht mit den Ausgaben für Getränke und Knabberzeug Schritt hielten: Es wurde großzügig eingeschenkt und die Deckelführung lax gehandhabt, während den „Aushilfen“ anständige Stundenlöhne gezahlt wurden.
Irgendwann führte der vom Jobcenter auf das „Projekt“ angesetzte „Coach“ ein ernstes Gespräch mit Uschi und Ansgar: Der Umsatz könnte besser sein, sagte er, der selbst eine Art „Staat-Up“ war: ein Unternehmensberater. Einst hatte er in der Hochschule für Ökonomie sozialistisches Wirtschaften gelernt, dann hatte er alsSelbständiger Firmen beraten. Diese hatten seine Wirtschaftskonzepte jedoch meist abgelehnt und waren „deswegen wieder vom Markt verschwunden“. So war es dann auch beim „Projekt“ von Uschi und Ansgar, denen er vorschlug, mehr Touristen anzulocken und z.B. Cocktails und „Happy Hours“ einzuführen, sowie mit „Flyern“ draußen für ihre Veranstaltungen zu werben. Aber dazu fand sich niemand und das ganze „Hawaii-Gelumpe“ mit den Happy-Hours lehnten alle ab, zumal sie befürchteten, dass dann plötzlich Englisch im „Fuchsbau“ gesprochen wurde. Nicht dass sie generell was gegen Fremde hatten, Polen und Russen waren z.B. willkommen, es standen acht Wodka-Sorten im Kühlfach.
Als der Coach sich mit der Anökonomie das „Fuchsbaus“ vertraut gemacht hatte, schlug er vor, mit den Stammgästen einen Kulturverein zu gründen, das würde die Verluste auf viele Schultern verteilen, wenn nicht gar dazu führen, endlich Gewinn zu machen, denn hinter einem solchen altruistischen Verein stünden viele Egoisten, die nicht draufzahlen wollen auf Dauer. Der Coach argumentierte gerne biologisch, in diesem Fall bemühte er eine Drosselart, bei der die ledigen Vögel den Brutpaaren bei der Aufzucht helfen, wodurch sie an Ansehen gewinnen. Desungeachtet wurde sein Rat angenommen und schon bald waren alle Mitglieder im Verein der Freunde des klassenlosen Fuchsbaus. Da die Höhe des Mitgliedsbeitrags jedoch von jedem selbst bestimmt wurde und man auch nichts zu zahlen brauchte, änderte der Verein wenig an der finanziellen Misere. Den „e.V.“ gibt es noch heute, aber Uschi und Ansgar übergaben die Kneipe einem anderen Wirtsehepaar. Dennoch blieb alles so wie es war, nur dass die neue Thekencombo etwas strenger wirtschaftete und die Gläser nicht mehr so voll schenkte.
Zu den Vereinsmitgliedern gehörte Kirsten, eine dänische Fotokünstlerin. Da sie selten ein Foto verkaufte, war sie arbeitslos gemeldet. Irgendwann legte das Jobcenter in der Rudi-Dutschke-Strasse ihr nahe, sich selbständig zu machen mit einer Förderung und einem Coach. Bei diesem handelte es sich um einen Westberliner, der eine Künstleragentur hatte, aber es sei ihm damit nach der Wende so ergangen wie Woody Allen in „Broadway Danny Rose“. Kirsten photographierte am Liebsten nordische Tiere, aber in Berlin vor allem Leute in U- und S-Bahnen. Danny Rose riet ihr, sich auf Hochzeiten, Betriebsfeiern und Firmenjubiläen zu werfen und dazu z.B. bei Kapitänen von Ausflugsschiffen und Betreibern von Hochzeitssälen vorzustellen – mit Visitenkarten. Seine Vorschläge machten Kirsten regelrecht krank. Oft hatte sie sich vorgestellt, wenn sie mal wieder einen hupenden türkischen Hochzeits-Konvoy auf der Straße sah, hinzurennen und die Braut aus dem Auto zu zerren, um sie zu retten. Das war also alles nichts für sie, ihr Coach machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl und ihr Sachbearbeiter beim Jobcenter drohte: „Wir können auch anders!“.
.

Russin füttert einen Eisbären.
.

Amerikaner füttert Eisbären.
.

Der Polarforscher Iwan Papanin posiert vor ausgestopftem Eisbären.
.

Eisbär im Zirkus mit der DDR-Dompteurin Ursula Böttcher.
.

Eisbär im Zoo.




Hallo, ich möchte natürliche Kräuter aus Afrika für Herpes und HIV empfehlen. 2012 wurde bei mir HIV diagnostiziert und im letzten Jahr wurde festgestellt, dass ich Herpes hatte. Ich war nicht zufrieden. Die Symptome, bei denen es unerträglich war, jeden Monat Wunden um Mund und Warzen zu haben, sind auf Herpes 1 und 2 zurückzuführen. Ich verwendete natürliche Kräuter für a Totalreinigung, die der Arzt bestätigte und bei Dr. Steven aus Afrika bestellte. Er sagte mir, er könne mich mit Kräutern heilen, die ich von zwei Leuten in den USA bestätigt habe. Ich habe die Kräuter geliefert bekommen und sie über eine Woche lang warm genommen. Ich war so glücklich zu wissen, dass ich eine Heilung bekam und die Symptome starben, nachdem ich die Kräutermedikamente verwendet hatte. Ich bekam eine Reinigung und Heilung und machte alle überrascht, einschließlich meines Arztes und meiner Freunde. Danke Dr. Teven für die Kräuterheilung, Ihre Behandlung ist empfehlenswert. (E-Mail: drsteven2002@gmail.com / whatsap +2348163807836).