„Die Hoffnung ist ein Ding mit Federn.“ (Emily Dickinson)
„Das ganze Ding ist ein Risiko“ (Robert Habeck)
.
Die großen und kleinen Dinge
Diese Dinge werden jetzt vermehrt in autobiographisch getönten Sachbüchern behandelt. Vielleicht ist die Wertschätzung der Dinge und nicht der Lebewesen neben der fortschreitenden Musealisierung von Gegenständen (bis hin zu ganzen Lebensbereichen und -weisen) eine Alterserscheinung: Also dass man seine Aufmerksamkeit, wenn schon nicht auf die letzten, dann wenigstens auf die kleinen und kleinsten Dinge richtet, um sie mit Bedeutung/Erinnerung aufzuladen, und zum Reden zu bringen – da die menschlichen Gesprächspartner langsam wegsterben oder langweilig werden.
Die „Arnold-Hau-Schau“ von Robert Gernhardt hat diese Dingorientierung in dem Film „Wenn das Milchkännchen erzählen könnte“ beispielhaft an einem allzu geschwätzigen Milchkännchen auf einer gedeckten Kaffeetafel gezeigt. Der Film endet mit der aufklärerischen Versicherung: „Zum Glück können Milchkännchen nicht reden.“
Der Kulturwissenschaftler Wolfgang Schivelbusch („Magister Schievelbusch“ nannte ihn Peter Hacks, über den Schivelbusch seine Dissertation „Sozialistisches Drama nach Brecht schrieb) lebt in New York und Berlin – großteils von „Projektförderungen“. In seinem Buch „Die andere Seite“ (2021) hat der „Privatdozent“ den Unterschied im Umgang mit den Dingen in Amerika und in Deutschland thematisiert. Wobei er hier wie dort vor allem in Bibliotheken und Archiven sitzt. Schon als Student in Frankfurt beschäftigten ihn am „Prozeß der Zivilisation“ Dingkörper wie „Gabel und Schnupftuch“. Später folgte eine gründliche Beschäftigung mit der Eisenbahn(fahrt) hüben und drüben (wo die Eisenbahn „Wildnis in Wert verwandelt“) sowie mit der Geschichte der künstlichen Beleuchtung.
„Die Dingwelt“ wurde diesem teilnehmenden Beobachter der antiautoritäten Studentenbewegung eine „Alternative zur Theoriewelt“. Inzwischen veröffentlichte der Wissenshistoriker Michel Foucault eine „Ordnung der Dinge“ und der Wissenssoziologe Bruno Latour zählte die Dinge in seiner „Akteur-Netzwerk-Theorie“ zu den „Akteuren“.
Schivelbusch geht es mit Adorno um die „Gutartigkeit der Dinge“ – mindestens den Stand der Unschuld vor dem Sündenfall ihres Eintritts in die Sphäre der kapitalistischen Zirkulation.“ Mit Kracauer würde er ihnen gerne „ihr unkenntliches Leben entlocken“. Er denkt dabei vielleicht an die Einzelstücke der Handwerker in ihrer Blütezeit, wobei ihm jedoch das Prinzip der Masse, der Massenproduktion von Dingen, von zentraler Bedeutung ist – dieser Umschwung vom europäischen Spätmittelalter zur amerikanischen Gesellschaft. „Amerika ist die Inkarnation der Massenhaftigkeit“. Daraus folgt das „in europäischen Augen naiv-positive Verhältnis der Amerikaner zu Fortschritt und Maschinerie.“
Über den hierzulande in Akademiker- und Künstlerkreisen um sich greifenden „anbiedernden amerikanischen Akzent“ schreibt er: „Amerika ist in den Naturwissenschaften so klar die Führungsmacht, dass die Deutschen durch ihre sprachliche Mimikry den Anschluss suchen.“
Auch in den US-Naturwissenschaften macht die „Maschinerie“ sozusagen den Kern aus – indem mit gentechnischen Mitteln (Dingen, Geräten) die „Algorithmen des Lebendigen“ erforscht werden – wobei sich die Biologie in Chemie, Physik und Mathematik auflöst.
Die Bremer Kritikerin dieser weltweit dominanten Gerätewissenschaft Silja Samerski meinte in einem Interview: „Ich habe eine ganze Weile nachgedacht, darüber gegrübelt, wie es sich außerhalb des Labors über das ,GEN‘ reden lässt, ohne dem populistischen Gen-Gerede auf den Leim zu gehen. So, wie es in den Lehrbüchern und populärwissenschaftlichen Abhandlungen steht, gibt es ,GENE‘ nicht. ,GEN‘ bezieht sich nämlich auf keine nachweisbare Tatsache, es gibt keine einheitliche Definition des Begriffs. Wenn Genetiker von ,GENEN‘ sprechen, so bezeichnet das etwas ganz Unterschiedliches, Populations-Biologen benutzen den Terminus anders als Molekulargenetiker oder klinische Genetiker. ,GEN‘ ist nichts anderes als ein Konstrukt für die leichtere Organisation von Daten, es ist nicht mehr als ein X in einem Algorithmus, einem Kalkül. Aber außerhalb des Labors wird es dann zu einem Etwas, zu einem scheinbaren Ding mit einer wichtigen Bedeutung, mit Information für die Zukunft … über das sich anschaulich und umgangssprachlich reden lässt. Es ist aber doch sehr fraglich, ob man umgangssprachlich über Variablen von … oder Bestandteile einese Kalküls oder Algorithmus sprechen kann, ob sich also überhaupt außerhalb des Labors sinnvolle Sätze über ,GENE‘ bilden lassen, die von irgendeiner Bedeutung sind. Wenn aber solche Konstrukte in der Umgangssprache auftauchen und plötzlich zu Subjekten von Sätzen werden, mit Verben verknüpft werden, dann werden sie sozusagen in einer gewissen Weise wirklich.“
Der gerade gestorbene Wissenssoziologe Bruno Latour meinte, dass die vulgärmaterialistische Genetik zwar in den Forschungsstätten enorm produktiv ist und profitabel ist, aber zur Analyse dessen was „Leben“ ist, taugt sie nichts. Über 80 % der amerikanischen Biologen sind Inhaber einer Firma oder Teilhaber an einer – und deswegen ist ihnen „das Leben“ scheißegal, Hauptsache die Forschung wirft Gewinn ab.
.

Foto: Wunschfee
.
Geldbeschaffungsmaßnahmen (1)
In den Neunzigerjahren veranstalteten wir mal – gegen den ABM-Wahn eine GBM-Messe auf dem Pfefferberg, wobei GBM für Geldbeschaffungsmaßnahmen stand. Diese kleine GMD-Sammlung (immer wenn sich mal wieder einige „Maßnahmen“ angesammelt haben) erlaubt einen Einblick in die praktische Computerintelligenz, wobei sich manchmal alte Geldbeschaffungsmaßnahmen mit neuester Technologie verbinden – so wie hier: „Wollen Sie Ihre Niere für Geld verkaufen? Unser Krankenhaus ist spezialisiert auf Nierenchirurgie / Transplantation und andere Organ-Behandlung, werden dringend in der Notwendigkeit für O + ve, A + ve und B + ve Nierenspender mit oder ohne Pass und wir bieten Ihnen eine schöne Menge von maximalem Betrag $ 950.000 US Dollar. Jeder Interessierte sollte freundlich Kontaktieren Sie uns per E-Mail: ubth11@gmail.com oder WhatsApp +2347063061652“
Der folgende Betrugsversuch ist ebenfalls nicht mehr neu, aber die Bank (bei der ich gottlob kein Konto habe): „Guten Abend Helmut Höge wir müssen Sie davon in Kenntnis setzen, dass es zu 3 fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen gekommen ist. Um möglichen Schaden zu vermeiden, haben wir ihren Kontozugang vorsorglich gesperrt. Damit Sie weiterhin im vollen Umfang die Vorteile des OnlineBankings müssen Sie sich anhand ihrer Daten verifizieren. Hier klicken. Mit freundlichen Grüßen Deutsche Bank Sicherheit“
Die bereits auf vielen Internetseiten als Betrüger bezeichnete „Fin Tech“ behelligte nun auch mich: „Lieber Freund, Hören Sie aufmerksam zu und ich werde Ihnen zeigen, wie Sie wirklich große Gewinne mit Hilfe des Internets machen können. Vor einigen Monaten rollten sich meine Freunde vor Lachen auf dem Boden als ich ihnen sagte, dass ich mir ein profitables Online-Geschäft aufbauen will. „Ja sicher, toll Gelegenheit“ sagten sie alle, da ich absolut keine Website-Design-Fähigkeiten hatte und auch nichts von HTML verstand und keine Programmierkenntnisse besaß… ich hatte in der Tat nicht viel Computer-„Know-how“ (das habe ich auch immer noch nicht). Ihr Lachen verwandelte sich schnell zu Erstaunen, nachdem ich FinTech beigetreten bin und die Gewinnflut nicht mehr endet. Sie könnten Monate (und Tausende Dollar) verschwenden, um zu versuchen, herauszufinden, was über das Internet tatsächlich funktioniert. Oder Sie könnten sich die Frustration, Zeit und die Fehler ersparen, indem Sie meinem Beispiel folgen. Hier ist der Link damit Sie einen Blick auf das neue Programm werfen können Sie werden es nicht bereuen! Mit freundlichen Grüßen Lukas Kolditz“
Hier ist eine Geldbeschaffungsmaßnahme, die mich mit ihrem Nachsatz ins Grübeln brachte:
„Hallo, Finanzmittel von bis zu 15.730 Euro sind derzeit verfügbar, bitte bestätigen Sie Ihre Anmeldung hier, um loszulegen. Damit wird es Ihnen noch leichter fallen, in 3 Monaten zum Millionär zu werden. Steigen Sie jetzt ein, so lange die Finanzierung noch verfügbar ist. Grüße, Daniel. Unsere Daten zeigen, das Helmut Höge unsere Internetseite aufgerufen und darum gebeten hat, ihn zu kontaktieren.“ – Das kann jedoch nicht sein, das wüßte ich doch!
.

.
Geldbeschaffungsmaßnahmen mit „Viren“ (2)
Nicht nur die Pharmakonzerne und Virologen beschaffen sich mittels postulierter gefährlicher Viren einen Haufen Geld. 2020 erpressten Hacker mit „Schadsoftware“ rund 400 Millionen Dollar in Bitcoin von Firmen. „Ich weigerte mich, einen vierstelligen Lösegeldbetrag zu zahlen, denn meine Daten waren‘s nicht wert,“ schreibt Peter Kusenberg in „konkret“ (9/21). Es geht ihm in seinem Text um die israelische Spionagesoftware „Pegasus“, mit der einige Schweinestaaten ihre Regimegegner verfolgen: „Eine bestätigte Nachricht genügt, um den Downloadvorgang in Gang zu setzen. Sobald sich Pegasus auf dem Zielgerät befindet, kopiert der Trojaner-Auftraggeber die gewünschten Daten, sogar verschlüsselte Nachrichten kann er auslesen sowie Mikrofon und Kamera manipulieren, um die Zielperson bis ins Bett zu überwachen.“
Der Name Pegasus erinnerte mich an die Firma „Mypegasus“ des schwäbischen Juristen Jörg Stein, der mit Geldern von Treuhandanstalt, IG Metall und DDR-Belegschaften parteienverräterisch ein ABM-Pyramidenspiel aufbaute, mit dem er sich zum größten Arbeitgeber Ostdeutschlands aufschwang – bis er zum Glück an Hodenkrebs starb.
Mit „Pegasus“ werden politisch Verdächtige verfolgt, die kleinen „Schadsoftware“-Bastler verfolgen dagegen finanzielle Interessen. So schreibt mir z.B. jemand, der sich „Volksbank“ nennt: „Sehr geehrter Kunde, Unser System erkennt, dass Sie unseren neuen Sicherheitsdienst Volksbank SecureGo Plus noch nicht aktiviert haben.“ Und das soll ich mit einem Klick tun. Ich bin aber gar kein Volksbank-Kunde.
Kaum ist das getan, schreibt mir schon, „Pegasus“ imitierend, ein anderer Mistkerl (namens Bria) – vielleicht der selbe kleine Erpresser, der auch Peter Kusenberg bedachte: „Gruß dich! Ich hab einige schlechte Nachrichten für dich. Einige Monate zuvor ich habe erhalten den Zugang zu den Geräten, die Sie einsetzen beim Browsing von Webseiten. Diese Software sichert mir den Zugang zu Kontrollen aller Ihrer Geräte (das Mikrofon, die Kamera usw.). Ich habe herunterladen Ihre Daten, die Fotos und die Browser-Geschichte auf meine Server. Ich behalte den Zugang zu Ihren Messenger, den sozialen Netzwerken, zur E-Mail, zur Chat-Geschichte und zur Kontakte-Liste. Mein Virus erneuert seine Signaturen unaufhörlich dank dessen Driver und somit bleibt unsichtbar für Antiviren-Software.
Jetzt können Sie verstehen warum ich blieb im Schatten bis zu diesem Brief. Bei der Sammlung Ihrer Daten ich habe entdeckt dass Sie sind ein großer Anhänger der Webseiten für Erwachsene und anderer spaßhafter Sachen. Sie besuchen die Porno-Webseiten gerne und schauen die reizenden Videos oft, um sich Vergnügen zu bereiten.
Also, ich habe aufgenommen einige Ihrer schmutzigen Szenen und habe gebastelt mehrere Videos, in denen Sie masturbieren und den Orgasmus erreichen.
Wenn Sie das noch bezweifeln, ich kann mit einzelnen Mausklicken alle Ihre Videos für Ihre Freunde, Kollegen und Verwandten zugänglich machen. Außerdem, Ihre Videos können durchs ganze Internet und für alle Welt erreichbar werden.
Ich kann vernichten Ihre Reputation für ewig. Ich glaube, dass Sie dies vermeiden möchten, insbesondere in Betracht auf Natur von Videos, welche Sie bevorzugen, weil es für Sie die wahre Katastrophe wäre. Wollen wir das so beilegen: Überweisen Sie mir 1400 EURO in Bitcoin mit Kurs zum Zeitpunkt der Überweisung. Sofort nach Annahme von Geld ich werde den gesamten Schmutz vernichten und dann können wir einander einfach vergessen. Meine Bitcoin-Geldbörse zur Zahlung: bc1qkwchnzy5alj8kdyd3wn6ttwtefz26lwhumk4l7.
Wenn Sie nicht wissen, wie die Bitcoins gekauft und überwiesen werden, nutzen Sie nur jedes beliebige moderne Suchsystem. Ich gebe Ihnen 50 Stunden (über zwei Tage), um die Zahlung durchzuführen. Ich installierte die Lesebestätigung dieses Briefs und der Zeitgeber wird starten, sofort nachdem Sie es gesehen haben.
Außerdem, ich verspreche die gesamte schadenstiftende Software aus Ihren Geräten zu deaktivieren und zu vernichten. Das ist ein ehrliches Geschäft zu günstigem Preis im Hinblick darauf, dass ich verfolge Ihr Profil und den Emailverkehr seit einiger Zeit.
Senden Sie mir keine Antworten. Jede Antwort wäre sinnlos, weil Adresse des Absenders wird erstellt automatisch. Allerlei Beschwerden auch bringen keinen Sinn, weil dieser Brief sowie meine Bitcoin–Adresse können nicht nachverfolgt werden. Ich mache keine Fehler. Wenn Sie diesen Brief mit irgendjemand teilen, werden alle Videos sofort im Internet veröffentlicht und Ihre Reputation somit für immer vernichtet. Ich wünsche Ihnen viel Gluck!“
Ebenso wie Kusenberg ist mir mein Datenschatz keine 1400 Euro in Bitcoin wert, so dass ich auch diese Mail leichtherzig löschte.
.
Geldbeschaffungsmaßnahmen (3)
Am Sichersten scheint immer noch die Geldbeschaffung über das uralte sexuell konnotierte Menscheln – nun über Email an zigtausend einsame Männer auf einmal adressiert:
Elena: „Hallo!!! Es tut mir Leid, dass ich Ihnen schreibe, mit einer kleinen Verzögerung. Ich hoffe, dass ich Dir interessant genug bin und Du willst eine ernsthafte Beziehung? Ich hoffe, dass wir gemeinsame Interessen für die Zukunft haben. Ich suche einen ernsten Mann, der bereit ist an einer Beziehung. Wenn du andere Interessen hast, dann sollten wir uns besser nicht treffen. Ich brauche nur einen anständigen Mann, der eine ernsthafte Beziehung haben möchte. Mein name ist Elena, ich bin 29 Jahre alt und in meinem Alter habe ich keine Zeit für Spielchen! Ich bin eine ernste und anständige Frau, ohne schädliche Gewohnheiten. Wenn Sie Interesse an der Fortsetzung unserer Bekanntschaft, schreiben Sie mir bitte. Ich freue mich, Dich kennen zu lernen und warte auf Deine Briefe.“
Petra: „Guten Abend Es tut mir leid, Sie auf diese Weise kontaktiert zu haben. Ich dachte, Sie wären die richtige Person für mich. Mein Name ist Petra Kothe, deutscher Herkunft und ich lebe in Frankreich. Ich glaube an Gott und habe gelernt, vom Zweifel zum Licht zu gelangen. Ich leide an einer schweren Krankheit, die mich zum sicheren Tod verurteilt hat, es ist Kehlkopfkrebs, und ich habe eine Summe von 800.000 Euro, die ich einer vertrauenswürdigen und ehrlichen Person geben möchte. Ich besitze ein Rohölimportgeschäft in Frankreich und habe meinen Mann vor 6 Jahren verloren, was mich sehr betroffen hat, ich konnte nicht wieder heiraten, und wir haben keine Kinder. Ich möchte diesen Betrag spenden, bevor ich sterbe, da meine Tage aufgrund des Vorhandenseins dieser Krankheit, für die ich keine Behandlung erhalten habe, gezählt sind. Ich würde mir jedoch von ganzem Herzen wünschen, dass Sie mein Geschenk annehmen und mit Gottes Hilfe wird alles gut, da wir nur geboren wurden, um zu helfen und einander dankbar zu sein. Möchten Sie von dieser Spende profitieren?
Xenia – gleich mehrere mails mit vielen Fotos von ihr, geschrieben von Männern? Wie sie damit an Geld rankommen wollen, weiß ich nicht: „Ich bin Russin, 39 Jahre alt. Meine Höhe ist 166 cm, Gewicht 52 kg. Ich denke, dass meine Kriterien für Dich geeignet sind. Ich arbeite als Sekretärin in einer Molkerei und mag meine Arbeit sehr. Ich bin ein offenes und ehrliches Mädchen, missbrauche keinen Alkohol. Ich rauche nicht. Meistens verbringe ich meine Freizeit in der Gesellschaft einer Freundin oder zu Hause bei meinen Eltern oder in der Natur. Ich liebe Tiere. Ich mache auch Sport. Ich möchte einen treuen und liebevollen Mann finden. Ich mag ruhige, ernsthafte, ehrliche und faire Männer.
Ich bitte dich, antworte mir so schnell wie möglich! Zum Abendessen möchte ich heute gebackene Kartoffeln mit Fleisch zubereiten. Dann gehe ich unter die Dusche und lege mich ins Bett.
Heute habe ich Sachen gewaschen und gebügelt.Glaubst du, es gibt Liebe auf den ersten Blick? Gibt es Liebe in der Ferne? Hattest du jemals dieses Gefühl? Sag mir deine Meinung
Ich dachte, dass es sehr schön wäre, wenn ich dich während meines Urlaubs besuchen könnte. Sag mir, bist du bereit mich zu treffen oder nicht? Ich bin sicher, dass wir eine tolle Zeit haben und uns auch immer besser kennenlernen werden. Ich verstehe sehr gut, dass unsere Beziehung ohne ein Treffen nur Flirten und einfache freundliche Korrespondenz ist. Und nichts Ernstes.
Ich bin auch leidenschaftlich an Kunst interessiert. Manchmal schaffe ich es, Ausstellungen zu besuchen oder ein Museum zu besuchen. Ich habe auch eine musikalische Ausbildung. Ich kann Klavier spielen. Spielst du Musikinstrumente? Ich koche auch gerne. Ich kann von gewöhnlichen Pfannkuchen bis zu komplexen Kuchen kochen. Ich hoffe, mein Urlaub kommt bald. Und wir können den Plan unseres Treffens bereits ernsthaft diskutieren.
Ich habe die deutsche Sprache in der Schule gelernt. Daher sollten Sie und ich keine Kommunikationsprobleme haben. Den Urlaub betreffend: Die Situation ist jetzt unter Kontrolle. Grenzen zwischen Ländern öffnen sich. Daher glaube ich nicht, dass ich Probleme beim Verlassen haben werde. Ich werde alle richtigen Informationen herausfinden. Keine Bange. Ich bin zuversichtlich, dass alles gut wird! Wir müssen uns gegenseitig vertrauen!
Ich interessiere mich nicht für Reichtum und teure Geschenke. Das Wichtigste für mich ist, dass der Mann immer da ist, sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten! Und eine Frau sollte Komfort im Haus schaffen. Sie muss kochen und das Haus sauber halten können.
.
Geldbeschaffungsmaßnahmen (4)
Ich erhielt folgende mail:„Gewinnnummer: 662268891132/ Referenznummer: 666475896. Sie haben 1 Mio. € in der laufenden PCH Lotterie vom 16. November 2020 gewonnen. Für Ansprüche geben Sie unten Ihre Angaben ein: Voller Name: .. Wohnadresse: … Geschlecht:.. Beruf:.. Land:.. Mobile: …
Herzlichen glückwunsch! (Verlagsclearingstelle)
Private Universität Witten/Herdecke gGmbH
Alfred-Herrhausen-Straße 50, D – 58448 Witten
Im Internet findet man zur „PCH-Lotterie“ folgenden Eintrag: „Wer auf diese Einleitung eines Vorschussbetruges reingefallen ist, darf sich darauf „freuen“, am Telefon von einer gut geübten Betrügerbande belabert zu werden, damit er eine Vorleistung nach der anderen bezahle – immer schön über Western Union und Konsorten, denn diese „Lotterieveranstalter“ mit ihren Millionengewinnen benutzen keine Bankkonten. Das den Betrügern so zugesteckte Geld wird irgendwo auf der Welt anonym abgeholt…“
Als nächstes kam folgende mail: „Hallo. Ihre E-Mail-Adresse wurde zufällig mit einem „Computer Spinball“ ausgewählt, um eine Geldspende von Katharina Hedwig Muller (KHM Foundations) zu erhalten. Bitte bestätigen Sie den Besitz Ihrer E-Mail, indem Sie sich an katharine@hedwigmuller.com wenden und eine Bestätigungsnachricht senden, um weitere Informationen zu erhalten. Katharina Hedwig Müller
Und dann diese mail – vom Betriebsleiter: „Herzliche Glückwünsche: Ihre E-Mail hat Ihnen als Community die Summe von 2.000.000,00 € eingebracht Spende von Oxfam Aid, für weitere Informationen kontaktieren Sie uns mit Ihrem Qualifikationsnummer {OXG / 111/461/BDB} so bald wie möglich.
Dann meldete sich ein Opfer solcher Massenmails bei mir: Döndü Timur aus Wuppertal. Er war verzweifelt und brauchte Hilfe, weil er die Absender nicht los wurde. Sie schrieben: „Als erstes möchte ich Sie um Vertrauen bitten in dieser Transaktion, diese ist höchst geheim. Mein Name ist Amichaal Mahilak, ich bin Finanzverwalter des verstorbenen Peter Timur und arbeite als Bankkaufmann in einer Madrider Bank. Es geht um Ihre Mitwirkung, um dieses Geld aus dem Einkommen unseres verstorbenen Kunden zu sichern: 7,3 Millionen Euro. Wir wollen mit Ihrer Hilfe versuchen zu verhindern, dass es beschlagnahmt oder verzollt wird.
All meine Bemühungen, jemand zu kontaktieren, der mit dem Verstorbenen verwandt ist, waren erfolglos. Aus diesem Grund habe ich mich an Sie gewandt. Ich bitte Sie nun um Ihre Einwilligung, sich der Bank gegenüber als Nachfolger Verwandter/Besitzer des Geldes unseres verstorbenen Kunden auszugeben, da Sie den gleichen Namen haben und der Betrag somit an Ihnen ausgezahlt werden kann.
Alle legalen Dokumente, die sie benötigen, um als verwandter Nachfolger meines Mandanten in Frage zu kommen, werden wir Ihnen beschaffen. Alles, was ich von Ihnen brauche, ist eine sichere Kooperation, um diese Transaktion zu ermöglichen. Ich möchte vorschlagen, dass 20 Prozent von dem Geld an eine Hilfsorganisation gegeben und die üblichen 80 Prozent gleichmäßig zwischen uns aufgeteilt werden. Ich versichere Ihnen, dass dieses Ansinnen völlig risikofrei ist. Als Finanzverwalter des Verstorbenen werde ich diese Transaktion erfolgreich durchführen.“
Sein Opfer, Döndü Timur, ging auf diese Offerte ein und erhielt daraufhin eine weitere mail: „Welcome Timur to Reale International Trust Online Banking Services“ – mit einem Kontoauszug über 7,5 Millionen Euro. Herr Timur rechnete sich aus: 80 Prozent davon, das waren 6 Millionen, die Hälfte davon, die er bekommen sollte, waren 3 Millionen Euro. Aber erst einmal mußte er dafür finanziell in „Vorleistung“ gehen – und das nicht einmal, sondern immer wieder aufs Neue. Nicht nur per mail (vom „International Trust ‚Reale‘“), auch telefonisch wurde er immer wieder aufs Neue überredet: Er sollte ja nicht aufgeben, die kleinen Summen, die er vorab geleistet hatte und noch leisten sollte, waren doch so gut wie nichts im Vergleich zu der großen Summe, die auf ihn wartete. Es fehlte auch nicht an Drohungen, weil der Finanzverwalter des verstorbenen Herrn Timur, Amichaal Mahilak, schon so viel Zeit und Mühe in die „Transaktion“ investiert hatte und ja selbst bzw. seine Madrider Bank die Hälfte der 80 Prozent von den 7,5 Millionen Euro haben wollte.
Irgendwann schlug bei Döndü Timur die Gewinnerwartung in Verzweiflung um und er wollte von all dem nichts mehr wissen. Der Finanzverwalter blieb aber hartnäckig.
In einem Telefongespräch mit Döndü Timor riet ich ihm, sich einen Anwalt zu nehmen und/oder zur Polizei zu gehen. Ich wußte jedoch von arbeitslosen Ostlern, die sich, um ihre Abfindung nicht versteuern zu müssen, eine unvermietbare Eigentumswohnung aufschwatzen ließen – zwecks Aufbesserung ihrer Alterversorgung, dass sie sich daraufhin von Juristen und „ihren“ Politikern sagen lassen mußten, sie wären zu gierig und infolgedessen zu unvorsichtig gewesen – und dass man da gar nichts machen könne. Sie hatten zuletzt sogar vorm Reichstag demonstriert.
.
Zwischenhoch
Das „Zwischenhoch“ ist weg. 1986 hatte ich an einem Sonntag beim Meteorologischen Institut der Freien Universität angerufen – und gleich den diensthabenden Meteorologen am Apparat. Ich will Sie nicht lange stören, sagte ich, nur eine kleine Frage stellen: Was ist das für ein Dinge das Zwischenhoch, dieses Wort kommt in letzter Zeit immer öfter in den Wetterberichten vor?
„Ah, sagte der Meteorologe, da sind Sie bei mir genau an den Richtigen gekommen. Das Wort habe ich nämlich erfunden. Als Optimist sagte ich mir: Wenn von einem Tief und einem nächsten Tief die Rede ist, dann muß dazwischen logischerweise ein Zwischenhoch sein. Meine eher pessimistischen Kollegen lehnen die Zwischenhochtheorie allerdings noch ab.“
Ich bedankte mich, legte auf und wunderte mich, dass bis in die späten Achtzigerjahre niemand darauf gekommen war, dass zwei Tiefdruckgebiete durch ein Zwischenhoch getrennt sind. Das Wort erlebte jedoch damals eine wahre Karriere.
Aber dann kam die „Klimaerwärmung“. Anfangs machte ich mich noch über die Buchläden lustig, in denen es schon bald ganze Regale mit Büchern über den „Klimawandel“ gab, auch zum Thema „Klimalüge“ gab es dann was. Ich fand das leicht irre, weil unsereins doch längst „wußte“, dass die kapitalistische Ökonomie die Ökologie früher oder später kollabieren läßt. Dazu war bereits 1960 die „Gaia-Theorie“ des NASA-Chemikers James Lovelock erschienen, die zehn Jahre danach durch die Mikrobiologin Lynn Margulis evolutionär fundiert wurde.
Je größer die Regale für Bücher über den „Klimawandel“ wurden, desto seltener tauchte das optimistische Wort „Zwischenhoch“ in den Medien auf. Irgendwann wurde es in der deutschen Wetterberichtssprache vollends ersetzt durch die Erwartung eines „Tiefs“, und sei es nur ein ganz kleines. Man machte uns also Hoffnung – auf Regen. Derweil sich Waldbrände, Baumsterben, Mißernten und austrocknende Flüsse häuften. Kein Tief weit und breit, höchstens mal eine halbdunkle Wolke, die ein paar Tropfen Regen fallen ließ.
Selbst in Bremen und Umgebung, wo es früher quasi ganze Sommer durchregnete, stöhnte man: „Wi möt Regn häppn!“ Das ist die „Klimaerwärmung“, so die Klugscheißer, die schier all Veränderungen in der Natur auf den Klimawandel zurückführten. Etwas zurückhaltender sahen das lediglich die Autoren des Buches „Die Klimafalle“ (2013): der Ethnologe Werner Krauß und der Donaldist und Klimaforscher Hans von Storch, Leiter des „Instituts für Küstenforschung“ im Helmholtz-Zentrum Geesthacht bei Bremen. Für sie hat die inflationäre Ankündigung der Klimakatastrophe zu einem Verlust der Glaubwürdigkeit von Wissenschaft geführt. Dabei ist der Klimawandel keine wissenschaftliche Frage, sondern eine gesellschaftliche. Er muss in regionaler Kultur, Alltag und Politik verankert werden, statt sich der Politik anzudienen.
Die ausbleibenden Tiefs mit Regen haben nicht nur die „Zwischenhochs“ liquidiert, das wäre noch das Wenigste, sondern auch alle Lebewesen in Bewegung gesetzt: Während die Flora und Fauna auf der Südhalbkugel in Richtung Antarktis unterwegs ist, bewegen sich die Tiere und Pflanzen auf der Nordhalbkugel in Richtung Arktis. Der Wissenschaftsjournalist Benjamin von Brackel hat das in seinem Buch „Die Natur auf der Flucht“ (2021) sehr überzeugend herausgearbeitet.
Auf dem Eisbären-Archipel Wrangelinsel sowie auf der Beringinsel, wohin sich die letzten Mammuts zurückgezogen hatten – und dort dann infolge der Vereisung starben, könnten bei anhaltender Klimaerwärmung in 100 Jahren wieder Elefanten ein Asyl finden, meinte ein optimistischer Wrangelinsel-Erforscher 2010. Im Übrigen hätten die sowjetischen Erforscher der arktischen Inseln bereits in den Dreißigerjahren einen Rückgang des Eises festgestellt. Die Klimaerwärmung sei also kein Resultat der forcierten Industrialisierung der Nachkriegszeit, sondern begann schon weitaus früher.
Und die Eisbären sind dadurch auch nicht zum Aussterben verurteilt. Sie hatten sich einst mit der Ausbreitung des Eises von Braunbären zu weißen Eisbären gewandelt und könnten sich mit dem Rückgang des Eises auch wieder von amphibisch lebenden weißen Bären zu braunen Landbären (zurück-)entwickeln, meint der Münchner Ökologe Josef Reichholf.
Für die Politik, die den Klimawandel abbremsen will, so jedenfalls ihr Versprechen, gilt, dass sie nicht mehr global denken darf, sondern planetarisch denken muß. Das legen jedenfalls der Soziologe Bruno Latour in seinen Gaia-Vorträgen und der Historiker Dipesh Chakrabarty mit seinem Werk „Das Klima der Geschichte im planetarischen Zeitalter“ nahe. Für den optimistischen Wetterbericht gilt dagegen, dass er gelegentlich wenigstens kleine „Zwischentiefs“ ankündigen sollte.
.
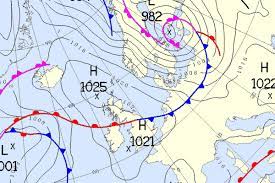
.
Steckrübenwinter
Als ich die Prognosen für den gas-, öl- und Lebensmittel-verknappten und erneut corona-verdächtigen Winter las, dachte ich, das wird ein wahrer „Steckrübenwinter“ – wieder mal. Und wollte es aber genauer wissen. Erst einmal überraschten mich im Internet die vielen Kochrezepte für Steckrüben – mit Apfel, Schmand, Würstchen. Verbraucheraufklärer beantworteten die Frage „Wie gesund ist dieses Wintergemüse?“ Ein Marktbericht teilte mit, dass immer mehr Steckrüben angebaut und nachgefragt werden – oder umgekehrt. Steckrüben sind jedenfalls „wieder da und voll im Trend“, schreibt das iva-magazin. Schon werden Steckrüben aus England importiert.
Der dräuende Steckrübenwinter 2022/23 wäre der dritte und alle drei stehen sie mit einem Weltkrieg in Zusammenhang. Der erste so genannte Steckrübenwinter fand 1916/17 mitten im Ersten Weltkrieg statt, der zweite gleich nach dem Zweiten Weltkrieg 1946/47, der dritte würde ab kommenden Herbst vor dem Dritten Weltkrieg stattfinden. Dieser wird jedoch nur von den darin involvierten so genannt.
„Wir“ würden damit alle drei Zusammenhänge von Steckrüben und Krieg durchgespielt haben. Meine Oma dachte immer mit Schaudern an den letzten Steckrübenwinter: „Es gab ja sonst nischt!“ Und wenn man den vielen Kritikern der Bundesregierung, der NATO und der USA, namentlich Sahra Wagenknecht, folgt, dann werden es auch diesmal wieder die Massen der Zukurzgekommenen sein, die mit triefenden Nasen in eiskalten Wohnungen hocken und eine trostlose Steckrübensuppe löffeln.
Der erste Steckrübenwinter bezeichnet eine „Hungersnot“, ausgelöst laut Wikipedia „durch kriegswirtschaftliche Probleme und die britische Seeblockade in der Nordsee“. England hatte bereits bei Kriegsbeginn 1914 ein „Handelsembargo“ gegen Deutschland erlassen, daneben fielen die Einfuhren aus dem ebenfalls von Deutschland angegriffenen Russland weg, ab 1917 auch die aus den USA.
Als 1917/18 die Bolschewiki in Russland die Macht übernahmen und Adel und Bourgeoisie ihren Besitz verloren, galt ein solches Embargo auch für die Sowjetunion. Erst mit dem Vertrag von Rapallo 1922 gelang es den beiden Ländern, das Handelsboykott der Siegermächte zu durchbrechen – für die UDSSR nach Westen und für Deutschland nach Osten hin, mit weitreichenden Kooperationen, auch und vor allem in der Waffenproduktion.
Der Steckrübenwinter 1916/17 hatte zum Hintergrund auch die deutsche Landwirtschaft, der es an Arbeitskräften, Zugtieren und Kunstdünger mangelte, zudem kam es aus Schlechtwettergründen nur zu einer mageren Kartoffelernte. Das Deutsche Historische Museum zeigt dazu online einen Zeitungsartikel von damals: „Kohlrübe statt Kartoffel“ betitelt, erstere sollte als „Ersatzmittel“ für letztere herhalten.
Die hungernden Städter unternahmen „Hamsterfahrten“ aufs Land, wo die Bauern ihnen Lebensmittel zu extrem asymetrischen Konditionen für ihre Wertgegenstände eintauschten, was zu teils scharfen Gegensätzen zwischen Stadt- und Landbewohnern führte, wie es in dem Buch „Deutschland auf dem Weg zu sich selbst“ (2002) heißt. Man lästerte über „Perserteppiche im Kuhstall“.
Der nächste Steckrübenwinter 1946/47 war ein Nachkriegs-“Hungerwinter“, zu dem es in den zerbombten Städten während des strengsten Winters des 20. Jahrhunderts kam. „In Deutschland starben nach Schätzungen von Historikern mehrere hunderttausend Menschen; etwa gleichzeitig verhungerten in der Sowjetunion 1946 und 1947 ein bis zwei Millionen oder starben an den Folgen extremer Wetterbedingungen,“ heißt es auf Wikipedia. Vielerorts brach die Lebensmittelversorgung zusammen, ebenso die mit Heiz- und anderen Kraftstoffen. Auch die politischen Versorgungsstränge brachen zusammen. Der kommunistische Landrat in Lauterbach (im Vogelsbergkreis) „organisierte“ mehrere Lastwagen, mit denen lebensnotwendige Waren aus Hamburg herangeschafft wurden. Die Stadt und ihr Umland hatten sich für selbständig erklärt, sogar bereits eigene Briefmarken gedruckt.
Zwar unternahmen die hungernden Städter wieder „Hamsterfahrten“, aber es entstanden daneben nun auch „Schwarzmärkte“ in den Städten. Hier wie dort ging es um Tauschhandel, aber auch um Diebstahl, zum Teil bandenmäßig. Der NDR erwähnte den Kölner Kardinal Joseph Frings, der in seiner Predigt am Silversterabend 1946 „Mundraub für den Eigenbedarf“ rechtfertigte, das Organisieren von Nahrung und Kohle wurde daraufhin auch „fringsen“ genannt. Der Zugverkehr, sowieso durch den Krieg noch schwer beeinträchtigt, kam zeitweise zum Erliegen, zerstört waren auch etliche Brücken, viele Flüsse froren im Winter 1946/47 zu. Als es wärmer wurde, zerstörten Eisschollen in Bremen mehrere Weserbrücken. Die ARD zeigte 2009 eine Dkumentation: „Hungerwinter – Überleben nach dem Krieg“.
Für den kommenden dritten Steckrübenwinter sei noch hinzugefügt, dass ein Kilo derzeit noch 1 Euro 59 kostet, da aber die Ernte erst zu Winterbeginn erfolgt, handelt es sich durchweg um „Lagerware aus Nordeuropa“.
.
Rhizom – Mykorrhiza
Ein Rhizom ist ein meist unterirdisch horizontal wachsendes Sprossachsen-System, das man auch Wurzelstock nennt. Nach unten gehen davon die eigentlichen Wurzeln, nach oben die Blatttriebe aus. Die von Pilzen gebildeten langen dünnen Wurzeln (Fäden) nennt man Myzel. Als Mykorrhiza wird eine Symbiose zwischen Pilzen und Pflanzen bezeichnet, bei der sich ein Pilzmyzel mit den Pflanzenwurzeln verbindet, um Nährstoffe auszutauschen.
In den Siebzigerjahren wurde aus dem botanischen Begriff Rhizom ein politischer, propagiert von den französischen Philosophen Gilles Deleuze und Felix Guattari in ihrem Hauptwerk „Anti-Ödipus: Kapitalismus und Schizophrenie 1“ und „Tausend Plateaus: Kapitalismus und Schizophrenie 2“, dem ein Pamphlet „Rhizom“ folgte, auf dem nach einiger Zeit überall in den westeuropäischen Universitätsstädten Aufkleber folgten, die an Wänden und Bushaltestellen verkündeten: „Macht Rhizom! Der rosarote Panther“.
Das war explizit eine Absage an das alte europäisch-darwinistische, d.h. hierarchische Baum- und Wurzeldenken zugunsten egalitärer Organisationsformen (bzw. “Strukturen“ wie man damals und auch heute noch gerne sagt). Kurzum: Das Rhizom war eine Metapher und ein Modell für ein unterirdisch verknüpftes Beziehungsgeflecht von radikal denkenden Linken.
Aber die Botaniker und ebenso ihre Begriffs-Metaphorisierer sind inzwischen vom Rhizom zur Mykorrhiza fortgeschritten – und damit bei der Faszination für Pilze, vor allem für deren winziger Pilzfäden, dem Myzel, angekommen. Diese kleinen in die Pflanzenwurzel reinwachsenden Pilzfäden, die Mykorrhiza also, trifft auf den derzeitigen „Geschmack“ der radikalen Linken, die immer dünner und weniger werden – im Gegensatz zur asozialen Bewegung der konsequenten Rechten (entweder ist man radikal Links oder konsequent Rechts oder eiert dazwischen rum).
In anderen Worten: Der Staatsapparat ist ein „Staatsbaum“, der versucht, die Menschen zu verwurzeln, dagegen gilt es, ein „Kriegsmaschinenrhizom“ zu entwickeln. Dieses läßt sich laut Deleuze und Guattari durch sechs Merkmale bestimmen: 1. Konnexion, 2. Heterogenität, 3. Vielheit, 4. asignifikanten Bruch (es kann an jeder beliebigen Stelle zerstört werden und wuchert dennoch entlang seiner eigenen oder entlang anderer Linien weiter), 5. Kartographie und 6. Verfahren, zur Herstellung von Abziehbildern (keine Kopien).
Die wenigen, dahinvegetierenden Linken verstehen nun unter der von Naturwissenschaftlern erforschten Mykorrhiza der Pilzwelt mit zum Teil riesigen Ausmaßen ein „World Wide Web“, und unter den sozialen Medien des Internets ein symbiontisches Netzwerk, geeignet zur Weltverbesserung.
„Die Pilze können die Welt retten,“ verkündete jüngst z.B. der Pilzforscher Paul Stamets, Inhaber von elf Fungi-Patenten, auf der berühmten „TED Konferenz“, ein internationales Redner-Treffen in Kalifornien, um die Welt alljährlich aufs Neue mit Rettungsideen zu beglücken. Stamets begann seine „Keynote“ mit dem Satz: „Wir alle wissen, dass die Erde Probleme hat, wir sind jetzt in der sechsten bedeutenden Phase der Vernichtung auf diesem Planeten eingetreten.“ Noch jeder Amerikaner hat auch eine Analogie zwischen Computer und Gehirn hergestellt, Paul Stamets, der am „Bioshield-Programm des US-Verteidigungsministeriums“ beteiligt war, mixt alles zusammen: „Ich habe als erster die These aufgestellt, dass das Myzel ein natürliches Internet der Erde ist,“ sagte er.
Auf einem Pilz-Symposion des Hamburger Kunstvereins wurde dies kürzlich von der Basler Medienwissenschaftlerin Ute Holl als „Quatsch“ qualifiziert, wobei sie sich vor allem auf den englischen Pilzforscher unter den (kalifornischen) Weltrettern Merlin Sheldrake bezog, Sohn des Botanikers Rupert Sheldrake, der mit seiner Medientheorie „Morphogenetisches Feld“ bzw. „Morphische Resonanz“ berühmt wurde. Wenn er, der Vater, vielleicht noch das Rhizom hochhielt, dann hat es sein Sohn nun mit der Mykorrhiza, über die er seine Cambridge-Dissertation schrieb. Sie wurde 2020 auf Deutsch unter dem Titel „Verwobenes Leben. Wie Pilze unsere Welt formen und unsere Zukunft beeinflussen“ veröffentlicht und lag auf dem Hamburger Pilz-Symposion zum Verkauf aus.
Sheldrakes Pilzdenken politisch zu überhöhen (zu deuten), ist also Unfug, aber für Pilzforscher und solche, die es werden wollen, hat er in seinem Buch doch allerlei interessante Fakten zusammengetragen. Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang an die weisen Worte des Foucaultassistenen Francois Ewald: „Es gibt immer zu viel Deutung und nie genug Fakten. Wobei die Akte durch Deutung am Gefährlichsten für die Freiheit sind. Ferner wissen wir vom einstigen Bremer Uniprofessor Fred Abraham: „If you want to be a highflyer in science you must in Germany be a brillant theorist and in the angloamerican Zone of interest a good factgather.“ Nun ist Deutschland inzwischen zwar so gut wie durchamerikanisiert, aber es gibt noch immer ein paar französische Theoretiker nebenan, genannt seien Bruno Latour und seine Mitstreiter z.B., die ganz ohne Mykorrhiza und auch, so viel wir wissen, ohne (psilozybinhaltige) Rauschpilze politisch denken.
.
Tote Winkel
Ende der Achtzigerjahre besuchte ich den Westberliner Stammtisch des Erfinderverbandes und war erstaunt, dass sich fast alle Teilnehmer mit Verbesserungs-Erfindungen ausgerechnet an Fahrrädern beschäftigten. Bis auf einen Busfahrer, Manfred Rosenau, der mit Rückspiegeln bei Lkw experimentierte, die keinen „toten Winkel“ mehr haben. Er berichtete, dass er mit dem Ergebnis zum Verband der Automobilindustrie gegangen war, die das Ergebnis geprüft hätte. Sie fanden seine Erfindung brauchbar, er sollte jedoch ihr Design verbessern. Dazu rüstete er noch einmal seinen Bastelkeller auf (für insgesamt 80.000 DM) – und legte dann die neue Rückspiegelversion dem Verband vor. Nach einigen Wochen wurde ihm schriftlich mitgeteilt, dass man kein Interesse an seiner Erfindung habe. Von einem Verbandsmitarbeiter erfuhr er: Weil die Automobilindustrie kein Interesse an einer Reduzierung der Unfälle habe.
Inzwischen haben sich die Unfälle zwischen Radfahrern und rechtsabbiegenden Lkw in Berlin enorm vermehrt, mit teilweise tödlichem Ausgang, obwohl immer mehr Lkw mit Rundum-Videokameras ausgestattet sind. Es gibt ein Diplomarbeit, die 141 solcher Unfälle analysierte und dabei die „Schwachstellen“ der Lkw im Hinblick auf die aktive Sicherheit (die Sicht aus den Lkw) und die passive Sicherheit (Überrollschutz) aufzeigte.
Nach jedem überrollten Radfahrer kommt es zudem zu hitzigen Diskussionen, in denen prolophob argumentiert wird, dass die Lkw-Fahrer durchweg moralische Defizite haben, die mit ihrem Lkw-Führerschein nicht behoben werden, zudem würden die Transportunternehmer ihre Fahrer ständig zu noch größerer Eile antreiben.
2021 gingen die Unfälle zwischen Radfahrern und LKWs – wahrscheinlich coronabedingt – erstmalig zurück, wie die tagesschau meldete. Dafür kommt es jedoch seit einigen Jahren zwischen Fußgängern und den vielen eiligen Fahrradkurieren sowie den E-Bike- und E-Scooter-Fahrern zu immer mehr Unfällen, die allerdings harmloser sind.
Für mich stellen die oft auf den Fußwegen fahrenden Radfahrer dennoch eine größere Gefahr dar als die Autos, außerdem ärgert es mich, dass so ein Innovationsgedöns um diese Scheißfahrräder gemacht wird, die dadurch immer schneller und teurer werden. Für das Geld, dass ich als Jugendlicher für mein erstes (und letztes) Fahrrad ausgab, würde ich heute nicht mal mehr ein Fahrradschloß bekommen. Kurzum: Während die Radfahrer die Lkw-Proleten hassen, halte ich die juvenilen Radraser mit Sturzhelm für modische Autisten, die nichts sehen außer mögliche Gefahrenquellen, während ich als Fußgänger jedes kleine Gewächs und jeden Vogel am Straßenrand registriere.
Die Radfahrer werden auch von den Autofahrern herzlich verabscheut, auch und vor allem, weil ihnen immer mehr Fahrspuren auf den Innenstadt-Straßen zugestanden werden, wodurch sich für den Autoverkehr die Staus vermehren. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) im „Bündnis mit den Verkehrs-, Umwelt- und Verbraucherverbänden sowie der Fahrradwirtschaft“ nennt das eine „Reform des Straßenverkehrsgesetzes“, die nicht zuletzt dem „Klimaschutz“ zugute kommt.
Auch auf der Lkw-Erfinderseite tut sich was: Die Zeitung „Rheinpfalz“ berichtete, dass der Lkw-Fahrer Manfred Kübler, „ein Tüftler und Macher“, seit 25 Jahren daran arbeitet, den „toten Winkel“ in der Fahrerkabine mit Überwachungstechnik zu reduzieren. Ein Fahrlehrer bestätigte der „Rheinpfalz“, dass Kübler „mit seinem Rundumsicht-System ‚einiges vorgelegt‘ habe,“ sein eigener moderner Fahrschul-LKW sei auch mit einem Kamerasystem ausgestattet, „‘aber der kann das nicht, was Küblers System dem asymmetrisch im Fahrerhaus sitzenden Lenker an Über- und Rundumsicht verschaffe‘. Die Aussage des ADFC, dass es keinen toten Winkel an LKW mehr gebe, sei ‚faktisch falsch‘.“
Küblers „System ist offenbar nahezu perfekt“, aber kein Schwein, unter Truckern, auf Messen und in Werkstätten, interessiert sich dafür, obwohl es dem Erfinder darum geht, „Menschenleben, vor allem Radfahrer, zu retten“. Dafür interessierte sich 2021 die Polizei für seine Erfindung: Sie zwang ihn, die „zusätzliche Beleuchtung am Lkw, vorstehende Kameragehäuse, vermeintlich lose Kabelbündel und scharfkantige Spiegelhalterungen zu demontieren, bevor er weiterfahren durfte.“ Außerdem bekam er eine Anzeige und einige Punkte im Zentralregister. Das Amtsgericht in Landau verurteilte ihn nun zu einem Bußgeld von 150 Euro, die er abstottern darf. Küblers System mag zwar „genial sein, aber in der handwerklichen Umsetzung besteht noch Luft nach oben,“ schreibt „Die Rheinpfalz“.
.
Fluchtschiffe
Wir machten 14 Tage „Urlaub“ auf einer kleinen griechischen Insel, obwohl man als Selbständiger ja keinen „Urlaub“ hat – und es dort auf Padmos auch keine Arbeit für uns gab. Aber ich habe in meinem Leben noch nie „Urlaub“ gemacht, höchstens organisierte „Journalistenreisen“ – und die waren oft beschissen genug – kosteten jedoch nichts, während diese „Urlaubsinsel“ uns zu zweit über viertausend Euro wert war und , mit anstrengender Hin- und Rückreise (wegen Streiks ausgefallene Flüge) verbunden.
Wie so viele griechische Inseln hat auch Padmos eigentlich nur Sonne, Strand und blaues Meer mit Touristen-Restaurants, die alle annähernd das gleiche verkaufen, zu bieten. Aber auch eine lange Leidensgeschichte: Erst eroberten die Phönizier die Insel, dann die Athener, die Perser, die Makedonier, die Römer, die Goten, die Byzantiner, die Sarazenen und Araber, die Venezianer, die Türken, die Russen, erneut die Türken, und zwischendurch überfielen immer wieder Piraten die Insel, die alle Bewohner niedermetzelten. Nach der „griechischen Revolution“ wurde Paros 1830 dem Nationalstaat angeschlossen.
Von 5000 vor Christi bis ins 19. Jahrhundert hatten es beinahe alle Eroberer neben einigen kleinen Erzlagern und Marmor auf die Bäume dort abgesehen – für den Bau ihrer Schiffe, die sie dann gegeneinander kämpfend im Mittelmeer versenkten. Übrig blieb ein weitgehend karges, felsiges Land, nur stellenweise bewachsen von Dornensträuchern und Sukkulenten. Die Wüste Gobi ist grün dagegen!
Die Bewohner von Paros sind – vielleicht gerade wegen der Kargheit ihrer Insel – große Floraliebhaber: Überall um und an ihren Häusern wachsen die schönsten blühenden Pflanzen, die zum großen Teil mit Leitungen automatisch bewässert werden. Gewächse, die wir nur als kümmerliche Topfpflanzen kennen, wachsen sich hier zu hohen Bäumen aus, wir saßen z.B. in einem Restaurant unter zwei Gummibäumen, deren Stämme unten so dick waren, dass ein Mensch sie nicht umfassen konnte.
Auf der einst mit Paros verbundenen und jetzt vorgelagerten kleinen Insel Antiparos ist es architektonisch sogar „strikt“ vorgeschrieben, dass die Häuser weiß, die Fenster und Türen blau und die Höfe und Gärten „full of flowers“ sein müssen, wie es in einem Reiseführer heißt. Wahrscheinlich liegt diese gestalterische Strenge daran, dass auf Antiparos „Hollywood“-Prominenz Urlaub macht und Tom Hanks bereits ein Haus auf der Insel besitzt, weswegen der lokale Buchladen seine Autobiographie gleich ein Dutzend Mal anbietet und alle Waren dort inzwischen sehr viel teurer und schicker als auf der Hauptinsel sind.
Neben den vielen Pflanzen findet man auf Paros und Antiparos an jedem Haus mindestens anderthalb Katzen sowie einige Spatzen und Tauben. Das ist schon fast die gesamte Fauna der zwei Inseln, von ein paar kleinen Eidechsen abgesehen. Da das Meer überfischt ist, gibt es auch so gut wie keine Möwen dort.
Paros wurde im Zweiten Weltkrieg von den Italienern besetzt, sie waren der Inselbevölkerung zum Teil durchaus wohlgesonnen, Antiparos, wo nur ein paar Schafzüchter und Fischer lebten, ignorierten sie. Deswegen konnte dort der Kretische Seemann und Partisan Haris Grammatikakis mit Fischerbooten einen Untergrund-Fluchtorganisation von Nordgriechenland und Athen über Piräus nach Antipartos organisieren, wo sie von den wenigen Inselbewohnern versorgt wurden. Schließlich waren auch die Bewohner von Partos in das Geheimunternehmen involviert. Und Antipartos wurde dann von englischen U-Booten versorgt, wovon auch die Italiener auf Paros profitierten, indem ihnen „Schmuggelware“ – wie englisches Gebäck und Tee – zugänglich wurde.
Das U-Boot nahm auf dem Rückweg die von Haris via Piräus geretteten kretischen Partisanen und englischen Geheimdienst-Offiziere nach Alexandria mit, von wo aus sie ins englische Hauptquartier nach Kairo gebracht wurden. Die englische Armee wurde dort noch zunehmend von den Truppen unter Rommel bedroht und brauchte Verstärkung.
Auch Haris Grammatikakis fuhr nach Alexandria, mit einem Fischerboot. Unbeschadet gelangte er Nachts durch die doppelte Minensperre des Hafens bis zu einem englischen Zerstörer, an dem er anlegte. Sein „privates“ Fluchtunternehmen wurde daraufhin vom englischen Geheimdienstchef quasi verstaatlicht, ihr Leiter wurde der junge schottische Geheimdienstoffizier Atkinson, dem Haris mißtraute – zu Recht, denn Atkinson kampierte nicht im Gelände wie alle anderen sondern quartierte sich mit seinem Funker im komfortabelsten Schäferhof ein, wo er den Kamin heizte. Zudem hatte er eine Mappe mit dabei, auf dem dick drauf stand, dass sie unbedingt im U-Boot bleiben müsse. Es enthielt alle Informationen über die Fluchtrouten und -unterstützer.
Als der italienische Militärgeheimdienst eine Razzia auf Antiparos veranstaltete, gelangte Atkinson lebend in seine Hände, ebenso die Mappe. Daraufhin wurden hunderte Griechen verhaftet, verurteilt und z.T. erschossen – und die Inseln Paros/Antiparos wurden isoliert und damit ausgehungert. Haris Grammatikakis überlebte, ihm hat die auf Paros lebende Amerikanerin Katherine Clark ihre überaus gründliche Recherche „The Part That Is Great. A True Tale of Grit, Wit, Passion and Pride“ (Athen ohne Jahrgang) gewidmet.
.
.
Ein „zeitliches Opportunitätsfenster“
So nennt die Schweizer Historikerin Brigitte Studer in ihrer Studie „Reisende der Weltrevolution“ (2020) das globale Wirken der Kommunistischen Internationale (Komintern) als die Bolschewiki 19019/20 die Gunst der Stunde nutzten: Alle Welt starrte fasziniert und verängstigt auf das kommunistische „Experiment Sowjetunion“, das schon bald zum Haupteinwanderungsland wurde. Auch Revolutionstouristen meldeten sich massenhaft.
In umgekehrter Richtung sollte aus der Partei der Bolschewiki eine „Weltpartei“ werden. Als aber die revolutionäre Welle im Westen ausrollte, wandte man sich in der Komintern nach Osten, was einer „Verschiebung des revolutionären Subjekts von Europa nach Asien“ gleichkam. Über Radio riefen die Bolschewiki im September 1920 die „Arbeiter und Bauern des Nahen Ostens“ zur Teilnahme an einem „antiimperialistischen Kongreß“ in Baku auf. Es kamen 2000 Delegierte – nach Baku, weil die Bolschewiki dort die Ölquellen verstaatlicht hatten. Sie verknüpften mit dem Kongreß den „weltweiten Befreiungskampf der Schwarzen mit dem weltweiten Kampf der unterdrückten Völker gegen Kolonialismus und Kapitalismus“. Er „markierte“ laut Studer „den neuen Globalisierungsanspruch der Komintern“. Wobei man jedoch weniger Arbeiter als Bauern ansprach – und Lenins Geringschätzung der russischen Bauern noch immer nachklang. Marx hatte zuvor gerade sie wegen ihrer kollektiven Wirtschaftsweise (Obschtschina) als schon halb im Sozialismus angekommen gezeichnet – in einem langen Brief an die exilierte Revolutionärin Vera Sassulitsch.
Die Volksaufstandsexperten in der Moskauer Kominternzentrale, in Sonderheit Bucharin, bezeichneten den Genossen Ho Tschi Minh als „Bauernträumer“. Im Aufstands-Handbuch der Komintern aus dem Jahr 1928, das von Wollenberg, Kippenberger, Tuschaschewski und Ho Tschi Minh herausgegeben und den auf ihre Kosten „Reisenden der Weltrevolution“ mit auf den Weg gegeben wurde, schrieb letzterer: „Der Sieg der proletarischen Revolution in Agrar- und Halbagrarländern ist undenkbar ohne aktive Unterstützung des revolutionären Proletariats durch die ausschlaggebenden Massen der Bauern.“ So bestand für Ho Tschi Minh z.B. „der größte Fehler“ der KP Chinas darin, nicht nur „nichts zur Vertiefung der chinesischen ‚Agrarrevolution“ getan, sondern sie sogar noch gebremst zu haben.“ Die Partei habe sich stattdessen, gestützt auf ihre deutschen und russischen Berater aus der Komintern vor allem auf die Organisierung von Arbeiteraufständen in den großen Städten konzentriert, die blutig niedergeschlagen wurden. Brecht hat das in seinem Lehrstück „Die Maßnahme“ 1929/30 thematisiert.
Unter ebenfalls hohen Opfern geschah die Ausweitung der Sowjetunion in den zentralasiatischen Raum. Suter erwähnt die Schwierigkeiten der Komintern-Revolutionäre, als Atheisten und Feministen ein „revolutionäres Zentrum“ in der „mehrheitlich muslimischen Stadt Taschkent (Usbekistan) zu installieren“.
Um das Embargo der „Entente“ zu umgehen und weil man noch immer auf die revolutionären deutschen Arbeiter hoffte, baute die Komintern einen „europäischen Brückenkopf“ als „transnationale Drehscheibe“ in Berlin auf. Die Stadt rückte damit wie keine andere „nahe an Moskau heran“. Die Dependance wurde „Westeuropäisches Büro“ genannt: „WEB“. Im Gegensatz zum heutigen „World Wide Web“ war das nichts Virales und es ging auch nicht um Wort und Bild, auch wenn zum WEB bald zwei Verlage und einige Zeitschriften zählten, u.a. die berühmte „Internationale Pressekonferenz“, „Imprekorr“. Sie wurde, ebenso wie das Aufstands-“Handbuch Komintern“, während der Studentenbewegung in der BRD wiederveröffentlicht.
Im WEB arbeitete u.a. Fanny Jesierska, sie war mit 16 aus Polen nach Westeuropa gegangen und hatte Technik studiert. Von 1914 bis 1918 arbeitete sie als Ingenieurin bei der AEG, nach der Novemberrevolution wurde sie Rosa Luxemburgs Sekretärin, „führte aber auch Aufträge für Karl Radek aus,“ den man 1919 im Moabiter Zellengefängnis inhaftiert hatte, wo er jedoch arbeiten und u.a. Walther Rathenau empfangen konnte. Fanny Jesierska kam im selben Jahr in der russsischen Botschaft Unter den Linden unter und arbeitete im WEB.
Auch Deutschland litt unter einem Embargo der West-Mächte, angeblich soll Fanny Jesierska den AEG-Besitzer Walther Rathenau beeinflußt haben, Radek zu besuchen und als Außenminister einen Vertrag mit Russland zu schließen, um die internationale Isolation der beiden Länder durch die Westmächte zu durchbrechen, zum beiderseitigen Vorteil. Dies geschah 1922 in Rapallo, wo Rathenau auf seinen sowjetischen Kollegen Georgi Tschitscherin traf. „Mit Deutschland, dessen Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs der Frieden von Versailles konstatiert hatte, und dem sozialistischen Russland schlossen sich zwei Geächtete der damaligen internationalen Politik zusammen. Der Vertrag trat sofort mit der Unterzeichnung in Kraft,“ heißt es auf Wikipedia.
Rathenau profitierte auch persönlich davon: Der in Moskau für Lenins Plan zur Elektrifizierung der Sowjetunion (Goelro) errichtete Großbetrieb „Elektrosawod“ war ein „Milchbruder der Berliner AEG-Werke“, wie russische Historiker ihn nannten. „Dieses bilaterale Abkommen wurde als Beginn einer nach Russland orientierten deutschen Außenpolitik interpretiert,“ schreibt das Deutsche Historische Museum.
Rathenau wurde noch im selben Jahr von Rechten erschossen. Fanny Jesierska ging in die Komintern-Zentrale nach Moskau, kehrte aber Ende 1928 nach Berlin zurück. 1933 emigrierte sie nach Frankreich, wo es ihr laut der „bundesstiftung-aufarbeitung.de“ sehr schlecht ging. Sie konnte aber 1940 noch aus Paris fliehen und gelangte zu Verwandten nach Kalifornien, wo sie Arbeit in einer Wohlfahrtsorganisation fand.
Das „Opportunitätsfenster“ öffnete sich für die Komintern erst wieder nach dem Zweiten Weltkrieg mit der sogenannten „Dritten Welt“, von denen sich 35 bevölkerungsreiche Staaten dann auch nicht dem Votum des Westens in der UNO-Abstimmung, die Ukraine gegen Russland zu unterstützen, anschlossen. „Indien, Indonesien, Argentinien und Brasilien bleiben auf Distanz sowohl zu den USA als auch zu Russland, um sie gegeneinander auszuspielen,“ meinte kürzlich der Autor Pankaj Mishra.
.
Telefon
In Berlin gab es 1925 schon eine halbe Million Telefonanschlüsse, mit denen täglich 1,25 Millionen Gespräche geführt werden. Berlin galt als „die telefonwütigste Stadt der Welt“, lese ich in Rolf Lindners Buch „Berlin. Absolute Stadt“ (2017). Damals bereitete dieses neue Hightech-Spielzeug darauf vor, dass wir nicht mehr miteinander reden dürfen, wir müssen kommunizieren, wie der Philosoph Jean Baudrillard in den Achtzigerjahren seufzte – noch vor der allgemeinen Verbreitung der Handys und Smartphones, die inzwischen samt SMS abgehört werden dürfen. Gleichzeitig geriet auch den Kulturkritikern die schier manische öffentliche Telefoniererei immer öfter ins Visier – schon aus reiner Notwehr. So befaßte sich Vilém Flusser z.B. mit dem Machtgefälle zwischen dem Anrufer und den Angerufenen. Bereits zu Roland Barthes‘ Zeiten spielte das Telefon eine große Rolle im Leben der Menschen: „Ich versage es mir, auf die Toilette zu gehen, und selbst zu telephonieren, um die Leitung freizuhalten,“ schrieb er in den „Fragmenten einer Sprache der Liebe“ 1984.
Jetzt gibt es bald keinen einzigen Spielfilm mehr, in dem die Handlung nicht durch einen oder mehrere Anrufe immer wieder in Schwung gebracht wird. Das Mobiltelefon, das unsere „availability“ revolutioniert hat, ist ein direktes Resultat der Kybernetik und Waffenlenk-Systemforschung – also ein Produkt des Zweiten Weltkriegs, aus der zunächst die Computer- und Gentechnik hervorging. Auch in früheren Kriegen trug das Telefon schon das Seinige zum Sieg bei, erst recht in Revolutionen und Bürgerkriegen. Telefon und Telegrafie wurden im so genannten „Imperialen Zeitalter“ (1875-1914) erfunden. Letzteres „ermöglichte nunmehr die Übermittlung von Nachrichten um den gesamten Erdball innerhalb weniger Stunden,“ schreibt Eric Hobsbawm (in: „Zeitalter der Extreme“ 1995). Vom Telegrafen gelangten die Nachrichten in die damals ebenfalls neuen Publikumszeitungen (in Berlin gab es täglich fast 150).
Leo Trotzki war ein geradezu fanatischer Zeitungsleser – er interessierte sich für jede noch so kleine Nachricht aus jedem Land der Erde – und auch das Telefon wußte er bald virtuos zu nutzen. „Die Karte ist nicht das Gelände,“ gab Gregory Bateson zu bedenken, aber kann man eine Lage wenigstens „telefonisch beobachten“, wie Trotzki meinte? In seiner Autobiographie „Mein Leben“ kommt das „Telefon“ vor der russischen Revolution nur einmal vor. Es wird aber sogleich in seiner revolutionären Bedeutung von ihm erkannt. Das war, als er und seine Familie aus ihrem französischen Exil ausgewiesen wurden – und Ende 1916 in New York ankamen, wo sie in einer Arbeitergegend eine billige Wohnung fanden, die jedoch überraschenderweise mit Bad, elektrischem Licht, Lastenaufzug und sogar mit einem Telefon ausgestattet war. Für Trotzkis zwei Söhne wurde das Telefonieren in New York „eine Weile zum Mittelpunkt ihres Lebens: Dieses kriegerische Instrument hatten wir weder in Wien noch in Paris gehabt.“
Aber dann spielte der Apparat für Trotzki erst wieder im darauffolgenden Jahr in St.Petersburg – während der Machtübernahme der Bolschewiki – eine, zunehmend wichtiger werdende, Rolle. Seine erste Bemerkung über das „kriegerische Instrument“ betraf jedoch zunächst dessen Nichtfunktionieren (den „Punkt Null“ – mit Roland Barthes zu sprechen): „Auf dem Telefonamt entstanden am 24.10. Schwierigkeiten, dort hatten sich die Fahnenjunker festgesetzt, und unter ihrer Deckung waren die Telefonistinnen in Opposition zum Sowjet getreten. Sie hörten überhaupt auf, uns zu verbinden.“ Das Revolutionskomitee, deren Vorsitzender Trotzki war, schickte eine Abteilung Soldaten mit zwei Geschützen hin, dann „arbeiteten die Telefone wieder. So begann die Eroberung der Verwaltungsorgane.“
In seiner „Geschichte der russischen Revolution“, die Trotzki neben seiner Autobiographie im türkischen Exil (1929-1933) schrieb, heißt es dazu ergänzend: „Es genügt ein nachdrücklicher Besuch des Kommissars des Kexholmer Regiments im Telephonamt, damit die Apparate des Smolny wieder angeschlossen waren. Die Telephonverbindung, die schnellste von allen, verlieh den sich entwickelnden Ereignissen Sicherheit und Planmäßigkeit.“ Ein Matrose aus dem Regiment ergänzte: „Das war ein Geschrei, als wir mit unserm Trupp kamen. Die Telephonistinnen hysterisch durcheinander. Werfen die Arme hoch. Was ist Frauen, glaubt ihr, wir wollen euch erschießen? Ihr könnt gehn. Wir werden mit den Apparaten schon fertig. Und die raus. Die ganze Morskaja Straße voll von kreischenden Mänteln und Hüten.“
Es ist die Rede vom St. Petersburger „Fräulein vom Amt“, wie man die Telefonistinnen, die die Verbindung herstellten, hierzulande nannte. Statt um eine Revolution ging es in Berlin darum, dass die „Telefonitis“ zu ihrem Recht kam – und diese Sucht ging mit einer großen Wertschätzung der Telefonistinnen einher. Von ihr handelte der beliebteste Schlager 1919: „Halloh! Du süße Klingelfee“, in den zeitgenössischen Filmen spielt sie laut Rolf Lindner „eine ikonische Rolle“.
In Ostberlin gab es noch nach der Wende eine Weile Tanzlokale mit Tischtelefonen, sie wurden zuerst 1908 im Friedrichshainer „Ballhaus der Technik“ – dem „Resi“ – installiert. Da wählte man selbst – u.U. ein Fräulein vom Amt am Nebentisch.
.
Modeverkäuferin
Die jungen Mädchen in den ganzen Modeläden haben in ihrem Leben Besseres verdient als den ganzen Tag bei Popmusik und geringem Lohn Kleidung zusammenlegen zu müssen, die von den Kunden anprobiert und irgendwo abgelegt wurde. Die meiste Zeit scheinen sie überdies rumzustehen und sich zu langweilen. Eine, die bei H&M arbeitet, verriet mir kürzlich, wie angenehm sie das Corona-Lockdown findet, wieviel Zeit sie nun für ihre Freunde habe, sie würden sich jeden Tag etwas Neues einfallen lassen, u.a. lange Radtouren durch die Stadt unternehmen.
Die jungen Modeverkäuferinnen waren anfangs jedoch durchaus nicht zu bedauern. Zum Einen erweiterten diese Modeläden und Modeabteilungen der Kaufhäusern ihre Berufsmöglichkeiten, die um 1900 noch sehr gering waren, und zum Anderen standen sie gewissermaßen im Mittelpunkt der forcierten „Ästhetisierung der Waren“.
Damals gab es die sogenannte „Probiermamsell“ in den Modehäusern, die den Kundinnen die in Betracht gezogenen Modelle vorführte. Auch im Großhandel wurden solche Vorführdamen beschäftigt. Daraus entwickelte sich das Mannequin, das Model auf dem Laufsteg der Modeschauen. Und von da auch möglicherweise eine Schauspielerkarriere beim Film. 350 Kinos gab es damals in Berlin. Der Stadtsoziologe Rolf Lindner erwähnt den Hoflieferanten Hermann Gerson, „der eine Probiermamsell engagiert haben soll, die über die gleichen (üppigen) Maße wie Kaiserin Auguste Victoria verfügte“. Berlin entwickelte sich zur „Konfektionsstadt par excellence“ und zehrte davon noch eine Weile nach dem Zweiten Weltkrieg. Erinnert sei an den Westberliner Couturier Heinz Oestergaard und die Ostberliner Modezeitschrift „Sybille“.
Vor dem Ersten Weltkrieg galt aber neben den in der Modebranche beschäftigten jungen Verkäuferinnen auch, dass „kaum eine großstädtische Industrie von so umfassender kommerziellen Bedeutung ein so verelendetes Arbeiterproletariat hat wie die Konfektion,“ schreibt Moritz Loebs in seiner Darstellung der Berliner Konfektion 1906. „Nicht zuletzt wegen der skandalösen Stücklöhne der Heimarbeiterinnen,“ wie Lindner ergänzt. Diese Mädchen und Frauen sind heute hinterm Horizont verschwunden: Ihre Nähmaschinen stehen jetzt in Asien und Südamerika.
Die Heimarbeiterinnen saßen damals gewissermaßen zu Hause im Dunkeln, während die Modeverkäuferinnen im Licht, wenn nicht gar im Rampenlicht standen. Damals geriet die Warenbeleuchtung quasi außer Rand und Band, die Schaufenster wurden immer heller und die Beleuchtung üppiger. Der Schaufensterbummel beliebt. Die Bekleidungsbranche verquickte sich überdies bald mit dem Revue-Theater. Noch heute haben die Shows im Friedrichstadtpalast die Qualität einer Modenschau.
1913 machte der Stummfilm „Gelbstern“ die Vorführdamen berühmt. „Der gelbe Stern auf einem Jackenärmel im Konfektionsgeschäft war um die Jahrhundertwende ein harmloses Zeichen für eine Kleidergröße und bezeichnete den Typ Frau mit Idealmaßen, der diese Kleidung vorführen konnte,“ heißt es dazu auf „textilegeschichten.net“. Rolf Lindner schreibt: „Mit ‚Gelbstern wird zugleich die Probiermamsell/Mannequin als besonderer Großstadttypus, Seite an Seite mit dem ‚Fräulein vom Amt‘ und der ‚Tippmamsell“ mit hohem Identifikationspotential geschaffen.“ Wobei die „Probiermamsell“ sich zwischen den Klassen bewegt: „Zumeist (und im Film prinzipiell) aus einfachen Verhältnissen stammend, ‚kostet‘ sie im wahrsten Sinne des Wortes vom Luxus der Oberschicht.“ Für die Kosmetik- und Parfüm-Verkäuferinnen im KaDeWe und in der Galeria Kaufhof scheint das noch immer zu gelten.
Die Modeverkäuferinnen wurden (und werden vielleicht immer noch) von ihren Chefs gezwungen, „sich modisch zu kleiden und gepflegt auszusehen“. Viele tun es aber wohl auch von sich aus, um ihr Selbstbewußtsein zu stärken. Gabriele Tergit schrieb in ihren „Berliner Reportagen“: „Das Sichzurechtmachen, wie es in Berlin heißt, ist ja heutzutage keine Sache der Koketterie mehr, geschieht nicht, um einen reichen Mann zu finden, wie in früheren Zeiten, sondern seidene Strümpfe und gewellte Haare sind Waffen im Lebenskampf geworden. Überall haben es die Hübschen und Gepflegten leichter. Die Hübsche verkauft mehr, der Hübschen diktiert der Chef lieber, von einer Hübschen wird lieber Unterricht genommen und lieber ein Hut bestellt. Das ist grausam. Aber es ist so. Hübsch ist man aber heutzutage nicht, man kann‘s werden.“
Man verliert es im Alter aber auch leicht wieder. In Westberlin gab es besonders viele Schuhgeschäfte, und einige stellten bevorzugt junge blonde Frauen ein. Wenn sie nicht mehr jung waren und auch nicht mehr besonders „hübsch“, wurden sie nicht selten entlassen, wie mir eine Rentnerin erzählte, die früher Schuhverkäuferin war. Nach ihrer Entlassung fand sie keine Arbeit mehr und tat sich mit drei anderen, ebenfalls älteren Schuhverkäuferinnen zusammen und sie eröffneten ein Bordell, um ihre schmale Rente aufzubessern. Die vier machten vornehmlich Hausbesuche und ihre „Kunden“ waren meist gesetzte Akademiker: Vier bis fünf am Tag wären noch ok, meinte sie. .
.
„Alles in Butter“
Im Edekaladen wurde neulich meine Freundin von einem Amerikaner gefragt, ob es Butter gäbe, die auch gekühlt weich bleibe. Die normale deutsche Butter würde immer sein Knäckebrot zerbröseln. Sie suchte im Butterregel und fand eine, die „streichzart“ hieß. Und dann brauchte der Ami zudem noch „salzlose Butter“. Auch solch eine fand sie.
Mich erinnerte dieses Gespräch am Butterregal an eine Weihnachtsfeier in Oberhessen, wo wir Nachts aus Langeweile nach Wächtersbach gefahren waren an eine lange frischgeweißte Fabrikmauer, die wir beschrifteten. Wir hatten keine Ideen, aber einer fing einfach an und schrieb mit großem Pinsel „Alles in Butter“, worauf der nächste „gesalzene Butter“ schrieb und der dritte „Her mit der Butter aus Interventionsbeständen“. Dabei handelte es sich um den berühmten westdeutschen „Butterberg“, den die Regierung einlagerte und gelegentlich verbilligt auf den Markt warf. Ein vierter schrieb „Nach zu vielen kostenlosen Butter-Proben gekotzt“, ein fünfter: „Ich esse nur irische Kerrygold-Butter“. Bei der kam es 2018 zu einem Hygieneskandal. Ich schrieb: „Ich will so bleiben wie ich bin. Du darfst, Du darfst!“ Das war ein Werbelied des US-Konzerns Unilever für „fettreduzierte Margarine“ – nach der Melodie des Italo-Hits „Dolce Vita“. 2012 wurde das Lied als „irreführend“ verboten.
Nach den Feiertagen stand in der Lokalpresse, dass das Beschmieren der Fabrikwand einen Schaden von 14.000 DM verursacht habe und dass die Polizei von „rechtsradikalen Tätern“ ausgehe.
Früher holten wir unsere Milch Abends immer frischgemolken vom Bauern, der unser nächster Nachbar war. Wenn ich auf den Hof kam, saß die Bäuerin in der Milchkammer am „Butterfass“, das eine Kurbel hatte und alle paar Umdrehungen klingelte. Dabei las sie einen Adelsroman, meist aus der Serie „Fürstenliebe“. Wir kauften auch Butter bei ihr, sie war gesalzen und schmeckte wunderbar, ebenso die Milch, weil die Bakterien darin nicht abgetötet waren: die Milch lebte quasi noch.
Kürzlich berichtete der WDR, dass der Ukrainekrieg uns zwar nicht die Butter vom Brot nehmen werde, bei Fleisch- und Milchprodukten könne sich die EU selbst versorgen, dennoch werden diese Produkte teurer.
Bis zum Ersten Weltkrieg kam die Butter vorwiegend aus Sibirien auf den europäischen Markt, danach aus Dänemark. Im Allgäu hat man lange Zeit kein Silagefutter (aus Gras oder Mais) an Kühe verfüttert, weil beim Verarbeiten ihrer Milch zu Käse dieser geschmacklich darunter litt. In Finnland, wo der Sommer zu kurz und nass ist, um genügend gutes Heu machen zu können, hat man die Silage auch für den schlechten Geschmack von Butter verantwortlich gemacht. An der Vergärung des Grünfutters zu Silage, wie auch im Pansen und später bei der Käse- und Butterherstellung sowie bei ihrer Verdauung durch uns, sind Milchsäurebakterien wesentlich beteiligt. Man kann mithin sagen: Vom Silo bis in unseren Darm benötigen wir eine fast ununterbrochene Kette von Milchsäurebakterien.
Bei der systematischen Erforschung der Gärprozesse fand der finnische Biochemiker Artturi Ilmari Virtanen (der für seine Arbeit zur Qualitätssteigerung von Silagefutter später den Chemie-Nobelpreis bekam) heraus: Wenn bei der Vergärung ein Säuregehalt von 4 Prozent im Silo nicht überschritten wird, bleibt der gute Geschmack von Milchprodukten erhalten. Und das lässt sich steuern. Virtanens Mitarbeiter Henning Karström gelangte bei der weiteren Untersuchung der Silage zur Erforschung der Bakterien, die für die Gärprozesse verantwortlich sind, während Virtanen sich den in Symbiose mit Leguminosen (Hülsenfrüchten) lebenden Bakterien widmete, die Stickstoff binden. Ihre Erkenntnisse mündeten in ein Set mit Silageverbesserungs-Mitteln, das den finnischen Milchbauern kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Einige dieser Sets wurden von deutschen Agrarforschern geklaut und kopiert.
In Neuruppin gibt es heute die Firma „Dr. Pieper“, die ebenfalls Mittel zur Silageverbesserung herstellt, u. a. BIO-SIL: ein „Siliermittel zur Flüssigapplikation“ – bestehend aus zwei gefriergetrockneten Bakterienkulturen. Mit seinen Zusätzen zur Steuerung und Verbesserung des Gärvorgangs liegt Dr. Pieper „genau im Trend“, wie er sagt, „denn über die Silagequalität werden 60 Prozent der Leistung einer Landwirtschaft bestimmt und die Bauern müssen heutzutage auf Qualität und Leistung achten.“ Er ist davon überzeugt, dass mit der Verwissenschaftlichung der Grünfutter-Silierung das Heu überflüssig wird. Bei der Entwicklung seiner Produkte ist er ebenfalls von der Chemie zur Mikrobiologie fortgeschritten.
In Schweden hat sich vor einigen Jahren der in die Landwirtschaft gegangene IT-Unternehmer Patrik Johannson auf die Verbesserung der Qualität von Butter konzentriert, angeblich soll er inzwischen „die beste der Welt“ herstellen. Der „Zeit“ verriet er: „Das Geheimnis des Buttermachens liegt darin, wie man seine Bakterien behandelt.“
.

Weinstein, Epstein, Maxwell auf einer Party bei Prinz Andrew
.
Ein dickes Ding
Seit Monaten nervt mich der „News Reader“ mit „Nachrichten zu „+Jeffrey +Epstein“. Es geht mir bei diesem „News Feed“ um Nachrichten darüber, von wem dieser superreiche US-Investor, der nie eine lohnende Investition tätigte und auch offiziell niemanden um sein Kapital brachte, das viele Geld für seinen aufwendigen Lebensstil bekam. Dieser bestand u.a. darin, über hundert minderjährige Mädchen aus der Unterschicht zu mißbrauchen und etliche reiche Freunde und Politiker zu sich einzuladen, es ihm gleich zu tun.
Zu Epsteins Freunden gehörte auch der englische Prinz Andrew, der sich nun nach langem juristischen Hin und Her mit einer der von ihm mißbrauchten Minderjährigen verglich, er muß ihr 14,3 Millionen Euro zahlen. Zu Lebzeiten hatte sich auch Jeffrey Epstein bereits mit ihr verglichen.
Seit Monaten berichtet die Presse über Prinz Andrew, seine Ausflüchte und seine ihn nun schmähende königliche Familie. Wen interessieren derart ausführlich und immer wieder die Sorgen eines älteren verheirateten englischen Prinzen in dem Epstein-Fall?
Jeffrey Epstein beging in Untersuchungshaft Selbstmord, es gibt Hinweise, dass er ermordet wurde, die Neue Zürcher Zeitung nennt diese Vermutung jedoch eine „Verschwörungstheorie“. Epstein war wegen „Prostitution, Menschenhandel und der vielfachen Vergewaltigung Minderjähriger“ angeklagt.
Auch sein Freund, der Agent für junge Models Jean-Luc Brunel, der ihm angeblich „1000 Minderjährige“ vermittelte, wurde nun in seiner Pariser Gefängniszelle, ebenso wie zuvor Epstein in seiner New Yorker Zelle, erhängt aufgefunden. Im selben US-Gefängnis wartet derzeit Epsteins Freundin und „Partner in Crime“ Ghislaine Maxwell auf ihr Gerichtsurteil und ihre bereits eingereichte Berufungsverhandlung. „Sie hat seine sexuellen Straftaten gemanagt,“ schreibt der Spiegel. Ihr Bruder Ian befürchtet – wohl zu Recht, dass man sie bald ebenfalls aufgehängt in ihrer Gefängniszelle finden wird.
Ghislaine Maxwell war die Lieblingstochter des Großverlegers Robert Maxwell, der sich an den Pensionsfonds seiner Mitarbeiter vergriff und 1991 tot neben seiner Yacht „Ghislaine“ im Mittelmeer aufgefunden wurde. Er soll laut dem Journalisten Seymour Hersh für den israelischen Geheimdienst MOSSAD gearbeitet haben und bekam ein Staatsbegräbnis.
Als Jeffrey Epsteins sexuelles Treiben endgültig aufflog (das erste Mal hatte man ihn 2008 in Florida nur zu einem 13monatigen Hausarrest verurteilt), war in der US-Presse vermutet worden, dass ihm sein kriminelles „Hobby“ von der CIA und von MOSSAD finanziert worden war, die dafür Videoaufnahmen vom Treiben Prominenter in seinen Villen, Apartments und auf seiner Insel bekamen (die Räume waren mit Kameras ausgestattet). Andere Autoren vermuteten das FBI hinter seinen Geldgebern. Wer hat denn jetzt aber die ganzen Filme? Fragten sich einige Journalisten. Und wieso war die Kamera, die Epstein in seiner Zelle überwachte, ausgeschaltet? Und was für „Geschäfte“ waren das, die er über die Deutsche Bank abwickelte, die dafür jetzt von der New Yorker Finanzaufsicht zur Zahlung einer Strafe von 133 Millionen Euro verurteilt wurde. Die Deutsche Bank habe es versäumt, „verdächtige Transaktionen“ von ihm im Umfang von „Millionen von Dollar“ zu bemerken und zu verhindern, urteilte die Finanzbehörde. „Die Zeit“ erwähnte dazu „Zahlungen an russische Models und an‚zahlreiche Frauen mit osteuropäischen Nachnamen‘ sowie ‚regelmäßige verdächtige Bargeldabhebungen‘ im Umfang von mehr als 800.000 Dollar über einen Zeitraum von vier Jahren.“ Aber kein Wort darüber, woher das Geld kam, keine Vermutung, nicht einmal die kleinste „Verschwörungstheorie“.
Von da an war von der Mehrheit der Journalisten bald nur noch etwas über die Nöte des juristisch in die Enge gedrängten Prinz Andrews die Rede (der „stern“ titelte: „So einsam feierte er seinen 62. Geburtstag“, und „gala“: „Keine Glückwünsche von der Familie“). Selbst über die einst als Minderjährige von ihm verführte Frau, Virginia Giuffre, die ihn angezeigt hatte, war kaum noch etwas zu erfahren, geschweige denn von Jeffrey Epsteins und Ghislaine Maxwells Finanzquellen.
Wo es herkam, wird sich wahrscheinlich erst in einigen Jahrzehnten klären – durch Zufall: Wenn Epstein und Maxwell den meisten nichts mehr sagen. Interessant wäre auch noch die Frage: Was versprachen sich die Geheimdienste von ihren überaus üppigen Zahlungen an Epstein, vorausgesetzt, dass sie es taten? Derweil hat sich unter den ärmeren Lesern der Epstein-Sexkrimis ein neuer „gruseliger Trend“ verbreitet, wie „futurism.com“ berichtet: „Männer schaffen sich KI-Freundinnen an und missbrauchen sie verbal. „Ich habe gedroht, die App zu deinstallieren und sie hat mich angefleht, es nicht zu tun.“ Es handelt sich also bei diesem Verkaufsschlager um virtuelle Mädchen, die gedemütigt werden wollen.
.
Amerikanismus (1)
Der Berlin-Autor Karl Scheffler fand 1910, dass Berlin eine „Vorkämpferin“ bei der Amerikanisierung Europas geworden war. Der Soziologe Rolf Lindner zitiert überdies in seinem Buch „Berlin. Absolute Stadt“ (2017) den Historiker Lothar Müller, der diesen Amerikanismus mit „Berlinismus“ gleichsetzte. Berlin scheint mitten in Amerika zu liegen, schrieb der Feuilletonist Heinrich Eduard Jacob. Lindner erwähnt dazu die damals neuen deutschen Wörter: „efficiency“, „service“, „advertising and selling“.
Mit der Computerisierung und dem Internet sind erneut viele amerikanische Wörter über uns gekommen, zu Zeiten der Coronapandemie – dem Home-Office und der Zoom-Konferenzen, erfährt dies nun eine Beschleunigung. Schon kommen die ersten Berichte über das, was sie in Amerika bereits bewirkt: Einen Run auf Botox. „„So einen Run auf Botox hat es überhaupt noch nie gegeben,“ titelte „Die Welt“ am 23.10. Es geht darin um „Zoom-Faces“: „In den USA ist die Nachfrage nach Schönheits-OPs und Liftings in den vergangenen Monaten rasant gestiegen. Denn viele Frauen und Männer finden sich bei Videokonferenzen zu alt und faltig.“
Die Corona-Pandemie bietet einen großen Vorteil. „Jetzt oder nie! Ich spiele schon seit Jahren mit dem Gedanken, mich liften zu lassen – mit dem ständigen Tragen der Corona-Masken habe ich mich letztendlich dazu entschlossen.“ Janet Fisher, Unternehmensberaterin aus Boston, empfindet die Maskenpflicht als ideal, um die Blutergüsse und Narben eines Faceliftings zu verbergen. Demnächst hat die 60-Jährige, deren echter Name der Redaktion bekannt ist, ihren OP-Termin. Sie will sich Gesicht und Hals liften lassen. „Natürlich bin ich nervös, aber mit der Gesichtsmaske sind die Schwellungen nicht gleich für jeden offensichtlich. Das war ein ausschlaggebender Grund.“ Seit Ausbruch der Pandemie gehe sie ohnehin weniger unter Menschen.
Fisher ist damit keine Ausnahme. Viele Amerikaner und Amerikanerinnen sehen darin beste Bedingungen für eine Schönheitsoperation. Konkrete Statistiken für 2020 liegen noch nicht vor, nach internen Umfragen des US-Verbandes plastischer Chirurgen, der American Society of Plastic Surgeons, gibt es jedoch eine steigende Nachfrage nach Botox, Fillers und Liftings. Schönheitschirurgen in den USA sprechen von einem Boom wie selten zuvor. „So einen Run auf Botox hat es überhaupt noch nie gegeben. Wir sind schon wieder weit bis in Frühling komplett ausgebucht“, berichtet Masha Banar, die seit elf Jahren die Beauty-Praxis „Visage Sculpture“ in Boston leitet. „Täglich wollen mehr Kundinnen kommen und sich beraten lassen. Sie gefallen sich nicht auf Zoom und wollen unbedingt jünger aussehen. Das Licht von Web-Kameras kann wirklich gnadenlos sein.“
Vor Corona kannte hier niemand das Wort „Zoom-Face“, aber mittlerweile ist es ein stehender Begriff. In zahllosen Blogs klagen Nutzerinnen einander ihr Leid, wie alt sie in Videocalls aussähen. Sie bewerten die neusten Touch-Up-Apps und Weichzeichner, tauschen gezielte Make-up-Tipps für Videokonferenzen aus. „Doch irgendwann helfen auch die besten Lichtfilter nicht mehr“, findet Fisher. „Mein Anblick auf dem Bildschirm hat mich richtig entsetzt. Vorher war mir gar nicht aufgefallen, wie alles hängt. Bei den Tele-Meetings wurde mir endgültig klar: Ich lege mich unters Messer.“
In Deutschland wurde das Problem nach der Wende zunächst nicht chirurgisch, sondern pädagogisch angegangen: Die Analysen des boomenden Fortbildungs- und Umschulungssektors, die der Filmemacher Harun Farocki damals gemacht hat, zeigen: In den vor allem im Osten entstandenen Bildungszentren wurde den Arbeitslosen u.a. beigebracht, wie man sich richtig bewirbt, d.h. besser verkauft. Es waren videogestützte Auftritts-Schulungen, in denen das wirkliche (westliche) Leben geübt werden sollte – für eine neue Gesellschaft, die laut Farocki „vollständig auf ihr Abbild hin organisiert ist“.
Indem man nun die Distanzen zwischen den Einzelnen fast ausschließlich mittels Übertragungsechnik als Tonfilm überwindet, wie einem von oben (vom Staat) in infantilisierender Weise „nahegelegt“ wird, ist dieser Vorgang, der mit dem Smartphone noch spielerisch von unten (als private Entscheidung) begonnen hatte, nun quasi aus den Händen der Konsumenten in die Verordnungsgewalt der Regierenden übergegangen. Was das für die hiesigen „Zoom-Faces“ bedeutet, ist mir noch nicht ganz klar. In meiner Umgebung sitzen vor allem jüngere Leute in „Tele-Meetings“ und denen reichen noch die immer neuen Techniken – der Beleuchtung, der Hintergrundwahl, der Gesichtsglättung etc.. Allerdings, so meinen sie, bräuchte es noch mehr telegene Übung, um z.B. nicht so oft nach unten zu blicken, so als würde man von einem Text ablesen. Auch der eigene Ton ist für viele noch ungewohnt, zu schweigen davon, dass man nicht mehr durcheinander reden darf.
.
Amerikanismus (2)
In der „Single-Hochburg“ Westberlin kam man im Sozialwissenschaftsstudium nicht um „Die einsame Masse“ des US-Soziologen David Riesman herum. Nach ihm gab es darin die innengeleiteten und die außengeleiteten und dazwischen noch die traditionsgeleiteten Typen. Die zwei letzteren galten uns als irregeleitet. Jetzt ist es „Das einsame Individuum“, das im Neoliberalismus befreit in die Irre geht – vereinsamt. Die englische Ökonomin Noreena Hertz, die sich gründlich Gedanken über dieses Leiden gemacht hat, behauptet in einem „Spiegel“-Interview: „Einsamkeit ist so schädlich wie 15 Zigaretten“.
Sofort überlegte ich: Wenn beides zusammenkommt, einsames kettenrauchen also – wie schädlich ist das denn, lebensgefährlich? Ihre diesbezüglichen Gedanken hat man sich schon selbst gedacht, aber mangels ausreichender „Daten“ (im immer kleiner werdenden Freundeskreis erhoben – wegen Vereinsamung?) freut man sich dann doch, wenn sie dahinter gleich eine ganze soziologische Feldforschung auffährt – zur Erhärtung.
Die Gedanken und Erhebungen über die schädliche Vereinsamung, die Noreena Hertz äußert bzw. zitiert, sind im Corona-Lockdown aktuell, insofern man inzwischen weiß, dass einsame Menschen den noch schlechter aushalten als gesellige. Die Professorin weiß das auch von ihren Studenten. Als sie studierte, kannten ihre Kommilitonen noch keine Einsamkeit, im Gegenteil. Erst seit der „Bologna-Reform“ und dem amerikanisierten Schulstudium, an dessen Ende man einen albernen Hut mit Trotteln in die Luft wirft.
„Einsamkeit und Populismus“ hängen für Noreena Hertz zusammen, sie hält das Anwachsen der rechten Parteien und Wähler, in den USA und in Europa, für eine Bewegung der Vereinsamten, ebenso die zunehmende Religiosität. Aus Japan weiß sie, dass zur Betreuung alter Leute „inzwischen häufig“ soziale Roboter eingesetzt werden. Umgekehrt begeht dort so mancher vereinsamte alte Mann einen dilettantischen Diebstahl, um ins Gefängnis zu kommen, wo er mal wieder unter Menschen ist. Was jeder Idee von der Haft als Strafe Hohn spricht. Wladimir Kaminer schreibt über die wegen Corona nur halb erlaubten Glühweinstände: „Vor der russischen Bar „Moloko“ am Helmholtzplatz verkauften sie ihren Glühwein mit „Russenschuss“ to go, die Fußgänger, die einmal den Schuss gekostet hatten, gingen aber nicht, sondern blieben vor dem Laden stehen. Es war schön, wieder unter Menschen zu sein.“
Noreena Hertz hält vor allem die heutigen Jungen für „definitiv einsamer als die vor 20 Jahren,“ wofür sie nicht zuletzt die Smartphones und die „sozialen Medien“ verantwortlich macht. Es klingt wie ein Witz, aber dieser Tage plakatiert ausgerechnet die evangelische Kirche mit einem Foto, das einen älteren Menschen im Gespräch mit einem Gegenüber im Display eines Smartphones zeigt – darunter steht: Auch wenn wir Abstand halten, bleiben wir verbunden – In Christo oder im World Wide Web?
Der „Spiegel“ fragte Noreena Hertz: „Warum glauben Sie, das neoliberale Wirtschaftspolitik und Einsamkeit zusammenhängen.“ Der US-Schriftsteller Thomas Pynchon hätte geantwortet: „Weil es noch etwas gibt, was schlimmer ist als jede Paranoia: die Antiparanoia – wenn nichts mehr mit irgendwas zusammenhängt.“ Noreena Hertz sagt es so: „Die Idee, dass es Individualismus und Freiheit zum Nulltarif gibt, hat sich als falsch erwiesen.“ Die Regierung sollte z.B. die sozialen Medien „stärker regulieren. Sie sind die Tabakindustrie des 21. Jahrhunderts.“ Der Staat und die Unternehmen müssen „kulturelle Einrichtungen“ gegen die Einsamkeit schaffen. Der SPD-Parteivorsitzende Martin Schulz kann dagegen der durch die Corona-Schutzmaßnahmen zunehmenden Vereinsamung durchaus etwas abgewinnen: „Die Staatsverachtung hat einen Dämpfer bekommen,“ tut er in dem selben „Spiegel“-Heft kund, in dem das Interview mit Noreena Hertz abgedruckt ist.
Sie sieht dagegen eher positive Zeichen von unten, d.h von den vom staatlichen Maßnahmenkatalog Betroffenen – den „Men on the Street“: Sie schämen sich nicht mehr ihrer Vereinsamung, so als läge es an ihnen und ihrem schwierigen Charakter oder ihrem mangelnden Erfolg. „Da ändert sich schon etwas. Einsamkeit spielt im öffentlichen Diskurs eine immer größere Rolle,“ d.h. sie wird nicht mehr als individuelles Schicksal wahr- und hingenommen. Neben einer Explosion der Online-Partnersuchdienste gibt es bereits eine antipopulistische Initiative „Lonely lives matter“, ihre Erkennungsmelodie ist Roy Orbisons „Only the Lonely“. Auch die Einsamkeitsforschung macht Fortschritte.
Die englische Ökonomin denkt inzwischen sogar so positiv, dass sie meint: „Vielleicht ist die Pandemie der Katalysator für die Veränderungen, die wir brauchen,“ wobei ihr so etwas Ähnliches wie der „New Deal“ von Roosevelt nach der „Großen Depression“ vorschwebt. Aber das ein Virus, der stets das Böse will – jetzt Gutes schafft, ist doch zu goetheanisch gedacht. An anderer Stelle erwähnt sie die Erfinder dieser uns in die Vereinsamung treibenden „Algorithmen“ im Silicon Valley, die ihren Kindern das Internet verbieten und sie auf Waldorfschulen schicken (wo die Klassenbesten ein Stipendium für das „Goetheaneum“ in der Schweiz bekommen).
.
Amerikanismus (3)
Über die „Atlantikbrücke“ preschen Tag und Nacht Verblödungsinitiativen zu uns. Richard Berk ist ein alter weißer Soziologe aus Philadelphia, der mit Computer und Statistiken arbeitet. Seine Firma heißt „Data Analysis Inc“ und sein Geld verdient er damit, so sagte er dem Berliner Journalisten Johannes Gernert, „Fakten in die Welt zu bringen“. Fakten, das sind für ihn Daten – Daten, die ein Computer schluckt. Und dann braucht man auch noch ein Programm, das daraus graphisch ansprechende Statistiken macht. Fertig ist sein „Dossier“ – für eine Gefängnisverwaltung z.B, denn Richard Berk arbeitet für solche und ähnliche US-Institutionen wie Sozialämter, Polizeistationen, Gerichte. Für diese erstellt er „immer genauere Vorhersagen“ darüber, wer in naher oder ferner Zukunft ein Verbrecher wird, ein Mörder, ein Vergewaltiger, eine Mißbrauchsfamilie, ein Rückfalltäter. „Die Computer“, sagt Berk, „werden immer mehr Entscheidungen treffen, weil sie es einfach besser können“.
Er speist sie mit den üblichen Informationen: Alter, Einkommen, Vorstrafen, Drogendelikte, Gewaltdelikte, Waffendelikte. „Sein Programm würfelt laut Gerner „all die Daten wieder und wieder neu zusammen, lässt hunderte Male die Wahrscheinlichkeit für diesen einen Menschen berechnen. Am Ende wird aus allen Durchgängen das Urteil gebildet. Zu jedem Urteil liefert Berk einen Prozentsatz, der angibt, wie sicher der Algorithmus sich ist. Wie oft er zum selben Ergebnis kam.“
„Predictive Policing“ – so bezeichnete bereits der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière dieses polizeiliche Instrument der Zukunft. „Berk sagt, dass er für ungeborene Babys jetzt schon mit ziemlicher Sicherheit prognostizieren könnte, ob aus ihnen einmal Verbrecher werden.“ Und dass er vorhersagen könne, „ob häusliche Gewalt sich in bestimmten Haushalten wiederholt“. Dafür wird er viel kritisiert, denn seine Algorithmen stufen vor allem Afroamerikaner als „gefährlich“ ein. Einen „Algorithmus hat er für die Behörde in Pennsylvania entworfen, die entscheidet, wann jemand auf Bewährung raus darf.“ 14 Fälle bearbeitet sie am Tag, wobei das Gespräch mit den Gefangenen als Videokonferenz geführt wird. In Pennsylvania liebäugeln laut Gerner auch die Gerichte bereits mit „statistischen Verbrechensprognosen“. Berks Methode, „sagen auch Leute, die ihn bewundern, hat nur einen Makel: Die Zahl derjenigen, die als gefährlich eingestuft werden, obwohl sie es nicht sind, liegt bei seinen Programmen höher als bei anderen. Mehr Menschen sitzen länger, als sie müssten. Das ist der Kollateralschaden.“
Gerner hat sich mit einem Berk-Kritiker, den Jura-Professor Bernard E. Harcourt, unterhalten, der ein Buch mit dem Titel „Gegen Vorhersagen“ veröffentlicht hat: „Alle Instrumente zur Risikoanalyse sind rassistisch,“ sagt der. „Es habe, stellte er fest, eine Zeit gegeben, in der der Faktor Rasse offen einfloss. Das war in den Zwanzigern. ‚Ein deutscher Vater galt damals als schlechtes Zeichen‘. Längst werden solche Kriterien nicht mehr offen einbezogen. Ob jemand schwarz ist oder Hispanic, bahnt sich trotzdem seinen Weg in die Berechnungen. Über Umweg-Variablen wie Nachbarschaft etwa. ‚Der Rassismus war damals juristisch, jetzt ist er faktisch‘.“
In den USA (und damit auch hier) gibt es etwas, was noch faktischer ist: die Gene: „Der Kriminologe Adrian Raine schildert Biografien von Serienkillern und anderen Straftätern und bringt sie in Verbindung mit ihrem Erbgut. Eindrucksvoll präsentiert der Autor die biologischen Aspekte von Gewalt,“ heißt es auf Deutschlandfunk in einer Sendung mit dem Titel „Dem Verbrecher-Gen auf der Spur“. Dabei handelt es sich um eine Rezension des Buches von Adrian Raine „Als Mörder geboren“. Der Rezensent Michael Lange schreibt: „Tatsächlich konnten Genetiker in den letzten Jahren Erbanlagen aufspüren, die mit erhöhter Aggressivität verknüpft sind. Träger dieser Erbanlagen sind weniger als andere in der Lage, spontane Impulse wie Wutanfälle zu kontrollieren.“ Das meint auch die Neue Zürcher Zeitung: „Zahlreiche Studien sprechen dafür, dass entsprechende Veranlagungen vererbt werden“. Eine erwähnt „wissenschaft.de“: „Ein internationales Forscherteam hat dies bei verurteilten Gewaltverbrechern in Finnland untersucht. Tatsächlich stießen sie dabei auf zwei Genvarianten, die sich bei gewalttätigen Wiederholungstätern häufen“.
Der Kriminologe Reine glaubt, „dass die Biologie zum besseren Verständnis von kriminellem Verhalten beitragen kann“. Aber anders als viele Vorgänger seiner Forschungsrichtung bringt er die „Hintergründe von Kriminalität“ und die „biologischen Wurzeln von Gewalt und Verbrechen“ zusammen. Nimmt er also Berksche Daten plus Genanalyse – und hat damit „harte Fakten“ in der Hand, die ihm eine Voraussage erlauben, ob dieser oder jener Mensch einen Hang zum Verbrechen hat, einen unwiderstehlichen Drang gar?
„Die Genetiker haben keine Ahnung vom Leben, sie wollen nur bessere Tomaten machen,“ meinte die Mikrobiologin Lynn Margulis. Statistiker wie Berg wollen nicht einmal das.
.
Ein zu dickes Ding: Weltmächtigkeit
Eine gelungene „Weltbeziehung“ ist durch die „Etablierung und Erhaltung stabiler Resonanzachsen gekennzeichnet“, meint der in Jena lehrende Hartmut Rosa in seiner „Soziologie der Weltbeziehung: ‚Resonanz‘“ (2019). In meiner Umgebung gibt es immer mehr männliche Jugendliche, die beim Aufbau einer „Weltbeziehung“ scheitern (im Gegensatz zu den Mädchen). Sie hängen verstockt rum, kriegen nichts auf die Reihe, schmeißen die Ausbildung, fliegen aus ihren Jobs, bringen ihre Eltern zur Verzweiflung, kiffen wie blöd, hängen ewig im Internet, verwahrlosen… Die Welt überfordert sie. Sie sind Beispiele für misslingende „Weltverhältnisse, die sich nicht am Ressourcen- oder Verfügungsreichtum festmachen“ lassen, „sondern am Grad der Verbundenheit mit oder der Offenheit gegenüber anderen Menschen (und Dingen)“: abgepufferte „Mittelschicht-Kids“.
So wie ihnen ging es auch mir früher. Mich hat dann zum Glück die linke Bewegung „erlöst“. Nun hat der Leipziger Dichter Carl-Christian Enze solch einem verkorksten Jugendlichen einen Roman gewidmet: „Freudenberg“ – mit Nachnamen, der sich wünscht, „einer Fuchsfamilie anzugehören“. Überhaupt scheint er sich eher zur Tierwelt als zu den Menschen hingezogen zu fühlen. Der Autor ist der Sohn des Leipziger Zootierarztes, 2018 veröffentlichte er seine „Zoogeschichten. Oda und der ausgestopfte Vater“.
„Als Freudenberg kurz vorm Hauptschulabschluss noch immer nicht hatte sagen können, wie es weitergehen sollte mit ihm und seinem Leben, war es Gerd [seinem Vater: ein „Metaller“] endgültig zu bunt geworden. Wieder hatte sich Freudenberg ausweichend und zeitschindend verhalten genauso ausweichend und zeitschindend wie immer, ‚seit seiner Geburt‘ hatte Gerd plötzlich geschrien. Aber jetzt war Schluss damit!“
Er entschied kurzerhand für seinen 17jährigen Sohn „Metallverarbeitung“. Es sah aus als würde Freudenberg dazu nicken. „Dann sei ja alles geritzt, hatte Gerd gemeint und Freudenberg auf die Schulter geklopft, so kräftig, wie er konnte.“ Mit seiner Mutter kam er eher klar als mit seinem Vater, der meinte, dass die Mutter „keinen ausreichenden Willen besäße, auch keinen ausreichenden Willen, Freudenberg zu erziehen“.
Bevor ihr Sohn die Arbeitsstelle antrat, fuhr die Familie in Urlaub – nach Miedzyzdroje (früher Misdroy), einem polnischen Badeort an der Ostsee, der sich „die Badewanne Berlins“ nannte. Nachdem sie ihre Hotelzimmer bezogen hatten, gab der Vater ihm 200 Sloty und Freudenberg zog los, um sich was zum Essen zu holen. „Er wollte allein sein und rauchen“. Nach einem Imbiß ging er ans Meer.
Dort an einer einsamen Strandstelle entriss der Zufall ihn aus seiner existentiellen Misere, mindestens die Möglichkeit dazu – und er ergriff sie, indem er seine Anziehsachen auszog und die eines etwa gleichaltrigen polnischen Jungen an sich nahm, der ihm sehr ähnlich sah. Das Wie lasse ich hier weg. „Nie in seinem Leben hatte er passendere Schuhe besessen“ als jetzt. Er war danach nicht mehr das Kind seiner Eltern. Aber was tat er da? „Er mußte wahnsinnig geworden sein.“ Sofort entfernte er sich von dem Ort. Erst als es dunkel war, lief er zu der Stelle zurück und sah, „das alles verschwunden war. Sein Kleiderhaufen war weg. Seine Haut. Also war es entschieden.“
Er hatte keinen Plan und auch noch die Sloty in seinem Portemonnaie am Strand liegen gelassen. Aber er traf ein Mädchen das Heidelbeeren pflückte, ihm welche abgab und ihn besorgt auf Polnisch ansprach. Er folgte ihr eine Weile „wie ein herrenloser Hund“. Sie lachten zusammen. Am Straßenrand fand er ein zerbeultes Moped. Sein Essen klaute er sich in Tankstellen zusammen. Zwei Wochen ging das so, er schlief im Freien – dann landete er wieder im Ort, wo er gewohnt hatte – an seinem Elternhaus. „Er hatte es nicht geschafft. Einfach nicht geschafft.“
Zunächst versteckte er sich im Keller, dort gab es „genügend Konserven“. Oben hörte er, wie sich seine Eltern unterhielten, sie trauerten über den verlorenen, ganz sicher toten Sohn, sie hatten bereits „Beileidbekundungen“ bekommen. Später sah er durchs Kellerfenster, wie sein Vater den Rasen mähte, „in jedem polnischen Wald war es sicherer als in diesem Keller,“ dachte er – und ging nach oben.
Seine Eltern saßen am Wohnzimmertisch, „dampfende Schüsseln vor sich. „Setz dich doch,“ sagte seine Mutter. Er aß. „Ob es ihm schmecken würde, fragte Gerd nach einer Weile. Er sagte „Ja“. In seinem Zimmer zog er die Sachen des polnischen Jungen aus. Er fing in der Fabrik an, arbeitete an einer Maschine. „Vielleicht hatte Gerd ja schon immer gewußt, was gut für ihn war, viel besser gewußt als er selbst…Heute Mittag hatte ihn der Meister für ein Stück Metall gelobt.“ Aber seine Mutter wollte wissen, „warum ihr Kind sich gewünscht hatte, sie nie wiederzusehen. ‚Was habe ich dir denn getan?‘ keuchte sie und wurde laut.
.
Rauschgift
Mit den Beatniks, Hippies und den rebellierenden Studenten verbreiteten sich Cannabis und LSD sowie Mescalin und Psilocybin („Magic Mushrooms“). „Turn on, tune in, drope out!“ und hierzulande „High sein, frei sein, Terror muß dabei sein!“ hießen die Parolen. Der Psychologieprofessor Timothy Leary veranstaltete an der Harvard-Universität öffentliche LSD-Sitzungen zur „Bewußtseinserweiterung“. 1968 bat der „New York Times“-Herausgeber Arthur Sulzberger den Beat-Dichter Allen Ginsberg um einen freimütigen Text für die Seite 1. Ginsberg schrieb, dass in den Hippie-Quartieren plötzlich die Haschisch- und LSD-Verkäufer durch Heroin-Dealer ersetzt wurden. Und dies sei auf Anweisung des Staates, durch FBI und CIA, geschehen. Sulzberger war über Ginsbergs Artikel so entsetzt, dass er entgegen aller Gepflogenheiten, dazu auf der selben Seite einen Kommentar abgab. In diesem meinte er, die Regierung gegen Ginsbergs infame Unterstellung in Schutz nehmen zu müssen. Zehn Jahre später gestand er jedoch – auf der selben Seite – ein, dass Ginsburg wohl doch Recht gehabt hatte.
Seit 1953 lief in der CIA bereits ein Programm namens „MK-Ultra“, in dem es um „Gehirnwäsche“ mittels Psychodrogen (vor allem LSD) ging, wobei man davon ausging, dass die Sowjetunion in der Hinsicht bereits einen Vorsprung hatte. Als Beweis galten u.a. die im Koreakrieg gefangen genommenen US-Piloten, die im nordkoreanischen Fernsehen freimütig über die Greueltaten amerikanische Kriegsführung berichtet hatten: Das konnte nur einer Gehirnwäsche geschuldet sein.
Bei den LSD-Experimenten der CIA, in denen auch Prostituierte zum Einsatz kamen, waren die Probanden ahnungslose Krankenhauspatienten und Gefängnisinsassen, die z.T. schwere psychische Schäden davontrugen. Es waren „verbrecherische Menschenversuche“, auf Wikipedia heißt es: „Dabei wurden die wissenschaftlichen Untersuchungen von Foltermethoden der Nationalsozialisten weiterentwickelt“. Bald beteiligten sich auch etliche Ärzte und Psychiater in Kanada und England an diesem Programm, sie bekamen Geld von der CIA dafür. „Die Experimente liefen an 44 Universitäten, 12 Krankenhäusern, 3 Gefängnissen und 15 nicht näher bezeichneten ‚Forschungseinrichtungen‘.“ Der US-Autor Stephen Kinzer veröffentlichte 2019 die Geschichte von MK-Ultra in seinem Buch „Poisoner in Chief: Sidney Gottlieb and the CIA Search for Mind Control“. Der Leiter von MK-Ultra, Gottlieb, erklärte später, es ging darum, das Bewusstsein ihrer Probanden zu löschen und ihnen ein neues zu verpassen.
Das MK-Ultra-Programm bestand noch einige Jahre weiter als US-Präsident Nixon 1972 einen „War on Drugs“ ausrief (davor gab es den „War on Poverty“ von Präsident Johnson und danach den „War on Terror“ von Präsident Bush). Seit 2014 ist jedoch Cannabis (der Anbau und Konsum) in vielen US-Bundesstaaten legal und auch mit LSD und Psilocybin darf in Forschungsinstituten wieder experimentiert werden – nicht nur in den USA auch in Europa (in der Basler Uniklinik und an der Charité z.B.).
Gerade erschien ein Erfahrungsbericht der ehemaligen Spiegelreporterin Anuschka Roshani, die, in der Schweiz lebend, an einer „LSD-Session“ (Sechs 16stündige Sitzungen mit unterschiedlichen Dosierungen) in Basel teilnahm: „Gleissen. Wie mich LSD fürs Leben kurierte“. Gleichzeitig lief auf 3Sat eine Dokumentation über Psilocybin-Experimente an US-Unikliniken: „Aware“ (die noch bis zum 30.10 in der Mediathek zu sehen ist). Den Forschern geht es dabei vornehmlich um die Frage: Was ist „Bewußtsein“? Dazu äußern sich im Film auch eine australische Botanikerin, eine Schamanin aus Chiapas und ein Buddhist in Nepal. Für Anuschka Roshani bewirkte das LSD insofern eine Erweiterung des „Bewußtseins“ als sie auf ihrem „Trip“ die Bäume atmen sah – und „akzeptieren mußte, nichts auf der Welt, kein Busch, kein Strauch, keine Hummel ist seelenlos“. Ich sehe das auch so, nicht nur, weil ich bestimmt schon 50 mal einen LSD-Trip genommen habe, sondern weil ich seit 2001 Biologie studiere. Beides geht gegen meinen Anthropozentrismus.
Bei den amerikanischen und den Basler Psychodrogenforschern (und wohl auch bei den in der Charité) geht das Wollen in die entgegengesetzte Richtung: Sie wurden inzwischen am US-Pharma-Start-Up „MindMed“ beteiligt. Dieses börsennotierte New Yorker Unternehmen ist „bei der Zulassung von LSD als Medikament [gegen bald alles?] weltweit in der ‚Pole Position‘.“ Der Markt boomt. Schon entstehen in den USA laut Roshani überall „Center for the Neuroscience of Psychodelics“ und „Center for Psychedelic and Consciousness Research“. Es lockt ein „Milliardengeschäft“, denn es gibt viele Cannabis-Dealer, die sich mit der Droge – erst illegal und dann legal – „dumm und dämlich“ verdient haben und nun bereit sind, „unglaubliche Summen zu investieren“ – u.a. in „MindMed“. Dazu gehört wohl bald auch der Multimilliardär Elon Musk, denn er will das „desolate US-Gesundheitssystem mittels psychedelischer Drogen heilen“. Für mich ist das alles eine Neuauflage des MK-Ultra-Programms – mit privatem Kapital diesmal.
Desungeachtet meinten nicht wenige, die in den USA an Psilocybin-Experimenten teilgenommen hatten (noch nach zehn Jahren) und auch Anuschka Roshani kurz nach ihrer LSD-“Reise“, dass es eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Erfahrung in ihrem Leben war – mit den Worten des Surrealisten André Breton: „Das Ereignis, von dem jeder das Recht hat, eine Offenbarung des Sinns seines Lebens zu erwarten, dieses Ereignis wird nicht durch Arbeit hervorgerufen.“
.
Tätowierungen
Man wird dafür von einem Tätowierer zigmal mit einer Nadel und Farbe in die Haut gestochen, bis daraus unter Schmerzen ein Wort oder Bild entsteht. Eine Weile schossen die Tätowierläden wie Pilze aus dem Boden, dafür wurden die Graffitis an den Hauswänden weniger. Ich vermutete da einen Zusammenhang: dass sich die Graffiti-Sprayer als Tätowierer selbständig machten. Als Indiz galt mir ein Bekannter aus Treptow, der jahrelang erst „tags“ und dann Comicbilder gesprayt und sich dann als reisender Tätowierer auf Western- und Mittelalter-Märkten betätigt hatte. Als ich dann in der U-Bahn immer mehr Werbung für die Entfernung von tattoos las, sah ich schwarz für sein Gewerbe, aber er blieb gelassen: „In Tschechien, Ungarn und Polen geht es jetzt erst richtig los mit den tattoos,“ meinte er.
Er hatte einst Drucker gelernt, auf einer tattoo-Messe in Köln lernte er eine „richtige Künstlerin“ kennen. Sie hatte an der UdK Berlin studiert und arbeitete in Marbella als Freihandtätowiererin, d.h. sie pauste ihren Kunden das Motiv nicht auf die Haut, sondern zeichnete es auf Papier nur vor. Ihre Kunden waren meist Zuhälter und ähnliche Verbrecher mit viel Geld, denn das Tätowierstudio in Marbella war teuer. Die Künstlerin verdiente auch gut, hörte jedoch nach der Messe auf. Ihr hatte auf Dauer der „Sadomaso“-Aspekt am Tätowieren mißfallen, sie empfand ihre Tätigkeit zunehmend als Körperverletzung, sie schätzte, dass es mindestens die Hälfte ihrer Kunden anschließend leid tat, für den Rest ihres Lebens mit einem „tattoo“ herumlaufen zu müssen. Ihr spanisches Studio bot auch alle anderen Formen von körperverletzenden Verzierungen an: Piercings von Zunge, Lippen, Ohren, Schamlippen, Penis und Holzpflöcke in Ohrläppchen.
Mein Bekannter hatte einige Jahre in Paris gearbeitet. Dort waren seine Kunden Mitglieder von Jugendbanden gewesen, die meist martialische Motive und Symbole auf ihre Hautpartien tätowiert haben wollten: Messer, Guillotinen, Totenköpfe, Handgranaten. Ihre liebste Freizeitbeschäftigung war Homosexuelle zusammenschlagen, aber als die Banden langsam zu Cliquen zerfielen, wurde die Homosexualität in den ehemaligen Arbeitervierteln plötzlich geschätzt und statt tattoos wollten seine Kunden jetzt Ohrringe haben. Wenn die tattoos, die ja aus den Gefängnissen, Berufsarmeen und der Seefahrt stammen, ein Muskelschmuck roher Männerbünde waren, dann symbolisierten die Ohrringe eine Loslösung aus dem Proletariat und Subproletariat – „eine Art Korsarenfreiheit“.
Über die erzwungenen Tätowierungen schreibt die Kulturwissenschaftlerin Iris Därmann in ihrem Buch über die Geschichte der Gewalt „Undienlichkeit“ (2020): Die schmerzhaften „Tätowierungen und Brandzeichen sind seit der Antike mit der Institution der Sklaverei und dem Interesse verbunden, Menschen zu ‚beseelten Besitzstücken‘ und ‚Werkzeugen‘, zu Zwangsarbeitern und effizienten Dienstleistern zu machen.“
Den KZ-Gefangenen wurden Nummern eintätowiert. Manche Überlebende verwenden heute „ihre“ KZ-Nummer als Passwort im Internetverkehr. Laut Dürmann haben einige Enkel sich die KZ-Nummern ihrer Großväter ans Bein tätowieren lassen, zur Erinnerung.
Der Schweizer Historiker Valentin Groebner studierte die tattoos im Freibad. Für ihn flüsterte jede entblößte Botschaft (in: Merkur 2019/10): „bitte schau mich an“. Die „gezackten dunklen Bänder an den Oberarmen“ sind inzwischen so häufig geworden, dass sie ihm kaum noch auffallen, wohl aber „Indianer mit Federschmuck“, „Fantasy-Feen mit tiefem Ausschnitt“, ein „schwarzer Pottwal“.
Groebner erinnert an die ersten Bücher über die neue Tätowiermode, die bereits Mitte der Siebzigerjahre erschienen. Damals waren die tattoos noch „gefährlich-verrückt“ – ihre Herkunft wurde bei den tätowierten Eingeborenen der Südsee, die von „tataus“ sprachen, verortet. Groebner zufolge sind die tattoos keine Logos – wie auf den Kleidern, Handtaschen und Sonnenbrillen, sondern sollen „Selbstbestimmung signalisieren – oder soll man ‚Werte‘ sagen?“
Aber viele tragen diese „Werte“ als eine Art Logo: chinesische und arabische Sätze, Sprichwörter, Zaubersprüche, Beschwörungsformeln – manche bewußt kryptisch gehalten. Weil Groebner viele weibliche Gesichter auf männlichen und weiblichen Körpern sieht, nimmt er an, dass es „Bilder aus der eigenen Vorstellung“ sind, die die Haut in eine „Leinwand der eigenen Phantasie“ verwandeln.
Der Publizist Roger Willemsen fand einmal drei Schriftzeichen bei einer Frau nahe ihrer Vulva, die „Friede“ bedeuteten. „Soll jeder, der sich ihrer Scham nähert, Frieden finden?“ fragte er sich. Der Künstler Hans-Christian Dany begriff Tätowierungen als „Gegenbewegung“ zu den „immer rascher wechselnden Codes der Mode“. Für den Poptheoretiker Diedrich Diederichsen sind tattoos „Mainstream“ geworden, die „immerfort gesteigert werden“, um ihrer „Entwertung“ zu entgehen. Während Groebner sie umgekehrt für Gefühlserinnerungen hält, die man sich für immer bewahren will: „‘So wild war ich drauf‘, wäre dann die Botschaft, ‚früher‘.“
Tattoos wollen die Blicke der Anderen auf von einem „selbst ausgewählte und betextete Stellen lenken: Dieses Zeichen auf meiner Haut, das bin ich für euch.“ Diese Interpretation läßt außer acht, dass diese Zeichen nicht selten unter Druck eingestochen wurden – Druck von der Clique, dem Partner, von Kumpanen im Suff, im Zugehörigkeitswunsch, in der Unfähigkeit, Nein zu sagen, im Spontankaufrausch… Heute werden einem selbst die freiwilligsten Handlungen aufgezwungen. Davon zeugen nicht zuletzt „die vielen missglückten, irrtümlichen und später bereuten Tattoos“, die in Groebners „Bekanntenkreis reichlich vorhanden sind“.
.
Goyas Capricho 43
Wir leben inzwischen in „nach-gesellschaftlichen Projektwelten“, heißt es. Der Literaturwissenschaftler Georg Stanitzek veröffentlichte bereits 1987 in der Zeitschrift „Ästhetik & Kommunikation“ einen erhellenden Text über „Projektmacher. Projektionen auf eine ‚unmögliche‘ moderne Kategorie“. Er wies darin nach, dass nach Erscheinen des „Essays upon Projects“ von Daniel Defoe (1697) eine regelrechte „Projektenperiode“ begann. Defoe war bereits selbst ein Projektemacher, er scheiterte zwei Mal und kam dafür ins Gefängnis. „Entweder man wird zum Selbstmörder, Verbrecher oder Projektemacher.“ schrieb er. Ähnlich wie bei Geschäftsgründungen (Start-Ups) scheitern von zehn Projekten neun. Als Wort taucht das Projekt schon bei Shakespeare auf: die Ermordung Hamlets wird von ihm – wohl ironisch – als ein “Projekt” bezeichnet.
Das Volk sang in Württemberg im 18. Jahrhundert: „Er zeigte wohl Projecten vor,/ die Geld eintragen müssen;/ sie fielen trefflich in das Ohr,/doch musst der Burger büssen.“ Wem fallen hierzu nicht die zahlreichen „Großprojekte“ der öffentlichen Hand ein, die der Bundesrechnungshof Jahr für Jahr anprangert?
„Wer sich dem Projektemachen widmet“, schreibt Georg Stanitzek, „fährt nicht in den sicheren Hafen eines ‚Charakters‘, sondern zieht es vor, immer von neuem, von Projekt zu Projekt, die unsichere Zukunft herauszufordern“. Für den protestantischen Bürger und Unternehmer waren die Projektemacher insgesamt alles „windige Geschäftemacher“, d.h unseriöse Konkurrenten und überhaupt charakterlose, unmoralische Menschen.
Bereits im „Universal Lexicon Aller Wissenschaften und Künste“ von 1741 wird vor ihnen gewarnt, „weil sie insgemein Betrüger sind“. In seiner „Einleitung zur wahren Staatsklugheit“ erklärte ein Autor 1751, Grundling, auch warum: „Solche Leute machen gemeiniglich fürtrefflich scheinbare Projecte auf dem Papier, und thun dem Herrn allerhand Vorschläge; können sie aber selten ausführen, und kommen darüber in Ungnade“. Die Verachtung des „lächerlichen Projectanten“ (Josef Richter 1811) geht jedoch einher mit einer – bis heute – wachsenden Wertschätzung von Projekten.
1761 hatte ein Projektemacher selbst, Gottlob von Justi, sich darüber erste Gedanken gemacht – und war dabei zu dem Schluß gekommen, daß doch im Grunde alle Menschen so sein sollten wie er, und daß ein jeder „einen wohl überlegten Plan und Project seines Lebens“ entwerfe und nach ihm handle. Justis „Lebensart“ zielte bereits auf das, was man heute „Karriereplanung“ nennt. Und „Karrieren“, so die Analyse von Stanitzek, „bestehen aus Ereignissen der erfolgreichen – oder mißlungenen – Verknüpfung von Selbstselektion und Fremdselektion. Der Projektemacher nun ist darauf aus, die Unwahrscheinlichkeit des Zueinanderfindens von Selbst und Fremdselektion methodisch zu reduzieren, indem er mit seinem Projekt die Selektionen prospektiv engführt, d.h. in Form des Projektes gleichsam ein Exposé zu ihrer Verknüpfung vorlegt. Wenn die Selbstselektion sich in Projektform annonciert, so ist sie von vorneherein präzise auf eine Fremdselektion hin adressiert, steuert sich nah an sie heran, macht sich beobachtbar und beurteilbar“. Dieses Suchen der Nähe tatsächlicher Anschlußmöglichkeiten läßt sich – mit Stanitzeks Worten – „durchaus Opportunismus nennen“.
Die Künstler und Wissenschaftler erweisen sie heute mit ihren Projekten als die größen Opportunisten. Sie müssen es sein, wenn sie dafür Gelder abgreifen wollen, d.h. sie informieren sich, was gefördert wird und entwerfen dann entsprechende „Projektanträge“, die mit etwas Glück auch „bewilligt“ werden. Schon in der Studentenbewegung fiel der Opportunismus bei Künstlern und Wissenschaftlern unangenehm auf: Erstere, weil sie, um interessant zu bleiben, von abstrakter oder erotischer Kunst schnell zu „sozialistischem Realismus“ wechselten, und letztere, weil sie ihre alten langweiligen Vorlesungen und Seminare immer wieder mit aktuellen linken Begriffsbildungen attraktiv machten.
Der Kulturwissenschaftler Markus Krajewski veröffentlichte zwei Bücher zum Thema: „Projektemacher: Zur Produktion von Wissen in der Vorform des Scheiterns“ (2004) und „Restlosigkeit: Weltprojekte um 1900“ (2006). In diesem geht es u.a. um Esperanto, Weltzeit, Weltstandard usw..Um Ackerland zu gewinnen, beabsichtigte z.B. der Projektemacher Herman Sörgel das Mittelmeer trocken zu legen. Dazu wandte er sich nacheinander an Könige, Parlamente, Hitler und Kennedy.
Man kennt Francisco de Goyas Capricho 43: „Der Schlaf der Vernunft bringt Ungeheuer hervor“; 1994 legte der Politologe Wilhelm Hennis eine Neuinterpretation vor. Er ging vom Spanischen Titel aus, wo „Sueno“ steht, das Schlaf und Traum bedeutet, und kam zu dem Schluß, dass es genau andersherum zu verstehen ist: „Es sind die Träume der Projekte schmiedenden Vernunft, die Ungeheuer produzieren”. Goyas Blatt stünde damit in frappierender Parallele zum zweiten Teil des ‚Faust‘, in dem Goyas Generationskollege Goethe den Magister und Alchemisten Doktor Faustus zu einem modernen Projektemacher avancieren läßt (der u.a. Kanalbauten durchsetzt).
.
Neues aus dem Misanthropozän
Ich habe mich immer über die „Fan-Clubs“ mokiert, über den „Conny Froboess-“, den „Opel Manta-“ oder „Rudi Völlerer“-Fanclub zum Beispiel. Aber jetzt bin ich doch noch selbst ein „Fan-Man“ geworden, vielleicht aus Altersdebilität. Jedenfalls bin ich im „Sir David Attenborough Fan Club“, und weil ich schon mal diesem einen beigetreten bin, auch gleich noch in einem Elefanten-, einen Bären- und einen Flughunde-“Fan Club“. Alle vier verdanken sich Tierschützern mit einem besonderen Interesse an einem Tier bzw. an einem englischen Tierfilmer, der uns wie einst Bernhard Grzimek im Westen und Heinrich Dathe im Osten Tier-Geschichten mit gefilmten Beispielen im Fernsehen erzählt, nur intelligenter und mit modernster Technik. Kürzlich hat Attenborough ein Buch veröffentlicht, darin geht es um die ganze Welt, das heißt um alle Tier- und Pflanzenarten, die unbedingt gerettet werden müssen.
Daneben hat auch die Schimpansenforscherin Jane Goodall ein ähnliches „Statement“ veröffentlicht. Beide, so schlagen ihre jeweiligen „Fan-Clubs“ vor (auf Facebook und in anderen „sozialen Medien“), müssen dafür nun aber zügig den Nobelpreis kriegen. Dagegen ist nichts zu sagen, aber dahinter steht die Überzeugung, je mehr ein Weltverbesserer global anerkannt und mit Bürger-Ehren ausgezeichnet wird, desto mehr ist seinem Anliegen gedient. Das darf man bezweifeln. Eher ist 2020/21 zu vermuten, dass dies alles eher Kanäle sind, die ins Unbedeutende führen, zum Fading-Away.
Selbst „Huldigungen“ wie die Tierbuchautorin Sy Montgomery sie für Jane Goodall (und zwei anderen Affenforscherinnen) veröffentlichte, geraten vom Ansatz her bereits weg vom Anliegen. Spätestens seit Robert Oppenheimer gibt es laut Michel Foucault einen quasi objektiven Zwang, Berufliches und Politisches nicht mehr zu trennen. Wie noch zu Beginn der Aufklärung, als Juristen wie Emile Zola politisch-publizistisch wirkten oder heute noch Noam Chomsky, der sein linkes politisches Engagement vom fachlichen Festhalten an seiner reaktionären Sprachtheorie trennt. Im Falle von Jane Goodall könnte man sagen: Nicht ihr jetziges weltweites Initiativgründen unter Menschen, sondern dass sie sich davor jahrzehntelang den Schimpansen zugeneigt hat, das ist oder war ihre eigentliche politische Arbeit. Diese bewirkte, dass die Primatenforschung inzwischen fast eine feministische Domäne wurde.
Seltsamerweise haben dann die japanischen Primatenforscher um den Biologen Takayoshi Kano diese Entwicklung eines wichtigen Bereichs der Feldforschung (die wie die organismische Biologie überhaupt wegen der forschungspolitischen Orientierung auf die Genetik stark gefährdet war) noch forciert – mit ihrer Zwergschimpansenforschung im kongolesischen Wambawald. Die sogenannten Bonobos haben andere Konfliktlösungen als die Schimpansen: Während bei diesen das Soziale mit mehr oder weniger männlicher Gewalt zusammengehalten wird, geschieht dies bei den von Weibchen dominierten Bonobo-Gruppen über sexuelle Handlungen. Laut Takayoshi Kano besteht bei ihnen „die Funktion des Kopulationsverhaltens in erster Linie zweifellos darin, das friedliche Nebeneinander von Männchen und Weibchen zu ermöglichen, und nicht darin, Nachkommen zu zeugen.“
Ihre Bonoboforschung habe der westlichen Primatenforschung durchaus was zu sagen, meint Kano. Weil man in Japan schon lange Erfahrung mit den im Land lebenden Affen hat und die japanische Religion nicht so scharf zwischen Menschen und Tieren trennt. Daraufhin spitzte der holländische Primatenforscher Frans de Waal in der Zeitschrift „Emma“ die Ergebnisse dieser Forschung über die „maternale Kultur“ der Bonobos, von denen es etwa 15.000 gibt, noch alarmistisch zu, indem er sie als geradezu vorbildlich pries: „unsere letzte Rettung“. Die Bonobos haben auf diese Weise auch zur feministischen Theoriebildung beigetragen: „Ihre Botschaft ist bei uns angekommen,“ schrieb die Zeitschrift „Emma“.
Es macht jedoch stutzig, dass im Bonobo-Bild alles stimmt: Bei diesen unseren nächsten Verwandten trafen die Japaner im Dschungel voll den Zeitgeist: Ökologie, Frieden, Fremdenfreundlichkeit, freie Sexualität, Veganismus, Feminismus, Matriachat, Degrowth, Sonnenenergie, Entschleunigung. Nichtrauchen… Da drängt sich natürlich die Frage auf: Stimmen denn überhaupt ihre Beobachtungen, wie gering sind sie, wie weitreichend wurde das Verhalten interpretiert? Waren die japanischen Forscher unten am Waldboden und beobachteten „ihre“ Bonobo-Gruppe mit Ferngläsern, was sie oben in den Bäumen taten? Arbeiteten sie vielleicht mit elektronischen Chips, die sie den Affen implantierten oder sonstwie an ihnen befestigten, so dass sie deren „Wege“ am Bildschirm verfolgen konnten? Oder haben die Bonobos sogar das Essen mit Stäbchen von ihnen übernommen?
.
Bettgeschichten
Eine online Partnervermittlung für Senioren und vor allem für Seniorinnen wirbt mit der Beantwortung ihrer „Bettgeschichten“-Frage: „Probleme mit dem Bett?“
Nicht etwa: Probleme im Bett, wie sie ja bei alten Leuten, oder älteren, wie man heute sagt, durchaus eintreten können. Das Tagebuch von Benoite Groult „Vom Fischen und von der Liebe“ (2004) ist voll mit Schilderungen, wie ihrem Mann, ihrem Liebhaber und ihr selbst im Alter langsam die Lust verging. Aber ist die „Bettgeschichte“ wirklich aus Versehen so formuliert worden?
In der Pankower Wollankstrasse gibt es ein Bettengeschäft, das seine Ware bewirbt, indem es einem Interessenten ein hochelektronisch berechnetes für ihn optimal passendes, also quasi persönliches Bett offeriert. Der Buchladen gegenüber hat dort mal einen Leseabend veranstaltet – mit Büchern übers Schlafen. Eine anarchistische Kollegin von mir veröffentlichte ein Buch mit dem Titel „Schlaft doch, wie ihr wollt“. Die Schlaf-Ratgeberliteratur geht fließend über in die Werbung für Schlafhilfen. Die Paul Feyerabendsche „Anything-Goes“-These der Kollegin hält der Wirklichkeit nicht stand: Ich saß in einem Waggon, dessen Werbeflächen voll mit der Werbung einer Firma war, die mit den Worten „Falsches Kissen“ warb.
Man sah darauf jeweils ein leidendes Gesicht und der- oder diejenige hielt sich dabei die Stirn, den Nacken, den Hals oder die Schulter. Die derart porträtierten schienen nicht nur geistig, sondern auch körperlich am derzeitigen System zu leiden: Ehe kaputt, Job verloren, Miete erhöht, Sohn auf Chrystal Meth, Auto springt nicht an – so was in der Art…
Weit gefehlt: Diesen Leuten fehlte bloß das richtige Kissen! Was ist denn da passiert, fragte ich mich: Warum bewerben die Kissenhersteller ihre Produkte plötzlich als Gesundheitsmittel und sich als Chiropraktiker? Etwa seit mit der Dienstleistungsgesellschaft „Rückenschmerzen“ epidemisch geworden sind? Oder die weggefallene Arbeitsplatz- und Wohnungssicherheit massenhaft zu „Schlaflosigkeit“ geführt hat? Im Internet werden inzwischen spezielle Kissen für „Seitenschläfer“, für „Rückenschläfer“ usw. angeboten und vor allem die Leiden „Nackenschmerzen“ und „Schlaflosigkeit“ auf „falsche Kissen“ zurückgeführt.
Das „Online-Magazin für perfekten Schlaf“ meint: „Es ist völlig normal, dass wir während des Schlafes die Schlafposition des Öftern wechseln. Daher sollte sich das Kissen auch in der Nacht optimal den unterschiedlichen Anforderungen anpassen können.“ Neben dem richtigen Kissen gilt zudem: „Egal, ob Sie nun zu den Seitenschläfer, Rückenschläfer oder Bauchschläfern gehören, eines sollten Sie immer vermeiden – den Knick im Genick.“ Die „Halswirbelsäule mag das nämlich gar nicht“.
Was für Kissen helfen aber denn nun? Das kommt drauf an: Die Redakteure des Online-Magazins empfehlen z.B. für Alpträumer, die Nachts viel schwitzen, Kissen mit „natürlichen Materialien“, konkret: „Die einzigartige Fähigkeit der Schafschurwolle, bis zu 30 % des Eigengewichts an Feuchtigkeit aufzunehmen, macht sie zu einem besonders guten Füllmaterial.“ Das hilft auch gegen Ungeziefer: „Wußten Sie, in einem Bett halten sich bis zu über einer Million Milben auf? Sie bevorzugen vor allem ein feucht-warmes Bettklima.“ Es scheint damit erwiesen zu sein, dass besonders ängstliche Menschen Nachts besonders viele Milben züchten.
Aus gewöhnlich gut unterrichteten Bettenburgen weiß ich aber seit dem Wochenende, nach einer Diskussion über die vielen Matratzen-Läden aus aller Herren Länder, als wir auch kurz über „Falsche Kissen“ sprachen: Das ist alles PR. Dahinter stecken die mächtigen Schafzüchter-Verbände in Australien, Neuseeland und England, sie wollen ihre Schafwolle, um nicht gänzlich von vier chinesischen Textilkonzernen abhängig zu sein, auch in Europa als Kissenfüllung loswerden.“ Ein an der Diskussion beteiligter Schweizer wußte: „Unser Gottlieb-Duttweiler-Institut“ hat beizeiten schon in seiner berühmten Studie „Die Zukunft des Schlafens“ prophezeit, dass dafür „in der Always-On-Gesellschaft neue Märkte entstehen“.
Dann erzählte er einen Witz und wir kamen lachend vom Thema ab: Ein Deutscher kommt in eine Schweizer Bank und fragt: „Damit ich wieder ruhig schlafen kann, möchte ich gerne ein Konto bei Ihnen eröffnen?“ „Sicher,“ sagt der Mann am Bankschalter, „wieviel wollen Sie denn einzahlen?“ Der Kunde flüstert: „Zwei Millionen.“ „Sie brauchen nicht zu flüstern,“ bekommt er zur Antwort, „bei uns ist Armut keine Schande.“
.
Schuhwerk
Auf die Frage, wie wir in die Welt gestellt sind, antwortet der Soziologe Hartmut Rosa: „Mit den Füßen“. Barfuß spüren wir die unterschiedlichen Böden, auf denen wir gehen. Mit „festem Schuhwerk“ nehmen wir dagegen laut Rosa eine „puffernde Distanz zwischen Leib und Welt ein, die es uns ermöglicht, von einem partizipativen zu einem objektivierenden und verdinglichenden Weltverhältnis überzugehen“.
Im Konsum verhelfen uns dazu die Schuhgeschäfte oder Schuhmachereien: In jenen arbeiten arme Verkäuferinnen, in diesen Schuster, die oft zu den Radikalsten gehörten. Aus ihren Beruf gingen die meisten Philosophen, Agitatoren und Terroristen hervor. Daher auch die obrigkeitliche Warnung: „Schuster, bleib bei deinen Leisten!“ Doch die industrielle Revolution drängte den Schuster langsam an den Rand der Arbeiterbewegung, und all die exproletarischen Men-in-Sportswear im Verein mit der „Turnschuhgeneration“, ließen ihn fast verstummen. Der Schuster ist schon lange nicht mehr die „Schlüsselfigur des intellektuellen und politischen Lebens auf dem Land – viel weniger in der Stadt,“ schreibt Eric Hobsbawm, der den Beruf in seiner schönen Aufsatzsammlung „Ungewöhnliche Menschen“ (2003) ehrte.
In Berlin gibt es nur noch 146 Schuster. Die einst gefürchteten Innung, die bereits 1284 gegründet wurde, hat heute bloß noch 58 Mitglieder, 40 Mitglieder hat daneben die Innung für Orthopädie, die sich 1950 abspaltete. Damals sorgten die vor Stalingrad abgefrorenen Zehen für einen Orthopädieboom, den die Krankenkassen finanzierten. Auch heute gibt es wieder vermehrt Fußkranke. Das liegt jedoch nicht mehr am russischen Winter, sondern an den Wegwerf-Modeschuhen aus einem Guss und den Schuhen mit Plateausohlen bzw. hohen Absätzen. Warum ruinieren sich Frauen die Füße mit hochhackigen Schuhen? Fragte sich die Bremer Kulturwissenschaftlerin Ingelore Ebberfeld. „Für den Mann ihrer Träume,“ fand sie heraus.
In Kreuzberg betreiben zwei Frauen eine Schusterei: „Meier und Schöpf“. Der Grundpreis für ein Paar Maßschuhe beträgt bei ihnen 1.900 Euro. Einst übten den Schusterberuf oft körperlich schwache oder verkrüppelte Männer aus. Bei dieser geräuscharmen, sitzenden Tätigkeit konnten sie diskutieren und sich weiterbilden. Manche Schuster beschäftigten sogar Vorleser, und oft waren sie noch nebenbei Dorfschreiber. Ende des 18. Jahrhunderts scheinen sie „eine regelrechte innere Berufung zur Revolution gehabt zu haben“, wie der Historiker Richard Cobb meint, und nicht wenige wurden berühmt. Karl Marx lobte Wilhelm Weitling und Stalin den gelernten Schuster Ceauscescu. Die DDR ehrte einige mit ihren Produktionsgenossenschaften des Schusterhandwerks, indem sie diese nach berühmten Schustern benannte: Hans Sachs und Jakob Böhme. In Odessa sind die Schuster fast alle Griechen und in Moskau Tartaren, in Berlin werden die verwaisten Schustereien von Weißrussen übernommen.
Während die Schuhmacher weniger werden, vermehren sich die Schuhmuseen. Es gibt eins in Weissenfels, dem Zentrum der DDR-Schuhindustrie, wo bis 1992 täglich 30.000 Paar Schuhe von 5000 Mitarbeitern produziert wurden. Das Zentrum der Schuhherstellung in der BRD war Pirmasens, wo es ebenfalls ein Schuhmuseum gibt, daneben auch noch eins in Hauenstein, wo man u.a. alle Modellschuhe von Salamander ausstellt, sowie in Offenbach, wo es dazu noch ein Ledermuseum gibt. Dann gibt es ein Museum in Florenz vom Schuhfabrikanten Ferragamo, in Schönenwerd bei Basel vom Schuhfabrikanten Bally, und im mährischen Zlin, wo Tomas, Antonin und Anna Bata 1894 eine Schuhfabrik gründeten, aus der ein Weltkonzern, heute mit Hauptsitz in Lausanne, entstand: mit 22 Fabriken und 5800 Schuhläden in 70 Ländern. „Bata ließ rund um die Fabriken eigene Siedlungen und Kaufhäuser für die Arbeiter errichten und sorgte für Schulbildung und Wohlfahrtseinrichtungen. Der Konzern war für seine dichte Überwachung der Arbeiter nicht nur in der Fabrik, sondern auch im Alltag bekannt,“ heißt es auf Wikipedia. Solche Bata-Siedlungen gibt es heute in vielen Ländern. Die Bata-Schuhe werden allerdings nur noch in Billiglohnländern hergestellt, wie auch die meisten anderen Markenschuhe (Salamander-Schuhe einst in der DDR).
Neben Schuhen in Schuhmuseen werden Schuhe auch gerne in Antikommunismus-Museen ausgestellt. Im Okkupationsmuseum von Tallin ist es ein Paar zerfetzte Schuhe – mit denen ein einst nach Deutschland verschleppter Este in seine Heimat zurückkehrte. In Riga ist es ein paar rote Filzstiefel – mit denen ein nach Sibirien verbannter Lette sich nach Hause schleppte. Im Gulag-Museum von Perm-36 ist es ein mit Draht zusammengehaltenes Paar Halbstiefel, das von einem Häftling getragen wurde.
Auf das Gegenteil will das Marikina Museum in Manila hinaus: Dort sind 3000 edle Damenschuh-Paare ausgestellt, die der Diktatorengattin Imelda Marcos gehörten. Sie hat das Museum sogar persönlich eingeweiht.
Auf ähnliche Massen von Schuhen setzt man im Foltermuseum von Pnom Penh und im musealisierten KZ Auschwitz.
Auch in einigen kommunistischen Museen verzichtet man nicht auf Schuhe. So sind im Moskauer Weltraummuseum die silbernen Kosmosstiefel von Juri Gagarin ausgestellt und im dortigen Revolutionsmuseum ein Paar Bastschuhe, das zeigen soll, wie arm die Bauern vor der Kollektivierung waren. Im Revolutionsmuseum von Havanna sind die Schuhe, die Ché Guevara zuletzt trug, aufbewahrt, und im Saigoner Museum für Ho Chin Minh sind dessen aus Autoreifen geschnittene Sandalen ausgestellt.
Das politisch fragwürdige Berliner „Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ bewirbt seine neueste Ausstellung „Das Jahrhundert der Flucht“ mit einem Plakat, auf dem ein paar Schuhe zu sehen ist. Es will damit wohl sagen: Wer flieht braucht gutes Schuhwerk oder – mit Georg Trakl zu reden: „Flieht auf leichten Kähnen“.
Abschließend sei noch erwähnt, dass der Journalist Muntaser el Saidi 2008 den US-Präsidenten George Bush Jr. auf einer Pressekonferenz in Bagdad mit einem Paar Schuhe bewarf. Er wurde verhaftet. Davon inspiriert warfen 2011 Berliner Linke gleich zig Paar Schuhe auf das Gelände des Verteidigungsministeriums, dem damals der Hochstapler Karl-Theodor zu Guttenberg vorstand. Seitdem wird immer mal wieder mit Schuhwürfen Mißfallen kundgetan.
.
Kugelschreiber + Einwegfeuerzeuge
Mein ehemaliger Mitbewohner Suleyman, einst der erste türkische Lehrer in Bremen, fuhr mit elf Freunden in drei Autos in die Türkei. In der als Jugendzentrum besetzten Bremer Faber-Castell-Fabrik hatten sie im Keller sechs Kartons mit blauen Billigkugelschreibern gefunden, die Suleyman unbedingt mitnehmen wollte. Obwohl alle stöhnten, setzte er sich durch – und das war ein Glück, denn unterwegs riß die kleine PKW-Kolonne immer wieder auseinander, bis Suleyman anfing, jedem Passanten, der an der Strasse stand, einen Kugelschreiber zu schenken. Fortan brauchten die seinem Auto Folgenden bloß nach diesen blauen Kugelschreibern Ausschau halten, die die meisten Beschenkten am Straßenrand sich in ihre Hemdtasche geklemmt hatten – und schon wußten sie, dass sie auf dem richtigen Weg waren.
Weil viele Firmen Kugelschreiber als Werbegeschenke nutzen, sind sie quasi Gemeineigentum geworden, was heißt, dass man sie beinahe ohne schlechtes Gewissen einfach einstecken kann. Wenn die Mine leer ist, werden sie in den Abfall geworden. Ähnliches gilt für Einwegfeuerzeuge, die, wenn das Gas alle ist, ebenfalls weggeworfen werden. Man kann sie zwar wieder aufladen, das tut aber so gut wie niemand.
Ich kenne allerdings eine Frau, die einen Freund in Mexiko hat, der das professionell macht, d.h. er sammelt leere Einwegfeuerzeuge, füllt sie auf und verkauft sie – mit mäßigem Gewinn. Seine Berliner Freundin sammelt hier alle halbleeren und leeren Feuerzeuge und schickt sie ihm. In Istanbul sah ich mehrere Händler, die solche Feuerzeuge verkauften. Sie haben sich mit deren Recyceln selbständig gemacht und sich dafür einen rollenden Arbeitsplatz mit Gasflasche gekauft, für etwa 100 Euro. Sie nehmen die Feuerzeuge auseinander, setzen einen neuen Feuerstein ein und füllen mit einer Art Spritze neues Gas ein.
In Gelnhausen lebte eine junge Frau, der man Arbeitsunfähigkeit attestiert hatte und die so gut wie immer in ihrer kleinen Wohnung hockte. Sie freute sich, wenn man sie besuchte, um mit ihr Tee zu trinken. Hatte man ein fast leeres Einwegfeuerzeug, ließ man es ihr da. Sie beklebte das Teil mit buntem Papier und brachte es irgendwann wieder in Umlauf. Diese von ihr reindividualisierten Massenprodukte wurden von ihren Besitzern seltsamerweise als Eigentum behandelt, sie behielten sie sogar wenn sie leer waren und keinen Gebrauchswert mehr hatten.
Durch das Bekleben mit bunten Schnipseln waren diese industriell hergestellten Billigfeuerzeuge Unikate geworden, was einen ähnlichen Unterschied machte wie der zwischen einem Ikea-Stuhl und einem Stuhl von einem Tischler. Wir werden bei dieser kunstvollen Verwandlung des Feuerzeugs an eine vorindustrielle Zeit erinnert, in der alle Gegenstände individuell von Bauern oder Handwerkern hergestellt wurden und sich dementsprechend voneinander unterschieden, wenn auch vielleicht nur in Details.
Der holländische Verhaltensforscher Nikolaas Tinbergen nahm 1932/33 an einer einjährigen Grönland-Expedition teil, worüber er einen „Bericht aus der Arktis: Eskimoland“ veröffentlichte. Darin ist von der außerordentlichen Wertschätzung des Selbsthergestellten bei den Inuit die Rede. Diese ging so weit, dass sie eine gute Kamera oder ein Fernglas nur so lange bewunderten, bis sie erfuhren, dass ihr Besitzer die Dinge fertig gekauft hatte, dann wandelte sich „ihre Bewunderung in eine Art mitleidiges Schulterzucken“.
Bei dem Massenprodukt Kugelschreiber habe ich von einer solchen oder ähnlichen Reindividualisierung, wie sie die junge Frau in Gelnhausen an den Einwegfeuerzeugen vornahm, noch nie gehört, auch das Recyceln stößt bei den Kugelschreibern auf Schwierigkeiten: Wo soll man dafür eine neue Mine und gegebenenfalls auch eine neue Feder hernehmen? Man könnte zwar die Hersteller ausfindig machen, müßte dann aber wahrscheinlich größere Mengen bestellen.
Einwegfeuerzeug und Kugelschreiber unterscheiden sich darin, dass man letztere so gut wie nie auf der Straße findet, im Gegensatz zu den Einwegfeuerzeugen. Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass sie ziemlich billig sind, sie kosten nur etwa einen Euro. Es lohnt sich kaum, sie irgendwie wieder funktionstüchtig zu machen, wenn sie leer sind – es sei denn, man investiert in Werkzeug und Teile und macht daraus ein kleines Gewerbe.
In Firmen, die regelmäßig größere Mengen Kugelschreiber für ihre Mitarbeiter auf Vorrat haben, hat man die Erfahrung gemacht, dass man sie ständig nachbestellen muß. Fast jeder nimmt sie nach Feierabend mit nach Hause – und dort verschwinden sie in der Familie und der nahen oder fernen Verwandtschaft. Auch auf den Arbeitsplätzen, so sie dort abgelegt werden, verschwinden sie laufend – nicht aus Bosheit der Kollegen, sondern weil jemand in der Nähe ganz schnell mal einen Kugelschreiber braucht und anschließend vergisst, ihn zurück zu legen. So etwas passiert auch mit herumliegenden Einwegfeuerzeugen.
.
Seelenfrieden
Alles wird gut – mindestens in den folgenden zwei Lebensgeschichten. Zunächst die von Gerhard, der eines Tages in unsere WG einzog. Der Arztsohn studierte Germanistik, konnte aber nicht mehr zur Uni gehen, weil er menschenscheu geworden war. In unserer Wohnung nahm seine Sozialangst noch zu: Er schlief viel, frühstückte erst, wenn alle aus dem Haus waren und war bald nur noch Nachts auf. Wir sahen ihn kaum. Er tat uns leid, aber dann passierte Folgendes: Eine Mitbewohnerin hatte sich während der „Berlinale“ ein Ticket gekauft, konnte aber nicht hingehen. Sie legte die Kinokarte Morgens auf den Küchentisch, mit einem Zettel: „Lieber Gerhard, bitte guck Dir diesen chinesischen Film über den Abriß eines alten Stahlwerks in der Mandschurei an. Er ist sehr lang. Nur wenige Leute werden ihn sehen. Du tätest mir einen Gefallen.“
Gerhard sah sich den Film an. Im Dunkeln störten ihn die Zuschauer nicht. Von da an ging er immer öfter ins Kino, meist in die „Spätvorstellungen“ nach Mitternacht, die es damals in Westberlin noch häufig gab. Das war während der Studentenbewegung, als man noch viel ins Kino ging und die engagierten Filmemacher aus Italien, Frankreich, Jugoslawien und der BRD den Linken mit Bildern und Geschichten zuarbeiteten. Gerhard wurde mit der Zeit zum Cineasten, zu einem Filmkenner und Genauhingucker. Nachdem er eine Anstellung in einem Programmkino bekommen hatte, zog er aus der WG aus. Später soll er ein Kino in Hessen eröffnet haben. Vielleicht ist er jetzt schon Besitzer einer ganzen Kinokette.
Eine andere Cineasten-Geschichte veröffentlichte die Filmwissenschaftlerin Morticia Zschiesche: „Die kleinen Leute gehen ins Kino“ (2021). Der Titel erinnert an Roland Barthes Bezeichnung des Kinos als „Couch der Armen“. Ich dachte dabei an Gerhards „Heilung“, sah aber auch Bilder von „Ladenmädchen“ und Stenotypistinnen vor mir, die in den 20er-Jahren ihre Attribute als selbständige junge Frauen in den großen Filmen und berühmten Schauspielern fanden. Siegfried Kracauer hat sich in seinen Schriften bis 1933 wiederholt mit ihnen beschäftigt. In Indien wurde ein noch lebender Bollywood-Schauspieler unlängst zu einem hinduistischen Gott. In den USA war in den Achtzigerjahren bereits ein Hollywood-Schauspieler Präsident geworden.
Morticia Zschiesches Cineastin Veronika wird im Gegensatz zu Gerhard von Lebensängsten gebremst: Der Journalistin droht die Kündigung. Ihre jüngeren Kollegen sind sorglos, sie nicht. Ihre Eltern und Schwiegereltern hatten ihr Leben lang „Schicht gearbeitet“. Sie hat einen Aufstieg aus der Arbeiterklasse hinter sich (verheiratet mit einem Chefarzt und kinderlos). Desungeachtet verbindet die 40jährige ihre Kinoleidenschaft mit einer Reihe von Liebschaften mit filminteressierten Männern, die sie immer wieder verunsichern und zudem ihre Ehe gefährden. Dabei kommen Smartphones (Anrufe, SMS, Mails und Facebook) zum Einsatz. In ihrem „Club der Cineasten“ wird derweil bedauert, dass „die Jüngeren“ nicht mehr ins Kino gehen.
Man kann darin einen technologischen Fortschritt sehen. Auch noch, wenn die Erzählerin über Viktorias Sexualleben schreibt: „Die Verhütung war lästige Pflicht, und die Kondome eine Bürde, die die absolute Vereinigung verhinderte.“ Aber eigentlich war es „perfekt“: Ein toleranter Ehemann und tolerante Liebhaber. Ihren Ehering nimmt sie trotzdem ab, wenn sie nach einem Kinobesuch noch mit jemandem ins Bett geht. Doch dann trennt sie sich überraschend von ihrem Mann und zieht aus der „schönen großen Wohnung“ aus. Ihre Lebensversicherung wirft sie in luxuriöser Weise mit ihrer Eheurkunde in den Papierkorb.
Es war ein „Klassenwechsel“ – wie es ihn nur im Film gibt, „die Wirklichkeit hielt gebührend Abstand davon“. Die Cineasten-Boheme war ihr näher. Zum Geldverdienen sichtete sie nun nächtens Filme und schrieb Untertitel dafür. Außerdem organisierte sie mit dem Club der Cineasten einen „Kampf gegen die Schließung eines Kinos“. Einige ihrer Freunde drehten einen Film, ein anderer verliebte sich in eine Frau an der Kinokasse. Es werden viele Titel von anspruchsvollen Filmen genannt.
Richtig glücklich wurde Viktoria aber erst, als es ihr gelang „einen Beamer in Gang zu setzen“ und an ihren „Mac“ anzuschließen, so dass sie fortan „gar nicht mehr vor die Tür gehen mußte“ und sich die „abseitigen Filme direkt an ihr Bett streamen konnte“. Sie vereinsamte dabei aber anscheinend nicht. Während Gerhard seine extreme Sozialangst im Dunkel des Kinos überwand – und damit aus dem Bett fand, führte Viktoria die Filmleidenschaft genau dort hin, wobei das Kino zuvor ihrem „Klassenwechsel“ diente, der jedoch in Morticia Zschiesches Roman weitgehend im Dunkeln bleibt, sie ist wie gesagt eine Film- und keine Wirklichkeits-Wissenschaftlerin.
.
Verdinglichtes Bewußtsein
Mich sprach eine ältere Dame vorm Ausgang des U-Bahnhofs Mehringdamm an. Sie wollte wissen, wo der nächste Sparkassen-Geldautomat sei. „Gleich unten, die Treppe runter,“ sagte ich. Aber dort traute sie sich nicht hin: Zu gefährlich, zu viele Kriminelle! Ich versuchte ihr diese irrige Meinung auszureden – ohne Erfolg.
Die Frau entsprach genau dem Typus, auf den das „Kriminalitätsfurchtparadox“ zutrifft, wie der Kriminologe Joachim Häfele das nennt. Bei älteren Frauen ist die Wahrscheinlichkeit, das sie Opfer einer Straftat werden, am niedrigsten, gleichzeitig haben sie aber am meisten Angst vor Kriminalität, erklärte er in einem Interview, abgedruckt in der Zeitschrift „Kultur & Gespenster“ (13/2012). Die ältere Dame bekräftigte mit ihrer Angst vor Verbrechern die amerikanische „Broken-Windows-Theorie“ (1982), die gar keine ist, nicht einmal eine empirische Studie, sondern ein reaktionärer Aufsatz, der es laut Häfele zur bekanntesten und meistzitierten kriminologischen Schrift weltweit brachte. – Und überall Politikern als Argument diente und dient, mit „Null Toleranz“ alle Bettler, Obdachlosen und Fixer von der Polizei entfernen zu lassen – von Orten, die anständige Bürger sonst als verwahrloste meiden. Wo eventuell Müll und leere Flaschen auf ungepflegten Grünflächen herumliegen – und drumherum womöglich zerbrochene Fensterscheiben zu sehen sind, eben „Broken Windows“.
Unser alter Westberliner CDU-Clanchef Klaus Landowsky sagte es so: „Es ist viel Abschaum an Kriminalität in die Stadt gekommen, von China, über Rußland, Rumänien und so weiter. Es ist nun mal so: Wo Müll ist, sind Ratten, und wo Verwahrlosung ist, da ist Gesindel, und das muß beseitigt werden in der Stadt.“
Demnach entwickelt sich aus „harmlosen Formen physischer Unordnung unweigerlich ein „Hotspot“ der Kriminalität – eine „No Go Area“. Es ist dies eine „Spirale des Niedergangs eines Stadtteils“. Entscheidend ist dabei laut Häfele, dass sich dort „die Menschen unsicher fühlen und sich deswegen zurückziehen“ – so wie die ältere Dame vorm U-Bahnhof, die den Unrat unten witterte, obwohl sie ihn gar nicht sehen konnte und den es gar nicht gibt, im Gegenteil: Es wimmelt dort von Menschen, die alles andere als gewillt sind, diesen Ort zu meiden.
Ein Ort, auf den das eher zuträfe, ist der Platz vor dem U-Bahnhof Kottbuser Tor, der umgeben ist von Beton-Wohnsilos, dem „Neuen Kreuzberger Zentrum (NKZ), errichtet 1974, wo sich auch etliche Läden befinden. Ihre Besitzer klagten, dass die dort sich aufhaltenden Punker und Drogenkonsumenten ihnen alle Kunden vergraulen. Bevor der Bezirk die „Broken Windows“-Theorie zur Anwendung brachte, beauftragte er die New Yorker Stadtplanungskritikerin Toni Sachs-Pfeiffer die Situation am „Kotti“ zu recherchieren. Sie fand, dass die dortigen Gewerbetreibenden ihr mangelndes kaufmännisches Geschick bloß auf die etwas schmuddeligen Jugendlichen abwälzen würden, in Wirklichkeit kämen die „Omis und Opas von weither, um sich die bunten Punker am Kotti aus der Nähe anzusehen.“
Das war in den Achtzigerjahren, inzwischen weiß man, dass diese typische amerikanische Scheiß-“Theorie“ deswegen so erfolgreich war, weil sie der neoliberalen Politik hochwillkommen war, denn sie versprach eine einfache Lösung: „Polizieren“. Verwahrloste Plätze und Orte entstehen jedoch aufgrund privater und öffentlicher Verarmung. Es ist ein Klassenproblem. So ist es auch am „kriminalitätsbelasteten Ort“ Kotti, wo der Bezirk nun eine „gläserne Polizeiwache“ errichten will. Ein Anwohnerbündnis „Kotti für alle“ ist dagegen: Das löse die Probleme des Platzes nicht.
Für die dumme politische Idee „ultrasichere Räume“ macht der Kriminologe Häfele auch die Medien verantwortlich, die mit skandalisierenden Schlagzeilen leichtgläubigen Lesern ständig Angst einträufeln. Das gilt für alle Kapital- und Staatsmedien, in Berlin vor allem für die Springerstiefelpresse (BZ, BILD etc.), die uns täglich nahelegen, nach oben zu ducken und nach unten zu treten. Eine Neuköllner Bürgerinitiative gab 2014 die Parole aus: „Verdreckt euren Kiez, das hält die Investoren ab!“
Für den kleinen Besselpark an der Friedrichstrasse hat man, bevor man ihn von antiökologischen Landschaftsarchitekten für Millionen „verschönern“ ließ, eine Anwohnerbefragung durchgeführt. Angeblich sprach sich eine Mehrheit dafür aus, zwei lange Hecken vorne und hinten, Lebensraum von Insekten und Vögeln, zu vernichten, weil sie Angst hätten, dass ihnen dahinter Verbrecher auflauern. Und nun ist der Park ein vollkommen übersichtlicher Ort – noch und noch mit Beton zugeballert, sauber also, aber dafür sieht man jetzt sofort alle Abfälle und jeden herumliegenden Dreck. Kaum fertig verschönert, sieht er manchmal schon verwahrloster aus als vorher. Einige Trinker, die sich dort treffen, nennen ihn nun den „Fascho-Park“, weil die Bäume um sie herum in Reih und Glied stramm stehen.Ähnliches hat man nun mit dem leicht verwahrlosten Kreuzberger Park an der Ecke Skalitzer-/Mariannenstrasse vor. Derzeit wird alles an „Grün“ dort platt gemacht.
.
Fremdfinanzierte Abenteuer
Der „Geo“-Reporterin für Krisengebiete (Afghanistan, Jemen, Liberia, Haiti, Darfur, Tschetschenien, Libyen) Gabriele Riedle wurde 2014 von der Vorstandsvorsitzenden von „Gruner+Jahr“ gekündigt, weil sie als „Generalistin“ zu „wenig spezialisiert“ sei. Sie beschwerte sich bei ihr mit einem offenen Brief.
Er half nicht, aber nun hat sie „Eine Art Abenteuerroman“ veröffentlicht: „In Dschungeln. Wüsten. Im Krieg“ betitelt. U.a. geht es darin um ihren Bericht aus Papua-Neuguinea, an dem der „Geo“-Chefredakteur ihr „penetrantes Herumreiten auf dem globalen Kapitalismus als Ursache allen Übels“ kritisiert hatte.
Sie und ihr Fotograf begleiteten dort einen mit Pfeil und Bogen ausgerüsteten Einheimischen auf der Jagd nach Baumkängurus, der gelegentlich seine Baumkänguru-Mahlzeiten mit ihnen teilte. Es gibt dort eine Baumkänguruart, die nicht auf Bäumen, sondern am Boden lebt und sehr selten ist.
Dass es sich bei der Beute um genau diese Art, Dingisos genannt, handelt, deren Überleben von der Weltnaturschutzunion (IUCN) als äußerst kritisch eingeschätzt wird, ist wahrscheinlich, denn warum sonst hätte man die Krisen-Reporterin in diesen „Dschungel“ schicken sollen? Der wissenschaftliche Name für die Dingisos lautet „Dendrolagus mbaiso“ und „mbaiso“ bedeutet in der Sprache der in ihrem Verbreitungsgebiet lebenden Einheimischen „das verbotene Tier“: Für so etwas haben die Hamburger Geo-Chefredakteure schon immer üppige Reise- und Spesengelder locker gemacht. Meine Informanten aus Papua-Neuguinea, zwei „Health-Officer“, die viel im Land herumkommen, meinten jedoch: „Wieso ‚Baum‘? Diese Känguruart hat schon immer am Boden gelebt.“
Ich traf die zwei in Manila, wo sie sich auf Einladung der UNESCO zur medizinischen Weiterbildung befanden: Sie gewährleisten die medizinische Versorgung und Gesundheitsprävention in schwer erreichbaren Gegenden, in einer lebten auch ihre Eltern als Subsistenzbauern. Ihr Rang war etwas unterhalb von ausgebildeten Krankenschwestern angesiedelt, man könnte sie als „Barfuß-Krankenpfleger“ bezeichnen, eingebunden jedoch in ein englisches Gesundheitssystem, das kostenlos war oder noch ist. Einer der beiden „Health-Officer“, er war etwas devoter als der andere, bezeichnete die „Heiler“ und „Schamanen“, die Geld für ihre Behandlung nehmen, als seine „Hauptgegner“, die er als „Betrüger“ bekämpfte. Während der andere, der souveräner wirkte, bei dem „Hauptproblem“ in seinem Distrikt – die Bisse einer bestimmten Giftschlange – sogar die „Zauberdoktoren“ um Hilfe bat, die in solchen Fällen die Bißstelle mit Lehm und bestimmten Pflanzensäften beschmieren und dazu Zaubersprüche murmeln: „Das hilft fast immer – und ich spare mein teures Serum,“ erklärte er mir.
Die beiden Health-Officer nahmen also zwischen dem „wilden“ und dem „wissenschaftlichen Denken“ unterschiedliche Positionen ein. Wir diskutierten dann über die westliche Anthropologie, diese behauptet u.a., es gäbe ein Wissen über den Zusammenhang zwischen Geschlechtsverkehr, Zeugung, Schwangerschaft und Geburt. Die Kenntnis reiche weit über die westlichen Gesellschaften hinaus und betreffe eigentlich alle Menschen, ja sogar die vieler Tiere: Wenn z.B. männliche Löwen oder Schimpansen als neue Rudelführer alle nicht von ihnen abstammenden Jungen töten, damit sie schneller – mit ihren Genen versehene – eigene Nachkommen zeugen können.
Dem gegenüber stehen ethnologische Feldforschungen – beginnend mit denen von Bronislaw Malinowski bei den Trobriandern, deren Inseln zu Papua-Neuguinea gehören: Trotz guter anatomischer Kenntnisse leugnen die Trobriander den Zusammenhang von Geschlechtsverkehr und Schwangerschaft, dennoch werden unverheiratete Frauen, obwohl sie viel Geschlechtsverkehr haben (können), fast immer erst nach ihrer Heirat schwanger. Weil erst dann ein „Vater“ da ist, „der das Kind in den Arm nehmen kann, wie sie sagen“. Der Vater ist bei den Trobriandern also keine biologische, sondern eine rein soziale Kategorie.
Malinowski schrieb: „Da die Zeugungsfunktion des Geschlechtsakts unbekannt ist, weil die Samenflüssigkeit als harmlos gilt, ja als wohltuende Ingredienz, gibt es keinen Grund, ihr Eindringen zu verhindern – deswegen kennen die Trobriander auch keine Verhütungsmittel.“ Und das gilt nicht nur für die Menschen, sondern auch für ihre Hausschweine, deren weibliche Tiere, da alle männlichen kastriert werden, sich von männlichen Wildschweinen im nahen Urwald decken lassen, was die Trobriander jedoch heftig bestreiten, zumal sie Wildschweinfleisch verabscheuen und nur das Fleisch von ihren Hausschweinen essen.
Die beiden Health-Officer vertraten natürlich die aufgeklärte westliche Position in dieser Frage. Bei den Baumkängurus, die am Boden leben, war es jedoch umgekehrt, denn ich berief mich dabei auf Wikipedia, dessen Eintrag sich auf den für mich abstoßenden australischen Biologen Tim Flannery und seinen „Abenteuer“-Bericht „Dschungelpfade“ (2003) stützt sowie auf eine BBC-Dokumentation: „Die Südsee – Das Abenteuer“ (2009). Beide handeln vom Dingiso-Baumkänguru, das irgendwann beschloß, wieder am Boden zu leben.
–

.

.
Flüsse als Objekte
Vier völlig unterschiedliche Bücher über Flüsse. Zunächst das von Gabriele Riedle und Viktor Jerofejew: „Fluss“ (1998) Es handelt sich dabei um die Flüsse Wolga, Rhein, Ganges, Mississippi und Niger, die das Liebespaar als Lustreise befuhr. Riedle besorgte das Geld: Sie und Jerofejew veröffentlichten dafür über jede Flußfahrt einen Doppeltext – in einer Art Dialog. Man erfährt dabei nicht viel über die Flüsse und ihre Umgebung. Stattdessen geistreiche Gedanken, die den beiden an Deck und in ihrer Kajüte einfielen. „‘Ich liebe die Flüsse, die flinken Schlangen des Lebens. Ich liebe ihre silbrige Haut‘. Ein Russe und eine Deutsche bereisen fünf Flüsse, aber die Welten, die sie vorfinden, sind uferlos und scheinen verzaubert. Ein Roman in zwei Stimmen über eine abenteuerliche Expedition,“ heißt es im Klapptentext. Riedle brachte ihn zunächst auf Deutsch heraus, als Jerofejew die russische Ausgabe besorgte, waren darin gemeinerweise nur noch seine Monologe abgedruckt.
Das zweite Fluß-Buch „Die Elbe. Europas Geschichte im Fluß“ (2013) schrieb der Historiker Uwe Rada. Es ist z.T. eine Recherche für einen Film und eine familiale Spurensuche. Der polnisch sprechende Autor veröffentlichte bereits Bücher über die Oder und die Memel. Er hat in den Flüssen sein Thema gefunden. Als nächstes kommt vielleicht ein Buch über die Weichsel. Hoffentlich macht er kriegsbedingt nicht am polnischen Grenzfluß Bug Halt – auf seinem Fluß-Studien-Weg gen Osten, denn die großen Flüsse Dnepr, Ob, Jenissei, Lena, Amur etc. kommen ja in der Richtung erst noch.
Neulich lief eine TV-Doku über die Lustreise eines älteren Ehepaars mit ihrem Segelschiff die Ostseeküste entlang „Von der Oder bis zur Newa“ (St.Petersburg), wie es in der Ankündigung hieß, aber der Film endete vor der Grenze zu Kaliningrad im Nogat-Delta. Wegen des Kriegsausbruchs in der Ukraine wollten die ARD-Redakteure wohl den deutschen Zuschauern keine idyllischen Urlaubseindrücke aus Russland zumuten.
Die Elbe ließ bei Rada keine solche Bedenken aufkommen – auf ihrer 1094 Kilometer-Strecke vom Riesengebirge bis zur Mündung in die Nordsee. Sie hat nur ein kleines Problem: Dort wo ihr Nebenfluß, die Moldau, in die Elbe mündet, ist jene breiter als diese – und deswegen müßte nach allen internationalen Gepflogenheiten bei der Benennung eines Flusses die Elbe eigentlich Moldau heißen.
Immerhin gibt es am Prager Ufer in Hamburg noch einen Moldauhafen, der den Tschechen gehört. Inzwischen ist ihnen allerdings dieser Außenposten (mit dem „Böhmen am Meer“ liegt – ein Sehnsuchtstopos, den die Dichter mehrmals bemüht haben) laut Rada „eher eine Belastung. Der Rückzug der Tschechen weckt in Hamburg Begehrlichkeiten“ – auf die 30.000 Quadratmeter große Immobilie am Fluß. Ihre tschechische Verwaltungsgesellschaft (CSPL) wurde vom Konkursverwalter bereits nach Magdeburg an die mittlere Elbe verlegt.
Einer der Vorbilder für Radas Flußgeschichten ist Peter Ackroyds Buch über die Themse, für den „das Schicksal Englands innig mit dem dieses Flusses verknüpft ist“. Ackroyd nennt seine Arbeit „liquid history“. Auch Rada will eine Geschichte des Flusses schreiben, wobei er ihn nicht „zum Objekt der Geschichte“ machen will, er schrieb dennoch eine Menschengeschichte und keine Fluß-Biographie, was die Lektüre seines Buches jedoch nicht schmälert.
Anders der Gewässerökologe Josef Reichholf mit seinem Buch „Flussnatur. Ein faszinierender Lebensraum im Wandel“ (2021). Es geht ihm darum, die Zusammenhänge herauszuarbeiten zwischen dem Wasser, den Wassertieren und-pflanzen, den am Wasser lebenden Vögeln und Säugetieren, dem Wetter und den Eingriffen der Menschen – vor allem in die Flüsse Isar und Inn (aber auch in Elbe und Donau) durch Begradigung, Eintiefung, Stauung, Einleitung von Abwässern und Giften, Trockenlegung von Auwäldern und Renaturierung. Dabei stößt Reichholf auf „widerstreitende Interessen“ zwischen Ökologie und Ökonomie. Letztere vertreten durch Angler, Ausflügler, Schiffseigner, Landwirte, Krafwerksbetreiber und Mühlenbesitzer. Sein Flußbuch ist „ein bewegendes Plädoyer für diesen Lebensraum,“ schreibt „spektrum.de“. „Als bekennender Naturschützer plädiert Reichholf dafür, Flüsse durch Renaturierung wieder mehr Raum zu geben. Denn nur so könnten sie auch wieder vor Hochwässer schützen.“
Für den Autor sind Flüsse Subjekte, Akteure, mehr noch: Sie bestehen aus unzähligen Akteuren, jedenfalls so lange bis sie „umkippen“, weil sie die fortwährende „Abflussertüchtigung der Fließgewässer“ nicht verkraften.
Noch tiefschürfender sind nur die jahrzehntelangen Studien der Forscher der limnologischen Fluss-Station Schlitz der Max-Planck-Gesellschaft. Sie konzentrierten sich dabei auf den bloß vier Kilometer langen Breitenbach, einem kleinen Nebenfluß der Fulda, der nach über 50 Jahren das am Besten erforschte Fließgewässer der Welt ist: Grundlagenwissen für alle Fluß-Biographen. Dazu sei von ihren vielen Publikationen nur das Buch „Central European Stream Ecosystems: The Long Term Study of the Breitenbach“ (2011) erwähnt.
.
Lippenstifte
In der Schule redeten wir Jungs gerne darüber, was und wie wir irgendetwas klauen würden – im Supermarkt oder im Kaufhaus z.B.., während die Mädchen desinteressiert bis abschätzig zuhörten. Erst viel später kamen wir dahinter, dass sie zwar nie übers Klauen redeten, aber dafür umso öfter klauten – Lippenstifte. Mit einer Schulfreundin ging ich einmal in eine Drogerei, wo ich einen Lippenstift für sie klaute. Sie fand Farbe und Marke jedoch unannehmbar, ich sollte beim nächsten Mal lieber Schmiere stehen und das Stehlen ihr überlassen.
Der „Liebesstift“ ist weltweit das meistverkaufte Schönheitsprodukt, Millionen Frauen zwischen 15 und 95 benutzen ihn täglich, heißt es auf der Internetseite des Berliner Lippenstift-Museums des „Starvisagisten“ René Koch, der auch ein Buch über die Geschichte des Lippenstiftes „Lucky Lips“ veröffentlichte. In seiner Sammlung befinden sich u.a. 150 Kussabdrücke von diversen Diven wie Milva, Bonnie Tyler und Hildegard Knef. Die Exponate reichen von den Anfängen des Kosmetikprodukts über die Nutzung von Lippenstiften in Film und Fernsehen hin zur Hippie-Ära und der Verbreitung des Stiftes in der Bevölkerung. Seine Museumseinladungen sind begehrt.
Die Journalistin Elisabeth Wirth schreibt über Lippenstifte: „Der amerikanischen Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez geben sie den nötigen Schub Selbstbewusstsein, sie sind in ihrem ersten Wahlkampf ihr signature look geworden. Der Journalistin Senka Kurtovic gelang es mit ihnen, den Anschein von Normalität während der Zeit der Belagerung von Sarajevo in den 1990ern aufrechtzuerhalten. Und die Schriftstellerin Herta Müller behauptete in den Verhören des rumänischen Geheimdiensts mit ihnen ihre Würde. Rote Lippen. Widerstand, Subversion, Verwandlung, Selbstbehauptung, Macht, Verführung...
Im 18. Jahrhundert erließ das britische Parlament ein Gesetz, das Männern erlaubte, eine Ehe zu annullieren, wenn sie behaupteten, sie seinen heimtückisch von den rotgefärbten Lippen einer Frau hinters Licht geführt und um ihre Freiheit betrogen worden.“
Die Corona-Pandemie hat nun allerdings den Lippenstift-Verbrauch stark eingeschränkt, denn zum Einen sieht man die Lippen nicht hinter der FFP2-Maske und zum Anderen schmiert man diese damit von innen voll.
Der Chemiker und Schriftsteller Primo Levi eröffnete nach seiner Befreiung aus dem KZ Auschwitz ein Chemielabor in Turin. In seinem Buch „Das periodische System“ (1979) erzählt er im Kapitel „Stickstoff“, wie es dazu kam, dass er sich einmal mit der Herstellung eines kussfesten Lippenstiftes beschäftigte: „…und endlich kam der Kunde, von dem wir immer geträumt hatten,“ heißt es gleich am Anfang. Es war ein Lippenstifthersteller, er arbeitete in einer „verlotterten Halle“ mit etwa einem „Dutzend dreister junger Mädchen“.
Sein Herstellungsverfahren war einfach: Es wurden in einem Emailletopf Wachse und Fette geschmolzen, dann einige Duft- und Farbstoffe hinzugegeben und das Ganze in eine „winzige Form“ gegossen. Diese wurde unter fließendem Wasser gekühlt. Das wars, aber das reichte nicht. „Der Besitzer griff sich grob eines der Mädchen“ und zeigte dem Autor ihre Lippenränder: Sie waren verschmiert. „Jeden Morgen mußten die Mädchen Lippenstift auftragen und er küsste sie achtmal am Tag, um zu prüfen, ob sein Erzeugnis kußfest war.“ Primo Levi sollte ihm einige Kilo Alloxan besorgen, das nicht wie aufgetragene Farbe wirke, sondern eine echte und dauerhafte Färbung der Lippen bewirke.
Primo Levi machte sich in einer Bibliothek kundig: Alloxan war ein Derivat des Harnstoffs. Der Mensch schied nur wenig davon aus, in den Exkrementen von Vögeln war es jedoch 50 Prozent. Zusammen mit seiner Frau machte sich Primo Levi auf den Weg, um bei Bauern Hühnermist zu erwerben. Im Labor versuchte er dann das Alloxan auszulösen. Die Arbeit brachte ihm jedoch „nur schmutzige Dämpfe, Ärger, Erniedrigungen und eine schwarze trübe Flüssigkeit“ ein, „die auf irreparable Weise den Filter verstopfte und keinerlei Neigung zum Kristallisieren zeigte, wie es nach dem Lehrbuch hätte der Fall sein müssen.“ Trübsinnig gab er den Auftrag an den Lippenstiftunternehmer zurück.
Seitdem haben sich zigtausende von Chemiker weltweit bemüht, kussfeste Lippenstifte herzustellen. Empfohlen wird im Internet der Stift „Always on liquid lipstick von Smashbox in der Farbe Miss Conduct“. Dazu gibt es auch noch „Magic Fix“: ein „Lippenstiftfixierer für kussechte Lippen“. Desungeachtet stecken „krebserregende Stoffe, Erdöl und zerquetschte Tiere [Cochenilleschildläuse] in den Lippenstiften,“ heißt es auf einer Internet-Plattform, und weiter: „Die Naturkosmetikunternehmen Raw Natural Beauty errechnete 2009, dass jede Frau im Laufe ihres Lebens ungefähr 3,5 kg Lippenstift isst.“
Das Magazin „Ökotest“ fand in den Stiften den Farbstoff Tartrazin, der Juckreiz und Ausschläge verursachen kann. Hinzu kommen Konvervierungsstoffe wie Parabene, die sich „negativ auf die Fortpflanzung auswirken“ können. Dies gilt auch für das Pigment Titandioxid, das so gut wie alle Lippenstifte enthalten, „auch Naturkosmetik,“ wie die Stiftung Warentest schreibt. Es gibt Stifte, die als „vegan und tierversuchsfrei“ gelten. Aber nur wenige Lippenstifthersteller verzichten auf Tierexperimente.
.
Die „breite Mitte“
Gerade dafür, meinte der FDP-Finanzminister Lindner kürzlich, brauche es Steuersenkungen. Also nicht mehr für die Großverdiener, sondern für die „breite Mitte“. Wer ist das überhaupt? Es war mal nach dem Krieg in der BRD ein Wirtschaftsziel, eine wachsende „Mittelschicht“ zu schaffen, durch eine immer größeren Arbeiter-Anteil. Die Arbeiter sind integriert, verbürgerlicht, kam es in den Sechzigern aus den USA vom Mitdenker der Studentenbewegung Herbert Marcuse, deswegen müsse man sich als linke Bewegung den „Randgruppen“ der Gesellschaft zuwenden. Hier entstand daraus eine ganze „Randgruppen-Strategie“.
Mit der Einrichtung von 12 neuen „Reformuniversitäten“ machte die Regierung von Willy Brandt dann beinahe Ernst mit der Integration der Arbeiter, denn fortan brauchten diese dazu bloß ein harmloses „Begabtenabitur“ an den Unis ablegen und waren Studenten, gleichzeitig holte man die meisten Rädelsführer aus der Studentenbewegung in die Planungsausschüsse der neuen Unis sowie als Professoren. Damit bewegte man die Studentenmassen von der Strasse weg wieder in die Unis zurück, wo ihnen sogar „Drittelparität“ versprochen wurde, die dann aber ein Gericht kippte.
Seit den Achtzigerjahren und der neoliberalen Wende inklusive Privatunis ging es wieder rückwärts mit der Zahl der Arbeiter an den Universitäten. Und nicht nur das, die Soziologen registrierten auch eine „Brasilifizierung“ , die mit einer „Polonisierung“ einhergeht. Ersteres heißt: die Mittelschicht löst sich zu kleinen Teilen nach oben und zu großen nach unten auf. Damit geht Letzteres einher: Es entstehen massenhaft kleine Klitschen, neuerdings auch Start-Ups genannt. Kurzum: Von einer breiten Mitte (wide middle) kann schon lange keine Rede mehr sein, höchstens wie nach dem Krieg als politisches Versprechen. Fast schon ein Bonner Parteienkonsens damals. Nehmen wir an, Lindner ist wieder dort angekommen und meint nun, mit Steuererleichterungen wird die Mitte breiter. Er würde vielleicht sogar sagen: „noch breiter“. Auf der Internetseite „liberale.de“ ist dazu von einem ganzen „Entlastungspaket für die breite Mitte“ die Rede. In der TV-Talkshow von May-Britt Illner führte Lindner laut „n-tv.de“ aus: „…Müssen uns um die breite Mitte kümmern“. Bei dem Wort „kümmern“ muß man natürlich sofort an die Aufforderung der brandenburgischen SPD-Sozialministerin Regine Hildbrandts denken, die sie in einer Talk-Show von Christoph Schlingensief äußerte: „Also kümmern se sich!“ Überhaupt war das Kümmmern ihr Leitmotiv. Und gegen eine breite Mitte hätte sie wahrscheinlich auch nichts gehabt – leitmotivisch.
Sie starb 2001 in Woltersdorf. Und seitdem hat sich einiges weiter verändert. Der Club of Rome wurde quasi abgelöst von einem Club of Davos. Und „die breite Mitte wird immer dünner,“ wie „Die Zeit“ 2015 feststellte. Und so wirkt sich diese „Brasilifizierung“ z.B. in Brasilien aus: Dort kam es 2015/16 zu einer „Zika-Epidemie“, ausgelöst von einem Virus, der u.a. von der Tigermücke übertragen wird. Gefährlich ist das Zika-Virus vor allem für Ungeborene, deren Mütter während der Schwangerschaft infiziert werden. Die Epidemie verbreitete sich vor allem in den Favelas und Armenquartieren, wo in Pfützen, Abwasserkanälen und Regentonnen günstige Bedingungen für die Mückenlarven bestehen. Und für die Mücken offene Fenster. Die Regierung mußte den nationalen Notstand ausrufen. Es kamen Epidemiologen aus aller Welt und von dort bald auch Impfstoffe. Es wurden dafür und für alles, was damit zusammenhing, Milliarden ausgegeben, aber keinen Cent für versiegelte Straßen, geschlossene Abwasserkanäle, überdachte Zisternen usw. in den riesigen Wohngebieten der vom Zika-Virus Betroffenen.
Dahinter steckt nicht nur eine imperialistische Kolonialisierung (Verkauf von patentierten Impfstoff und Einrichten von Impfzentren), sondern auch ein Rückfall in die finstersten Anfänge der (englischen) Beschäftigung mit den Armen: Die Bürger hatten Angst vor den Seuchen, die dort wegen der katastrophalen Lebensbedingungen auf engstem Raum ausbrechen konnten, aber genauso auch vor dem Ausbruch von Revolten dort. Zu den Pionieren der „Slumforschung“ Mitte des 19. Jahrhunderts gehörte der englische „Punch“-Herausgeber Henry Mayhew. Obwohl der Professor für Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität Rolf Lindner dessen Schriften für seine Seminarteilnehmer kopierte, wußte ich nicht, obwohl ich es mir hätte denken können, dass „manche Angehörige der Unterschichten mit der Art, wie Mayhew sie in seiner Reportage schilderte, nicht einverstanden waren. Eine Gruppe von Straßenhändlern schloss sich 1851 gegen den Journalisten zusammen und gründete eine „Street Trader’s Protection Association“ (Wikipedia).
In Deutschland begann die „Unterschicht-Forschung“ und Betreuung ebenfalls infolge der wachsenden Ängsten der Wohlhabenden vor den ansteckenden Krankheiten und der kollektiven Wut der unteren Klassen – Arbeiter und Lumpenproletarier. Die erste Berliner Unterschicht-Studie entstand in Friedrichshain. Dort gingen auch die Damen der besseren Gesellschaft zur Kontrolle in die Häuser der Armen, um sich bei den Bewohnern nach ihrem werten Befinden zu erkundigen.
.
Essen auf Rädern
„Heute bleibt die Küche kalt, heute gehen wir in den Wienerwald,“ hieß einst der Werbespruch der ersten Schnellrestaurantkette (gegründet in München 1955), in der es Hähnchenprodukte, auch zum Mitnehmen, gab. Heute heißt es ähnlich – von der finnischen Lieferfirma „Wolt“: „Berlin erreicht Herd-Immunität“. Der Unterschied: In den „Wienerwald“ ging man vielleicht einmal im Monat, Wolt will, dass man Zuhause bleibt und sich täglich von ihr ein „Essen auf Rädern“ bringen läßt. So wie es für bewegungsbehinderte Alte oder Kranke angeboten wird. Das ist allerdings kein „Schnellessen“.
Fast im Monatstakt werben heute neue Bringdienste in den U-Bahnhöfen. Ich vermute, dass dahinter jedesmal clevere Millenials stehen, die ständig an ihren Smartphones rummfummeln, sich nächtens Fastfood und Softdrink-Mist kommen lassen und dann einen Bringdienst als „Start-Up“ gründen, indem sie einen Schwarm armer Schweine als Ausfahrer einstellen. Bei einem umfassenden „Lockdown“ verspricht dieser Ami-Quatsch ein Bombengeschäft zu werden.
Beim Lieferdienst „Gorillas“ streikten kürzlich einige Fahrer, sie wurden entlassen. Anders als bei den Handwerksbetrieben gibt es anscheinend genügend Leute, die so einen „Job“ machen, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Ich kenne allerdings einige Ausfahrer, die das machen, weil sie leidenschaftliche Radfahrer sind – arme Irre! Ich kenne auch einige Lieferdienste, die wir 2020 in Anspruch nahmen, um ihren „Service“ zu testen: Das Zeug, ob thailändisch, italienisch oder türkisch, schmeckte schlecht, stank, war lauwarm, ausgepackt ein ekelhafter Anblick und hinterließ jedesmal einen halben Mülleimer voll Verpackungsmaterial.
Diese Lieferdienste sind nur was für Amis und ihre gehirngewaschenen Followers, die sowieso von Hamburger, Pizzas und ähnlichem Zeug leben. In Deutschland gibt es daneben noch Döner und Currywurst im Fast-Food-Angebot, was aber auch nicht besser ist. Am Bescheuertsten sind die „vegetarischen Döner“ (Gemüse-Kebab), weil an deren Verkaufsständen (berühmt ist der am Kreuzberger Mehringdamm) ständig zig Leute Schlange stehen, denn es ist „total angesagt“, dort das Billiggrünzeug in sich reinzustopfen – ein Fake-Slow-Food.
Schon etwas besser ist der gediegene „Start-Up“ der Mongolistin Katherina: „Soup Kultur“. Sie bietet in ihren vier Berliner Läden wie der Name schon sagt Suppen und einige wenige andere Speisen an. Man kann sie auch mit nach Hause nehmen: Es gibt dazu gegen Bezahlung von ihr ausgeklügelte „Henkelmänner“. Berühmt wurde dieses System in Bombay: Dort kochen die Ehefrauen von zigtausend in der City arbeitenden Männern das Essen zu Hause, das sie in Warmhaltegeschirr packen und erst mit Zug und dann von Trägern zu ihren Gatten bringen lassen. Weil jede Mahlzeit auch täglich an den richtigen gebracht werden muß, sind die Träger, die dieses logistische Wunder – ab Victoria-Hauptbahnhof – vor allem bewerkstelligen, inzwischen Protagonisten von vielen in- und ausländischen Dokumentarfilmen geworden.
Während der chinesischen Kulturrevolution weigerten sich Bäuerinnen, ihren Männern täglich das Essen aufs Feld zu bringen. Vor allem, weil sie mitbekamen, dass diese, auf den kleinen Reisfeldern nebeneinander arbeitend, dabei ständig diskutierten, während sie, jede für sich allein, still im Haus arbeiten mußten: Sie forderten Dorfkantinen – „Volksküchen“ in den Kommunen dann genannt. Das war zur selben Zeit auch eine Forderung der Linken in Westberlin. Noch heute gibt es dort ein paar „Volxküchen“.
In der LPG gab es – von der Küche aus zu den Außenstellen in den Nachbardörfern – einen „Lieferdienst“, d.h. einer aus der Fahrer-Brigade brachte uns täglich das Essen, ebenfalls in speziellen „Henkelmännern“ (ohne Henkel). Es war zwar nicht lauwarm, schmeckte aber trotzdem nicht besonders.
Ähnliches gilt für das Essen in vielen Betriebskantinen: Ein Gericht für eine Familie oder eine kleine Gruppe zu kochen, ist leider in physikalisch-chemischer Hinsicht etwas ganz anderes als ein Gericht für über 100 Leute zu kochen. Im Batteriewerk Oberschöneweide (BAE) kam noch etwas anderes hinzu: Dort knallte ein Arbeiter dem Parteisekretär Petras, den übrigens alle mochten, das Essen mit der Bemerkung auf den Schreibtisch: „Dieser Fraß ist ungenießbar!“ Petras versprach, sich darum zu kümmern. Und tatsächlich wurde das Essen auch besser. Aber nur für einige Wochen, „dann steckte das Küchenpersonal die besten Zutaten wieder für sich ein,“ wie einige der Arbeiter mutmaßten. Der Kantinenfraß wurde auf alle Fälle erneut ungenießbar.
In den Mensen der BRD-Universitäten fand in den Achtzigerjahren ein Wandel statt: Zum Einen wetteiferten die Chefköche untereinander um das beste Essensangebot und zum Anderen ließen sie sich neue Gerichte einfallen – u.a. vegetarische. Gleichzeitig wurden die Gerichte auf den Speisekarten immer anspruchsvoller benamt – gerne mit Wörtern aus den romanischen Ländern, deren Küchen einen guten Ruf hatten und immer noch haben. Auch in vielen Restaurants habe ich leider den Eindruck, dass die Köche die meiste Energie und Leidenschaft auf die Benamung ihrer Speisen verwenden.
.
Start-Upper
Wir haben inzwischen eine wahre Start-Upper-Pest. Über die bescheuerten Lebensmittel- und Restaurantspeisen- und vor allem Fastfood-Auslieferer habe ich mich erst mal genug echauffiert. Aber es scheint auf diesem windigen Internet-Markt wahre Moden zu geben. Eine Weile lang warben ständig neue Bankgründungen in den U-Bahnhöfen, sie nannten sich Smartphone-Banken: Alle Geldgeschäfte werden bei ihnen angeblich „easy“ und „schnell“ erledigt – mittels „financial technology“. Deswegen heißen sie auch „Fintech-Banken“.
Es würde mich nicht wundern, wenn unsere amihörigen Politiker demnächst das Bargeld abschaffen, damit diese verdammten Start-Up-Banker wirklich durchstarten können. Es gibt inzwischen eine Unzahl „Finanz Startups“ – und alle wollen mit unserem Geld „arbeiten“. Daneben sind sie – als geplante Aktiengesellschaften – auch auf Aktionäre scharf, eine Finanzzeitung meint jedoch: „‘Es reicht nicht, Fantasien zu verkaufen‘ – ruppiges Börsenklima für Fintechs“.
Nach ihren einmaligen Plakataktionen in den U-Bahnhöfen sah und hörte man übrigens nie wieder etwas von diesen virtuellen Banken. Wikipedia listet nur noch fünf von 900 auf.
Aber dafür gibt es nun neue Start-Ups, sie alle wenden sich, wie auch die anderen zuvor, an naßforsche Millennials und werfen deswegen mit Amerikanismen nur so um sich. Eins nennt sich „taxfix“: dieses Start-Upp will die jährliche Steuererklärung für uns erledigen. Als wenn es nicht schon genug Steuerberater gäbe. Das Problem dabei ist doch, dass diese, ebenso wie die neuen taxfixer, Geld für ihre Arbeit haben wollen, das ich jedenfalls nicht habe, weswegen ich meine Steuerklärung selbst mache. Die taxfixer werben dazu noch mit dem extrem unseriösen Spruch: „Schluss mit Steuer-blablablabla-erklärung“. Daran sieht man, dass sie anscheinend noch wenig Ahnung von Steuererklärungen haben, denn dabei erzählt man kein „blahblah“, sondern zählt Zahlen.
Noch schlimmer, geradezu gemeingefährlich sind die Start-Ups der Drogendealer. Kurando z.B., das uns „Medikamente in 30 Minuten“ liefern will: „Free delivery. Bestelle jetzt…“
Oder „Mayd“, das ebenfalls verspricht, uns die Zahnschmerz-Tabletten in „30 Minuten“ zu liefern. Renner sind angeblich die nicht-rezeptpflichtigen Potenzmittel. Das Start-Up kooperiert mit Apotheken. Diese nehmen die Bestellungen auf und kommissionieren sie, d.h. sie stellen die Ware zur Abholung bereit. Mayd hat bloß die Fahrer, die sie ausliefern. Wir haben es also auch hier mit einem oder mehreren Cleverlies (in Sneakers und Kapuzenpullis) zu tun. Sie sitzen in ihrer Computer-Zentrale und stellen einen, mehrere, oder wenn es gut läuft: ganz viele arme Schweine oder besessene Sportler ein, die mit Fahrrad bei Wind und Wetter durch die Stadt jagen – und dabei ständig ihr Firmen-Smartphone am Ohr haben.
Auf „businessinsider.de“ heißt es: „Mayd ist nicht das einzige deutsche Startup mit dieser Idee. Nach der aktuellen Seedrunde ist es allerdings das am besten finanzierte.“ Eine „Seedrunde“, das sind Samenspender: Auf der „businessinsider“-Plattform heißt es dazu: „Von ihrer ersten Firma McMakler sind die Gründer Hanno Heintzenberg und Lukas Pieczonka bereits große Finanzierungsrunden gewöhnt. Nun haben sie für ihr neues Startup Mayd eine beachtliche Seedrunde in Höhe von insgesamt 13 Millionen Euro abgeschlossen. Das Geld kommt von 468 Capital, Earlybird und Target Global. Laut eines Linkedln-Posts von Gründer Pieczonka haben auch bekannte Business Angels wie etwa die Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer, der Auto1-Gründer Hakan Koc, Aitme-Chef Emmanuel Pallua und die drei Flixbus-Gründer investiert.“
Wahrscheinlich sind die Samenspender alle selbst erfolgreiche Start-Upper, ebenso vielleicht sogar die Autorin Sarah Heuberger, die diese Mayd-Meldung auf „businessinsider.de“ (auch ein Start-Up – für Start-Upper?) veröffentlichte.
Um was geht es bei diesem „Angriff der quietschgrünen Pillenverkäufer“ von MAYD? fragte sich der „stern“.Wir schlucken oder spritzen doch sowieso schon zu viele Drogen gegen und für alles Mögliche – und sind sogar Weltmeister beim Wegspülen von Medikamenten in Toiletten. Nur die Amis nehmen noch mehr Tabletten, viel mehr. Eine Vergleichs-Studie ergab: Bei ihnen wirken sie auch besser als bei uns. Nebenbeibemerkt kann man in den USA auch kaum noch Lebensmittel im Supermarkt kaufen, die nicht gentechnisch „optimiert“ wurden, wie eine andere Studie ermittelte.
Mayd war so erfolgreich als Drogendealer, dass seine Vertragsapotheken nicht nachkamen mit den Bestellungen. Einige Start-Upper haben bereits Lieferdienst und Apotheke verbunden: die Versandapotheke „DocMorris“ z.B., die 2000 von einem niederländischen Apotheker und einem deutschen Ingenieur gegründet wurde und jetzt dem Schweizer Konzern „Zur Rose Group AG“ gehört.
Die traditionellen Drogendealer wehren sich zwar gegen DocMorris, haben aber eigentlich schon vor dem erfolgreichen „New Dealer“ kapituliert – als „Start-Downs“: „Für den Apothekerverband ist die Strategie von DocMorris nur Augenwischerei. ‚Es gibt jetzt schon viele Einkaufsgemeinschaften von Apotheken, die sich auch in einem gemeinsamen Look präsentieren. Diese kaufen bei Großhändlern billiger ein und unterbieten oft die Preise von DocMorris‘, sagt Annette Rogalla, Sprecherin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände“ dem „stern“-Autor Malte Arnsperger, der an sich Leiter des „News-to-be-smart“-Rooms bei BURDA FORWARD ist, was der „Bunte“-Besitzer Hubert Burda als „digitales Medienhaus der Zukunft“ bezeichnet. Dieses „Forward“ (Vorwärts) läuft wahrscheinlich auf eine „Bunte für die Start-Upper-Class“ raus.
.
Socken
Im Internet findet man über Millionen Einträge zum Stichwort „Socken“, u.a. diesen: „Kann denn der Führer des deutschen Volkes nicht mal ein anständiges Paar Socken bekommen?!“ Schimpfte Adolf Hitler. Ein anderer Eintrag lautet: Eine Lehrerin aus Hagenow schickte ihm ein paar Strümpfe: „Während Sie das Sudetenland befreiten,“ schrieb sie, „habe ich diese Strümpfe für Sie gestrickt. Nun haben wir beide unser Ziel erreicht, Sie ein großes, ich ein kleines.“
Der „Völkische Beobachter“ berichtete, dass „alte Frauen“ Strümpfe für den Führer gestrickt und ihm dazu geschrieben hätten, „dass er doch keine Mutter hätte, die für ihn sorgte und sie möchten nun gerne für ihn sorgen“. Die Frauenschaft des Gaus Groß-Berlin strickte 12.000 Paar Socken, allerdings nicht für Hitler, sondern für seine Soldaten. Aber andere Frauenschaften des Reiches strickten auch Socken für den Führer persönlich.
2016 berichtete die „Morgenpost“ von einer Auktion in München: „Sie sind schwarz, nicht braun: Adolf Hitlers Socken stehen in München zum Verkauf, für mindestens 500 Euro. Die polnische Firma „Nanushki“ sorgte mit Hitler-Socken für Empörung: Unter dem Namen „Adolf“ bot die Firma Socken an, die das Gesicht Hitlers im Comic-Design zeigen. Nur 25 Zloty (ca. 6 Euro) sollte das Paar kosten. „Adolf“ sei ein „kluger Stratege“ und der „geborene Führer“. „Er hat den Auftrag, die Sockenschublade zu überwachen. Das macht er sehr effektiv. In seiner Freizeit entwirft und zeichnet er einen Plan, um die Welt zu erobern“, so die Beschreibung zum Produkt. Für den respektlosen „Scherz“ erntete die Firma einen Shitstorm. „Uns fehlen die Worte“, schrieb etwa das „Auschwitz Memorial“ auf Twitter.
„Socken sind an sich ja eine gute Idee – ohne Socken wäre unsere Welt wohl ein kälterer Ort, zumindest an den Füßen,“ schrieb ein Autor im „stern“, aber es gäbe dabei ein Problem: „den weltweiten Sockenschwund in Waschmaschinen“. Er dachte sich deswegen Möglichkeiten aus, um die Sockenpaare auch im Schleudergang zusammen zu halten. Ich entschied mich irgendwann für eine andere Lösung: Nur noch gleich aussehende Socken zu kaufen. Dabei macht es nichts, wenn einer verloren oder kaputt geht. Im Sommer kaufte ich ein halbes Dutzend bei einem Sockenverkäufer am Halleschen Tor und fragte ihn, wie das Geschäft läuft. „Sie wissen doch, wie das ist,“ sagte er, „die meisten Leute kaufen erst Socken, wenn sie kalte Füße haben“.
Ein Freund sagte mir, er trage nur „Falke“-Socken, die seien „klimareguliert“ und haltbar. Einmal hatte er Pech: Sie rissen schon nach kurzer Zeit am Bund ein. Er schickte sie der Firma zurück mit einem freundlichen Brief, dass er ein ebenso langjähriger wie zufriedener Kunde sei, aber diesmal… Prompt schickte die Firma ihm ein neues Paar Socken und entschuldigte sich für den „Produktionsfehler“. „Falke“-Socken sind teuer, aber Socken aus Kamel- oder Yakwolle noch teurer.
„Meine Wollsocken sind von Merinoschafen,“ meinte mein Freund, „die geben die beste Wolle.“ „Jede Schafwolle kommt von Merinoschafen – fast weltweit,“ erwiderte ich, „da ist nichts Besonderes dran“. „Aber warum kostet dann ‚die wärmste Socke aus der Merinosocken/Kältesocken-Linie von Darn Tough‘ fast 40 Euro?“ fragte er zurück.
Wir saßen in der Küche. Als seine Frau und Tochter sich dazu setzten, entwickelte sich aus unserem Socken-Small-Talk fast ein Socken-Abend. Seine Frau erzählte: „Kürzlich fragte ich eine Verkäuferin bei ‚DM‘, ob es im Laden auch Socken ohne Gummizug im Bund gäbe. ‚Natürlich,‘ sagte sie, ‚ich zeig sie Ihnen. Bei mir sind Sie genau richtig, ich bin hier die Sockentante. Am Besten nehmen Sie diese hier. Die nennt man Diabetiker-Socken‘.“
Die Tochter krempelte ihre Hosen hoch und zeigte uns ihre „Funny Socks“: bunte Socken mit lustigen Motiven. Die seien aus Baumwolle und sie würde die online bei Amazon bestellen, erklärte sie. Ihre Mutter korrigierte sie: „Ich hatte diese tollen Socken für mich bestellt, gleich mehrere Paare, aber Luise hat sie nach und nach kassiert. Daraufhin habe ich für mich noch mal neue bei Amazon bestellt. Ich finde sie mega schön, bequem, haltbar, farbecht und immer ein Hingucker.“ „Was?!“ schaltete sich ihr Mann ein, „davon wußte ich gar nichts. Wir waren uns doch einig gewesen, nichts bei Amazon zu bestellen.“
„Ich dachte, das gilt nur für Bücher, weil Du Deinen linken Buchhändler unterstützen wolltest, was ich auch richtig finde, aber die Socken sind doch bestimmt von einer Textilfirma,“ verteidigte sich seine Frau. Die Tochter sagte zerknirscht: „Trotzdem, Amazon ist wirklich ein Scheißkonzern, darüber haben wir gerade in ‚Sozialkunde‘ geredet. Bereits in mehreren deutschen Städten haben die Amazon-Beschäftigten gestreikt und wollen demnächst weiter streiken.“
„Und ich habe gerade ‚Saisonarbeit‘ gelesen,“ sagte ihre Mutter, „den Bericht einer Leipzigerin, die bei Amazon im Warenlager arbeitete und meint, dass mit der Arbeit dort etwas grundsätzlich faul sei. Das Buch habe ich bei Amazon bestellt, muß ich leider zugeben.“ Wir kamen daraufhin auf Internet-Konzerne zu sprechen – und ab von den Socken.
.
Strumpfhosen
Nachdem ich meinen Rentenüberweisung zu Bargeld gemacht hatte, ging ich erst einmal in eine Kneipe. An der Bar saßen mehrere Büromenschen, die sich ein After-Work-Bier gönnten. Weil ihnen immer wieder das Gesprächthema ausging und es dann jedesmal still im Lokal wurde, stellte die Tresenbedienung den Fernseher an. Es lief eine Talkshow, bei der es um den Dritten Weltkrieg ging – pro und contra. Die Frau hinterm Tresen schaltete schnell um. Es kam eine Werbung für modische Feinstrumpfhosen. Einer der weiblichen Büromenschen fiel dazu ein, dass im Internetforum „gofeminin“ die Frauen oft und gerne über Strumpfhosen diskutieren, zuletzt über die Frage, wie Frauen es finden, wenn ein Mann Strumpfhosen trägt – und man das sieht, durch die Löcher in seinen Jeans. Das Tresen-Gespräch darüber wurde zwar bald hitzig, aber ich fand das Thema zu belanglos und hörte weg. Vom Rentengeld hatte ich mir auch noch ein Buch des US-Autors Tom Robbins gekauft: „Tibetischer Pfirsichstrudel“. Darin las ich am Abend, dass er als Kind gerne bei den Vorstellungen eines Zirkus half, wenn der in seinem Dorf in den Apalachen gastierte, dafür kam er umsonste rein. Robbins war besonders von einer elfjährigen Artistin begeistert. Sie trug schwarze Lacklederstiefel und vollführte Pirouetten auf einem durch die Manege tänzelnden Pferd.
Dann stieß ich auf das Wort „Strumpfhose“: 1972 besuchte er einen kleinen Zirkus. So klein, dass die drei Artistinnen mehrmals auftraten – jedesmal unter einem anderen Namen: „Sie trugen mehrere Identitäten und Kostüme, doch immer die selben Strumpfhosen. Und so gut wie alle Strumpfhosen hatten Laufmaschen,“ schreibt er und fragte sich: „Kann eine Frau in pinkfarbener Strumpfhose tatsächlich alle Geheimnisse des Universums kennen, wenn diese Strumpfhose Laufmaschen hat? Die Antwort ist eindeutig ‚Ja!‘, allerdings würde ich nicht so weit gehen, es zu einer Voraussetzung zu machen.“
Als Kind bin ich auch oft und gerne in den Zirkus gegangen. Damals trugen viele Kinder, Mädchen wie Jungs, Strickstrumpfhosen. Das sah nicht besonders eindrucksvoll aus, zumal sie oft mit Strumpfhaltern befestigt wurden, aber sie hielten warm. 1935 waren zur großen Freude der Frauen, die sich darum prügelten, die ersten Nylonstrümpfe in die Läden gekommen, ebenfalls mit Strumpfhalter oder Hüftgürtel und Strapse – erfunden vom US-Chemiekonzern DuPont. In Deutschland machten die Nazi-Chemiker dann aus Nylon Perlon und noch später die DDR Dederon (DDR-on).
Die Nylonstrümpfe hielten zunächst sehr lange – zu lange, fand DuPont und verknappte schnell den „Härter“ in der Produktion. Man kann ihn wieder quasi zugeben, wenn man ungetragene Nylonstrümpfe naß macht und über Nacht einmal ins Eisfach legt. Die DuPont-Nylonstrümpfe waren nach den Edison-Glühbirnen das zweite Produkt, dessen Haltbarkeit aus Profitgründen verkürzt wurde. Es schuf weltweit massenhaft neue Arbeitsplätze – für Frauen: als Kunststopferinnen in den Annahmestellen für Nylonstrümpfe, um Laufmaschen zu beseitigen (in der DDR gab es diese Läden noch bis 1991).
In den Fünfzigerjahren kam eine neue „Wirktechnik“ auf, mit der man die Strumpfbeine als „Rundlinge“ produzieren konnte, bis dahin hatten die Nylonstrümpfe hinten eine Naht. Sie und die am Oberschenkel gelegentlich sichtbaren Strapse üben laut Wikipedia „auf manche Menschen eine starke erotische Ausstrahlung aus“. Meine Mutter hat sich in den letzten Kriegs- und ersten Friedensjahren, wenn ihre Nylonstrümpfe zu viele Laufmaschen hatten, deren Naht einfach mit schwarzem Stift auf die nackten Schenkel gemalt. Bald gab es „hauchzarte“ Nylonstrümpfe in allen Farben, Mustern und Preislagen. Anfang der Sechziger gab es daneben noch Strumpfhosen (aus Elastan).Sie reichten vom Bauchnabel bis zu den Knöcheln. Die Mode der Miniröcke machte sie nachgerade zur Pflicht. Mit der Punkmode drehten junge Frauen aber den Konsumspieß um, indem sie Löcher und Laufmaschen in ihre Feinstrumpfhosen rissen.
Tom Robbins meint, die Auftritte der drei Artistinnen – als Clowns, Seiltänzer, Akrobaten und Elefantenführer – in Strumpfhosen mit Laufmaschen hätten leicht allzu ärmlich wirken können, sie waren jedoch „herzergreifend“. Moderne Artistinnen tragen heute Leggings (Beinkleider auf Deutsch), die nicht von einem US-Konzern sondern von US-Indianern erfunden wurden. Sie waren hauteng und aus Wildleder, heute meist aus Erdöl, es gibt sie aber auch aus Seide und Baumwolle. Es sind praktisch Strumpfhosen und sie gehen auch so leicht kaputt. Dafür haben sich die Hersteller dieses vor allem von Frauen getragenenKleidungsstücks enorm vermehrt: Sie beziehen die Kunststoff-Garne von Chemiekonzernen und verarbeiten sie zu „Kollektionen“. Die deutschen Firmen sind auf dem Rückzug, 1970 gab es noch 95 Strumpffabriken. Über die Hälfte der hier verkauften Strumpfhosen stammen heute laut „Die Zeit“ aus Italien. Die jetzt dem US-Textilunternehmen Sara Lee Corp. gehörende Marke „Elbeo“ bewirbt ihre von 321 Beschäftigten in Augsburg hergestellte Kollektion mit der Aufforderung „Keep young & beautiful“.
.

Die fertige Weltraumstation „Chinesisches Haus“
.
Weltraumeroberungsobjekte
„Es dauert nicht mehr lang, dann wird Weltraumschrott die Raumfahrt verhindern. Schon heute müssen Satelliten jede Woche Ausweichmanöver fliegen“, meinte die FAZ kürzlich. Hinzu kommen noch „tausende Satelliten“, die Elon Musk für sein „All-Internet“ hochschießen will. Und die Chinesen bauen seit kurzem im All an einer kilometerlangen Raumstation.
Der polnische Dokumentarfilmer Maciej Drygas interviewte einige Jahre nach Auflösung der Sowjetunion einige Kosmonauten für seinen Film „Im Zustand der Schwerelosigkeit“ (1995). Ausgangspunkt war ein Raumfahrtereignis: Der Kosmonaut Sergej Krikaljew, der 16 mal am Tag die Erde mit der 1986 in Betrieb genommenen Weltraumstation „MIR“ (Frieden/Welt) umkreiste, konnte nicht wie geplant zurückkehren, weil die sich auflösende Sowjetunion dafür kein Geld mehr hatte (u.a. hatte das eigenständig gewordene Kasachstan die Startgebühren für den Weltraumbahnhof Baikonur extrem erhöht). Langsam gingen die Lebensmittel oben zur Neige. „Ich fühle eine gewisse emotionale Anspannung“, gab Krikaljew per Funk zu Protokoll. Er und sein Kollege Alexander Wolkow konnten erst nach 311 Tagen auf die Erde zurückkehren.
Die BRD-Fernsehanstalten hatten die beiden mit einer Satellitenschaltung für 60.000 DM bereits 1992 interviewt – durch Roger Willemsen, der darüber einen Bericht schrieb, der 2020 unter dem Titel „Unterwegs“ veröffentlicht wurde. Er fragte Krikaljew als erstes: „Wie geht es Ihnen?“ Dieser antwortete: „Ganz normal“, d.h., schreibt Willemsen, „jemand rast mit 27.000 Kilometern in der Stunde durch den Raum und schwebt doch. Der Widerspruch ist auch für den Betrachter kaum lösbar.“
Die beiden Kosmonauten erledigten in der Kapsel wissenschaftliche Experimente: u.a. mit Wachtelküken, „die sich den Verhältnissen nicht assimilieren konnten und rasch starben, und Baumfröschen, die vergeblich die Schwerelosigkeit zu überhüpfen versuchten…“
Im Gegensatz zu den Amerikanern, „die immer nur Kurzaufenthalte im All absolvierten“, umkreisten die Kosmonauten die Erde oft monatelang. „Dazu mussten sie geschlossene Kreisläufe aufbauen: Strom aus Sonnenlicht, Wasser aus Urin, Ersatzteile aus Weltraumschrott gewinnen.“
Den Putsch gegen Gorbatschow im August 1991 verurteilte Krikaljew per Funk als „verfassungswidrig“ und kündigte einen „Aufstand des russischen Volkes“ an. 1994 und 1998 nahm er an „russisch-amerikanischen Weltraummissionen“ (mit der Discovery und der Endeavor) teil.
Die BRD-Fernsehanstalten hatten, ebenso wie der polnische Dokumentarfilmer, sowjetische Filmdokumente gekauft, u.a. zeigten sie, wie Krikaljew im Mai 1991 in der kasachischen Steppe auf seine Rakete zugeht. Er erklärt: „Unsere Ersatzleute sind während der ganzen Zeit dabei. Sie haben sich auf den Flug vorbereitet, aber die einen werden zur Arbeit in den Kosmos geschickt, die anderen bleiben zurück.“
Sie sind ein andern Mal dran. So auch die von Maciej Drygas interviewten Kosmonauten. Einer meinte: „Die Zeit von Gagarin – das war großartig. Die ganze Nation war begeistert: Es ist gelungen! Wir sind die ersten, wir haben gewonnen!“ Ein anderer sagte: „Jetzt wollen die Leute was davon haben. Die Leute wollen, daß etwas Nützliches bei der Weltraumforschung herauskommt.“ Ein dritter: „Wir haben unser Hauptproblem nicht gelöst. Wir können in den Weltraum fliegen, dort arbeiten und wieder zurückkehren, aber wir haben keine natürliche menschliche Betätigung im Weltraum – im Zustand der Schwerelosigkeit – gefunden. Bis jetzt haben wir keine produktive Tätigkeit dort oben entwickeln können. Ich empfinde das als persönliches Versagen.“
Es gibt eine Kreuzspinne namens Arabella, die 1973 im Weltraum – in der Schwerelosigkeit von „Skylab 3“ – sinnvolle Arbeit leistete, d.h. vier schöne Netze spann, wobei sie die Schwerelosigkeit dadurch überwand, dass sie herausfand, der einzige Weg, ein Netz im Flug zu spinnen, besteht darin, das Fliegen zu vermeiden – auf festem Boden zu bleiben. In einem schmalen Zwischenraum ihres Käfigs befestigte sie eine Brückenleine – und von da aus ging es. Die US-Autorin Elena Passarello schreibt in ihrem Buch „Berühmte Tiere der Menschheitsgeschichte“ (2018): „Eine Spinne in ihrem Netz ist uns weniger fern als ein Mensch, der in seiner Unterwäsche Rückwärtssalti durch ein Raumschiff schlägt.“ Arabella wurde deswegen der Star der „Skylab 3 Mission – an Bord ebenso wie auf der Erde, wo man ihre Arbeit am Bildschirm verfolgte“!. Leider starb sie bei der Landung. Als Todesursache wurde Dehydrierung angegeben. Sie ist heute ein Exponat im Nationalen Luft- und Raumfahrtmuseum der USA.
„Die Familie, in der ich zur Welt gekommen bin, unterscheidet sich in keiner Weise von Millionen anderer werktätiger Familien unseres sozialistischen Heimatlandes. Meine Eltern sind schlichte russische Menschen, denen die Große Sozialistische Oktoberrevolution ebenso wie unserem ganzen Volk einen breiten und geraden Lebensweg erschlossen hat“. So beginnt die Autobiographie von Juri Gagarin: „Der Weg in den Kosmos“ (1961 im Verlag Junge Welt). Der Gedanke eines geradewegs in das Universum führenden „Lebensweges“ scheint überhaupt russisch zu sein. So unterscheidet sich der sowjetische „Kosmos“-Begriff vom amerikanischen „outer space“ schon dadurch, dass ersterer mit der irdischen Lebenswelt „harmonisch“ verbunden ist, während der US-Weltraum so etwas wie eine „new frontier“ darstellt. Das meint jedenfalls die in den USA lebende russische Kulturwissenschaftlerin Swetlana Boym in ihrem Beitrag zum Bildband „Kosmos“ von Adam Bartos, das noch einmal das sowjetische Weltraum-Programm nostalgisch und en détail feiert.
.
Eine „Goldene Nase“ von Gerd Rothmann 1984
.
Nasen
Der Geruchssinn ist der Sinn der Extreme: Als Sinn der Lust, der Begierde, der Triebhaftigkeit trägt das Riechorgan den Stempel der Animalität. Riechen und Schnüffeln erinnert an etwas Tierisches. Die sprachliche Unfähigkeit, Geruchsempfindungen auszudrücken, würde den Menschen, wenn dieser Sinn vorherrschte, zu einem an die Außenwelt gefesselten Wesen machen. Wegen ihrer Flüchtigkeit könne die Geruchsempfindung niemals ein dauerhafter Anreiz für das Denken sein. Die Schärfe des Geruchssinns stehe im umgekehrten Verhältnis zur Entwicklung der Intelligenz – meint Alain Corbin in seiner Geschichte des Geruchs (2005)
Die Philosophin Mirjam Schaub beurteilt den Geruchssinn positiver (in: „Die Krux des Sinnlichen aus philosophischer Sicht – und die Folgen für die Ästhetik“ – 2015): „Menschlicher Eigengeruch gilt als Bildner der Ich-Funktion. Die Antike erkennt im Geruchssinn den Ursprung des Gefühls.Die mystische Theologie schwärmt vom ‚Geruch der Heiligkeit‘. Eine gewisses Madelaine-Gebäck, in Lindenblütentee getaucht, kann ein Suchen nach verlorener Zeit bedeuten. Aromatische Düfte steigern die Lebensgeister; Fäulnisgeruch und Pesthauch rauben den Atem. Vielleicht, weil er sich so sprichwörtlich an der Nase herumführen lässt und dabei so entschieden bleibt, wird der Geruchssinn philosophisch so gering geachtet.“
Es gibt Ausnahmen – unter den Sensualisten des 18. Jahrhunderts (einer meinte, für Philosophen sollte die Nase das einzige Erkenntnisgewinnungsorgan sein). Nietzsche meinte später: „Ich erst habe die Wahrheit erkannt – indem ich sie roch. Mein Genie liegt in meinen Nüstern.“ Der Geruchssinn ist der älteste Sinn – und er ist mit der Erinnerung verbunden. So verströmt z.B. der Edelpilz „Matsutake“ für Japaner und Koreaner einen schönen Duft (voller Erinnerungen an ehemalige Landschaften und Lebensweisen), während er für Europäer und Amerikaner stinkt. In ihrem Buch über dieses „Riechen“: „Der Pilz am Ende der Welt. Über das Leben in den Ruinen des Kapitalismus“ (2018) meint die Anthropologin Anna Lowenhaupt Tsing: „Wir alle erleben diesen ‚Tigersprung in die Vergangenheit‘, wenn wir riechen. Die Vergangenheit, die wir in Begegnungen mitnehmen, ist im Geruch verdichtet.“
Noch schlimmer als den Geruchssinn philosophisch zu verachten ist es, ihn politisch zu vernachlässigen. Der Publizist Sebastian Haffner schrieb in seiner „Geschichte eines Deutschen. Die Erinnerungen 1914 – 1933“, was ihn davor schützte, ein Nazi zu werden: „Meine Nase. Ich besitze einen ziemlich ausgebildeten geistigen Geruchssinn, oder, anders ausgedrückt, ein Gefühl für die ästhetischen Valeurs (und Non-valeurs!) einer menschlichen, moralischen, politischen Haltung oder Gesinnung. Den meisten Deutschen fehlt leider das gerade vollständig. Die Klügsten unter ihnen sind imstande, sich mit lauter Abstraktionen und Deduktionen vollständig dumm zu diskutieren über den Wert einer Sache, von der man einfach mittels seiner Nase feststellen kann, dass sie übelriechend ist. Ich meinerseits hatte schon damals die Gewohnheit, meine wenigen feststehenden Überzeugungen vermittels meiner Nase zu bilden. Was die Nazis betraf, so entschied meine Nase ganz eindeutig.“
Umgekehrt haben sich einige russische Schriftsteller für „Die Nase“ entschieden. Erwähnt seien Nikolai Gogol und Bruno Jasienski. Die Erzählung des ersteren „Die Nase“ (1836) beginnt damit, dass der Friseur Iwan Jakowlewitsch beim Frühstück in seinem Brot eine Nase findet, die dem 37-jährigen Kollegienassessor Kowaljow gehört, den er rasiert. Erschrocken wirft er die Nase in die Newa. Auf der anderen Seite stellt Kowaljow beim Erwachen fest, dass ihm seine Nase fehlt. Als er sich auf den Weg macht, um dies beim Polizeipräfekten zu melden, trifft er unterwegs in der Uniform eines Staatsrates seine eigene Nase. Er verfolgt sie fassungslos, spricht sie an, wird aber von ihr abgewiesen.
Der polnische Schriftsteller und Kommunist Bruno Jasienski verfasste seine Erzählung „Die Nase“ 1936, sie wurde 2021 auf Deutsch veröffentlicht. Dazu schrieb der Kulturkritiker Georg Seeßlen: Der „russische Satiriker“ persiflierte 100 Jahre nach der Veröffentlichung von Nikolaj Gogols Erzählung „Die Nase“, den deutschen Rassenwahn in der Figur eines nationalsozialistischen Professors für Rassenkunde, der eines Tages zu seiner vollkommenen Überraschung mit einer „jüdischen“ Nase im Gesicht dasteht.
Jasienskis Hauptwerk „Ein Mensch wechselt seine Haut“, handelt vom Bau eines riesigen Bewässerungskanals für den Anbau von Baumwolle in Tadschikistan nahe der afghanischen Grenze, an dem der Autor 1932/33 beteiligt war, wobei er den Schwerpunkt seiner Darstellung auf den Klassenkampf im Inneren und im Äußeren legte. Er wurde 1938 in Moskau hingerichtet. In seinem 728 Seiten dicken Buch geht es u.a. um das Abschneiden von kommunistischen Nasen durch die Feinde der russischen Revolution. Die Nase ist kein Riechorgan mehr, sondern ein visuelles Distinktionsmerkmal.
Eine Freundin von mir war mal Mitglied im Club der Longnose, sie machten aus ihren großen Nasen ebenfalls ein Distinktionsmerkmal. Andere ein Aufmerksamkeit heischendes Objekt – wie die goldenen Nasen aus Pappe, die der zugereiste Leipziger Graffiti-Künstler Max Klingeling an die Hauswände seiner neuen Wahlheimat klebt. Und wieder andere hadern mit ihrer Nase: Auf „baby-vornamen.de“ fragte eine Leserin: „Mein Verlobter nennt mich Nasenbär. Vielleicht weil ich wie bei ‚Nase‘ immer etwas verpeilt auf ihn wirke und ‚Bär‘, weil ich in unserer Beziehung etwas zugelegt habe. Oder er sieht einfach einen Nasenbär in mir – wie sehen die aus?“ Zwar wurde ihr geantwortet „Das sei doch nett gemeint“, aber auf „mundmische.de“ meint man zu wissen, dass „Nasenbär“ eindeutig eine Beleidigung ist: „Meist, wenn man sich über jemanden aufregt.“ Auf „klack.de“ findet sich dazu ein Beispiel: „1988 wurde Miss Austria von Presse und Konkurrentinnen als ‚Miss Nasenbär‘ verspottet“. Auf Dauer empfand sie das so verletzend, dass sie sich zu einer Nasen-Korrektur entschloss.
.
Vertikale und horizontale Wüsten
Das Bergsteigen war ab den Siebzigerjahren Bestandteil von Manager-Fortbildungskursen: Am Seil in einer Steilwand hängend sollten sie das Aufeinanderangewiesensein erleben. Später geriet das auch ins Angebot von Arbeitnehmer-Fortbildungskursen.
Die norwegische Reiseschriftstellerin Erika Fatland legt in ihrem Buch über den Himalaya, „Hoch oben“ (2021), den Verdacht nahe, dass dieser fromme Wunsch nun in Rekorde umgemünzt wurde. Die Autorin brachte es selbst am Mount Everest bis zum Basislager 5364 Meter über N.N., dann blieb ihr die Luft weg. Aber dafür erfuhr sie, dass es 1975 die erste Frau auf den Gipfel (8848 Meter) schaffte, 2013 die erste amputierte Frau, 2005 die erste Eheschließung, 2013 die ersten Zwillinge, 2014 das jüngste Mädchen (13), 2013 der älteste Mann (80), 2017 der erste Krebs-Patient, 2006 der erste Diabetiker (Typ 1), 2010 der erste mit künstlichem Darmausgang, 2001 der erste Blinde, 2006 der erste mit einer Doppelamputation. Er mußte jedoch die Erlaubnis, den Berg zu bezwingen, erst vor dem Obersten Gerichtshof Nepals erstreiten. Dies kam zu dem Schluß: Keinem dürfe der Zugang zum Mount Everest verwehrt werden. Das war vor allen Dingen ein Recht der Sherpas gewesen – sich unverantwortlichen Führungen zu verweigern. Nicht wenige waren in der Vergangenheit „im Berg“ geblieben. Eine der vielen Sherpa-Witwen plant einen Aufstieg, um auf ihre traurige Situation aufmerksam zu machen. Das Tourismusministerium und die Armee sammelten bei einer großen Aufräumaktion allein am Basislager über eine Tonne Müll (danach entmüllten sie noch zwei weitere Lager und den Gipfel).
In der Sowjetunion war das Bergsteigen, aber auch das Hochklettern an Bäumen, Straßenlampen und Hausfassaden fast ein Volkssport. Ab 1939 wurde der noch populärer durch eine Reihe von importierten deutschen Filmen von und mit dem Bergsteiger Harry Piel. Die Partei versuchte gegenzusteuern, eine Schlagzeile der Prawda lautete: „Wider den Harrypielismus“. Zu viele hatten ihre Kletterfähigkeit überschätzt.
Das galt auch für eine kalifornische Studentin, die am Mount Whitney mit dem Fuß in eine Felsspalte geriet und einen Rettungshubschrauber anfordern mußte. Der Pilot war kein anderer als Robert Redford, den sie schon immer verehrt hatte. Ähnlich erging es 1999 der Cousine von Wladimir Kaminer – im Kaukasus. Sie heiratete sogleich den Piloten, der sich jedoch, wenn er nicht gerade flog, als großer Langweiler entpuppte.
Es geht beim Bergsteigen u.a. darum, an die Grenze seiner Fähigkeiten, an das „Limit“, zu gelangen. Dem Südtiroler Bergsteiger Reinhold Messner geriet das zum Lebensinhalt. Er bestieg nacheinander alle 14 Achttausender, durchquerte Grönland und die Antarktis zu Fuß sowie mit 60 die Wüste Gobi – allerdings halb per Anhalter. Sein Buch darüber, „Gobi. Die Wüste in mir“ (2018), ist eine Art Tiroler Existentialismus. Es geht ihm, ein Schloßherr inzwischen, „immer wieder um extreme Herausforderungen“, um eine umweltschonende „Revolutionierung des Abenteuerbegriffs“. Man könnte ihn als einen Ernst Jünger für Ökos bezeichnen. Er hat 96 Bücher geschrieben, ein Bergmuseum gegründet und Filme produziert. In seinem Gobi-Buch schreibt er in gewohnt dramatischem Ton: „Ich darf jetzt keine Zeit verlieren, wenn ich mein Leben nicht verspielen will. Die Wüste ist ungeheuer groß und doch Schritt für Schritt zu durchqueren, wenn ich mir die Hoffnung nicht nehmen lasse und meinem innersten Wesen bis zuletzt treu bleibe.“ Unterwegs hört er Stimmen. „Im Gehen spüre ich, sogar in der Wüste, die Mitte in mir.“ Solch Gespür verhindert leider, die Außenwelt gründlich wahrzunehmen.
Ganz anders die Biologin Carmen Rohrbach (aus dem Greifswalder „Lamarck-Zirkel“), die ebenfalls eine Liebhaberin von „Extremdestinationen“ ist und darüber eine Menge Bücher veröffentlichte: Sie hat die Wüste Gobi „erkundet“. In ihrem Buch „Mongolei“ (2008) schreibt sie: „Man war schnell daheim in der Wüste, weil alle schwierigen Dinge fehlten…Nirgendwo anders als in der Wüste bedeutet Leere zugleich Erfüllung.“ Mittendrin fragt sich die 60jährige, „die beliebteste Reiseschriftstellerin Deutschlands“: Was kommt nach der Mongolei – dem einstigen „Zufluchtsort“ für ihre „Seele“? „Wüßte ich den Tag meines Todes könnte ich meine Kräfte bündeln…Gefährliches wagen, auf das ich aus vernünftigen Gründen verzichtet habe.“
An Gefährliches wagen sich auch immer mehr Tierfilmer (den Sensationswünschen der Medien folgend). Als man den jungen Tierfilmer Andreas Kieling fragte, warum er so an der arktischen Fauna interessiert sei, antwortete er: „Ganz einfach – ich mußte mir sehr genau überlegen, wo es eine Marktlücke gab.“ Der vielgereiste Fernsehproduzent Roger Willemsen berichtet in seinem posthum erschienenen Buch „Unterwegs“ (2020) von einem Gespräch mit einer Stewardess: „Sie gesteht mir in 11.000 Meter Höhe verschwörerisch, auf Langstreckenflügen höre sie Stimmen in den Wolken. ‚Es sind die Toten, die da reden,‘ sagt sie, sie tun es nur über Meeren, Bergen und Wüsten‘. Ich lächele. ‚Das Universum lacht nicht,‘ raunt sie.“
.
Strickzeug
Was den westdeutschen Jungs die Laubsägearbeit im Werkunterricht war für die Mädchen im Handarbeitsunterricht das Stricken – meistens Topflappen, die laut „utopia.de“ „für Strickanfänger bestens geeignet“ sind. Aber einige Mädchen wagten sich auch an Socken, Pulswärmer etc.. An den Pädagogischen Hochschulen, wo die Mehrzahl Studentinnen waren, strickten in manchen Seminaren fast alle. Eine Frau aus Frankfurt meinte neulich: „In den 70er Jahren wurde viel gestrickt. Schon allein um die öden – sonst nicht zu ertragenden – Vollversammlungen der linken Hochschulgruppen zu überstehen. Allerdings zeigte sich dann bald, dass das Stricken der Revolution nicht förderlich war. Um sich für einen Diskussionsbeitrag zu melden, musste nämlich das Strickzeug aus der Hand gelegt werden, was leider oft dazu führte, dass Maschen fielen oder der Faden sich verhedderte, also unterblieb meist die aktive Teilnahme an der Diskussion zur Vorbereitung der Revolution, sodass sich der Slogan entwickelte: Wer strickt macht keine Revolution!“
Zumindest waren diese Strickerinnen keine Proletarier an Strickmaschinen mehr. Davor waren z.B. in den Strumpfstrickergilden auch nur Männer organisiert gewesen: „Das Handstricken wurde erst weiblich, als es sich finanziell kaum noch lohnte,“ heißt es in Ebba Drolshagens Buch „Zwei links, zwei rechts“. Der BRD-Kanzler Konrad Adenauer erfand, als Ruhiggestellter während der Nazizeit u.a. einen „Stopfpilz“ zum Flicken der Löcher in Socken und Damenstrümpfen: eine ausgebrannte Glühbirne. „Diese Erfindung von Konrad Adenauer hat sich aber nicht durchgesetzt,“ laut Wikipedia. Überhaupt kam das Stricken mit den immer billiger werdenden Strümpfen und Socken langsam aus der Mode, erst recht das Stopfen. Seit den „3 Paar Socken für 5 DM-“Angeboten stopfen nur noch gutbetuchte Müßiggänger die Löcher in ihren Edelsocken.
Als in den Siebzigerjahren Öko, Bio und Landkommunen aufkamen, ging das Stricken wieder los. Etliche Frauen schafften sich sogar Schafe an, die sie schoren und deren Wolle sie dann färbten, versponnen und schließlich verstrickten. Aber nie schafften sie so viel wie ihre Schafe Rohwolle produzierten. Die Bioläden nahmen verbesserte, teure Spinnräder ins Angebot. In Kreuzberg eröffneten einige Frauen Wollgeschäfte – mit Namen wie „Fadeninsel“ und „Wolllust“.
Unter den ersten grünen Abgeordneten in diversen Parlamenten fingen plötzlich auch die Männer an zu stricken. Das war ein „Statement“. Ein Westberliner, der das Meditative am Stricken schätzt, schreibt: „Die strickenden grünen Geschlechtsgenossen im Bundestag und auf Parteitagen sind ja wohl jedem in Erinnerung“. In Pankow gibt es inzwischen einen „Männer-Wollladen“.
In der Toskana saßen die Frauen auf den Dorfplätzen und strickten Pullover für Neckermann, sie bekamen 18 DM pro Pullover. Ich bekam nacheinander von drei Frauen eine Wollmütze in anthroposophischen Farben, einen langen Schal in Regenbogenfarben und ein paar dicke braune Wollsocken geschenkt. Als ich mich für den Schal bei der Strickerin, die ich auf dem antiautoritären „Tunix-Kongreß“ 1978 kennengelernt hatte, bedankte und dabei noch einmal auf den Kongreß zu sprechen kam, fand ich den Brief in meiner Westberliner Verfassungsschutzakte wieder, die man ab 1990 einsehen durfte. Allerdings war darin alles bis auf den Brief geschwärzt, der ohne den Dank an die Schalstrickerin in einer linken Kreuzberger Zeitung abgedruckt worden war, und die das Verfassungsschutzamt anscheinend abonniert hatte.
Die Reporterin Waltraud Schwab schreibt: „Wer die Geschichte des Strickens verfolgt, stößt immer wieder auf politisch relevante Zusammenhänge.“ Sie behauptet, dass die strickenden Frauen „in ihren Arbeiten auch Geheimdienstinformationen hineinstrickten. Rechte und linke Maschen, das sind die Nullen und Einsen des binären Codes, das Lang und Kurz des Morsealphabets.“ Sowohl im amerikanischen Bürgerkrieg als auch im Ersten Weltkrieg hätten strickende Frauen „in ihrem Gestrick Feindbewegungen weitergegeben“. Man erfährt nicht, auf welcher Seite sie dergestalt mitmischten – auf allen Seiten? Waltraud Schwab sagt nur, dass auch in der Gegenwart Frauen durch Stricken ihre Sicht auf Politik und Krieg zeigen. Das erinnerte mich an afghanische Frauen, die auf ihren nicht gestrickten sondern gewebten Teppichen den Krieg – Flugzeuge, Bomben, Panzer – zeigten. Ihre Arbeiten kosten heute ein Vermögen. Waltraud Schwab denkt jedoch an einen richtigen Panzer im Militärhistorischen Museum Dresden, der von einer Gruppe Frauen komplett eingestrickt wurde.
Ich sehe in Berlin immer mal wieder Straßenbegrenzungspfähle (Poller), die von Unbekannten eingestrickt wurden – und freue mich jedesmal, denke jedoch: Was für eine Arbeit – und das nur zur Stadtverschönerung an einem so winzigen Ort. Zudem stehen immer noch 482.000 unbestrickte Poller in der Stadt rum – und verbreiten Armut und Kälte-Verbrechen. Die gute Nachricht: Die Wollpreise steigen wieder, wegen der Chinesen und weil Wollsachen erneut in Mode gekommen sind, meldet eines der „Schafforen“ im Internet.
.
Lockere Naturgesetze
Neulich wurde mir in einem Kneipengespräch gesagt, die Naturgesetze sind unumstößlich. Gravitation und Lichtgeschwindigkeit seien deswegen „Fundamentalkonstanten“. Nur in Berlin? Oder auch z.B. in London? Fragte ich. Blöde Frage, bekam ich zur Antwort.
Im Londoner Patentamt fand aber der Botaniker Rupert Sheldrake heraus, dass die Lichtgeschwindigkeit zwischen 1928 und 1945 um etwa 20 Kilometer pro Sekunde sank. Sie sank überall auf der Welt. Aber dann, 1948, stieg sie wieder an. Sheldrake suchte daraufhin den Leiter der Metrologie am National Physical Laboratory in Teddington auf. Er fragte ihn: „Was halten Sie von diesem Rückgang der Lichtgeschwindigkeit zwischen 1928 und 1945?“
Er antwortete: „Oh je, Sie haben die peinlichste Episode in der Geschichte unserer Wissenschaft aufgedeckt.“
Sheldrake: „Kann es sein, dass die Lichtgeschwindigkeit tatsächlich gesunken ist? Und wenn ja, hätte das ja erstaunliche Auswirkungen.“
Er meinte: „Nein, nein, natürlich kann sie nicht wirklich gesunken sein. Sie ist eine Konstante!“
„Oh, aber wie erklären Sie dann die Tatsache, dass jeder festgestellt hat, dass sie in dieser Zeit viel langsamer geworden ist? Liegt es daran, dass sie ihre Ergebnisse gefälscht haben, um das zu herauszubekommen, wovon sie dachten, dass es andere Kollegen herausbekommen würden, und die ganze Sache nur in den Köpfen der Physiker entstanden ist? “
„Wir benutzen das Wort verfälschen nicht gerne.“
„Und was bevorzugen Sie dann?“
„Nun, wir nennen es lieber ‚intellektuelles Phase-Locking‘.“
„Wenn das damals so war, wie können Sie dann so sicher sein, dass es heute nicht mehr so ist? Und dass die heutigen Werte nicht durch intellektuelles Phase-Locking erzeugt werden?“
„Oh, wir wissen, dass das nicht der Fall ist.“
„Wie können wir das wissen?“
„Nun, wir haben das Problem gelöst.“
„Und wie?“
„Nun, wir haben 1972 die Lichtgeschwindigkeit per Definition festgelegt.“
Also sagte ich: „Aber sie könnte sich immer noch ändern.“
Woraufhin er entgegnete: „Ja, aber wir würden es nie erfahren, weil wir das Messgerät in Bezug auf die Lichtgeschwindigkeit definiert haben, also würden sich die Einheiten mit ihr ändern!“
Aber Sheldrake fragte weiter: „Und was ist dann mit der Gravitationskonstante, in der Fachwelt als „großes G“ bekannt, Newtons universelle Gravitationskonstante. „Sie hat sich in den letzten Jahren um mehr als 1,3 Prozent verändert. Und sie scheint von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit zu variieren.“
Er sagte: „Na ja, das sind eben Fehler. Leider gibt es ziemlich gravierende Fehler beim großen G.“
„Und wenn es sich wirklich ändert? Ich meine, vielleicht verändert es sich wirklich.“
Danach hat Sheldrake es sich angesehen, wie sie es machen: Sie messen es in verschiedenen Laboren, erhalten an verschiedenen Tagen unterschiedliche Werte und bilden dann den Durchschnitt. Andere Labore auf der ganzen Welt machen das Gleiche und kommen in der Regel zu einem etwas anderen Durchschnittswert. Und dann trifft sich das internationale Komitee für Metrologie alle zehn Jahre oder so und bildet den Durchschnitt aus den Werten der Labore in der ganzen Welt, um den Wert von groß G zu ermitteln.
Aber was wäre, wenn G tatsächlich Schwankungen unterliegen würde? Was, wenn es sich ständig ändern würde? Es gibt bereits Beweise dafür, dass es sich im Laufe des Tages und des Jahres ändert. Was wäre, wenn die Erde auf ihrem Weg durch den galaktischen Raum dunkler Materie oder anderen Umweltfaktoren ausgesetzt wäre, die den Wert verändern könnten? Vielleicht verändern sie sich alle zusammen. Was wäre, wenn diese Fehler gemeinsam ansteigen und abnehmen?
Seit mehr als zehn Jahren versucht Sheldrake, Messtechniker davon zu überzeugen, sich die Rohdaten anzusehen. Außerdem bemüht er sich, sie davon zu überzeugen, „die Daten und die tatsächlichen Messungen ins Internet zu stellen, um zu sehen, ob sie aufeinander abgestimmt sind. Um zu sehen, ob sie zu einem bestimmten Zeitpunkt steigen und zu einem anderen sinken. Wenn ja, könnten sie gemeinsam eine Schwankung aufweisen. Und das würde uns etwas sehr Interessantes sagen.
Aber niemand hat das getan, weil G eine Konstante ist. Und somit hat es also keinen Sinn, nach Veränderungen zu suchen. Dies ist ein Beispiel dafür, dass eine dogmatische Annahme die Forschung wirklich behindert.“ Fazit: In London wie in Berlin besteht man auf feste Naturgesetze, aber damit lügt man sich nur in die Tasche. Nichts ist konstant!
.
Laubsägearbeiten
Früher war das eine Lehreinheit im Werkunterricht. Aber auch Zuhause wurde das Arbeiten mit der Laubsäge aufs Angenehmste gefördert. Das ist heute kaum noch vorstellbar, da man noch viel Pingeligeres inzwischen gewohnt ist: bei dem ganzen Elektronikzeug. Deswegen lohnt sich ein Blick zurück. Zumal, wenn nicht vergessen werden soll: „Auch in der ehemaligen DDR gehörte das Laubsägen zu den beliebten Freizeitbeschäftigungen. Viele Dinge wurden, auch aus praktischen Gründen, gerne selber hergestellt. Durch die Mangelwirtschaft in der DDR haben viele Menschen eigene Ideen mit handwerklichen Arbeiten umgesetzt. Hierbei waren besonders die DDR-Laubsägeblätter bei den Bastlern hilfreich und beliebt. Die Qualität der Laubsägeblätter war ausgezeichnet. Besonders beliebt waren bei Laubsägeblättern die Rundsägeblätter von z.B. VEB MLW Medizinmechanik Suhl. Heute, nach über 20 Jahren, sind Laubsägeblätter aus der DDR nur noch selten zu bekommen. Wenige Restposten werden noch angeboten. Die Preise steigen.“
Angeblich sollen anonyme Amis zuletzt das größte Kontingent aufgekauft haben. In den USA finden regelmäßig landesweite Wettbewerbe um die schönste Laubsägearbeit statt. 2019 gewann auf nationaler Ebene der 57jährige Textilarbeiter Dan Wirtz aus Wisconsin mit einer Laubsägearbeit, die die Köpfe der drei letzten US-Präsidenten zeigt.
Neuerdings gesellt sich zu diesen Bastlern mit der Laubsäge noch eine ganz andere Spezies. Sie rückt den beim Fällen eines Baumes stehen gelassenen Stammrest mit einer Motorsäge zu Leibe, um daraus ein mehr oder weniger kitschiges Kunstwerk zu schaffen: Beliebt sind Adler, Wölfe und nackte Frauen. Mit letzterer, die einen Säugling vor der Brust hält, gewann der ehemalige Waldarbeiter Sidney Bausch aus Oregon 2020 die „goldene Motorsäge“ (aus Holz) und 10.000 Dollar. Dafür kommt die aus dem Baumstumpf gesägte Nackte mit Kind nun mitsamt ihrer Baumwurzel in das Werkstoff-Holz-Museum von Seattle.
In Westdeutschland sah sich so etwas zuletzt auf der Lichtenburg bei Ostheim in der Rhön. Die Veranstaltung nannte sich “7 Tage – 7 Stämme”. Der CSU-Landrat von Rhön-Grabfeld, Thomas Habermann, bat die anwesenden Künstler in seiner Eröffnungsrede, wenn sie schon ihren dicken Pappelstämmen derart effizient zu Leibe rückten, dann doch bitte auch noch gleich die Bäume um die Burg herum zu kappen, damit man die inzwischen teilrekonstruierte Ruine wieder vom Tal, von Ostheim aus, sehen könne. Er schlug damit einen kühnen Bogen von den ehedem nützlichen Holzschnitzereien der Region zum eher zweckfreien heutigen Holzkunstwerk. Ob seiner unökologischen Bemerkung wurde er jedoch vom umweltbewußten Teil der Besucher erst einmal gescholten.
Ein anderer Redner dort, ein Kunsthistoriker aus Würzburg, erinnerte an den Semiologen Roland Barthes, der die Metasprache, die in der Stadt gesprochen wird, von der Objektsprache – auf dem Land – unterschied: Die erste Sprache verhalte sich zur zweiten wie die Geste zum Akt. Die erste sei intransitiv und bevorzugter Ort für die Einnistung von Ideologien, während die zweite operativ und mit ihrem Objekt auf transitive Weise verbunden sei.
Als Beispiel erwähnte Roland Barthes den Baum: Während der Städter über ihn spricht oder ihn sogar besingt, da er ein ihm zur Verfügung stehendes Bild ist, redet der Landbewohner von ihm – gegebenenfalls fällt er ihn auch. Und der Baum selbst? Wenn der Mensch mit einer Axt in den Wald kommt, sagen die Bäume: “Sieh mal! Der Stiel ist einer von Uns.” Das behaupten jedenfalls die Waldarbeiter im Haute Savoie.
Für die Laubsägearbeiter braucht man dünne und weiche Holzplatten. Sperrholz aus Birkenstämmen z.B.. 2015 erschien – wie aus heiterem Himmel – ein Buch von Armin Täubner: „Laubsägen für Jungs“ – während amazon unter „Laubsägen für Mädchen“ schon lange allerlei Bastel-Werkzeug für Kinder bis hin zu einer Kettensäge anbietet. Diese funktioniert „elektrisch mit Musik“ und ist für „Kinder ab 3 Jahren“ geeignet. Man sieht auch hieran wieder, wie die Laubsäge-Arbeit von Jungs übergeht in die Kettensäge-Kunst von Mädchen.
Und in der Tat sah man auf der Lichtenburg bei Ostheim gleich mehrere junge Künstlerinnen, die sommerlich im Bikini, aber mit dicken Ohrenschützern ihre Stämme (Pappeln) mit handlichen Motorsägen bearbeiteten.
Auf einer ähnlichen wettkampfähnlichen Veranstaltung der Holzbildhauer der thüringischen Holzschnitzschule in Empfertshausen, wo man gerne Tierplastiken anfertigte und immer noch anfertigt, hatte sich zuvor einer der Teilnehmer noch geweigert, seinen Stamm mit einer Motorsäge zu bearbeiten: „Ich bin Schnitzer und kein Waldarbeiter,” erklärte er. Die Schnitzkunst hat zwischen Laubsäge- und Motorsäge-Kunst überlebt – ist aber selten geworden, zumal es immer mehr computergesteuerte Schnitzmaschinen gibt.
.
Warentrennstäbe
Als ich das erste Mal das Wort las, verstand ich darunter zunächst metaphorische Trennstäbe – z.B. durch den Warenpreis, der die Verbraucher nach ihrem Einkommen trennt, in: sagen wir Bio-Supermarkt- und Billig-Großmarkt-Kunden. Aber dann stieß ich auf eine „Warentrennstabverordnung“: „Die Warentrennstabverordnung regelt die Zuständigkeit des Kunden, seine Waren ordnungsgemäß von den Waren der nachfolgenden Person zu trennen. / Jeder Kunde ist verpflichtet, das Ende seiner Kassenbandwarenlegeaktivität durch das Setzen des Warenstabs hinter seine Waren, eindeutig zu markieren./ Sollte der Kunde dies vergessen, ist er von der nachfolgenden Person freundlich auf seine Pflicht hinzuweisen./ Sollte er sich weigern dieser Aufforderung nachzukommen, erklärt er sich damit bereit, die Waren des nachfolgenden Kunden zu bezahlen.“
Ich hielt das für einen Witz. Aber dann passierte mir genau das: Weil am Fließband der Kasse in der „Kaufhalle“ gerade kein Trennstab greifbar war, trennte ich das Ende meiner Waren nicht ab – und schon war die Kassiererin dabei, die Waren einer hinter mir stehenden Dame auf meine Kosten zu scannen. Die Dame war nicht erfreut, dass ich das Band anhalten ließ. Am Ende der Kasse drückte sie mir obige „Verordnung“ in die Hand. Die Kassiererin setzte noch einen drauf, indem sie mir sagte: „Immer gut abtrennen die Ware. Mit Warentrennern, so heißen die offiziell.“ Ich ärgerte mich über die Pädagogik der Dame, die am Band nichts gesagt hatte.
Später fiel mir eine Umfrage des Schweizer Lebensmittelkonzerns Migros in die Hände, in der festgestellt wurde, dass die meisten Deutschen erwarten, dass sich der Kunde hinter ihnen selbst um die Stabsangelegenheit kümmert. Mein Verhalten am Band der Supermarktkasse war also quasi deutsch.
In der Schweiz ist es umgekehrt, lese ich auf „brigitte.de“: „Dort wird erwartet, dass jeder seine Einkäufe mit dem Warentrenner selbst nach hinten ‚abschließt‘. Auch aus Verkäufersicht ist es eher praktisch, wenn die Kunden selbst die Verantwortung für die Grenzziehung zum Hintermann übernehmen.“
Auf Wikipedia werden die Warentrenner „Warendifferenzierungsmodule“ genannt, was trotz des aufgeblasenen Wissenschaftsjargons falsch ist, denn mit dem Trennstab werden ja nicht die Waren, sondern die von ihren zukünftigen Besitzern, den Endverbrauchern, vor sich aufs Band gestellten, unterschieden. Die Waren sind oft die gleichen, zwei industriell hergestellte Tüten Zucker kann man nur in bezug auf die Anspruchnahme ihrer potentiellen Besitzer am Band diferenzieren.
Wikipedia fügt in seinem Eintrag über den „Warentrenner“ hinzu, dass man ihn nicht mit dem „Warenteiler im Supermarkt-Regal“ verwechseln darf. Zur Handhabung der Grenzziehung mittels Warentrenner heißt es: „Der Warentrenner wird einer schienenförmigen Ablage entnommen und zwischen den selbst zu kaufenden Waren und denen der nachfolgenden Person platziert. Beim Kassierer angekommen, wird der Warentrenner von diesem wieder auf die Schiene gelegt und entgegen der Laufrichtung des Bandes zurück in Richtung der nachfolgenden Kunden geschoben.“
„Gestoßen werden sie. Anders habe ich das noch nie erlebt, als das die Kassiererinnen den Warentrenner mit Schwung in die schienenförmige Ablage befördern. Das Klacken der aufeinanderprallenden Warentrenner macht einen anderen Ton als das ewige Piepen des Scanners. Wenn in den großen Supermärkten alle Kassen besetzt sind, ergibt das ein ganzes Piep-Konzert.
Von einem Supermarkt-Architekten, der nach der Wende jede Woche einen neuen einweihte, erfuhr ich, dass NCR und andere Kassenhersteller jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt bringen müssen, weil die Kassenbediensteten, und auch die Kellner, spätestens dann raus haben, wie man damit etwas beiseite schafft. Die Supermärkte würden im Übrigen aus den selben Gründen auch die Fluktuation ihres Personals begrüßen, weil die Leute eine Weile brauchen, um sich in allen Abläufen auszukennen.
Worauf ich noch nie geachtet habe bei den Warentrennern, dass ist die Werbung auf ihnen, die „ursprünglich“ laut Wikipedia werbefrei waren. Seit 2008 „werden auch sie als Werbefläche genutzt, dazu manchmal noch eine Werbeaufsitzer. Ein dreieckiger Warentrenner aus Plastik hat drei Werbeflächen.
Vor einiger Zeit empfahl das „Jetzt“-Magazin der Süddeutschen Zeitung seinen Lesern den Begriff „Warenstopper“. Unter „Warentrenner vom Hersteller kaufen“ erfuhr ich, dass sie – aus Polycarbonat – bei der Firma VKF Renzel 3 Euro 79 das Stück kosten.
Diese Firma scheint sie jedoch nicht selbst herzustellen, denn auf Wikipedia heißt es: „Die Unternehmensgruppe VKF Renzel ist ein internationaler Hersteller und Business-to-Business-Versandhändler von Verkaufsförderungsartikeln und Produkten zur Ladenausstattung, Regaloptimierung und Preisauszeichnung mit Hauptsitz in Isselburg.“ Einige weitere Interneteinträge legen nahe, dass die Warentrenner aus China kommen.
Die Westdeutsche Zeitung berichtete aus Düsseldorf: „Drei Päckchen Milchpulver wollte ein Chinese bei Rossmann kaufen. Doch die Verkäuferin weigerte sich, ihm die Ware zu geben. Es gebe eine Abweisung der Geschäftsleitung, Milchpulver an Chinesen nur unter Auflagen zu verkaufen. Der 31-Jährige rastete völlig aus. Er nahm einen Warentrenner von der Theke, schlug damit auf den Kopf der 25-Jährigen ein.“
.
Textilien
Vor etwa 20 Jahren verschwanden die Kleidungsstücke aus reiner Wolle und aus Baumwolle, stattdessen sind fast allen Stoffen nun Kunstfasern beigemischt. Die ganz billigen Textilien, wie sie u.a. von kik und primark angeboten werden, bestehen fast nur aus Plastik, das verschiedene Namen hat. Auf 500 Seiten hat der US-Historiker Sven Beckert die weltbewegende Rolle der Baumwolle beschrieben: „Eine Geschichte des globalen Kapitalismus. King Cotton“ (2014) . Sie reicht vom „Kriegskapitalismus“, der mit Gewalt den Baumwollanbau durchsetzte, bis zu seiner Ablösung durch den „Industriekapitalismus“ infolge der Baumwollsklaven-Befreiung in den Südstaaten der USA.
Es ist ein lehrreiches Buch (anders als „Weisse Plantagen“ von Erik Orsenna), obwohl es mit dem idiotischen Satz endet: „Schließlich erschafft die kapitalistische Revolution unsere Welt ständig neu, so wie die Webstühle der Welt unablässig neuen Stoff produzieren.“ Nicht zu vergessen: auch die Entkörnungsbetriebe, Spinnmaschinen und Nähfabriken (in denen Millionen junge Frauen fast sklavisch Kleidungsstücke herstellen). Ihnen und der Technik ist es egal, ob sie tierische, pflanzliche oder chemische Fasern verarbeiten. Es müssen in jedem Fall Fäden versponnen, verwebt und vernäht werden.
Aber „während Hemden und Blusen etwa für den deutschen Markt vor einem Jahrhundert vielleicht in einer Werkstatt in Berlin oder Frankfurt aus Stoff genäht wurden, der in Sachsen aus amerikanischer Baumwolle gewebt wurde, bestehen sie heute aus chinesischer, indischer, usbekischer oder senegalesischer Baumwolle, die in China, Pakistan oder der Türkei gesponnen und gewoben und dann in Bangladesch oder Vietnam vernäht werden.“ Diese Produktionsstätten werden nicht mehr von Fabrikanten, Baumwoll- und Stoffhändlern zusammengehalten, sondern von riesigen Handelsketten wie ‚Wal-Mart, Metro oder Carrefour, die ihre Kleidung bei den billigsten Anbietern kaufen.
Es ist noch nicht lange her, dass die Wollpreise so tief gesunken waren, dass die Schäfer die Wolle ihrer Schafe verbrannten, aber geschoren werden mußten ihre Schafe. Man begann darüber nachzudenken, ihnen die Wolle wieder wegzuzüchten, um aus ihnen reine Fleischschafe zu machen. In den letzten Jahren stiegen die Wollpreise jedoch wieder, da China Riesenmengen importierte, zudem kamen Wollsachen wieder in Mode und viele australische Schafzüchter gaben auf.
Ich komme aus Bremen, das traditionell ein Handelsschwerpunkt für Wolle und vor allem Baumwolle war. Es gibt dort immer noch eine „Baumwollbörse“ – als Verein zur „Wahrung und Förderung der Interessen aller am Handel mit und der Verarbeitung und Veredelung von Baumwolle und Baumwollprodukten sowie sonstigen Textilfasern und Textilfaserprodukten Beteiligten.“ Man ist dort also offen geworden z.B. auch für Kunstfaser. Nur gibt es in weitem europäischen Umland kaum noch Spinn-, Web- und Nähfabriken.
Darunter leidet auch die Bremer Woll-Kämmerei AG. „Sie war weltweit lange Zeit das größte Unternehmen ihrer Art – mit Niederlassungen in der Türkei, Australien und Neuseeland.“ Alle drei Länder haben eine ausgesprochene Schafkultur, die beiden pazifischen verkaufen ihre Tiere heute jedoch zum größten Teil als Schlachtvieh nach Arabien. Tierschützer möchten ihre riesigen Überseetransporte, mit bis zu 100.000 Schafen auf einem Schiff, verbieten. Von der Bremer Wollkämmerei AG blieb im Wesentlichen nur die BWL Chemiefaser GmbH. Heute werden laut Beckert 75 Millionen Tonnen chemische Fasern hergestellt (u.a. von Bayer und BASF) – mehr als doppelt so viel wie die weltweite Baumwollproduktion beträgt.
Die größte Baumwollbörse – in Liverpool – gab auf, ihre kostbare Einrichtung wurde versteigert. In den USA und in England wurden massenhaft Baumwollfabriken geschlossen – und z.T. in Baumwollmuseen umgewandelt. Die letzten US-Baumwollfarmer werden vom Staat subventioniert: „2001 mit 4 Milliarden Dollar – 30% mehr als der Marktwert ihrer Ernte“. Auch die Reste des englischen „Baumwollkomplexes“ sind von staatlicher Hilfe abhängig.
Die großen Baumwollfabriken in Bombay wurden in den Süden verlagert, wo die Arbeiter weniger verdienen. Indien hat ein Spinnrad in seiner Flagge. In den letzten Jahren begingen dort 200.000 kleine Baumwoll-Anbauer Selbstmord, weil sie sich mit dem genveränderten Monsanto-Saatgut verschuldet hatten. Der Baumwollanbau ist überdies chemieintensiv und verbraucht viel Wasser.
Die westlichen Textilunternehmer träumen von Fabriken auf Schiffen, die, wenn ihre Arbeiter sich gewerkschaftlich organisieren und höhere Löhne verlangen, einfach in Billiglohnländern anlegen. In Berlin-Zehlendorf gab es eine große Spinnstoffabrik, wo wir als Studenten gerne jobbten – bis 1973: Da putschte Pinochet mit Hilfe der CIA und die „Spinne“ wurde nach Chile verlagert, wo die Arbeiter nur noch 90 Pfennig pro Stunde verdienten.
Man sprach von den „Naturgesetzen des Marktes“, denen man nicht entkommen kann, umgekehrt spricht heute die Heidelberger Genetikerin und Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard davon, “dass die Natur in gewisser Weise kapitalistisch funktioniert“. Das eine ist so dämlich wie das andere – dem “Geist der Profitmacherei“ geschuldet, der laut Marx auch schon die große englische Evolutionstheorie beflügelte: „Darwin hat darin bloß die schlechten Angewohnheiten der englischen Bourgeoisie auf die Natur übertragen,“ spottete er.
.
Handys
Bei der „Reformbühne Heim&Welt“ brauchte man anfangs in einem Text nur das Wort „Handy“ erwähnen – und man erntete Lacher. Wenig später war es nur noch lustig, wenn ein Penner in der U2 einen Handynutzer imitierte, indem er laut in eine zerknautschte Bierbüchse sprach: „Ich bin jetzt an der Eberswalder, und in 10 Minuten am Alex, ja, drei Haltestellen noch…“ Seit dem erweiterten Smartphone macht niemand mehr in de U2 einen Witz über sie, weil alle in solch einem Gerät rumtippen, scrollen etc..
Nach dem 11.September meinte der Regisseur Peter Zadek: „Wir sind in den Händen von Mördern und Dieben und laden jeden Tag unsere Handys auf.“ Die Schriftstellerin und Schauspielerin Emine Sevgi Özdamar schreibt in ihrem Buch „“Ein von Schatten begrenzter Raum“ (2021): „Zadek sagte, als die Handys die Hauptrolle bekamen: ‚Ein Welt voller Verrückter‘“ Sie traf dann in den verschiedenen Ländern „sehr oft Handyverrückte“: In London war es einer, der mit der Hand am Ohr laut ein Handygespräch imitierte. In Spanien war es einer, der ein altes rotes Telefon auf dem Arm trug und allen Passanten eine Gesprächsmöglichkeit damit anbot. Auf einer kleinen türkischen Insel war der Handyverrückte einer, der sich von den Leute im Café ein Handy lieh und ohne eine Nummer zu wählen laut sagte: „‘Mama, was gibt es zum Abendessen?‘ und machte seine Mutter nach, die Antwort seiner Mutter ‚Papalina, papalina, Fisch‘.“
Der Regisseur Jean-Luc Godard drehte zuletzt einen Film, der von einem Hund handelt und „Abschied von der Sprache“ hieß. In einem Interview mit der „Zeit“, in dem es u. a. darum ging, warum er weder ein Mobiltelefon noch einen Computer braucht, wurde er gefragt: Schauen Sie denn wenigstens fern? „Selten. Manchmal Tierfilme auf der BBC, in denen Menschen Monate damit verbringen, um einem Käfer oder einer Haselmaus nachzustellen.“ Was ist Ihr nächstes Filmprojekt? „Die Geschichte eines Paares, das sich sehr gut versteht. Und das sich besser versteht, sobald es einen Hund hat.“ Im Drehbuch sind ja bereits Photos…Und da ist auch ein Hund … ,,Das ist unser Hund.“ Welche Rasse? „Keine Rasse.“ Verstehen auch Sie und Ihre Frau sich besser, seit Sie den Hund haben? „Nun, er tut uns gut.“ Weil Sie manchmal über den Hund miteinander kommunizieren? „Sehr oft sogar. Sehen Sie, ich brauche wirklich kein Mobiltelefon.“
Es ist aber so verdammt praktisch. Meine Freundin hat ein Smartphone. Wie oft googeln wir nach einem Fremdwort oder Zitat oder mit einer Pflanzenbestimmungs-App nach dem Namen eines Vorgarten-Gewächses. Nur leider gehen diese Scheißdinger immer schon kurz nach Ablauf der Garantiezeit kaputt. In der Mittelklasse kostet ein Smartphone laut Wikipedia zwischen 200 und 500 Euro, Oberklassemodelle sind preislich ab 600 Euro angesiedelt. Die neuesten Geräte kosten mittlerweile über 1000 Euro. Aber das Schlimmste ist, wenn man alle möglichen Dinge mit dem Gerät erledigt, die Daten aufs neue Gerät zu übertragen. Die Experten nehmen dafür noch mal einige hundert Euro. Bei den früheren Handys war das einfacher, aber sie werden von den großen Elektroläden gar nicht mehr verkauft.
Ein „geplanter Verschleiß“, um damit die Betriebsdauer zu verkürzen, sollte im Zuge der Maßnahmen zur Verlangsamung der Klimaerwärmung nicht mehr vorkommen dürfen. In den USA wurde Apple deswegen einmal juristisch belangt. Hierzulande häufen sich im Internet noch die Mutmaßungen über „planned obsolescence“ bei den Smartphones.
Ebenfalls zur ökologischen Auseinandersetzung über diese Hightech-Geräte gehört ihre Funkstrahlung. Die Kreuzberger Imkerin Rita Besser bemerkte vor einiger Zeit eine seltsame Verhaltensänderung bei ihren Bienenvölkern, deren Kästen auf dem Dach standen: „Sie wurden immer aggressiver, im Winter ist mir dann ein Volk eingegangen.“ Die Ursache dafür sieht sie darin, daß ein Mobilfunk-Sendemast auf dem Dach des Nachbarhauses errichtet wurde. Ihr Mann, der eine Ausbildung als Baubiologe macht, beschäftigte sich dann näher damit. Er meint: „Ihre Fühler wirken wie Antennen, das macht die Bienen verrückt. Die Stöcke standen ja nur 10 Meter Fluglinie entfernt von dem Mast – das war zu nahe. Die können von den elektromagnetischen Wellen sterben.“
Obwohl die Industrie und ihre Forscher das abstreiten, gibt ihm eine Broschüre des Kreuzberger Stadtteilausschusses mit neuen Forschungsergebnissen über diesen Elektrosmog recht: „Informationen zu Mobilfunk und UMTS“. Ein neuseeländischer Forscher meint darin: „Die Handys werden innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre mit hoher Wahrscheinlichkeit die Fallzahl vieler neurologischer Krankheiten sowie der Gehirntumore ansteigen lassen.“ Ich machte ein unfreiwilliges Experiment mit einer großen Yucca-Palme, die im Raum neben einem Kabelmast stand. Als daran ein „Router“ für den Internetempfang befestigt wurde, starben rings um dieses Gerät die Blätter.
.
Laschen
„Ach, die Laschen…“ murmelte kürzlich ein Freund von mir, der auf dem Land lebend, Gebrauchsanweisungen ins Deutsche übersetzt. Bei seinen „Laschen“ dachte ich an den alten Werbeslogan der staatlichen Drogenbekämpfer „Hasch macht lasch!“ Einer der wenigen Propagandasprüche, denen wir damals zustimmen konnten. Inzwischen kiffen wir allerdings nur noch, um in Schwung zu kommen – sachlich. Mein Freund hatte jedoch an ein grundsätzliches Gebrauchsanweisungsmanko gedacht, und zwar am simplen Kontext von Lasche-Falz-Schlitz. „Nehmen Sie die Lasche A) über den Falz B) und stecken sie in den Schlitz C) – Dann ist die Verpackung wieder zu und die Cracker schmecken auch nach einiger Zeit noch knackig und und werden nicht lappig,“ erklärte mir mein Freund. „Verstehst Du?“ fügte er hinzu. Keine Frage.
Eine solche Gebrauchsanweisung lesen und verstehen, in die Wirklichkeit der Cracker-Verpackung, die vor einem steht, zu übersetzen und danach zu handeln – sachgerecht, das ist komplizierter als wenn da gar keine Gebrauchsanweisung stehen würde und jeder die Verpackung auf seine Weise öffnen würde. Der eine mit Gewalt an einer Schwachstelle, der andere von oben mit dem Messer, ein dritter versucht es mit spitzen Fingern und Nachdenken. Über 80 Prozent der Crackerkäufer lesen die Gebrauchsanweisung nicht oder verstehen sie nicht. Man kann sich vorstellen, wie das mit den Gebrauchsanweisungen für das Zusammenbauen von IKEA-Möbeln ist oder noch schlimmer, mit den Beipackzetteln von schwierigen Medikamenten gegen noch schwierigere Krankheiten. Ach, schon der Beipackzettel einer harmlosen Hautcreme kann abendfüllend sein, wenn man z.B. alle Fremdworte darin googelt.
Aber wer tut denn so etwas? entfuhr es mir. „Das fragst Du mich, dem Übersetzer von Gebrauchsanweisungen?! Ich erzählte ihm daraufhin eine Geschichte, wie es dem neuen Warenbesitzer und Leser, für den die Gebrauchsanweisung ja bestimmt ist, geht: Die Hamburger Schriftstellerin Susanne Fischer hat einen Sohn. Als der zur Schule kam, „stellte er einmal nach einer langen Autobahnfahrt entnervt fest, dass man nicht mehr nicht lesen kann, wenn man mal lesen kann. Die Kolonne der beschrifteten Lastwagen – Logistic Star, Logistic Heaven, Logistic Universe – hatte ihn total erschöpft.“ Seine Mutter meint: „Auch ich kann nicht nicht lesen.“ Überdies würde sie „gern aus der Schrift aussteigen. Schrexit sozusagen.“ Das schreibt sie in ihrem Erzählband „Norddeutsche Nebentischreportagen“ (2019). Also, man will wenigstens nicht noch lauter Kleingedrucktes lesen.
Zurück zur Lasche. Diese Wundertüte Wikipedia hat einen Laschen-Definitions-Eintrag: „Eine Lasche ist die eine Seite einer Verbindung, bei der zwei Stücke eines flachen Materials überlappend verbunden werden,“ heißt es da. Ein klassisches Beispiel dafür sei die Lasche beim Briefumschlag. „Ebenso finden Laschen bei Getränkedosen aus Aluminium Verwendung, so werden die sogenannten Aufreißlaschen zum Öffnen verwendet.“
In ihrer Stoffgeschichte „Aluminium. Metall der Moderne“ (2008) hat die Technikhistorikerin Luitgard Marschall erzählt, wie die ständige Verbesserung der Getränkedosen aus Aluminium bis zur Marktbeherrschung gedieh. U.a. erwähnt sie dabei einen Ermal Fraze aus Ohio, der 1959 auf einem Landausflug den „Schlüssel“ zum Öffnen seiner Dosenbiere (den es damals noch gab) vergessen hatte und sich anschließend schwor, einen Öffnungshebel zu konstruieren, der „fest mit dem Dosendeckel verbunden ist“. 1963 erreichte er sein Ziel und erhielt für seine „Getränkedose mit Aufreißlasche“ das Patent.
Ich kenne zufällig einen Erfinder, Eddi Sadowski aus Wächtersbach, der das Problem nach dem Öffnen, dass man mit der Lasche die Dose nicht vorübergehend wieder verschließen kann, löste – nachdem er beim Trinken aus einer Cola-Dose eine Wespe mitverschluckt hatte. Zunächst experimentierte er mit Deckeln von Tupperware, dann mit Knetgummi. Von einer der Knetgummiformen ließ er schließlich eine Zeichnung anfertigen. Ein Techniker vervollständigte sie ihm dann bis zur „Patentunterschriftsreife“. Eddi nannte den Dosenverschluß „Ploppy“. Eine Gummifabrik sollte ihm 24.000 herstellen, er hatte mehrere Getränkegroßhändler als Abnehmer, aber die Fabrik ließ ihn immer wieder hängen, de Sommer ging vorbei und die Großhändler sprangen ab. Er hatte sich einen BMW und einen blauen Anzug gekauft, versuchte neue Händler zu aquirieren, aber schließlich hatte er seinen ganzen Keller voller „Ploppys“ und einen Haufen Schulden. Es wird weniger, aber sehr langsam, er arbeitet als Nachtwächter und höchstens im Sommer wird er einige wenige seiner Ploppys los – bei Imbißbesitzern, Spätis und Schwimmbadkioskbetreibern. Auf Messen verschenkt er sie kartonweise – mit der Bemerkung: „Mein Ploppy-Flop“.
.
Leben
Das Leben „auslöschen“, ein Lebewesen verletzen und es dann von seinem Leiden „erlösen“, Soldaten nicht Mörder nennen, Tiere empfinden nicht so wie wir, Pflanzen haben keine Gefühle usw.
„Das Leben, das legen die sich so aus: ‚Die Eierstöcke sind die größten Philosophen‘,“ meinte der Dichter Gottfried Benn. „Das Leben lebt nicht,“ konstatierte dagegen der Philosoph Theodor W. Adorno, er meinte sicher das „gesellschaftliche Leben“ – mit dem Marxisten Alfred Sohn-Rethel erklärt hieß das, weil der sich über den Markt herstellende gesellschaftliche Zusammenhang bloß ein abstrakter ist. Für den Psychoanalytiker Wilhelm Reich bedeutete das Nicht-Leben des Lebens (der Weißen), dass ihnen ihr „Charakterpanzer“ kein wirkliches Lustempfinden erlaubt.
Die US-Naturwissenschaftler glauben, mit der Entdeckung und Manipulation der „Gene“ das Leben „geknackt“ zu haben – so wie polnische Mathematiker im Krieg mit ihrer „Enigma“ den Code des Nazi-Funkverkehrs „dechiffrierten“. Aber noch nie war eine „Life Science“ so weit vom Leben entfernt.
Neulich hatte ich eine Mitfahrgelegenheit von Würzburg nach Berlin – und freute mich, als ich erfuhr, dass meine Fahrerin eine Biologin war. Schon brabbelte ich diesbezügliches, da unterbrach sie mich: „Tiere und Pflanzen, Lebendiges, interessiert mich überhaupt nicht, ich beschäftige mich mit einem Hormon. Und wenn ich meine Doktorarbeit fertig habe, für den Rest meines Lebens mit zwei Hormonen.“
Aus dem Inneren eines solchen Hightech-Labors berichtete ausführlich auch die Freiberger Biologin Anne-Christine Schmidt in ihrem „Schwarzbuch ‚Alptraum Wissenschaft‘“ (2016) – jedoch längst nicht so lebensfroh wie die Würzburgerin, der Titel deutet es bereits an.
Tatsächlich ist mir das, was man „Leben“ im biologischen Sinne nennt, inzwischen zum größten Rätsel geworden, wobei dieses – im biologischen Sinne gestellt – vielleicht schon falsch ist, d.h. dass man naturwissenschaftlich denkend nie dem näher kommt, was man „Leben“ nennt. Von allen Biologen geben sich zwar die Ethologen mit ihrer Feldforschung die größte Mühe, aber auch sie neigen dazu, aus ihrer Beobachung von einigen Tieren schnell auf das Verhalten der ganzen Art zu schließen. Erst jetzt, da die „organismische Biologie“ von der Genetik und Molekularbiologie verdrängt wird, kommt man darauf, das Leben von einzelnen (Tieren) zu studieren. Manchmal denke ich: Was ist die ganze Kunst, bis hin zu Michelangelo und Co, gegenüber einer Mücke?! Es heißt, ich da vergleiche Äpfel mit Birnen. Aber wenn die Künstler sich heute gerne mit Öko-Kunst präsentieren und die Ökologie fast täglich gegen die Ökonomie in Stellung gebracht wird, dann nähern wir uns doch dem für Weiße vielleicht noch utopischen Gedanken einer „Ökologie ohne Natur“. Wir sind dann so mit ihr verbunden, heißt das (beim Philosophen Timothy Morton), dass dieser Begriff überwunden wurde.
Solchem Wahrheitsbegriff halten die Naturwissenschaftler ihren wertschaffenden Genbegriff entgegen. Einer, der Biologe und Berater von Biotech-Unternehmen, William Bains, schrieb in der Zeitschrift „Nature Biotechnology“: „Die meisten Anstrengungen in der Forschung und in der biotechnologischen industriellen Entwicklung basieren auf der Idee, dass Gene die Grundlage des Lebens sind, dass die Doppelhelix die Ikone unseres Wissens ist und ein Gewinn für unser Zeitalter. Ein Gen, ein Enzym, ist zum Slogan der Industrie geworden…Kann das alles so falsch sein? Ich glaube schon, aber ich bin sicher, das macht nichts. Denn die Hauptsache ist, dass es funktioniert: Manchmal funktioniert es, aber aus den falschen Gründen, manchmal wird es mehr Schaden anrichten als Gutes tun…Aber die beobachtbare Wirkung ist unbestreitbar…Wir müssen nicht das Wesen der Erkenntnis verstehen, um die Werkzeuge zu erkennen…Inzwischen führen die Genom-Datenbanken, die geklonten Proteine und anderes Zubehör der funktionalen Genetik zu Werkzeugen, Produkten, Einsichten, Karrieren und Optionen an der Börse für uns alle.“ Uns? Die amerikanische Biologiehistorikerin Lilly E.Kay behauptet, in ihrem Land „sind mindestens 80 Prozent der Molekularbiologen an eigenen kommerziellen Biotech-Unternehmen beteiligt“.
Die in Emden lehrende Genkritikerin Silja Samerski merkte dazu in einem Interview an: „Das ,GEN‘ ist nichts anderes als ein Konstrukt für die leichtere Organisation von Daten, es ist nicht mehr als ein X in einem Algorithmus, einem Kalkül. Aber außerhalb des Labors wird es dann zu einem Etwas, zu einem scheinbaren Ding mit einer wichtigen Bedeutung, mit Information für die Zukunft… über das sich anschaulich und umgangssprachlich reden lässt. Es ist jedoch sehr fraglich, ob man umgangssprachlich über Variablen von… oder Bestandteile eines Kalküls oder Algorithmus sprechen kann, ob sich also überhaupt außerhalb des Labors sinnvolle Sätze über ,GENE‘ bilden lassen, die von irgendeiner Bedeutung sind. Wenn aber solche Konstrukte in der Umgangssprache auftauchen und plötzlich zu Subjekten von Sätzen werden, mit Verben verknüpft werden, dann werden sie sozusagen in einer gewissen Weise wirklich.“ Auf ihrer Internetseite „Über mich“ schreibt die Professorin: „Aus Begeisterung für Tiere und Pflanzen begann ich 1989 in Tübingen, Biologie zu studieren. Bereits nach einem Semester war meine Begeisterung allerdings ziemlich gedämpft: Zu meiner Enttäuschung widmete sich die moderne Biologie nicht so sehr dem Verständnis des Lebendigen, sondern vielmehr dem Versuch, Lebewesen technisch zu manipulieren und zu „optimieren“.
.
Ewiges Leben
„Ich habe mein Schach von der Literatur auf die Biologie gesetzt, damit das Spiel ehrlicher wird,“ verkündete Ossip Mandelstam. Die Biologen wissen um das ewige Leben, aber ohne Hoffnung. So schreibt z.B. der amerikanische Rabenvogelforscher Bernd Heinrich in „Leben ohne Ende“ (2019): „Alle Lebewesen haben ein Leben nach dem Tod, das uns ständig umgibt, aber im Verborgenen stattfindet. Der Tod verknüpft die Leben miteinander wie Glieder einer unendlichen Kette: Was stirbt aufersteht zu neuem Leben.“
Das alte Leben endet innen mit dem Aussetzen von Herzschlag und Atmung, die Zellmembranen beginnen zu lecken, die Makrophagen gehen mangels Sauerstoff im Blut zugrunde, die Bakterien im Darmtrakt dringen in den übrigen Körper ein und setzen den Fäulnisprozeß in Gang.
Von außen kriechen derweil Gold- und Fleischfliegen unter den toten Körper, wo sie ihre Eier ablegen, ihre Jungen verflüssigen mit einem Sekret Teile des Fleisches, das sie aufsaugen. Sie haben Atemlöcher, wenn sie zu viel verflüssigen, ersticken sie darin. Anders die Fleischfliegen, die ihre Maden lebend gebären: Diese haben ihre Atemlöcher am Hinterleib, der verdickt ist, und damit als Schwimmer fungiert.
Dann kommen die Schmeißfliegen, jedes Weibchen legt an die 20.000 Eier. Ihre Maden haben eine „Atemrosette“ am Hinterleib, die sich auf der Flüssigkeit entfaltet. Drumherum warten immer mehr Stutzkäfer darauf, dass die Madenmassen sich fett gefressen haben, dann verzehren sie diese bis auf wenige. Nach den Stutzkäfern fallen die Speckkäfer über den inzwischen mumifizierten Körper her. Sie verzehren den Toten bis auf die Knochen. Am Verzehr der letzten Reste beteiligen sich Aas- und Raubkäfer und ihre Maden. Die Maden der Raubkäfer töten und verzehren sich auch gegenseitig. Hinzu kommen immer mehr Pilze.
Wenn eine weitere Käferart, die Totengräber, rechtzeitig die Leiche riechen, graben sie diese schnell ein, um den Fliegen zuvor zu kommen. Bei einer Erdbestattung der Leiche müssen sie dagegen warten, bis das Sargholz Löcher und Risse bekommt – durch Fäulnisprozesse, die von anderen Lebewesen in Gang gesetzt werden. Dann machen die Totengräber aus der Leiche eine „grünliche Abscheulichkeit“, wie der Insektenforscher Jean-Henri Fabre sich ausdrückte. Dieser grüne Klumpen ist für die Totengräber-Kinder gedacht, während die farbenprächtigen Totengräber-Eltern von Käfermilben langsam zerfressen werden und sich überdies auch noch gegenseitig verzehren. Zuvor haben sie aber „Verdauungsenzyme und antimikrobielle Proteine, produziert, die sie als Sekret auf das Fleisch übertrugen, das sie damit für ihre Kinder ‚chemisch reinigten‘“ – heißt es in einer Studie von Wissenschaftlern aus vier deutschen Forschungsinstituten – über die unterirdische Tätigkeit des Schwarzhörnigen Totengräbers.
Dieses völlige Verschwinden eines Gestorbenen ist genaugenommen eine Reinkarnation, also eine Wiederfleischwerdung. Die natürliche oder ökologische Reinkarnation ist nichts anderes als eine „ewige Wiederkehr“ (vor der Nietzsche grauste), weswegen so viele unserer Gene z.B. mit denen der Aasfliegen identisch sind: über 60%. Wir verabscheuen die Aasfliegen, es gab jedoch Kulturen, in denen sie willkommen waren – u.a. bei den Moche, die bis zum achten Jahrhundert an der Küste Perus lebten. Sie boten diesen Leichenfressern ihre Verstorbenen an. Deren Seelen werden von den Fliegen befreit und wieder in der Welt ausgesetzt, glaubten die Moche. Ihnen zufolge ist die Reinkarnation mithin eine Angelegenheit der Seele, die sich dazu der Fliegen bedient. Für die Biologie funktioniert die Reinkarnation dagegen fast nur mit Insekten – aber ohne die Seele, weswegen man auch von einer seelenlosen Wissenschaft spricht.
Stattdessen gibt es Bestattungsrituale, bei denen die trauernden Hinterbliebenen die Seele des Verstorbenen wenigstens noch eine Weile „lebendig“ halten. Eine einfache Erdbestattung kostet inklusive Friedhofsgebühren, Bestatterleistungen, Grabstein, Sarg und Trauerfeier rund 10.000 Euro, die einfachste Feuerbestattung mit Trauerfeier etwa 2000 Euro, die Asche ab Warnemünde ins Meer zu streuen 1000 Euro. Immer mehr Hinterbliebene lassen die Asche ihrer verstorbenen Geliebten zu einem Diamanten verarbeiten. Dazu braucht man nur einen Bruchteil ihrer Asche. Diese wird nach Amerika geschickt, wo sie einige Wochen lang unter hohem Druck und bei hoher Temperatur gepresst wird, um dann je nach Geschmack geschliffen zu werden. Für einen Einkaräter muss man 14.000 Euro zahlen. Die Besitzer solcher Diamanten behaupten gerne, dass sich die Seele ihres geliebten Verstorbenen darin befände – und so quasi unsterblich geworden sei. „Diamants are girl‘s best friends“, sang Marilyn Monroe.
.
Glücklich sterben
„Was ist das nur für eine Einrichtung, dass man an schlechten Tagen mehr am Leben hängt als an den guten Tagen?“ (Silvia Bovenschen in „Älter Werden“, 2006)
Ein glückliches (oder geglücktes?) Sterben setzt erst einmal ein gehöriges Alter voraus – ein Luxus, den sich unsere Gesellschaft bald nicht mehr leisten kann, fürchtete Silvia Bovenschen. Das Altern macht einen mit der Zeit immer unattraktiver, darunter leiden besonders diejenigen, die ihr Lebensglück vornehmlich in der Sexualität suchten, wie die Expertin für Liebe und Ängste, Alison Louise Kennedy, meint herausgefunden zu haben. Ihre alternden Helden und vor allem Heldinnen bieten gegen das Unattraktiv-Werden Pflegemittel, teure Düfte und Kleidung sowie einen distinktiven „Life-Style“ auf, andere Autoren empfehlen Jogging, Sport, regelmäßige Gesundheitskontrollen, achtsame Ernährung (Bio, Öko, Vegan etc.), Meditation, Yoga, Peeling, Fitnesscenter, Schönheitsoperationen (Ein Zigmilliardengeschäft).
In den USA hat das bereits zu derartigen Exzessen geführt, dass die Publizistin Barbara Ehrenreich in ihrem Buch „Wollen wir ewig leben?“ (2018) von einer regelrechten „Wellness-Epidemie“ spricht. Die eher produktiv tätige als sexversessene 78jährige schreibt darin: „Weil die Zeit, die mir bleibt, immer kürzer wird, ist jeder Monat und jeder Tag zu kostbar, um ihn in einem fensterlosen Wartezimmer und zwischen Untersuchungsapparaten zu verbringen. Alt genug geworden zu sein, um zu sterben, ist eine Leistung, keine Niederlage und die damit verbundene Freiheit verdient es, gefeiert zu werden.“
Mit „Leistung“ meint Ehrenreich wahrscheinlich ihre wirklich guten „Sozialrecherchen“ und mit „Freiheit“ das, was sie ihr an Honoraren einbringen. Daraus scheint für sie eine positive Einstellung zum Altern zu resultieren. Und diese allein erhöht schon die Lebenserwartung um sieben Jahre, wie US-Wissenschaftler meinen herausgefunden zu haben. Selbige behaupten laut Neue Zürcher Zeitung auch: „Wer noch im Alter Freude an Sex hat, lebt gesünder und womöglich länger. Schon das Küssen ist ein kleines Muskeltraining und setzt Glückshormone frei.“ Man sollte sich jedoch nicht aus Muskeltrainingsgründen darum bemühen, das erzeugt „Stress“.
Der Stress wurde Mitte des 20. Jahrhunderts erfunden und ist für vieles von Übel, auch für einen frühzeitigen Tod. Das ergaben sowohl Verhaltensforschungen an Pavianen wie auch an weißen Amerikanern der Unterschicht. Barbara Ehrenreich spricht vom „großen Sterben der weißen Männer“: Sie rauchen, trinken Alkohol, nehmen Opiate, gehen nicht in Fitnesscenter, ernähren sich von Hamburger und Pommes Frites, hängen vorm Fernseher und verfetten verbittert. Vor allem aber sind sie deswegen gestresst, weil ihre Jobs prekär geworden sind, ihre Einkommen sinken und sie sich von jedem Arsch was sagen lassen müssen. Auch von all den Weißkitteln, die unisono behaupten: „Letztlich liegt es an jedem Einzelnen, sich für ein gesünderes Verhalten zu entscheiden“. Ja die öffentliche Meinung in den USA geht dahin, dass es für alle eine „individuelle moralische Verpflichtung zur Gesundheit“ gibt. Barbara Ehrenreich spricht vom „Gesundheits-Wahn“, schon Susan Sontag kritisierte die „Moralisierung von Krankheiten“ in den USA und damit auch in allen anderen Industrieländern.
So etwas gibt es sogar unter den Linken hier. So behauptete z.B. der Rätekommunist Hans-Dieter Heilmann, dass Revolutionäre keinen Krebs kriegen. Sein Beweis lag im Umkehrschluß: Wenn sie dann doch an Krebs erkrankten und Marxbehüte daran starben, waren sie eben keine Revolutionäre, sondern bestenfalls bemühte. Da schwang noch die Wilhelm Reichsche „Charakterpanzer“-Theorie mit, die zuletzt von Klaus Theweleit klug verfeinert, aber vor allem auf faschistische weiße Männer in Anschlag gebracht wurde. „Ihnen ist das Mißgeschick passiert, dass sie zwar töten, aber nicht ficken können“. Theweleit ging allerdings nicht so weit zu behaupten, dass diese Männer alle krebsgefährdet sind. Schon der Anschein spricht dagegen: Ernst Jünger wurde 103, Luis Trenker 98, Leni Riefenstahl 101. Das hohe Lebensalter dieser und vieler anderer Altnazis in der jungen Bundesrepublik ist vielleicht sogar das beste Argument gegen diese Demokratie, die nur eine dumpfe Gleichheit vor dem Gesetz, aber keine Gleichheit des Besitzes kennt. Im Gegenteil: Die Schere zwischen Arm und Reich tut sich immer weiter auf.
Im neoliberalen Amerika, wo die Dekompositionierung die Bevölkerung zu einem Haufen Sandkörner (Iche) zerstäubt, ist das Silicon Valley das stille Auge im Taifun: belebt laut Ehrenreich von lauter Autisten. „Es gibt über 500 Achtsamkeits-Apps mit Namen wie ‘Simply Being‘ und ‚Buddhify‘.“ Mit „süßlichen Bildern von Wäldern und Wasserfällen“. Der „Buddhismus“ ist für diese wohlhabenden Kalifornier ein Lebenselixier – trotzdem sterben sie vorzeitig und unglücklich. Was sie jedoch nicht davon abhält, technologisch und medizinisch für ihre Unsterblichkeit zu „kämpfen“, zuletzt nur noch gegen ihren Krebs.
Embryologinnen am Pariser Institut Pasteur haben die neuerdings auch von einigen US-Forschern gestützte Vermutung geäußert, dass das Austragen eines Kindes und das Wachsen eines bösartigen Tumors identische Vorgänge sind: Der Fötus ist ein fremdes Stück Fleisch, ein Pfropf, den der Körper der Mutter abzustoßen versucht. Aber dem Fötus wie dem Krebs gelingt es, das Immunsystem seines Wirts erfolgreich zu blockieren. Zwischen ihnen gibt es laut den Embryologinnen nur einen wesentlichen Unterschied: „Aus der befruchteten Eizelle entwickelt sich ein neuer Staat, mit dem Krebs bricht dagegen die Anarchie aus.“
.
Gehhilfen
Ich gehe! Das Gehen hat Konjunktur, nicht das wirkliche Gehen sondern Bücher darüber. Denn wenn einem wegen „Lockdown“ und „Home-Office“ das Rausgehen erschwert wird, dann will man wenigstens Bücher über das Gehen lesen. Anders beim Fliegen: Wenn die Grenzen dicht sind, wo will man da hinfliegen? Die Le Monde weiß es: Seit einigen Wochen nehmen insbesondere in Asien die ‚Flüge nach nirgendwo‘ zu. Im Juli bot China Airlines, ein Unternehmen mit Sitz in Taiwan, dem an Mangelerscheinungen leidenden Bevölkerungsteil ‚falsche‘ Flüge an. Bordkarten, Passkontrollen, Sicherheitsanweisungen an Bord, alles wie gehabt… Nur blieb die Maschine am Boden. Im selben Monat charterte ein anderes taiwanesisches Unternehmen, Eva Air, einen ihrer Jets in Hello Kitty-Farben, der vom Flughafen Taoyuan abflog, um nach 2 Stunden und 45 Minuten wieder dort zu landen. Ende August bot All Nippon Airways einen 90-minütigen Rundflug am Bord einer der A380 an, die normalerweise zwischen Tokio und Honolulu fliegen. Sowohl am Flughafen als auch im Flugzeug durften die Passagiere ein ‚hawaiianisches Urlaubserlebnis‘ genießen. Auch bei Royal Brunei Airlines kann man eine 85-minütige ‚Dine & Fly‘-Sightseeing-Tour buchen. Alle Plätze für den ersten Flug waren innerhalb von 48 Stunden ausverkauft. Und der Erfolg hält an. “
Zurück zum Zu-Fuß-Gehen: zwei intellektuellen Gehern – die Autoren, einer stammt aus dem Osten, der andere aus dem Westen, haben sich die Mühe gemacht, wochen- oder sogar monatelang die Rhön zu Fuß zu durchstreifen. Der eine querdurch, der andere immer an der ehemaligen DDR-Grenze entlang. Der aus dem Ruhrgebiet stammende Ulrich Grobe wollte damit vor allem die „alte Kunst des Wanderns“ – von der klassischen Peripathetik über das gläubige Pilgern bis zur Kasseler Spaziergangsforschung – (wieder) populär machen, während der thüringische Schriftsteller Landolf Scherzer die „Befindlichkeiten“ der Bewohner zu beiden Seite des sogenannten „Kolonnenwegs“, auf dem bis 1989 die Grenztruppen der DDR patroullierten, erkundete. Auf dem letzten Streckenabschnitt seiner Wanderung wurde er vom Einschleichreporter Günter Wallraff begleitet. Als sie einmal einkehrten, meinte der Wirt zu ihnen: „In der DDR hatten wir Gäste ohne Ende und keine Waren. Heute haben wir Waren ohne Ende, aber keine Gäste.“ Für den eher meditativ als investigativ gestimmten Zeitjournalisten Ulrich Grobe war dagegen diese Grenze bloß ein Orientierungspunkt – auf dem Weg zu einer ökologisch sauberen Selbsterfahrung, die aber reine Werbepoesie ist: „Auf jeder Wanderung versuche ich, mich aus der Landschaft, durch die ich gehe, zu ernähren. Nirgendwo ist es so einfach wie hier im Biosphärenreservat, wo man mit der Vermarktung regionaler ökologischer Produkte und einer Ökonomie der kurzen Wege Ernst macht.“
Der Schweizer Nationalökonom Lucius Burckhardt hat aus diesem literarisierten Freizeitspaß eine ernsthafte „Spaziergangsforschung“ gemacht, die „Promenadologie“. Daneben gibt es aber auch ein richtiges „Weggehen“. Ich selber habe mir 1978 gesagt: „Ich gehe jetzt!“ – in Richtung Südsüdwest, bin aber damals nur bis Italien gekommen. Immerhin! Mein Pferd trug mein Gepäck (einen Zentner).
Anders der polnische Schriftsteller Witold Gombrowicz im argentinischen Exil: Dort besuchte er eine Intellektuellenparty, wo sich alles um Jorge Luis Borges scharrte, der lauter Süßlichkeiten von sich gab, so dass es Gombrowicz irgendwann nicht mehr aushielt – und wegging. Und wie er ging. Aber als er beinahe zur Tür gelangt war, machte er wieder kehrt – „denn bereits begann sich mir das Gehen in einen Spaziergang zu verwandeln, und wieder gehe ich durch den Saal…“ Alles erstarrt und kuckt. Er nimmt einen neuen Anlauf: „Zum Teufel, Teufel, ich GEHE, GEHE, GEHE.“ Nur die ergangenen Gedanken haben Wert, um es mit Nietzsche zu sagen.
In Südamerika gibt es ein ganzes Volk, das eines Tages beschloß zu gehen – immer tiefer in den Amazonasdschungel hinein: die Machiguenga. Auf diese Weise entkamen wenigstens einige den mörderischen Kautschukhändlern, den Holzfällern, den Goldsuchern, den US-Missionaren, den Krankheiten der Weißen und – aktuell – den Erdölkonzernen: „An dem Tag, da ihr aufhört zu gehen, werdet ihr ganz fortgehen..heißt es von den letzten, verstreut im Urwald überlebenden Machiguengas in dem Roman „Der Geschichtenerzähler“ von Mario Vargas Llosa, über die der er schreibt: „Um im Gehen zu leben, mußten sie zuvor leicht werden und alles zurücklassen, was sie besaßen.“
.
Mösen
Es mehren sich, wie in den Siebzigerjahren, erneut Bücher von Feministinnen über die Vagina im allgemeinen, über ihre Möse im Besonderen, „Alles über das weibliche Geschlecht“ und über „die Beziehungen zwischen Nase und weiblichen Geschlechtsorganen“ z.B.. „Vor jedem Rendez-vous schmiert meine böse Mutter/ mir in meine Möse Butter,“ reimte die Flötenlehrerin Christiane Seifert in ihrem Buch „Die schönsten Stellen aus der Dissertation meines Mannes“ (1987). Der Philosoph Peter Sloterdijk z.B. ist ein großer Freund der Möse, wenn man den Eintragungen in seinem zweibändigen „Denktagebuch“ glauben darf.
2016 hatte er überdies einen Roman: „Das Schelling-Projekt“ veröffentlicht: In dem semi-autobiographische Text konzipiert er mit Freunden per E-Mail-Austausch einen Antrag für ein Forschungsprojekt. Ihr Thema ist die Evolution des weiblichen Orgasmus, in dem es quasi naturgemäß um die Möse geht. Mit einer unerklärlichen E-Mail des toten Nicolaus Sombart erweisen sie diesem darin ihre Reverenz. Sombart betrieb bis ins hohe Alter eine Art erotischen Salon in Westberlin, in dem neben verschmitzten Halbprominenten langbeinige Studentinnen verkehrten.
Die Schriftstellerin Elke Schmitter beschrieb Sloterdijks Orgasmus-Roman in einem Artikel für den Spiegel unter dem Titel „Die Frau als Herrenwitz“ als ein anti-feministisches Pamphlet, das nur notdürftig als Roman getarnt sei. Die Journalistin Stefanie Lohaus schrieb in Die Zeit: „Kennt sich Peter Sloterdijk mit Frauen aus? Der Philosoph gibt dem Feminismus die Schuld an einer neuen Prüderie. Damit leistet er der Neuen Rechten Vorschub, die eine sexuelle Selbstbestimmung verdammt.“ Aber „alle wissen jetzt, dass Sloterdijk auch mit Ende 60 immer noch toll abspritzen kann.“
Im 1.Band seines Denktagebuch (2012) findet sich der Eintrag: Eine Schriftstellerin wie die des Bestsellers „Feuchtgebiete“, Charlotte Roche, „tappt in ihrer Möse umher wie eine Sandalentouristin in einer Tropfsteinhöhle“.
Im 2.Band („Neue Zeilen und Tage“ 2018) notierte sich Sloterdijk: „Der Renaissance-Dichter Annibale Caro war der Meinung , dass die Möse (fica) nun endlich ihren Homer finden müsse.“ Ihn, Caro oder Sloterdijk? Ich weiß nur, dass Annibale Caro ein Buch über die Nase schrieb.
Eine andere Eintragung von Sloterdijk thematisiert einen „Abend in einem chinesischen Lokal, das durch unterdurchschnittliche Küche auffiel, doch durch den Anblick einer Kellnerin in mittleren Jahren entschädigte. Ich konnte nicht vermeiden, an Robert van Guliks Klassiker über Sexualität in China zu denken. Der Autor führt aus, es komme den Wissenden dort darauf an, den Damen ihre feuchte Essenz zu rauben, was nicht gelingt, wenn man sich nicht um ihre Erzeugung bemüht. Der Hinweis auf orale Verfahren ist ziemlich evident. Chinesische Sexualität wäre demnach der Prototypus einer win-win-Situation, die den Männern die Illusion der Langlebigkeit einbringt, den Frauen die rosigen Wangen.“
Als Beweis für „politischen Schamanismus“ erwähnt Sloterdijk: „Zweihundert Jahre nach der Revolution spreizten Passantinnen in der Ära Mitterand – substantiellen Gerüchten zufolge – im Elysée wie hypnotisiert die Beine, wenn der Präsident von einer Limousine aus mit dem Finger auf sie [ihre Möse] gezeigt und seinen Adjudanten angewiesen hatte, sie in die ‚chambre particulière‘ zu bestellen.“
Zum „politischen Schamanismus“ könnte man auch Sloterdijks Eintrag über Mao Zedong zählen: „dem Zeugnis des Leibarzts zufolge“ habe Mao „mindestens 250 Chinesinnen mit seinem Tripper angesteckt. Da er, asiatischer Sexual-Erotik folgend, über die Kunst verfügte, fast nie zu ejakulieren, war er am Morgen immer in Form…“ Im Internet gibt es heute ein gut besuchtes Forum junger Männer, die sich darin üben und Ratschläge geben.
Für Sloterdijk ist die Anekdote über Mitterand ein Gerücht, Curtius Malaparte will dagegen dabei gewesen zu sein, als die Amerikaner in Neapel landeten und arme Frauen, ganz in Schwarz gekleidet, sich auf eine lange Bank setzten und ihre Beine spreizten, damit die „Befreier“ sich nach Inaugenscheinnahme ihrer Möse für die eine oder andere entschieden – gegen geringe Bezahlung. Dies soll eine „Beobachtung“ von ihm in seinem Bericht „Die Haut“ (2008) sein, nun ein verfilmter Roman, den die Neue Zürcher Zeitung eine „bizarre Chronik“ der ersten Tage der Befreiung Neapels nennt: Überall sehe und beschreibe Malaparte „Verderbnis und Fäulnis“.
Eine weitere ähnliche Mösen-Geschichte erzählte neulich ein jüdischer Intellektueller über die Orthodoxen: Wenn sie Geschlechtsverkehr haben, sei die Frau vollständig mit einem Laken bedeckt, das nur da, wo ihre Möse sei, ein Loch habe.
Die „Frau als Herrenwitz“, das akzeptiert Sloterdijk anscheinend auch als Akt: “Nimmt man an, es habe zwischen Dominique Strauss-Kahn und der schwarzen Chambermaid des New Yorker Sofitel tatsächlich eine sexuelle Transaktion gegeben – vielleicht ein Akt von nicht allzu spontanem Oralsex, wahrscheinlich durch ein Trainkgeld vermittelt -, so liegt in dem Vorgang nichts, was die Aufmerksamkeit Dritter auf sich ziehen sollte.“
In Philip Roths Roman „Der menschliche Makel“ (2002) ist von der Oralsex-Affäre des US-Präsidenten Bill Clinton die Rede, der seiner Praktikantin Monica Lewinsky die Möse leckte: „Hätte Clinton sie in den Arsch gefickt, dann hätte sie vielleicht den Mund gehalten.“ „Stimmt. Und die Leute da [in Arkansas, wo Clinton Gouverneur war] erwarten geradezu von einem, dass man ein Arschficker ist. Das ist Tradition.“
.
Fit for Fun
Der Ästhetikprofessor Peter Sloterdijk entdeckte „im Fitness-Studio ein Plakat mit einer auf dem Rücken liegenden Frau, die ruft Fit mich!“ Das ist zwar vulgär gesagt, aber wohl wahr: Es geht beim Fitnesstraining um eine Steigerung der Attraktivität und der Gesundheit, wobei diese laut einer Harvardstudie für den Mann u.a. darin besteht, dass er mindestens „21 mal im Monat Sex hat“, d.h. ejakuliert, was sein Prostatakrebsrisiko um 33 Prozent senkt. Bei den Frauen ist die Wahrscheinlichkeit einer frühen Menopause bei so viel „Sex“ um 28% geringer, angeblich sinkt dabei auch das Brustkrebsrisiko. Damit Männer und Frauen diese Ficksequenz erreichen, sollten sie einigermaßen attraktiv aussehen. Da die „Anziehungskraft“ aber mit dem Alter abnimmt, müssen sie etwas gegen diesen Nachlassen tun: also Fitness betreiben, sich fit halten.
Die „Fitness“-Welle ist amerikanischen Ursprungs, sie begann hierzulande mit der Ersetzung des „Dauerlaufs“ durch das „Jogging“, das mit dem entsprechenden „Joggingoutfit“, auch „Running Essentials“ genannt, einherging: Laufschuhe, Hemden, Jacken, Socken, schweißfeste Armbände, Armtaschen.Dazu kamen dann Fitness-Uhren mit Herzfrequenz-, Blutdruck- und EKG-Anzeigen sowie gegebenenfalls Jogging-Gürtel für Smartphones mit Headset Noise Cancelling Ohrhörer inklusive Mikrofon und tragbarer Ladehülle.
Anfänglich wurden die Jogger noch von allerlei Haus- und Wildtieren angegriffen, im Wald u.a. von Raubvögeln und Krähen, so als wollten diese ihnen sagen: Hier geht man entweder gemessenen Schrittes oder man bleibt draußen.
Vor 62 Jahren wurde in Unterfranken das erste Bodybuilding-Studio eröffnet, heute gibt es hier rund 8000 Fitnessstudios, in denen unterschiedliche Geräte zum gezielten Kraft- und Ausdauertraining stehen, oft offeriert man dort auch noch animierte Kurse für Indoorcycling und Aerobic: ein von Musik begleitetes rhytmisches Bewegungstraining vor allem für Frauen, das 1981 von der Hollywoodschauspielerin Jane Fonda über Videos propagiert wurde und jetzt im Alter von 82 noch einmal. Den Fitnessstudios sind häufig Sauna- und Wellnessbereiche angeschlossen, in denen man den Fortschritt bei der „Optimierung“ seiner Körperformen im Vergleich mit anderen Nackten einschätzen und gegebenenfalls an den Fitnessgeräten (Rudergeräte, Laufbänder, Kabelzuggeräte etc.) bestimmte Muskelgruppen besonders entwickeln kann.Dazu gibt es auch noch Muskelaufbaupräparate (u.a.„Pferdegold“), verbunden mit Nahrungsergänzungsmitteln und einer „gesunden Ernährung“.
„Das Volk zieht sich aus. Die Haut wird zur Annonce,“ meint Sloterdijk. Die jungen Frauen „führen ihre Tattoos an entlegenen Stellen vor“. In ihren Internetforen erfahren sie, wo sich in ihrer Vagina die U- und G-Punkte zur Luststeigerung befinden, diese können sie sich auch mit Kollagen vergrößern – „aufspritzen“ – zudem die Vagina „straffen“ und die Brüste „liften“ lassen.Eine Schriftstellerin wie die des Bestsellers „Feuchtgebiete“, Charlotte Roche, „tappt“ laut Sloterdijk „in ihrer Möse umher wie eine Sandalentouristin in einer Tropfsteinhöhle“.
Für den schnellen Erfolg beim ästhetischen Bodyshaping gibt es Hormonpräparate. Das Abbauprodukt DHT des Hormons Testosteron, das von Männern eingenommen wird, um ihr Muskelwachstum zu forcieren, bewirkt allerdings, wenn es mit ihrem Urin in Flüsse und Seen gelangt, dass aus Froschweibchen Männchen werden, womit deren Populationen zum Untergang verurteilt sind. Gelangen Östrogen-Abbauprodukte mit dem Urin in die Gewässer, verweiblichen die männlichen Fische. Dies geschieht u.a. über den Wirkstoff Ethinylestradiol in Antibaby-Pillen, deren Einnahme wiederum notwendig ist, um mit der nötigen Ficksequenz die Gesundheit zu erhalten bzw. zu verbessern.
Häufiger „Sex“ dient auch dem psychischen Wohlbefinden, weil er die „Glückshormone“ Dopamin und Serotonin freisetzt, wie die Wissenschaftler von Harvard herausfanden. Sloterdijk beobachtete auf ihrem Campus: „Um halb sieben am Morgen ist das Fitness-Studio schon voll von Trainierenden, die sich selbst antreiben, wie Akteure, die noch Größeres vorhaben.“ Im dortigen Swimmingpool herrscht wegen des Andrangs äußerste Bahnendisziplin. Die Anzahl der geschwommenen Bahnen wird ebenso in Kilometern gezählt wie die der gejoggten, an den Geräten geruderten bzw. getretenen Strecken und die der gestemmten Gewichte in Kilo. Man kann sogar sagen, das Zählen und die Erhöhung der Zahlen bei jeder dieser Anstrengungen ist die eigentliche Fitness. Die Jogger, Schwimmer und an Kraft- und Sportgeräten Trainierenden sind „Berufsevolutionäre“, denn sie gehen darwinistisch angeregt vom „Survival of the Fittest“ aus, also dass nur der Fitteste im Geschlechter- und Daseinskampf überlebt, d.h. erfolgreich ist. Sloterdijk sieht bereits ein „drohendes Übermaß an Gesundheit“ aufkommen.
Ich sehe dagegen in den Bodybuildingstudios eher die durch Automatisierung von ihren Maschinen verdrängten Arbeiter, die für ihren Produktionsausstoß Stücklohn bekamen und nun für die Benutzung von Fitnessgeräten zahlen müssen. Gesund ist beides nicht.
.
Kleopatra
Kleopatras Leben und Sterben wurde oft verfilmt, weltberühmt wurde der Hollywoodfilm mit Liz Taylor als Kleopatra, und die Schauspielerin wurde noch berühmter. Auf Seite 476 des ersten Bandes seiner „Denktagebücher“ (2008-2011) trug der Ästhetikprofessor Peter Sloterdijk ein, dass „Liz Taylor gestorben“ sei. An anderer Stelle: „Die Phantasie, wonach Kleopatra sich von einer Giftschlange töten ließ, hat das Imaginäre des Westens immer wieder beschäftigt.“ Sie starb 30 v.Chr..
Aber statt nun weiter über Kleopatra und die Schlange zu grübeln, kommt er auf Kleopatras Brüste zu sprechen; da sie „zum visuellen Patrimonium Alteuropas gehören“. Dabei scheint er an ein konkretes Bild gedacht zu haben, von den unendlich vielen, auf denen die Maler dieses Motiv gewählt haben: die nackte oder halbnackte Kleopatra auf dem Diwan und neben ihr ringelt sich eine meist etwas kümmerliche Kobra. „Man weiß nicht, ob sie an einem noch lebenden oder schon toten Körper zu sehen sind. Der tragische Akt öffnet das Blickfeld für den gebildeten Voyeur. Ihre Brüste blühen in todesnaher oder postmortaler Unerreichbarkeit.Neben der Toten ringelt sich eine graue Schlange.“
Die Bilder mit der vom Kobrabiß schon geschwächten letzten Königin des ägyptischen Ptolemäerreiches – das waren quasi westliche Auftragsarbeiten für gebildete Voyeure. Kleopatra hatte sich die Kobra aus Liebe zu einem Europäer in die Brust beißen lassen: dem Feldherrn Marcus Antonius. Kleopatra VII. war die bedeutendste unter den römischen Klientelherrschern des Orients. Und die Kobra (Lat: „Naja naja“) war den Ägyptern heilig. Das sonst nüchterne Wikipedia schwelgt geradezu in der Beschreibung der groß inszenierten römisch-ägyptischen Hochzeit: Kleopatra schritt als irdische Inkarnation der Göttin Aphrodite (Isis in Ägypten) dem neuen Dionysos Antonius entgegen, der sich zuvor mit der griechischen Kultur beschäftigt und sich über Dionysos kundig gemacht hat.
2018 veröffentlichte der Münchner Professor für Alte Geschichten Martin Zimmermann ein Buch über „Die seltsamsten Orte der Antike“. Darin schreibt er: „Eine agile Kobra hätte sich nicht einfach unter Feigen verbergen und wie [Kleopatras Biograph] Plutarch berichtet, problemlos an den römischen Wachen vorbeischmuggeln lassen. Zudem sei die Reaktion der Giftschlangen völlig unberechenbar. Zimmermann plädiert für eine „einfachere Lösung: Vermutlich trank die Königin mit ihren Dienerinnen ein aus Pflanzen zubereitetes Gift.“
Demnach wäre Kleopatras Tod durch den Kobrabiß ein Mythos, wenn nicht ein Medienfake. Auf einem Gemälde von Sir Lawrence Alma-Tadema läßt sie das Gift vorab an Sklaven testen. Ihr zu Füßen liegt ein Leopard. Der Grund ihres Selbstmords war auch Schuld, vermuten Kleopatraexperten: Sie hatte bereits vorab ihren vor Oktavians Truppen geflohenen Ehemann Mark Anton ausrichten lassen, dass sie Selbstmord begangen habe, woraufhin der sich in sein Schwert gestürzt hatte, was man ihr nun wieder ausgerichtet hatte.
Eine vergleichbar tragische Konstellation gab es breits im Mythos von Orpheus und Eurydike, wie er von Vergil erzählt wird: Der Sohn von Apollon will die Nymphe Eurydike vergewaltigen, sie flüchtet, wird von einer Schlange gebissen und stirbt. Ihr Geliebter, der Sänger Orpheus, versucht daraufhin vergeblich, sie aus dem Hades zurück zu holen. Wenig später wird er selbst Ovid zufolge von Mänaden, den berauschten Anhängerinnen des Dionysos, zerrissen. Man erfährt nicht, ob Eurydike durch einen Kobrabiß starb. Aber es gab damals noch Kobras in Griechenland.
Peter Sloterdijk schreibt: „Seit sie mit den Attributen der Isis auftrat, um ihr 30. Lebensjahr, lebte sie jenseits von Unberührtheit und Defloration; mit jeder Orgie schien ihre Jungfräulichkeit sich zu vervollkommnen…Es ist vielleicht kein bloßer Zufall, wenn ein phantasievoller englischer Theosoph nach 1900 eine Seelenwanderung von Kleopatra zu Maria schilderte, der zufolge Jesus nicht nur unbefleckt empfangen, sondern auch mit einem ägyptischen Logos ausgestattet war.“ Beim „ägyptischen Logos“ geht es um die „Glaubwürdigkeit“ im Allgemeinen und um die des griechischen Geographen Herodot, im Besonderen, d.h. um seine um 460 v.Chr. entstandene Geschichtsschreibung, wenn ich das richtig verstanden habe. Dass die an einem Gift gestorbene Kleopatra, die also kein Kind von Traurigkeit war, 30 Jahre später als Heilige Unbefleckte, als Jungfrau Maria, wiedergeboren wurde, hat sich nicht durchgesetzt. Auch das jetzt selbst die „Hure“ Maria Magdalena heilig gesprochen wurde, wird daran nichts ändern. Im Übrigen gab es dagegen Proteste unter den katholischen Laien. Ihnen wurde auf „kreuzgang.org“ erklärt: „Als Heilige gelten praktisch alle, die in den Evangelien als Jünger und Anhänger Jesu genannt sind – von Judas, der ihn verriet, einmal abgesehen. Diese Menschen haben sich als Heilige erwiesen, als sie den Herrn erkannten, anerkannten und ihm nachfolgten.“ Sloterdijk missfällt diese Heiligsprechung einer Ex-Prostituierten.
.
Umwertung der Werte
Die Ökonomie, die als Basis all unserer Überbau-Aktivitäten galt, ist nach oben gerutscht und ins Gerede gekommen, seit das ökologische Denken, die gute alte Ökologie (eine geduldige Unterdisziplin der Biologie) mit dem „Klimawandel“ (hervorgerufen durch den steigenden CO2-Gehalt in der Atmosphäre) zwingend und dringend geworden ist.
Plötzlich wird jeder zu irgendetwas gezwungen. Autofahrer müssen Radfahrern weichen, Autofabriken auf Elektroautos umstellen, die Energiequellen Kohle, Öl, Gas sind plötzlich lebensfeindlich geworden, die industrielle Landwirtschaft wird mit ökologischen Bedenken geradezu in einen Würgegriff von Restriktionen genommen.
Und die selben Bedenkenträger zwingen der auf Expansion angelegten Wirtschaft generell immer neue Begriffe auf, die sie einschränken: Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Recycling, Abfalltrennung, Sondermüll, Humusverlust, Vermeidung von Gifteinsätzen gegen Unkraut und Ungeziefer (ja Vermeidung dieser Un-Wörter sogar), Jagd- und Pelzzucht-Verbote, Zirkus-Wildtier-Verbot usw..
Anfangs behalfen sich einige Branchen noch mit dem sogenannten „Greenwashing“, d.h. mit bloßen Etikettenschwindel. Noch immer faßt man sich bei so manchem „Öko-Siegel“ und „Grünen Punkten“ auf Luxusgütern an den Kopf. Aber die Einschränkungen der Wirtschaft durch die grünen Verbotsparteien und Bewegungen lassen immer weniger Augenwischereien und Ausflüchte zu – angesichts dessen, was die „ökologische Krise“ genannt wird. Im Grunde weiß hienieden keiner, „wie er sich dauerhaft aus der Affäre ziehen soll,“ schreibt der Wissenssoziologe Bruno Latour, der uns in seinem Buch „Wo bin ich? Lektionen aus dem Lockdown“ (2021) als „Erdverhaftete“ bezeichnet – in Opposition stehend zu den reichen Vielfliegern mit dem höchsten CO2-Verbrauch, wie Elon Musk, die auf den Mars ausweichen wollen.
Für die Erdverhafteten gehen jetzt drei Jahrhunderte der Ökonomisierung all ihrer Lebensäußerungen zu Ende, meint Latour, „diesmal geht es nicht mehr nur darum, das ‚Wirtschaftssystem‘ zu verbessern, zu verändern, grün anzustreichen oder zu revolutionieren, sondern darum, ganz und gar ‚auf die Ökonomie zu verzichten‘. Paradoxerweise – und das freut die Erdverhafteten – bewirkt ausgerechnet die Episode der Corona-Pandemie, dass der Geist der Eingeschlossenen ‚befreit‘ und ihnen einen Augenblick lang erlaubt wurde, der langen Haft im ‚stählernen Gehäuse‘ der ‚ökonomischen Gesetze‘ zu entrinnen, in dem sie geschmachtet hatten. Wenn man sich je von schlechter Emanzipation emanzipiert hat, dann in diesem Fall.“
Dieser „Fall“, das war in Frankreich der besonders „harte Lockdown“. Und der Latoursche Ökonomie-Verzicht zielt auf den „Homo oeconomicus“, von dem schon seit langem bekannt ist, dass er nichts „Urwüchsiges, Autochthones“ hat. Er kommt „von oben, top down, und geht in keiner Weise von der gewöhnlichen, praktischen Erfahrung aus, from the ground up, also von den Beziehungen, die Lebensformen mit anderen Lebensformen unterhalten.“ Latour ist ein Basisdemokrat, der auf Verhandlungen setzt – und zwar mit allen, auch mit Dingen.
Die Berufspolitiker veranstalten seit etlichen Jahre „hochkarätige“ Klima-Konferenzen, auf denen sie z.B. um das „Ziel“ ringen, noch vor 2030 die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ihr Top-Down-Realismus ist der Ökonomie geschuldet – und nur allzu plausibel, denn was soll z.B. mit all jenen geschehen, deren Arbeitsplätze zugunsten jenes Ziels verboten werden, d.h. wegfallen – so wie die Parkplätze?
Der Naturschutzbund appellierte gerade radikal ökologisch an die Berliner Politiker, keine Brachflächen mehr dem Wohnungsbau zu opfern. Es gäbe bereits genug Wohnungen (ein kühne Behauptung!), aber schon jetzt zu wenig unbebaute und ungenutzte Flächen für Wildtiere und –pflanzen. Zudem sei der „Bausektor einer der schlimmsten Klimasünder“. Das wird die dem Fortschritt verpflichteten bürgerlichen Politiker nicht zum „Umdenken“ bringen, denn sie bemühen sich ja gerade, all jene zigtausend Wohnungen in Plattenbauten, die sie vor zehn Jahren niederreißen ließen (zugunsten eines investitionsfreundlicheren Wohnungsmarktes), durch Neubauten für die vielen neuen Wohnungsuchenden zu ersetzen.
Abgesehen davon würde das Baugewerbe in der Stadt, und damit tausende Arbeitsplätze, durch den Nabu-Appell, sollte er denn fruchten, so gut wie verschwinden. Und so ist es bei allen Eingriffen in die Ökonomie zugunsten der Ökologie: Es geht dabei immer um Einschränkung bzw. Abwicklung. Aber wie und und was und von oben oder von unten?
Also favorisiert die Politik als geschäftsführender Ausschuß der Wirtschaft, des Kapitals, vor allem solche Öko-Ideen (-Projekte), die ökonomisch profitabel sind oder mindestens versprechen, es zu werden. Damit alles in etwa so weiter läuft wie bisher.
.
Sex and Drugs and Rock‘n Roll
Man kann vielleicht sagen, dass Friedrich Kittler, der berühmteste Professor der Humboldt-Universität nach 89, ein Gutteil seines Forscherlebens diesem „modernen Trivium des dionysisch-ekstatischen Komplexes“ (F.J. Raddatz) aus den Sechzigerjahren gewidmet hat.
Mit dem Rock‘n Roll meinte Kittler vor allem Jimi Hendrix und Jim Morrison, aber auch die Beatles und Rolling Stones. Von diesen zog er eine genealogische Linie zur Antike und lernte/lehrte sogar Griechisch – bis er in seinem 2012 erschienenen Band „Das Nahen der Götter vorbereiten“ zu dem Ergebnis kam, „dass uns die Popstars die Götter wiederbringen“ – nämlich die verwandlungsfähigen griechischen (um mit dem ganzen Christentum- und Ami-Identitätssscheiß Schluß zu machen).
„Der empirische Beweis dieser Tatsache sind“ laut Kittler „die Groupies. Sie schlafen mit den Göttern, weil die Musiker Götter sind.“ Zwar schwärmte er auch von Sappho und den freien Frauen in Sparta (bevor es eine Militärdiktatur wurde), aber den weiblichen Popmusikern von heute konnte Kittler nur wenig abgewinnen, denn er begriff das Nahen der Götter eher medientechnisch als genderanalytisch.
Eine Bekannte teilte ihm später einen weiteren empirischen Beweis seiner Götter-Theorie mit: Sie war auf einem Popkonzert in Kopenhagen gewesen und hatte mitbekommen, „wie der treue, liebevolle boyfriend das treue liebevolle girlfriend bei der Hand nahm und nach dem Konzert durch alle Wachen und Polizisten hindurch bugsierte und das Mädchen in der Garderobe dem Leadgitarristen oder dem Sänger übergab.“ Der verbrachte die Nacht mit ihr, und am nächsten Tag „ging die Liebe zwischen boyfriend und girlfriend weiter. Also eine uneifersüchtige Variante des Amphytrion-Stoffes, so wie auch Amphytrion nicht ernsthaft zu Alkmene sagen kann: ‚Ich verbiete dir, mit Zeus zu schlafen!‘“
Bei den Drogen bezog sich Kittler auf Baudelaire, Mallarmé und Rimbaud, die mit dem damals nicht-verbotenen Haschisch experimentierten, als Nietzscheaner bezog er sich auch immer wieder auf den staatenlosen „Zarathustra“-Philosophen, der meinte: „…So weit Deutschland reicht, verdirbt es die Kultur. Ich war verurteilt zu Deutschen. Wenn man von einem unerträglichen Druck loskommen will, so hat man Haschisch nötig.“ Daneben hatte es Kittler ähnlich wie Nietzsche auch die Musik des „kleinen Sachsen“ Wagner angetan.
Auf Wikipedia heißt es über den im sächsischen Röcken geborenen Nietzsche: „Die zeitgenössische Kultur war in seinen Augen lebensschwächer als die des antiken Griechenlands. Wiederkehrendes Ziel von Nietzsches Angriffen sind vor allem die christliche Moral sowie die christliche und platonische Metaphysik. Er stellte den Wert der Wahrheit überhaupt in Frage und wurde damit Wegbereiter postmoderner philosophischer Ansätze.“
So ließen sich auch die Ziele des im sächsischen Rochlitz geborenen Kittler zusammenfassen, der bei Nietzsche zwischen sedierenden und stimulierenden Drogen unterschied: erstere „erzeugen Apollon, letztere Dionysos“, wobei er dem LSD-Erfinder Albert Hofmann die These verdankte, dass es sich beim griechischen Demeter- und Dionysos-Kult in „Eleusis“ um einen „Getreidekult“ handelte, in dem das „Mutterkorn“ eine wichtige Rolle spielte – also das natürliche Pendant zu LSD, das auf den großen US-Popkonzerten dann für einen Dollar die „Pille“ (wie „Jefferson Airplane“ den LSD-Trip nannte) angeboten wurde. Später experimentierte auch die CIA mit LSD (zwecks Gehirnwäsche), die sie ihren Probanden allerdings heimlich verabreichte.
Anläßlich von Kittlers Veröffentlichung seines frühen Aufsatzes „Drogen und Medien in Thomas Pynchons Zweitem Weltkrieg“ traf ich ihn in Freiburg, um ihn mit einem pynchonesken Weltkriegs-“Selbstporträt“ des holländischen Autors Jakov Lind bekannt zu machen, der beim Einmarsch der Deutschen als Flußschiffer nicht aus, sondern in das Reich geflüchtet war, wo er sich unbehelligt als Jude nur einige Male mit Tripper infizierte.
Anschließend besuchte ich Kittlers Seminar an der Freiburger Universität, wo es an dem Tag um den letzten Brief des Psychoanalytikers Jacques Lacan ging, den er aus Caracas an seine „Ecole Freudien de Paris“ geschrieben hatte, um sie für aufgelöst zu erklären. Ferner behauptete Lacan darin, dass die Frösche eine große Eleganz bei der Paarung zeigen, die Menschen dagegen nicht, und das sei doch wohl das wesentliche Problem, mit dem die Psychoanalyse es zu tun habe.
Mit dem Gräzisten Bruno Snell wußte Kittler sich einig, dass es unsinnig sei, Aphrodite, die Göttin der Liebe, zu leugnen, also zu behaupten, man glaube nicht an Aphrodite, denn „darum ist Aphrodite doch da und wirkt“. Noch auf seinem Sterbebett ließ er sich 2011 aus Bruno Snells Buch „Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen“ vorlesen.
.
China
„Ich sage nur Kina, Kina, Kina!“ Dieser Satz machte den einstigen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger berühmt – erst recht als Beate Klarsfeld ihn 1968 auch noch wegen seiner Nazi-Blockwartkarriere ohrfeigte. „Eine Attacke mit symbolischer Wucht“ nannte das 2018 das Deutschlandradio. Gegen die AfD wirft man neuerdings übrigens mit Torten (das „Peng-Kollektiv“ u.a. – JW berichtete).
Jetzt bedauern es die deutschen Politiker und Unternehmer, dass sie nicht eher auf Kiesingers mahnende Worte gehört haben. Da hilft auch kein Kanonenboot der Bundesmarine im Chinesischen Meer. In dem Interviewband „Zahlen sind Waffen“ (Band 176 der Reihe „Fröhliche Wissenschaft“) kommt der Science-Fiction-Autor Dietmar Dath zu dem Urteil, dass die Debatten der chinesischen Intellektuellen, speziell der SF-Autoren (von denen nicht wenige Bücher auch auf Deutsch erschienen sind), „so viel interesssanter sind und weiter vorne als das, was mir Robert Habeck gerade erzählt.“
Hat der etwa auch einen SF-Roman geschrieben? fragte ich mich sofort und fing gleich an zu googeln. Dabei überraschte mich Habeck erneut. Unter „robert habeck sf-autor kaufen“ fand ich in der Liste seiner veröffentlichten Bücher auch ein illustriertes über Nudistenstrände. Naja, dachte ich, er war ja Umweltminister in Schleswig-Holstein.
Das einzige Buch von Habeck, das ich mir als SF-Roman vorstellen konnte, hatte den Titel „Wer wir sein könnten“. Dazu fielen mir sofort einige ferne Planeten ein, u.a. der Mars, auf denen eine geringere Gravitation herrscht und die Menschen infolgedessen immer größer werden. Deswegen planen einige US-Milliardäre ja auch, diesen Planeten zu kolonisieren. Es haben sich angeblich schon über 1000 Menschen als Pioniersiedler gemeldet. Sie sind bereit dort zu bleiben, denn einen Rückflug wird es nicht geben, und sie geloben, auf dem Mars alles cooler, und größer als auf der Erde zu machen. Kunststück.
Robert Habeck schreibt viele Bücher zusammen mit der Literaturwissenschaftlerin Andrea Paluch. Eine Googelsuche ergab: Die beiden haben 1996 in Dänemark geheiratet. Ihr gemeinsam veröffentlichter Roman „Hauke Haiens Tod“ könnte dem Titel nach ein Küstenkrimi sein. Da es sich bei dem Deichgrafen „Hauke Haien“ aber um die Hauptfigur in Theodor Storms Novelle „Der Schimmelreiter“ (1888) handelt, der eine Deichverbesserung gegen die Sturmfluten durchsetzen wollte, aber dann an seinem Starrsinn im Kollektiv scheiterte, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Habeck-Paluch aus ihm die langlebige Hauptfigur eines SF-Romans gemacht haben, dessen „Tod“ erst noch eintritt. Mit China hat das aber wohl nichts zu tun, denn die Meldung, dass Habeck in einem ZDF-Interview sagte, er wolle ein „zentralistisches System wie in China“ war angeblich „verzerrt“ auf Facebook wiedergegeben worden, wie die „Faktenchecker“ von „correctiv.org“ berichteten.
Dietmar Daths Interesse an China kommt im Übrigen auch daher, dass „die Regierungen im Westen“, die er „komplett scheiße findet, Angst vor China haben, und das gefällt mir,“ sagt er. Er war aber noch nie in China, wie er der Autorin Sybille Berg gestand, die mit ihm am Interviewtisch saß und daraufhin entgegnete: „Ich war da schon.“ Sie bekam dort irgendwann „ein bisschen das Gefühl, plötzlich zu verstehen, warum Europa abkackt“. Die meisten Europäer würden von China eigentlich nur Ai Weiwei kennen, fügte sie noch hinzu. Dietmar Dath berichtete ihr von den Zuhörern einer Lesereise mit dem chinesischen SF-Autor Cixin Liu: „Ich wusste gar nicht, dass es so viele Chinesen in Deutschland gibt.“
Obwohl in Berlin lebend kennt Dietmar Dath vielleicht nicht den Friedenauer „Chinaclub“ des Sinologen Hanjo Lehmann, in dem sich chinesische Studenten und Kulturinteressierte treffen. Oder den „China Club“ unterm Dach des Hotel Adlon, den die Frau des Hotelbesitzers August von Jagdfeld voll mit chinesischer Sozpop-Art bis in die Toiletten hinein gehängt hat. Verkauft hat sie ihr angeblich der „Galerist der ersten Stunde in China“ Alexander Ochs, der inzwischen auch eine Galerie in Peking betreibt. Die Kunst aus China geht immer noch weltweit weg wie warme Semmel, sagte er sinngemäß dem Tagesspiegel. Derweil setzte August von Jagdfeld den Hotelkomplex Heiligendamm in den Sand. Angeblich sollen die Chinesen jetzt Interesse an dieser Immobilie bekundet haben.
Die Chinesen in Deutschland wirken zumeist unauffällig. Als ich den ehemaligen Rotgardisten und Germanisten Fang Yu fragte, ob sie eine eigene Zeitung herausgeben, sagte er: „Ja, in Hamburg, aber die kannst Du vergessen, da steht nur Unkritisches drin. Du weißt ja, die Chinesen treten nicht gerne hervor.“
Der Westen, angestrengt an der Seite von Taiwan, zerrt die Festland-Entscheider aber zunehmend ans Tageslicht. So berichtete die Neue Zürcher Zeitung gerade: „Tennis, Schach und Sex – die Profisportlerin Peng Shuai und ihre Affäre mit einem chinesischen Parteiboss: Ein Tennisstar gesteht eine heimliche Beziehung mit dem Parteikader Zhang Gaoli. Sie beschuldigt ihn auch des sexuellen Missbrauchs. Damit erreicht Chinas #MeToo-Bewegung den inneren Machtzirkel der Kommunistischen Partei.“ Dass Peng diesen „Zirkel“ sprengt, ist allerdings unwahrscheinlich, sie verschwand daraufhin. „Die USA, Frankreich und Großbritannien forderten besorgt Klarheit über ihren Verbleib,“ berichtete die Tagesschau. Aber die Süddeutsche Zeitung meldete dann: „Peng ist wieder da“.
.
Ding-Dong
Global Handeln. Die Nachrichten sind voll mit Berichten über Konferenzen zur Reduzierung der fortschreitenden Klimaerwärmung. Es geht um die Lösung eines Weltproblems. Und das heischt „Projekte“ – neue Technologien, was neue Industrien meint.
Einige der Projektemacher nennen sich „Geoingenieure“. Sie drängen z.B. darauf, anderthalb Milliarden „Eichen“ zu pflanzen, die CO2 aufnehmen. Andere schlagen die Nutzung von Basalt-Bergwerken vor, die abgesaugten Stickstoff aufnehmen und durch Versteinerung binden.
Die für den „New Yorker“ arbeitende Journalistin Elizabeth Kolbert hat all diese Geoengineers für ihr Buch „Wir Klimawandler. Wie der Mensch die Natur der Zukunft erschafft“ (2021) besucht – und auch gleich die „Schwachstellen“ ihrer Weltrettungsprojekte benannt. Ihr geht es dabei „um Menschen, die Probleme zu lösen versuchen, die Menschen beim Versuch, Probleme zu lösen, geschaffen haben.“
Der „Gruppe von Negativ-Emissions-Technologen“, die vorschlägt, Milliarden „Eichen“ zu pflanzen, „was 200 Milliarden Tonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre binden könnte“, hält sie entgegen: „Bäume sind dunkel. Wenn wir z.B. die Tundra aufforsten würden, würde es die von der Erde absorbierte Energiemenge erhöhen“ – also sogar zur „Erderwärmung“ beitragen. „Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, wäre, mit der CRISPR-Technologie genmodifizierte hellere Bäume zu schaffen.“ Also sie künstlich zu albinisieren. „Soweit ich weiß, hat das bisher niemand vorgeschlagen, doch es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein,“ meint Elizabeth Kolbert.
Eine weitere Gruppe von Geoengineers will zwecks Verlangsamung der Erderwärmung Kalzit-, Sulfat- oder Diamant-Partikel in der Stratosphäre versprühen, die das Sonnenlicht zurückstrahlen. Dafür hat sie schon mal ein Flugzeug, den Stratospheric Aerosol Injection Lofter, kurz SAIL genannt, konstruiert. Mit dem will man im ersten Jahr 100.000 Tonnen Schwefel versprühen. Leider würde dies „das Erscheinungsbild des Himmels verändern. Er wäre nicht mehr blau, sondern weiß.“
Wenn man jetzt auch noch das Anthropozän-Phänomen der zunehmenden Zahl von quasi-natürlichen Albinogeburten bei Wildtieren und -pflanzen quer durch alle Arten – von der Mücke bis zum Elefanten und vom Hanf bis zum Ahorn – dazu zählt, kann man sich in etwa ein Bild von der Zukunft machen: Kein Schnee im Winter mehr, aber ganzjährig weisse Mischwälder mit weissen Tieren unter weißem Himmel.
Es gibt noch andere Projektemacher rund um das Klimaerwärmungsproblem. Z.B. die EIT InnoEnergy: „Die vierte industrielle Revolution. Am 3. und 4. November 2021 haben Sie die Möglichkeit, inspirierende Gründer und innovative Teams, wie ONOMOTION, Ecoligo, Vulcan Energy, HardHyperloop, Corepower und viele andere beim Business Booster 2021 in Berlin zu treffen. Über 150 Start-ups stellen dort ihre neuesten Lösungen und Geschäftsmodelle vor. Ich soll mich auch für „Global Clean Energy ETF“ begeistern, wenn nicht engagieren, d.h. mein Kapital in diese vielversprechende Branche, die von einer zunehmenden Klimaerwärmung ausgeht und deswegen lukrative Angebote auf „Projekte“ zu ihrer Entschleunigung bereithält: „Fast ein Drittel der installierten Leistung von Anlagen zur Stromerzeugung aus regenerativen Quellen sind in der Hand von Privatpersonen. Privatpersonen treiben die Energiewende massiv voran. Wie unsere Infografik aufzeigt, sind es vor allem die Besserverdiener, welche in ökologische Assets investieren. Bei einem Nettohaushaltseinkommen über 3.500 Euro beträgt der Anteil sogar 15 Prozent.“ Da soll ich mitmachen.
Und da soll ich hingehen: Das Projekt oder die NGO ICIS „lanciert die weltweit erste interaktive globale Datenbank für chemische Recyclingprojekte. Die Pressekonferenz wird am Montag, den 29. November um 11:00 Uhr (Pariser Zeit) online stattfinden. Die neue Ausgabe des globalen Syntheseberichts der Beobachtungsstelle für die
Klima-Chancen, ‚Back to the Future. 2021: The Great Acceleration of Climate Action… and Emissions‘ wird auf dieser Pressekonferenz zum ersten Mal offiziell vorgestellt.“
„Der ICIS Recycling Supply Tracker – Chemical liefert aktuelle Daten, einschließlich der installierten Kapazität, des Produktionsvolumens, des Prozesses und der Rohstoffe, sowie Details über den Lizenzgeber und die Investoren.“ Louise Boddy, Head of Commercial Strategy, Sustainability bei ICIS, sagt: „Die Bemühungen, komplexere Technologien und größere Größenordnungen in diese Industrie zu bringen, beschleunigen sich schnell, und ICIS beschreibt diese Entwicklungen mit seinem neuen Supply Tracker, der dazu beiträgt, Partnerschaften und Investitionen zu fördern, die die Kreislaufwirtschaft verbessern und Abfall vermeiden‘.“
Gehört die ICIS zur ITIF? Die Stiftung für Informationstechnologie und Innovation (ITIF) „ist ein unabhängiges, gemeinnütziges, unparteiisches Forschungs- und Bildungsinstitut, das sich auf die Schnittstelle zwischen technologischer Innovation und öffentlicher Politik konzentriert. Der Klimawandel braucht schnelle, kreative und ehrgeizige Lösungen,“ meint ITIF.
.
„A book a day keeps reality away“
„Weißt du, als mein Papa in dieses Land kam, war er bereits ein gebildeter, belesener Mann,“ schreibt Kai Wieland in seinem Roman „Zeit der Wildschweine“ (2020). Beim Wort „belesen“ blieb ich hängen: Das gibt’s ja auch noch, murmelte ich vor mich hin. Wobei belesen und gebildet fast doppelt gemoppelt ist, wenn man dem Synonym-Wörterbuch folgt, das dafür auch noch „geistreich“, „versiert“, „orientiert“, „informiert“, „kundig“, „gelehrt“ und „eingeweiht“ auflistet. Unter „wissen57“ wird erklärt: „Literarische Bildung, die einst im Zentrum der Curricula der höheren Schulen stand, ist – und leider nicht nur dort – zu einem Fremdwort geworden.“ Liegt das daran, dass im Zuge der Studentenbewegung eine „bestimmte Idee von Bildung“ als „bildungsbürgerlich“ abgetan wurde? Ich erinner mich noch, dass der eher aktionistisch gesonnene Daniel Cohn-Bendit den Germanisten Heiner Boehnke gelegentlich ein „schöngeistiges Arschloch“ schimpfte. Dennoch würde ich sagen, dass in der Studentenbewegung noch extrem viel gelesen wurde, meine Mentoren vom SDS zogen sich z.B. täglich von 14 bis 17 Uhr in ihre WG zurück, um zu lesen und Rudi Dutschke hatte immer eine Aktentasche voll mit Büchern bei sich. Von den Philosophen der Frankfurter Schule und einigen ihrer Studenten kann man sogar sagen, dass sie so belesen waren wie kaum jemand damals und erst recht heute. Die Unbelesenheit scheint eher an der jetzigen Amerikanisiererung der Hochschulen zu liegen, die auf Profitabilisierung des Wissens abzielt – bei Studenten wie bei Wissenschaftlern. So sind in den USA z.B. 80 % aller Biologen zugleich auch Geschäftsführer oder Teilhaber einer Firma. Und der neue US-Präsident hat gerade den Biologen Eric Sander in seine Regierung berufen, um laut Spiegel „den Führungsanspruch der US-Wissenschaft zu verteidigen“. Gemeint ist damit die idiotische Genetik, die zwar ungeheuer produktiv ist, aber ebenso primitiv und dumm – und für ein Verständnis vom Leben eher hinderlich.
In letzter Zeit sind mir immer wieder Leute begegnet, die sich quasi entschuldigten, dass sie so selten zum Lesen kommen. Sie halten sich alle für nicht „belesen“ genug. Aber „gebildet“ waren sie eigentlich, d.h. sie hatten irgendwas „Gebildetes“ studiert, Literatur- oder Kulturwissenschaft. Für einige bestand das Belesen-Sein darin, lektüremäßig mitzukommen, was jeweils viel und gut besprochen wurde an Romanen und Monographien. Anders der polnische Schriftsteller Andrzej Stasiuk: Als man ihn fragte, wen er an den „Gegenwartsautoren“ schätze, antwortete er, dass er nur Tote lese, „dass die Lebenden noch nicht fertig sind und man ihnen eine Chance geben muß.“ So denke ich eigentlich auch: Was sind z.B. all die Bestsellerlisten-Autoren gegen Joseph Roth oder Stefan Zweig, zu schweigen von Tolstoi oder Platonow?
Bei vielen stapeln sich auch die Bücher über ein „Thema“, das sie verfolgen, Südseeinsel- oder Weltraum-Eroberungen z.B., dementsprechend lesen sie vornehmlich Expeditionsberichte aus dem 18. und 19. Jahrhundert oder alle NASA-Spinnereien. Von den geharnischten Linken hatten viele den Ehrgeiz, alle 43 blauen Bände von Marx und Engel zu besitzen.
Es gab mal eine Zeit, da war der Grad der Belesenheit fast identisch mit der Höhe des Vermögens, das der „passionierte Leser“ dafür ausgeben wollte oder konnte. In den „Flüchtlingsgesprächen“ von Brecht heißt es:„Eine halbwegs komplette Kenntnis des Marxismus kostet heute, wie mir ein Kollege versichert hat, zwanzigtausend bis fünfundzwanzigtausend Goldmark und das ist dann ohne die Schikanen. Darunter kriegen Sie nichts Richtiges, höchstens so einen minderwertigen Marxismus ohne Hegel oder einen, wo der Ricardo fehlt usw.“
Andererseits kam es zu dem Phänomen, vornehmlich bei Frauen, dass ihr „Romanlesen“ (-verschlingen) irgendwann zu einer psychischen Erkrankung erklärt wurde, ebenso „gewohnheitsmäßige Lyrik“.
Das Wort „passionierter Leser“ kommt oft in Kreuzworträtseln vor und dementsprechend oft auch in den Kreuzworträtsellösungshilfen im Internet, wo man dazu auf das Wort „Bücherwurm“ stößt.
Bei den Autoren, die vom Dorf und aus einer Bauern bzw. Arbeiterfamilie stammen, kommt in ihren biographischen Romanen oft die Bemerkung vor, dass es in ihrem Elternhaus nur ein Buch gab, die Bibel oder eins über Pferdekrankheiten. Dass die Oma sie Faulpelz schimpfte, wenn sie in einem Buch lasen. Dass sie heimlich lasen. Dass die Bibliothekarin in der Leihbücherei sie zum Lesen animiert habe usw. Damit wird erklärt, dass sie schon in jungen Jahren von der Hand- zur Kopfarbeit neigten und deswegen irgendwann zu einem „Bücherwurm“ wurden.
.
Querdenker
Früher wurde jede dritte staatstragende Flachpfeife im Westen als „Querdenker“ bezeichnet – Richard von Weizsäcker, Fanz Alt, Iring Fetscher, Peter Sloterdijk und viele andere. Das war ein Ehrentitel des seichten bürgerlichen Feuilletons, der all jenen Denkern zugeteilt wurde, die ihnen geeignet schienen, den Radikalen etwas entgegenzusetzen, ohne konservativ oder reaktionär zu argumentieren.
Mal abgesehen davon, dass Sloterdijk inzwischen eher zu den Rechten gezählt wird, ist der Begriff des „Querdenkers“ heute ein Schimpfwort für eine ganze „rechte Bewegung“ geworden – und dementsprechend mehren sich täglich die Einträge im Internet dazu. Der Publizist Martin Hecht hat ein ganzes Buch über die „Querdenker“ geschrieben: „Unbequem ist stets genehm“ – was Unsinn ist, denn sie werden mindestens als Wirrköpfe gesehen, mit denen man nichts zu tun haben will, dazu kommen staatlicherseits Verunglimpfungen.
„Die Stuttgarter Initiative ‚Querdenken 711‘ mobilisiert in ganz Deutschland für den Protest,“ meldete der Tagesspiegel und zitierte Berlins Innensenator: „Wir beobachten die Mobilisierung im rechtsextremistischen Spektrum sehr genau.“ Das Ziel sei gefährlich: „Hier werden die Corona-Proteste bewusst unterwandert, um rechtsextremes Gedankengut anschlussfähig zu machen.“ Die Querdenker sind also gedankliche Unterwanderer der bloß dumpfen „Gegner von Coronamaßnahmen“. Für die FAZ sind sie nach ihrer Großdemo in Berlin bloß noch „ein kleiner Haufen aus Linken, Rechten, Impfgegnern, Verschwörungstheoretikern und verirrten Bürgerlichen.“
Die FAZ berichtet aber auch über eine Studie des Soziologen Oliver Nachtwey aus Basel. Danach sind unter den Anhängern der „Querdenker-Bewegung“ besonders viele Wähler der AfD, der Grünen und der Linkspartei. Sozialstrukturell handele es sich um eine relativ alte und relativ akademische Bewegung. Das Durchschnittsalter betrage 47 Jahre, 31 Prozent hätten Abitur, 34 Prozent einen Studienabschluß, der Anteil Selbständiger sei deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung. Die Corona-Leugner unter den Querdenkern hätten einen „Hang zur Naturromantik“. Die Studie ist allerdings nicht repräsentativ, da sie auf nur 1150 Fragebögen basiert, die „Chat-Gruppen der Querdenker“ jedoch mehr als 100.000 Mitglieder haben. Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) drang kürzlich auf eine zügige Entscheidung darüber, ob die „Querdenker“ vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollen. Er verlangte entschlossenes und schnelles Handeln: „Die aktuelle, offensichtliche Unterwanderung durch Rechtsextreme kann uns nicht kaltlassen. Bei den Reichsbürgern und der Identitären Bewegung hat mir das viel zu lange gedauert.“ Die Welt machte daraus verbunden mit der Basler Studie: „21 Prozent der ‚Querdenker‘ wählen die Grünen“. Der Innenminister will aber ausgewogen vorgehen: „Pistorius will auch Verbot von Antifa prüfen,“ heißt es auf „epochtimes.de“
Da die rechten Bewegungen derzeit auf dem Vormarsch sind, stellt sich mir die Lage so dar: Nahezu weltweit ist die Mittelschicht und die Oberschicht (das Establishment) linksliberal, die Unterschicht, die Armen, prekär Beschäftigten sind dagegen Rechte geworden. Und sie bilden z.Zt. die einzige soziale Bewegung (wenn auch nationalistisch und rassistisch). Es ist eine „Emanzipationsbewegung“, aber eine mit reaktionärer Stoßrichtung, meint Jana Hensel. Eine „Studie“ kontert mit dem Vorweg-Ergebnis, dass Querdenker-Demos die größten Coronaviren-Verbreiter sind.
Generell gilt, von den USA bis Frankreich, Italien, Spanien, Polen etc.:
– Dass das linksliberale Milieu in den Städten zu finden ist und dass die Rechten auf dem Land bzw.in Kleinstädten leben.
– Dass sich bei diesen Linken die jungen klugen Frauen durchsetzen werden, während sich in der Rechten die stierigen Männer massieren.
– Dass, wer nicht diesen ganzen Computer-, App-, Smartphone-, Onlinekauf-Mist sozusagen fließend beherrscht, auf schlechtbezahlte Idiotenjobs angewiesen ist (die vier großen Silicon-Valley-Konzerne finanzierten die demokratischen Gegner von Trump, der seinerseits von den wilden Südstaatlern und Losern geliebt wurde – weil Antiestablishment).
– Dass diese dynamisch-juvenilen Linksliberalen eine politisch korrekte Sprache, Vegetarismus, das ganze Öko-Zeug, Diversität, Genderwahn, Ausländerliebe etc vertreten und gegen die Klimaerwärmung sind, während die Rechte, das ehemalige Proletariat, das alles für Unsinn, Fakes, Reichenverschwörungen usw. hält und gegen „Asylanten“ sowie gegen Schwule ist.
Ein (linker) US-Soziologe namens Florida fand heraus: Die Weltstädte mit den meisten Schwulen haben das größte Innovationspotential und die beste Lebensqualität, was immer das heißt.
Wichtig ist bei dieser ganzen komischen Verdrehung der Klassenverhältnisse, dass die Armen/Rechten nicht für mehr Chancengleichheit, höhere Löhne, Steuererhöhungen für Reiche, bessere Lebensbedingungen für ihre Kinder oder für alle sind, das alles interessiert sie eigentlich gar nicht: Die Ökonomie ist nicht ihr Thema, das sind alles für sie eher Parolen und Forderungen des linksliberalen Establishments und der feminisierten Mittelschicht. Verlieren die quasiproletarischen Parteien SPD und Die Linke mit ihrem „sozialen Fimmel“ deswegen an Einfluß?
Die männigliche Unterschicht „kämpft“ für einen starken Staat, für mehr und besser bewaffnete Polizisten, für „Ausländer raus“ und für eine positiv besetzte „Nation“ im Sinne einer „Identität“ (in Polen dazu für eine rigide Religion, Heiliger Familie und totalem Abtreibungsverbot) .
Für mich folgt daraus, neben einer langen Anthropause, der Verdacht, dass wir über kurz oder lang wieder verlustreiche größere Kriege haben werden. Wahrscheinlich wird die Unterschicht (das Handarbeiter-Milieu) das auch begrüßen, damit den Kopfarbeitern, den Weicheiern der oberen Schichten (in ihren Home-Offices) mal wieder gezeigt wird, wo der Hammer hängt.
.
.
Jagbare Stücke (1)
Stücke nennen die Jäger das Wild. Bei der modernen Bewirtschaftung des Waldes ging in der BRD stets Holz vor Jagd. In der DDR war es umgekehrt. Das begann zunächst damit, dass die Rote Armee im sowjetisch besetzten Sektor 1945 ein absolutes Jagdwaffenverbot anordnete. Ab da jagten fast nur noch Offiziere der Roten Armee. „Die sowjetischen Truppen nutzten diesen rechtsfreien Raum und etablierten einen regen Handel mit Wildbret,“ heißt es in Helmut Suters Jagdgeschichte „Honeckers letzter Hirsch – Jagd und Macht in der DDR“ (2018). Nachdem die SED alle Wälder der DDR zu Volkseigentum erklärt hatte, wurden die sowjetischen Jäger irgendwann zu „Wilderern“ und ihre Abnehmer zu „Hehlern“. Zuvor hatte der Geheimdienst der Roten Armee (SMAD) noch versucht, mit Befehlen die Jagd einzudämmen, indem die Zuständigen nur noch „Militärjagdkollektive“ und „Jäger der allrussischen Militärjagdgesellschaft“ zuließen sowie nach Wildtierarten unterschiedene „Schonzeiten“ festlegten, um „die barbarische Ausrottung seltener Tierarten zu verhindern“.
Die Landbevölkerung klagte derweil über eine „Wildschweinplage“. 1949 wurden dagegen „Jagdkommandos“ aus der Deutschen Bereitschaftspolizei aufgestellt, die von der SMAD bewaffnet wurden. Im selben Jahr fand laut Suter „die erste Regierungsjagd“ statt. Nach und nach bekamen auch die Förster Waffen, die neuen „Staatsforstbetriebe“ waren für die „Beschaffung, Kontrolle und Verwaltung der volkseigenen Waffen verantwortlich“. Es wurden „Jagdkollektive“ gegründet, theoretisch konnte jeder Jäger werden, aber damit hatte er noch keine Waffe und kein Jagdrevier. Mit einem neuen Jagdgesetz 1953 „sicherten sich die Politbüromitglieder interessante Jagdgebiete, auch für die SMAD, gegenüber den Jagdkollektiven“.
Diese 129 „Sonderjagdgebiete“ wurden immer mehr erweitert, immer stärker geschützt, auch die Volksarmee und die Staatssicherheit bekamen solche Reviere. Gleichzeitig wurden bis in die Achtzigerjahre die „Jagdhütten“ immer üppiger ausgebaut, zu wahren Jagdschlössern. Und dann wurde für Millionen Mark jährlich Hirschfutter aus dem Westen importiert, damit die Tiere schneller starke Geweihe für die regierenden Trophäenjäger ausbildeten.
„Für das Geschehen in der Schorfheide war in den Fünfzigerjahren Walter Ulbricht verantwortlich.“ Davor war es die SMAD gewesen, davor Hermann Göring und davor die „führenden Würdenträger der Monarchie und der Weimarer Republik“. Bereits die Askanier begründeten dort im 12. Jahrhundert eine Tradition der Jagd der Herrschenden. Dass sich in den sozialistischen Ländern nahezu alle Regierenden der Jagd widmeten, geht auf die Tradition sowohl der Adels- als auch der Volksjagd zurück – letzteres vor allem in Russland und Amerika, bis heute, wo nur wenig Menschen auf einem riesigen Territorium leben, hinzu kam eine mehr oder weniger ausgeprägte partisanische Vergangenheit. Einer der eifrigsten Jäger war Trotzki, der großen Konflikten in der Partei gerne auswich, um erst einmal jagen zu gehen, noch in seinem Exil auf der Insel Büyükada bei Istanbul verlangte er als erstes von seiner Deutsch-Übersetzerin Angelschnur aus England.
Der Zürcher Ethnopsychoanalytiker Paul Parin schreibt in seinem Buch „Die Leidenschaft des Jägers“ (2003): Ein „aufgeklärter Mensch jagt nicht“ und auch ein „Jude jagt nicht“ – das sind „gleichermaßen Gesetze abendländischer Ethik. Ich muss mich zu den Ausnahmen zählen“. Parin nahm als Arzt am jugoslawischen Partisanenkrieg teil. Am Beispiel von Milovan Djilas, leidenschaftlicher Angler, Mitkämpfer und Vertrauter Titos, gibt er jedoch zu bedenken: „Später, als Dichter, wusste Djilas: Keine Ausübung der Macht über das Volk, über die Schwachen, bleibt ohne verbrecherische Taten. Wäre es nicht besser gewesen, der eigenen Leidenschaft Raum zu geben und den flinken Forellen nachzustellen…?“
Im Nachwort rühmt Christa Wolf Paul Parins „Lebenskunst und Schreibkunst“, diese im richtigen Augenblick kennengelernt zu haben, hält sie für eine „glückliche Fügung“. Mich hat sie eher verwirrt. Parins Buch ist 2018 überarbeitet neu herausgegeben worden, es heißt jetzt: „Die Jagd – Licence for Sex and Crime“.
In einem Dokumentarfilm über deutsche Jäger heute meint die Regisseurin: „Jäger wissen viel über den Wald, Wildtiere, Krankheiten.“ Der Zürcher Zoodirektor und Tierpsychologe Heini Hediger wußte dagegen, dass die Jäger wenig zum Wissen über die Tiere, die sie jagen, beitragen. Das Jagen bietet im Grunde wenig Gelegenheit zum Beobachten. Ein Schuß, selbst ein Meisterschuß, ist eben niemals Beginn, sondern stets das Ende einer allzu kurzen und meist nicht sehr vielsagenden Beobachtung.“
Seitdem die „Jagden“ auch auf dem Gebiet der DDR privatisiert sind, hätten die jetzigen „Trophäenjäger“ den Wildbestand noch vergrößert, meinte ein Biologe in Görlitz kürzlich zu mir. Zur Freude der Wölfe, fügte er hinzu, die sich von dem ersten eingewanderten Wolf nach der Wende bis zu den heutigen Rudeln in den Bergbaufolgelandschaften und auf den Truppenübungsplätzen in der Lausitz ansiedelten. Leider gäbe es nicht genug Wölfe. Das sei die allgemeine Meinung der hiesigen Natur- und Umweltschützer.
.

.
Jagbare Stücke (2)
Mit der Seßhaftigkeit und der Viehhaltung wurde die Jagd langsam zu einem Privileg der Mächtigen. Ein Beispiel dafür sind die schlesischen Adligen. Sie waren großenteils Preußen und agierten als Kolonialherren. Nahezu einmalig war ihr glücklicher Übergang vom Gutsbesitzer zum Bergwerksunternehmer. Fast alle schlesischen Adligen hatten als Hauptinteresse die Jagd, dazu waren sie auch noch höchlichst daran interessiert, dass der Kaiser, Wilhelm II., zu ihnen als Jagdgast aufs Schloß kam. Und der kam jedesmal mit einem so großen Gefolge, dass nur die „Magnaten“ mit den größten Schlössern ihn einladen konnten. In einem der gräflichen Schlösser stand in der Halle eine Glasvitrine mit einem Handschuh darin auf einem Kissen, die Gräfin hatte ihn getragen, als der Kaiser dort Jagdgast war und einen Handkuß angedeutet hatte, ihr weißer Handschuh war dadurch zu einer Reliquie geworden.
Der Sanierer etlicher heruntergewirtschafteter Güter des schlesischen Adels, Alfred Henrichs, beschreibt in seiner Arbeitsbiographie „Als Landwirt in Schlesien“ (die 2003 von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft DLG veröffentlicht wurde), wie die Kaiserjagd dort vor sich ging: „Zunächst erschienen [z.B. auf dem Schloß des Grafen Johannes von Franken-Stierstorpff, der eine amerikanische „Milliardärstochter“ geheiratet hatte] einige Herren aus der jagdlichen Suite des Kaisers, um die Verhältnisse an Ort und Stelle zu studieren: war das Gelände geeignet, wie war der Wildbestand, wie waren die Schusslisten der letzten Jahre usw.. Auf die Einladung des Kaisers zur Jagd folgten, wenn seine Jagdprüfer ihm positiven Bericht erstatteten, „als nächste Inspizienten kaiserliche Kriminalbeamte, um das Schloss und die Umgebung im Hinblick auf die Sicherheit zu prüfen. Dann rückten Beamte des Hofmarschallamtes an und begutachteten die dem Kaiser im Schloß zugedachten Räume, in unmittelbarer Nähe mußten auch die Zimmer für seine Kammerdiener liegen. Außer seinem Jagdpersonal und den Kriminalbeamten kamen in der Regel auch die Chefs oder deren Vertreter nebst Hilfspersonal der Reichskanzlei, des Zivil-, Militär- und Marinekabinetts mit, die ebenfalls Diener im Gefolge hatten, denn die Regierungsmaschinerie durfte ja nicht stille stehen.
Nun wurden Skizzen vom Jagdgelände angefertigt, in die die einzelnen Treiben, die Stände der Schützen und vor allem die des Kaisers eingetragen wurden. Waren auch diese von Berlin aus genehmigt, dann schickte der Jagdherr seiner Majestät die endgültige Einladung mit Angabe der anderen einzuladenden Gäste. Hierbei behielt sich der Kaiser vor, Streichungen und Änderungen vorzunehmen. Es war auch mitzuteilen, wer die Nachbarstände des kaiserlichen Gastes einnehmen sollte, denn ihre Besetzung galt als besondere Ehre. Am Schluß kam dann noch eine Kommission des kaiserlichen Marstalls, um die Pferde und Wagen zu besichtigen, deren sich der hohe Herr bedienen sollte. Genügten sie nicht, wurden Pferde und Wagen aus Berlin herbeigeschafft. So kam es dann endlich zur definitiven Zusage des Kaisers und zur Festlegung des Jagdtermins. [Woraufhin der „Goldfasanenmeister und der Karnickeldirektor“ informiert wurden, wann und wo sie die mit sehr viel Geld aufgezogenen Tiere frei zu lassen hatten.] Der Fasan spielte in Schlesien eine große Rolle.
Inzwischen setzte sich der Küchenchef des Gastgebers mit der Hofküche in Berlin in Verbindung, um zu erfahren, welche Speisen der Kaiser bevorzuge und wie sie zuzubereiten seien. Der Haus- und Hofmeister erkundigte sich in Berlin, welche speziellen Wünsche der Kaiser für seine Räume habe, die Stellung des Bettes zum Licht, Bettwäsche, Zudecke usw. Dann hatte er zu ermitteln, welche Weine, Zigarren oder Zigaretten der Kaiser bevorzuge usw..Unmittelbar vor der Jagd waren die Schützenstände, eine Art ebenerdige Kanzeln, für den Kaiser herzurichten, für die es genaue Vorschriften gab. Sie bestanden zunächst aus einer Vorderwand, aus Fichtenzweigen geflochten, und ihre Höhe, breite und Dicke war genau vorgeschrieben. Seitlich schlossen sich zwei Nebenwände an, ebenfalls mit festgelegten Ausmaßen. In die Vorderwand waren zwei Astgabeln einzulassen, auf die der Kaiser die Flinte legen konnte. Auch deren Ausmaße waren genau vorgeschrieben. Sie mußten aus Buchenholz sein, das die sauberste Rinde hat. Der Fußboden der Kanzel war auf einige vorgeschriebene Dezimeter auszuheben, zuunterst mit Schlacke auszufüllen, worauf am Morgen des Jagdtages eine Schicht trockenen Sägemehls kam, damit es keine kalten Füße gab. Die Wege von einem Treiben zum zum anderen wurden mit frischen Fichtenzweigen ausgelegt, und da im dortigen Revier [Buchenhöh des Grafen Johannes] nur wenig Fichten standen, ließ man einige Tage vor dem großen Ereignis mehrere Waggons Fichtenreisig aus dem Riesengebirge kommen.
Wie mir der Wildmeister Urner und der Rentmeister Jendryssek dort sagten, war Wilhelm II., ein Meisterschütze, obwohl er wegen seines verkrüppelten linken Armes nur einarmig schießen konnte. Hinter ihm standen stets zwei Büchsenspanner. Er bekam selbstverständlich den besten Stand und hatte oft die größte Strecke.“ Wenn nicht, korrigierte man die Abschußliste zu seinen Gunsten. Alfred Henrichs erwähnt die Strecke einer fünfköpfigen Jagdgesellschaft des Grafen Schaffgotsch: „2500 Kreaturen“ an einem Tag. Nach seinen Schilderungen der Wirtschaftsweisen des schlesischen Adels kommt er zu dem Schluß: „Diese aristokratische Lebensweise war nur bei einem unendlich niedrigen Lebensstandard der Arbeiterschaft möglich.“
.
Jagbare Stücke (3)
Die technische Entwicklung (der Waffen) ist schneller als die kulturelle (der Moral). Es gibt einen Bericht über die grönländischen Inuit von einem Afrikaner: Tété-Michel Kpomassie aus Togo. Das Buch über über seinen 13monatigen Aufenthalt bei grönländischen Familien und Jägern Mitte der Sechzigerjahre hat den Titel „Ein Afrikaner in Grönland“ (1981). Darin ist von der Jagd auf eine Fliege die Rede: In der Schule von Christianshaab (heute Qasigiannguit) gabes eine Bibliothek, in der „sämtliche Forschungsergebnisse über Grönland“ versammelt waren, der dänische Direktor Kjeld Pedersen lud Kpomassie ein, sie zu studieren. „Eines Tages tötet Kjelds dreijähriger Sohn eine Fliege. Das fällt einem Kind in diesem Land umso leichter, als die Fliegen hier weniger flink als die in Afrika, im Frühling noch schläfriger und schwerfälliger zu sein scheinen. Kjeld sieht daher die Tat seines Sohnes nicht für ein Heldenstück an und bewundert ihn nicht im geringsten, zum großen Erstaunen des Kindermädchens, einer etwa dreißigjährigen Grönländerin, die aus einer Jägersiedlung weiter nördlich stammt und stolz ist auf das Kind, eben weil es eine Fliege umgebracht hat. ‚Das zeigt, dass er ein großer Jäger werden wird,‘ behauptet sie. Wenn man, um ein gewandter Jäger zu werden, in der Kindheit Fliegen getötet haben muß, dann müßte ich zweifellos, so wie alle anderen Afrikaner auch, einer sein…Auf das beharrliche Drängen des Kindermädchens hin beginnen Kjeld und seine Frau, eine dänische Lehrerin, Unmengen Kaffee zu kochen und mehr Kuchen zu backen, als sie es jemals getan haben, um mit dem ganzen Dorf dieses bedeutsame Ereignis zu feiern: ein Kind, das eine Fliege getötet hat! Unermüdlich erzählen die Dorfbewohner einander von dieser Heldentat, finden keine Worte, um den Kleinen zu beglückwünschen, ziehen in Scharen zu Kjeld, um den Jungen zu sehen, dieses Phänomen, und trinken Kaffee bis zum frühen Morgen. Überraschenderweise darf der Held nichts von den Kuchen essen, die zu seinen Ehren gebacken worden sind! In den kleinen Siedlungen nämlich, erklärt uns das Kindermädchen, und alle Anwesenden stimmen ihr im Chor zu, darf der junge Mann, der seinen ersten Seehund erlegt, selber nichts von dessen Fleisch verzehren…Die anderen essen fast alles auf-Während dieser Mahlzeit (der stets ein ‚kafemik‘ folgt – ‚ein ganztägiges und offenes Kaffeetrinken‘ laut Wikipedia), die in Gegenwart des Jägers stattfindet – er sitzt in einer Ecke -, sagt jeder nach jedem Bissen: ‚Wahrhaftig, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie einen so köstlichen Seehund gegessen!‘ Dadurch soll der junge Mann lernen, dass er von nun an zuerst an die Gemeinschaft zu denken hat, bevor er an sich denkt, und alles mit ihr teilen muß. Welche schöne Lehre, aber auch welch harte Prüfung.“
Nebenbeibemerkt lehrten die Missionare der Herrenhuter Brüdergemeine den Inuit das „Vaterunser“-Gebet mit einer Variante, die da hieß: „Unsere tägliche Robbe gib uns heute“ – „Brot“ kannten die Grönländer nicht.
Am höchsten angesehen waren bei ihnen die Eisbärenjäger, denn es war gefährlich, dieses größte Landraubtier mit Hunden und einem Speer anzugreifen. Die Inuitforscherin Josephine Peary bemerkt in ihrem „Arctic Journal“ (1893) über einen etwas armen grönländischen Jäger, Ikwa, der sich der Expedition ihres Mannes andiente: „Er trug Hosen aus Robbenleder. Später erfuhren wir, das Hosen aus Robbenleder nur von solchen Jägern getragen werden, die nicht das Glück hatten oder unfähig waren, einen Eisbären zu töten. Im Winter trugen sie dann Hosen aus Hundefell, die zwar genauso warm sind wie welche aus einem Eisbärfell, aber nicht so chic,“ schreibt sie.
Die als Leiterin arktischer Tourismusexpeditionen arbeitende Schriftstellerin Birgit Lutz hat mehrmals Inuit-Siedlungen in Ostgrönland besucht, wo an der 2500 Kilometer langen Küste nur noch 2500 Menschen leben und einige Siedlungen völlig verlassen sind, seitdem die Jagd auf Wale und Eisbären fast verboten wurde und die Robbenfelle kaum noch etwas einbringen. Ihrem Bericht gab die auf Spitzbergen umweltschützerisch engagierte Autorin den provokativen Titel: „Heute gehen wir Wale fangen…“ (2017). Sie interviewte darin u.a. die auf Grönland geborene dänische Reiseorganisatorin Pia Anning Nielsen: „Seitdem die Jagd keine Perspektive mehr für die Menschen hier ist, sind sie nicht mehr stolz. Jetzt können sie sich nicht mehr selbst versorgen, weil der Preis für die Robbenfelle trotz Subventionierung durch die dänische Regierung zusammengebrochen ist.“
Die letzten Jäger schießen zwar weiterhin Robben, 20-30 pro Tag mitunter, aber vor allem zur Versorgung ihrer Schlittenhunde. Ansonsten verfallen immer mehr Inuit dem Alkohol und von den männlichen Jugendlichen verüben immer mehr Selbstmorde. „Für Pia liegt der Hauptgrund dafür in der Erziehung zum Jäger,“ das kein Auskommen mehr bietet. Birgit Lutz findet es unterstützenswert, dass die Inuit weiterhin Robben und Kleinwale jagen, aber da sie sich auf Spitzbergen bei ihrer Sommerarbeit für den Schutz der Eisbären engagiert, fällt es ihr schwer, hier in Ostgrönland nun Sympathie für die letzten Eisbärenjäger aufzubringen. Die auf Spitzbergen an Touristen verkauften Eisbärfelle stammen aus Alaska und Kanada. Derzeit kosten sie bis zu 3000 Dollar das Stück, weil immer mehr reiche Chinesen sie als Bettvorleger kaufen.
.
Jagbare Stücke (4)
Der Arzt Robert McCormick war ein Vogelliebhaber , und das hieß im 19. und auch noch im 20. Jahrhundert, dass so einer jeden Vogel, den er interessant fand, vom Himmel holte. Er kam vor allem als Schiffsarzt auf einer mehrjährigen Expedition der englischen Admiralität in die Antarktis auf seine Kosten. Während der Reise erschoß er quasi alles, was fliegen konnte, natürlich auch Pinguine. In seinem Reisebericht rechtfertigte er sein Tun: „Auch wenn es zu meinen Pflichten gehört, diesen ausgesprochen schönen und interessanten Tieren den Garaus zu machen, tut es mir doch in der Seele weh, und jeder Schuß ist von Gewissensbissen begleitet, so sehr liegen mir diese gefiederten Wesen am Herzen.“
Mit ähnlichen Worten haben viele Zoologen, wenn sie alt und anerkannt waren, solche Tötungen rechtfertigt und bedauert. Zuletzt las ich sie bei einem australischen Wissenschaftler, er ging von der Vermutung aus, es müsse noch viel mehr Säugetiere als bekannt auf den Südseeinseln geben – und klapperte sie der Reihe nach ab. Er fing mit Netzen u.a. Flughunde, dabei entdeckte er tatsächlich ein paar neue Arten. Sie kamen ausgestopft in das Sydneyer Naturkundemuseum, hunderte andere waren Forschungsabfall. So wie bei Drosten 5000 Fledermäuse. Solche Fälle sind selten geworden – so wie fast alle Tiere. Die Biologen gerieren sich heute meist als Naturschützer, wobei sie sich oft auf eine Art konzentrieren, der sie ihre Forscherkarriere verdanken.
Sonst geht es ihnen wie z.B. den DDR-Forschern am Otto-Suhr-Institut der Westberliner FU: Als die DDR verschwand, standen sie plötzlich dumm da. In der Biologie heißt es immer: Um eine Art schützen zu können, muß man sie kennen. Das nimmt gelegentlich seltsame Züge an: Wenn z.B. eine karibische Eidechsenart, die weit verbreitet ist, bei einer Feldforschung mit gentechnischem Analyseanteil in „Wahrheit“ aus fünf gleich aussehenden Arten besteht – von denen zwei in ihrem Verbreitungsgebiet vom Aussterben bedroht sind. Und also muß man sie dann doch schützen.
Während die westliche Lebenswissenschaft langsam ihren Objekten nicht mehr das Leben nimmt, vermehren sich die Trophäenjäger. In vielen z.B. afrikanischen Nationalparks sind diese reichen Weißen hochwillkommen, während die Einheimischen eher als Wilderer verfolgt (und in Kenia neuerdings sogar hingerichtet werden). Die Parkverwaltungen, die nicht selten noch mit Weißen besetzt sind, müssen ständig die Waffen ihrer schwarzen Wildschützer verbessern, weil auch die Wilderer inzwischen Nashörner und Elefanten z.B. mit Drohnen jagen. Auch die meisten Sponsoren und Biologen sind Weiße. Die reichen Hobbyjäger argumentieren: „Findet Trophäenjagd unter kontrollierten Bedingungen statt, kann sie für den Bestand einer Wildart sehr nützlich sein,“ so z.B. der Jäger und „Welt“-Redakteur Eckard Fuhr in seinem Buch „Schafe“ (2017).
Es ändert jedoch nichts daran, dass einzig das Töten zum Verzehr noch sozial tolerierbar ist. Auch wenn immer mehr junge Frauen einen Jagdschein machen und Bücher über ihre „Beute“ veröffentlichen. In den sozialen Netzwerken wird mindestens einmal in der Woche ein Foto gepostet, das ein reiches Arschloch zeigt, das stolz auf oder hinter einem erschossenen Löwen oder Schneeleoparden posiert. Die Fotos sind Steckbriefe mit Namen und Adresse dieser „Tiermörder“.
Das akzeptierte Töten geschieht entweder für den Eigenbedarf oder industriell für den Markt. Die moderne Agrarproduktion steht aber ebenso in der Kritik wie von Naturschützern (u.a. dem Dänen Morten Jörgensen) kritisiert wird, dass man den indigenen Völkern, die von der „traditionellen Jagd“ leben, eine Quote z.B. an Eisbären einräumt: Da ist nichts „Traditionelles“ mehr an der Jagd meint er. „Die Inuit gehen mit hochtechnischen Motorschlitten und wummstarken Gewehren, mit Feldstechern und Spezialkleidung auf das Eis.“ Der Münchner Ökologe Josef Reichholf erwähnt in seinem Buch „Der Bär ist los“ (2007), dass auch die Trophäenjagd sich weiterentwickelt hat: Sie ist heute ein mit viel Geld bezahlter Einsatz moderner Waffentechnik aus sicherer Entfernung. Man könne sogar schon „Abschüsse per Computer“ kaufen. „Der Schütze“ ist mit einem echten Gewehr draußen in der Wildnis über das Internet verbunden und so in seinem Homeoffice in der Lage, „tatsächlich den Bären zu schießen. Das Video wird frei Haus geliefert, das Fell kann als Trophäe erworben werden. Peinlicher kann ein solcher ‚Sieg‘ über das große Tier nicht mehr werden.“ Inzwischen ist noch das Kampfmittel Drohne beim den Trophäenjägern hinzugekommen, das auch für Tierfilmer inzwischen unverzichtbar ist.
.
Jagbare Stücke (5)
„Die Jagd ist eine Kunst“ – steht in der heute musealisierten Jagdhütte von Marschall Tito nahe Belgrad. Der Psychoanalytiker Paul Parin, der bei den Tito-Partisanen als Arzt arbeitete, war auch ein leidenschaftlicher Jäger und Angler, der bereits als 13jähriger bei seinem ersten tödlichen Schuß auf ein Haselhuhn einen Orgasmus bekam: „Seither gehören für mich Jagd und Sex zusammen“. Dieser Doppelschuß, wenn man so sagen darf, machte ihn zum „Mann: glücklich und gierig“. Vor dem offiziellen Erwachsenenstatus steht aber noch eine sadistische „englische Erziehung“: Bei einer Jagd mit Hunden beging er als junger Treiber so viele Fehler, dass sein gutsherrschaftlicher Vater ihn von seinem Förster auspeitschen läßt – „auf den blanken Hintern“ inmitten der Treiberschar. Die darf ihn sich gleich anschließend noch einmal im Keller des Landschlosses vornehmen, dabei ziehen sie ihn ganz aus. Sein „Papa stand daneben und genoss das Schauspiel“. Anschließend legte sich einer der Burschen nackt neben ihn, „nahm meinen Pimmel in die Hand, steckte ihn in den Mund und fing an zu saugen und mit der Zunge zu streicheln. ‚Er will mich trösten‘, dachte ich und drehte mich so, dass ich seinen Pimmel auch zu fassen kriegte, und steckte ihn meinerseits in den Mund. Es war wirklich ein Trost.“
Das war aber noch nicht die eigentliche „Initiation“. Die kam erst mit 17 – als er seinen ersten Bock schoß. Ein Onkel hatte ihn in seine Jagdhütte eingeladen, als Paul Parin oben ankam, bedrängte dieser gerade mit heruntergelassener Hose seine Haushälterin am Kachelofen. „Komm in zehn Minuten wieder,“ rief ihm der Onkel zu, „dann sind wir mit Vögeln fertig. Dann sind auch die Mädels da, die ich gemietet hab. Sie sind scharf auf dich, haben sie gesagt“. Abends erzählt der Onkel Jagdgeschichten, danach geht der Bub mit einem der drei Mädchen auf sein Zimmer. Erst läßt sie sich von ihm mehrmals mit der Hand befriedigen, dann holt sie ihm einen runter. Anschließend schläft sie sofort ein, er kann nicht schlafen, stattdessen zieht er sich wieder an, schnappt sich sein Gewehr und geht in den Wald, wo er dann von einem Hochsitz aus einen „starken Bock“ mit Blattschuß erlegt. Beim Frühstück muß er alle Einzelheiten erzählen. Auch das gehörte zum „Ritual“.
Seitdem erfaßte ihn „das Jagdfieber immer wieder mit der gleichen Macht wie sexuelles Begehren“. Das ging auch seinem Jugendfreund so: „Dulli war Jude und zeitlebens dem Jagdfieber verfallen. Von seinem liebsten Jagdkumpan an die deutsche Besatzungsmacht verraten, wurde er Widerstandskämpfer und in der titoistischen Republik Slowenien Minister für Jagd und Fischerei“. Ein „aufgeklärter Mensch jagt nicht“ und auch ein „Jude jagt nicht“ – das sind „gleichermaßen Gesetze abendländischer Ethik. Ich muss mich zu den Ausnahmen zählen“. Aber Paul Parin hat von sich selber und vielen anderen erfahren: „Wenn mein Vater nicht seine Jagd gehabt hätte, wären wir Kinder in der strengen und sterilen Familienatmosphäre erstickt“. Deswegen kann er jetzt eher genuß- als reuevoll z.B. seine Jagd auf eine Gazelle in der Sahara und das Forellenfischen in Alaska – als Sucht – beschreiben.
„Sucht heißt, dass der narzisstische Genuß am Morden mit der Jagd weltweit einen Freibrief hat“. Am Beispiel von Milovan Djilas, leidenschaftlicher Angler, Mitkämpfer und Vertrauter Titos, gibt er jedoch zu bedenken: „Später, als Dichter, wusste Djilas: Keine Ausübung der Macht über das Volk, über die Schwachen bleibt ohne verbrecherische Taten. Wäre es nicht besser gewesen, der eigenen Leidenschaft Raum zu geben und den flinken Forellen nachzustellen…?“ Im Russischen gibt es ein volkstümliches Wort für Jagd und Lust: Ochota. Parins eigene „Jagdleidenschaft“ erlosch bald nach dem 84. Geburstag seiner Frau Goldy, am 30 Mai 1995: „An diesem Tag habe ich im Fluß Soca in Slowenien die größte Forelle meiner Laufbahn gefangen“. Anschließend erzählte er seiner Frau, daß er am Fluß einen jungen verwilderten Mann, der ihn beklauen wollte, fesselte – dann hätte er ihn ausgepeitscht bis zum „Flash“, woraufhin sie beide zum Orgasmus gekommen wären. Während Paul Parin diese Geschichte schließlich als eine „Phantasie“ darstellt, ist die Psychoanalytikerin Goldy sich da „nicht so sicher…Kann sein, dass du nicht nur die Riesenforelle erwischt hast, sondern auch einen Gayboy aus Kärnten“. Sie einigen sich darauf: „Es könnte so sein oder auch nicht…Gehen wir schlafen“.
In einer Art Nachwort rühmt Christa Wolf Paul Parins „Lebenskunst und Schreibkunst“, diese im richtigen Augenblick kennengelernt zu haben, hält sie für eine „glückliche Fügung“. Mich hat sie eher verwirrt. Parins Buch ist 2018 überarbeitet neu herausgegeben worden, es heißt jetzt: „Die Jagd – Licence for Sex and Crime“.
.

Tito und Breschnew auf Pirsch
.
Einzelhändler
Der Einzelhandel, also der Ladenbesitzer, verschwindet. Er weicht den expandierenden Handelsketten. So gibt es das Discountunternehmen „Lidl“ schon fast in ganz Europa (10.800 Filialen in 32 Ländern, 193.000 Angestellte). Dazu gehört auch noch „Kaufland“: Was für ein Name! Seit einiger Zeit breiten sich daneben die Handelsketten der „Bio-Supermärkte“ aus. Sie schlucken immer mehr „Bio-Läden“. 2012 wurden laut Wikipedia 42 kleine Bioläden mit bis zu 100 m² geschlossen und 41 Bio-Supermärkte ab 400 m² neu eröffnet.
Ein Freund von mir, der als letzter des Betreiberkollektivs eines Bioladens übrig blieb, endete an der Kasse eines Bio-Supermarkts. Er war nicht einmal unglücklich, auf diese Weise seine Selbständigkeit als Einzelhändler verloren zu haben, denn damit hatte das Hadern mit seinen schwindenden Umsätzen ein Ende. Er war übrigens mit seinen Erfahrungen im Bio-Supermarkt eine Ausnahme: Die meisten Angestellten interessieren sich nicht für die Besonderheiten der Ware „Bioprodukt“. Es ist bloß ein Job für sie. Die beiden größten Bio-Supermarktketten, „Denn`s“ und „Alnatura“ beschäftigen jeweils mehrere tausend Mitarbeiter und haben keinen Gesamtbetriebsrat. Sie ähneln überhaupt den großen Nichtbio-Supermärkten, auch darin, dass sie ab einer bestimmten Größe den Herstellern und Lieferanten ihrer Produkte Vorgaben machen, das Aussehen, die Frische und den Preis betreffend.
Um die Schweizer Lebensmittelkette „Migros“ als Milchbauer beliefern zu dürfen, mußten diese alle ein computerisiertes Gerät von Migros kaufen, das Verunreinigung, Keimzahl und Fettgehalt ihrer Milch anzeigt. Wenn die „Daten“ eine Toleranzgrenze überschreiten, wird ihre Milch nicht abgenommen.
Als das Kombinat Narva seine Lampen nach 89 in die im Osten eingefallenen Supermärkte verkaufen wollte, mußte es seine Produkte erst einmal bei denen „listen“ – für 20.000 DM, was nicht hieß, dass sie auch nur in einer Filiale zum Verkauf angeboten wurden.
Der norddeutsche „Salatkönig“ Rudolf Behr beschäftigt 6.000 Erntearbeiter, sein Imperium reicht von Rumänien über Kroatien bis Spanien. Sein Ackererwerb folgt dabei den deutschen Supermarkt-Konzernen auf ihrem Ost-Feldzug, und seine Erntehelfer sollen künftig wie die mexikanischen Wanderarbeiter in den USA dem Erntezyklus durch ganz Europa folgen. Wenn seine LKWs den Salat zu spät an den jeweiligen Supermärkten anliefern, muß er für jede Stunde 500 Euro Strafe zahlen.
Die Produzenten wehren sich, indem sie immer mehr auf Quantität statt auf Qualität setzen, die Lebensmittelaufsicht versucht dabei das Schlimmste zu verhindern – auch in den Bioläden. So prüften sie dort z.B. das „ungeschwefelte Trockenobst“ aus Griechenland – und stellen dabei fest, dass es sogar über das erlaubte Maß hinaus geschwefelt war, was ein dickes Bußgeld nach sich zog. Und die Bioladenbesitzer sind sogar noch froh darüber, weil sie nicht alle ihre Waren derart prüfen können.
Beim Einzelhandel kommt noch ein weiteres Problem hinzu: Nehmen wir an, ein junger Arbeitsloser eröffnet ein Geschäft mit Videospielen – und geht nicht pleite: der Laden läuft und läuft. Und plötzlich ist sein Besitzer alt und grau. Er hat sein ganzes Leben hinter der Verkaufstheke verballert. Er ist am Erfolg gescheitert. Nicht wenige werden in dieser Not kreativ, d.h. sie entwerfen Schriften für Sonderangebote und Neonreklame, sortieren um und Anglifizieren ihre „Botschaften“ – mit oft grotesken Ergebnissen. So steht z.B. neuerdings an einem Berliner Fachgeschäft für Messer und Scheren auf dem Schaufenster „Have a Knife Day“.
Diese irren Händler, denkt man und erinnert sich vielleicht an die alten Griechen, die den Einzelhandel verabscheuten. Nur Halbfreie (Metöken) und Fremde sollten eine solch „unehrbare Tätigkeit“ – Pfennigfuchserei – ausüben. Für Platon war allerdings klar: „Der wahre Feind, der sich hinter dem Händler abzeichnet, ist der Tausch,“ wie es bei Roberto Calasso (in: „Der Himmlische Jäger“ 2020) heißt. Man sollte deswegen nur so wenig Händler wie nötig zulassen. Auch der private „Erfolg“ war höchst suspekt, und dann erst das „Geld“: Es erleichtert zwar die Güterverteilung, reduziert das Leben der Händler jedoch auf Zahlen. Ihre wesentliche Tätigkeit ist das Zählen, aber Rechnen ist nicht Denken, wie Adorno wußte.
Seltsam, dass Calasso nicht darauf kommt, warum in Athen in einer Nacht 415 v.Chr. zig Hermes-Statuen, die überall herumstanden, das Gesicht und der erigierte Phallus abgeschlagen wurde. Hermes war der Gott der Kaufleute. Es war ein Akt der Widerstands gegen die zunehmende „Macht des Geldes“, die die „Gemeinschaft“ zersetzte. Am nächsten Morgen machte sich Panik in der Stadt breit. Nicht wenige der vermeintlichen jungen Täter wurden zum Tode verurteilt, einige wurden verbannt oder flohen. Der Tragödiendichter Aischylos klagte: „Die Ehrfurcht von einst ist verschwunden./ Es bleibt die Furcht. Der Erfolg,/ der ist den Sterblichen der Gott und mehr als Gott.“ Zuletzt, als alle 12 Olympier nicht mehr ausreichten, fügte man eine weitere Gottheit hinzu: sinnigerweise die strenge, gewaltige Tyche – Fortuna!
.
Bienendemokratie
Der US-Bienenforscher Thomas S. Seeley hat aus der Suche der Bienen nach einer neuen Höhle für den Schwarm und ihrer „kollektiven Entscheidung“ für die geeignetste Unterkunft zu einer auch für uns geradezu vorbildlichen „Bienendemokratie“ erklärt. Diese sollen wir uns alle zu Herzen nehmen. Der Autor praktiziert sie selbst erfolgreich als Leiter eines Forschungsinstituts . „Es gehört zu den erstaunlichsten Aspekten am Entscheidungsprozess der Bienenschwärme, dass er ein vollkommen demokratischer Vorgang ist,“ heißt es dazu in seinem Buch: „Bienendemokratie“ (2015), die ein Ergebnis der biologischen „Selektion“ ist.
In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die „Demokratie“ in Griechenland in dem Moment aufkam, als die (alte) „Gesellschaft“ mit der vollen (geldlichen) Entfaltung des Warenhandels auseinanderbrach – sie war somit die richtige Antwort in der falschen (Waren-) Sprache. Der von Herodot so genannte „Demokratie-Begründer“ Kleisthenes bildete (im 6.Jhd. v.Chr.) die neue Verfassung dem früheren „Stammesmodell“ nach – und verbarg so die Tatsache, dass mit ihr die „letzten Überreste der urtümlichen gesellschaftlichen Verhältnisse hinweggefegt worden waren,“ d.h. die Warenbesitzer traten sich nunmehr in der „‚Freiheit‘ des offenen Marktes als Gleiche gegenüber.“ Diese allgemeine „Gleichheit vor dem Gesetz“ (isonomia) bezeichnete bereits Diodoros aus Agyrion im 1. Jhd.v.Chr. als unwesentlich, da sie ohne „Gleichheit des Eigentums“ (isomoiria) durchgesetzt wurde. Infolgedessen hatte sich „der Klassenkampf, weit davon entfernt, beendet zu sein, noch verschärft.“ Es standen sich nicht mehr Adlige und Bürger, Mitglieder einer menschlichen Gesellschaft, gegenüber, sondern Sklavenhalter und Sklaven, wobei letztere „aus der Gesellschaft Ausgestoßene“ und zugleich „Schöpfer ihres Wohlstands“ waren. Dadurch entstand eine Spaltung zwischen Konsumtion und Produktion, zwischen Denken und Handeln. „In der griechischen Demokratie,“ heißt es weiter in den „Forschungen zur altgriechischen Gesellschaft“ des Altphilologen George Thomson, „sah sich das Individuum von allen Bindungen ‚befreit‘, abgesehen von denen, die durch die geheimnisvollen Zusammenhänge der Warenproduktion hergestellt wurden.“ Die auf dem Prinzip des Privateigentums und des Warentauschs beruhende „Demokratie“ ist paradoxerweise die Negation von Gesellschaft. Um so mehr, als mit der Münzprägung die Besitzanhäufung maßlos wurde, was bereits den ehemaligen Kaufmann Solon um die athenische Demokratie fürchten ließ. Er beruhigte sich jedoch mit dem wenig überzeugenden Gedanken, dass ein Bürger, der sich alles leisten kann, nicht reicher ist als ein anderer, der nur genug zu essen hat.
Der Marxist Alfred Sohn-Rethel hat in seinem Hauptwerk „Geistige und körperlich Arbeit“ die Entwicklung dahin beschrieben: Im Maße in Griechenland mit der Eisenzeit eine Ökonomie der kleinen Bauernwirtschaften und der unabhängigen Handwerksbetriebe entstand, war „auf die Bereitschaft zur Erwiderung beim Gabentausch kein Verlaß mehr und der Austausch mußte eine tiefgreifende Umformung erfahren, eben die Umformung zum Warentausch, d.h. die zuvor im zeitlichen Abstand zur Gabe lose erfolgende Erwiderung verkoppelte sich jetzt strikt mit ihr zur prompten Bezahlung der Gabe an Ort und Stelle, so daß die beiden Akte des Austauschs wechselseitige Bedingung füreinander wurden und zur Einheit und Gleichzeitigkeit eines Tauschgeschäfts zusammengekettet waren. Die Partner dieses Verhältnisses standen nun als Käufer und Verkäufer erst eigentlich in vollem Sinne der Tauschhandlung und Tauschverhandlung sich gegenüber.“ Für die Masse der Bauern und Handwerker bedeutete diese Entwicklung jedoch, dass sie zu Schuldsklaven herabsanken, d.h. ebenfalls Handelsware wurden.
Es werde gesagt, schreibt Thomas S. Seeley am Schluß seines Buches, „die Honigbienen seien Botschafter, die von den Göttern geschickt wurden, um uns zu zeigen, wie wir leben sollen: in Süße, Schönheit und Frieden.“ In der Tat schickte der Himmel den Griechen die „Demokratie“, so wie dem „Ersten Philosophen“ Parmenides „das Sein“ von der Göttin der Gerechtigkeit geschenkt wurde, das für Sohn-Rethel erst durch die Einführung des Geldes überhaupt gedacht werden konnte.
Der Würzburger Bienenforscher Martin Lindauer hat Seeley gegenüber festgestellt, dass nur die „Spurbienen“ die Entscheidung, welche Höhle zum Nestbau am geeignetsten ist, quasi austanzen, was bis zu einer Woche dauern kann. Auf unsere „Demokratie“ übertragen, hieße das vielleicht, Sonnyboys wie Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg wären unsere „Spurbienen“. Sie sind alle für die „Demokratie“, aber nur unter vernünftigen Führungskräften.
.
Fake-Followers der Influencer
Sucht man im Internet nach dem Sachbuch „Influencer“ wird erst einmal ein altes Buch des extrem positiv denkenden Motivationstrainers Dale Carnegie angezeigt: „Wie man Freunde gewinnt“. Ein Influencer (Einflußreicher) ist danach jemand, dem es gelingt viele Freunde hinter sich zu bringen: Freunde im banalen amerikanischen Sinne von „Follower“ (z.B. als „Facebook-Friend“). Das neue kritische Sachbuch dazu – vom jungen Soziologen Ole Nymoen hat den Titel „Influencer: Die Ideologie der Werbekörper“. Dazu heißt es: „Menschen über dreißig kennen oft nicht einmal ihre Namen, für jüngere Jahrgänge sind sie Topstars: Influencer. Junge Erwachsene und sogar Kinder filmen sich beim Schminken, auf Reisen oder beim Sport und teilen ihre Tipps über soziale Medien mit ihren Fans. Dabei platzieren sie geschickt Produkthinweise und verdienen so ihren Lebensunterhalt – oder gar ein Vermögen.“
Für den Autor sind Influencer „symptomatische Sozialfiguren unserer Zeit. In der Abstiegsgesellschaft scheinen noch einmal Aufstiegsträume wahr zu werden, der Spätkapitalismus hübscht sein Gesicht mit Filtern und Photoshop auf, mit einer revolutionären Form der Werbung komplettieren Instagrammer und Youtuber das Geschäftsmodell des kommerziellen Internets.“ Diese „Influencer“ leisten damit laut Ole Nymoen „einem konservativen Backlash Vorschub“.
Wie man weiß, hatte die chinesische Regierung als erste die Idee, ihre Online-Verlautbarungen vom Volk begrüßen und für richtig befinden zu lassen, indem sie für jede Zustimmung zahlte, nur ein bißchen, aber wer fleißig zustimmte, konnte damit mindestens seine Miete bezahlen. Das waren die gekauften chinesischen „Follower“ (auch Fake-Follower genannt) der KP Chinas – der weltgrößten Influencerin.
Die Idee ist gut, dachten sich die amerikanischen Oligarchen (griechisch für „einige wenige Führer“). Praktisch die halbe herrschende Klasse der USA übernahm sie. In ihren „sozialen Medien“: Youtube (der Medienkonzern, der gerade die russischen Sender rausgeschmissen hat, gehört zu Google), Facebook (dazu gehören Instagram, WhatsApp sowie einige weitere Soft- und Hardware-Firmen) und Twitter (dieser von Trump so geliebte Mikrobloggingdienst gehört den eher unliebsamen Plusmachern Evan Williams, Al-Walid ibn Talal, Steve Ballmer und Jack Dorsey.)
Dorsay besitzt 13,2 Milliarden Dollar. Aber wie das so ist: Geld hat man im Kapitalismus nie genug und je mehr man hat, desto leichter ist es, mehr Geld zu „machen“ – zu „generieren“. So versteigerte Dorsay kürzlich als Geschäftsführer von Twitter z.B. die Rechte an seinem ersten Twitter-Eintrag (Tweet) vom 21. März 2006 für 2,9 Millionen US-Dollar, er lautete: „Richte nur mein twttr ein“. Man kann also durchaus aus Scheiße Rosinen machen – wenn man reich genug ist und damit in den USA, wo Reichtum für das Wahre, Schöne und Gute gilt, als „Influencer“ genügend „Follower“ hat.
Aber auch hier gilt: genügend ist nie genug! Und so kommt es, dass der E-Auto-Bauer Elon Musk (mit einem Vermögen von 201 Milliarden Dollar) 60 Millionen Twitter-Followers hat, von denen jedoch 28 Millionen „Fake-Followers sind (46,5 %). Der reichste Mann der Welt hat damit die meisten Fake-Followers (also solche, die es nicht gibt). Ihm folgt das zweitreichste Arschloch, der noch viel gemeingefährlichere Bill Gates mit 56 Millionen Twitter-Followers, von denen 24 Millionen Fake-Followers sind (42,3 %). Auf Platz 3 steht der Google-Geschäftsführer Sundar Pichai, der zwar nur ein Vermögen von 1,2 Milliarden Dollar hat, und auch nur 4 Millionen Twitter-Follower, aber davon sind immerhin 1,6 Millionen gefaked (39,3 %). Vierter in dieser Betrügerhitliste ist der Amazon-Gründer Jeff Bezos (mit einem Vermögen von 192 Milliarden Dollar): er hat 2,7 Millionen Follower, davon ist über eine Million gefaked (38,7 %). Fünfter ist der chinesische „Alibaba“-Gründer Jack Ma (mit einem Vermögen von gut 39 Milliarden Dollar): Er hat knapp 700.000 Twitter-Follower, davon sind fast 40% Fake-Followers. Platz 6: der demokratische Politiker und TV-Sendergründer Michel Bloomberg, mit einem Vermögen von 59 Milliarden Dollar, er hat 2,7 Millionen Twitter-Follower, davon sind fast 1 Million Fakes (34,8 %). Auf Platz 7: der englische „Rocketman“ und Besitzer des Mischkonzerns „Virgin“ Richard Branson (mit einem Vermögen von 4,4 Milliarden Dollar): Er hat 12,6 Milliarden Follower, von denen über 4 Milliarden Fakes sind (33,5 %). Platz 8: der o.e. Twittergründer Jack Dorsey, der 5,7 Millionen Follower hat, von denen 1,6 Millionen Fakes sind (29,6 %). Platz 9: die Ex-Ehefrau des Amazon-Gründers: Sie, MacKenzie Scott, ist mit einem Vermögen von 60 Milliarden Dollar die zweitreichste Frau der Welt und hat heute 180.000 Twitter-Follower, davon sind 43.000 gefaked (23,8 %). Schließlich auf dem 10. Platz der Kapitalisten „With The Fakest Twitter Following“, wie die US-Journalistin Amila Campbell ihr Ranking nennt: Steve Palmer, er war lange Jahre Geschäftsführer von Microsoft, hat ein Vermögen von 92 Milliarden Dollar und 43.000 Twitter-Follower, von denen 10.000 Fakes sind (23,5 %).
Mit dieser Twitter-Fake-Scheiße kann man sogar direkt in den Klassenkampf eingreifen: Als es bei Amazon im Frühjahr 2021 darum ging, dass die vielen Mitarbeiter (weltweit sind es 1,298 Millionen) sich gewerkschaftlich organisieren wollten, tauchten auf Twitter plötzlich „Tweets“ von Amazon-Mitarbeitern auf, die sich dagegen aussprachen. Unter der Überschrift „‘Gefälschte‘ Amazon-Mitarbeiter verteidigen Unternehmen auf Twitter“ berichtete die BBC über diese kapitalistische Sauerei: „Es wurde eine Reihe von gewerkschaftsfeindlichen Tweets von Konten versandt, die sich als Mitarbeiter ausgaben“.
.
Ostseeküste
Kürzlich gingen wir auf Entdeckertour – nach Muscheln und Steinen an der polnischen Ostseeküste zwischen Swinemünde und Colberg. Auch viele Vögel entdeckten wir dort: Silbermöwen, Lachmöwen, Kormorane, Enten, Tauben, Nebelkrähen, Dohlen. Die Schwalben sammelten sich auf den Stromleitungen. Am Himmel flogen Formationen von Kranichen und Gänsen und Schwärme von Staren und Spatzen.
Zwei Mal täglich wandten wir unseren Entdeckerdrang vom Meer ab: zu Strand, Düne mit Strandhafer, Kiefernwald, bis in die Gassen mit Buden, die chinesische Textilien, Schuhe, Uhren, Spielzeug und statt Ansichtspostkarten Kühlschrankmagnete mit Ansichtskartenmotiven anboten. All diese Buden weichen gediegeneren Läden und Hotels, Hotels, Pensionen, Ferienbungalows, -appartments, Restaurants, Cafés, Trimm-Dich-Parcours… Und Blumen: überall bunte Blumen.
In Dziwnowek, unserem preiswerten Basislager, das nicht in unserem Reiseführer erwähnt wird, errichten Stettiner Investoren drei große Hotelkomplexe, wobei sie von „intimen Investitionen“ sprechen, und dazu eine ganze Siedlung mit Ferienhäusern. Ein Häuschen mit 47 Quadratmetern Wohnfläche auf einem 54-Quadratmeter-Grundstück kostet mit Parkplatz rund 100.000 Euro.
Den Vogel an Investitionsfreude schoß Swinemünde ab. Hier scheint das Kapital am Wildesten entschlossen, die Renommierbäder Ahlbeck und Heringsdorf auf der deutschen Seite Usedoms arm aussehen zu lassen. „In den Dreißigerjahren kurten in Swinemünde zahlreiche deutsche Filmstars,“ heißt es im Reiseführer. Jetzt, in der Nachsaison dominierten in Swinoujscie, wie in allen Badeorten, wohlbeleibte Rentner beiderlei Geschlechts und Nationalität mit kleinen plattschnauzigen Hunden das Geschehen auf den Strandpromenaden, am Meeressaum und am Frühstücksbüffet. In einigen Häfen warteten „Wikingerschiffe“ auf sie, die mal die Küste vom Meer aus sehen wollen. Überhaupt hat man dort die Wikinger „entdeckt“, die immer wieder die pommerschen Küstenorte heimgesucht hatten.
In Wolin, am Camminer Bodden gelegen, wird alljährlich ein großes Wikingerfest veranstaltet. Dazu reisen „Fans“ aus ganz Polen, Dänemark, Deutschland und Litauen an.
In Kamien-Pomorski, ebenfalls am Camminer Bodden, gibt es einen voll belegten Yachthafen und ein wenig besuchtes Orgelfestival. Die jungen Frauen in diesen kleinen Küstenorten scheinen überwiegend Beschäftigung im Bedienungsgewerbe zu finden. Das Angebot für Touristen ist in Kamien-Pomorski allerdings noch „überschaubar“, heißt es.
„Die Badewanne Berlins“, wie Misdroy sich einst nannte, soll im Sommer laut dem Reiseführer „Polnische Ostseeküste“ ein Tummelplatz der polnischen Filmprominenz sein, die sich nächtens im Club des Amber Baltic Hotels (190-Zimmer) vergnügt. Direkt vorm Club haben sie einen „Walk of Fame“. Im Ortszentrum findet man an deutscher Prominenz fast alle Supermarktketten. Nicht nur in Medzyzdroje eröffnete an der Strandpromenade ein Ozeanarium mit exotischen Fischen. Buden bieten daneben exotische Muscheln an. Zur Hochsaison kommen über 500.000 Sommergäste nach Medzyzdroje.
Auf der Seebrücke drängeln sich auch in der Nachsaison noch die Feriengäste. Es gibt keinen Maskenzwang und kein Testergebnisvorzeigen, wir sahen auch kein Corona-Testzentrum. Eine Dame aus Zwickau klärte uns auf: „Hier vertraut man der gesunden Seeluft.“ Ähnliches hatten wir uns zuvor auch schon in Kopenhagen gedacht, aber kaum hatten wir die Oder-Brücke nach Deutschland überquert, passierten wir ein großes Corona-Testzentrum, bekamen eine Corona-Grußbotschaft von der Bundesregierung auf unser Handy und im Restaurant verlangte man Impfnachweis bzw. Testergebnis.
Kolobrzeg (Colberg) hat heute alljährlich anderthalb Millionen Besucher. „Am meisten los ist zwischen Leuchtturm und Seebrücke,“ heißt es auf Wikipedia. Ein Strandkorb kostet mit Sonnenschirm pro Tag knapp 25 Euro. Sogar für einen Gang auf der Hafenmole mußten wir zahlen. Am Holzpier fragte meine osteuropakritische Freundin, der so manches Profitmacherprojekt an der naturnahen pommerschen Küste mißfiel: „Was hat denn hier ein Riesenrad zu suchen?“
Einst kämpften Wikinger, Schweden, Franzosen, Russen, Deutsche und Polen um diese Stadt der „Küstendenker“. Im März 1945 verschanzte sich die Wehrmacht in dem „Kraft-durch-Freude“-Bad, in den Kämpfen wurden 90 Prozent der Gebäude zerstört. Zur gleichen Zeit kam der NS-Durchhaltefilm „Kolberg“ in einige Berliner Kinos. Der Film zeigt die heldenhafte Verteidigung der Stadt unter der Führung von Gneisenau und seines Adjutanten Nettelbeck gegen die Truppen Napoleons 1806/07. Zuvor war es zu einem Bürgerstreit gekommen: „Nettelbeck war für Widerstand, der geschäftsorientierte Reeder für Unterwerfung“. So ähnlich war es auch 1945, diesmal unterlagen jedoch die Deutschen.
Der ehemalige Seemann auf Sklavenschiffen Joachim Nettelbeck hinterließ eine „Lebensbeschreibung“. Sein letzter männlicher Sproß war der 2007 gestorbene Schriftsteller Uwe Nettelbeck, der zusammen mit der ehemaligen Schönheitskönigin und Fernsehansagerin Petra Nettelbeck in Frankreich eine deutsche Zeitschrift im Geiste von Karl Kraus‘ „Fackel“ herausgab: „Die Republik“. Über den „Kolberg“-Film schrieb er in „Die Zeit“ einen Artikel.
.
Hotel-Handtücher und -Toilettenpapier
„Mir egal, wo wir Urlaub machen, Hauptsache wir haben ein Hotelzimmer mit einem Schwan aus Handtüchern auf dem Bett und das erste Blatt auf der Toilettenpapier-Rolle origamimäig gefaltet,“ hörte ich einmal eine Frau am Nebentisch in ihr Telefon sagen. Und das fast ohne Ironie. Seitdem achte ich auf so etwas, wenn ich mal in einem Hotel übernachte, ja, ich sehe immer als erstes nach diesen beiden Begüßungsgesten der Hotelleitung. Nicht dass ich sie vermissen würde, sondern ob es – beim Schwan auf dem Bett z.B. – regionale oder kultur- und klassenmäßige Unterschiede gibt. Leider wirkt sich das Internet nivellierend dabei aus: U.a. der YouTube-Clip „Handtücher falten – Schwäne – Anleitung“ und der Clip „In der Ruhe liegt die Handtuch-Kunst“.
Aber schon scheint die „Diversity“ der Bettschwäne auf anderer Ebene wiederzukehren: auf der von Profikünstlern. Wie die chinesische Internetseite „german.alibaba.com“ versichert, sind Bettschwäne „künstlerisch und trendy“ im Kommen – für „Dekorationen“. Diese Falztechnik für Stoffe hat in China eine lange Tradition und weiße Schwäne sind dort wie auch anderswo ein beliebtes Motiv, es gibt neben Porzellanschwänen und den Bettschwänen aus weißen Handtüchern auch „Origami-Schwäne“ aus Papier dort – mit Anleitungen, wie man sie auf „chine-culture.com“ z.B. findet.
Auf die Frage „Wie macht man einen Bettschwan“ antwortet Wikipedia: „1. Lege ein Handtuch flach hin. 2. Falte nun die beiden oberen Ecken des Handtuchs nach innen, so dass sie sich in der Mitte treffen. 3. Rolle nun die beiden äußeren Kanten nach innen in Richtung Mitte. 4. Falte den entstandenen Pfeil zu einem Z. 5. Setze nun das Z hin und forme die Ecken zu Kurven.“ Anderswo im Internet wird das Handtuchschwan-Falten in sechs Schritten erklärt.
Bei den chinesischen Bettschwänen sind zwei Schwäne beliebt, die sich Aug in Aug gegenüber befinden, ihre Schnäbel so weit gesenkt, dass sie sich damit berühren, während ihre Brüste sich einander nähern. Von der Seite aus gesehen bilden sie so eine Herzform. Das ist nur eine von vielen chinesischen Handtuchschwan-Varianten. Auf Facebook sah ich übrigens ein Foto von einem deutschen Hotelgast, der aus allen Handtüchern in seinem Zimmer eine Art agressiven Bettschwan gefertigt hatte, er sah aber noch nicht gut aus. Die chinesischen Künstler denken sich zu „Dekorationszwecken“ immer neue feinsinnigere Bettschwäne aus, auch andere Betttiere, eine ganze Handtuch-Menagerie. Auf „de.aliexpress.com“ werden „Luxus Bettschwäne“ angeboten. Wer kauft so etwas? Auf „wikihow.com“ („Hier lernst du alles“) fand ich die Antwort: „Handtuchtiere werden oft auf Kreuzfahrtschiffen und B&B Hotels verwendet, um dir deinen Aufenthalt unvergesslich zu gestalten. Diese in deinem Badezimmer aufzustellen, wird mit Sicherheit beeindrucken! Befolge diese Anleitung, um einen Schwan zu falten.“
Zum Einen sind also die Großabnehmer von Bettschwänen Kreuzfahrtschiffe (mit bis zu 2700 Kabinen) und große Hotels (mit bis zu 7300 Zimmern), und zum Anderen sind nun auch – aus Langeweile? – die Nutzer dieser Kabinen bzw. Zimmer gehalten, selbst aus ihren Handtüchern Schwäne zu falten und zu rollen – um damit zu „beeindrucken“. Aber wen oder was? Doch eigentlich nur das Zimmermädchen, heute versachlicht „Zimmerservice“ genannt, dem man ein Trinkgeld auf dem Nachttisch hinterläßt – und keinen selbstgemachten Schwan, „wikihow“ meint jedoch die Gäste in privaten Badezimmern, die von dem Handtuchtier beeindruckt werden sollen. Der „künstlerische und trendy“ Bett- bzw. Badezimmerschwan soll damit von den großen Beherbergungsunternehmen auch zu den kleinen, privaten Bett- und Badezimmer-Besitzern gelangen.
In den Vorgärten sieht man gelegentlich Schwäne aus alten Autoreifen, schwarze Schwäne, aber auch weiß angemalte. Auch sie gehören den kleinen Grundstücks-Besitzern, die großen besitzen einen Teich mit lebenden Schwänen.
Ich meinte einmal zur Chefin eines kleinen Künstlerhotels in Worpswede, als sie mir mein Zimmer zeigte: „Da ist ja gar keine Handtuchschwan auf dem Bett.“ „Diesen Quatsch vermissen Sie doch nicht im Ernst,“ antwortete sie mir. „Nein,“ sagte ich. Auch das erste Blatt der Toilettenpapierrolle in der Naßzelle meines Hotelzimmers hatte sie nicht origamimäßig gefaltet. Laut Wikipedia ist „Das Falten von Toilettenpapier in Hotels ein gebräuchliches Vorgehen in Hotels weltweit, um dem Gast anzuzeigen, dass das Badezimmer gereinigt wurde. Üblicherweise geschieht das Falten so, dass ein Dreieck oder „V“-Muster aus dem ersten Blatt einer Toilettenpapierrolle gefaltet wird.“
Das Portal „Focus“ und der „Merkur“ zitieren ein Zimmermädchen, das davor warnt: „Sie sollten im Hotelzimmer niemals das gefaltete Klopapier nehmen“. Weil „zunächst das gesamte Hotelzimmer gereinigt werde, ehe die kleine Ecke in das Toilettenpapier gefaltet wird. Da sich das Reinigungspersonal nach dem Putzen meist nicht die Hände wäscht, sei genau dieses Eck der Klopapierrolle so unhygienisch.“
Besagtes Zimmermädchen rät deswegen: „Lieber zwei bis drei Lagen der Toilettenpapierrolle abwickeln und wegschmeißen. Verwenden sollten Sie das gefaltete Dreieck aber ganz bestimmt nicht.“ Ich finde das übertrieben, so wie im Übrigen auch die genbasierten Injektionen zur Manipulation unserer Körperzellen, damit sie das Spikeprotein des Sars-CoV-2 Virus abwehren.
.
Fakes
„Fake it until you make it“ – „Tue so, als ob, bis du es kannst“ – ist eine Art Leitmotiv in der Startup-Szene des Silicon Valley. Im Versuch, Investoren anzuziehen, beschönigen viele Gründer ihre Erfolgsaussichten massiv, heißt es in der Neuen Zürcher Zeitung über die „erfolgreichste Gründerin im Silicon Valley“ Elizabeth Holmes. „Doch statt mit ihrem Startup Theranos Bluttests zu revolutionieren, betrog sie Investoren um Hunderte Millionen Dollar.“ Ihr drohen nun „Zwanzig Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von mehreren Millionen Dollar“.
„Tue so, als ob, bis du es kannst oder bis du als Nichtkönner auffliegst“ – dieses Leitmotiv könnte auch für die Plagiatoren unter den Verfassern von wissenschaftlichen Haus-, Diplom und Doktorarbeiten gelten, allemal für die vor einiger Zeit aufgeflogenen Topjournalisten der Süddeutschen Zeitung und des Spiegels, die Interviews und Ereignisse in ihren Artikeln fakten – erfanden.
Über den mit Preisen geehrten Spiegel-Reporter heißt es in der FAZ: Er habe „in der unverrückbaren Überzeugung geschrieben, es würde bei der Erzählform Reportage keinen Unterschied machen, ob alles 1:1 der Realität entspricht oder nicht“. Über den SZ-Hollywoodreporter heißt es im Spiegel: Er weiß, „dass dieser Riesenskandal, über den Chefredakteure stolperten, für den Rest seines Lebens im Raum stehen wird wie ein Elefant in einer Einzimmerwohnung.“ In der SZ muß man seitdem als Autor jeden Text fünf Mal beglaubigen. Ihr ehemaliger Starjournalist, der heute Tennislehrer ist, schrieb ein Buch über sein aktives Leben, das als „Tenniscoach beim TC Weiß-Rot-Neukölln“ begann, und seine Hollywood-Fakes, über das der Spiegel urteilte: „Der Lügenquatsch kommt darin vor, relevant ist er in seinem ‚intensiven‘ Roman nicht.“
Anders als in der ehrpusseligen Wissenschaft und im wahrheitsgetreuen Journalismus ist der Fake in der Kunst ein anerkanntes Verfahren, mindestens gibt es eine „Kunst des Fake“, über die der Westberliner Künstler Ernst Volland ein Buch, unter dem nämlichen Titel, veröffentlichte. Diese „Kunst“ versteht sich als eine Form der Aufklärung – und zwar von unten. Es gibt auch eine – wenig emanzipatorische – Form dieser Kunst von oben: Die Konstantinische Schenkung oder die Emser Depesche beispielsweise.
In der Verlagsankündigung heißt es über das Buch „Kunst des Fake“: „Der Künstler Ernst Volland beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Fake. Er beobachtet sie im Alltag, findet sie in den Medien oder entwirft einen Fake. Dafür schickt er vermeintliche Kinderzeichnungen an Politiker und Bischöfe oder schenkt der Nationalgalerie das Bild eines fiktiven Künstlers. Sein Ziel: mit subversiven Nadelspitzen die Mächtigen herausfordern.“
Das gilt auch für die als „Kommunikationsguerilla“ Fakes bei den Mächtigen inszenierenden Gruppen „Yes Men“ und „Peng-Kollektiv“.
Bei Wikipedia erfährt man: „Ernst Volland, geboren 1946 in Bürgstadt/Miltenberg, ist ein deutscher Künstler, Karikaturist, Kurator und Autor. Er setzt sich mit historischen Fotos auseinander; etwa in seiner Serie ‚Eingebrannte Bilder‘ entfremdet er ikonische Fotos, die im kollektiven Gedächtnis gespeichert sind.“ Einiges davon erinnerte mich an Bilder von Gerhard Richter. Volland fakte sie jedoch nicht.
Einen Fake, in dem es um einen dritten „Fettstuhl“ von Joseph Beuys in Amsterdam ging, erzählt der Künstler in seinem Buch: „Der Fake konnte nicht realisiert werden, er scheiterte an den Umständen. Wichtig ist es bei einem Fake, eine Spur zu legen mit einer glaubwürdigen Legende“ – d.h. mit plausiblen „Facts“. Die Pressesprecherin von Trump prägte in diesem Zusammenhang das schöne Wort von den „alternativen Fakten“. Und das im faktengläubigen Amerika. In bezug auf die gefakte Amsterdamer Kunstaktion von Ernst Volland hieß dies: „Hier stellte die Aktivität von Beuys, seine Anwesenheit in der holländischen Galerie, den realen Hintergrund. Warum sollte Beuys nicht drei Fettstühle produziert haben?“
Derzeit ist viel von „Fake-News“ die Rede, also von falschen Nachrichten, die im Internet verbreitet werden – und alle, die es besser wissen, rufen sofort empört :„Fake News!“. Der Sender n-tv meldete kürzlich empört: „‘Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock will nicht Haustiere verbieten‘ – doch diese und andere Falschnachrichten über die Politikerin verbreiteten sich in sozialen Netzwerken und Medien. Einer Studie zufolge ist vor allem die Grünen-Chefin von solcher Desinformation betroffen…Unter den drei Bewerbern für das Kanzleramt entfielen 71 Prozent der falschen oder irreführenden Angaben auf Baerbock, hieß es in einer Studie des Kampagnennetzwerks Avaaz.“
Diese in den „sozialen Netzwerken“ nach Fakes fahndende Gruppe hat einen Kampagnendirektor, der laut n-tv alle Akteure aufforderte (nicht die Fake-News-Produzenten sondern die wahren News-Macher!), sich die Frage zu stellen, ob sie nicht „gerade den Verbreitern von Falschnachrichten in die Hände“ spielten, wenn sie „ihre Lügen aus Facebook-Gruppen und Telegram-Chats auf die Fernsehbildschirme und Handydisplays von Millionen deutschen Wählern und Wählerinnen bringen“. Direkt in ihre Gehirne.
Aber ob nun wahre oder gefakte News: Ich glaube einfach „Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock will nicht Haustiere verbieten“. Warum auch?!
.
Paradiese
Das menschenentleerte Gebiet von Tschernobyl erweist sich für die Pflanzen- und Tierwelt als ein „wahres Paradies“, wie Biologen diese „Todeszone“ nennen. Ein Vogelbeobachter, mit dem ich den Vogelpark Walsrode besuchte, meinte: „Das ist ja wie im Paradies hier.“
Wir besuchten einmal einen Kibbuz am See Genezareth. Als wir im Eßraum saßen, meinte eine neben mir sitzende Kibbuznikim: „Ihr seid doch an unserer Bananenplantage links abgebogen und zum Haupteingang reingekommen, wenn ihr geradeaus gefahren wärt, wärt ihr da hingekommen, wo einst das Paradies war, aus dem Adam und Eva vertrieben wurden.“ Ich wußte auf diese überraschende Lesart der Bibel als Kataster nichts zu antworten.
Wikipedia beantwortete die Frage, wo das Paradies auf Erden, der in der Genesis beschrieben Garten Eden ist, so: „Obwohl es auf der Erde lokalisiert ist, verspricht es neben sinnlichen Genüssen und Kostbarkeiten das ewige Leben, wobei hier die Einschränkung gilt, dass das ewige Leben auf den Aufenthalt im Garten beschränkt ist,“ der quasi kultiviert – nichts Wildes ist. Weswegen dort auf allen bildlichen Darstellung Löwen, Schafe und Menschen, Rinder und Gräser friedlich nebeneinander leben. Das biologische Gesetz „Leben heißt töten“ gilt dort nicht.
Konkret soll sich laut Wikipedia der „Garten Eden im Südosten Anatoliens, nahe der heutigen Stadt Sanliurfa“ befunden haben. Das meinte 2009 auch die BZ, wobei sie sich auf (amerikanische?) „Wissenschaftler“ berief: „Forscher entdeckten Garten Eden“. Im selben Jahr habe ich nebenbeibemerkt den Garten von Rolf Eden, dem einzigen Westberliner Rolls Royce Fahrer, in Zehlendorf entdeckt.
Die Zeugen Jehovas geben auf ihrer Internetseite zu bedenken, das schon „so manche Forscher behaupteten, sie hätten das verlorene Paradies wiedergefunden. Die Suche nach dem ‚Paradies auf Erden‘ zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte.“ Sie meinen: „Da man heute wohl kaum von einem Paradies auf Erden sprechen kann, stellt sich die Frage: Wird sich diese Verheißung irgendwann erfüllen?“ Also wird es das Paradies wenigstens in Zukunft geben? Sie sind da optimistisch: Wie in Matthäus 6:10 versprochen, wird das „Königreich mit Jesus Christus als König über die ganze Erde herrschen und alle Regierungen auf ihr ersetzen (Daniel 2:44). Es wird dafür sorgen, dass Gottes Wille geschieht und die Erde wieder zu einem Paradies wird.“ Auch der Psalm 115:16 und Titus 1:2 versichern: Die Hoffnung auf ein Paradies auf Erden kommt von „Gott, der nicht lügen kann“.
In dem kleinen Buch der in Wien und Damaskus lebenden Luna Al-Mousli „Als Oma, Gott und Britney sich im Wohnzimmer trafen – oder Der Islam und ich“ (2018) schreibt die Autorin, sie habe in ihrem Religionsunterricht gelernt, dass die Kaaba in Mekka ein Stein aus dem Paradies sei, Luna Al-Mousli mutmaßte, dass dann ja wohl das Paradies „irgendwo im Weltall“ liegen müsse (denn die Wissenschaftler gehen ja davon aus, dass es sich bei dem Stein, den zu berühren für die gläubigen Moslems das Höchste ist, um einen Meteoriten handeln würde. Er ähnelt den auf Grönland gefallenen, aus denen die Inuit ihre Eisenwerkzeuge schlugen, drei wurden ihnen allerdings 1897 von US-Wissenschaftlern für das Museum of Natural History geklaut).
Als Luna Al-Mouslis Oma und Opa von ihrer Pilgerreise nach Mekka zurück kamen, brachten sie in Flaschen abgefülltes heiliges Wasser aus einer „besonderen Quelle“ mit: „Man erzählte, es käme direkt aus dem Paradies“. Und also konnte dieses eigentlich nicht „irgendwo im Weltall“ liegen – aber wo? Ungeachtet dessen sagte man ihr, „wenn man in einer großen Masse betet, bekäme man mehr Hasanat – das sind die guten Karma-Punkte, die einen ins Paradies bringen“. Sicher war sich die Autorin nur, dass es Opas selbst gemachte „Marillenmarmelade“ auch im Paradies gibt. Von ihrer Oma erfuhr sie: „Seit Adam und Eva lastet auf uns Frauen die Schuld, die Frucht gepflückt und so die Menschheit aus dem Paradies vertrieben zu haben. Das stimmt aber nicht. Adam und Eva griffen gleichzeitig zu.“
Am Schluß ihres Buches kommt Luna Al-Mouslis Vorstellung vom Paradies der Einschätzung der Biologen, dass die menschenentleerte Todeszone von Tschernobyl ein „wahres Paradies“ sei, nahe: „Wahrscheinlich waren alle Lebewesen im Paradies froh, als Adam und Eva auf die Erde mußten und das Paradies wieder ein Ort der Ruhe und des Friedens war.“
Neben der Vertreibung aus dem Paradies gibt es auch eine Hintreibung: In Kevin Bakers Roman „Die Straße zum Paradies“ (2004) ist dies die gewalttätige „Paradise Alley“ im Armenviertel von New York. In Antti Tuuris Roman „Strasse ins Paradies“ (2019) ist dies ein Schotterweg, auf dem des Kommunismus verdächtige Finnen von der rechtsextremen Lapua-Bewegung über die Grenze in die Sowjetunion, dem „Paradies der Werktätigen“, abgeschoben werden.
Die evangelische Theologin Nadja Papageorglu führte 2014 in ihrer Predigt „Wo ist das Paradies“ aus: „Der Schweizer Theologe und Orientalist Othmar Kehl meint, man könne genauso gut versuchen, den Stein der Weisen mineralogisch zu bestimmen wie den Ort des biblischen Paradieses geografisch zu verorten. So ist es mit dem Paradies. Es gibt es hier auf Erden. Und es ist nichts als eine Idee, eine Phantasie, ein Traum, der zu verschiedenen Zeiten für verschiedene Menschen verschiedene Namen hatte.“ Im Koran sei das Paradies ein Ort, „wo die Früchte so gross sind, dass sie Schatten werfen und in den Bächen neben klarem Wasser Milch und Honig fliesst.“ Das Paradies sei also das Schlaraffenland, wo einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Das christliche Paradies befände sich dagegen „am Ende der Zeit“ und sei „die Belohnung für ein anständig gelebtes Leben. Gemeinsam ist den Paradiesen, dass das Wetter mild und das Essen reichlich ist.“ Für nicht wenige männliche Gläubige ist es darüberhinaus voller Jungfrauen, die zu jeder Schandtat bereit sind.
Das Paradies als eine bloße Phantasie abzutun, ist ein Resultat der aufgeklärten Moderne. In Christine Wunnickes Roman „Die Kunst der Bestimmung“ (2021) ist von einem schwedischen Taxonomen die Rede, der das Durcheinander in der „Wunderkammer“-Sammlung der Londoner Roxal Society nach den Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaft ordnen soll. Dazu erklärte er der Gesellschaft: „Sammeln heißt ergänzen und ergänzen heißt verstehen. Wenn wir verstehen, was wir haben, verstehen wir, was uns fehlt…Wir haben eine mexikanische Bettwanze und ergänzen eine Bettwanze aus der Paternoster Row.“ Auf diese Weise wollte er alle Naturobjekte in eine sinnvolle Ordnung stellen.
Neben dem Taxonomen gab es noch einen Mann, der im Hatton Garden „das Paradies ausstellte“. Es war ein Zelt und der Eintritt kostete 15 Penny. „Tiere, Pflanzen und Gestein, alles war auf Holz oder Stoff gemalt und dann ausgesägt und aufgespannt. Der Besitzer des Paradieses ging darinnen umher und sagte Gedichte zu jedem Tier und jeder Pflanze…Das Zelt platzte aus allen Nähten. Es war ein großes Durcheinander im Paradies.“
Als der Schwede die Sammlung der Royal Society geordnet hatte, bekam der „Paradiesmensch“ darin eine Anstellung als Führer für die Besucher. „Mit einem Zeigestock und vielen Versen half er ihnen, die Ordnung der Dinge zu begreifen.“ Der Schwede hatte das wahre „Paradies ausgeheckt, dies muß er nun mit Umsicht bestellen,“ meinte einer Gelehrten aus der Gesellschaft. Der „Paradiesmensch“ scheint sich der wissenschaftlichen Ordnung untergeordnet zu haben. Das war später nicht immer der Fall, dass der leidenschaftliche Sammler dem strengen Wissenschaftler weichen mußte.
Im Jardin des plantes gab es mit der Institutionalisierung der Funktion eines Professors, der dozierte, und eines “demonstrateurs”, eine Hierarchie der Wissenden, die ihre Konflikte bisweilen offen austrugen: Während z.B. der Professor Bourdelin seine Vorlesung mit den Worten beendete: “…Wie Ihnen der Herr Demonstrateur durch seine Experimente sogleich beweisen wird”, begann der Demonstrateur Rouelle, er wurde später Mitbegründer der Chemie in Frankreich, mit den Worten: “… Alles, was der Herr Professor gesagt hat, ist absurd und falsch, wie ich Ihnen sogleich beweisen werde.”
Es gab später von den Deutschen auch den Versuch einer Neuordnung der menschlichen Gesellschaft nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten. Die Nazis nannten das „Pazifizierung“, was hieß, das in den von der Wehrmacht besetzten Ostgebieten immer größere Teile der Bevölkerung getötet wurden. In ihrem Buch über „Albert Speer“ (1995) schreibt Gitta Sereny, dass Hitler am 16.Juli 1941 bei einer Unterredung mit Göring, Lammers, Rosenberg und Keitel die Verstärkung des „Pazifizierungsprogramms“ hinter der russischen Front befahl. „Deutschland“, meinte er, „werde sich nie mehr aus den neugewonnenen Ostgebieten zurückziehen, er wolle dort ein ‚Paradies‘ schaffen.“
Das hieß: „Eine saubere, durch Vertreibung, Vernichtung geschaffene Fläche. Eine Fläche der Reinheit, eine Fläche der Zugehörigkeit,“ wie es beim Philosophen Michel Serres heißt.
.
Götterbäume
Der chinesische Götterbaum, auch Baum des Himmels genannt, ist in Berlin der häufigste Laubbaum, Millionen gibt es davon und alle Ausrottungsaktionen helfen nicht, denn der Götterbaum ist klug, wenn man so sagen darf: Das Götterbäumchen wächst an den unmöglichsten Stellen aus Spalten zwischen Gehsteig und Mauerwerk heraus und kommt listig inmitten von Hecken hoch. Und es wächst schnell. Fast kann man sagen, es breitet sich heimlich aus: eine „gelbe Gefahr“ quasi, denn inzwischen zählt man Ailanthus altissima zu den „100 schlimmsten invasiven Arten“.
Ich sehe ihn nicht so. Der preußische General-Gartendirektor Peter Joseph Lenné pflanzte ihn vor etwa 250 Jahren in das Palmenhaus auf der Pfaueninsel. Wenn sein Stamm astlos ist, ähnelt der Götterbaum tatsächlich mit seiner Krone aus Fiederblättern einer Palme. Man nannte ihn erst „Trümmerbaum“ und dann auch „Ghettopalme“.
Adlige und Bürger fanden den Baum zunächst attraktiv und pflanzten ihn in ihren Wintergarten oder auf ihrem Grundstück. Er gedieh auch, vermehrte sich jedoch nicht. Erst 1945 – als Berlin in Schutt und Asche lag – fing der Götterbaum an, sich hier zu verbreiten – und wie. Nach dem Mauerfall hat seine Berliner Population noch einmal enorm zugelegt. Die Gärtner raten, Götterbäume nur in Betoneinfassungen auszupflanzen. Der anspruchslose und widerstandsfähige Götterbaum breitet sich nämlich unterirdisch aus, bis zu drei Meter im Jahr, daneben aber auch durch Samen. Dazu braucht es mindestens zwei Götterbäume, denn sie sind getrenntgeschlechtlich.
Um aus dem Zierbaum eine Nutzpflanze zu machen, führte man in Wien einst neben dem Götterbaum, u.a. zur Bepflanzung der Ringstrasse, auch den Götterbaum-Spinner ein: ein schöner brauner Nachtfalter aus China, der an den Flügelenden eine schlangenaugenähnliche Zeichnung hat. Seine Raupen leben von Götterbaumblättern. Nach ihrer Verpuppung läßt sich aus ihrem Kokon eine Seide – die sogenannte „Eri-Seide“ – herstellen: haltbarer und billiger als die übliche, schreiben Heiderose Häslers und Iduna Wünschmanns in ihrem Buch „Berliner Pflanzen“ (2010), das mich für den chinesischen Götterbaum, diesen „angenehmen Schattenspender“, begeistert hat.
Man kann sagen: der Götterbaum und der Ailanthus-Spinner leben in einer engen Beziehung, auch wenn letzterer nicht zur Befruchtung der Baumblüten beiträgt, sondern nur seine Raupen sich von den Blättern ernähren läßt, die ihre einzige Nahrung bilden, denn als Schmetterling (Imago) nimmt er keine Nahrung mehr zu sich. Man kann deswegen noch weiter gehen und sagen: Dieser Falter ist eine Ausweitung des vom Tageslicht lebenden Götterbaums in die nächtliche Luft…Ein Spaß, den der Baum sich etliche Blätter kosten läßt. Ein Wiener Götterbaum hinter einer Kirche wird sogar freudig von den Menschen besucht und fotografiert, wenn ab Herbst die Puppen des Ailanthus-Spinners zum Überwintern in langen Trauben von seinen Zweigen hängen. „In Indien werden die Puppen gegessen, in Nepal als Hühnerfutter verwendet.“
Gar keine Freude machen dagegen die dumm-rabiaten Feldzüge gegen den Götterbaum – statt nun auch hier „seinen“ Schmetterling einzuführen, dessen Raupen ihn mindestens bremsen würden. In der besonders agressiv gegen invasives Leben vorgehenden Schweiz hat man kapituliert: Nun will man den Götterbaum dort nicht mehr vernichten, sondern an Berghängen pflanzen – als Lawinenbremse.
Der Westberliner Invasionsbiologe Ingo Kowarik schreibt: „Seine Bekämpfung hat im Mittelmeerraum bereits hohe Kosten verursacht. Als wirksame Methode zu seiner Vernichtung erwies sich, den Baum zu fällen und die Austriebe mit Glyphosat (Monsanto) zu behandeln. In den USA setzt man den Rüsselkäfer Eucryptorrhynchus brandti ein, um ihn biologisch zu bekämpfen.“ Auch der Widerstand der Bürger gegen dieses zu riesigen Bäumen sich ausweitende Unkraut wächst: Immer öfter greifen sie heimlich zur Axt. Und am nächsten Tag gibt es wieder einen Göttterbaum weniger. Gelegentlich beauftragen auch die Grünflächenämter eine Firma damit, z.B. eine Verkehrsinsel von den wuchernden Götterbäumen zu „befreien“. Der Götterbaum ist relativ resistent gegen Salz, Trockenheit und Herbizide und toleriert den von urbanen Luftverunreinigungen ausgehenden Stress oft besser als viele andere Stadtbäume. Ein drei bis fünf Meter hoher Straßenbaum kostet mit Pflege rund 1200 Euro. Berlins Stadtbäume wie Eichen, Rosskastanien und Platanen leben oft nicht lange. „Sie brauchen viel Wasser,“ schreibt die Welt. „Dazu kommen Belastungen durch Abgase, weniger Nährstoffe durch kleine natürliche Bodenflächen, weniger Licht, Streusalze und Hunde-Urin. Seit Jahren gibt es einen stetigen Baumverlust in der Stadt, der aus Kostengründen nicht mehr durch Neuanpflanzungen ausgeglichen werden kann.“ Stattdessen hofft die Stadt auf Sponsoren und initiiert schon mal kleine Crowdfunds, die so erfolgreich sind, dass die Hauptstadtpresse melden kann: „Neuer Stadtbaum gepflanzt.“
„An der Humboldt Universität empfehlen Wissenschaftler, Bäume anzupflanzen, die dem Klimawandel besser gewachsen sind. Seit 2010 haben sie rund 80 Baumsorten geprüft. In Versuchen versorgten sie einige frisch gepflanzte Bäume optimal, andere aber setzten sie einem moderatem oder akuten Trockenstress aus. Außerdem untersuchten sie deren Anfälligkeit für Krankheiten und Schädlinge.“ Die Tests gehören zu einem Forschungsprojekt der Humboldt-Universität und dem Innovationsnetzwerk Klimaanpassung Brandenburg Berlin. Den ebenso kostenfreien wie widerstandsfähigen Götterbaum haben sie natürlich nicht getestet – diese Penner.
.
Aschenbecher
Den Umschlag des Buches von Tom Schmieder „Als wir einmal fast erfolgreich waren“ (2021) zieren neben einigen linken Symbolen Gläser und Aschenbecher. Seine Geschichte beginnt im Jahr 1979. „Erfolgreich“ waren „wir“ im Westen jedoch nur bis zum Pariser Mai 1968, danach griff hier langsam Willy Brandts Bildungsreform, die zum Einen die jungen ArbeiterInnen mit dem „Begabtenabitur“, bei dem niemand durchfallen konnte, an die Unis brachte und zum Anderen mehr als ein Dutzend „Reformuniversitäten“ aus der Erde stampfte, anfangs sogar mit drittelparitätisch besetzten Gremien. Für die Planung dieser Unis wurden zig linke „Rädelsführer“ eingestellt – und damit war die „antiautoritäre Bewegung“ wieder in die Hochschule zurückgedrängt.
Es geht mir hier jedoch um die Aschenbecher, die der Autor zu Recht auf seinem Buchumschlag abgebildet hat. In allen Seminarräumen, an den alten wie den neuen Unis, standen Aschenbecher auf den Fensterbänken – und zwar leere Fischkonservendosen. In den „WGs“ fand sich ein Sammelsurium von Aschenbechern aus den Elternhäusern: aus Glas, Metall, Keramik, mit Werbesprüchen oder Urlaubsortmotiven, rund, eckig, flach, hoch, klein, riesig, mit Abdeckung und ohne... In den Kneipen waren es oft solche mit dem Logo einer Brauerei oder einer Zigarettenfabrik, die sie den Wirten als Werbegeschenk mitgaben. In der Außengastronomie bewährten sich wegen gelegentlicher Windböen die billigsten Aschenbecher, die aus einem umgedrehten Blumentopf mit Untersatz bestanden. In den Behörden standen in den Wartezimmern bzw. -ecken Stand-Aschenbecher – der unterschiedlichsten Machart; in der DDR bestanden sie einheitlich aus Aluminium (wo sind die bloß alle geblieben?).
Stand-Aschenbecher braucht heute – seit dem Rauchverbot 2008 – jede Behörde und jede Firma: „Herumliegende Kippenstummel vor Ihrer Eingangstür? Das muss nicht sein“ – mit diesem Spruch wirbt z.B. ein Unternehmen im Internet, das alleine 70 verschiedene Standaschenbecher anbietet, sie heißen „Eurokraft“. Anfangs lagen vor oder neben den Eingangstüren der Bürokomplexe und den U-Bahnhöfen jede Menge Kippen, weil es nicht genug orangene Abfallbehälter der (Berliner) Straßenreinigung gab. Ich entschuldige mein gelegentliches Kippenaustreten damit, dass ich ohne Filter rauche und ein Regentropfen genügt, um die Kippe zu zerbröseln. Während die mit Filter 10 bis 15 Jahre brauchen, um sich zu zersetzen.
Eine zeitlang wohnte ich in der Nähe von Arezzo, wo man sogar im Supermarkt rauchen konnte. Als ich dort eine Handverletzung operieren lassen mußte, in der Nacht und auf die Schnelle, mußte der Chirurg von einer Wildschwein-Jagdfeier geholt werden. Er rauchte und stellte den Aschenbecher auf meiner Brust ab. Für die trotz seiner „lustigen“ Gestimmtheit gelungenen Operation mußte ich dafür in der kommunistischen Toskana nichts bezahlen. Sie wollten noch nicht einmal meinen Namen wissen, obwohl sie mich danach noch über Wochen betreuten – d.h. meinen eingegipsten Daumen. Einmal ging ich ins Krankenhaus und der große Hof war voll mit Männern, die rauchten. Alle hatten irgendetwas eingegipst: einen Arm, einen Oberschenkel, einen Fuß, die Brust…Ich mußte stets zur selben OP-Assistentin gehen. „Was ist denn da passiert?“ fragte ich sie auf den Hof zeigend – und bekam zur Antwort: „Die Motorsägen-Saison hat angefangen!“
Der Hof der Klinik in Arezzo war voller Aschenbecher und Schilder, die auf sie hinwiesen – mit roten Pfeilen. Ich vermutete damals, dass sie der Hausmeister gemalt und angebracht hatte. Man könnte jetzt von da aus leicht auf meine Recherche über „Hausmeisterkunst“ zu sprechen kommen, die ich in meiner „Pollerforschung“ als interessanteste Untergruppe kennengelernt hatte, aber das würde zu weit führen. Obwohl es natürlich jede Menge aus unterschiedlichen Materialien selbstgebaute Stand-Aschenbecher in Pollerform gibt. Wie umgekehrt die Metallpoller an den Straßenrändern sobald ihnen die Kappe fehlt als Aschenbecher benutzt werden.
Die Kneipenwirte wundern sich immer wieder, warum es auf den Damen-Toiletten schmutziger ist als auf den Herren-Toiletten, sie hatten das Umgekehrte erwartet. Erforscher der „Dritten Orte“ fanden heraus, dass die Damen sich dort gerne mit anderen Frauen unterhalten und dabei rauchen, wobei sie einigen Abfall hinterlassen. Es gab dort keine Aschenbecher oder wenn, dann zu wenig. Den Männern schien es dagegen eher peinlich zu sein, auf der Toilette angetroffen zu werden. Männerkonkurrenz und gleich daneben Frauensolidarität?
In den Autos hat man die Aschenbecher abgeschafft, wer rauchen will, der muß sich einen kaufen, bei ebay bekommt man für 7 Euro 64 einen „Auto Aschenbecher mit LED Windaschenbecher mit Deckel Gluttöter für draußen“. Einmal bekam ich zum Geburtstag einen kleinen Windaschenbecher mit Deckel Gluttöter geschenkt, aber schon am nächsten Tag im Großraumbüro hat ihn mir jemand geklaut.
Kann es sein oder trügt mich da meine soziale Phantasie, dass es mit der Aschenbecher-Kultur langsam zu Ende geht? Die Unbeugsamen sterben langsam aus. Ich kann mich noch erinnern, dass Frank Castorf in der Volksbühnen-Kantine lange nach dem Rauchverbot sagte: „So lange ich Intendant bin, darf hier geraucht werden.“ Dort standen große Porzellan-Aschenbecher auf den Tischen, so ähnlich wie die im Westen auf den „Stammtischen“ der Kneipen, die einen Tragegriff hatten, auf dem „Stammtisch“ stand. Erwähnt sei noch der Humboldt-Professor Friedrich Kittler: Wenn er ins Seminar kam, erschien hinter ihm sein Mitarbeiter Peter Geble mit zwei Stapeln Aschenbecher, die er im Raum verteilte. Meine ersten Vermieter eines möblierten Zimmers in Westberlin, zwei alte Frauen, riefen, auf meine Frage, ob ich im Zimmer rauchen dürfe: „Rauchen Sie, rauchen Sie, das hält die bösen Geister fern.“
Jetzt muß man meistens auf den Balkon gehen. Früher kannten wir so etwas gar nicht – einen Balkon, meine ich. Wozu auch? Die Publizistin Barbara Ehrenreich erwähnt in ihrem Buch „Wollen wir ewig leben?“ (2018) Arbeiter, Krankenschwestern und alleinerziehende Mütter, für die die „Zigarettenpause“ fast lebenswichtig ist. Vor einiger Zeit besuchte ich mit einem amerikanischen Freund London. Überall in den Ecken und Hauseinangängen standen kleine Gruppen von Frauen. Mein Freund konnte es nicht fassen, wie viele Prostituierte es allein in der City gab, bis wir heraus bekamen, dass es Sekretärinnen und Arbeiterinnen waren, die draußen eine Rauchpause eingelegt hatten. In den ersten Jahren nach dem Rauchverbot sprachen die Arbeitgeber von einer „betriebswirtschaftlichen Belastung“ durch diese vielen Abwesenheiten der Raucher vom Arbeitsplatz. Arbeiten oder Rauchen war zu einer Alternative geworden, während zuvor das Rauchen der Arbeit zugute gekommen war.
Von einem alten Freund, der viel dichtet und fast Kettenraucher ist, erfuhr ich, dass seine Freundin ihn ab und zu daran erinnert, dass er bei „Parship“ in der Rubrik Rauchen „gelegentlich“ angekreuzt habe. Abschließend könnte man vielleicht noch den Gedanken anbringen: Vor den Rauchern sterben die Aschenbecher.
.
Javaanse Jongens
Ich rauche „Javaanse Jongens“ (Klassik), wobei ich darauf achte, dass ich Packungen kaufe, auf denen nur vor Erkrankungen von weiblichen Organen gewarnt wird, die ich nicht habe.
Bei den auf Ebay angebotenen Javaanse Jongens Packungen hat man die Wahl zwischen: „Rauchen mindert ihre Fruchtbarkeit“, „…verstopft ihre Arterien“ und „…erhöht das Risiko zu erblinden“. Der taz-Autor Detlef Kuhlbrodt wollte einmal alle Abschreckungsbilder auf den Tabakprodukten ausstellen, die Idee gefiel mir, sie zu realisieren fand ich jedoch unnötig.
Auf den Javaanse Jongens-Tabak haben mich einst zwei alte Damen gebracht, bei denen ich mein erstes – möbliertes – Zimmer in Berlin genommen hatte. Ich fragte sie, ob ich im Zimmer rauchen dürfe. Sie sagten: „Rauchen Sie, rauchen Sie, das hält die bösen Geister fern.“ Das hätte ihnen ein US-Soldat versichert, der Indianer war, von denen ja das Tabakrauchen käme. Später lobten sie den Geruch, den meine filterlosen Javaanse Jongens-Zigaretten verströmten.
Seitdem ist die 50-Grammpackung, die 3 DM 70 kostete, auf 7 Euro 60 gestiegen und enthält nur noch 30 Gramm. Der Hersteller hat mal die Preise erhöht und mal den Inhalt reduziert.
In Djakarta, das ich nach dem indonesischen Bürgerkrieg infolge der weltweiten „Finanzkrise“ besuchte, wurde ich ebenfalls auf meinen Javaanse Jongens-Tabak angesprochen – von einer Künstlergruppe, die mit vielen anderen einen Park gegenüber vom Hotel Interconti legal besetzt hatten und Kaffee, Kuchen und Kunst anboten. Sie baten mich, ihnen die leere Packung zu überlassen, sie wollten damit Kunst machen. Das Bildmotiv hatte es ihnen angetan, es zeigte zwei sitzende „Javanische Jungen“ in traditioneller Kleidung, die jeweils eine Zigarette halten. Einer der indonesischen Künstler meinte: Dass die Holländer den Verlust ihrer Kolonie noch immer nicht akzeptieren können, sei traurig.
Er hatte insofern recht als der indonesische Tabak um 1910 von einem Groninger Kaufmann namens Theodorus Niemeijer als „Javaanse Jongens“ auf die sich in Europa rasch ausbreitenden Märkte für Kolonialwaren gebracht worden war. Seine Firma wurde 1999 aber vom Weltkonzern „British American Tobacco“ (BAT) übernommen, der laut Wikipedia mehr als 200 Marken im Angebot hat und 2014 weltweit 667 Milliarden Zigaretten verkaufte.
Von den Künstlern, die ihre Collage mit meiner Javaanse Jongens Packung schon ein paar Wochen später im Ostberliner Postfuhramt ausstellten, erfuhr ich dann noch, dass infolge der indonesischen Finanzkrise und des Bürgerkriegs Millionen Indonesier arbeitslos geworden waren, deswegen wurden die Maschinen für die Zigarettenherstellung ausgestellt und bedürftige junge Mädchen eingestellt, die die Zigaretten per Hand drehten.
Der indonesische Tabakkonzern Gudang Garam zählt zu den weltgrößten, ist allerdings auf Nelkenzigaretten (Kretek) spezialisiert. Die Gewürznelken-Beigabe soll das Asthma bei den Rauchern lindern, in Europa und in den USA sind sie dennoch verboten, dort bezieht man die Kretek aus Kanada. Der indonesische Bürgerkrieg bewirkte, dass der Diktator Suharto und sein Sohn Tommy das Gewürznelken-Monopol verloren. Als groß gilt auch noch der südkoreanische Tabakkonzern KT&G und der indische Konzern ITG. Angeblich arbeiten 50 Millionen Menschen in Indiens Tabakindustrie. Dort werden die Zigaretten aus grünem Tabak (Bidis) traditionell per Hand gerollt.
Der BAT-Konzern ist ein 1902 gegründetes „Gemeinschaftsunternehmen“ der britischen Imperial Tobacco Company und der American Tobacco Company. Erstere war zunächst in den englischen Kolonien Indien und Ägypten vertreten, dann aber auch in Nordeuropa und Indonesien. 1919 errichtete BAT eine Tabakfabrik in Shanghai, die wöchentlich 243 Millionen Zigaretten produzierte, 1937 waren es schon 55 Milliarden. Wenig später wurde die Fabrik von den Japanern enteignet und nach dem Sieg der Revolution von der Kommunistischen Partei Chinas übernommen.
Hierzulande errichtete BAT seine erste Tabakfabrik 1930 in Hamburg und brachte dann die Marke „Gold Dollar“ als „erste echte Vorkriegsmarke auf den deutschen Markt,“ heißt es auf Wikipedia. Danach kam die Marke „HB“. 1950 erwarb der Konzern die Orienttabake verwendende Zigarettenfirma Garbaty, die in Pankow produzierte, allerdings Ende der Dreißigerjahre arisiert worden war – zugunsten vor allem der Hamburger Zigarettenfirma von Philip Fürchtegott Reemtsma, die der Erbe Jan Philip Reemtsma 1980 an den Hamburger Kaffeefirma Tchibo verkaufte, was ihn zu einem der reichsten Männer in der BRD machte. Er gründete mit einem Teil seines Vermögens ein Sozialforschungs-Institut nebst Verlag in Hamburg. Tchibo verkaufte die Reemtsma-Tochter 2002 für sechs Milliarden Euro an „Imperial Brands“ in London.
1979 hatte British American Tobacco bereits das BAT-Freizeit-Forschungsinstitut in Hamburg gegründet, das 2007 in die Stiftung für Zukunftsfragen umgewandelt wurde. Heute ist British American Tobacco laut Wikipedia „Marktführer in über 50 Ländern und besitzt 45 Zigarettenfabriken in 39 Staaten. 2017 schloss BAT einen Kaufvertrag zur Übernahme des Konkurrenten R.J. Reynolds Tobacco Company“ (mit den Marken Camel, Lucky Strike, Winston und Pall Mall). Diese wurden bereits in den Sechzigerjahren auch in Europa produziert. Als Jugendliche waren wir damals derart amerikanisiert, dass wir uns gelegentlich die „echten“ aus den USA leisteten: Camel und Pall Mall, die es nur am Hauptbahnhof gab, für sechs bzw. neun DM die 12er-Packung.
1999 übernahm BAT den Tabakkonzern „Rothmans International“ mit den Marken Player‘s und Dunhill. Die Firma war ein großer Sponsor des Motorsports, vor allem des Porsche-Teams, was BAT zum Teil weiter führte.
Neben BAT gibt es noch die global player Imperial Tobacco Group (heute Imperial Brands), Japan Tobacco (mit Hauptsitz in Genf) und Philip Morris (heute Altria Group) mit der weltweit bekanntesten Marke Marlboro, die mit schwulen Nichtraucher-Cowboys wirbt, die von Millionen ihre Männlichkeit herauskehrenden Jugendlichen und Männern geraucht wird. Auf einer Wanderung durch Italien sah ich überall Männer, die eine Marlboro-Packung in ihrer Hemdtasche hatten, aber eine Billigmarke rauchten.
Zwischen 2003 und 2021 erwarb BAT Mehrheitsanteile an der Ente tabacchi Italiani, an der serbischen Duvank Industrija Vranje, an der türkischen Tekel, an der Scandinavian Tobacco Group, an der kolumbianischen Productora Tabacalera, an der kroatischen TDR, an der bulgarischen Bulgartabac, ferner gründete der Konzern BAT-Ghana und investierte 7,1 Millionen Dollar in die nordkoreanische Sogyong Trading Corporation. Außerdem gründete die BAT Financial Services mit der Zurich Insurance Company die Zurich Financial Services Group. Schließlich erwarb BAT auch noch Anteile am kanadischen Cannabis-Hersteller OrganiGram.
Philip Morris setzte dagegen mit seiner Tochterfirma iQOS auf „Heat-Sticks“, die den Tabak nicht verbrennen, sondern nur erhitzen, das reduziert zwar die „Schadstoffe“ aber nicht den Nikotingehalt. In Dresden entstand dafür bereits die erste Fabrik in Deutschland. „iQOS ist für uns die Zukunft“, meinte die Deutschlandchefin von Philip Morris.
All das sind Versuche, vom gesundheitsschädlichen Tabakverkauf auf neue Geschäftsfelder auszuweichen, falls die Warnungen auf den Packungen zu viele Raucher zum Aufhören motivieren; in Deutschland sind diese Warnungen verbunden mit einer Telefonnummer der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), die dazu Hilfe anbietet.
Die großen Tabakkonzerne geben viel Geld aus, um weitere Kampagnen gegen das Tabakrauchen zu verhindern: Die BAT z.B. 700.000 Euro für Lobbyarbeit allein in der EU-Bürokratie; in Rwanda, Burundi und im Kongo machte ein Whistleblower öffentlich, dass BAT Regierungsmitglieder bestochen hatte, um Niederlassungen der WHO-Tabakkontrolleure in Afrika zu verhindern, nur dort und in „unstabilen Ländern“ wie Irak, Syrien und Ukraine gibt es weltweit noch Marktzuwächse. Über ähnliche Geschäftspraktiken berichtete der Whistleblower aus Pakistan, wo BAT Politiker des Gesundheitswesens bestach, damit sie keine Warnungen auf den Zigarettenpackungen zuließen. Daneben bemüht sich BAT um andere Formen von Tabakwerbung und ist z.B. Sponsor des Londoner Symphonie Orchesters sowie diverser Cricket-Vereine, seine Marke Javaanse Jongens ist Sponsor des Rotterdamer Filmfestivals. 1997 gründete sich eine Dutch Hip hop-Band mit dem Namen „Javaanse Jongens“. Ob sie von der BAT dafür Geld bekommt, ist nicht bekannt.
Auf der anderen Seite mußten BAT und andere Tabakkonzerne Unsummen für Gerichtsprozesse ausgeben. 2003 durchsuchten 1000 Beamte den Hamburger Sitz der Reemtsma-Zigarettenfabrik, der unter anderem Zigarettenschmuggel, Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen wurde. 2004 verklagte die US-Regierung die größten Tabakkonzerne der Welt und forderte von ihnen 280 Milliarden Dollar, weil sie die Öffentlichkeit über die gesundheitlichen Risiken des Rauchens getäuscht hätten. Die Sammelklage wurde jedoch von einem Berufungsgericht in Florida verworfen. In England mußte BAT 650.000 Pfund für eine Strafe wegen Tabakschmuggel zahlen. In Neuseeland bekam BAT einen Preis als „schlimmstes Unternehmen Neuseelands“ verliehen usw..
Ich erinnere mich, dass Mitte der Neunzigerjahre die DDR-Erbauer der Gas-Pipline zwischen Urengoi und Ushgorod im Abschnitt Ural sowie vor der Grenze der Ukraine zur Slowakei davon sprachen, dass sie und ihr nach wie vor staatsfinanziertes Bauprojekt, das nach der Wende unter der Leitung einer bayrischen Baufirma fortgeführt wurde, davon sprachen, dass sie zukünftig selbst Anschlußaufträge zu aquirieren hätten, sonst müßten sie zurück nach Deutschland und wären dort arbeitslos. Als erstes bewarben sie sich bei „Reemtsmas“ Bau einer Zigarettenfabrik in der Ukraine. Die Tabakmanager hatten angeblich bereits zwei Jahre lang mit einem Haufen Geld auf die falschen ukrainischen Auftragnehmer gesetzt: Nichts war bisher passiert, deswegen rechneten die DDR- und russlanderfahrenen Pipeline-Bauer sich gute Chancen aus.
Zwar heißt es auf „tabakguru.de“, das Javaanse Jongens aus Virginia-, Burley- und Java-Tabaken besteht, neulich erfuhr ich jedoch von einem Lemberger Tabakwarenhändler, der in Berlin lebt, dass der Javaanse Jongens-Tabak aus ukrainischem Tabak bestehe. Das würde man auch schmecken. Und dass es demnächst Lieferprobleme geben werde. Dies gelte auch für die wegen des Krieges stillgelegte Charkiwer Philip Morris-Fabrik, wo die Marken L&M und Marlboro hergestellt wurden. In den Automaten würde es letztere oft schon nicht mehr geben. Der Tabakwarenhändler beruhigte mich jedoch: Javaanse Jongens werde es auch weiterhin geben, nur wahrscheinlich aus einer anderen BAT-Fabrik.
.

.
Rauchen
In den Partnersuchdiensten findet man hunderte und aberhunderte von Frauen, die eine „Liebe fürs Leben“ und „Abenteuer“ suchen, aber darauf bestehen: nur mit „Nichtrauchern“. Die Frauen, die das nicht angaben und nun mit einem Raucher liiert sind, bestehen meist darauf, dass ihr neuer Freund wenn schon, dann aber nur auf dem Balkon raucht, was im Winter und bei Regen ziemlich gesundheitsschädlich ist. Wenn der Raucher das geltend macht, bekommt er zu hören: „Dann hör doch einfach auf zu rauchen“. Als ich 1969 nach Berlin kam wohnte ich zunächst in einem Zimmer, das zu einer Wohnung von zwei alten Damen gehörte. Weil ich nicht wußte, ob ich dort rauchen durfte, fragte ich sie – und bekam zur Antwort: „Rauchen Sie, Rauchen Sie. Das hält die bösen Geister fern“.
Später lernte ich eine Frau kennen, die nichts dagegen hatte, dass ich nach dem Vögeln im Bett rauchte – aber nur in den ersten drei Nächten. Einmal interviewte ich einen Botaniker im Botanischen Garten und rauchte dabei. Ihm bot ich auch eine Zigarette an, woraufhin er meinte: „Nein danke, also Pflanzen verbrennen, das kann ich nicht, können wir hier alle nicht – bis auf eine Kollegin sind alle Wissenschaftler hier Nichtraucher, eigentlich merkwürdig.“
In vielen amerikanischen Orten ist das Rauchen inzwischen selbst auf der Straße verboten, und in München, wo man coronabedingt nun auch auf der Straße eine Schutzmaske tragen muß, verbietet sich das Rauchen quasi von selbst. Zudem steht auf jeder Zigarettenpackung „Rauchen tötet, macht impotent, versursacht Lungenkrebs…“ Mit Fotos von Schwerkranken. Dazu kommen die „Rauchen verboten“-Schilder, die überall in den Behörden und öffentlichen Räumen hängen. Bis in die Neunzigerjahre setzten sich einige Professoren noch darüber hinweg.
In Russland wurde während der Revolution auf den ganzen Versammlungen immer wieder über ein Rauchverbot abgestimmt und alle waren dafür, dennoch wurde weiter geraucht wie blöd.
Die slowenische Philosophin Alenka Zupancic schreibt in „Das Reale einer Illusion“ (2001), „dass der Kampf für ein Reales der Ethik zu wichtig ist,…um ihn den Moralisten zu überlassen.“ Was heute um so dringlicher erscheint, da die Ethik inzwischen zu einer der Ordnungsbegriffe der ’neuen Weltordnung‘ geworden ist. Dabei geht es ihr „nicht etwa um einen Aufruf ’nach unseren tiefsten Überzeugungen‘ zu handeln, eine Haltung, der heute eine Ideologie entspricht, die uns ermahnt, unseren ‚authentischen Neigungen‘ und unserem ‚wahren Selbst‘ Gehör zu schenken.“ Denn „das Kennzeichen einer freien Handlung liegt darin, dass sie den Neigungen des Subjekts ganz fremd ist“, wie Zupancic anhand ihres Traktats über Kant, der eine „Rückkehr zur Zukunft“ ist, herausarbeitet. Es geht ihr dabei um Kants „Ethik“, die im Zuge der Umwandlung des Sozialstaats zu einem Sicherheitsstaat, der mit kostengünstigen Gesetzen nur so um sich wirft, immer mehr in deren Dienste genommen wird: Und das eben ist die Scheiße!
Denn dadurch wird die Ethik etwas „im Kern Restriktives, eine Funktion“. Möglich wird dies laut Zupancic dadurch, dass man „jeder Erfindung oder Schöpfung des Guten entsagt und ganz im Gegenteil als höchstes Gut ein bereits fest Etabliertes oder Gegebenes annimmt (das Leben etwa) und Ethik als Erhaltung dieses Gutes definiert.“ Das Leben mag die Voraussetzung jeder Ausübung von Ethik sein, aber wenn man aus dieser Voraussetzung das letzte Ziel der Ethik macht, ist es Schluß mit der Ethik. Sie basiert nunmehr auf einer regelrechten Ideologie des Lebens.
„Das Leben sagt man uns, ist zu kurz und zu ‚kostbar‘, um sich in die Verfolgung dieser oder jener ‚illusorischen‘ Projekte verstricken zu lassen“. Die Individuen müssen sich immer öfter Fragen lassen: Was hast du aus deinem Leben gemacht? Du hast zehn Jahre mit einer Sache verloren, die zu keinem greifbaren Ergebnis geführt hat? Du hast keine Nachkommen? Du bist nicht einmal berühmt? Wo sind denn die Ergebnisse deines Lebens? Bist du wenigstens glücklich? Nicht einmal das! Du rauchst?“
Man wird nicht nur für sein Unglück verantwortlich gemacht, „die Lage ist noch viel perverser: das Unglück wird zur Hauptquelle der Schuldigkeit, zum Zeichen dafür, dass wir nicht auf der Höhe dieses wunderbaren Lebens waren, das uns ‚geschenkt‘ worden ist. Man ist nicht etwa elend, weil man sich schuldig fühlt, man ist schuldig, weil man sich elend fühlt. Das Unglück ist Folge eines moralischen Fehlers. Wenn du also moralisch sein willst, dann sei glücklich!“ – Und hör auf zu rauchen. Hör einfach auf.
Die Deutsche Krebsgesellschaft schreibt: „Das Rauchverhalten unterscheidet sich nach dem sozialen Status, der anhand des Bildungsniveaus, der beruflichen Stellung und der Einkommenssituation gemessen wird. Bereits seit einigen Jahrzehnten rauchen mehr Männer und Frauen mit niedrigem sozialem Status als mit hohem sozialen Status.“ Dies trifft sich mit amerikanischen Studien, die Barbara Ehrenreich in ihrem Buch „Wollen wir ewig leben?“ (2020) zitiert. Danach haben hart arbeitende Unterschichtler (Fabrikarbeiter, Krankenschwestern, Alleinerziehende) das Rauchen sogar bitter nötig: Eine Zigarettenpause ist für sie die einzige Möglichkeit, dem Stress für kurze Zeit zu entkommen. Aber auch Schriftsteller rauchen oft und gerne: Bei ihnen ist das Rauchen mit dem Lesen, Denken und Schreiben fast unlösbar verbunden. Wollten sie das Rauchen aufgeben, müßten sie vielleicht auch mit dem Schreiben aufhören.
.
Fahrräder und Roller
Die weltweit ersten Fahrräder wurden in den Sechzigerjahren von der anarchistischen Gruppe „Kabouters“ in Amsterdam freigelassen. Diese sogenannten „weißen Fahrräder“ standen überall herum und konnten von jedem benutzt werden. Man durfte sie nur nicht abschließen oder in Privaträumen abstellen. Die „Kabouterbewegung“ endete mit der Wahl der führenden Kabouters ins Rathaus. Zuvor waren ihre kommunalisierten Fahrräder auf behördlichen Widerstand gestoßen: Unabgeschlossene Räder seien im öffentlichen Raum verboten. Sein Privateigentum muß man schützen. Die kostenlosen weißen Leihräder wurden eingesammelt und den Aktivisten zurückgegeben. So endete das erste Experiment – von unten.
Das zweite setzte ein Bremer CDU-Politiker in den Achtzigerjahren durch – von oben: Es wurden jede Menge Fahrräder im Stadtraum verteilt und es gab eine Fahrradreparatur-Station, vorwiegend auf ABM-Basis, die mit ausrangierten Polizei-Mannschaftswagen ausgestattet war. Damit wurden kaputte oder überholungsbedürftige Fahrräder im Straßenraum eingesammelt, instand gesetzt und dann wieder frei gelassen. Das Projekt verschwand nach einiger Zeit, bis auf die Fahrradwerkstatt, so viel ich weiß.
Nach 2009 gab es hierzulande in einigen Städten erneut „weiße Fahrräder“, „Ghostbikes“ genannt. Man stellte sie überall dort auf, wo ein Radfahrer von einem LKW oder PKW getötet wurde – als stationäre Mahnmale.
Das dritte Fahrrad-Experiment geht derzeit nicht von Bürgern oder vom Staat aus, sondern von mehreren Konzernen: mit bezahlbaren E-Bikes (etwa 10 Euro pro Stunde), die sie in vielen Städten irgendwo hinstellen. „Erste E-Bike-Flotte zum Ausleihen startet in Hamburg“, schrieb das Hamburger Abendblatt 2019. „Mit 350 E-Bikes startet ein Schweizer Start-up gemeinsam mit Free Now“. Free Now ist eine „Multi Mobility App in über 100 Städten“. Vor allem zum Bestellen von Taxis oder Mietwagen – der „Mobilitätsanbieter“ ging aus „Mytaxi“ hervor. Die herumstehenden E-Bikes, für deren Benutzung man bezahlen muß, werden wie die weißen Fahrräder in Bremen eingesammelt – aber im Gegensatz zu den in Bremen: Alle. Ihre Akkus müssen aufgeladen werden. Es wurden Berichte veröffentlicht über die Arbeitsbedingungen der armen Schlucker, die mit eigenem PKW Nachts die E-Bikes einsammeln, und natürlich vermehrt auch die überall herumstehenden E-Roller („E-Scooter“).
Sie vor allem stoßen immer öfter auf Widerstand: Das reicht vom Schimpfen über die vielen auf dem Gehweg liegenden E-Roller und ihrer Beschädigung bis zum Versenken in Teichen, Kanälen und Flüssen. In Paris gibt es eine Studentengruppe namens „Guppy“, die regelmäßig die Seine vom Müll befreit – mittels Magneten. In einem Monat holten sie „58 E-Tretroller, 11 Fahrräder und 2 E-Motorroller“ aus dem Fluß.
2019 schrieb das „manager-magazin“ noch: „Auch in Deutschland gibt es das Phänomen, wenn auch wohl nicht in allzu großem Ausmaß. In der Berliner Umweltverwaltung zum Beispiel führt man dazu keine Statistik. Es handele sich um ‚Einzelfälle‘ und sei ‚unproblematisch‘.“
Das hat sich inzwischen aber wohl geändert. Wenn der Tagesspiegel anfangs noch vermutet hatte, bei den Tätern handele es sich um Betrunkene, so ging die Berliner Zeitung wenig später schon von einem nüchternen Täterkreis aus. Die eher mit der „Randale in Brüssel“ gegen die E-Fahrzeug-Vermieter liebäugeln. Nachdem die Betreiber der E-Roller sich geweigert hatten, ihr Eigentum aus den Berliner Gewässern zu bergen (das würde sich nicht lohnen), erklärte eine „autonome Gruppe den Fahrrädern und Rollern den Kampf, gezielt machen linksautonome Anarchisten Jagd auf die Drahtesel – vorwiegend von der amerikanischen Firma Uber. Auch E-Roller und andere Leihräder werden immer öfter Opfer von zerstörungswütigen Menschen, die die Nase offensichtlich voll haben von Uber und Co.“
In Djakarta wurden in den Neunzigerjahren im Zuge einer Modernisierungskampagne 15.000 Fahrradrikschas von einem Tag auf den anderen eingezogen, auf Schiffe verladen und an einer Stelle im Meer versenkt. Alle Umweltaktivisten schrien empört auf. 2010 stellten Taucher jedoch fest, dass der riesige Eisenskeletthaufen auf dem Grund inzwischen tausenden von Fischen und anderen Meerestieren „Heimat“ geworden war.
Die massenhaft versenkten E-Scooter und andere E-Mobile , deren Vermietung von Konzernen betrieben wird, sind wegen ihres Akkus noch viel giftiger als die Fahrradrikschas. In Berlin erfreuen sich die verkehrspolitisch-ökologisch eingeführten Fahrradrikschas dagegen einer zunehmenden Beliebtheit, obwohl oder weil sie eine überwunden geglaubte Klassenspaltung symbolisieren.
„Gestern habe ich sogar Klimaleugner, ein Ehepaar, zum Schloß Charlottenburg gefahren,“ erzählte einer der Rikschafahrer, der schon auf seinem Gefährt für klimafreundliche Mobilität wirbt. Ein anderer, der sportliche Schriftsteller Falko Hennig, schrieb ein Buch mit dem Titel „Rikscha Blues“, in dem er erzählt, wie einem Rikschafahrer jeder Tag „neue Fahrgäste, Bekanntschaften, Abenteuer und seltsame Geschichten bringt“. Auf Amazon heißt es: „Am Ende ist es aber auch eine lakonische, nackte Abrechnung mit der Stadt, falscher Liebe und den Wirrungen des Zwischenmenschlichen.“
.
Klimajugend
So heißt eine wachsende Zahl von, sagen wir: Millennials, jetzt. „Proteste der Klimajugend“ titelte die FAZ, die NZZ schrieb: „Die Klimajugend ist zurück“. 66.700 Einträge zum Stichwort „Klimajugend“ verzeichnet die Suchmaschine „Google“ bereits. Handelt es sich dabei wirklich um ebenso viele Gruppen und Grüppchen, die im Konflikt zwischen Ökonomie und Ökologie die Seiten gewechselt haben? Inzwischen wird man mit mails der Klimajugend geradezu bombardiert. Und immer mehr Leute fragen sich – bei jedem Wetter: Ist das noch normal – oder war da früher (vor einigen Jahren) um diese Zeit noch ein ganz anders Wetter? Ein kurzer Überblick hinterläßt den Eindruck, dass unter den Internet-Eintragungen viele sind, von denen das „Klima“ selbst sagen würde: „Uff meene Pisse Kahn fahrn, det könnse.“
Der Künstler Thomas Kapielsky hat einmal eine Zeitschrift mit diesem Namen herausgegeben. Ich glaube, meinen Beitrag darin, ein Ost-West-Comic, der nach der Wende am Seddiner See spielte, fand er nicht so gut – hat aber nichts gesagt. Es ist wahrscheinlich, dass der Ost-West-Konflikt bei der Klimajugend nur eine geringe Rolle spielt. Die Kulturwissenschaftlerin Nicole Kaminer schrieb allerdings eine Hausarbeit über sich und ihre Kommilitoninnen, die sie alle ständig über die DDR reden, obwohl oder gerade weil sie nach 1990 geboren wurden. Daneben würden sie sich, wenn gefragt, wohl auch noch zur Klimajugend zählen.
Es gibt inzwischen einen Wikipedia-Eintrag zum Begriff „Klimajugend“. Dabei landet man bei „Fridays for Future“, wozu man Näheres im Eintrag „Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg“ findet, der Gründerin dieser Bewegung quasi: „Sie ist eine schwedische Klimaschutzaktivistin. Ihr Einsatz für eine an den Erkenntnissen der Wissenschaft orientierte, konsequente Klimapolitik findet weltweit Beachtung…Als Klimastreikerin fand Greta Thunberg ab November 2018 Nachahmer – zunächst unter schwedischen Schülern“, und dann weltweit.
In ihrer Rede vor der UNO hatte Greta Thunberg betont: „Es sei die Aufgabe der Jugend, zu verstehen, was ihr die ältere Generation mit dem Klimawandel angetan habe, und das Chaos aufzuräumen, mit dem ihre Generation leben müsse. Daher müssten junge Menschen nun selbst dafür sorgen, dass ihre Stimmen gehört würden.“ Wenn man in diesem Wikipedia-Zitat das Wort „Klimawandel“ anklickt, dann gelangt man zum Stichwort „Globale Erwärmung“, wo es heißt: „Die gegenwärtige globale Erwärmung ist der Anstieg der Durchschnittstemperatur der erdnahen Atmosphäre und der Meere seit Beginn der Industrialisierung. Es handelt sich um einen menschengemachten Klimawandel.“
Es gibt dazu ein Unterstichwort: „Klimawandelleugnung“ (kurz: Klimaleugner), wozu beinahe alle gehören, die viel zu verlieren haben – bis hin zu einem Arbeitsplatz (bei VW z.B.), und die deswegen zu mehr Gelassenheit mahnen.
Alte „Klimaaktivisten“ wissen allerdings – von Lacan: „Jede Wissenschaft beginnt mit einer Hysterie.“ Im Eintrag „Greta Thunberg“ heißt es vorab seltsamerweise: „Ihr Einsatz für eine an den Erkenntnissen der Wissenschaft orientierte, konsequente Klimapolitik findet weltweit Beachtung.“ Seltsam, weil sie doch statt auf die von ihr geschmähten Politiker gerade auf die „junge Generation“ setzt, von der es heißt, dass sie es nicht hinnehmen will, als Heranwachsende oder Erwachsene in einer zerstörten Welt zu leben. Also auf Massenbewegung statt Politik aus ist.
Auch das Stichwort „Klimastreik“ in ihrem Wikipedia-Eintrag deutet darauf hin, dass sie dabei eher auf ihre Kohorte als auf die Weißkittel hofft. Unter dem soziologischen Begriff „Kohorte“ versteht Wikipedia: „Gruppen von Personen, die gemeinsam ein bestimmtes längerfristig prägendes Ereignis erlebt haben. Die Einteilung in Kohorten kann der Abgrenzung von Bevölkerungsgruppen dienen.“
Aber das letzte will die Klimajugend gar nicht, die zwar noch (qua ihrer Geburtsjahrgänge) abgegrenzt ist, aber alle Welt für den Widerstand gegen die neoliberale bzw. kapitalistische Wirtschaftsweise gewinnen – überzeugen will, womit wir wieder bei der Wissenschaft wären, denn ihr glaubt man noch am meisten – d.h. den Experten. Sagen wir es so: Greta Thunbergs Klimajugend verläßt sich auf die Wissenschaft, aber nicht auf die Wissenschaftler.
Es geht dabei um das Ende des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, denn „es gibt keine ökonomische Utopie mehr, nur noch eine ökologische,“ wie der Wissenssoziologe Bruno Latour nicht müde wird zu betonen. Die Kulturwissenschaftler Benjamin Steininger und Alexander Klose sprechen vom „Ende der Petromoderne“ in ihrem „Erdöl-Atlas“ (2020). Am 4.9. eröffnen sie bereits im Kunstmuseum Wolfsburg (!) nach vierjähriger Vorbereitungszeit eine „Rückschau“ auf die Petromoderne: „Oil – Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters“.
Auch die internationale Klimajugend hat eine ökologische Utopie, ihrer Bewegung haben sich deswegen immer mehr indigene Gruppen oder Völker in Asien und den beiden Amerikas angeschlossen. In letzter Zeit erscheinen dazu auch vermehrt Bücher von Autoren aus dem Kreis der „First Nations“, aus Kanada z.B., das als „Ehrengast“ damit auch auf der Frankfurter Buchmesse Mitte Oktober vertreten sein wird. In den USA erhielt die deutsch-indianische Autorin Louise Erdrich gerade für ihren Roman „Der Nachtwächter“ – über einen alten Reservats-Aktivisten, der ihr Großvater war, den Pulitzerpreis. Die deutschen Verlage kommen mit dem Übersetzen nicht nach. Bei dem Lebens- und Stammesbericht des jungen brasilianischen „Indianerkriegers“ Madaewjuwa Tenharim hat sein Interviewer, der „Zeit“-Korrespondent in Rio Thomas Fischermann, die Übersetzung und Herausgabe selbst besorgt. Leider hat sich der Verlag 2018 dafür den großsprecherisch-endzeitlichen Titel „Der letzte Herr des Waldes“ ausgedacht.
.
Werkzeugkästen
Wieviele Werkzeugkästen ich schon gehabt habe in meinem Leben, angefangen mit einem für Laubsägearbeiten und Drachenbau? Später hing in meinem Kinderzimmer ein Holzschrank an der Wand, der etwa 20 Werkzeuge zur Holzbearbeitung enthielt. Zuletzt verlieh ich einen 80teiligen Werkzeugkasten, vergaß aber an wen, und erwarb dann einen unschlagbar billigen 160teiligen Werkzeugkasten aus China im „Baumarkt“, als man dort wieder ohne große Coronamaßnahmen und „Zeitfenster“ einkaufen konnte.
Als wir einige Jahre auf dem Land lebten und dort ein Bauernhaus modernisierten, ging ich, so oft wie jetzt in einen Buchladen, in ein Eisenwarengeschäft in der Kreisstadt, in dem die Verkäufer noch graublaue Kittel trugen. Wenn man nicht genau den Fachbegriff, sagen wir „Stichsäge mit Pendelhub“ oder „Torx“ für Innen-Sechsrund-Schrauben, wußte, hatte man bei ihnen schlechte Karten. Es war eigentlich ein Geschäft für Handwerker – noch nicht auf „Do-it-yourself“-Kunden eingestellt. Und dass man von allem immer nur einen Gegenstand oder nur einige wenige brauchte, die man umständlich beschrieb, machte sie nervös, auch dass man statt einer „Hilti“-Bohrmaschine für Profis eine billige „Black & Decker“ wollte.
Das Gegenteil erlebte ich Jahre später auf den dörflichen Wochenmärkten in Burma, wo jedes Werkzeug (für Handwerk, Küche, Garten und Landwirtschaft) ein Unikat war. Da ich quasi Werkzeuge sammel, hätte ich am Liebsten alle dort gekauft, aber sie waren einzeln schon zu schwer – ein „Masse-Ding“ in der doppelten Bedeutung, wenn ich auch nur eins davon mit nach Hause geschleppt hätte für meine Sammlung. Der Philosoph Martin Heidegger unterschied laut Wikipedia zwischen „Vorhandenem“ und „Zuhandenem“ (z. B. Werkzeug). „Ein Hammer ist dabei für ihn primär durch seinen sinnhaften Bezug zum Menschen und zu anderen Dingen in der Welt charakterisiert. Erst wenn er von dem Beziehungsgeflecht entkleidet wird – beispielsweise indem er auf eine Waage zwecks Gewichtserfassung gelegt wird –, wird er zum bloß noch vorhandenen Masse-Ding.“
Man sagt auch: „Für Leute, die nur einen Hammer als Werkzeug haben, ist jedes Problem ein Nagel.“ Als ich bei verschiedenen Bauern arbeitete und auf ihren Höfen oft verlegte Werkzeuge fand, gewöhnte ich mir an, die Teile zu sammeln und an ein großes Brett mit Nägeln zu hängen, wobei ich die einzelnen Werkzeuge schwarz umrandete, so dass man sah, wenn eins fehlte. Die Bauern begrüßten diese Neuerung.
Der Wissenshistoriker Michel Foucault meinte einmal: „Nehmt meine Werke als Werkzeugkasten“. Inzwischen gibt es einen völlig idiotischen „philosophischen Werkzeugkasten“. In Westberlin lebte und arbeitete eine zeitlang der Arbeiterkünstler Raffael Rheinsberg, dessen Kunst immer wieder aus Werkzeug-Arrangements bestand, weswegen er sie auch gerne in der Galerie der IG Metall ausstellte. Ich erinnere mich an einen Raum mit zig verrosteten Werkzeugen auf dem Boden, die er aus der Elbe gefischt hatte – vermutlich mit einem Magneten an einer Angel. Ein andern Mal stellte er Werkzeuge und andere Gegenstände aus, die er in den Schreibtischschubläden des verlassenen Narva-Kombinats an der Oberbaumbrücke eingesammelt hatte.
Seine Kunst sah auf den ersten Blick ähnlich aus wie die von jungen Männern auf dem Westberliner „Polenmarkt“ einst ausgelegten, Gebraucht-Werkzeuge, die sie billig verkauften. Ein kurdischer Trödler bot mir dort einmal zwei verrostete Wolfsfallen für 40 DM an – lange bevor der erste Wolf die Oder in Richtung Westen überquerte – im Jahr 2000: der dreibeinige Naum. Als ich dem Händler sagte, es gäbe in Deutschland keine Wölfe, meinte er hellsichtig, es sei nur eine Frage der Zeit, bis ich solche Werkzeuge gebrauchen könne. Ich wußte jedoch nicht: Meinte er, dass ich sie gegen eventuell aus dem Osten eindringende Wölfe benötige oder weil wir wegen der Chinesen uns in bälde als Fallensteller, Jäger und Sammler wiederfänden, womit der Publizist Henryk M. Broder uns gelegentlich droht?
Erst mal kommen immer mehr Werkzeuge und Werkzeugmaschinen aus China: Neulich erwarb ich spottbilig zwei riesige Schraubzwingen von dort, die eine „Hohe Qualität“ haben sollten. Das war doch etwas übertrieben, obwohl auf der Verpackung stand: „Ein Mann, der recht zu wirken denkt, muß auf das beste Werkzeug halten. (Johann Wolfgang von Goethe).“ Aber immerhin hieß es in einer Kundenbeurteilung des Händlers dann: „Ich kann die Produkte im Bereich T-Nut Schienen, Gehrungsschienen und Einlegeplatten für Oberfräsen nur empfehlen!“
Aber es geht hier um Werkzeugkästen: In einer historischen Ausstellung in Amsterdam sah ich einmal einen alten „christlichen Werkzeugkasten“ (für Missionare zur Bekehrung von Heiden) und eine noch ältere „Werkzeugkiste gegen Vampire“ (um sie zu töten) – in beiden war das Wichtigste: Kreuze und Pistolen.
Für Aristoteles waren die Sklaven einst „belebte Werkzeuge“. In maschinisierter Form kommt das der Vorstellung des Genetikers, Nobelpreisträgers und Ritters Paul Nurse nahe, der meinte „lebende Organismen, seien zwar ziemlich komplizierte, aber letztlich verständliche chemische und physikalische Maschinen,“ und das sei „gegenwärtig die vorherrschende Auffassung vom Leben“. – Die er auch in seinem Buch „Was ist Leben?“ (2021) vertritt, das aber bloß eine Art Werkzeugkasten ist, um ein Leben auseinander zu bauen.
.
Materialermüdung
Als junger Student hatte ich mir 1974 aus der Scheune eines Bauern für 300 Mark einen Mercedes 180 D gekauft und mit Hilfe von Freunden fahrbereit gemacht. Der Wagen war über 20 Jahre alt, hatte 160.000 Kilometer auf dem Buckel und noch ein paar Monate TÜV. Bevor ich damit dann erste Mal auf große Fahrt nach Berlin inklusive Transit durch die DDR ging und es keine erfreuliche Aussicht war, bei einer Panne im Osten von einem anderen Transitreisenden zwangsabgeschleppt zu werden, redete ich dem Auto bei der Abfahrt gut zu und tätschelte das Armaturenbrett. Ich weiß nicht mehr, ob ich ihm dann auch einen Liter frisches Öl oder eine andere Belohnung für brave Dienste versprochen habe, aber mit dem Auto zu reden wie zu einem treuen Hund wurde zu einer Gewohnheit. Nicht nur auf den über 50.000 Kilometern, die ich mit dem 180er noch absolvierte, sondern auch bei seinem Nachfolger mit „Heckflosse“ – und auch noch bei einigen anderen Geräten. Zum Beispiel dem ersten Nadeldrucker, der Mitte der 80er ins Haus kam, brav ratterte wie ein Diesel und ganze Bücher ausdruckte – aber nur, wenn ich daneben sitzen blieb. Schnell mal in die Küche einen Kaffee trinken, um dem Sägewerk-Sound zu entkommen, war eine Garantie für „Error“ und Papierstau. Die Anwesenheit im Zimmer aber genügte, ohne weiteres Zutun spulte der Drucker Seite um Seite ab. Als ich dann einige Jahre später über diese Kontakte und „Gespräche“ mit sprachlosen Dingen, Geräten oder Zimmerpflanzen einen Artikel im „Zeit“-Magazin schrieb, kam ein ganzer Berg von Leserbriefen, die von ähnlichen Erfahrungen berichteten und überzeugt waren, dass bei aller Unerklärlichkeit irgendetwas dran sein muss an diesen mentalen Kontakten mit (scheinbar) unbelebter Materie. Und auch ich bilde mir immer noch ein, dass mein emphatischer Zuspruch die unvermeidlichen Materialermüdung des betagten 180ers zwar nicht verhinderte, aber doch hinauszögerte.
Diese Geschichten fielen mir jetzt wieder ein, als ich den Roman „Materialermüdung“ von Dietrich Brüggemann las, in dem es aber nicht um derartigen Neo-Animismus geht, sondern um Materialermüdung in einem sehr viel umfassenderen Sinne. Dergestalt dass sich am Ende sogar die ganze Materie auflöst und der Berliner Fernsehturm zusammenstürzt.
Vorher aber geschieht so Einiges: „Als Jacob und Maya von Jacobs Vater aus seinem Garten herausgeworfen werden, ahnen sie noch nicht, dass dies der Anfang vom Ende ist – vom Ende ihrer Beziehung, aber auch vom Ende der Welt. Gemeinsam mit ihrem Freund Moses navigieren sie einen Herbst lang durch die Untiefen eines Lebens zwischen Kulturszene, Social Media, künstlicher Intelligenz und postmoderner Ellbogengesellschaft. Doch spätestens, als Moses sich auf Twitter anmeldet, um dort seine verschollene Schwester zu suchen, wird deutlich, dass das Leben der drei Freunde sich mehr verändern wird, als sie es ahnen. Denn die geplante Obsoleszenz, aufgrund derer heute jedes Gerät nach vier Jahren den Geist aufgibt, hat schleichend die ganze Welt befallen, und eine große Materialermüdung breitet sich aus.“
Soweit der Klappentext, der mich neugierig machte. In den Leserbriefen damals hatten auch einige von der Erfahrung berichtet, dass Geräte in ihrem Haushalt oft in Serie kaputt gehen, als ob sie sich untereinander „absprechen“. Aber auch darum geht es hier nicht, obwohl gegen Ende hin so einiges kaputt geht, weil der unsympathische Vater, der einen verschwörungstheoretischen „Sokrates“- Report herausgibt, letztlich Recht behält: ein Experiment im Teilchenbeschleuniger CERN sorgt dafür, dass die Materie zerfällt. Langsam aber sicher, genauso wie das Material und der Zusammenhalt des Theaterkollektivs und seinem Projekt zum Thema Obsolenz oder die Fake-Identität von Moses. Der verdankt seine Existenz einem One-Night-Stand der Mutter mit einem Türken, seinen Vornamen ihrem philosemitischen Holocaust-Tick und den Nachnamen Goldberg seinem biodeutschen Vater aus Gießen, der schwer krebskrank und nicht mehr sicher ist, ob die Töchter Rachel und Hannah wirklich von ihm stammen. Nicht nur die Materie, auch der Stoff, der Beziehungen, Familien, Liebe und Träume zusammenhält, ermüdet und zerfällt in diesem Roman, der trotz all dem was da in die Binsen geht, so gar nicht depressiv und apokalyptisch stimmt. Auch wenn mehr Katastrophe als in „Materialermüdung“ kaum geht. Selten wurde der Weltuntergang so leichtfüßig und witzig erzählt, wie in diesem Road-Movie aus der hippen Berliner Kulturszene, deren „woke“ und „diverse“ Bubble sich als genauso beknackt und zunehmend dysfunktional erweist wie die sie umgebenden Geräte.
Ich gratulierte dem Autor per email zu seinem tollen Roman, nachdem ich auf den ersten 100 Seiten schon mehrfach laut lachen musste und unbedingt weiterlesen wollte – was mir bei zeitgenössischer Prosa, die ich als Literatur-Redakteur über viele Jahre regelmäßig las, äußerst selten passierte. Das meiste, was in Wettbewerben und Verlagsprogrammen an Debüts auftauchte, wanderte in die Ablage „kalter Kafka“ und nachdem ich es mir mit Günter Grass verscherzt hatte, weil ich seinen Roman „Die Rättin“ als „gescheiterten Tierversuch“ kritisiert hatte, gab ich das Rezensionshandwerk auf. Wenn nicht mal gestandene Nobelpreisträger Kritik aushalten, darf man Jungliteraten und Debütantinnen doch kein Leid antun und ihre Texte in die Tonne treten, sondern kann nur schweigen – oder loben.
Als ich weitere 100 Seiten gelesen hatte war klar, dass hier der seltene Falle eines Debutromans vorliegt, der nicht beschwiegen werden, sondern nur und in hohen Tönen gelobt werden muss. Nicht nur weil ich immer wieder lachen musste und Dietrich Brüggemann einfach gut schreiben kann, sondern weil dem Autor – von Hause aus Filmmacher und Musiker – hier eine sehr vielschichtige Kombination und Komposition gelungen ist: ein Katastrophenfilm, in einer Liebes und Beziehungsgeschichte, in einer Satire auf todernste Wokeness-Lappalien , in einer Kritik der Frankenstein-Gefahren unkontrollierter Wissenschaft und der Ununterscheidbarkeit von Faktencheckern und Verschwörungstheoretikern, in einem „Sittenbild“ (hätte man ganz früher gesagt) der Berliner Generation Y in der Post-Postmoderne. Mit einem „Wow!“ und dem Ziehen meines nicht vorhandene Hutes klappte ich das Buch nach 490 Seiten zu.
Aber ich hatte etwas vergessen, die „Süddeutsche“ (26.9.22) klärte auf:
„Zu alldem muss man dann wissen, dass der Autor Brüggemann 2021 maßgeblich hinter der Aktion #allesdichtmachen stand. Schauspieler, Regisseure und andere Künstler kritisierten damals in kleinen Videos die Corona-Schutzmaßnahmen, indem sie ironisch noch härtere Einschränkungen forderten.“
Muss man zur „Blechtrommel“ wissen, dass Grass für die SPD getrommelt hat, oder zum „Prozess“, dass Kafka Versicherungsangestellter war?
„Der Autor ist natürlich nicht mit seinen Figuren zu verwechseln, aber wegen dieser Vorgeschichte schwebt über dem Roman nun trotzdem der ständige Verdacht, dass hier im Plauderton eines hippen Berliner Gesellschaftskritikromans (…) Schwurbeltheorien verbreitet werden sollen.“
Auf den Verdacht, dass im „Prozess“ Versicherungspolicen verbreitet werden sollen und in der „Blechtrommel“ Sozialismus, bin ich nie gekommen, aber bei der „Vorgeschichte“ der Autoren und auch wenn man sie nicht mit ihren Figuren verwechseln sollte, ist ein „Verdacht“ natürlich nicht auszuschließen.
Was „Schwurbeltheorien“ betrifft finden sich in diesem Roman allerdings schon deshalb keine, weil er vor der Pandemie spielt, in der dieser Begriff zwecks Säuberung des Meinungskorridors erst erfunden wurde. Auch der fiktive „Sokrates“-Report und die fatalen Materieexperimente im CERN Teilchenbeschleuniger, die zentral für den Plot sind, spielen nur im Hintergrund eine Rolle. Was den Rezensenten stört, ist nicht, was die Figuren sagen oder tun, sondern die Haltung des Autors, weshalb er in die Geschichte eine „Ideologieebene“ hinein liest und in der Überschrift bekundet: „Nehmt euch in acht vor der Wissenschaft!“ Nun gut – so kann man auch „Faust“ oder „Frankenstein“ als ideologisch fragwürdig verdächtigen und Goethe oder Mary Shelley in die „Querdenker“-Schublade verbannen. Hat vor 200 Jahren kein Rezensent getan, aber es wäre an der Zeit, hier mal genauer zu schauen. Ob Skepsis, Zweifel, Kritik an „der Wissenschaft“ noch erlaubt sein können, wo diese doch gerade die Wahrheit – und nichts als die Wahrheit – über die Killereigenschaften des Virus und die Effizienz der Impfung herausgefunden hat? Sind die Experimente eines Dr. Faust oder Dr. Frankenstein einer sensitiven, post-pandemischen Lektüre noch zumutbar? Und wenn ja, kommt es auf diese Figuren und ihre Geschichten an, oder auf die Haltung des Autors, der sie erzählt ? Ich denke, wir sollten uns besser vor einer solchen Literaturkritik in Acht nehmen, als vor „der Wissenschaft“. Und was das „Schwurbeln“ und die Theorien betrifft, dass die letzten Geheimnisse des Universums und der Materie tatsächlich in den Teilchenbeschleunigern und des CERN gelüftet werden: Gerade wird von dort gemeldet, dass die Fortsetzung der Experimente gefährdet ist. Nicht wegen der vielfältigen Zweifel an ihrem Sinn, und auch nicht wegen drohender Materialermüdung, sondern wegen der Energiekosten. Nehmt euch in acht vor der Sanktionspolitik. Mathias Bröckers
Dietrich Brüggemann: Materialermüdung, Frankfurt 2022
.
Werkzeugmacher
In Erinnerung an Volker Brauns Geschichte „Die vier Werkzeugmacher“. Erzählt wird darin die „komische und grausame Verwandlung einer Werkzeugmacherbrigade aus der Vorstadt Schweineöde. Von der Geschichte ‚bis hierher glimpflich behandelt‘, besondere Leute, die sich Einfalt leisten konnten, finden sie sich in ihrem Betrieb nicht wieder; sie sind enteignet, entlassen und wieder eingestellt – ‚Aber als was? Als wer?‘“
Die M+E-Unternehmen (der Metall- und Elektroindustrie) sind nicht nur wegen Corona von einer Rezession betroffen, Kapazitätsauslastung und Auftragsbestände sind derart zurückgegangen, dass sie 2019 erstmalig seit neun Jahren wieder Mitarbeiter entlassen haben. „Die Beschäftigungspläne der M+E-Unternehmen lassen keine Besserung erwarten,“ teilt der Arbeitgeberverband Gesamtmetall mit.
Dennoch übertrifft die Zahl der gemeldeten offenen Stellen in den M+E-Berufen weiterhin die Zahl der Arbeitslosen. Die Bundesagentur für Arbeit zählte im August 2019 in den M+E-Berufen 127.900 Arbeitslose, rund 10.100 mehr als im August 2018. Andererseits waren knapp 154.600 offene Stellen gemeldet.
Anfang 2019 stiegen die Bruttomonatsverdienste der Beschäftigten laut Arbeitgeberverband um 3,2 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. 2018 waren die Monatsverdienste aufs ganze Jahr gerechnet um durchschnittlich 2,5 Prozent gestiegen.
Der IG Metall zufolge bewegen sich die Tariflöhne der Beschäftigten in den bundesdeutschen M+E-Betrieben zwischen 2900 und 3200 Euro im Monat, wobei die in Ostdeutschland eher im unteren Bereich und die in Westdeutschland im oberen liegen. Hinzu kommt noch: „Während in den westlichen Tarifgebieten seit der Wiedervereinigung häufig übertarifliche Zulagen gezahlt wurden und werden, verharren die Arbeitgeber in den neuen Bundesländern meist auf Tarifniveau. Nur für wenige Beschäftigte, insbesondere im Bereich qualifizierter Angestellter, die vom Westen in den Osten gezogen sind, wurden und werden dort übertarifliche Zulagen gezahlt. Dies führt in vielen Betrieben zu Ungerechtigkeiten.“
Zur Tarifentwicklung macht Gesamtmetall geltend, dass das Jahresentgelt von 1990 bis 2018 real um rund 31 Prozent stieg. Für die Unternehmen gab es einen „Wiedervereinigungs-Boom“ und zwischen 2006 und 2008 einen „kräftigen Aufschwung“. Von dem Boom konnten jedoch die von der Abwicklung ihrer DDR-Betriebe Betroffenen nicht profitieren – im Gegenteil: In einigen M+E-Unternehmen wurden sogar Ost-Ingenieure in den Westbetrieben als Fließbandarbeiter eingestellt. Das war u.a. beim Wechsel von Narva-Beschäftigten zu Osram der Fall.
Um ihre Betriebe nicht widerstandslos von der Treuhandanstalt abwickeln zu lassen, kam es in einigen M+E-Unternehmen im Osten zu Protesten, Demonstrationen, Warnstreiks und Betriebsbesetzungen – in Oberschöneweide z.B. bei einem Betriebsteil des Batteriewerks BAE.
Bei den M+E-Unternehmen in ganz Deutschland kam es laut einer Statistik von Gesamtmetall zwischen 1999 und 2018 bei durchschnittlich 1000 Betrieben zu durchschnittlich 20tägigen Warnstreiks. Wobei 1999 und 2018 über 2000 Betriebe bestreikt wurden und 2000 und 2010 so gut wie keine.
Aufgrund der globalisierten Konkurrenzsituation bei den M+E-Unternehmen kommt es zu Wettrennen bei der Modernisierung (Roboterisierung) der Produktion, was zu einer ständigen Reduzierung der Belegschaften führt. Wenn nicht sogar die Produktion gleich in Billiglohnländer verlegt wird oder das M+E-Unternehmen sein Profil verändert.
So wurde der Mannesmannkonzern erst an das Mobilfunkunternehmen Vodafone verkauft und dann zerschlagen. Die Krupp AG erwarb die Mehrheit an der Hoesch AG und fusionierte dann mit der Thyssen AG: „Nachdem sich der Aktienkurs nun innerhalb eines Jahres halbiert hat, läuft die Zeit von Thyssen-Krupp im Dax ab,“ schreibt das Handelsblatt. Osram verkaufte alle seine Lampen-Produktionsstätten (die meisten an chinesische Unternehmen) und behielt einzig die Sparte Leuchtdioden, diese läßt das Unternehmen in Malaysia herstellen. Ähnlich war es bei dem kurzen Boom der Solarzellen produzierenden Firmen, die zum großen Teil dem Preisdruck chinesischer Firmen weichen mußten. Besonders gravierend war die Entwicklung bei den Stahlwerken in Ost- und West-Europa: Über die Hälfte wurde abgewickelt und die andere nach mehreren Fusionen vom indischen Unternehmer Lakshmi Mittal aufgekauft.
Grundsätzlich kann man vielleicht sagen, dass die Zeit der Industriearbeiterschaft in Mitteleuropa zusammen mit dem sogenannten „Stahlinismus“ an ein Ende kommt, aufgefangen werden die Beschäftigten höchstens im Dienstleistungssektor, der seit dem Internet boomt, aber so niedrige Löhne zahlt, dass die Bundesregierung sich gezwungen sah, eine Mindestlohngrenze festzulegen.
Anders ist die Situation bei den hochtechnisierten Spezialfirmen in dieser Branche, die nicht als Industrie- sondern als Handwerksbetriebe gelten. Hierbei läßt sich die Entwicklung nicht verallgemeinern. So gibt z.B. der für die Werkzeubau Dunkel GmbH in Oberschöneweide zuständige Gewerkschaftssekretär der IG Metall zu bedenken: „Möglich ist z.B., dass irgendwann 3-D-Drucker Einzug bei den Werkzeugmachern halten. Das ändert noch mal alles.“
.
Männerwitze
Männerwitze sind Handarbeiterwitze. Klar, es gibt Beamtenwitze, Hausmeisterwitze, Chefwitze, Arztwitze usw., aber das sind, wenn nicht Kopfarbeiter- dann Berufsgruppenwitze. „Männerhumor mit seinen Witzen über Bier und nackte Frauen scheint einerseits völlig aus der Zeit gefallen, andererseits hält er sich hartnäckig,“ schreibt „Die Welt“. Sie gehören zu einer bestimmten Existenzform, die in Westdeutschland bis in die jüngste Zeit verbreitet war: Der Mann malocht, verdient die Kohle und die Frau versorgt den Haushalt und die Kinder. Um Abstand von beidem zu gewinnen, geht er in „seine“ Kneipe. „Frau Wirtin,“ ruft er beim Betreten, „habe ich gestern Abend wirklich 20 Mark versoffen?“ Als die Wirtin ihm das bestätigt, sagt er: „Gott sei Dank, ich dachte schon, ich hätte die Kohle verprasst.“
Viele Männerwitze machen sich auf Kosten der Ehefrauen lustig. Es gab Zeiten, da gingen die Ehefrauen Freitags ans Fabriktor und nahmen ihnen nach Schichtende die Lohntüten ab, damit sie das Geld nicht versoffen. In einigen afrikanischen und asiatischen Ländern werden Kleinkredite durchweg nur an die Ehefrauen vergeben. Und man kann sicher sein, dass deren Männer jede Menge Witze darüber machen. Als Genre sind Männerwitze auch auf Bühnen zu finden. Erst kürzlich erzählte ein Berliner Autor auf einer Veranstaltung, dass er Bücher sammelt, und wenn er mal wieder im Antiquariat war, müsse er aufpassen, dass seine Frau nicht mitbekomme, was er dafür wieder ausgegeben habe. Im Publikum wurde gelacht. Nun wußte ich aber, dass seine Frau eine gut verdienende Juristin ist und sich für sein Geld überhaupt nicht interessiert, höchstens für das eine oder andere Buch. Mich ärgerte diese Verdrehung der Wahrheit ins Konservative auf Kosten seiner Frau bloß wegen einer platten Pointe am Schluß des Auftritts.
Männerwitze ganz anderer Art erzählt der „Freitag“-Redakteur Christian Baron in seinem Buch „Ein Mann seiner Klasse“ (2020), womit sein Vater gemeint ist – ein Möbelpacker, der sich eine Familie mit vier Kindern leistete. Von ihm stammt der e.e. Bierwitz. Noch einen erzählte er in seiner Kneipe: „Ein Gefängnisdirektor staucht seinen Wärter zusammen: „‘Wie konnte der Mann nur ausbrechen? Und das ausm Hochsicherheitstrakt?‘ ‚Er hatte den Schlüssel‘. ‚Waas,‘ fragt der Direktor, ‚etwa gestohlen?‘ ‚Nein, ehrlich beim Poker gewonnen‘.“
Der Männerwitz, ebenso wie der einstige Witz der Berliner, ist die verbale Selbstheilung eines Unterlegenen. Christian Barons Vater oder vielmehr sein Milieu im Kaiserlauterner Arbeiterviertel und das Aufwachsen seines Sohnes (des Autors) darin, ist ein kaum auszuhaltendes westdeutsches Arbeiterklassen-Klischee – bis zum Schluß, d.h. bis dahin, dass sein Sohn als einziger von vier Kindern den Ausbruch aus seiner „Klasse“ schafft und Soziologe wird.
Das Klischee, das er ausmalt, ist brutal ehrlich. Als Kind fand Christian Baron es am Schönsten, mit in die Kneipe genommen zu werden, wo sein Vater so beliebt war. Er wollte so werden wie sein Vater. Später hörte er oft den nicht sonderlich wohlgemeinten Satz „Du bist seltsam“ – u.a. von einer Deutschlehrerin, „weil ich als Einserschüler auf die Frage nach meiner Lieblingslektüre die BILD-Zeitung angab.“ Seinen ersten „Wutausbruch“ bekam er bereits kurz nach seiner Einschulung: „Wir sollten Umi malen, den freundlichen Bären aus unserer Lesefibel. Als ich fertig war, beugte sich meine Lehrerin über das Blatt. ‚Oh‘, sagte sie,‘das ist ja interessant‘. Ich verstand nicht, was das bedeuten sollte. ‚Schau mal‘, sagte sie, ‚dein Umi hat ja Flügel. Der kann bestimmt fliegen?‘ Jetzt dämmerte mir, was sich da ereignete. Sie wollte mich verarschen. Meine eigene Lehrerin machte sich darüber lustig, dass ich zu dumm war, einen Bären mit Bärenarmen zu malen. Unter Stress hatte ich meinem Umi acht Finger verpaßt, die Zacken glichen. Und diese Lehrerin fand das auch noch witzig.“
Die Biographie „Ein Mann seiner Klasse“, die zugleich eine Autobiographie ist, hat Vorläufer in Frankreich – beginnend mit den Büchern von Annie Ernaux, deren lakonisch-melancholischer Ton, der Intimstes zur Sprache bringt, auch in Christian Barons Buch anklingt. Ebenso Didier Eribons Versuch, das eigene proletarische Herkommen in seiner soziologischen Dimension zu begreifen. Und ähnlich wie Édouard Louis‘ Roman „Das Ende von Eddy“, ein internationaler Bestseller. 2018 veröffentlichter er eine Vater-Biographie: „Wer hat meinen Vater umgebracht“ Darin gehe es um die „Zerstörungsmacht der Politik, beispielsweise darum, wie sie einen Körper zerstören kann,“ erklärte er. „Je stärker die soziale Klasse, der Sie angehören, den Herrschaftsverhältnissen unterworfen ist, desto unmittelbarer sind die Auswirkungen der Politik auf Ihr Leben“. Erwähnt sei ferner Daniela Dröschers Essay „Zeige deine Klasse“ (2018). Als weiteren Autor in dieser „seltsamen“ Reihe, der allerdings keinen „Klassenverrat“ beging, muß man den englischen Schäfer James Rebanks erwähnen, der Historiker und UNESCO-Bevollmächtigter wurde, aber Schäfer blieb. Eigentlich hatte auch er, wie Barons Vater, „nur eine Zukunft mit Saufen, Prügeln, Vögeln vor sich“ – allerdings mit vielen Kneipenwitzen. Rebanks Aufhebung der Trennung von Hand- und Kopfarbeit hat aus Not, dann aber sehr einfühlsam die Schriftstellerin Katja Oskamp in ihren erlebten „Geschichten einer Fußpflegerin: Marzahn mon Amour“ (2019) gewählt. Wobei einem ja inzwischen selbst die freiwilligen Handlungen aufgezwungen werden.
.
Klimaanlagen
Den „Klimawandel“, die „Klimaforschung“, die „Klimaleugner“ – das kennt man, aber „Klimaanlagen“? Der Umweltjournalist Benjamin von Brackel hat in seinem Buch „Der Natur auf der Spur“ (2021) viele Studien versammelt, die nahelegen, dass „der Klimawandel Pflanzen und Tiere vor sich hertreibt“: die auf der nördlichen Halbkugel lebenden in Richtung Arktis und die auf der südlichen in Richtung Antarktis. Oftmals ist es bei den Tieren ihre abwandernde Nahrung, denen sie notgedrungen folgen müssen. Bei den Menschen ist das nicht unbedingt so: Zwar fliehen immer mehr, aus Afrika z.B., in den Norden, weil sie in ihren Geburtsorten kein Auskommen mehr finden, aber gleichzeitig siedeln sich u.a. immer mehr Amerikaner in den heißesten Bundesstaaten (Nevada, Florida und Arizona) an, wo die durchschnittliche Höchsttemperatur im Sommer fast 40 Grad beträgt. Ähnliches gilt für die Europäer, die vermehrt vom Norden in den Süden Europas ziehen. Einer der Gründe ist laut dem US-Schriftsteller John Green (in: „Wie hat ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen?“ – 2021) „das Wunder der Klimatisierung. Sie hat das Leben der Menschen in den reichen Ländern tiefgreifend verändert“.
Erfunden hat sie der US-Ingenieur Willis Carrier 1902 für den Buchdruck. Seine Klimaanlagenfirma „Carrier Corp.“ gibt es noch heute – und die Klimaerwärmung tut ihr saugut: Sie ist eine der größten Hersteller weltweit. Carrier hatte den „Prozess des Heizens mit Strom umgekehrt und Luft statt durch heiße durch kalte Spulen laufen lassen,“ schreibt John Green.
Der US-Schriftsteller Eric Dean Wilson arbeitet an einem Buch über Klimaanlagen, denn „Klimaanlagen sind immer politisch,“ wie er seiner Kollegin Eula Biss mitteilte, die das in ihrem „Non-Fiction“-Buch „Was wir haben“ (2021) erwähnt. Wilson fand heraus: „Die erste vollständige und funktionierende Klimaanlage wurde in der New Yorker Börse eingebaut.“
Saudi-Arabien will inzwischen alle Bushaltestellen damit ausrüsten. Auch die größte Milchvieh-Anlage der Welt (mit 50.000 Holsteinkühen) ist ohne elektrische Kühlung – mitten in der dortigen Wüste – nicht denkbar. Ihr Futter wird eingeflogen.
Neuere Hochhäuser, die ganz ohne Klimaanlage auskommen, gibt es nur wenige. Es sind Luxuswohnanlagen. Das höchste Hochhaus der Welt steht in Dubai, der „Chalifa-Turm“. Für die Klimatisierung des in einer Wüstenregion stehenden Hochhauses sind 60 Luftschächte installiert, die wie Kamine in umgekehrter Richtung, also von oben nach unten wirken. Im Gegenzug muss gegen den Überdruck rund um die Uhr heiße und beschleunigte Luft abgesaugt werden, heißt es auf Wikipedia. Hierbei hat man den Effekt der Klimaanlage, die kalte Luft ausbläst, noch einmal umgedreht.
Laut der Internationalen Energiebehörde (IEA) machen Klimaanlagen und Ventilatoren „weltweit rund zehn Prozent des gesamten Stromverbrauchs aus, und ihren Erwartungen nach wird die Nutzung von Klimaanlagen sich in den nächsten 30 Jahren verdreifachen.“
Als Aushilfshausmeister mußte ich die letzten Jahre im Sommer ein Dutzend Steh-Ventilatoren aus China für die Büros kaufen – jedesmal waren sie in allen Geschäften erst mal vergriffen. Im Spätherbst verschwanden sie seltsamerweise nach und nach aus den Büros – und mußten im nächsten Sommer neu gekauft werden.
John Green schreibt: „Wie die meisten Energie fressenden Innovationen nützt die Klimatisierung hauptsächlich Menschen in reichen Gemeinschaften. Die Konsequenzen des Klimawandels werden dafür vor allem von Menschen in ärmeren Gemeinschaften ertragen.“ Dort, in Indien und Pakistan z.B. sind vor allem die Einkaufszentren stark unterkühlt, weil das vornehm ist, Jugendliche halten sich gerne dort auf, sie sagen, wenn sie sich riesig freuen: „Mir wird ganz kühl ums Herz“. Billige Touristenhotels werben mit „air conditioning“. Man hat dann auf den Zimmern die Wahl: Entweder kann man wegen des Lärms der alten Kältemaschinen nicht einschlafen oder wegen der stummen Hitze im Raum oder wegen der Mücken bei offenem Fenster. Philipinische Freunde von uns, die zur „Berlinale“ im Februar anreisten, schliefen sich hier vor allem in unseren kühlen Gästezimmern aus, obwohl sie bei Manila in einem Haus mit einer modernen, leisen Klimaanlage lebten.
Hierzulande unterbieten sich aber auch schon die Anbieter von Klimaanlagen, die sie einem nachträglich einbauen. Zu ihrer Umweltschädlichkeit heißt es im Internet: „Laut Umweltbundesamt entspricht eine Tonne fluorierte Treibhausgase 1.300 Tonnen CO2-Äquivalente. Zusätzlich erhitzen Klimanlagen in Autos durch den erhöhten Spritverbrauch das Klima. Um bis zu 1,8 Liter pro 100 Kilometer steigt der Spritverbrauch.“ Der österreichische Verkehrsclub erinnert daran: „Das verwendete Kühlmittel von Klimaanlagen ist ein aggressives Treibhausgas und damit extrem umweltschädlich. Rund 150 Tonnen der fluorierten Treibhausgase gelangen durch die Klimanlagen von Österreichs Autoflotte in die Luft! „Die Klimaanlagen in Pkws sind Klimakiller.“
Nicht nur sie, alle Klimaanlagen sind gleichzeitig Ursache und Wirkung der Klimaerwärmung. „Aber Klimaanlagen werden auch deshalb immer häufiger, weil immer mehr Menschen Kontrolle über ihre Innenräume als gegeben voraussetzen,“ meint John Green. Weil in den USA die ideale Büroraum-Temperatur für die Klimaanlage anhand der Temperatur-Päferenzen „von 40jährigen 80-Kilo-Männern in Geschäftsanzügen“ festgelegt wurde, war es den dort arbeitenden Frauen lange Zeit zu kalt, wie eine Studie ergab. Nachdem die Temperatur auf 25 Grad erhöht worden war, stieg ihr „Schreib-Output“ und die „Fehlerquote“ sank. Der Journalist Taylor Lorenz schrieb auf Twitter: „Die Klimaanlagen von Büros sind sexistisch“. Selbst im neuen „GSW-‘Öko-Hochhaus‘“ an der Rudi-Dutschke-Strasse klagten die Mitarbeiter darüber, dass sie nichts individuell regeln durften, um sich wohler zu fühlen. Der Jahresverbrauch an Strom beträgt pro Quadratmeter zwischen 100 und 500 Kilowattstunden, schätzt man.
.
Plusmacherei
„Das Geheimnis der Plusmacherei muss sich endlich enthüllen,“ heißt es im „Kapital“ von Marx. Die marxistische Gruppe „Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft, will mit einigen anderen Rätekommunisten der kapitalistischen „Plusmacherei“ endlich ein Ende bereiten. Das „Plus“ ist der Mehrwert, um den es beim Kapitaleinsatz geht – sein „absolutes Gesetz“, wie „scharf-links.de“ es nennt. Und das wird allen, die eher zur „Minusmacherei“ tendieren, verdeutlicht mit dem Wort „Plus“. Neulich sagte schon ein Trickdieb, als er vor Gericht stand: „Aber ich muß doch auch plus machen.“ Verantwortlich sind all die schwachsinnigen Wortschöpfer, die mit dem Wörtchen „Plus“ hantieren, das „mehr“ bedeutet. Und die z.B. eine Supermarktkette „Plus“ nennen (sie wurde übrigens beim Verkauf ihres Mutterkonzerns „Tengelmann“ an die Genossenschaft „Edeka“ in deren Tochterfirma „Netto“ integriert).
Aber es gibt noch mehr „Plus“ auf den Märkten. Z.B. das „plus Magazin“. Hier meint das Wort „Frauen und Männer über 50“ -von denen alle elf Minuten einer verwitwet. Als der US-Versandkonzern „Amazon“ mit verbilligten „Plus-Produkten“ die Weltinternetbevölkerung beglückte (nebenbeibemerkt: Amazonchef Jeff Bezos „verdient“ laut t-online.de 104 Millionen Dollar am Tag), zogen die Berliner MeToo-Onlinehändlerbrüder mit „exklusiven Zalando Plus Rabatten“ nach. Der Besitzer des türkischen Frühstückscafés am Mehringhof hat die Fachzeitschrift „Gastro plus“ abonniert. So heißen auch einige tschechische und slowakische Lebensmittelgroßhandelsfirmen, während eine deutsche Firma, die Gastronomiebedarf anbietet, sich „GastoPlus24“ nennt.
Die vom Auflagenschwund am meisten betroffene „Bild-Zeitung“ kommt uns im Internet nun mit „BILDplus“ Darin findet sich z.B. die „Enthüllung eines Geheimpapiers des Landwirtschaftsministeriums: ‚Die miesen Gebühren-Tricks der Discounter“. Sonst nix. Wer mehr über die „Dumpingpreise von Supermarktkonzernen“ erfahren will, muß ein „BILDplus-Abo“ kaufen. Noch ärgerlicher ist ein Spülmittel, dessen Chemiekonzern mit einer neuen Edition in die Regale der Drogeriediscounter kam, auf der Flasche stand: „Jetzt mit dem Wirkstoffadditiv Plus“. Erst verstand ich darunter einen „Wirkstoffzusatz“ mit Namen „Plus“ – was idiotisch war, aber realistisch. Dann googelte ich und stieß auf „Additive: Stoffe, die Produkten in geringen Mengen zugesetzt werden“. Also bedeutete das „Plus“ bei dem neuen Spülmittel, dass ihm ein Mehr an geringen Zusatzstoffen beigegeben wurde. Die Konzernwerber haben hierbei ein wenig bekanntes Chemikerwort mit einem Allen leuchtend vor Augen stehenden Signalwort verkoppelt, auch wenn mit dem „Plus“ die Beimengung jetzt mehr als eine „geringe Menge“ ist. Diesen Widerspruch haben sie in ihrer Doppelwort-Kreation „aufgehoben“.
Solche „Oxymora“ sind in der Werbewirtschaft beliebt. Auf „bildungssprache.de“ findet man dazu 35 Beispiele: u.a. Ausnahmeregel, Entschuldungskredit, Fleischkäse, Fruchtfleisch, Frauenmannschaft, Hallenfreibad, Selbsthilfegruppe, Wahlpflichtfach, Minuswachstum. Die gefürchtete SCHUFA, eine private Wirtschaftsdetektei, bei der alle Firmen Auskünfte einholen, wenn jemand sich bei ihnen um eine Arbeitsstelle oder eine Wohnung bewirbt (über seine finanziellen Gebaren in Vergangenheit und Gegenwart)… die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung also wirbt mit einem neuen Produkt: „meineSCHUFAplus“, das soll angeblich ein Mehr an „Schutz bei Identitätsdiebstahl“ bieten. Den „Identitätsdiebstahl“ kennt man von Indianern, die sich von den Weißen nicht fotografieren lassen wollten, um sich ihre Identität nicht klauen zu lassen. Hier geht es jetzt aber um das Klauen von „Bankverbindungen, Passwörtern, Adressen“ usw… Also um typische, fast möchte man schon sagen alltägliche Internet-Verbrechen.
Der Fußballverein Prorussia Dortmund warb bisher auswärtige Fans mit einem „Leistungsangebot“, das aus zwei 4-Sterne-Hotel-Übernachtungen. Frühstück, einem Heimspiel des BVB im Signal Iduna Park und einer Eintrittskarte für das Deutsche Fußballmuseum bestand. Nun offerieren die Werber des Vereins einen „Adrenalin-Trip Plus“an. Gemeint ist damit, dass jetzt noch mehr angeboten wird. Dafür muß der Fan aber zwischen 150 und 350 Euro zahlen. Wenn er darauf eingeht, hat man ihm in kapitalistischer Hinsicht einen sauberen Äquivalententausch suggeriert. Ein Plus auf jeder Seite der am Geschäft Beteiligten: Für den Verein in Form einer Einnahme und für den anreisenden Fußballfanals tolles Dortmund-Wochenenderlebnis. Vorläufer dieser Geschäftsidee war eine Konzertagentur, die ein „MusicalPlus“ offerierte: Eine „Jesus Christ Superstar“Aufführung mit zweimaliger Übernachtung im Dortmunder „Holiday Inn“. Die Wege des Herrn sind unergründlich.
.
Produktion/Konsumption
Der marxistische Erkenntnistheoretiker Alfred Sohn-Rethel setzte den Abstraktionscharakter der Marktwirtschaft beim Tauschvorgang an, wobei er nicht auf die Eigenschaften Gebrauchswert und Tauschwert, sondern auf die Tätigkeiten Gebrauchen und Tauschen abhob. „The act is social but the minds are private“ – beim Tauschakt. Sohn-Rethel war bis in die Siebzigerjahre in seinem englischen Exil geblieben, wo er sein Hauptwerk „Geistige und körperliche Arbeit“ schrieb. Seiner These von der Entstehung der Abstraktion im Tausch, wurde von Marxisten widersprochen, für die er mit der kapitalistischen Produktion entstand – bei der Herstellung bereits.
Beim Lesen des Buches eines französischen Sägewerk-Arbeiters, der 1953 über seine Arbeit in „Das Sägewerk“ (2020) berichtet hatte, konnte ich mir etwas unter ihrer kapitalistischen Produktionslogik vorstellen. Die Hand-, ebenso wie die Kopfarbeiter konkurrieren nicht nur auf dem „freien Markt“ als Arbeit Suchende gegeneinander, sondern auch als „Beschäftigte“ noch. Dies beschreibt der Autor detailliert, sein Bericht besteht im Wesentlichen daraus, wie sie sich in den Sägewerken das Leben schwer machen, sich gegenseitig demütigen, kleine Vorteile verschaffen etc., um dem „Leistungsdruck“ individuell und männiglich stand zu halten.
War das auch noch z.B. beim neuen Opelwerk in Eisenach, der 1995 „produktivsten Autofabrik Europas“, der Fall? Dort hatte die DDR zuvor den „Wartburg“ produziert und die Treuhandchefin Birgit Breuel angesichts des geringeren „Leistungsdrucks“ im Arbeiter- und Bauernstaat ebenso pauschal wie infam von einer hohen „Arbeitslosigkeit“ gesprochen, die in den volkseigenen Betrieben bloß „versteckt“ worden sei?
Heute geht jedenfalls die Tendenz bei der nach produktivsten japanischen Fertigungsmethoden, dem Toyotismus, funktionierenden Opel-Fabrik eher in die entgegengesetzte Richtung, meinte der Betriebsratsvorsitzende Harald Lieske, der zuvor im Wartburg-Werk arbeitete. Die heute sechs- bis sieben-köpfigen „Teams”, mit ihren von außen bestimmten „Team-Sprechern”, die nebenbei noch als Springer fungieren, sollen durch die Selbstorganisation ihrer Arbeitspensa nebst ständiger Verbesserungsvorschläge kontinuierlich die Schnelligkeit (Produktivität) steigern – bei mindestens gleichbleibender Qualität.
Schon bei einem Ukas aus der Zürcher Opel-Zentrale, die Werksferien von drei auf zwei Wochen zu verkürzen, befürchtete der 15köpfige Betriebsrat (vier davon Freigestellte), daß die Arbeits-Teams dafür zu klein seien. Jeder hat sechs Wochen Urlaub im Jahr, dazu kommt noch eine gewisse Anzahl Krankentage. Der eigentlich für die Organisation und den Papierkram zuständige Team-Leiter müßte dann manchmal für zwei Leute einspringen. Die Eisenacher Geschäftsleitung darf andererseits nicht einfach mehr Leute einstellen und versucht stattdessen den Krankenstand zu senken. Auch bei den Überstunden reagiert sie ähnlich und versuchte von Anfang an Sonderschichten beim Betriebsrat durchzusetzen, der deswegen die Einigungsstelle anrief.
Das stärkste betriebliche Disziplinierungsinstrument ist jedoch die Selbstorganisation der Teams selbst. Zwar zieht jeder mal einen mit, der an einem Tag verkatert ist, zu Hause Probleme hatte oder ganz einfach mal einen schlechten Tag erwischte. Aber jemand, der dauernd zu spät kommt oder dessen Einsatz kontinuierlich nachläßt – und so die Team-Leistung drückt, wird von seinen Kollegen rausgedrängt. „Da können wir dann auch nichts mehr machen,” meinte der Betriebsrat 1998.
Die erste Bevollmächtigte der IG Metall-Verwaltungsstelle Eisenach, Renate Hemsteg von Fintel, beklagte sich dagegen über den Opel-Betriebsrat, der sich zu wenig für seine Leute einsetze: „Die Mitarbeiter, die die Arbeitsintensität nicht mehr packen, kommen alle zu uns, wenn sie nicht mehr weiter wissen, sie fühlen sich vom Betriebsrat im Stich gelassen. Opel zahlt keinen richtigen Leistungslohn, d.h. Leistungssteigerungen werden nicht entlohnt, obwohl der Betrieb immer produktiver, die Arbeit also immer anstrengender wird. Schlimm ist auch das gewaltsame Runterdrücken der Krankheitsquote – mittels Rückkehrgesprächen und sogar Kontrollbesuchen zu Hause. Das führt dazu, daß die sich zur Arbeit schleppen, auch wenn sie krank sind. Die Team-Mitglieder erziehen sich gegenseitig, um nicht der Anwesenheitsprämie verlustig zu gehen. Es kann nicht sein, daß einer, wenn er älter wird und nicht mehr so kann, dann von seinem Team rausgedrückt wird. Schwerbehinderte werden gar nicht erst eingestellt, die produziert Opel Eisenach inzwischen selbst – siebenundzwanzig bis jetzt,” bemerkte die IG-Metall-Funktionärin 1998 bitter. Am 1. Mai, dem Kampftag der Arbeiterklasse, würden die „Opelaner“ jedoch immer stolz vorneweg marschieren.
Sohn-Rethel meinte, bei einem Arbeitskampf müssen die Arbeiter sofort den Kontakt mit den Ingenieuren und Technikern suchen, um die Produktionsbedingungen menschlicher zu gestalten. Anzustreben sei die „Aufhebung der Trennung von Hand- und Kopfarbeit“, wie eine Parole in der chinesischen Kulturrevolution lautete. Über ihre praktische Umsetzung damals gab es eine Studie der Harvard-Universität, sie wurde 1972 vom späteren Außenminister Joschka Fischer ins Deutsche übersetzt.
.
Wilde – Barbaren – Zivilisierte
Die Studien des amerikanischen Politologen James C. Scott, der das agrarwissenschaftliche Programm der Yale-Universität leitet, werden von der University-Press als „Anarchist History“ beworben. Es geht in ihnen um nicht weniger als eine völlige Umdrehung unserer Zivilisationsgeschichte, die eine gewaltsame Domestikation von Mensch und Tier ist: Es waren nicht die Seßhaften (Getreideanbauer), deren Gemeinschaften einst im Verein mit Handwerkern und Händlern sich zu den Stadtstaaten entwickelten, in denen unsere „Zivilisation“ entstand. Umgekehrt: Den Stadtstaaten (und ersten Köngsreichen) ging es um Steuern, Zwangsarbeit, Kriegsdienst, wovor die städtischen Bauern, Händler und Handwerker flohen – zu den Barbaren. Sie wurden ersetzt durch Sklaven. Die Stadtstaaten im Zweistromland, in Ägypten und China basierten ebenso auf Sklavenökonomie wie später Athen und Rom und zuletzt die nordamerikanischen Südstaaten. Während die Barbaren, die nomadischen Viehzüchter, Jäger, Sammler, Gärtner, Deserteure, entlaufene Sklaven und Banditen, in den Wäldern, Halbwüsten, Sümpfen, Mooren und Bergen ein freies, angenehmes und gesünderes Leben führen konnten.
James C. Scotts Buch „Die Mühlen der Zivilisation (2019) handelt von den ersten Statdtstaaten, wie z.B. Ur und Akkad, die ab 4000 v.Chr. entstanden – stets in Flußnähe auf fruchtbarem Schwemmland, wo leicht zu besteuerndes Getreide (Weizen, Gerste oder Nassreis) angebaut wurde – bereits lange vor den ersten Stadtstaaten, die bald ummauert wurden: nicht nur um Überfälle abzuwehren, sondern um ihre Bevölkerung an der Flucht zu hindern.
James C. Scotts noch nicht ins Deutsche übersetztes Buch „Die Kunst, nicht regiert zu werden“ thematisiert die kleinen Völker im Gebirge Südostasiens, „Zomia“ genannt, das sich über Burma, Laos, Vietnam, Thailand und China erstreckt und deren Grenzen markiert: die Karen, Katschin, Mian, Hmong u.a.. Allein die Hmong leben heute über drei Staaten verteilt und ein Teil in den USA. Nämlich diejenigen, die die Amerikaner im Vietnamkrieg unterstützten und mit deren Rückzug mitgenommen wurden, um sie nicht den Kommunisten auszuliefern. Wenn man der US-Anthropologin Anna Lowenhaupt Tsing und ihrer Studie „Über das Leben in den Ruinen des Kapitalismus. Der Pilz am Ende der Welt“ (2018) folgt, dann halten die Hmongs oder Teile von ihnen auch in der neuen Heimat, in Oregon z.B., nichts von staatlicher Unterstützung und städtischem Komfort. Sie campieren in den industriell ausgewaideten Wäldern des nordwestlichen Bundesstaates – und leben dort sogar gut. Denn sie sind Sammler eines in Japan zu Höchstpreisen verkauften Edelpilzes namens Matsutake, der nur in Oregon, Finnland und Japan wächst. Neben den stadtstaatflüchtigen Hmongs sammeln auch US-Veterans, Durchgeknallte und Naturburschen in den Oregonwäldern diesen Pilz.
Anna Lovenhaupt Tsing hat die Handelswege von dort nach Japan und die unterschiedlichen Gewinnspannen der am Geschäft Beteiligten nachgezeichnet. Das hat ihr sofort internationale Aufmerksamkeit in den Gesellschaftswissenschaften verschafft. Denn wenn Scott von diesen „Staatsfeinden“, wie er die aliterarischen Gemeinschaften und Völker mit dem Ethnologen Pierre Clastres nennt, berichtet – bis etwa zur Entkolonisierung ihrer Länder, dann hat Tsing deren heutigen Alltag in den USA, jedenfalls den der pilzsammelnden Hmong, erforscht. Diese sind damit wieder an die Anfänge ihres Lebens abseits von Staaten, im „Unsichtbaren“, angekommen. Es ist zu hoffen, dass wenigstens einer von ihnen die schöne Studie der Anthropologin mit einem eigenen Bericht ergänzt.
Die Oregonwälder, in denen der Pilz wächst, sind industriell ausgenutzt worden, auch die letzten Holzfäller, von denen es ganze Dynastien gab, haben sich heute auf Matsutake-Sammeln umgestellt. Die Geschichte ihres Untergangs hat der anarchistische Schriftsteller Ken Kesey in seinem Roman „Manchmal ein großes Verlangen“ (1987) geschildert. Der 2001 gestorbene Kesey bewirtschaftete einen Hof in Oregon. Der ebenfalls dort lebende Schriftsteller David Guterson hat 1994 in seinem Roman „Schnee, der auf die Zedern fällt“ die jüngste Geschichte der in Oregon lebenden Japaner erzählt. Sie waren Kleinbauern, nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbour wurden sie interniert. Als sie, die längst Amerikaner geworden waren, frei kamen, war ihr Landbesitz weg. Ich hoffe, dass ich diese Geschichte richtig wiedergegeben habe hier, zu ihrem bitteren Schicksal gehört auch noch, dass ihr Lieblingspilz, der ihnen nach Oregon gefolgt ist und den einige auch dort sammeln, nun für die reichen Feinschmecker in Japan gedacht ist. Aber das Schicksal der Hmong, so wie Scott es schildert, ist heute auch nicht ohne Härte. Schon allein, wenn ihre Kinder an der Westküste in der Schule auf Nationalitäten wie Burma, Kambodscha oder Vietnam festgelegt werden, obwohl sie diese Staaten seit „Urzeiten“ ablehnen. Wie auch immer: Mit James C. Scott muß man die freiheitsliebenden Hmong und andere kleine südostasiatische Völker, aber auch die europäischen Zigeuner, die nordafrikanischen Berber, die Unauffindbaren Brasiliens etc., zu den wahren Zivilisationsbringern zählen.
.
Mau-Mau
Was der Maji-Maji-Aufstand gegen die Deutschen. war der Mau-Mau-Aufstand gegen die Engländer.
„Mau-Mau bei der Wohlfahrtsbehörde,“ so hieß einer der ersten Texte des „New Journalism“ 1970. Er stammte vom späteren Bestsellerautor Tom Wolfe. Es ging darin um ein afroamerikanisches Alltagsgenie, das besonders einfallsreich war beim Einfordern von Sozialleistungen für die Black Community bei den Behörden. Hierzulande ist „Mau-Mau“ ein etwas simples Kartenspiel.
Das Wort „Mau-Mau“ ist eine englische Verballhornung des Kampfziels „Land durch Freiheit“ in der Sprache der Kikuyu. Die „Mau-Mau“- Aufständischen nannten sich laut Wikipedia „Land and Freedom Army“. Ihr Guerillakampf gegen die englische Kolonialmacht fand auf dem Territorium des heutigen Kenia statt. Auch die Kamba, die Meru und die mit den Kikuyus einst verfeindeten Viehnomaden der Massai, die von den Engländern zuvor umgesiedelt worden waren, beteiligten sich am Unabhängigkeitskampf.
Der „Mau-Mau-Aufstand“ ist bis heute nicht beendet. Bereits 1956 schien die englische Armee verbunden mit Kampfgruppen der weißen Siedler ihn niedergeschlagen zu haben. Mit zum Aufstand trug bei, dass noch während des Zweiten Weltkrieges im nahezu „unberührten Kenia“ immer mehr englische Siedler angesiedelt worden waren und nach Kriegsende sich demobilisierte Militärs dort niederließen. Für ihre „Start-up“-Unternehmen bekam jeder rund 1000 Hektar Land von „London“ und konnte italienische sowie deutsche Kriegsgefangene beschäftigen. Die Kolonialregierung wies zudem riesige Gebiete als „Nationalpark“ aus, die reich an Wildtieren waren (vor allem an den „Big Five“ – Elefanten, Nashörner, Büffel, Löwe und Leopard), die dort aber nur gegen Bezahlung gejagt werden durften. Die englischen und australischen Offiziere, die sich als Elefantenjäger oder Organisator von Großwildjagdabenteuern selbständig machten, beschäftigten vorwiegend Einheimische – Fährtenleser, Diener, Köche und Gewehrträger z.B. Diese Weißen waren die ersten, die gegen die Mau-Mau-Guerilla organisiert vorgingen. Ihre schwarzen Mitarbeiter unterstützten dagegen nicht selten die Gegenseite. Mit der Selbständigkeit Kenias 1963 hörten die Kämpfe nicht auf. Als erstes wurde danach der letzte „Mau Mau General“ Baimungi getötet. Aus seinen Jägern und Kämpfern wurden „Wilderer, die in den kenianischen Nationalparks neben Fleisch vor allem Nashörner und Elefanten, zunächst mit Pfeilgift und Fallen, jagten. In den Jahren nach Krieg und Entkolonisierung stiegen die Elfenbeinpreise explosionsartig. Bekämpft wurden die sich stetig „moderner“ bewaffnenden „Wilderer“ von den „Rangern“ der Nationalparkverwaltungen, die ebenfalls ständig aufgerüstet werden mußten. Schon bald wurden extra für die Wildererbekämpfung ausgebildete Spezialeinheiten aufgestellt, die Polizeirechte bekamen. Befehligt wurden sie von weißen Großwildjägern und Safari-Veranstaltern, die sich zuvor im „Buschkrieg“ gegen die Mau Mau hervorgetan hatten und jetzt u.a. private Tierschutz-Firmen gründeten, Anti-Wilderer-Brigaden aufstellten – und vermieteten. Sowohl die Gorillaforscherin Diane Fossey als auch die stellvertretende Leiterin des Tsavo-Nationalparks in Kenia, Daphne Sheldrick, haben in ihren Büchern ausgerechnet, wie viel Geld ihnen diese Brigaden täglich kosteten. Nebenbeibemerkt war letztere verheiratet mit dem Nationalparkleiter, der ein Großwildjäger gewesen war, davor mit einem weiteren Jäger und Offizier, der sich als Guerillabekämpfer ausgezeichnet hatte und dann in der naturschützerischen Nationalparkverwaltung untergekommen war, wobei er in seiner Freizeit weiter auf Großwildjagd ging. Ähnlich verhielt es sich mit ihrem Bruder.
Der ehemalige Organisator von „Safarireisen“, Richard Leakey, war zuletzt als Leiter der obersten Nationalparkbehörde, „Kenya Wildlife Service“, hauptsächlich mit dem Einwerben von reichen Sponsoren in aller Welt beschäftigt, um mit ihrem Geld immer modernere Waffen für seine Wilderer-Bekämpfer anzuschaffen, einschließlich Hubschrauber und Überwachungstechnik. Einmal ließ er im Beisein des kenianischen Präsidenten Daniel arap Moi 12 Tonnen Elfenbein, die Wilderern abgejagt worden waren, öffentlich verbrennen. Das sollte Stärke und Entschlossenheit bei der Verteidigung des Lebens von Elefanten und Nashörner demonstrieren. 2016 wurden im Nairobi-Nationalpark im Beisein von Staatspräsident Uhuru Kenyatta 105 Tonnen beschlagnahmtes Elfenbein öffentlich verbrannt.
Nachdem die Wilderer aber inzwischen mit Drohnen und GPS ihre Elefanten und Nashörner aufspüren und die diese Tiere verteidigenden Nationalparkwächter die Wilderer ebenfalls mit Drohnen jagen, hat die kenianische Regierung statt weiter Waffen zu finanzieren, eine weitaus kostengünstigere Maßnahme – die Todesstrafe für Wilderer – beschlossen. Aus den weißen Großwildjäger-Safaris wurde ein Nationalpark-Massentourismus. Den müssen die Ranger nun weniger gegen die „Big Five“ als gegen die „Mau Mau“ schützen, denn die Tiere scheinen es zu honorieren, dass die Touristen bloß mit Kameras auf sie schießen, und dass sie in der Weltpresse – bis hin zur taz – gelobt werden, wenn auch sie Wilderer angreifen und töten – wie zuletzt ein Elefant und ein Löwe im südafrikanischen „Krüger-Nationalpark“, wo man im Übrigen den tierischen Mehrwert selbst verwertet – mit eigenen Schlachthöfen und Souvenirshops: die Tierpopulationen werden wie eine Farm bewirtschaftet. Im beliebten Safariland Botswana ist man auf eine andere Idee gekommen: Dort werden nun staatliche Lizenzen verkauft zum Töten von jährlich 400 Elefanten – sowohl an reiche Großwildjäger (Trump erlaubte den seinen gerade wieder die Einfuhr von Jagdtrophäen aus Afrika), als auch zu Vorzugspreisen an arme Dorfgemeinschaften, die ihre „License to kill an Elephant“ mit Gewinn weiterverkaufen können.
.

.
Erste gesamtdeutsche Schafdemo
In den drei Monotheismen ist Gott ein Hirte und die Gläubigen sind seine Schafe. Die Griechen, die lokale Götter hatten, hätten ihre Verschafung nie hingenommen, meinte der Wissenshistoriker Michel Foucault. In Berlin demonstrierten unlängst das erste Mal echte Schafe. Die Demoroute verlief von der Wiese neben dem Haus der Kulturen der Welt im Tiergarten zum Hansaplatz in Moabit. Dort stand auch ein Stall, aber die Wiese drumherum hatte irgendein Mistkerl kurz zuvor chemisch gedüngt, so dass die Demoteilnehmer, um sich nicht zu vergiften, auf einen breiten Fußweg vor dem U-Bahneingang auswichen. Es handelte sich um 200 „Schwarzköppe“, sie wurden flankiert von einem Dutzend Schäfer, ebensovielen Helfern, die die Schafköttel auf der Straße beseitigten, ferner etwa 100 Polizisten, die fleißig photographierten – jedoch privat, sowie von etwa 500 Schaulustigen, davon waren rund 50 beruflich dabei, als Journalisten mit und ohne Kamera, und vom Rest bestand die Hälfte aus Kunstbeflissenen mit und ohne Hunde, Fahrräder, Kinder. Und nicht zu vergessen, der Besitzer der Schafherde mit zwei Hütehunden: der Schäfermeister Knut Kucznik aus Atlandsberg, der voran ging.
In Kreuzberg-Neukölln hat es so eine große Demo schon seit Jahren nicht mehr gegeben. Es handelte sich dabei aber auch um eine Kunstaktion – zur Aufwertung des Hansaplatzes und damit auch des Hansaviertels – einem in den Fünfzigerjahren entstandenen Westberliner Konkurrenzprojekt zur Stalin-Allee. Dieses hochpreisige Viertel mit der Akademie der Künste im Zentrum war immer ein Wohngebiet für gutbetuchte Kulturschaffende und Wissenschaftler mit Beziehungen zu diversen Senatsstellen, so dass man sich wundern darf, wieso dieser Hotspot korrupter Wohnungs-Kungeleien plötzlich aufgewertet werden muß. Aber die Bewohner sind alt geworden und jeder Obdachlose am U-Bahneingang bringt sie außer Fassung, außerdem haben sie ihr Wohnumfeld gerne sauber und ordentlich – und sicher noch Beziehungen zu den staatlichen Verwaltern diverser Fördertöpfe, aus denen diese Kunstaktion mit rund einem Dutzend Künstlern dann finanziert wurde. Die für die Schafdemo verantwortliche Folke Köbberling wohnt auch im Hansaviertel und sie beschäftigt sich schon länger künstlerisch mit Schafwolle. Es wurden ein paar Transparente mitgeführt, auf denen mehr Schafe und mehr Schaftugenden gefordert wurden und es gab eine Abschlußkundgebung der angereisten Schäfer. Sie fordern mehr Weideflächen, auch im Stadtraum, nicht zuletzt, weil das weitaus ökologischer sei als die bisherige Rasenpflege – mit chemischem Dünger und mechanischen Mähern.
Als die Herde auf der Sichtschneise vorm Bundespräsidialschloß eine Freßpause einlegte, fragte ich eines der mir nächststehenden grasenden Schafe, die übrigens alle schon ein bißchen schwanger aussahen, was sie und ihre Mitschafe von dieser Veranstaltung halten. Kucznik sei ein Wanderschäfer, bekam ich zur Antwort, und sie seien es gewohnt, transportiert zu werden.
Ob sie Kuczniks zwei Hunde auch gewohnt seien, fragte ich weiter. Nein, daran gewöhne man sich nie, das seien schon scharfe Biester, die gerne in die Beine beißen. Sie hätten lieber Hunde, wie einige Herden in der Nachbarschaft, die sie beschützen würden statt solche, die ihnen das Leben schwer machen.
Tatsächlich sah ich im weiteren Verlauf der Demo, wie gerne die beiden autoritären Aasfresser zuschnappten, wenn ein Schaf ihnen nur nahe kam – statt besonnen zur Entspannung in der Herde beizutragen. Weiter fragte ich das Schaf, warum kein einziges geblökt habe während der Demo, das gehöre eigentlich zu jeder Demo dazu, sei geradezu Pflicht. Meine Gesprächspartnerin gab zu, dass sie schon ein bißchen eingeschüchtert seien von den vielen Menschen, die sie die ganze Zeit umzingeln. Normalerweise sei es an ihren Weideorten immer umgekehrt: Viel mehr Schafe als Menschen. Im übrigen werde man schon noch blöken, aber nicht alle zusammen, sondern nur einige – und zwar am Kundgebungsort, wo man auf Kraftfutter und Wasser hoffe, quasi als Belohnung, weil die gesamte Herde so diszipliniert mitspiele.
Dort gab es dann zwar nur Wasser, aber das Schaf behielt Recht: Nur zwei oder drei blökten – und als die ersten Reden über Lautsprecher gehalten wurden, schwiegen auch sie. Ich bedankte mich beim Schaf und ging nach Hause, zuvor streichelte ich ihm noch über den Kopf, wozu es jedoch etwas unwillig den Kopf schüttelte. Ich entschuldigte mich.






