Das Foto zeigt ein sowjetisches Hammer-Drama aus der heroischen Zeit .
Mit der westlichen Unterstützung der Ukraine nimmt der alte deutsche Russenhass wieder zu. Es gibt Schilder an Läden mit der Aufschrift „Russen werden hier nicht bedient“, es kam zu Entlassungen von russischen Künstlern, die sich nicht sofort von Putin distanzieren, Mobbing von russischen Kindern in der Schule, in Talkshows wird davon geredet, dass die Russen ganz anders als wir sind – unzivilisierter, ein Stuttgarter Restaurant erklärt Russen für unerwünscht, ebenso eine Münchner Privatklinik, geflüchtete Russen gelten laut taz in der EU als unerwünscht, „Russe“ gilt inzwischen manchen als Schimpfwort und Russisch sprechende müssen sich mancherorts Beleidigungen anhören. Wladimir Kaminer berichtete, dass sie vor einem Lokal Russisch sprachen und ein deutscher Rechtsanwalt sich das verbat. Als sie sich weiterhin auf Russisch unterhielten, rief er die Polizei. Ähnliches war Kaminer zuvor in einem vietnamesischen Restaurant passiert.
.
Eisbären
Es gibt zwischen den westlichen und den östlichen Eisbären einen großen Unterschied in ihrer Wahrnehmung durch die Weißen. Wenn man dem Schriftsteller Björn Vassness (in seinem Buch „Im Reich des Frosts“ – 2019) folgt, dann hat das mit der Einstellung zur Arktis zu tun: Während dieses kalte „Reich“ im Westen als „gefährlich und schrecklich, ja sogar als Wiege des Bösen“ – in Märchen wie Andersens „Schneekönigin“ und Disney‘s „Eiskönigin“ z.B. – begriffen wird, mindestens als Land voller Entbehrungen und Gefahren, hat man in Russland „ein anderes Verhältnis zu Eis und Schnee“. Dort gab (und gibt) es Winter, die das Land mindestens zweimal in der neueren Geschichte vor Invasoren retteten – „Erst vor Napoleon, dann vor Hitler“, denen ihre Armeen in Russland buchstäblich erfroren. „Kein Wunder, dass in Russland Väterchen Frost den Kindern Geschenke bringt,“ meint Vassness. Für die letzten ca. 23.000 Eisbären bedeutet dies, das die amerikanischen gefährliche Bestien sind, während die russischen eher als friedlich gelten.
Am internationalen Tag des Eisbären 2020 begann in Russland eine Zählung aller Eisbären – von der Tschuktschensee bis zur Barentssee. Die Wrangelinsel vor der Tschuktschen-Halbinsel gilt als „Heimat der Eisbären“. An den Berghängen graben sich im Winter bis zu 500 weibliche Eisbären Schneehöhlen und bekommen dort ihre ein bis drei Jungen, währenddessen fasten sie bis zu vier Monate und wärmen und säugen ihre anfangs noch nackten Jungen. Manche der Höhlen auf der Insel sind dicht nebeneinander gebaut, so dass die Mütter, die zehn Monate tragend sind, sich durch einen Verbindungsgang verständigen können.
Die Zahl der Wurfhöhlen auf der Wrangelinsel nimmt zu, während ihre Orte u.a. an der Hudson-Bay und auf Spitzbergen inzwischen weniger stark von den Tieren genutzt werden, da sich in manchen Jahren das Meereis dort zu spät bildet – oder sogar überhaupt nicht. Die Eisbärinnen sind dann gezwungen, sich anderswo ein Winterlager zu suchen. „Es ist ein dynamisches System, daher gibt es gute und schlechte Jahre,“ erklärte der Eisbärforscher Andrew Derocher von der University of Alberta dem Wissenschaftsjournal „spektrum.de“. Doch insgesamt seien diese Schwankungen „Ausdruck eines langfristigen Rückgangs“. Denn die Zahl der Wurfhöhlengebiete nehme in den arktischen Gebieten der westlichen Nationen kontinuierlich ab.
Die Bären bleiben so lange wie möglich auf dem Eis, meint die Wildtierbiologin Karyn Rode vom U.S. Geological Survey in Anchorage, aber mit zunehmendem Rückzug des Meereises werde „Wrangel zum nördlichsten Punkt, an dem die Bären an Land gehen können“. Weibliche Eisbären verbringen daher heute eine längere Zeit auf der Insel als noch vor 20 Jahren.
Im Westen gilt die Hafenstadt Churchill an der kanadischen Hudson-Bay als „Eisbärenstadt“. Die hungrigen Tiere kommen dort hin, um in den Abfällen nach Futter zu suchen. Für besonders aufdringliche Eisbären hat die Stadt ein Gefängnis gebaut.
Auch auf Spitzbergen trauen sie sich gelegentlich bin in die Siedlungen: 2020 tauchte ein Eisbär wiederholt im Zentrum der Hauptstadt Longyearbyen auf. Nachdem er nicht vertrieben werden konnte und kein Tierarzt zur Betäubung vor Ort war, um ihn dann in ein entferntes Gebiet auszufliegen, es auch nicht genug Personal gab, um Wachen aufzustellen, ließ die Gouverneurin den „Problembären“ erschießen. Norwegens Umweltminister hatte zuvor den Van Mijen-Fjord zum neuen Schutzgebiet für Robben und Eisbären erklärt, weil sich dort das Eis besonders lange hält und man wegen des Arktis-Tourismus die letzten Eisbärinnen auf Spitzbergen halten will.
2008 gelangten nach langer Zeit wieder zwei Eisbären nach Island. Einen tötete man, der andere wurde betäubt und nach Grönland geflogen. Vor allem in Alaska, so behauptete „Die Welt“ 2014, seien die Eisbären wegen des Klimawandels „vom Aussterben bedroht“. Hinzu kam dann, dass der US-Präsident Trump das Verbot für Alaska, junge Eisbären zu töten, aufhob.
2020 äußerte Trump den Wunsch, Grönland zu kaufen, wo das US-Militär seit 1951 einen riesigen Stützpunkt „Thule Air Base“ hat. Die Amerikaner hatten ihre Flagge bereits 1882 auf der Wrangelinsel gehißt, die einem US-Millionär gehörte. Dessen Leute wurden dann von der Roten Armee vertrieben. 37 Jahre später landeten 8000 US-Soldaten in Wladiwostok und 5000 in Archangelsk, um den Bolschewismus zu bekämpfen. Ihre Parteinahme für die „Weißen“ im Bürgerkrieg nannte sich „Polar Bear Expedition“. Sie wurden von der Roten Armee angegriffen, 129 Soldaten starben. Als sie 1919 den Rückzug antraten, mit einigen Eisbärfellen im Gepäck, und mit einem Eisbrecher nach Hause gebracht wurden, bekam die Einheit den Namen „Polar Bears“; ihre Toten wurden auf einem Friedhof in Michigan um eine Eisbärenskulptur herum beigesetzt.
Dieses amerikanische Korps war eine von 16 westlichen Eingreiftruppen (einschließlich einer aus Japan), die sich anheischig machten, von allen Seiten der Sowjetunion die Kommunisten zu besiegen und das Land aufzuteilen. So ähnlich wie die jetzt entstandene Wunschlandkarte von Russland (ein Déja-vu):
.
.
Bei den Reichen ist die Trophäenjagd auf Eisbären noch immer beliebt. In Hollywood gab es lange Zeit kaum einen weiblichen Star, der sich nicht lasziv auf einem Eisbärfell räkelte, genannt seien: Pola Negri, Jean Harlow, Ann Miller, Ann Sheridan, Joan Collins, Ann Crawford, Carroll Baker, Edwina Both, Lisbeth Scott, Olga Baclanova, Dolores Del Rio, Rita Hayworth, Grace Kelly, Veronica Lake, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe – und zuletzt die Präsidentengattin Melania Trump.
Den Inuit werden auf internationaler Ebene für die Subsistenzjagd auf Eisbären Quoten zugeteilt: Sie erlegen jährlich etwa 150 Tiere. Deren Felle werden immer teurer, bis zu 3000 Euro, weil es eine steigende Nachfrage in China gibt. Naturschützer wie der Däne Morten Jörgensen kritisieren, dass man den Inuit, die von der „traditionellen Jagd“ leben, überhaupt eine Quote an Eisbären einräumte: Da ist nichts „Traditionelles“ mehr an der Jagd, meint er. „Die Inuit gehen mit hochtechnischen Motorschlitten und wummstarken Gewehren, mit Feldstechern und Spezialkleidung auf das Eis.“
In Russland reagiert man gelassener auf Eisbären. Der Sender RTL zeigte 2019 ein Video von einem Eisbären, der plötzlich in einem Dorf auf Kamtschatka auftauchte. Die Halbinsel liegt 700 Kilometer vom Eismeer entfernt im Pazifik. Eisbären können weit schwimmen – aber so weit, das ist selten. Die Bilder zeigten einen „erschöpften Eisbär bei der Ankunft und wie er von den Menschen empfangen wird. Die Einheimischen, die dem Bären Fisch hinwerfen, geben dem Tier das Gefühl, sich willkommen zu fühlen. Angst vor dem Tier brauchten die Menschen in diesem Fall nicht zu haben. Denn der Bär ging an den Bewohnern vorbei, ohne Aggression zu zeigen.“ Gleichzeitig bereiteten die Behörden in Kamtschatka sich aber auf eine Rettungsaktion vor: „Sie planen, den Bären mit einem Beruhigungsmittel für eine bestimmte Zeit auszuschalten und dann mit einem Hubschrauber zurück in die Arktis zu fliegen.“
Auf der riesigen nahezu unbewohnten Doppelinsel Nowaja Semlja tauchten 2020 in der Nähe des Hauptortes Beluschja Guba 52 Eisbären auf. „Zu viele, deshalb haben die Behörden auf der Doppelinsel im Nordpolarmeer den Notstand ausgerufen,“ berichtete die Tagesschau. Einige Bären waren in Häuser eingedrungen. Die zu vielen Tiere wollte man betäuben und fortbringen. Das erwies sich jedoch als nicht nötig. Der Verwaltungschef erklärte der Presse, die Eisbären hätten den Ort verlassen, als sich Eis angesammelt und eine Gruppe einheimischer Eisbären sie dann verjagt hatte.
Die Eisbären haben sich einst von den Braunbären nach Norden abgesetzt – und zur Not würden sie auch wieder ein Leben an Land führen können, meint der Ökologe Josef Reichholf. Derzeit passiert jedoch eher das Gegenteil: Die (braunen) Grizzlybären drängen in die Arktis, und sie verpaaren sich auch mit Eisbären, ihre Jungen sehen allerdings noch etwas schmuddelig aus. Überhaupt wandern die Tiere und Pflanzen auf der nördlichen Halbkugel wegen der Klimaerwärmung in Richtung Arktis und auf der Südhalbkugel in Richtung Antarktis, wie Benjamin von Brackel in seinem Buch „Die Natur auf der Flucht“ (2021) nachweist.
.

Russin füttert Eisbär
.
Das Momentum des „Kaputten“
In Berlin fand unlängst ein geballtes „Theater der Dinge“ an fünf Spielorten statt – mit 14 Inszenierungen, Installationen und Ausstellungen von Künstlern aus Argentinien, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Katalonien, Kroatien, Litauen, den Niederlanden, Norwegen, der Schweiz, Tschechien und Deutschland. Ihr gemeinsames Thema ist „Kaputt“. Und wer sich selber als Kaputtmacher*in an diesen Tagen betätigen will, kann das in der „Werkstatt der Zerstörung“ des „Fundus Theaters Hamburg“ tun.
Wir fluchen, wenn irgendetwas allzu schnell kaputt geht; aber wenn man dem marxistischen Erkenntnistheoretiker Alfred Sohn-Rethel glaubt, dann gibt es mindestens für den Neapolitaner ein „Ideal des Kaputten“, d.h. wenn er sich z.B. einen neuen Motorroller kauft, dann ist ihm das reibungslose Funktionieren dieser Maschine unheimlich. Erst wenn sie einen Schaden hat, den er mit einem Gummiband oder Ähnlichem reparieren kann, hat er das Gefühl, dass er die Maschine wirklich beherrscht. Der Neapolitaner denkt konstruktiv.
Das deutsche „Ideal des Kaputten“ ist dagegen heute eher destruktiv, es findet seinen Ausdruck im „Wutraum“. Der erste entstand in Halle, der zweite in München, der dritte in Berlin (hier heißt er natürlich „Crashroom“). In diesen Aggressionsabfuhr-Start-Ups schlagen vorwiegend Frauen alles kurz und klein. Sie müssen dafür zwischen 100 und 200 Euro zahlen, je nachdem welche Dinge sie zertrümmern wollen. „Bei manchen Leuten kann die Aggression durch so etwas allerdings noch gesteigert werden“, warnt die US-Psychologin Jennifer Hartstein. Sie denkt dabei an die 2,49 Schnellfeuergewehre, die auf jeden amerikanischen Bürger kommen – und wie schnell man damit nicht nur Dinge, sondern auch Menschen zerstören will, z.B. ein Mann seine Frau oder umgekehrt, was hierzulande (noch) selten geschieht und wenn, dann eher differenziert beurteilt wird. „Frau erschlug Ehemann mit Bratpfanne: Freispruch!“ So lautete eine BILD-Schlagzeile, die für Freude sorgte.
Es gibt noch ein drittes „Ideal des Kaputten“, für das man mitunter auf andere Weise zahlen muß: das „Macht kaputt was euch kaputt macht“ aus dem Lied einer Kreuzberger Musikgruppe, deren Name „Ton Steine Scherben“ dazu bereits so etwas wie eine Handlungsanweisungbietet: erst gröhlen („Ho Ho Tschin Minh“ z.B.) auf Demos, dann Pflastersteine ausbuddeln, und dann damit u.a. die ChiChi-Läden des Kudamms „entglasen“.
Dahinter steht die Marxsche Analyse des Kapitalismus, der eine derart „ungeheure Warenansammlung“hervorbringt, das die Beziehung zwischen den Menschen und den von ihnen hergestellten Dingen sich umkehrt. Mit Marx gesprochen: Auf der einen Seite „sachliche Verhältnisse der Personen“ und auf der anderen „gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen“ – beides miteinander verklammert. Nämlich dadurch, dass sich erst im Akt des Tausches Gesellschaft – abstrakt- herstellt. Zwar ist der „Tauschakt“ sozial, aber die daran Beteiligten handelnsolipsistisch(„the act is social the minds are private“).
Z.B. in der Supermarktfiliale von „Kaufland“ (!), wo wir unser als „Ware Arbeitskraft“ verdientes Geld gegen „Waren des täglichen Bedarfs“ eintauschen – bei der „Kassiererin“, deren Befindlichkeit uns in dem Moment und überhaupt scheißegal ist. Wir verkörpern dabei das „sachliche Verhältnis zu den Personen“, während unsere Gedanken in diesem Tauschakt bei den „gesellschaftlichen Verhältnissen der Sachen“ sind, die wir einkaufen. Die Veranstalter von der „Schaubude Berlin“ sprechen von einem „Figuren- und Objekttheater“. Die Objekte sindes – in ihrer Warenform, die gesellschaftsbildendwirken. Das funktioniert auch prächtig, ist aber scheiße, weil diese ungeheure Warenansammlung durch die industrielle Verwertung der Natur(reichtümer) zustandekommt und das Kapital getrieben durch die Konkurrenz gar nicht genug von diesen Schätzenvernutzen kann.
„In einer wahrhaft ökologischen Welt wird der Begriff der Natur sich in Rauch auflösen,“ meint der US-Philosoph Timothy Morton (in: „Ökologie ohne Natur“ 2016). Er denkt dabei an eine glückliche Aufhebung der Trennung von Subjekt und Objekt, Kultur und Natur. In Wirklichkeit löst jedoch unsere anthropozentrische Kultur die Natur in Rauch auf.
Dieses globale Unglück reicht weit zurück: Alles um uns herum basiert heute auf Mathematik: die Wände, die Möbel, die Kleidung, die Bücher, das Geschirr, das ganze Haus, die Straße, die Farben, die Töne, die Regierung… „Alles ist Zahl“ (Pythagoras). Das „Zählen“ begann mit der Heiligung der Zahlen durch Pythagoras. Wenig später gelang es kaufmännisch gewieften Pythagoräern bereits, einige Städte auf Sizilien an sich zu bringen, indem sie deren Bürger „zahlen“ ließen. Sie wurden von ihnen bald davongejagt, vorher ersetzten sie aber deren lokale Zahlungsmittelnoch durch ein gemeinsames: den ersten Euro, wenn man so will.
Gegen all das wehrt sich nun der kleine Mann auf der Straße („the man on the street“) – gerne auf Facebook mit farbig hinterlegten Sinnsprüchen wie: „Anstatt Dinge zu lieben und Menschen zu benutze, Sollten wir lieber Dinge benutzen und Menschen lieben.“ Im Kommentar heißt es dazu: „Genau“
Aber auch das gehört noch zu den ganzen „Kaputtheiten“, die von den aus Nah und Fern eingeflogenen Künstlern im „Theater der Dinge“ mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln der Darstellung für die systemkritischen Berliner aufbereitet werden sollen. Die Veranstalter versprechen zudem einen „hohen Lustfaktor“ („gefördert von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa“). Da kann eigentlich nichts mehr schief gehen.

Demonstration
.
Staubsauger
In Kreuzberg gab es 1986 eine Zeitschrift namens „Ich und mein Staubsauger“, einer ihrer Autoren war Max Goldt. Ab Mitte der Siebzigerjahre begann die große Zeit der Staubsauger. Sie wurden immer billiger und laufend verbessert. Was der Manta bei den Autofreaks war bei den Staubsaugerfans der „Vorwerk Kobold“, in der DDR der reparaturfreundliche „Omega“. Es gab Leute, die jeden Tag ihre Wohnung staubsaugten, andersherum galten Staubsauger in den besetzten Häusern als spießig. Seit 2000 mehrten sich die Staubsauger-Geräusche in den Zimmern über und unter mir, wo immer ich wohnte. In diesen reaktionär-digitalisierten Zeiten wunderte es mich deswegen nur wenig, als jetzt in einem Mietshaus ein Beschwerdezettel angebracht wurde, den jemand mit Smartphone abfotografierte und im Facebook veröffentlichte: „Wir haben Sie seit Wochen nicht saugen hören! Bitte reinigen Sie Ihre Wohnung bevor Mäuse kommen! Gez. Ehepaar Mörig, 1. OG“
Es erschienen ganze Bücher über den Staub, seine Bildung und seine Inhaltsstoffe. Bei den Wohnungsverwaltungen häuften sich die Beschwerden von Mietern: „Ihre Putzkolonne hat wieder nur den Staub nass verteilt.“ Die Intelligenzpresse berichtete über einen neuen Staubsauger, der von Männern zum Onanieren benutzt wurde, wobei es gelegentlich zu Verletzungen kam. 1978 hatte bereits der Münchner Urologe Theimuras Michael Alschibaja eine Dissertation über „Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsaugern“ veröffentlicht.
Vereinzelt war dann auch von Staubsauger-Masturbantinnen die Rede. Eine wurde berühmt: In den Sechzigerjahren brachte man einer Schimpansin die Taubstummensprache bei. Lucy wuchs im Haus des Psychotherapeuten-Ehepaars Temerlin auf, hatte einen Sprachlehrer, Roger Fouts, und der hatte eine Assistentin, Sue Savage-Rumbaugh. 2012 berichtete die Neue Zürcher Zeitung: „Wer zu dieser Zeit das Haus der Temerlins betrat, wurde Zeuge eines ungewöhnlichen Familienlebens. Hatte Lucy Durst, ging sie in die Küche, öffnete den Schrank, nahm einen Teebeutel heraus, kochte Wasser und füllte die Tasse. Dann setzte sie sich aufs Sofa und blätterte in Zeitschriften, am liebsten hatte sie die National Geographic. Bald entdeckte sie auch härteren Stoff wie Bourbon und Gin.“ Wenig später kam eine neue Vorliebe hinzu. „Eines Nachmittags saßen Jane und ich im Wohnzimmer und beobachteten, wie Lucy die Stube verließ“, berichtete Temerlin. „Sie ging in die Küche, öffnete einen Schrank, nahm ein Glas heraus, holte eine Flasche Gin hervor und schenkte sich drei Finger hoch ein. Damit kam sie zurück in die Stube, setzte sich auf die Couch und nippte. Doch mit einem Mal schien ihr ein Gedanke zu kommen. Sie erhob sich wieder, ging zum Besenschrank, holte den Staubsauger hervor, steckte ihn in die Steckdose, schaltete ihn ein und begann, sich mit dem Saugrohr zu befriedigen.“ Ihre beiden Betreuer fanden das nicht nur lustig. Lucy war eigentlich gar kein Affe mehr: „Sie war gestrandet, befand sich irgendwo zwischen den Arten.“
2018 erschien Meir Shalevs Roman „Meine russische Großmutter und ihr amerikanischer Staubsauger“. 2019 kam eine „Weltneuheit“ auf den Markt – von der schwäbischen Firma „Fakir“, die ihr Staubsaugermodell „Filter Pro“ nannte: „Der neue Zyklon-Staubsauger ‚Filter Pro‘ entfernt nicht nur jeglichen Schmutz von Boden, Couch und Co., sondern befreit zeitgleich die Raumluft von Feinstäuben, Schadstoffen, Staubpartikeln, Pollen und Gerüchen. Dafür sorgt zum einen die fein abgestimmte Kombination von acht Filtern. Zum anderen aber ein ganz besonderer Clou: der erstmals in einem Staubsauger eingebaute elektrostatische Filter sowie ein integrierter Ionisator. Dank dieser Filterung und Ionisierungstechnologie wird der beutellose ‚Filter Pro‘ zum Staubsauger und Luftreiniger in einem.“
Unklar ist, ob die inzwischen türkische Firma „Fakir“ genaugenommen zu einem amerikanischen Staubsaugerkonzern gehört, dessen Gründer mit der Erfindung eines beutellosen Staubsaugers reich wurde. Die Autorin Jenni Zilka bezeichnete sein Gerät 2020 in einem Feuilleton als „Saugroboter“: „Ganz klar ist mir zwar nicht, wo der viele Staub, die vielen, vielen Legosteine und die vielen, vielen, vielen Ohrringverschlüsse hingehen, wenn nicht in den Beutel, aber ich kann mir sein Produkt leider nicht leisten, um nachzuforschen…Es ist teuer – schließlich ist er damit nicht von ungefähr Milliardär geworden. Der saubere Industrielle residiert abwechselnd in verschiedenen Villen in verschiedenen Ländern, jede von ihnen hat etwa die Größe einer Napola; dazu besitzt er neuerdings auch noch ein Apartment in der ‚Park Avenue 520‘.“
Die staubsaugerinteressierte Jenni Zylka besaß selbst einmal einen Saugroboter, „allerdings einen sehr kleinen, markenlosen. Als ich ihn das erste und letzte Mal einsetzte, ging ihm nach zwei Minuten Saugens an einem Kekskrümel die Puste aus und er verkeilte sich in einem Schuhhaufen.“
.

Die Arbeiterin Zina
.
Zahlen/Listen
Viele Leute gehen beruflich mit Zahlen um, Buchhalter z.B.. Oftmals wissen sie dabei gar nicht oder wollen nicht wissen, was sich hinter den Zahlen verbirgt. Im Varieté treten gelegentlich Zahlengedächtniskünstler auf. Es gibt Autisten, die bis zu 18stellige Primzahlen im Kopf haben.
Der Biologe Konrad Lorenz schrieb – auf dem Königsberger Kant-Lehrstuhl: „Die Gesetze der reinen Mathematik sind für Kant wie die der Geometrie von jeder Erfahrung unabhängig, apriorisch, denknotwendig und besitzen daher für ihn eine absolute Geltung.“ Das kritisierte er als Verabsolutierung einer Abstraktion. Für Lorenz ist die Mathematik ursprünglich eine Anpassungsleistung des menschlichen Denkorgans an die Außenwelt: Die Mathematik sei nämlich durch das Abzählen realer Einheiten entstanden. Dabei arbeite sie mit Abstraktionen. Zwei Einheiten seien sich aber nur deshalb absolut gleich, „weil es ,genaugenommen‘ beide Male dieselbe Einheit ,nämlich die Eins‘ ist, die mit sich gleichgesetzt werde“.
So sei die „reine mathematische Gleichung letztlich eine Tautologie“, und die reine Mathematik wie die Kantischen apriorischen Denkformen inhaltsleere Verabsolutierungen: „Leer sind sie tatsächlich ‚absolut‘, aber absolut leer.“ In der Mathematik besitze „Gültigkeit immer nur der leere Satz“. „Die Eins, auf einen realen Gegenstand angewandt, findet im ganzen Universum nicht mehr ihresgleichen.“ Wohl seien 2 und 2 vier, „niemals aber sind zwei Äpfel, Gänse oder Atome gleich zwei anderen, weil es keine gleichen Äpfel, Gänse oder Atome gibt.“
Diesen Abstraktionsvorgang hat der friesische Inselvogt auf der Vogelinsel Memmert, Enno Janßen, in 18jähriger Einsamkeit inmitten von 11.000 Brutpaaren auf der kleinen Nordseeinsel nahe Juist für sich gestoppt. In seinem Buch „Der Inselvogt von Memmert“ (2021) schreibt er: „Vom Festland her war ich gewöhnt, auf Tage hinaus zu planen und mein Programm auch durchzuziehen…Alles war kalkulierbar, die Umstände wie auch ich selbst.“ Auf der Vogelinsel ist ihm nun „leichter“: Sein „Leben richtet sich nach der Witterung, den Gezeiten, der Windstärke und dem Lebensrythmus der Vögel.“ Zudem darf er dort „praktisch nichts machen…Überhaupt ist alles verboten bis aufs Zuschauen.“
Dennoch entkommt auch der Inselvogt den Zahlen und Listen nicht: Er muß die Vogelarten zählen, die Brutpaare, die Rastvögel und die zum Jagen einfliegenden Greifvögel. Eigentlich zählt er alle und alles, sogar die angeschwemmten toten Seevögel.
Er erwähnt es nicht, aber seine Zahlen werden von ihm sicher in Listen übertragen, wahrscheinlich auf vorgedruckten Blättern oder vielleicht auch schon online auf Excel-Tabellen. Statistisch ausgewertet und abgelegt werden sie dann in der staatlichen Vogelwarte Helgoland.
Es gibt viele Leute, die ständig Listen anfertigen („To-Do“-Listen u.a.) . Der Dokumentarfilmer Michael Glawogger erstellte sogar Listen von seinen Listen. In der Informatik ist die Liste eine „Datenstruktur“.
Der Inselvogt gibt seinem mutmaßlich aus der jüngeren Generation kommenden Nachfolger zu bedenken: „Ohne ein Gehirn, das sich von den allgegenwärtigen digitalen Lebensbewältigungshilfen freimachen kann, wird man auf der Insel kaum glücklich werden.“
Und darum geht es – trotz aller Zählprobleme (u.a. bei der „schwierigen Rastvogelerfassung“; hierbei kommt es jedoch „bei 25.000 Vögeln einer Art nicht auf hundert mehr oder weniger an“).
Den auf Memmert einst brütenden 14.000 Großmöwenpaaren wurden lange Zeit die Eier geklaut. Das gehörte zu einem „Möwendezimierungsplan“, an der Küste, der jedoch in den Siebzigerjahren gestoppt wurde. Auf der „Möweninsel“ vor Schleswig sammelte ein Pächter, der „Möwenkönig“, die Eier weiter ein. Der Verkauf wurde ihm jedoch 1989 von der Landesregierung verboten, als die Fischkutter keine Fische und Krabben mehr anlandeten und die Möwen auf die Müllkippen der Stadt ausgewichen waren, was ihre Eier angeblich vergiftete. Heute brütet nur noch ein Bruchteil der Möwen auf der Insel und der Möwenkönig bewacht ihre Gelege.
Der Inselvogt meint, dass „der Verzehr von Möweneiern inzwischen unbedenklich ist, da die offenen Müllkippen abgeschafft wurden“.
Von der Vogelinsel Trischen vor Dithmarschen berichtete die Vogelwartin Anne von Walmont (in: „Und an den Rändern nagt das Meer. Sieben Monate auf der Vogelinsel Trischen“ – 2021), dass die Möwen dort junge Möwen fressen, aber nur Sonntags, wenn die Krabbenkutter nicht ausfahren, und die eigenen Kinder hungern.
Der Vogelwart auf Memmert berichtet dagegen, dass „seine“ Möwen bei den Nichtmöwen in ihrer Kolonie oder bei Nachbarn räubern, falls „ein Versorgungsengpaß auftritt“. Im Übrigen vertritt er, basierend auf seinen langjährigen Beobachtungen, einen starken „Bewußtseins“-Begriff und einen schwachen „Instinkt“-Begriff (damit ist er nicht mehr allein), und dass er lieber mit den Vögeln als mit langweiligen Menschen zusammen ist. Ähnlich sieht das auch die finnische Ethnologin und Vogelbeobachterin Ulla-Lena Lundberg. In ihrem Buch „Sibirien: Selbstporträt mit Flügeln“, das von einer ornithologischen Expedition in die einstige GULAG-Region um Magadan handelt, schreibt sie: „Von Vogelbeobachtern heißt es, sie seien Menschen, die von anderen Menschen enttäuscht wurden. Darin liegt etwas Wahres, und ich will nicht leugnen, dass ein Teil des Entzückens, mit anderen Vogelguckern gemeinsam draußen unterwegs zu sein, in der unausgesprochenen Überzeugung liegt, die Vögel verdienten das größere Interesse.“
.

Arbeiterinnen in der Revolution
.

Arbeiterin in Schokoladenfabrik (1980)
.
Doppelleben
Kürzlich verbrachten wir ein Wochenende in Hettstedt – im Mansfelder Land. Es ging um die Bergwerke und Fabriken dort, die zuletzt zum Mansfeld Kombinat gehörten. In Hettstedt ist davon noch das Mansfelder Kupfer- und Messingwerk (MKM) übrig, das nun einem Mailänder Konzern gehört. Auch wir konzentrierten uns auf den Kupferbergbau, dabei kam u.a. der Gedanke auf, dass die DDR ihre Kupferförderung subventionierte. Aber war im Rahmen des Wirtschaftsverbandes der sozialistischen Länder nicht eine andere „Weltwirtschaft“ entstanden, in der es z.B. sinnvoll war, die nach westlichen Maßstäben unwirtschaftlichen Kupfervorkommen zu fördern und zu verarbeiten (wobei noch weitere 18 z.T. seltene Metalle gewonnen wurden)?
Mit Fahrrädern des „Zentrums für Medienkunst Werkleitz“ fuhren wir zum Schloß der Hardenbergs, dem Geburtshaus von Novalis, nach Wiederstedt im Kreis Hettstedt, wo die Werkleitz-Kader sich in einer Klosterscheune nebenan eine Ausstellung vorstellen können – über den Bergbau im Mansfelder Land. Der romantische Dichter Novalis war Bergbau-Ingenieur gewesen, er hatte in der Bergbau-Akademie Freiberg studiert und es bis zum Salzbeisitzer und Amtshauptmann gebracht, als er 1801 im Alter von 29 Jahren an der Schwindsucht starb.
Im Zuge der Industrialisierung, „mit der Geologie als Leitwissenschaft einer Umbruchzeit“ (F. Fühmann), an der Friedrich von Hardenberg als „Modernisierer“ beteiligt war, dachte und dichtete er als Novalis gleichzeitig die Gegenbewegung. Das erschien schon seinen „Mitromantikern“ seltsam. Dieser Widerspruch übte z.B. auf Ludwig Uhland „eine sonderbare Wirkung“ aus. Ihn und anderen „störte“ es geradezu, Novalis als Bergbauingenieur zu denken, was aber in ihrem Nekrolog für das junge Genie natürlich nicht unterschlagen werden durfte. Ebensowenig, dass Novalis sich nach dem Tod seiner ersten Braut Sophie (der er in überschwänglicher Liebe seine „Hymnen an die Nacht“ hinterhergeschickt hatte), ein zweites Mal – mit Julie, der Tochter eines Bergrates – verlobte. Das störte „die Poesie“, wie der Arzt und Dichter Justinus Kerner fand, „aber sein Tod“ sei „schön und vieles schön“.
In der DDR wollte der Rat des Kreises Hettstedt das Geburtshaus des frühromantischen Dichters Novalis abreißen, an den frühen Bergbau-Experten Friedrich von Hardenberg dachte man dabei nicht, obwohl mehrere Schriftsteller, die im Mansfeld-Kombinat Bergbau-Wissen gesammelt oder sogar wie Franz Fühmann Unter Tage gearbeitet hatten (siehe: „Im Berg“ 1993), novalistisch gestimmt im Bergmann „eine Schlüsselgestalt der Romantik“ sahen.
Gegen den von oben beschlossenen Abriss des Hardenberg-Schlosses gründete sich quasi von unten eine „Interessengemeinschaft Novalis“. Diese nahm Kontakt zu diversen Novalis-Freundeskreisen in Westdeutschland auf – und geriet dadurch prompt unter geheimdienstliche Beobachtung, was in den „Vorgang: „IG Novalis“ gipfelte, in der es vor allem um den IG-Gründer „A.“ aus dem Kreis Hettstedt ging. Für den Herbst 1989 war ein Ost-West-Treffen am zum Abriß bestimmten Schloß geplant. „Der A. soll dieses Treffen arrangieren, wobei er zum Ausdruck bringt: ‚Wir sind nicht kleinlich‘. Dies bringt u.a. auch zum Ausdruck, dass die materielle Interessiertheit des A. erkannt wurde.“ Einige Monate nach Eröffnung der ersten zwei Räume der „Novalis-Gedenkstätte“ wurden Maßnahmen erwogen, denn „A. ließ eine bedenkliche Internationalisierung der Novalis-Aktivitäten erkennen“. Aber das wurde dann nicht weiter verfolgt, weil die Auflösung der Sicherheitsapparate der DDR im Herbst 89 immer näher rückte.
Dafür sieht jedoch heute das Novalis-Geburtshaus wie neugeboren aus. Es beherbergt die Internationale Novalis-Gesellschaft, ein Novalis-Museum und hat mehrere festangestellte Novalis-Erbepfleger inklusive Gärtner. Wir saßen im Obstgarten des Schlosses und sprachen über Novalis als Bergbauingenieur, der während seines Studiums in Freiberg die Professoren (u.a. für „Bergbaukunst“) direkt bezahlte und deswegen keine Studentenuniform tragen mußte.
Der Novalis-Biograph Professor Gerhard Schulz an der Universität von Melbourne behauptet (in: „Leben und Werk Friedrich von Hardenbergs“ – 2011): „Es gab bei ihm keinen grundsätzlichen Widerspruch zwischen Salzbeisitzer und Dichter“. Nicht einmal seine zweite Verlobung soll ihn „aus dem Konzept“ gebracht haben. Novalis selbst meinte, es gehöre zu einer „vollendeten Bildung“, dass man Hofmeister, Professor, Handwerker, Diener und eine zeitlang auch Schriftsteller gewesen sei, nur die Schauspielerei solle man meiden, da sie „manche Bedenklichkeit erregt“. Sein „romantischer Schwung“ würde im übrigen „in dem alltäglichen, sehr unromantischen Gange meines Lebens viel von seinem schädlichen Einfluß auf meine Handlungen verlieren.“
Im Obstgarten seiner Eltern kamen wir leider nicht mehr auf die Frage zurück, ob die Kupferförderung von der DDR „subventioniert“ wurde, d.h. ob auch vor 1989 schon ein einziger „Weltmarkt“ existierte, nach dem man die Bergwerksökonomie auch der DDR beurteilen durfte. Aber klar war: Wenn Hardenberg als Ingenieur Vernutzung, Fortschritt und Konkurrenz beförderte, dann dachte er als Novalis zugleich deren Ende mit, das darin bestand, in der Natur eine „wunderbare Gemeinschaft [zu] entdecken und sich selbst als Teil von ihr“ – eine „zarte Befreundung“, der wir uns heute vielleicht mit den Begriffen Symbiose, Empathie und interesseloses Wohlgefallen annähern.
.

Arbeiterin auf einer Großbaustelle
.
Amazonen (1)
Das Pferd stirbt nicht aus, weil es den Übergang vom Nutztier zum Heimtier schaffte. Gleich hinter Spandau, in Dallgow-Döberitz, wo seit der Wende mehr Pferde als Menschen leben, gibt es einen Reiterhof mit Pferdepension und einer Reithalle, in der man vom Café im ersten Stock aus den jungen und älteren „Amazonen“ zuschauen kann, wie sie auf ihrem Pferd Runde um Runde drehen und sich dabei im Takt des Pferdeschritts betont vorschriftsmäßig vom Sattel erheben. Irgendwo auf dem Parcours lauert immer ein Reitlehrer.
In der Pension hat auch eine Westberliner Polizistin ihr Pferd stehen. Sie kommt mehrmals in der Woche, um es zu reiten – in der Halle, aber auch außerhalb – durch das Dorf raus in die Döberitzer Heide.
Dieser 3422 Hektar große Truppenübungsplatz, zuletzt für die Rote Armee, war 2005 zum größten Teil von der Sielmann-Stiftung erworben und in riesige Gehege für fast ausgestorbene und rückgezüchtete Rassen – wie Wisente und Przewalski-Pferde – umgewandelt worden.
Die Polizistin hatte bis 2005 zu der aus Kostengründen abgeschafften Westberliner Reiterstaffel gehört, die u.a. im Tiergarten patroullierte. „Wer reitet herrscht!“ hatte der nationalsozialistische Staatsrechtler Carl Schmitt einst bemerkt. Heute, da Pferde aus Chrom und Stahl gemacht sind, die von kleinen fetten Männern geritten werden, trifft eher das Gegenteil zu: Es sind nun vornehmlich Mädchen und Frauen, die reiten – und ihnen geht es dabei eher um „interspecies communication“.
Ich hatte die rothaarige Polizistin auf ihrem „Fuchs“ immer mal wieder „im Dienst“ gesehen, meist ritt sie zusammen mit drei Kollegen durch den Tiergarten, wo sie sich z.B. am Rand der „Schwulen-Wiese“ und angesichts der vielen Nackten dort in ihrer Reiterkluft hoch zu Roß etwas seltsam ausmachte. Man muß jedoch sagen, dass ihr das enge Reiterkostüm sehr gut stand und ihr Dienstpferd sehr attraktiv aussah.
Dass die schöne Polizistin aber doch eine Polizistin war, eine regierte, merkte man, wenn ihr kleiner Trupp z.B. den „17.Juni“ entlangritt – im Schritttempo. Im Kreisverkehr an der Siegessäule ritten die vier in Richtung des Bundespräsidenten-Palais. Aus nächster Nähe sah ich, wie die Polizistin mit ihrem Pferd in den Spreeweg einbog. Dabei hielt sie die Zügel locker in der Hand und drückte in der Kurve das Tier mit ihren Schenkeln leicht nach rechts, was ziemlich „amazonisch“, wenn nicht gar „kentaurisch“ aussah. Aber dann streckte sie die rechte Hand waagerecht aus und bewegte den Arm auf und ab – wie Radfahrer es beim Abbiegen machen (sollen). Absolut vorschriftsmäßig. Es sah aber grauenhaft aus.
Wenn die Polizistin, die ihren Dienst seit 2006 in einem Streifenwagen versieht, sich jetzt nach Feierabend ihrem Pferd in Dallgow-Döberitz widmet und mit ihm ausreitet, hält sie sich viel weniger an die Verkehrsregeln. Sie ist mit einem Feuerwehrmann verheiratet, der sie aber nur selten zum Reiterhof begleitet. Ansonsten sind die meisten „Amazonen“, die dort ihr Pferd stehen haben und Reitstunden nehmen oder sich ein Pferd ausleihen, mit relativ wohlhabenden Männern verheiratet bzw. sind Töchter aus mehr oder weniger gutbetuchten Familien. Viele zogen nach der Wende von Westberlin in die nahe „Waldsiedlung“ Falkensee, einige der Reiterhöfe in Dallgow-Döberitz zogen ebenfalls aus Westberlin dort hin.
Die Görlitzer Schriftstellerin Roswitha Haring hat die letzten Nutzpferde auf den Straßen noch mitbekommen: Sie sahen elend aus und gingen in einer Wolke von Gestank, denn sie zogen die Fuhrwagen mit den Abfällen von Lebensmitteln, wie sie sich in ihrer Erzählung „Stadt Tier Raum“ (2013) erinnert. Ganz anders sahen dagegen die Pferde auf den Postern aus, die sie im Kinderzimmer ihrer Freundin sah: „Sie rannten über Felder, am Strand entlang, sprangen über Zäune, die Mähnen wehten, das gestriegelte Fell glänzte.“ Ihre Freundin „ritt auch ein solches Pferd irgendwo am Rand der Stadt und sprach über diese einmal wöchentlich stattfindenden Nachmittage immer in schwärmerischen, aber wenigen Worten.“
Die badische Genderforscherin Marion Mangelsdorf spricht von „’Liebesgeflüster‘ zwischen Menschen und Pferden“ “ in ihrem Aufsatz „Möglichkeiten und Grenzen speziesüberschreitender Emotionalität“, der 2013 in der Berliner Zeitschrift „Tierstudien“ veröffentlicht wurde, die dem Thema „Tierliebe“ gewidmet war.
Der Dichter Gottfried Benn nannte das „Freizeitreiten“ dagegen abfällig „Sodomiterei als Rasensport“. Das Sportpferdezuchtland Niedersachsen hat jüngst sogar „das Voltigieren zum Abiturfach“ erklärt. Dabei handelt es sich um eine Turnübung mit und auf einem Pferd, das laut der Süddeutschen Zeitung die aus Niedersachsen stammende Verteidigungsministerin von der Leyen empfohlen hatte, weil es den Mädchen ermögliche, „eine perfekte Kombination aus Akrobatik, Harmonie und Vertrauen“ einzuüben, was ihr z.B. bei der späteren Karriere sehr geholfen habe.
.
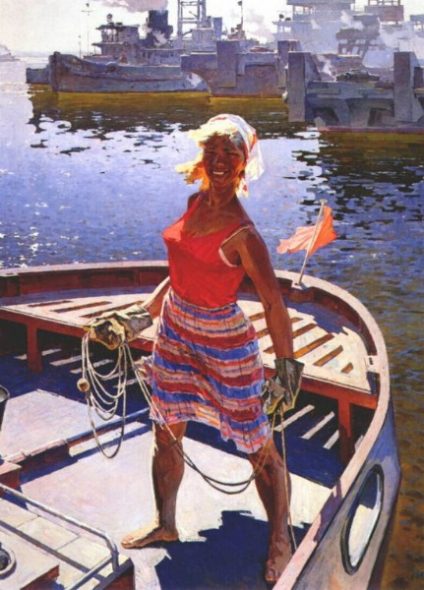
Arbeiterin auf einem Wolgaschiff (von Yuri Bosko)
.

Strassenverkäuferin
.
Amazonen (2)
Die Freizeitreiterinnen, „Amazonen“, hat auch der Leiter des Marburger Literaturarchivs Ulrich Raulff in seinem Sachbuch „Das letzte Jahrhundert der Pferde“ (2016) thematisiert: eine „Geschichte der Trennung“. Gemeint ist damit eine Trennung der Pferde von den Männern, die es als Nutztier (in der Landwirtschaft, im Transportwesen, bei Polizei und Militär) abschafften und durch Technik ersetzten. Heute gibt es zwar schon wieder über eine Million Pferde und Ponys in Deutschland, aber sie dienen vor allem sportlichen und therapeutischen Interessen – und vorwiegend von Mädchen und Frauen. Ulrich Raulff schreibt: Die Pferde sind „Seelsorger der weiblichen Pubertät…Die Verbindungen zwischen Menschen und Pferden, die heute eingegangen werden, sind Liebesbeziehungen, Herzensgemeinschaften und Sportkameradschaften.“ Um diese zu „optimieren“ gibt es inzwischen mindestens „zwei Dutzend Periodika für Ross und Reiter“ und hunderte Ratgeberbücher von „Pferdeflüsterern“. Den Anfang machte die kanadische Tiertrainerin Linda Tellington-Jones in den Sechzigerjahren.
Die Regisseurin Monika Treut schrieb über ihren Film „Von Mädchen und Pferden“ (2014): „Die Körperlichkeit und Energie des Reitens, das Pflegen und Zähmen der scheuen und starken ‚Fluchttiere‘ hatte eine eigene Erotik, die uns bezauberte und erdete.“ Monika Treut war selber einmal eine junge „Amazone“. Mit ihrem Film wollte sie zeigen, „wie ein ‚troubled teenager‘ durch den Kontakt mit den Pferden langsam fähig wird, eine Beziehung zu sich selbst aufzunehmen und Vertrauen zu anderen aufzubauen.“
Für die „kleinen Amazonen“, die Rulff auch „Pferdemädchen“ nennt und die „ein spezieller Fall sind, eine Welt für sich,“ gibt es zunächst den „Ponyhof“, auf dem man aber bekanntlich noch nicht das richtige Reiterinnenleben kennenlernt.
Für die großen – historisch jedoch nicht unbedingt verbürgten – Amazonen schuf der Bildhauer Louis Tuaillon beizeiten bereits – 1895 – ein Denkmal in Originalgröße, das am Tiergarten aufgestellt wurde, wo es noch heute steht. Ulrich Raulff beschreibt es so: „Die jugendliche Kriegerin, sattellos reitend, eine kleine, wenig bedrohliche Streitaxt in der Hand, ist nur mit einem Hauch von einem Chiton bekleidet, der ihre zierlichen Formen mehr hervorhebt als verhüllt und Gesäß und Schenkel freiläßt. Dort, wo sie das Pferd berührt, ist die Amazone vollkommen nackt.“
Es hat sich herumgesprochen, dass Frauen eine größere „soziale Kompetenz“ haben als Männer, und nicht nur das, diese findet auch zunehmend Eingang in das Geschäftsleben und wird dort als Qualifikationsmerkmal „nachgefragt“. Die Basler Philosophin Angelika Krebs hat den Frauen darüberhinaus auch eine größere „dialogische Kompetenz“ attestiert, die aber eigentlich zum Gelingen einer Beziehung für beide Beteiligten notwendig wäre. Dazu erklärte sie: „Viele Frauen lernen das schon im Mädchenalter. Warum reiten sie so gern? Sie haben mit dem Pferd bereits ein Verhältnis zu dem anderen, während Kraftsport diese Kompetenz nicht entwickelt. Da gibt es einen klaren Gender-Unterschied.“
Für Ulrich Raulff wird der „Reiterhof“ einige Jahre lang „zur Gegenwelt von Schule und Familie, ein Abenteuer, während dessen das Mädchen die Möglichkeit einer Wildheit in sich selbst entdecken kann, für die ihm jenseits des Amazonenreviers kein Raum zur Verfügung steht.“ Über „junge Mädchen, Pferde und die tieferen Gründe ihrer Affinität“ sei allerdings „das letzte Wort noch nicht gesagt“.
Der Freud-Biograph Ernest Jones fand erst einmal die „innige Zusammenstellung von Pferd und Frau in Dichtung, Spruchweisheit und Redensart ganz eigentümlich – und uralt.“ Neuerdings hat der Literaturwissenschaftler Wolfgang Matz den drei großen Ehebrecherinnen in den berühmten Gesellschaftsromanen des 19. Jahrhunderts – Madame Bovary, Anna Karenina und Effi Briest – eine Studie gewidmet, die er im Untertitel um den Zusatz „und ihre Männer“ ergänzte, wobei es laut Ulrich Raulff stattdessen auch „Emma, Anna, Effi und ihre Pferde“ hätte heißen können.
Vor einiger Zeit war ich auf einem Lesewettbewerb der 5. und 6. Klassen in einer Steglitzer Schule. Nicht nur, dass viele Mädchen Anna oder Emma hießen, alle lasen auch romantische Pferdegeschichten vor. Die meisten waren auch schon auf einem Reiterhof in Brandenburg gewesen. Dort nutzt man allerdings nicht selten (das weiß ich von ihren Müttern) die sich bei ihren Töchtern gerade im Verkehr mit dem Pferd oder Pony entwickelnde „soziale Kompetenz“ übelst aus: Sie bekommen nichts als Müsli zu essen, müssen die Ställe ausmisten, die Pferde endlos striegeln und überdies Hilfsdienste auf dem Hof leisten, so dass sie kaum zum Reiten kommen und ihre Eltern trotzdem viel Geld dafür zahlen müssen.
Darüberhinaus hat dieser Erwerb von sozialer Kompetenz auch noch einen anderen Preis. Der Spiegel zitierte 2012 den „Experten für Sicherheit im Reitsport“, Norbert Meenen: „Bei Frauen ist Reiten aufgrund seiner Beliebtheit die Sportart mit den meisten Unfallopfern. Jährlich verunglücken etwa 93.000 Menschen.“ Aber die Dunkelziffer sei hoch, weil viele Reitunfälle nicht gemeldet werden.
.

Arbeitern auf einer Briefmarke
.

Drei Mütter auf Antikriegs-Plakat (1957)
.
Bevölkerungsrückgänge
1972 gründeten Bernhard Grzimek und Konrad Lorenz mit anderen Naturforschern und Umweltaktivisten die Gruppe Ökologie. In ihrem Gründungsmanifest heißt es: „Wer die Überbevölkerung weiterhin fördert, bringt uns dem gemeinsamen Selbstmord näher.“
Bevölkerungswissenschaftler beruhigten sie: Mit der sich ausbreitenden Industrialisierung und der Proletarisierung von Kleinbauern würde die Steigerungsrate nach unten gehen. So wie z.B. bei der schlesischen Umwandlung der Gutsarbeiter in Bergarbeiter: dabei sank ihre Kinderzahl von 12 auf 4.
In Westeuropa war ferner in demoskopischer Hinsicht der „Pillenknick“ bedeutsam. Seit einigen Jahren geht es aber wieder anders herum. Man spricht von der „Überalterung“ einer („unserer“) Gesellschaft und von „Alterspyramiden“, wogegen eine rasche Vermehrung, nicht nur „unserer“ Gesellschaft, not tue.
Die NZZ titelte am 9.Mai 2021: „Die Chinesinnen wollen keine Kinder mehr bekommen. Ihnen ist auch die Lust auf eine Hochzeit vergangen. China steht vor einer demografischen Krise.“ Weiter heißt es: „Chinas Demografie-Experten haben ihre Prognosen geändert. Bisher waren sie davon ausgegangen, dass es erst ab 2030 weniger Chinesinnen und Chinesen auf dem Festland geben wird; nun haben sie diesen Wendepunkt auf das kommende Jahr vordatiert.“
Die New York Times berichtete am selben Tag: „China versucht, Geburten in Xinjiang zu unterdrücken. Die chinesischen Behörden zwingen Frauen in der Region Xinjiang dazu, sich entweder Spiralen einsetzen zu lassen oder sich sterilisieren zu lassen. Damit verschärfen sie ihren Griff auf die muslimischen ethnischen Minderheiten und versuchen, eine demografische Verschiebung zu orchestrieren, die ihre Bevölkerung über Generationen hinweg schrumpfen lassen wird.“ „Orchestrieren“ meint hier wohl eine Rassenpolitik an breiter Front.
Der österreichische Kurier schreibt: „Wegen Pandemie: Drastischer Geburtenrückgang in den USA erwartet. Forscher haben anhand von früheren Krisen eine Hochrechnung erstellt. Sie gehen davon aus, dass in den USA 2021 rund 500.000 weniger Babys geboren werden.“
Diese Staaten haben ein absurdes Problem: Sie wollen immer mehr Menschen (reinblütige Chinesen die einen, weiße Amerikaner die anderen). Es leben aber doch bereits 8 Milliarden Menschen auf der Erde, das sind bereits 16 Milliarden zu viel – gerechnet in Ressourcenvernichtungseinheiten.
Die indianisch-deutsche Bestseller-Autorin Louise Erdrich hat einen dicken Roman über dieses absurde Problem geschrieben: „Der Gott am Ende der Straße“ (2019). Es geht darin um faschistischen US-Fundamentalisten, die alles tun, damit Frauen Kinder gebären. Es werden u.a. Prämien gezahlt für Denunzianten, die schwangere Frauen anzeigen. Diese werden dann bis zur Geburt ihres Kindes inhaftiert, das Kind wird ihnen weggenommen. Andere Frauen werden verhaftet und künstlich befruchtet.
An Bernhard Grzimek und seine Warnungen vor einer Überbevölkerung erinnerte zuletzt die Journalistin Claudia Sewig mit einer Biographie „Der Mann, der die Tiere liebte“. Die Welt wollte es noch einmal wissen und fragte die Autorin: „Der Tierprofessor war ein Frauenheld?“ Sewig: „Er ließ nichts anbrennen, wie man so schön sagt. Neben seiner offiziellen Familie hatte er zwei Kinder mit einer langjährigen Geliebten, einer Schauspielerin. Nicht sehr konsequent für einen Menschen, der stets vor der Überbevölkerung des Planeten warnte.“ „Nutzte er die Frauen aus?“ Sewig: „In dem Maße, wie es zu seiner Zeit viele Männer taten, die etwas Besonderes leisten wollten.“ Zuletzt „heiratete er noch die Witwe seines Sohnes, seine Schwiegertochter, und adoptierte seine Enkel.“ In Summa: Bernhard Grzimek hat sich nicht an den von ihm propagierten Bevölkerungsrückgang gehalten. Das geht natürlich vielen Weltverbesserern so. An den Biologen und Nobelpreisträger Konrad Lorenz erinnerte derweil der bayrische Rundfunk. Dabei zitierte sie ihn aus einem Interview, das er der Zeitschrift „Natur“ gab, die er einst mitgegründet hatte: „Gegen Überbevölkerung hat die Menschheit nichts Vernünftiges unternommen. Man könnte daher eine gewisse Sympathie für AIDS bekommen. Eine Bedrohung, die die Menschen immerhin dezimieren, immerhin von anderen bösartigen Unternehmungen abhalten könnte. (….) Doch wenn wir das Problem durch Aufklärung und Erziehung lösen wollen, stoßen wir auf ein Problem: Es zeigt sich, dass die ethischen Menschen nicht so viele Kinder haben und die Gangster sich unbegrenzt und sorglos weiter reproduzieren.“
Aber nicht nur in politischer Hinsicht war Lorenz unakzeptabel geworden, auch seine Forschung wurde vom Bayrischen Rundfunk abgewertet: Da er seine Ergebnisse nur aus wenigen Einzelfällen gewonnen habe, seien sie nicht mathematisierbar und somit unbrauchbar.
In „Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit“ (1972) hatte Lorenz geschrieben: „Gegen Überbevölkerung hat die Menschheit nichts Vernünftiges unternommen.“ Aber nun geht es anscheinend darum, etwas gegen die Unterbevölkerung zu unternehmen.
.

Arbeiterin in einer Fischfabrik (von Igor Razdrogem)
.
Dämmerung der Petromoderne
Im „Anthropozän“ kommen die von der technisch-wissenschaftlichen Moderne verdrängten Weltbilder der Indigenen und der Romantiker wieder zur Geltung (ob auch zum Tragen, ist noch nicht ausgemacht). Ethnologen wie Eduardo Viveiros de Castro, Politologen wie James C. Scott versuchen zu vermitteln – für die Gebildeten unter den Verächtern der staatenlosen Völker. Dazu gehörte auch, in den Dreißigerjahren bereits, der sowjetische Zoologe Sawwa Uspenski. Er erforschte die arktische Fauna und hielt das Verhältnis der Tschuktschen und Inuit zu ihren „Ernährern“ (den Robben, Rentieren, Moschusochsen, Walrossen, Walen, Eisbären, Vögeln und Fischen), ihre Ökonomie also, für ökologisch vorbildlich. Seltsam, dass die dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt geradezu verfallenen Sowjets ihm ein derartiges Foschungsergebnis durchgehen ließen. Anfang der Sechzigerjahre registrierte er nebenbeibemerkt schon die Klimaerwärmung und den Packeisrückgang.
Heute gehört der französische Wissenschaftshistoriker Bruno Latour mit seiner „Akteur-Netzwerk-Theorie“ (ANT) zu den bekanntesten Kritikern der Petromoderne. Für Latour gibt es keine ökonomische Utopie mehr, nur noch eine ökologische. Nicht trotz, sondern wegen Klimaerwärmung, Bienensterben und Artensterben, radioaktiver Verseuchung und Überfischung der Meere, Humusverlust und Verwüstung der Erde.
Kürzlich erschien ein „Atlas der Petromoderne“. Er behandelt die Petromoderne bereits als eine abgeschlossene Ära, seine Autoren, die Kuturwissenschaftler Alexander Klose (Berlin) und Benjamin Steininger (Wien), bereiten daneben seit 2017 eine „Retrospektive“ dieser Ära im Kunstmuseum Wolfsburg vor: „Oil. Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters“. Die Ausstellung eröffnet am 4. September. Dazu wird es einen Katalog geben mit Beiträgen von Fremdautoren, während der Erdöl-Atlas jetzt von den beiden Kuratoren selbst verfaßt wurde. Sie bereiten eine Kunstschau vor, die gleichwohl und quasi zwangsläufig die globalen Probleme Anthropozän, Klimaerwärmung, indigene Arbeits- und Lebensbedingungen thematisiert.
Der Eingangstext ihres Buches befaßt sich erst einmal mit dem Mythos „Atlas“ – ausgehend von der Idee des „Shell-Straßenatlas“, der seit 1950 bereits aufs Schönste Erdöl und Mobilität garantiert. Sowie auch ausgehend vom „Atlas-Gebirge“ – so wie Alexander von Humboldt dessen vertikal differenzierte Vegetation sah. Analog dazu geht es bei der Erdöl-Exploration und Förderung um (geologische) Schichtungen, um Geschichte und Geschichten. Bei den Tiefenbohrungen werden Bohrkerne zu Tage gefördert, die paläontologisch aufschlußreich sind. Im Atlas findet man dazu die Kapitel „Bohrprotokoll“ und „Bohrkern“. Wirtschaftswissenschaftlich aufschlußreich ist, dass die Unternehmen im Oilfield-Service inzwischen wichtiger als die Ölkonzerne geworden sind und dass außerdem fieberhaft nach Alternativen zu fossilen Energieträgern, d.h. nach regenerativen Energiequellen, gesucht wird.
Als Leitmotiv für den Atlas gilt: Mit der petromodernen Mobilität war in den letzten 100 Jahren die Idee der absoluten Freiheit und des Überflusses verbunden – und das ist vorbei. Dahinter ging es um die Kolonialisierung der Natur, wobei die Schönheit der menschlichen Kultur darin bestand, dass sie das überschreitet, dass sie alles überschreiten kann. „Das stimmt ja auch, aber nur, weil der Input an fossiler Energie da immer rausgerechnet wurde,“ meint Alexander Klose, der von „Extraktivismus“ spricht, sowie von „Neo-Extraktivismus“, wobei er uns als „Arbeiter“ denkt, die wir am laufenden Band Daten produzieren, die Rohstoff für IT-Konzerne und Geheimdienste sind. Im Atlas heißt das entsprechende Kapitel „Daten sind das neue Öl“. Die Verwertung unserer Daten, das ist sozusagen der Preis der (Internet-)Freiheit.
Während die Heinrich-Böll-Stiftung der Verbotspartei „Die Grünen“ unter „Neo-Extraktivismus“ eine „post-neoliberale Variante des klassischen rohstoffbasierten Wirtschaftsmodells“ in Lateinamerika versteht, „in der über Rohstoffeinnahmen vermehrt Entwicklungs- und Sozialprogramme finanziert werden. Die negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen der Rohstoffausbeutung bleiben jedoch bestehen“. Die US-Amerikaner halten am verbissensten an der Petromoderne fest, seltsam, dass gerade die grünen Vordenker (u.a. der alte Außenminister und die junge Kanzlerkandidatin) sich immer wieder als Trittbrettfahrer der Amerikaner zu Wort melden und sie sogar ermuntern, kriegerische Schritte gegenüber dem öl- und gasreichen Russland zu unternehmen. „Wir müssen Russland dort treffen, wo es wirklich wehtut,“ sagte Joschka Fischer und greift die deutschen Stammtischgespräche über Stalingrad wieder auf: „Schade, dass Russland nicht vom Westen erobert wurde“. Während Annalena Baerbock laut „Merkur“ eine „harte Kante gegen Russland will“. Der letzte deutsche Kaiser, Wilhelm II., war da schon weiter: Er sah bereits das Ende der Petromoderne: „Ich bleibe beim Pferd, das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung,“ sagte er.
.

Bäckerei-Arbeiterinnen 1982
.
Berufskalender-Girls
Meine Freundin schrieb mir, sie hätte in der 20. KW einige Tage frei. Ich schrieb zurück: Was heißt KW? „Kalenderwoche! Kennst Du das nicht?“ Wann die 20. Kalenderwoche war, mochte ich sie danach gar nicht mehr fragen, sondern googelte. Im „Karpfenkalender“, in dem es um tote Karpfen in den Händen von lebendigen Mädchen in nassen T-Shirts geht, fehlte ausgerechnet der Monat mit der 20. KW. Aber im „Feuerwehrfrauenkalender“ wurde ich fündig. In diesem Kalender findet man pro Monat eine oder mehrere halbnackte Feuerwehrfrauen („zum Feuer anfachen“) zusammen mit allerhand modernen Geräten, die man heute zum „Feuer löschen“ braucht.
Ich war da auf ein ebenso seltsames wie expandierendes Marktsegment bei den „Terminplanern“ gestoßen. Man kennt vor allem den berühmten Pirelli-Kalender – sozusagen die Urmutter aller Pin-Up-Kalender. Dessen Herausgeber, der italienische Reifenkonzern (an dem neuerdings der russische Ölkonzern „Rosneft“ beteiligt ist), will ihn nun, nach 57 Jahren, einstellen, nachdem die Fotografen immer teurer und die Mädchen vor ihrem Auslöser immer berühmter geworden sind. Mehr ist wohl in dieser Minimaltext-Maximalbild-Gattung nicht drin. Oder machte auch diesem Printprodukt das Internet den Garaus?
Nun gibt es aber statt eines Gummikonzern-Kalenders, einen von mehr oder weniger billigen Fotografen und gänzlich unbekannten Mädchen zusammengestellten „Werkstattkalender“, die sich die Arbeiter und Handwerker in ihren Spind hängen sollen.
Ebenso „Baumaschinenkalender“, in denen zarte Mädchen alljährlich auf möglichst massigen Baggern posieren. Ferner Tattoo-Kalender mit komplizierten Motiven auf nackten tätowierten Mädchen.
Und „Boxenluder-Kalender“, in dem sogenannte „Grid Girls!“ posieren: überraschenderweise alle züchtig bekleidet mit einem Regenschirm in der Hand, auch die Hintergründe ihrer Wirkungsstätte (Rennstrecken) sind unscharf gehalten.
Die Kalender mit „Kackenden Katzen“ und „Kackenden Hunden“ sowie mit „Fickenden Tieren“ lass ich weg, ebenso die mit zu tötenden Tieren: die „Jagdkalender“ – mit „bierernstem Mörderblick“ oder mit „humorvollem Blick auf die grüne Passion“. Auch wenn die zum Abschuß freigegebenen Rehe und Hirschkühe den Betrachter durchaus noch oder schon an grazile Frauen erinnern. Aber das liegt wohl daran, dass viele Adressaten, unter den Jägern, wie der DDR-Dramatiker Heiner Müller mutmaßte, zwar töten, aber nicht ficken können.
Erwähnen muß man noch den „Bauernkalender“, der sich großer Beliebtheit erfreut. Es gibt deutsche, österreichische und Schweizerische „Bauernkalender“, auch „Jungbauernkalender“ genannt, die von den dortigen Verbänden herausgegeben werden – seit Mitte des 19. Jahrhunderts bereits. Man findet darin heute leichtbekleidete Jungbäuerinnen, sie sind umgeben von Ställen, Gärten, Nutztieren, Traktoren, füttern Tiere, drücken ein Huhn an ihr Herz oder zeigen auf dem Heuboden ihren Brüsten die Männer. Es gibt auch Kalender mit Jungbauern, sie posieren durchweg mit freiem Oberkörper.
In dem mir vom Verlag überlassenen „Jungbäuerinnenkalender“ will über die Hälfte der abgelichteten Rural-Models Bäuerin werden bzw. den Hof der Eltern übernehmen und lernt bzw. studiert Landwirtschaft oder Verwandtes. Nun haben die Landmädchen, die im Sommer in der elterlichen oder verwandtschaftlichen Wirtschaft mithelfen müssen, dies schon seit langem leicht bekleidet und zunehmend leichter bekleidet getan: „Wenn ich schon nicht an den Badesee fahren kann, dann will ich mich wenigstens bei der Arbeit ausziehen“. Seinem „Nachruf auf die Kleinbauern“ (sie stellen nur noch 2 Prozent der Bevölkerung) hat der österreichische Sozialforscher Bernhard Kathan deswegen den Titel „Strick, Badeanzug, Besamungssets“ gegeben. Den Badeanzug trug eine seiner Informantinnen immer zur Erntezeit auf dem Feld.
Auf dem Jungbäuerinnenkalenderbild für Juni läßt sich Veronika aus Innsbruck-Land im Bikini vor einen Wasserfall fotografieren. Die Allgäu-Stefanie im Juli vor der Ernte in einem Kornfeld (mit Mähdrescher) und die Schwaben-Stefanie im September nach der Ernte mit Strohgaben auf einem Stoppelfeld. Die jahreszeitliche Folge geht dann – dem bäuerlichen Arbeitsrhythmus folgend – so weiter, dass Heidi im Oktober in Hotpants und mit hohen Absätzen, die ihre langen, schlanken Beine gut zur Geltung bringen, ein Bullenkälbchen am Strick über den Hof zerrt – das wahrscheinlich zum Schlachter soll. Im November mistet Andrea aus Deutschlandsberg einen leeren Stall aus, damit er neu belegt werden kann. Sie ist dabei derart ins Schwitzen geraten, dass sie ihre Felljacke aufgeknöpft hat. Im Dezember schließlich backt Anna in Top und Minirock ihre Lieblingsweihnachtsplätzchen.
Die Vernutzung der Tiere und der erotische Frohsinn, mit dem dies geschieht, kommen in den Jungbäuerinnenkalendern markant zur Anschauung.
Ähnliches gilt auch für den „erotischen Karpfenkalender“, für den sich alljährlich junge Frauen halbnackt mit einem riesigen toten Karpfen ins seichte Wasser stellen. Daneben gibt es aber auch noch einen „literarischen Karpfenkalender“, mit Fotos von großteils lebenden Karpfen und Sprüchen von toten Prominenten wie Shakespeare und Schopenhauer.
.

Mechanikerin
.
Schwarze Löcher
Der Religionswissenschaftler Klaus Heinrich sprach in einem Vortrag, den er 1993 in der Psychiatrischen Klinik des Universitätsklinikums Rudolf Virchow der Freien Universität hielt (und der jetzt neu veröffentlicht wurde), über „Sucht und „Sog“. Darin heißt es: „Wir bewegen uns in katastrophisch eingefärbten Untergangs- und Auferstehungsvisionen, damit immer noch in einem großen, kosmisch geweiteten Initiationsraum. Und damit nicht genug: Chaostheorien beschwören die Selbstordnungskräfte der Materie und lassen uns als Nutznießer davon profitieren. Wirklich populär geworden aber ist das Bild – die große Phantasie vom ‚Schwarzen Loch‘. Dies ist die erstaunlichste Schoßmetapher, die wir zur Zeit haben: spur- und zeichenlos saugt es ein und läßt verschwinden, auch die Reizüberbietung der Katastrophenmetapher ist stillgestellt, denn keine Information dringt hier heraus, geschweige, dass ein Geschichtenerzähler, ein kosmischer Aussteiger sozusagen, ihm entkäme.“
Dazu aktuell – die Bild-Zeitung: „Weltallmonster bedroht Erde. Vor zwei Stunden Schwarzes Loch in Erdnähe entdeckt! Verschlingt alles erbarmungslos! Unser Reporter interviewt den Entdecker exklusiv!“
Währenddessen kommt uns die Zeitschrift „Nature“ nichtkatastrophistisch: „Ein Schwarzes Loch in 12 Lichtjahren Entfernung – die Strecke, die Licht in zwölf Jahren zurücklegt. (Licht breitet sich mit knapp 300000 Kilometern pro Sekunde, d.h. mit etwa einer Milliarde Stundenkilometern aus). Das neu entdeckte Schwarze Loch ist nur dreimal so weit vom Sonnensystem entfernt wie unser nächster Nachbar, der Stern Alpha Centauri, und gehört damit zu unserer unmittelbaren kosmischen Nachbarschaft. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hat sofort die Entsendung einer unbemannten Raumsonde angekündigt, die fundamentale neue Erkenntnisse liefern wird. Diese Mission ist ein Generationenprojekt: Bis die Sonde das Schwarze Loch erreicht, werden Jahrzehnte vergehen und wenn dann die ersten Daten zur Erde gefunkt werden, brauchen sie weitere 12 Jahre für den Rückweg.“
Bis das schwarze Loch die Erde verschlingt, werden wir auch Beobachter und Geschichtenerzähler haben – u.a. dank des US-Milliardärs Elon Musk. Dazu heißt es auf „ingenieur.de“: „Der große Wettlauf zum Mars hat längst begonnen. Siedlungspläne, Baustoffe, Polizisten – auf der Erde bereiten sich schwerreiche Unternehmer und Wissenschaftler schon detailliert auf die künftige Kolonisierung des roten Planeten vor.“ Und freiwillige Siedler, die nicht vom Mars zurückkehren wollen und auch nicht können sollen, gibt es ebenfalls bereits: zu Tausenden.
Aber vielleicht ist ja auch alles ganz anders: Am 30. November 2020 hieß es im Wissenschaftsforum „spektrum.de“: Wenn „die Masse des Universums in seinem Hubble-Radius so groß ist wie die Masse eines Schwarzen Lochs im gleichen Radius“, dann läßt sich unser ganzes „Universum als das Innere eines Schwarzen Lochs annehmen“, was bedeute, „wir leben in einem Schwarzen Loch“, sind also schon drin. Das konnte Klaus Heinrich 1993 natürlich noch nicht wissen.
Bei ihm heißt es weiter über das Schwarze Loch: „Der sexuelle Phantasiehorizont in dem die Forschung metaphorisch eingebunden bleibt, wird aufdringlich deutlich im sogenannten ‚Keine-Haare-Theorem‘ [des Physikers John Wheeler]: ‚Ein Schwarzes Loch hat keine Haare‘ (das bezeichnet den Umstand, dass die Beschaffenheit des Körpers, aus dessen Zusammensturz es resultiert, keinen Einfluß hat auf die Größe und die Gestalt des Lochs).“
„Doch so stark ist die Macht der mit Geschlechterspannung verfahrenden Phantasie, dass dieses letzte katastrophische Suchtprodukt – so möchte ich es angesichts seiner Popularität einmal nennen – doch wieder als Schoß und Schlund erscheint, freilich einer, der nur noch in der einen, der zerstörerischen Richtung tätig ist…
Am Schluß des Vortrags heißt es: „Durch unsere Suchtgesellschaft geht ein uns allen geläufiger Riß, der das Suchtproblem unmittelbar berührt. Die Süchtigen, die sich auf den privaten Trip begeben, Alkohol- und Drogensüchtige, Sex- und Freßsüchtige z.B., sind natürlich Teil der Suchtgesellschaft. Aber es wäre vorschnell, zu urteilen, sie agierten nur deren Probleme aus, steuerten nur eben auf ihre eigene, private Katastrophe zu. Wir werden zu fragen haben, wieweit nicht Süchtige heute eingesetzt werden als Mittel, der Suchtgesellschaft zu entkommen, nicht vor ihr die Augen zu schließen, sondern Sucht der Sucht entgegenzusetzen, ‚aus der Suchtgesellschaft auszusteigen mittels Sucht‘. Sucht, so gesehen, wäre ein erster, noch untauglicher, selbsttherapeutischer Versuch.“ Auch, um die idiotische Angstvorstellung vom Schwarzen Loch los zu werden.
.

Kranführerin
.

Junge Frau vorm Spiegel
.
Zwei Löcher
1960 kam ein Film von Jacques Becker ins Kino: „Das Loch“. Es geht darin um vier Inhaftierte, die aus einem Pariser Gefängnis flüchten wollen, indem sie einen Gang von ihrer Zelle zur Kanalisation graben. Ein fünfter macht zwar mit, doch ihm wird von der Gefängnisleitung gesagt, dass er bald entlassen werde. Als ihr Fluchtplan auffliegt, stürzen die vier sich auf den vermeintlichen Verräter, den die Gefängniswärter retten müssen. Ob durch ihn die Flucht scheiterte, läßt der Film offen.
Beim „Celler Loch“ blieb dagegen nichts offen: Der fälschlich als RAF-Terrorist geltende Sigurd Debus hatte 1975 versucht, die Hamburger Verfassungsschutzzentrale in die Luft zu sprengen. Er saß u.a. deswegen 1978 im Hochsicherheitsgefängnis von Celle, als in die Außenmauer ein 40 Zentimeter großes Loch gesprengt wurde, um ihn zu befreien. Linke Journalisten brauchten 8 Jahre, um zu beweisen, dass die Täter der niedersächsische Verfassungsschutz und die Anti-Terror-Einheit GSG 9 waren – mit Wissen des niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht.
Für seine „Aktion Feuerzauber“ hatte der Inlands-Geheimdienst zudem laut Wikipedia „Ausbruchswerkzeug in Debus’ Zelle schmuggeln lassen, das bei der auf den Anschlag folgenden Durchsuchung gefunden wurde und die Tatbeteiligung von Debus beweisen sollte“. Dazu hatte man einen gestohlenen Mercedes mit Munition und einem gefälschten Pass mit Foto von Debus als Fluchtauto präpariert und ein „Papier“ veröffentlicht, das angeblich vom RAF-Mitglied Karl-Heinz Dellwo stammen sollte, der ebenfalls in Celle einsaß. Darin stand, dass „durch Anschläge auf den äußeren Bereich von Vollzugsanstalten“ eine „Zusammenlegung einsitzender Terroristen zu Interaktionsgruppen“ erreicht werden solle.
Den Bombenanschlag selbst sollten zwei angeworbene Kriminelle – Klaus-Dieter Loudil und Manfred Berger – ausführen. Man erhoffte sich dadurch, dass sie als Spitzel (V-Leute) Zugang zur RAF finden würden. Loudil wurde den Medien als Tatverdächtiger präsentiert als der staatsterroristische Akt, der die Gefährlichkeit der RAF beweisen sollte, aufflog und ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt wurde, in dem die Regierung Albrecht „die Aktion als mindestens achtbaren Erfolg darstellte (Zugang zu Terrorismus, Ausbruch vereitelt, Waffen gefunden).“ Alles gelogen!
Laut Bericht des Untersuchungsausschusses zum Celler Loch waren sich die Mitglieder des Ausschusses uneinig über die Bewertung der Rolle der Spitzel (V-Männer). Einig war man sich nur darüber, „dass der Privatdetektiv Werner Mauss Konzepte und fingierte Aktionen der V-Männer unkontrolliert selbst bestimmen konnte,“ wie der NDR-Journalist Jochen Grabert in der Tagesschau berichtete. Daraufhin bewirkte Mauss dort eine Gegendarstellung, in der es hieß: „Hierdurch kann der Anschein entstehen, ich sei an Konzepten und fingierten Aktionen beteiligt gewesen, die mit dem sogenannten Celler Loch in Verbindung stehen. In Wirklichkeit habe ich mit diesen Konzepten und Aktionen nie etwas zu tun gehabt.“
Mauss arbeitete seit 1969 im Auftrag der damals neu eingerichteten Ermittlungsgruppe des Bundeskriminalamtes (BKA), wo er die „Institution M.“ genannt wurde. Er kam immer dann ins Spiel, wenn staatliche Organe nicht mehr weiterkamen, sich nicht „die Finger dreckig machen“ wollten „oder eine Operation aus juristischen oder völkerrechtlichen Aspekten heraus nicht durchführen konnten“. Dabei betätigte er sich wohl auch als agent provocateur, er stiftete also zu Straftaten an, „deren Aufklärung er sich später zuschreiben ließ“.
In dem Wikipedia-Eintrag über ihn heißt es weiter: „Mitte der 1980er Jahre wurde Mauss verstärkt in Kolumbien tätig. Hier war er – zunächst im Auftrag der Mannesmann AG – eingesetzt, um den Bau einer Pipeline gegen den Widerstand der Guerillagruppe ELN durchzusetzen und vier entführte Manager der Firma zu befreien.“
Sigurd Debus wurde 1979 in ein Hamburger Gefängnis verlegt. „Dort beteiligte er sich, nachdem Anträge auf Hafterleichterungen mit Hinweis auf den Sprengstoffanschlag (das Celler Loch) abgelehnt worden waren, im Februar 1981 an einem Hungerstreik der RAF-Gefangenen, der am 16. April 1981, obwohl oder weil er zwangsernährt wurde, zu seinem Tod führte.
Nun mußte das aufgedeckte Staatsverbrechen aber noch in ein profitables Spektakel überführt werden und damit dem Vergessen anheimfallen: 1987 erschien ein Buch „Das Celler Loch“, 1989 ein Dokumentarfilm „Das Celler Loch“, 2015 wurde vorm Eingang des Gefängnisses ein Denkmal für das Celler Loch aufgestellt (es besteht aus einem Stück der Betonmauer, das in einen Edelstahlrahmen eingefaßt und mit einer Texttafel versehen wurde), und schließlich brachte das Schlosstheater Celle auch noch ein Musical mit dem Titel „Celler Loch“ auf die Bühne.
Kurt Tucholsky „Zur soziologischen Psychologie der Löcher“:
„Das Loch ist ein ewiger Kompagnon des Nicht-Lochs: Loch allein kommt nicht vor, so leid es mir tut. Wäre überall etwas, dann gäbe es kein Loch, aber auch keine Philosophie und erst recht keine Religion, als welche aus dem Loch kommt. Die Maus könnte nicht leben ohne es, der Mensch auch nicht: es ist beider letzte Rechnung, wenn sie von der Materie berängt werden. Loch ist immer gut.“
.

Die Bolschewistin Alexandra Kollontai
.
Sanifair
Die Indiepopgruppe „Blond“ singt: „Sanifair Millionär hat den Highway-Flair“. Ich habe zwei Sanifair-Bildwitze aufbewahrt: Ein Typ geht an einem Mercedes-Geschäft vorbei an dessen Schaufenster ein Plakat hängt: „We accept Sanifair“, dazu das Logo der Firma, der alle Toiletten auf den Autobahnraststätten gehören. Sanifair ist die Tochterfirma des Autobahn-Raststätten-Betreibers „Tank & Rast“. Der Konzern war einst staatlich und wurde dann für 1,3 Milliarden DM verkauft (nachdem er alle Einrichtungen der MITROPA übernommen hatte): an den Finanzinvestor Terra Firma und einem Fonds der Deutschen Bank.
2015 verkauften diese „Tank & Rast“ an ein Konsortium „um den Versicherungsriesen Allianz. Zu der Käufergruppe gehören daneben der kanadische Infrastruktur-Fonds Borealis, der Staatsfonds von Abu Dhabi, ADIA, und die Münchener-Rück-Tochter MEAG,“ meldete die „tagesschau“. „Der Kaufpreis für die 390 Raststätten, 350 Tankstellen und 50 Hotels“ betrug 3,5 Milliarden Euro.“ Jährlich muß „Tank & Rast“ dem Staat Konzessionsgebühren um 17 Mio Euro zahlen, dieser hält dafür die Anlagen für 110 Mio Euro im Jahr instand.
Im Privatisierungsvertrag hieß es 2016: „Die Tank & Rast wird sich bemühen, die unentgeltliche Benutzung von sanitären Einrichtungen ganzjährig durchgehend sicherzustellen.“ Sie bemühte sich aber nicht. Gegen die Kostenpflicht bei Benutzung der Toilettenanlagen ist der Kabarettist Rainald Grebe juristisch vorgegangen – jedoch erfolglos. Unterdes hat sich der Abgeordnete der Partei „Die Linke, Victor Perli, zu einem weiteren Sanifair-Gegner profiliert.
Die Tochterfirma von „Tank & Rast“ „Sanifair“ verwendet statt Toilettenfrauen oder -männern, denen man 50 Cent für die Benutzung der Toiletten bezahlte, elektronisch gesteuerte Drehkreuze, die sich nur mit dem Einwurf von einem Euro öffnen lassen. Dafür bekommt man einen „Wertbon“ in Höhe von 50 Cent wieder. Da man diesen nur an den Raststätten einlösen kann, es dort jedoch so gut wie keine Waren zu diesem Preis gibt, kauft man notgedrungen irgendetwas teureres aus ihrem Angebot und verrechnet den Sanifair-Bon damit beim Bezahlen (Benzin ist davon ausgenommen). „Branchenschätzungen zufolge generiert jeder Sanifair-Bon knapp dreieinhalb Euro Umsatz,“ schreibt Florian Werner.
Auch auf den großen Bahnhöfen sowie in Österreich und in Ungarn gibt es seit einiger Zeit Sanifair-Toiletten. Ebenso in Ketten wie McDonald‘s, WMF, Nordsee und Backwerk.
Mein zweiter Sanifair-Bildwitz mit dem Titel „Tod eines Handlungsreisenden“ zeigt eine Frau, die einem Notar gegenübersitzt, der ihr mit wenigen Worten ein Testament vorliest: „Ihr Vater hat ihnen 3197 Sanifair-Bons hinterlassen.“ Auf Wikipedia ist zu erfahren: „Eine repräsentative Befragung des Marktforschungsinstituts INSA ergab, dass fast die Hälfte der Deutschen diese Gutscheine selten oder nie einlösen“.
Der Berliner Schriftsteller Florian Werner hat in seinem neuen Buch über die Raststätte „Garbsen Nord“ – „eine Liebeserklärung“ natürlich auch ein Kapital über die üblen Machenschaften von Sanifair eingefügt. Ich mochte schon seine Bücher „Die Kuh. Leben, Werk und Wirkung“ und „Schnecken. Ein Porträt“, und kenne die Raststätte „Garbsen Nord“, in der eine Familie bereits in der dritten Generation den Geschäftsführer stellt.
Weil ich auch dieses Buch von Florian Werner mit Vergnügen gelesen habe, hier einige seiner Überlegungen und meine Einwände: Für ihn sind die Autobahn-Rast- und Tankstellen „Nicht-Orte“, die jeder Kunde oder Gast so schnell wie möglich wieder verläßt. Der Autor hat sich dort für seine Recherche allerdings im Autobahn-Motel einquartiert. Er hat nur einen Flaschensammler getroffen, der fast täglich kommt – mit dem Fahrrad, „Garbsen Nord“ ist sein „Revier“.
Es gibt jedoch etliche Jugendliche in Sachsen und in den niedersächsischen Dörfern der Umgebung der Raststätte „Allertal West“ (nicht weit von „Garbsen Nord“ auf der A7), die Nachts, wenn die Kneipen schließen, auf die Raststätte fahren, wo eine nette Frau aus einem der Dörfer arbeitet. Sie nennt sie ihre „Dauergäste“.
Auf einer anderen Raststätte in Hessen, Pfefferhöhe, arbeitete der Verleger Werner Pieper als Koch und der Schriftsteller Uwe Nettelbeck durfte dort in der Küche, jedesmal wenn er nach oder von Frankfurt aus unterwegs war, für seine Frau „Porridge“ zubereiten. Auch er war eine Art Dauergast.
Und von mir und von vielen Freunden weiß ich, dass wir, egal welche Autobahn wir von Berlin aus nehmen, dort immer die selben Autobahn-Raststätten anfahren. Die Pfefferhöhe wurde nebenbeibemerkt 1983 von einer Familie übernommen, es war „das erste privat geführte Rasthaus an deutschen Autobahnen“, wie es auf seiner Internetseite heißt.
Den schönsten Satz in dem Autobahn-Raststätten-Buch sagt „die Rechte Hand“ des Geschäftsführers von Garbsen Nord, die trotz Radiomusik in ihrem Büro ständig die Autobahn hört: „Wenn das nicht mehr wäre, dann sei es, glaube sie, vorbei.“
Man wird sie noch einige Jahre hören, aber mit dem Ende der „Petromoderne“ werden auch wohl ihre einst stolzesten Stützpunkte an den Autobahnen, notgedrungen als vegane Radfahrer-Treff enden. Der Autor selbst ißt schon kein Fleisch und hat auch kein Auto mehr.
Der diesem Ende vorausgegangene Umschwung der Moderne in die Postmoderne wurde übrigens von dem Philosophen Jean-Francois Lyotard erstmalig erfahren, als er in das Urinal der Universität von Aarhus pinkelte, das dann automatisch mit Lichtstrahl spülte.
.

Bergarbeiterinnen
.
Das I-Wort
Franz Kafka hat sie mit einem Satz abgetan – aber in der Möglichkeitsform: „Wenn man doch ein Indianer [das I-Wort] wäre, gleich bereit, und auf dem rennenden Pferde, schief in der Luft, immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden Boden, bis man die Sporen ließ, denn es gab keine Sporen, bis man die Zügel wegwarf, denn es gab keine Zügel, und kaum das Land vor sich als glatt gemähte Heide sah, schon ohne Pferdehals und Pferdekopf.“
Nein, wenn die jungen Indianer in der Reservaten heute nicht das Auto ihres Onkels kriegen, dann reiten sie noch immer. Meine Gewährsfrau ist die wunderbare deutsch-indianische Schriftstellerin Louise Erdrich, deren Bücher großteils vom jetzigen Leben im Reservat der Ojibwe in Nord-Dakota handeln.
Einige Stämme in Reservaten drumherum sind mit einem Spielcasino ökonomisch erfolgreich geworden, so erfolgreich, dass sie zwecks Ausschüttung der Gewinne bereits Amerikaner suchen, die nur noch zu einem Sechsunddreißigstel zu ihrem Stamm gehören. Die Verwaltung der Akten des Stammes ist zu einer wichtigen Arbeit in den Reservaten geworden. Louise Endrichs Roman „Das Haus des Windes“ handelt von einer solchen Amtsinhaberin.
In den Vereinigten Staaten gibt es 567 Ureinwohner-Gruppen und 326 Reservate. Von den 2,5 Millionen indigenen Amerikanern lebten 2012 laut FAZ etwa eine Million in diesen Selbstverwaltungsbezirken – mit eigenen Gerichten und Polizisten. Bis in die jüngste Vergangenheit haben die Weißen das Reservatsland immer wieder verkleinert, aber 2020 entschied das Oberste Gericht, die Hälfte des Bundesstaates Oklahoma den Indianern wieder zu geben, ein Gebiet größer als Deutschland. 1999 hatte die kanadische Regierung den Inuit bereits ein autonomes Gebiet – Nunavut (Unser Land) – zugestanden, das einem Fünftel der Fläche von Kanada entspricht.
In Alaska haben die vereinigten Indigenen erst den Bau einer Öl-Pipeline verhindert und dann aber befürwortet, weil sie sich davon Arbeitsplätze versprachen. Auch in Louise Erdrichs Reservats-Geschichten geht es vorwiegend um ein nicht zuletzt wirtschaftliches Ausbalancieren zwischen Amerikanischem und Indianischem. Dazu gehört u.a. zur Ankurbelung des Indianer-Tourismus die Anschaffung von immer mehr kleinen Bisonherden in den großen Reservaten. Und prompt finden sich auch wieder alte Geschichtenerzähler ein, die noch Büffel erlegt haben, bevor die Weißen sie alle, vom Zug aus, zu tausenden erschießen konnten. Den allerletzten, eine alte Bisonkuh, will angeblich ein Ojibwe geschossen haben. Sie soll sich ihm regelrecht ergeben haben, um nicht auch noch von den Weißen abgeknallt zu werden.
Ein kanadischer Indianer meinte einmal zu einem Ethnologen, der ihn über die Büffeljagd ausfragte: „Unsere Vorfahren haben die Tiere geheiratet, sie haben ihre Lebensweise kennengelernt, und sie haben diese Kenntnisse von Generation zu Generation weitergegeben. Die Weißen schreiben alles in ein Buch, um es nicht zu vergessen.“ Der Unterschied zwischen Referat und Reservat.
Dazwischen müssen sich heute die Angehörigen der „First Nations“ zurechtfinden. Mit zweierlei Wahrnehmungen, wie der brasilianische Ethnologe Eduardo Viveiros de Castro sie umreißt: Im Westen ist ein „Subjekt“ der herrschenden „naturalistischen Auffassung“ gemäß – „ein ungenügend analysiertes Objekt,“ während in der animistischen Kosmologie der amerikanischen Ureinwohner genau das Gegenteil der Fall ist: „Ein Objekt ist ein unvollständig interpretiertes Subjekt“.
Das heutige Zwischendrin-Stecken ist das (auch biographische) Thema etlicher Bücher von Louise Erdrich. Ich habe mir erst mal nur die 14 gesichert, die bisher ins Deutsche übersetzt wurden. Natürlich thematisiert sie darin auch die Zeit „bis zu dem Jahr, als man uns unsere Grenzen auferlegte. Bis zum Jahr des Reservats“.
Und dann auch die ersten Jahre im Reservat, als es schon bald keine Kaninchen mehr gab, alle gegessen: „Ah, diese ersten Jahre des Reservats, als sie uns einzwängten. Auf wenige Quadratmeiler nur. Wir hungerten, während die Kühe der Siedler sich von dem abgezäunten Gras unserer alten Jagdgründe dick und rund fraßen.“
Noch der 26. US-Präsident Theodore Roosevelt war der Meinung, die Ausrottung der Indianer durch die meist armen weißen Siedler und Pioniere sei ein „gerechter Krieg“ gewesen: „Dieser großartige Kontinent konnte nicht einfach als Jagdgebiet für elende Wilde erhalten werden“.
In Deutschland hatte schon Friedrich der Große „das liederliche polnische Zeug“ mit „Irokesen“ verglichen. Der Generalgouverneur des besetzten Polen Hans Frank bezeichnete darüberhinaus 1942 auf einer Parteiversammlung in Lemberg die Juden als „Plattfußindianer“. Adolf Hitler freute sich etwa zur gleichen Zeit – angesichts der sich entfaltenden Partisanenkriegs im Osten: „Und immer aufknüpfen! Das wird ein richtiger Indianerkrieg werden.“ Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, seinen Soldaten zur moralischen Festigung Karl Mays „Winnetou“-Roman mit auf dem Weg an die Front zu geben. (Im Ersten Weltkrieg packte man ihnen Goethes „Faust“ in den Tornister.)
Der polnische Schriftsteller Ludwik Powidaj hatte bereits 1864 in seinem Essay „Polacy i Indianie“ das Schicksal der amerikanischen Indianer dargestellt und dabei die Frage gestellt: „Welcher Pole wird darin nicht die Lage seines eigenen Landes erkennen?“ Auch die Letten bezeichneten sich unter deutscher und dann sowjetischer Herrschaft als „die letzten Indianer Europas“, meint jedenfalls Indulis Bilzenz.
Nachdem Ostelbien kommunistisch geworden war, entstand dort eine ganze Indianerbewegung, die offiziell „Indianistik“ betrieb, d.h. sich dem Studium der Ureinwohner Nordamerikas widmete, die als Pioniere im Kampf gegen den Imperialismus galten. Einige Intellektuelle sahen darüberhinaus aber auch Parallelen zwischen den letzten Indianern und sich: „Wir lebten in der DDR ja auch in einem Reservat.“ Die Welt ist klein, aber das Land der Indianer groß.
.

Brigadierin (von Boris Nesterenko)
.
Hausarbeiten
„Doing the Dirty Work. Migrantinnen in der bezahlten Hausarbeit in Europa“ hieß 2006 eine Studie der englischen Soziologin Bridget Anderson. In Berlin fand die Autorin es „besonders bemerkenswert, dass Putzfrauen, die in Zeitungen inserieren, hier klarstellen: ,No Sex‘, womit sie deutlich machen, dass sie ein Angebot von ,Hausarbeit‘ für missverständlich halten“.
Nach der Wende und dem Zuzug von wohlhabenden Westlern erhöhte sich der Bedarf an „Dienstleistern“. In Westberlin gab es sehr viele Schuhläden – mit gutaussehenden Schuhverkäuferinnen. Wenn sie älter wurden, ersetzte man sie gerne durch jüngere. Vier dieser vorzeitig gekündigten Schuhverkäuferinnen (mit „Niedrigrente“) fingen als Putzfrauen an. Weil das aber auch nicht viel einbrachte, eröffneten sie ein Bordell – mit sich als „Modelle“. Daneben stellten sie eine alte Frau aus einem Zirkus als Telefonistin ein und einen Studenten, der sie zu den Freiern fuhr. Eine, Rita, erzählte der ukrainischen Prostituierten Lilly Brand (in: „Transitgeschichten“ 2006), dass sie fast nur Professoren als Kunden hätte, und bis zu vier oder fünf täglich wäre es noch ganz gut. Oft würden sie sich nur mit einem unterhalten wollen. Ihre früheren Putz-Kunden hätte sie an eine polnische Putzfrau abgetreten.
1998 veröffentlichte die polnische Soziologin Malgorzata Irek eine Studie über diese Frauen: „Der Schmugglerzug Warschau-Berlin-Warschau“. Bei den in Berlin arbeitenden unterschied sie zwischen den „Putzfrauen der ersten Generation“, die bis etwa 1990 aus einem staatlich „ausgewählten Personenkreis“ bestanden, und den „Putzfrauen der jüngeren Generation“, die danach kamen und auch „einen Hauch vom Kapitalismus spüren“ wollten. In Berlin wurden sie in einem „Netz“ tätig, das die Älteren vor ihnen aufgebaut hatten – und wofür sie auch Abgaben verlangten. Über ihre Kunden äußerte z.B. eine, die von der Arbeit Ekzeme an ihren Händen bekommen hatte: „Das kommt vom Essig. Diese Kühe wollen alles ökologisch haben.“ Die Berliner Professorenwerden allerdings auch von den polnischen Putzfrauen geschätzt: „Sie sind nicht pingelig und eigentlich braucht man überhaupt nicht gründlich sauber zu machen“.
Die polnischen Putzfrauen sind oft „überqualifiziert. In der Studie „Die ganze Welt zu Hause. Cosmobile Putzfrauen in privaten Haushalten“(2006) der ungarischen Soziologin Maria S. Rerrich heißt es: „Hier findet nicht nur ein ‚brain drain‘ aus den Heimatländern der Frauen statt. Es handelt sich auch um einen ‚brain waste‘ in Deutschland, also die vielfache Verschwendung von Humankapital“ – wenn die Frauen hier gezwungen sind, sich als Putzfrauen in irgendwelchen Wohnungen, Hotelzimmern und Büros zu verschleißen – nachts oft und schlecht bezahlt.
Während die polnischen Putzfrauen hier als „Selbständige“ einen Status als „Unternehmerinnen“ anstreben, kämpfen die polnischen Putzfrauen in den USA um kleine Arbeitserleichterungen. 2002 verdingte sich die US-Journalistin Barbara Ehrenreich als Putzfrau in Kalifornien. In ihrem Bericht „Working Poor“ schreibt sie, dass der US-Putzfrauenmarkt von großen Reinigungsfirmen beherrscht wird. Die Putzfrauen bekommen ihre Kunden fast nie zu sehen – nur durch die Einrichtungsgegenstände, die sie sauber halten müssen, können sie sich ein Bild von ihnen machen. Der eine hat eine große Bibliothek über Zen-Buddhismus, der andere sein Badezimmer zu einem Nassorgiencenter ausgebaut …Die Putzfrauen tragen grelle grün-gelbe Arbeitskleidung und ihre Arbeitsgänge sind von der Reinigungsfirma mit der Stoppuhr ausgetüftelt. Sie dürfen nicht fluchen und kein Glas Wasser trinken – der Kunde könnte sie mit Aufnahmegeräten überwachen. Als Ehrenreich sich für eine Kollegin einsetzen will, die sich nach einem Arbeitsunfall nicht getraut hatte, zur Ambulanz zu gehen, scheitert sie: „Dies war der absolute Tiefpunkt in meinem Putzfrauenleben, und wahrscheinlich nicht nur in dem.“
.

Drei Badende
.

Drei Badende
.

Drei Frauen und zwei Männer beim Sonnenbaden
.

Drei Frauen in einer Strandbar beim Schach spielen
.

Drei Frauen am Strand mit Majakowski (1920)
.
Vier Yahoo-Girls
Die Frauen drängen nach vorne, die Männer schlaffen ab, werden aber immer unangenehmer. Das zeigt sich auch in der Gegenwartsliteratur, u.a. an zwei Romanen des politisch Korrekten, die den ganzen Digitalisierungswahn affirmieren, indem die Handlung ständig über Smartphone, Twitter, Instagram, Facebook etc. weitergetragen wird…
1. Kate Davis „Love Addict“: Eine Angestellte im öffentlichen Dienst, die von den Ficks mit Männern enttäuscht ist und sich in eine lesbische Künstlerin verliebt, jeden Tag sich von ihrer Faust ficken läßt, mit Dildos, in lesbische Swingerclubs geht, auch einmal fesseln und schlagen läßt, aber sich schließlich zu sehr dominiert fühlt und sich in eine liebe lesbische Schwester eines Arbeitskollegen verliebt – quasi ein Happy-End. Diese ganze „komplizierte Sex der Millenials“ (Die Welt) wurde sehr sprachreich und ironisch verfaßt – von einer Literaturwissenschaftlerin.
2. Mithu Sanyal „Identitti“: Eine von allen jungen Studentinnen, vor allem den People of Colour, geliebte Düsseldorfer Dozentin mit indischem Namen entpuppt sich als Weiße, woraufhin sich ihre Fans spalten: Verräterin sagen die einen und schimpfen, die anderen bleiben ihr nahe und wollen wissen, warum sie das getan hat.
Inzwischen gibt es mehrere Fälle in den USA, da weiße Frauen sich als Schwarze ausgaben – und aufflogen, 2000 erschien bereits ein Roman von Philip Roth „Der menschliche Makel“, in dem sich ein Schwarzer als Weißer camouflierte, um Karriere zu machen. Mithu Sanyal handelt ihren „Fall“ digital mit den einschlägigen Medien, Smartphone, Twitter, Facebook etc. ab. Mir war er etwas zu unironisch (und die Studentinnen zu politisch korrekt), obwohl die Autorin, eine Kulturwissenschaftlerin, älter ist als ihre jungen Protagonistinnen ist und gewissermaßen sympathisierend zurückblickte.
Zwei Sachbücher, die diese ganze Digitalisierungsscheiße kritisieren, die wegen Corona immer unerträglicher wird:
3. Cathy O‘Neill „Weapons of Math Destruction. How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy“: „Wir leben im Zeitalter des Algorithmus. Immer mehr Entscheidungen, die unser Leben beeinflussen – wo wir zur Schule gehen, ob wir einen Autokredit bekommen, wie viel wir für unsere Krankenversicherung zahlen – werden von mathematischen Modellen getroffen. Theoretisch sollte dies zu mehr Fairness führen: Jeder wird nach den gleichen Regeln beurteilt, und Voreingenommenheit ist ausgeschlossen.“
In Wirklichkeit geschieht jedoch das Gegenteil – sie objektivieren die Diskriminierung: „Wenn ein armer Student keinen Kredit bekommt, weil ein Kreditvergabemodell ihn als zu riskant einstuft (aufgrund seiner Postleitzahl), dann wird er von der Art von Bildung abgeschnitten, die ihn aus der Armut herausführen könnte.“ Die Algorithmen stützen die Glücklichen und bestrafen die Unterdrückten. Die Autorin, eine Mathematikerin, führt dazu den Beweis.
4. Marieluise Wolff „Die Anbetung. Über eine Superideologie namens Digitalisierung“: „Die modernen Monopolisten Apple, Amazon, Facebook oder Google verdienen Milliarden mit dem Verkauf unserer persönlichsten Daten. Ohne entsprechende Aufklärung oder gar Gegenleistung verkaufen sie private Informationen, die auch zur Überwachung und Manipulation missbraucht werden.“ Die Autorin ist eine „erfolgreiche Managerin“, sie „kritisiert die Entwicklung zu einer sinnlos durch-digitalisierten Wirtschaft und ent-analogisierten Gesellschaft“. Sie fordert ein Umdenken und „ein Ende der Anbetung digitaler Trugbilder, die weder Fortschritt noch Werte schaffen.“ Fordern kann man leider viel.
All das hat zudem der US-Schriftsteller Kurt Vonnegut bereits 1953 sehr viel radikaler in seinem Buch „Das höllische System“ gesagt und der US-Schriftsteller Thomas Pynchon noch aktueller 1984 in der „New York Times Book Review”, wo er sich in einem Artikel fragte: “Ist es o.k., ein Luddit zu sein?” (Ludditen waren die englischen Maschinenstürmer, d.h. Webmaschinen-Zerstörer, die die Heimarbeiter arbeitslos machten) Sein Text endete mit dem Satz: „Wir leben jetzt, so wird uns gesagt, im Computer-Zeitalter. Wie steht es um das Gespür der Ludditen? Werden Zentraleinheiten dieselbe feindliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen wie einst die Webmaschinen? Ich bezweifle es sehr. Aber wenn die Kurven der Erforschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz, Robotern und der Molekularbiologie konvergieren… Jungejunge! Es wird unglaublich und nicht vorherzusagen sein, und selbst die höchsten Tiere wird es, so wollen wir demütig hoffen, die Beine wegschlagen. Es ist bestimmt etwas, worauf sich alle guten Ludditen freuen dürfen, wenn Gott will, dass wir so lange leben sollten.” Vonnegut und Pynchon sind alte Linke, letzterer hat 2014 noch einen ganzen anarchistischen Roman über diese Digitalisierungsscheiße geschrieben: „Bleeding Edge“ (inklusive einer 9.11.-Tätertheorie), wohingegen die vier Frauen zu den neuen Feministinnen zählen.
.

Arbeiterinnen in einer Werkskantine
.
Gleichheit
Will uns das amerikanische „Wikipedia“ hierbei für dumm verkaufen?: „Gleichheit bedeutet Übereinstimmung einer Mehrzahl von Gegenständen, Personen oder Sachverhalten in einem bestimmten Merkmal bei Verschiedenheit in anderen Merkmalen.“
Wir wissen es doch besser: Die mit der Durchsetzung der athenischen Demokratie erreichte allgemeine „Gleichheit vor dem Gesetz“ (isonomia) hatte bereits Diodoros aus Agyrion im 1. Jhd.v.Chr. als eine Farce bezeichnet, da ohne „Gleichheit des Eigentums“ (isomoiria) durchgesetzt.
Neuerdings hat sich der französische Ökonom Thomas Pickerty mit diesem „Gleichheits“-Begriff beschäftigt. Der Deutschlandfunk interviewte den „Rockstar der Wirtschaftswissenschaft“, der 2014 in seinem 800 Seiten starken „Das Kapital des 21. Jahrhunderts“ Daten aus 27 Ländern über einen Zeitraum von bis zu drei Jahrhunderten untersuchte und dabei nachwies, „dass der Kapitalismus systemimmanent zu einer Verschärfung der Ungleichheit führt. Auch weitere Grundüberzeugungen des Kapitalismus – beispielsweise, dass Steuersenkungen zu Wirtschaftswachstum führen würden – dekonstruierte er.“
Piketty erklärte dazu im Interview, „was ich in meinem Buch als Proprietarismus in der klassischen Ära beschreibe, sagen wir im 19. Jahrhundert und vor dem Ersten Weltkrieg, die Epoche der Ideologie „wenn wir anfangen, die in der Vergangenheit erworbenen Eigentumsrechte anzurühren, dann werden wir ins Chaos fallen“- das führte zum Beispiel zu der Entscheidung, die bei der Abschaffung der Sklaverei in Frankreich, in Großbritannien, in der Welt generell getroffen wurde, Sklavenbesitzer für ihren Eigentumsverlust finanziell zu entschädigen.“
Das war, „sagen wir, der klassische Proprietarismus des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg. Das schlägt heute niemand mehr ausdrücklich vor. Wir befinden uns heute in einer Form des Neoproprietarismus, der insbesondere auf den Zusammenbruch des Kommunismus in den 1990er-Jahren folgte, der eine weichere Form des Proprietarismus darstellt.
Mit anderen Worten, man behauptet nicht, dass man niemals die Ungleichheiten oder die in der Vergangenheit erworbenen Eigentums- oder Machtpositionen in Frage stellen sollte, aber man ist immer noch sehr, sehr misstrauisch gegenüber der Idee, über ein alternatives Wirtschaftssystem nachzudenken, und man hat eine Ideologie entwickelt, die die Organisation der Globalisierung betrifft, die auf der Idee beruht, dass absoluter Freihandel, der freie Kapitalverkehr ohne Bedingungen eine Voraussetzung ist.“
Bei Wikipedia heißt es über den „Proprietarismus“: Dies „ist ein von Thomas Piketty geprägter Begriff für ein politisch-ökonomisches System, das die Ungleichheit der Vermögen vergrößert, sowie eine Ideologie, die auf Eigentumsrechte fixiert ist, diese Ungleichheit fördert und ethisch-moralisch rechtfertigt.“
Hier findet sich auch ein Satz über den „Neoproprietarismus“: „Die Weigerung vieler Ökonomen, über Verteilungsprobleme zu sprechen, fördere laut Piketty die Entwicklung des (Neo-)Proprietarismus und legitimiere die globale Verteilungskrise; diese begrenze das vorhandene Potenzial der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, indem sie viele Menschen ausschließe.“
Picketty ist davon überzeugt, „wirtschaftlicher Wohlstand kommt in der Geschichte in erster Linie von Bildung, von der Teilhabe möglichst vieler Menschen am wirtschaftlichen, sozialen und politischen Leben und sicherlich nicht von der Hyperkonzentration der Macht bei sehr wenigen Menschen.“ Er denkt dabei an die Handvoll amerikanischer E-Milliardäre.
Picketty ist ein Neolinker: „Ich verteidige die Idee eines partizipatorischen, dezentralisierten, demokratischen Sozialismus, der nichts mit den Staatssozialismen zu tun hat, die wir im Osten im 20. Jahrhundert gesehen haben.“
Er kann sich aber auch durchaus vorstellen: „Die Wirtschaft funktioniert mit der Gründung kleiner und mittlerer Unternehmen, wo Menschen eine Million, fünf Millionen oder zehn Millionen Euro akkumulieren, was schon ein großer Erfolg ist. Das ist nützlich.“
Der Philosoph Jean Baudrillard hat einmal über die Auswirkungen von hartem Proprietarismus und weichem Neoproprietarismus in bezug auf die Linke gesagt: „Die Menschenrechte, die Dissidenz, der Antirassismus, die Ökologie, das sind die weichen Ideologien, easy, post coitum historicum, zum Gebrauch für eine leichtlebige Generation, die weder harte Ideologien noch radikale Philosophien kennt. Die Ideologie einer auch politisch neosentimentalen Generation, die den Altruismus, die Geselligkeit, die internationale Caritas und das individuelle Tremolo wiederentdeckt. Herzlichkeit, Solidarität, kosmopolitische Bewegtheit, pathetisches Multimedia: lauter weiche Werte, die man im Nietzscheanischen, marxistisch-freudianistischen (aber auch Rimbaudschen, Jarryschen und Situationistischen) Zeitalter verwarf.
Diese neue Generation ist die der behüteten Kinder der Krise, während die vorangegangene die der verdammten Kinder der Geschichte war. Diese jungen, romantischen, herrischen und sentimentalen Leute finden gleichzeitig den Weg zur poetischen Pose des Herzens und zum Geschäft. Sie sind Zeitgenossen der neuen Unternehmer, sie sind wunderbare Medien-Idioten: transzendentaler Werbeidealismus. Dem Geld, den Modeströmungen, den Leistungskarrieren nahestehend, lauter von den harten Generationen verachtete Dinge. Weiche Immoralität, Sensibilität auf niedrigstem Niveau. Auch softer Ehrgeiz: eine Generation, der alles gelungen ist, die schon alles hat, die spielerisch Solidarität praktiziert, die nicht mehr die Stigmata der Klassenverwünschung an sich trägt.“
.

.

Drei Scharfschützinnen
.

Drei Pilotinnen
.

Drei Veteraninnen des Zweiten Weltkriegs
.

Scharfschützen-Model der ukrainischen Verteidigungsarmee (2022)
.

Ukrainische Heldin (2022)
.

Drei Ukraine-Verteidigerinnen
.

Drei Ukraine-Verteidigerinnen (2022)
.

Russische Soldatin
.
Technikgeschichte
„Der Computer ist das erste Werkzeug in der Technikgeschichte, mit dem man keine Bierflasche aufmachen kann,“ meinte Peter Glaser kürzlich auf Facebook. Ich dachte, man kann doch an jeder scharfen Kante und mit jedem harten Gegenstand, einschließlich Wegwerffeuerzeuge, Bierflaschen öffnen, also würde Peter Glaser sich irren, denn so etwas hat eigentlich jeder Computer. Sie wurden ja nicht wie die Radios und Fernseher rund oder eiförmig aus Plastik gestaltet. Bei den anfänglichen riesigen Zentralrechnern konnte man jedenfalls an allen Ecken und Enden seine Flaschen öffnen. Aber vielleicht hat sich dabei mit der weiteren „Entwicklung“ eine psychische Barriere aufgebaut, so dass man nun aus Scheu gegenüber dem potentiellen Humanoid „PC/Internet“ keine Flaschen mehr daran öffnet. Dabei gäbe es selbst in ihren Innereien noch jede Menge flaschenöffnertaugliche Hardwareteile. Aber Peter Glaser denkt vielleicht an die Software, mit diesem „Weapon of Math Destruction“ kann man tatsächlich keine Flaschen mehr öffnen – vom ersten Algorithmus an bereits nicht mehr.
Weil aber Flaschenöffner zu den beliebtesten Werbegeschenken, nicht nur von Brauereien und Getränkegroßhändlern, gehören, zudem immer mehr Arbeits- und Küchengeräte, wie Korkenöffner, auch Flaschenöffner integriert haben (die teuerste Kombination, von Manufactum, kostet 59 Euro) und auch die Souvenirläden, vor allem an der Küste, gerne Flaschenöffner mit Badeortsangabe ins Sortiment nehmen, deswegen gehört der Flaschenöffner heute schon fast zu den kleinbürgerlichen Kitsch-Objekten, die als Erinnerungsstücke gelten, aber gleichzeitig eine Funktion haben. So wie die Muschel als Andenken an Sylt ein Thermometer hat. Der Formen- und Farben-Reichtum dieser Erinnerungsstücke mit Gebrauchswert ist riesig, ganze tropische Muschelpopulationen sind allein der Thermometermuschel-Nachfrage in den Badeorten zum Opfer gefallen. Ganz schlimm wurde es dann noch einmal nach dem Mauerfall, als die Ostdeutschen in Massen solche und ähnliche Souvenirs kauften. Präparierte Fische, wie Knurrhahn und Scholle, mit kleinem Kompaß z.B. Noch heute erfreuen sich unter Landratten die Flaschenöffner namens „Sea-Club“ in Form einer Kapitänsmütze aus Messing (für 6 Euro 8) einer gewissen Beliebtheit, besonders unter Hamburger und Kieler Seglern. Sie werden an die Wand bzw. an die Kajütentür geschraubt und befinden sich deswegen auch bei Windstärke 11 noch an Ort und Stelle.
So wie man beim Computer auf Algorithmen zurückgehen muß, sollte man beim Flaschenöffner auch auf den Kronkorken zu sprechen kommen. Über diese wußte ich zunächst nicht viel mehr als dass Onkel Dagobert in einer Donald-Duck-Geschichte bei einem Südseevolk landete, deren Münzen Kronkorken waren. Aus irgendeinem Grund wurde Dagobert von ihnen beschenkt und zum Dank überschütteten seine Flugzeuge die Insel mit Kronkorken – womit ihre Verwendung als Zahlungsmittel beendet wurde.
Ich nahm an, die Erfindung des Kronkorkens stammt ebenfalls aus den USA, seit dem Wikipedia-Eintrag von 2006 weiß ich nun: Der Kronkorken wurde von dem Erfinder William Painter (1838–1906) aus Baltimore 1892 zum Patent angemeldet. Er nannte seine Erfindung „Crown Cork“ . 1892 gründete er das Unternehmen „Crown Cork & Seal“.
Seine Kronkorken mußten sich anfänglich noch gegen den Bügelverschluß auf Flaschen durchsetzen. Einige Brauereien an der deutschen Küste haben sie noch heute, sie verschließen die Flasche besser als Kronkorken, die eigentlich nur einmal (maschinell) rauf auf den Flaschenhals– und dann (per Hand) wieder runter gedrückt werden, sie sind ein Wegwerfprodukt, wie lange Zeit eigentlich auch die Flaschen, die ihrerseits von Getränkedosen vom Markt verdrängt worden wären, wenn nicht die Regierungen mit verschiedenen Verordnungen eine Koexistenz zwischen ihnen erreicht hätten.
Der heute übliche Kronkorken weist 21 Zacken auf; ursprünglich waren es 24 Zacken. Ein Grund für die Änderung war eine Reduzierung des Flaschenhalsdurchmessers. Die Norm für die Kronkorken dafür lautet: DIN EN 17177. Auf der Internetseite „mb-kronkorken.de/DDR“ findet man alle DDR-Kronkorken, auf denen Reklame für eine Biersorte oder für “Club-Cola“ gemacht wurde. Die DDR hielt sich lange Zeit nicht an die Richtlinien der internationalen Kronkorken-Vereinigung der Glas- und Getränkehersteller, weil sie arbeiterkulturbewußt an den 24 Zacken ihrer Kronkorken festhielt. Mit steigendem Export dann aber doch.
Nach der Wende beeilte sich die Stasiaufklärungs-Stelle des Westens einen videodokumentierten Fall zu veröffentlichen: „Der Technische Direktor des Berliner Brauereien hatte dem DDR-Ministerrat über Probleme des Betriebs mit Flaschenverschlüssen berichtet. Die Stasi beschäftigte sich intensiv mit dem Fall. Die Geheimpolizei witterte Sabotage des Westens.“
2020 klärte die Mitteldeutsche Zeitung jedoch auf: Der letzte Generaldirektor des Mansfelder Kombinats berichtete der Zeitung, dass er „schlaflose Nächte wegen Kronkorken“ gehabt hatte: Die Kronkorkenfabrik des Kombinats kam nicht mit der Produktion für die Brauereien hinterher, zumal der Nachschub an Rohlingen immer wieder stockte und diese zudem oft von schlechter Qualität waren.
Erinnert sei ferner daran, dass Teile des Proletariats, hüben wie drüben, ihr Schlüsselbund am Gürtel trugen, verbunden mit einem Flaschenöffner, manchmal sieht man solche „Prolls“ auch heute noch; an der Stelle hängt jedoch immer öfter ein außen getragenes Smartphone in einem Lederetui – womit wir wieder bei der Verbindung von Computer und Flaschenöffner wären.
.

Arbeiterin in Murmansker Fischfabrik 1971
.

Arbeiterinnen in einer Uhrenfabrik bei Entspannungsübungen (1977)
.
Überleben
1978 und 1980 veröffentlichten die Sowjetschriftsteller Ales Adamowitsch und Daniil Granin ein „Blockadebuch“ über die 900 Tage dauernde Blockade Leningrads durch die deutsche Wehrmacht, wodurch etwa 900.000 Einwohner verhungerten oder erfroren. Die Autoren nahmen an, dass die, die überlebt hatten, vielleicht „ihre Menschlichkeit verraten“ hatten. „In Wirklichkeit war es jedoch umgekehrt“: Die Menschen, die anderen halfen, ihnen Trinkwasser oder Brennholz beschafften und ihre Brotrationen teilten, „überlebten öfter als diejenigen, die nur auf die Erhaltung des eigenen Lebens bedacht waren“.
Dieser Befund kam dem nahe, was der ehemalige FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher 2006 in seinem Buch „Minimum“ behauptete anhand der amerikanischen „Tragödie der Siedler am Donnerpass“, wo überwiegend „Einzelkämpfer“ ohne familiäre „Blutsbande“ im Schneesturm zu Tode kamen, Familienmitglieder hingegen überlebt hatten.“ Schirrmacher folgerte daraus, dass die Familie in Notzeiten eine „Überlebensfabrik“ ist und dass die Folgen der Auflösung der Familie als ‚Keimzelle der Gesellschaft‘ und damit die Schrumpfung sozialer Beziehungen auf ein „Minimum“ sich in gesellschaftlichen Krisen verderblich auswirkt.
Bereits die Anti-Coronamaßnahmen (wie Lockdown) haben angeblich gezeigt, dass Familien damit besser klar kamen als Alleinlebende, wie einige Psychologen meinten.
Daniil Granin erwähnte in einem Interview mit Michael Schneider über sein Blockadebuch (in: „Iwan der Deutsche“ 1989) die Lyrikerin Olga Bergholz, die „eine besondere Bedeutung für die Leningrader hatte, indem sie im Radio Ermutigungsgedichte las“. Sie meinte, „niemals habe sie sich so frei gefühlt wie während der Blockade“. Das ist eine schwer nachvollziehbare Äußerung über eine Zeit, in der die Versorgung mit dem Minimum an Lebensnotwendigem über alle Maßen schwierig war und bis zur Sprengung des Blockade-Rings durch die Rote Armee im Sommer 1944 immer schwieriger wurde.
Es gibt eine ähnlich seltsame Äußerung von Jean-Paul Sartre. Der französische Philosoph meinte 1944, zwei Wochen nach der Befreiung von Paris: „Niemals waren wir freier als unter der deutschen Besatzung.“ Anläßlich des 40. Todestages von Sartre 2020 urteilte der Vorsitzende der deutschen Sartre-Gesellschaft, Vincent von Wroblewsky, in einem Interview über diese provozierende Äußerung von Sartre: „Die Bedeutung unserer Freiheit werde uns gerade in Extremsituationen besonders bewusst. Wer sich etwa dazu entschieden habe, in den französischen Widerstand einzutreten, habe sein Leben und das seiner Mitstreiter aufs Spiel zu setzen. Wer sich dagegen entschied, machte sich in Sartres Augen dagegen mitverantwortlich für Krieg und Terror der Nationalsozialisten.“
Im Zentrum von Sartres Denken stehe unsere Eigenverantwortlichkeit. Die vielleicht berühmteste Sentenz von Sartre bringe dabei die Ambivalenz unserer Selbstbestimmung zum Ausdruck: „Der Mensch ist zur Freiheit verurteilt.“ Und diese existenzielle Freiheit zeige sich laut Sartre besonders deutlich in Ausnahmesituationen.
Wroblewski kommt sodann auf die Anti-Coronamaßnahmen zu sprechen, die viele als Einschränkung ihrer Freiheit empfanden. Jean-Paul Sartre hätte das vielleicht anders gesehen, meint er, „denn in Ausnahmesituationen zeige sich unsere Freiheit am deutlichsten.“
In gewisser Weise hat der Philosoph des Existentialismus damit den Gedanken des nationalsozialistischen Staatsrechtlers Carl Schmitt vom Kopf auf die Füße gestellt. Laut Schmitt „ist Souverän, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.“ Sartre zufolge gilt das nicht für die Naziführer und andere diktatorische Herrscher, sondern in diesem von ihnen ausgerufenen „Ausnahmezustand“ für jeden Menschen, der von diesen von oben angeordneten Maßnahmen unten betroffen ist.
Der italienische Philosoph Giorgio Agamben hat 2004 ein ganzes Buch „Ausnahmezustand“ – dem Schmittschen Begriff gewidmet, in dem es ihm um Folgendes geht: „Wenn der Ausnahmezustand zur Regel zu werden droht, sind die Institutionen des demokratischen Rechtsstaats und das verfassungsgemäße Gleichgewicht der Gewalten gefährdet, und die Grenze zwischen Demokratie und Diktatur verschwimmt.“ Mit den Anti-Coronamaßnahmen, den Folgen der Parteinahme im Ukrainekrieg und der fortschreitenden Zerstörung der Natur, deren Nutznießer und Teil wir sind, droht der Ausnahmezustand zur Regel zu werden.
Sartres Stück „Geschlossene Gesellschaft“, 1944 uraufgeführt, handelt von einem Lockdown post mortem: Nach ihrem Tod sind zwei Frauen und ein Mann zum Zusammenleben in einem Raum verdammt und machen sich das ewige Nachleben gegenseitig zur Hölle, indem sie sich selbst und die anderen belügen, voneinander Dinge erwarten, die sie nicht geben können. „In dem Moment, wo die Protagonisten nicht ehrlich zu sich und den anderen sind, sind die Bedingungen dafür gegeben, dass die anderen zu ihren Folterern werden“, sagt Vincent von Wroblewsky. Für Sartre sei dieses Leiden aber nicht zwangsläufig, im Gegenteil: „Menschen könnten sich immer auch entscheiden, anders zu handeln.“
In einem Dokumentarfilm: „Wettermacher“ (2021) des polnischen Regisseurs Stanislaw Mucha machen sich drei Meteorologen, zwei Männer und eine Frau, schon das Leben hier und jetzt zur Hölle – auf einer russischen Wetterstation am Polarmeer.
.

Im Frauenbad (von Zinaida Serebnikova)
.

Frauen mit Füchsen auf dem Arm (von Anastasiya Dobrovolskaya)
.

Moskauer Model mit Bär aus Staatszirkus (von Olga Barantseva)
.
Neues aus dem Misanthropozän
Ich habe mich immer über die „Fan-Clubs“ mokiert, über den „Conny Froboess-“, den „Opel Manta-“ oder „Rudi Völlerer“-Fanclub zum Beispiel. Aber jetzt bin ich doch noch selbst ein „Fan-Man“ geworden, vielleicht aus Altersdebilität. Jedenfalls bin ich im „Sir David Attenborough Fan Club“, und weil ich schon mal diesem einen beigetreten bin, auch gleich noch in einem Elefanten-, einen Bären- und einen Flughunde-“Fan Club“. Alle vier verdanken sich Tierschützern mit einem besonderen Interesse an einem Tier bzw. an einem englischen Tierfilmer, der uns wie einst Bernhard Grzimek im Westen und Heinrich Dathe im Osten Tier-Geschichten mit gefilmten Beispielen im Fernsehen erzählt, nur intelligenter und mit modernster Technik. Kürzlich hat Attenborough ein Buch veröffentlicht, darin geht es um die ganze Welt, das heißt um alle Tier- und Pflanzenarten, die unbedingt gerettet werden müssen.
Daneben hat auch die Schimpansenforscherin Jane Goodall ein ähnliches „Statement“ veröffentlicht. Beide, so schlagen ihre jeweiligen „Fan-Clubs“ vor (auf Facebook und in anderen „sozialen Medien“), müssen dafür nun aber zügig den Nobelpreis kriegen. Dagegen ist nichts zu sagen, aber dahinter steht die Überzeugung, je mehr ein Weltverbesserer global anerkannt und mit Bürger-Ehren ausgezeichnet wird, desto mehr ist seinem Anliegen gedient. Das darf man bezweifeln. Eher ist 2020/21 zu vermuten, dass dies alles eher Kanäle sind, die ins Unbedeutende führen, zum Fading-Away.
Selbst „Huldigungen“ wie die Tierbuchautorin Sy Montgomery sie für Jane Goodall (und zwei anderen Affenforscherinnen) veröffentlichte, geraten vom Ansatz her bereits weg vom Anliegen. Spätestens seit Robert Oppenheimer gibt es laut Michel Foucault einen quasi objektiven Zwang, Berufliches und Politisches nicht mehr zu trennen. Wie noch zu Beginn der Aufklärung, als Juristen wie Emile Zola politisch-publizistisch wirkten oder heute noch Noam Chomsky, der sein linkes politisches Engagement vom fachlichen Festhalten an seiner reaktionären Sprachtheorie trennt. Im Falle von Jane Goodall könnte man sagen: Nicht ihr jetziges weltweites Initiativgründen unter Menschen, sondern dass sie sich davor jahrzehntelang den Schimpansen zugeneigt hat, das ist oder war ihre eigentliche politische Arbeit. Diese bewirkte, dass die Primatenforschung inzwischen fast eine feministische Domäne wurde.
Seltsamerweise haben dann die japanischen Primatenforscher um den Biologen Takayoshi Kano diese Entwicklung eines wichtigen Bereichs der Feldforschung (die wie die organismische Biologie überhaupt wegen der forschungspolitischen Orientierung auf die Genetik stark gefährdet war) noch forciert – mit ihrer Zwergschimpansenforschung im kongolesischen Wambawald. Die sogenannten Bonobos haben andere Konfliktlösungen als die Schimpansen: Während bei diesen das Soziale mit mehr oder weniger männlicher Gewalt zusammengehalten wird, geschieht dies bei den von Weibchen dominierten Bonobo-Gruppen über sexuelle Handlungen. Laut Takayoshi Kano besteht bei ihnen „die Funktion des Kopulationsverhaltens in erster Linie zweifellos darin, das friedliche Nebeneinander von Männchen und Weibchen zu ermöglichen, und nicht darin, Nachkommen zu zeugen.“
Ihre Bonoboforschung habe der westlichen Primatenforschung durchaus was zu sagen, meint Kano. Weil man in Japan schon lange Erfahrung mit den im Land lebenden Affen hat und die japanische Religion nicht so scharf zwischen Menschen und Tieren trennt. Daraufhin spitzte der holländische Primatenforscher Frans de Waal in der Zeitschrift „Emma“ die Ergebnisse dieser Forschung über die „maternale Kultur“ der Bonobos, von denen es etwa 15.000 gibt, noch alarmistisch zu, indem er sie als geradezu vorbildlich pries: „unsere letzte Rettung“. Die Bonobos haben auf diese Weise auch zur feministischen Theoriebildung beigetragen: „Ihre Botschaft ist bei uns angekommen,“ schrieb die Zeitschrift „Emma“.
Es macht jedoch stutzig, dass im Bonobo-Bild alles stimmt: Bei diesen unseren nächsten Verwandten trafen die Japaner im Dschungel voll den Zeitgeist: Ökologie, Frieden, Fremdenfreundlichkeit, freie Sexualität, Veganismus, Feminismus, Matriachat, Degrowth, Sonnenenergie, Entschleunigung. Nichtrauchen… Da drängt sich natürlich die Frage auf: Stimmen denn überhaupt ihre Beobachtungen, wie gering sind sie, wie weitreichend wurde das Verhalten interpretiert? Waren die japanischen Forscher unten am Waldboden und beobachteten „ihre“ Bonobo-Gruppe mit Ferngläsern, was sie oben in den Bäumen taten? Arbeiteten sie vielleicht mit elektronischen Chips, die sie den Affen implantierten oder sonstwie an ihnen befestigten, so dass sie deren „Wege“ am Bildschirm verfolgen konnten? Oder haben die Bonobos sogar das Essen mit Stäbchen von ihnen übernommen?
.

Junge Arbeiterin auf avantgardistischem Teller (1928)
.

Junge Arbeiterinnen in moldawischer Fabrik (1976)
.
Briefmarken und Chinchillas
Ein Bremer hatte eine gute Geschäftsidee. Sowas gibt’s. Der in Berlin lebende Schriftsteller Peter Kohle (Nomen est Omen?) annoncierte in einer Philatelisten-Zeitschrift, dass er eine komplette Sammlung Briefmarken von afrikanischen Staaten besäße und sie umständhalber abgeben müsse. Ihm wurden daraufhin z.T. erhebliche Summen angeboten. Das könnte also funktionieren, dachte er sich. Seine Freundin und er kauften sich einen VW-Bus, bauten ihn aus und fuhren nach Afrika. Sie besuchten alle 54 Staaten und kauften deren Briefmarken, mehrere von jeder Marke.
Als die beiden Afrikareisenden wieder in Berlin angelangt waren, setzte Kohle erneut eine Anzeige in eine Philatelisten-Zeitschrift: Habe einen kompletten Satz Marken von allen afrikanischen Staaten zu verkaufen. Und weil er mehrere von allen besaß – wurde er damit zum Millionär. Gleichzeitig schrieb er einen Bericht über ihre Afrikatour, die er unter dem Titel „Afrika -Patt Problem“ veröffentlichte. Im Vorwort schrieb er: „…Die Besonderheit der folgenden Berichterstattung liegt in der Alltäglichkeit, in dem Irrsinn der Normalität, in dem täglichen Drama…“
Weniger Glück als Geschäftsmann hatte ein Altonaer namens Jörg Böttcher, der mit Frau und Kind in Teltow auf einem Resthof lebt und bei einem Besuch des Kirschblütenfests zwei Dithmarscher kennenlernte, die eine „tolle Geschäftsidee“ hatten: In seinem leeren Schweinestall könnte er wunderbar Chinchillas züchten, meinten sie. Chinchillafelle gelten neben dem Zobel als einer der wertvollsten Pelze im Rauchwarenhandel. Damit könne er reich werden: zwischen 100 und 150 Euro bekäme man für ein Fell. Und das Futter – Gräser, Blüten, Kräuter – koste so gut wie nichts. Die Dithmarscher boten sich sogleich an, ihm neun Paare zu verkaufen – pro Tier verlangten sie 250 Euro. Nähme er alle, bekäme er einen Mengenrabatt und müsse nur 4000 Euro insgesamt zahlen.
Jörd Böttcher wollte erst einmal Näheres über Haltung und Pflege von Chinchillas wissen: Es sind südamerikanische Nagetiere. Diese auch Wollmäuse genannten Tiere werden bis zu 35 Zentimeter lang. Die Weibchen können bis zu drei Mal im Jahr zwei bis vier Junge bekommen, die schon mit etwa acht Monaten geschlechtsreif sind.
Seine Frau, Marina Klose, war skeptisch, sie wollte erst einmal ein Tier sehen. Kein Problem: Die beiden Dithmarscher hatten in ihrem Auto ein Pärchen in einer Box dabei. Als sie den beiden die Tiere zeigten, waren sie begeistert – und machten den Deal sogleich perfekt.
Als die wertvollen Pelztiere angeliefert wurden, wuchs die Begeisterung noch, denn es waren zwei schwangere Weibchen dabei – und alle 18 lebten sich gut im Schweinestall ein. Im „Chinchilla-Lexikon“ las das Ehepaar: „Manche halten Chinchillas einfach nur aus Profitgier, andere aber haben sich das Ziel gesteckt, Qualität statt Quantität zu züchten. Grundsätzlich kann man aber sagen das nicht das teuerste Tier das beste Chinchilla ist. Jedoch ist auch gleichzeitig zu sagen, dass das günstigste Tier nicht immer das günstigste Tier ist. So müsse man für ein Persian Royal Angora Chinchilla momentan weit über 2000 € bezahlen. Und das wäre noch günstig!“
Im Geiste rechnete das Ehepaar sich schon die ungeheuren Gewinne aus. Und dann vermehrten sich die Tiere auch wirklich sehr gut. Als sie die ersten zum Verkauf anboten, machte man ihnen jedoch wenig Hoffnung, dass sie mehr als 25 Euro pro Tier bzw. Fell bekämen. Ein große Enttäuschung, doch loswerden mußten sie die Tiere, denn sie hatten schon bald zu viele. Mehrere Händler, die sich ihre Chinchillas persönlich ansahen, winkten ab: Das Fell war ihnen nicht gut genug. Zuletzt bot das Ehepaar die Tiere „fürn Appel undn Ei“ Zoologischen Handlungen an.
Unterm Strich war ihre Chinchillazucht ein Minusgeschäft. Immerhin konnten sie aber nun bei Gesprächen über Geschäftsideen am Start-Upper-Stammtisch in Teltow mitreden. Ihre Chinchilla-Pleite interessierte alle.
.

Drei Mitglieder des Bolschoiballetts machen eine Rauchpause
.

Zwei Mitglieder des Bolschoiballetts
.

Vier Balletttänzerinnen
.

Drei Folklore-Tänzerinnen
.

Drei Eiskunstläuferinnen
.

Drei junge Frauen auf einer Moskauer Parkbank
.
Schwachstellen
Im Zweizwerge-Verlag Berlin erschien vor einiger Zeit die Autobiographie eines Polizisten: Er las auf der Wache täglich die taz – um seine BZ und Bild lesenden Kollegen zu provozieren, dann wurde er Kontaktbereichsbeamter (KOB) im Wedding, wobei er hoffte, aus der Bevölkerung heiße Tips für irgendwelche schweren Delikte zu bekommen, er wurde aber geradezu überhäuft von Denunziationen, was er zunächst schätzte, aber schnell merkte er, dass an all diesen Anschwärzungen nichts dran war. Enttäuscht gab er seinen KOB-Job auf – und wurde Personenschützer bei Willy Brandt, den er sehr schätzte und vor allem davor schützte, dass der regierende Bürgermeister ständig besoffen gemacht wurde. Jedesmal, wenn man „Cognac-Willy“ auf einer Versammlung abfüllte, ging er nach einiger Zeit in den Saal zu ihm und sagte laut: „Herr Brandt, der Wagen ist vorgefahren.“ Obwohl der die ganze Zeit vor der Tür stand. Aber Willy Brandt verstand, sagte „Letzte Runde“ und verschwand mit ihm.
Die US-Wissenschaftlerin Shoshana Zuboff nennt das, was auf uns zukommt „Überwachungskapitalismus – wobei sie zuvörderst an die elektronische Überwachungstechnik denkt, die ständig vervollkommnet wird. So besitzen die Ehemänner in Saudi-Arabien z.B. ein Smartphone, dass Alarm gibt, wenn eine ihrer Ehefrauen sich mit ihrem Smartphone dem Flughafen nähert.
Letzten Endes braucht aber auch die totale Überwachung Staatsdiener, die handgreiflich werden, also Polizisten, die den Überwachten oder Verdächtigen festnehmen.
Und das ist die Schwachstelle aller Systeme. Der jüdische Schriftsteller Valentin Senger überlebte mit seiner Familie, weil ein Polizist in der Meldestelle den Eintrag „mosaischer Glaube“ einfach löschte. Wer das heute angibt, der muß nur noch „Kultussteuern“ zahlen.
Am Souveränsten war unser Dorfpolizist: Wenn er einen Bauernsohn zur Musterung für die Bundeswehr melden mußte, ging er erst zu dessen Vater. Wenn der sagte, er bräuchte seinen Sohn unbedingt auf dem Hof, dann meldete er ihn nicht. Wenn der Abgabetermin für das Dieselrückzahlungsformular nahte, ging er zu den Bauern und füllte sie mit ihnen aus. Er besuchte regelmäßig meinen Vater, der für ihn einen Schnaps bereithielt, irgendwann zückte er sein Notizbuch und sagte: „Schorse, kann ich Dir mal mein neues Gedicht vorlesen?! Einmal druckste er herum: „Was Unangenehmes diesmal, jemand hat dich angezeigt, weil Du Dein Haus schwarz gebaut hast.“ Mit Hilfe des Dorfpolizisten kam mein Vater aber gimpflich davon.
Mein bayrischer Halbbruder lud mich einmal auf ein Dorffest ein, wo ausschließlich „Maß Bier“ ausgeschenkt wurde (in 1, 069 Litergläsern). Ich sagte, dass ich noch fahren müsse, er meinte daraufhin: „Bis zu drei Maß darfst Du hier trinken, da sagen die Polizisten nichts.“
Auch im bayrischen Bischofsheim wurde mir in einer Kneipe gesagt: „Keine Gefahr, die Polizei hält Dich nicht an, nur wenn oben im Walddorf die ‚Bösen Onkelz‘ spielen, werden ausnahmslos alle kontrolliert.“
Am Seltsamsten war ein Grenzpolizist am Grenzübergang Wannsee/Dreilinden. Gewöhnlich fragten die Grepos, ob man Waffen oder Funkgeräte dabei hatte, er fragte jedoch den Fahrer: „Was ist denn das, es riecht so komisch?“ Wir antworteten: „Haschisch“. Und wie wirkt das? Wollte er wissen. Es entspann sich daraufhin ein längeres Informationsgespräch. Als alles gesagt war, schenkten wir ihm ein Stück Haschisch. Als wir wieder mal nach Westdeutschland fuhren, hatte „unser“ Grepo erneut Dienst. Er grüßte uns wie alte Bekannte – und wir gaben ihm erneut ein Stück. Dann fragte er, was da auf dem Aschenbecher läge. Eine Purpfeife für Haschisch antworteten wir und reichten sie ihm. Er besah sie sich so genau, dass wir sie ihm schließlich schenkten. Als ich das einer DDR-Dissidentin erzählte, war sie entsetzt, wie unmoralisch wir uns gegenüber der DDR-Staatsgewalt verhalten hatten. Dabei waren wir hocherfreut gewesen, dass einer von den „Organen“ sich so menschlich uns gegenüber verhalten hatte.
Das mögen alles Kleinigkeiten gewesen sein, aber sie sind wichtig, um den immer unmenschlicheren Systemen zu entkommen.
.

Butterverkäuferin
.

Drei ehemalige Bäuerinnen
.
Wilde – Barbaren – Zivilisierte
Die Studien des amerikanischen Politologen James C. Scott, der das agrarwissenschaftliche Programm der Yale-Universität leitet, werden von der University-Press als „Anarchist History“ beworben. Es geht in ihnen um nicht weniger als eine völlige Umdrehung unserer Zivilisationsgeschichte, die eine gewaltsame Domestikation von Mensch und Tier ist: Es waren nicht die Seßhaften (Getreideanbauer), deren Gemeinschaften einst im Verein mit Handwerkern und Händlern sich zu den Stadtstaaten entwickelten, in denen unsere „Zivilisation“ entstand. Umgekehrt: Den Stadtstaaten (und ersten Köngsreichen) ging es um Steuern, Zwangsarbeit, Kriegsdienst, wovor die städtischen Bauern, Händler und Handwerker flohen – zu den Barbaren. Sie wurden ersetzt durch Sklaven. Die Stadtstaaten im Zweistromland, in Ägypten und China basierten ebenso auf Sklavenökonomie wie später Athen und Rom und zuletzt die nordamerikanischen Südstaaten. Während die Barbaren, die nomadischen Viehzüchter, Jäger, Sammler, Gärtner, Deserteure, entlaufene Sklaven und Banditen, in den Wäldern, Halbwüsten, Sümpfen, Mooren und Bergen ein freies, angenehmes und gesünderes Leben führen konnten.
James C. Scotts Buch „Die Mühlen der Zivilisation (2019) handelt von den ersten Statdtstaaten, wie z.B. Ur und Akkad, die ab 4000 v.Chr. entstanden – stets in Flußnähe auf fruchtbarem Schwemmland, wo leicht zu besteuerndes Getreide (Weizen, Gerste oder Nassreis) angebaut wurde – bereits lange vor den ersten Stadtstaaten, die bald ummauert wurden: nicht nur um Überfälle abzuwehren, sondern um ihre Bevölkerung an der Flucht zu hindern.
James C. Scotts noch nicht ins Deutsche übersetztes Buch „Die Kunst, nicht regiert zu werden“ thematisiert die kleinen Völker im Gebirge Südostasiens, „Zomia“ genannt, das sich über Burma, Laos, Vietnam, Thailand und China erstreckt und deren Grenzen markiert: die Karen, Katschin, Mian, Hmong u.a.. Allein die Hmong leben heute über drei Staaten verteilt und ein Teil in den USA. Nämlich diejenigen, die die Amerikaner im Vietnamkrieg unterstützten und mit deren Rückzug mitgenommen wurden, um sie nicht den Kommunisten auszuliefern. Wenn man der US-Anthropologin Anna Lowenhaupt Tsing und ihrer Studie „Über das Leben in den Ruinen des Kapitalismus. Der Pilz am Ende der Welt“ (2018) folgt, dann halten die Hmongs oder Teile von ihnen auch in der neuen Heimat, in Oregon z.B., nichts von staatlicher Unterstützung und städtischem Komfort. Sie campieren in den industriell ausgewaideten Wäldern des nordwestlichen Bundesstaates – und leben dort sogar gut. Denn sie sind Sammler eines in Japan zu Höchstpreisen verkauften Edelpilzes namens Matsutake, der nur in Oregon, Finnland und Japan wächst. Neben den stadtstaatflüchtigen Hmongs sammeln auch US-Veterans, Durchgeknallte und Naturburschen in den Oregonwäldern diesen Pilz.
Anna Lovenhaupt Tsing hat die Handelswege von dort nach Japan und die unterschiedlichen Gewinnspannen der am Geschäft Beteiligten nachgezeichnet. Das hat ihr sofort internationale Aufmerksamkeit in den Gesellschaftswissenschaften verschafft. Denn wenn Scott von diesen „Staatsfeinden“, wie er die aliterarischen Gemeinschaften und Völker mit dem Ethnologen Pierre Clastres nennt, berichtet – bis etwa zur Entkolonisierung ihrer Länder, dann hat Tsing deren heutigen Alltag in den USA, jedenfalls den der pilzsammelnden Hmong, erforscht. Diese sind damit wieder an die Anfänge ihres Lebens abseits von Staaten, im „Unsichtbaren“, angekommen. Es ist zu hoffen, dass wenigstens einer von ihnen die schöne Studie der Anthropologin mit einem eigenen Bericht ergänzt.
Die Oregonwälder, in denen der Pilz wächst, sind industriell ausgenutzt worden, auch die letzten Holzfäller, von denen es ganze Dynastien gab, haben sich heute auf Matsutake-Sammeln umgestellt. Die Geschichte ihres Untergangs hat der anarchistische Schriftsteller Ken Kesey in seinem Roman „Manchmal ein großes Verlangen“ (1987) geschildert. Der 2001 gestorbene Kesey bewirtschaftete einen Hof in Oregon. Der ebenfalls dort lebende Schriftsteller David Guterson hat 1994 in seinem Roman „Schnee, der auf die Zedern fällt“ die jüngste Geschichte der in Oregon lebenden Japaner erzählt. Sie waren Kleinbauern, nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbour wurden sie interniert. Als sie, die längst Amerikaner geworden waren, frei kamen, war ihr Landbesitz weg. Ich hoffe, dass ich diese Geschichte richtig wiedergegeben habe hier, zu ihrem bitteren Schicksal gehört auch noch, dass ihr Lieblingspilz, der ihnen nach Oregon gefolgt ist und den einige auch dort sammeln, nun für die reichen Feinschmecker in Japan gedacht ist. Aber das Schicksal der Hmong, so wie Scott es schildert, ist heute auch nicht ohne Härte. Schon allein, wenn ihre Kinder an der Westküste in der Schule auf Nationalitäten wie Burma, Kambodscha oder Vietnam festgelegt werden, obwohl sie diese Staaten seit „Urzeiten“ ablehnen. Wie auch immer: Mit James C. Scott muß man die freiheitsliebenden Hmong und andere kleine südostasiatische Völker, aber auch die europäischen Zigeuner, die nordafrikanischen Berber, die Unauffindbaren Brasiliens etc., zu den wahren Zivilisationsbringern zählen.
.

Bäuerin mit Katze
.

Bäuerin mit Riesenkohl
.

Ins Schwitzen gekommene Bäuerin
.
Waschmaschinen
Die Berliner Ethnologen Katharina und Michael Rutschky haben nie eine Waschmaschine besessen, weil sie lieber in den nächsten (Kreuzberger) Waschsalon gingen. Dort ließen sie nicht nur kostengünstig ihre mitgebrachte Bunt- und Weißwäsche waschen, sondern machten auch noch interessante soziale Beobachtungen. Aber auch die Waschmaschine selbst ist interessant. Hierzulande weiß fast jeder mindestens eine Waschmaschinen-Geschichte zu erzählen – auf Anhieb, und es hat auch fast jeder Haushalt inzwischen eine eigene Maschine. Die mancherorts realisierten Waschmaschinen-Gemeinschaftskeller, Haus-Waschsalons quasi, wurden nach und nach stillgelegt. Bereits die ersten modernen Bergarbeiter-Siedlungen, in und bei Kattowitz, hatten eine Wäscherei für alle Familien.
In einem Buch von Christian Signol über das Leben der 2016 gestorbenen französischen Schäferin „Marie des Brebis“ heißt es: „Zwar akzeptierte sie es, dass ihre Kinder ihr eine Waschmaschine kauften, sie ging aber weiterhin zum Waschplatz, ohne es ihnen je zu erzählen“.
In China ist das kollektive Waschen der schmutzigen Wäsche von Frauen am Dorfbrunnen oder am Fluß ein uralter literarischer Topos. Noch in den Berichten und Romanen der aufs Land geschickten „gebildeten Jugend“ über die Zeit der „Kulturrevolution“ (1966-1976) gibt es die Frauen, die am Dorfbrunnen oder am Fluß Wäsche waschen. Die Landverschickungskampagne wurde „Die 3 Mits“ genannt: mit den Bauern leben, arbeiten und lernen. Dennoch wäre es keinem Rotgardisten (der seine Wäsche selber wusch) in den Sinn gekommen, sich für Wasch-Salons oder Waschmaschinen im Dorf einzusetzen, auch wenn Tschiang Tsching, die Ehefrau von Mao tse Tung, verkündete: „Schmutzige Wäsche Waschen ist kein Verbrechen, sondern ein notwendiger Akt, der noch in 100 Jahren immer wieder getan werden muß!“
An diesen Spruch der 1997 im Gefängnis gestorbenen „Mao-Witwe“ mußte ich denken, als ich im Fernsehen einen SFB-Film über die letzte Schicht eines Lausitzer Braunkohlebaggers sah, auf dem Gerhard Gundermann gearbeitet hatte, bis er 1998 starb. Die Baggerbrigade wurde natürlich auf seine „IM-Tätigkeit“ angesprochen, die Brigademutti wiegelte jedoch ab: „Unsere Schmutzige Wäsche haben wir noch immer selbst auf dem Bagger gewaschen.“ Sie hatten tatsächlich eine Waschmaschine im Sozialraum auf dem Bagger.
In den westdeutschen Haushalten standen vor 1989 massenhaft preiswerte Waschmaschinen von Neckermann, die in der DDR hergestellt worden waren – vom VEB Waschgerätewerk Schwarzenberg. Von einigen Freunden weiß ich, dass sie noch immer funktionieren. Es gab in der DDR so etwas wie ein Gesetz, dass Waschmaschinen und Kühlschränke 25 Jahre halten mußten, mein Foron-Kühlschrank hielt sogar viel länger, kürzlich tauschte ich ihn jedoch gegen einen stromsparenderen ein.
In dem Poem „Die Fremde ist auch ein Haus“ (1980) von Aras Ören diktiert der in Westberlin arbeitende Sevket Cakir seinem Freund Niyazi einen Brief nach Hause, in dem es heißt: „Wir waschen sogar unsere Wäsche elektrisch.“
Da im Kapitalismus Überproduktion herrscht, müssen die Produkte, u.a. Waschmaschinen, immer kurzlebiger werden. Höchstens träumen die großen Hersteller, es sind weltweit etwa ein Dutzend, davon, ihre Waschmaschinen jedes Jahr mehr zu computerisieren und sie mit anderen Geräten, z.B. dem Handy, zu „vernetzen“. Am Ende soll man mit allen möglichen Funktionsobjekten im Haushalt „kommunizieren“ können. Erst dann weiß Bauknecht wirklich „was Frauen lieben“, wie die Firma in ihrer Waschmaschinenwerbung 55 Jahre lang versprach.
Während der Depression in den USA versuchte man, um Arbeitsplätze zu schaffen, eine „Verkürzung der Lebenszeit“ aller Industrieprodukte gesetzlich durchzusetzen, aber vor allem die Ingenieure wehrten sich: „Wir sind für den Fortschritt ausgebildet worden und nicht für den Rückschritt,“ sagten sie.
Als ein NDR-Team in Bombay eine Wohnung mit drei Bediensteten angemietet hatte, mußten diese ihnen erst zu verstehen geben, dass sie nicht für das Waschen schmutziger Wäsche zuständig waren. Man gibt dort seine gebrauchte Wäsche in Annahmeläden und von dort gelangt sie zu einem riesigen Waschplatz, der von einer Schnellstrasse überbrückt wird. Von der aus sieht man hunderte Männer an mehreren80 Meter langen Trögen mit fließendem Wasser, wie sie u.a. die schmutzige Wäsche des NDR-Teams wuschen. Danach kam deren saubere Wäsche auf geheimnisvolle Weise zur Annahmestelle zurück. „Die Welt“ titelte: „Im größten Waschsalon der Welt – dem Dhobi Ghat in Bombay – schuften Tausende“.
Die Berliner Existenzgründungen „Waschsalon mit Bar oder Café“ haben sich nicht richtig durchgesetzt. Vielleicht weil dort an der Theke ständig nur über Waschmaschinen, Wäsche und Waschpulver geredet wird. Für die Rutschkys wäre das auch nichts gewesen. Regen Zuspruch erfährt dagegen „Die Wäschewasch-Tour“ an der Spree, die bis zur „Waschfrau ‚Mutter Lustig‘“ in Springlersfeld führt.
.

Laborantin (1968)
.

Sowjetische Smartphone-Werbung (1930)
.
Ostsee-Pipelines und Fracking-Gas
„Nord Stream ist Mord Stream,“ dichtete die BILD-Zeitung, der Tagesspiegel titelte: „Russisches Gas ist blutig und schmutzig“. Die Amis hatten zuvor ein Boykott gegen alle Firmen verhängt, die sich am Bau der zweiten Nordsee-Pipeline beteiligen. Sie wollen Deutschland ihr Frackinggas verkaufen und eine wirtschaftliche Interessensverbindung zwischen Russland und Deutschland verhindern. „Eine Pipeline gegen Deutschlands Interessen“, fand dann auch das „Atlantikbrücken“-Organ FAZ, um wenig später zu melden: „Merkel schließt Stopp von Nord Stream 2 nicht aus“.
Zur Erinnerung: 1963 verfolgte die deutsch-amerikanische Politik diese Propaganda schon einmal mit einem von Amerika gegen Mannesmann durchgesetzten „Röhrenembargo“, um den Bau einer Gaspipeline von Sibirien in die DDR und in die BRD zu verhindern. Die FAZ erklärte 1986: „An der Leitung kleben das Blut, der Schweiß und die Tränen von Heeren sowjetischer Arbeitssklaven.“ Das war eine faustdicke Lüge:
Zeitweilig arbeiteten bis zu 15.000 ostdeutsche „Botschafter im Blauhemd“ an den drei Abschnitten der Erdgastrasse, die zu verlegen die DDR sich verpflichtet hatte, was dann als „Zentrales Jugendobjekt“ der FDJ organisiert wurde. Es fiel den FDJ-Hauptamtlichen zu keiner Zeit schwer, dafür laufend neue Freiwillige anzuwerben: Der Monatslohn war mit 4800 Mark mehr als üppig („Einmal Trasse und nie mehr arm!“). Nach dreijährigem Einsatz gab es einige weitere Privilegien (wie einen Pkw-Bezugsschein z.B.). Der Trassenbau war aber auch eine Art „staatlich organisierter Abenteuerurlaub“. Und gestandene Trassenbauer waren irgendwann für normale Erwerbstätigkeiten nicht mehr zu gebrauchen, schon allein wegen ihres lockeren Umgangs mit Geld: „Wenn jemand zu mir in Schönefeld ins Auto stieg und nach Leipzig gefahren werden wollte, wußte ich sofort, das ist einer von der Trasse“, so erzählte mir ein Berliner Taxifahrer.
Die DDR hatte sich im „Jamburg Abkommen“ für drei „lineare Teile“ verantwortlich erklärt: In der Ukraine (an der Grenze zum Transitland CSSR), südlich von Moskau, und im Oblast Perm (am mittleren Ural). Neben der Gaspipeline waren dort jeweils eine gewisse Infrastruktur, Verdichterstationen alle 250 km sowie etliche Wohn- und Industriekomplexe zu errichten. Die Sowjetunion zahlte dafür mit Gas. Das Gesamtvolumen der von den Deutschen zu erbringenden Leistungen betrug rund 7 Milliarden DM. Nach der Wiedervereinigung war die Bundesregierung für die Abwicklung dieser für beide Seiten profitablen Bruderhilfe zuständig.
2011 wurde die erste Ostsee-Pipeline eingeweiht, die explizit gegen die baltischen Staaten und Polen gerichtet war, weil damit die hohen Transitkosten durch diese Länder entfielen, sie wurde im Volksmund “Schröder-Putin-Pipeline” genannt. Beteiligte Konzerne und Konsortien sind Nord Stream AG, GAZPROM-GERMANIA, Wintershall/BASF AG und E.ON Ruhrgas AG / E.ON AG. Die WINGAS ist ein gemeinsames Unternehmen der Konzerne Wintershall/BASF AG und GAZPROM-GERMANIA.
Die Ostsee-Pipeline zwischen Russland und Deutschland hatte Polen nachhaltig verstimmt. Zunächst schlug Polen statt der 5 Milliarden Euro teuren Unterwasser-Gastrasse durch die Ostsee eine weitaus billigere „Amber-Pipeline“ von Russland durch Lettland, Litauen und Polen nach Deutschland vor, die zudem das „politisch unsichere“ Weissrussland umgehen würde. Das wurde jedoch abgelehnt. Aus russischer Sicht ist Polen politisch viel „unsicherer“ als Weissrussland.
Wie zum Beweis versprach Premierminister Kaczinsky, seine Einwilligung zur Stationierung von US-Atomraketen gegen Russland auf polnischen Boden davon abhängig zu machen, dass sein Land an die so genannte Baku-Tbilissi-Ceyhan-Gaspipeline zwischen dem Kaspischen Meer und der Türkei angeschlossen wird. Die Projektierung dieser Trasse wurde zwar bereits 2002 begonnen, sie wird aber wohl nicht gebaut werden.
Die erste Ostsee-Pipeline war die dritte, mit der Russland Westeuropa beliefert. Die erste wurde 1982 mit Hilfe der sozialistischen „Bruderländer“ von der Yamal-Halbinsel über den Ural durch die Ukraine bis in die Tschechoslowakei verlegt, wo sie sich verzweigte – in die DDR und in die BRD. Die zweite Pipeline wurde nach der Wende mit westlichen Krediten gebaut – sie führt ebenfalls von der Yamal-Halbinsel über den Ural, aber dann durch Weissrussland und Polen nach Deutschland. Die Transitländer verlangen für die Durchleitung Gebühren. Russland hat Polen immer wieder vorgeworfen, dass sie zu hoch seien. Da Polen jedoch gleichzeitig sein Gas hauptsächlich aus Russland bezieht, gab das deutsche Wirtschaftsministerium im Zusammenhang der polnischen Proteste gegen den Bau der ersten Ostsee-Pipeline zu bedenken: „Polen befürchtet, es könne ohne die Rolle eines Transitlandes erpressbar werden. Der russische Lieferant könnte so Westeuropa direkt beliefern und die durch Polen laufenden Pipelines schließen, bis etwa höhere Preise gezahlt würden.“
Weil einige polnische Politiker den Vertrag zwischen Gazprom (51%), BASF und Eon (je 20%) sowie der holländischen Gasunie (9%) zum Bau der Ostsee-Pipeline unter dem Aufsichtsratsvorsitz von Gerhard Schröder als neuen „Hitler-Stalin-Pakt“ bezeichneten, bemühte sich zuletzt auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel um wenigstens verbale Beschwichtigung der polnischen Befürchtungen. Dazu teilte sie der zum deutschen Springerkonzern gehörenden polnischen Zeitung „Fakt“ mit: „Es geht bei diesem Projekt nicht nur um deutsche und russische Interessen; auch andere Länder in Europa – insbesondere auch Polen – sollen von der Ostsee-Pipeline profitieren können.“ Eine faustdickie Lüge.
Der Begriff „Hitler-Stalin-Pakt“ mag polemisch überzogen sein, aber eines ist sicher, dass Polen nicht von der neuen Pipeline „profitieren“ wird. Denn deswegen wird sie ja extra um das Land herum gebaut – und zwar mit weitem Abstand, so daß Polen nicht einmal gefragt werden muß. Matthias Warnig, der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Nord Stream, erklärte dazu: Ein Mitspracherecht haben beim Bau der Pipeline nur die Länder, deren Außenwirtschaftszone dabei tangiert wird. Das gilt für Finnland, Schweden und Dänemark. „Diese Länder können Auflagen machen, eine Genehmigungspflicht gibt es aber nicht.“ Gar kein Mitspracherecht haben die Hauptkritiker der Pipeline: Polen, Litauen, Lettland und Estland. Ihre Außenwirtschaftszone wird nicht berührt. „Diese Staaten können aber Fragen stellen und sie werden informiert.“ Die Bundeskanzlerin hat dabei erst einmal mit einer Desinformation angefangen.
Beim jetzigen Bau der zweiten Ostsee-Pipeline überschlägt sich die Desinformation in den deutschen Medien geradezu, denn jeder Politiker und Wichtigtuer äußert sich dazu nun hemmungslos pro oder contra. Desungeachtet ist Nord Stream 2 so gut wie fertig, derzeit jedoch von einem Baustopp betroffen, der zunächst den amerikanischen Boykottmaßnahmen und dann der Corona-Pandemie geschuldet ist.
Letzteres gilt auch für die Förderung von Frackinggas in den USA: Dort bahnt sich ein gewaltiges Umweltdesaster an – seitdem mehrere Förderfirmen Konkurs angemeldet haben, berichtete Manfred Kriener in der taz: Durch die Pleitewelle der Frackingfirmen werden unzählige Bohrlöcher verwaist zurückgelassen, durch die große Mengen des besonders gefährlichen Klimakillers Methan ausströmen – also rohes Erdgas. Nachdem die New York Times im Juli auf ihrer Titelseite groß über die gefährliche Hinterlassenschaft der Fracker berichtet hatte, griff nun der demokratische Päsidentschaftskandidat Joe Biden das Thema auf.
Er sprach von „Millionen aufgegebener Öl-und Gasbohrungen, die es im ganzen Land gibt“. Diese bedrohten „die Gesundheit und Sicherheit unserer Bevölkerung“. Viele der Frackingfirmen und deren Vorstände, so Biden, hätten über Jahrzehnte von staatlichen Subventionen profitiert. Nun würden sie unzählige löchrige Bohrstellen zurücklassen, die Giftstoffe und Klimagase verbreiten. Biden verwies auf ein pikantes Detail: Einige der Vorstände hätten noch vor dem Bankrott „Millionen und Millionen Dollar“ kassiert.
Das besonders umweltschädliche Fracking lohnt sich derzeit wegen des niedrigen Ölpreises nicht mehr. Um die Branche dennoch zu stützen, hat die US-Umweltbehörde erst vergangene Woche weitere Umweltauflagen noch aus der Zeit von Präsident Barack Obama gelockert. Methanemissionsvorschriften für Pipelines, Öl- und Gasfelder wurden gestrichen. Die Industrie musste bislang zweimal im Jahr Bohrlöcher und Installationen auf etwaige Undichtigkeiten und Umweltgefahren hin untersuchen. Das ist nun vorbei.
Die US-Regierung schätzt laut New York Times, dass inzwischen mehr als 3 Millionen Bohrstellen aufgegeben worden sind. Davon sollen 2 Millionen nicht sicher verschlossen sein und Methan in einem Ausmaß emittieren, das den Auspuffgasen von 1,5 Millionen Autos entspricht. Die texanische Ölfirma MDC Energy ist vor acht Monaten in die Pleite gerutscht und benötigt laut New York Times 40 Millionen Dollar, um ihre Bohrstellen abzusichern. Doch dieselbe Firma sitze bereits auf 180 Millionen Dollar Schulden.
Noch vor der Bankrotterklärung hatte MDC Energy nach Angaben der Zeitung 8,5 Millionen Dollar an die Geschäftsführung ausbezahlt. Whiting Petroleum, ein weiterer großer Fracker in North Dakota, war im April in Konkurs gegangen, nachdem die Firma den Vorständen 25 Millionen Dollar an Boni überwiesen habe. Das Unternehmen Diamond Offshore Drilling soll sogar Coronahilfen in Anspruch genommen haben, bevor es den Bankrott erklärte. Auch in diesem Fall hätten die Vorstände Millionenzahlungen erhalten.
Das Energieforschungs- und Analyse-Institut Rystad Energy rechnet für 2020 mit mehr als 200 Pleiten im US-amerikanischen Frackingbereich. Im zweiten Quartal registrierte das Institut 19 Konkurse. 8 der Firmen hinterlassen mehr als 1 Milliarde Dollar Schulden. An der Spitze liegt der jahrelange Börsenliebling Chesapeake Energy mit 9,2 Milliarden Dollar Schulden.
Alle Pleitefirmen haben offenbar eines gemeinsam: Sie haben, entgegen den Vorschriften, kein Geld zurückgelegt, um die Bohrstellen sauber schließen und gegen austretendes Gas sichern zu können. „Das ist der Gipfel beim Privatisieren der Gewinne und beim Sozialisieren des Schlamassels“, twitterte der bekannte Klimaaktivist Bill McKibben. Der Londoner Thinktank Carbon Tracker schätzt die Kosten für die ordnungsgemäße Schließung eines Bohrlochs auf 300.000 Dollar.
Der deutsche Frackingspezialist Werner Zittel sieht die Pleitewelle als logische Konsequenz einer Branche, die seit Jahren nur noch Schulden anhäufe. Zittels langjähriger Mitautor Jörg Schindler verweist auf Satellitenmessungen, die einen starken Anstieg der Methanemissionen über den Frackingzonen der USA belegen. Schindler: „Durch Fracking wurde nicht nur unendlich viel Geld verbrannt, jetzt hinterlässt man eine Schweinerei ohne Ende.“
Die taz v. 29.9.22 nach den Sprengungen der Pipelines durch die Amis: „Steckt Russland dahinter?“
„Mit dem Verschwinden der UDSSR hat sich die traditionelle Russophobie nur in der Erscheinung, nicht ab im Wesen verändert, heißt es in dem Essay „Die Angst vor den Russen – damals und jetzt“.
.

Die Arbeiterin Marusha (von Geli Korzhev)
.

Die Soldatin Vera
.

Drei Dorfschönheitn mit Soldaten (1967)
.
Onkomäuse
Die Onkomäuse sind gentechnisch modifizierte Mäuse, die infolge einer künstlich herbeigeführten Mutation Krebs haben. „Die Onkomaus ist ein Meilenstein,“ schreibt die Philosophin Lara Huber in ihrem Buch „Relevanz. Über den Erkenntniswert wissenschaftlicher Forschung“ (2020). Für die biomedizinische Forschung sowie auch für die kapitalistische Plusmacherei, denn die 1984 von einem Harvard-Gerätewissenschaftler mit einem vererbbaren Krebs-Gen versehene Maus war das erste patentierte Lebewesen.
Seitdem werden die Ökomäuse gezüchtet, gequält, zu Millionen getötet und viel Geld mit ihnen verdient. Es sind „transgene Organismen“ bzw. „Mensch-Maus-Chimären“, man nennt sie laut Huber auch „humanisierte Mausmodelle“. Auf dem Weg dahin beschossen die Biochemiker ihre Labormäuse mit Röntgenstrahlen, radioaktiven Strahlen und allen möglichen Giften, um eine Mutation auszulösen, die bei ihren Nachkommen z.B. ein Auge zu viel, sechs Beine oder zwei Köpfe entstehen ließ. Wenn das gelang, knallten im Labor die Sektkorken.
Aber Onkomäuse waren das noch nicht, obwohl sie manchmal auch Tumore bekamen. Erst durch eine gentechnisch herbeigeführte Mutation in diesen poussierlichen Nagetieren hatte man fortan genug Mäuse mit Krebs zur Verfügung. Nun sind aber nicht alle Tumore gleich. Gilt es z.B. den durch Mutation des Tumorsuppressorgens ‚BRCA1“ entstandenen „familiär bedingten Brustkrebs“ zu erforschen, benötigt man Onkomäuse aus der transgenen Mauslinie „BRCA1/P53“. Das leuchtet ein und ist auch kein Problem, denn es gibt überall Firmen, die zu jedem Tumor die passenden Onkomäuse liefern. Da sie patentiert sind, darf man sie jedoch bei Strafe nicht selbst nachzüchten, man muß ständig neue kaufen. Die Laborassistenten und Doktoranden sind deswegen angehalten, schonend mit diesen Tierchen umzugehen. Wie eine Untersuchung in England ergab, haben 98,9% aller Labormäuse die allergrößte Angst vor Menschen. Sie ahnen, was ihnen blüht. „Das Schicksal der Mäuse ist besiegelt, sobald sie in ein Labor gelangen. Dort kommen sie nur tot wieder heraus, und das fast immer nach Torturen, die wir unserem schlimmsten Feind nicht wünschen würden. Nach einer Schätzung der Universität von Rutgers, New Jersey, wurden bereits 1971 allein in den USA rund 40 Millionen Mäuse umgebracht,“ schreibt Francesco Santoianni, „Experte für Katastrophenschutz und -bekämpfung“ in seinem Buch „Von Menschen und Mäusen“ (1998). Nicht zu verwechseln mit dem Buch „Von Mäusen und Menschen“ von John Steinbeck.
Wenn man nachgewiesen hat, dass der Brustkrebs bei einer Patientin und bei einer Onkomaus quasi identisch ist, werden der letzteren allerlei Gifte injiziert – in der Hoffnung, dass eins davon das Wachstum des Tumors bremst. Und dann kommt auch schon der Pharmakonzern Hoffnung-La-Roche und versucht ein Krebsmedikament aus dem hilfreichen Gift zu machen, das marktfähig ist. Immer mehr Frauen bekommen Brustkrebs, derzeit jährlich 46.000, deswegen gibt es einen großen Markt dafür und also auch für Onkomäuse.
Unter ihnen gibt es welche, die einen Tumor des Brustdrüsengewebes haben, den man ihnen mit einem Virus eingeschleust hat: MMTV (mouse mammary tumor virus) genannt. Es geht dabei um ein menschliches Protein – „her2“, das die Entwicklung der Brustdrüse reguliert, aber infolge einer Mutation quasi außer Kontrolle geraten ist. Zunächst mußte man in der Onkomaus ein Protein identifizieren, „dass mit dem „her2“-Protein beim Menschen einen gemeinsamen Vorläufer teilt. Dieses Protein nannte man dann „neu“ (neuro/glioblastoma derived oncogene homolog) und die Mausmodelle „MMTV/c-neu“. Diese entwickelten dann einen Antikörper, der das „her2“-Protein gewissermaßen bremste, daraus mußte man nun bloß noch einen Wirkstoff für Menschen machen: der Onkomäuseantikörper mußte „humanisiert“ werden, 1990 führte diese Entwicklung laut Lara Huber zu dem Medikament „Herceptin“.
„Wir haben 99 Prozent unserer Gene mit der Maus gemeinsam – und wir haben sogar die Gene, die einen Schwanz machen,“ verkündete Jane Rogers vom internationalen „Mouse Genome Sequenzing Consortium“ (MGSC), zu dem der berühmte Londoner „Mäuseturm“ gehört, in dem tausende Onkomäuse ihrer Vernutzung entgegendämmern.
Pharmaforscher geben dem MGSC und anderen Onkomausforschern zu bedenken: „Mice tell lies!“ Mäuse lügen – denn was heißt schon eine 99prozentige Übereinstimmung der Mausgene mit den Genen der Menschen, wenn eine noch viel geringere Differenz bereits den großen Unterschied zwischen Affen und Menschen ausmacht?!
Mäuse haben Fähigkeiten, die beiden abgehen: Trächtige weibliche Mäuse können z.B. ihre Föten zurück bilden, wenn sie einem Männchen begegnen, „das ihnen noch besser ‚gefällt‘, so daß sie ihre Föten völlig wieder ‚aufsaugen‘, um eine Beziehung mit dem neuen Partner beginnen zu können,“ so Santoianni.
.

Femen-Aktion gegen Staatsgewalt
.

Femen-Aktion auf der Hannovermesse
.
Schwarzfahren
Zwei Mal hat man mich beim Schwarzfahren erwischt. Einmal waren es drei Türken, darunter eine besonders witzige Frau, ein andern Mal ein alter Deutscher. Er sowie auch die drei anderen versuchten mir alle möglichen Brücken zu bauen, damit ich nichts zahlen mußte, aber ich war nun mal schwarz gefahren. Als ich mit dem Bußgeldzettel des alten Kontrolleurs zur BVG-Zahlstelle nähe Jannowitzbrücke kam, schob ich dem Kassierer dort 60 Euro hin – einen Fünfziger und einen Zehner. Den Fünfziger schob er mir sofort zurück und nahm nur den Zehner, wovon er mir dann auch noch zu meiner großen Verblüffung drei Euro zurück gab. Mit dem Bußgeldzettel der türkischen Kontrolleurin ein halbes Jahr zuvor hatte ich von meinen 60 Euro noch nichts zurück bekommen.
Dennoch waren diese zwei freundlichen Kontrolleurserlebnisse eine Ausnahme, denn ich habe schon oft mit angesehen, dass die BVG-Kontrolleure unangenehme Typen waren, nicht selten rassistische Rechte. Ein Freund aus Togo, der einige Wochen im Humboldt-Forum forschte, mußte zwischendurch einen Vortrag in Paris halten. Er fuhr zum Flughafen Schönefeld und wurde unterwegs kontrolliert. Weil er nur einen Fahrschein für Berlin hatte, der Flughafen aber in Brandenburg liegt, mußte er aussteigen, alle möglichen Papiere vorzeigen und 60 Euro Strafe zahlen. Die ganze Prozedur war für ihn sehr unangenehm und dauerte so lange, dass er darüber seinen Flug verpaßte. Er mußte dann seinen Vortrag über Video halten, was ziemlich unbefriedigend für ihn war.
Man weiß, dass ziemlich viele Leute so oft beim Schwarzfahren erwischt werden, dass sie ins Gefängnis kommen. In Köln gibt es jetzt eine Initiative, die das ändern will. Dazu veranstalten sie am 30.11. in der Karl Rahner Akademie (Jabachstr. 4-8) einen „Abend“. In der Ankündigung heißt es: „Fast jeder zehnte Häftling in einem Gefängnis hierzulande verbüßt eine Ersatzfreiheitsstrafe. Das ist eine freundliche Umschreibung der Tatsache, dass obdachlose Menschen bisweilen beim Schwarzfahren erwischt und bei Wiederholung angezeigt werden.“
In Köln mögen die Schwarzfahrer in der Mehrzahl Obdachlose sein, in Berlin sind es vor allem männliche Jugendliche, die ihr letztes Geld für Drogen oder Essen ausgegeben haben. Eine zeitlang waren es aber auch Obdachlose, die mit der S-Bahn nach Brandenburg fuhren, wo sie in den dortigen Sozialämtern Bargeld bekamen. Das ist aber nicht mehr so, anscheinend waren es für die brandenburgischen Ämter zu viele Obdachlose geworden. Auf alle Fälle wurden viele von ihnen auf der Fahrt dorthin als Schwarzfahrer erwischt.
Besonders unangenehm sind die Razzien an der Bushaltestelle neben der Bundesdruckerei: Da stehen dann etwa ein Dutzend BVG-Kontrolleure und ebensoviele Polizisten und nehmen sich die Fahrgäste des Kreuzberger 29er-Busses vor. Manchmal ist nicht ein Schwarzfahrer darunter, aber die geballte Ladung von bösartig aussehenden Uniformierten erinnerte z.B. den Klavierstimmer Oskar Huth jedesmal an die Nazizeit. Die Nazis hatten vor allem während des Krieges regelmäßig und mit großem Personalaufwand die Berliner Busse und Bahnen kontrolliert . Der untergetauchte Oskar Huth war damals täglich in der Stadt unterwegs, um versteckte Juden mit von ihm gedruckte Lebensmittelkarten zu versorgen. Wegen der Razzien ging er zu Fuß. Die Nazizeit war für ihn vor allem ein „Monstermarsch“, zuletzt bewaffnet, einen besonders widerlichen SA-Mann brachte er um. Später bedauerte er, nur einen getötet zu haben.
In der Kölner Ankündigung der Veranstaltung zur Solidarität mit den Schwarzfahrern heißt es weiter: „Werden sie mehrmals erwischt „verhängt ein Gericht eine Geldstrafe, die die Menschen nicht zahlen können, worauf sie im Knast landen. Dieser ‚Ersatz‘ der Geldstrafe kostet den Staat ein Vielfaches der ursprünglichen Strafe, ganz abgesehen davon, dass die nicht nur obdachlosen, sondern meist auch arbeitslosen Menschen im Knast nichts zu suchen haben. So wird das Gefängnis zum Armenhaus. In diesem Sommer gab es dieses Problem dank der 9-Euro-Tickets fast gar nicht. Wie wäre es also mit Freifahrtscheinen für Obdachlose? Kriminologen und Sozialarbeiter fordern schon lange eine Reform der Ersatzfreiheitsstrafe. Ein Abend über Folgen der aktuellen Gesetzgebung und sinnvolle Alternativen.“
In Berlin wurden 2021 knapp 600.000 Fahrgäste ohne Fahrschein erwischt, was der BVG 7,2 Millionen Euro einbrachte. Die Justizsenatorin von den Linken, Lena Kreck, will nun das Schwarzfahren legalisieren – mit einem „0-Euro-Ticket“. Die Bild-Zeitung der Springerstiefelpresse zitiert dazu den CDU-Rechtsexperten Alexander Herrmann, der vor einem „Freifahrtschein für alle Kriminellen“ warnt. Der CDUler scheint ein Idiot zu sein, denn mit einem „0-Euro-Ticket“ fährt ja niemand mehr schwarz und wird also auch nicht mehr kriminalisiert. Das müßte eigentlich sogar ein „Rechtsexperte“ kapieren.
.
Studentin in Moskauer Kunstgalerie
.
Demonstrierende Rentnerin
.
Ukraine-Demo vor Moskauer Verteidigungsministerium
.
Festgenommene Teilnehmerin einer Demonstration
.
Verhaftung einer Demonstrationsteilnehmerin
.
Moskauer Demonstrantin wird abgeführt (2022)
.
Moskauer Demonstrantin wird weggetragen (von Irina Liventsova)
.
Mädchen demonstriert gegen den Ukraine-Krieg
.
Sit-In einer Moskauer Schülerin
.
Frauendemo gegen den Ukraine-Krieg in Tallin (Estland)
.
Demonstration in Minsk gegen die weissrussische Regierung
.
Trinkgelder
In der DDR gab es „Industriepfarrer“, sie betreuten keine Gemeinde sondern arbeiteten ganz normal in einem Betrieb, einige machten sogar kleine Karrieren. 1992 trafen sie sich mit ihren französischen Kollegen, die ebenfalls irgendwo arbeiten mußten, da es in Frankreich keine Kirchensteuer gibt. Am Schluß ihres Treffens besuchten sie gemeinsam einige berühmte Pariser Cafés am Boulevard Saint-Germain. Dort erzählten ihnen die Kellner, dass sie nicht nur kein Gehalt bekommen, sondern auch noch was dafür zahlen müssen, dass sie dort arbeiten dürfen. Sie leben vom Trinkgeld.
Weil die Kellner in den USA und Kanada so wenig verdienen, sollte man bis zu 20 Prozent im Restaurant geben, wenn nicht bereits eine Servicegebühr auf der Rechnung steht. Im Gegensatz zu Europa, wo man 10 Prozent der Rechnung für ein gutes Trinkgeld hält, ist es in Südostasien und Japan nicht üblich, dass man einen „Tip“ gibt , während in den Emiraten und in Dubai eine „Servicegebühr“ von 15 Prozent erhoben wird. In Moskau gab ich kurz vor meiner Abreise einer Kellnerin meine ganzen Rubel, sie stieß einen spitzen Schrei aus und gab mir einen Kuss. Ich vermutete daher, dass es doch mehr war als ich gedacht hatte, wir freuten uns aber beide.
Während der Corona-Hysterie leideten vor allem jene, schreibt die FAZ, „die in der Gastronomie und der Veranstaltungswirtschaft beschäftigt sind“, vor allem „während der beiden langen Lockdowns“. Sie verdienten nichts. Es gab aber Ausnahmen: Einige türkische Restaurants, in denen ich verkehrte, hatten ihre nicht-einsehbaren Hinterzimmer „geöffnet“. Ihre Kellner bekamen dafür über 20 Prozent.
Nun hat die bekannteste deutsche Kräuterlikörmarke – mit dem scheußlichen Namen „Jägermeister“ eine aufwändige Kampagne gestartet, die bereits in die zweite Phase geht: „Trinkgeld gehört dazu“. Mittels Plakaten spricht sie die Situation von Taxifahrern und in der Gastronomie Beschäftigten an – mit Porträtfotos: „Nur 54 Prozent finden Trinkgeld geben selbstverständlich“, „Jeder 2. unterschätzt die Bedeutung von Trinkgeld“, „Jede 2. Taxifahrt endet ohne Trinkgeld“, „65 Prozent finden, Trinkgeld muß man sich verdienen“. Die Aktiengesellschaft „Jägermeister“, deren Aktien sich im Privatbesitz der Familie Findel-Mast befinden, machte vor der Pandemie mit 900 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 500 Millionen Euro. In der zweiten Phase ihrer Kampagne will die Firma nun zeigen, „dass Trinkgeld geben Spaß machen kann und soll.“ Hierfür stellt sie „100.000 Euro Trinkgeld für zehn deutsche Clubs bereit. Die Übergaben werden als kurze Video-Clips in relevanten Social-Media-Channels zum Trinkgeld geben anregen.“
Außerdem hat die Firma Jägermeister eine Hip-Hop-Gruppe aus der Vorwendezeit „Die Fantastischen Vier“ („Fanta 4“ genannt) engagiert und ein Video produziert, in dem laut FAZ „die ‚Meister der Nacht‘ von ihrem Alltag berichten: Barkeeper, Taxifahrer, Türsteher, Reinigungskräfte, Soundtechniker, Garderobieren und Kioskbetreiber.“. Wenn man angibt, dass man mindestens 18 Jahre alt ist, kann man ihn sich unter „dienachtbrauchtmeister.de“ ansehen. Überdies wurde eine limitierte „Jägermeister“-Edition kreiert, die man im Onlineshop von Jägermeister bestellen kann, zusammen mit einem Kapuzenpullover und Tickets für die kommende Tour der Fanta 4: „Für immer 30 Jahre live“ (3 Monate 10 Städte).
Der Erlös aus dem Verkauf der „Jägermeister“-Edition soll dem Verein „Alarmstufe Rot“ zugute kommen. Dieser Verein wurde von acht Party-Profis gegründet: von Tom Koperek vom „LK“, einem „Anbieter von Live- und Markenkommunikation“, Sandra Beckmann aus dem „Event-Kombinat“, Christian Eichenberger, Geschäftsführer der „Party Rent Group AG“, Christian Dietzel vom „Mobilen Discoservice Berlin“, Alexander Ostermaier, Geschäftsführer der „Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft“, Chris Fleck, „Square Dance Caller“, Nico Ubenauf, „Eventdienstleister“, Christian Seidenstücker, Geschäftsführer der „Joke Event AG“.
Der Verein der acht Geschäftemacher mit dem kapuzentragenden Amüsierpöbel hat ebenfalls eine Kampagne gestartet „#SangUndKlanglos“: Sie setzt ein „Zeichen für freischaffende Künstlerkollegen, Bühnen- und Backstage-Mitarbeiter und über 1 Mio. Beschäftige im Veranstaltungswesen. Diese Aktion soll die Aufmerksamkeit von Regierung und Öffentlichkeit für unsere Not gewinnen.“ Die acht „kämpfen für das Überleben der Veranstaltungswirtschaft – dafür ist der Erfolg der Impfkampagne essentiell. Nur mit einer hohen Impfquote können wir alle es gemeinsam schaffen, schnell und sicher wieder an unsere Erfolge anzuknüpfen.“ In ihrem „Kampf“ haben sie quasi noch einen neunten mit im Boot: Unseren Corona-Minister Lauterbach. Er passt zu Jägermeister wie die Faust aufs Auge. Allerdings will er jetzt angeblich doch keine FDP2-Masken in Größenordnungen mehr bestellen (Corona ist out, Ukraine ist in), sondern tonnenweise Jod-Tabletten.
.

Valentina Gagarina mit Tochter (1961)
.

Valentina Tereshkova mit Kind
.
Matrosenfrust
Heide Gerstenberger lehrte „Theorie des bürgerlichen Staates und der Gesellschaft“ an der Universität Bremen, wo sie die „Forschungsstelle Schifffahrt“ gründete zusammen mit dem Wirtschaftswissenschaftler Ulrich Welke. Beide fuhren mehrmals als Sozialforscher auf Handelsschiffen mit, Welke zuvor auch als Ingenieur-Assistent. Und beide veröffentlichten viele Bücher über die Seeschifffahrt.
Als die Bremer Uni Mitte der Siebzigerjahre Forschung und Lehre aufnahm, hatte gleichzeitig „die alte Seefahrt aufgehört zu existieren“. Gefahren wird heute unter Billigflaggen. Die Schiffe betreiben nicht mehr länger Privatpersonen, sondern multinationale Konzerne und Investmentgesellschaften. Europäische Seefahrer finden sich nur noch auf der Brücke. „Den Großteil der Arbeit erledigen“ laut Welke „billige Handlanger aus Entwicklungsländern“.
Schon damals musterten die ersten See-Offiziere und Kapitäne ab und begannen ein neues Studium – u.a. an der Bremer Uni, wo sie mit ihrem Alkoholkonsum das Mensaklima auflockerten, aber auch, weil sie immer mal wieder Jobs z.B. auf Öltankern annahmen, ein halbes Jahr über die Meere fuhren und danach genug Geld hatten, um sich ein weiteres Jahr Weltwissen an Land anzueignen. Ich hatte Mitte der Sechzigerjahre, um der Bundeswehr zu entkommen, auf einem Hapag-Lloyd-Schiff als Messjunge angeheuert und mußte für so gut wie kein Geld die Offiziere bei Tisch bedienen und ihre Betten machen. Der zweite Messjunge war erst 16 Jahre alt, aber schon weit herum gekommen. Er prahlte damit, schon fünf Mal einen Tripper gehabt zu haben und wettete um einen Kasten Bier, dass er eine Flasche Tabasco auf Ex trinken könne – was er auch tat. Heiligabend hatte ich in Hamburg Landgang und wunderte mich, wie sentimental die alten Matrosen waren: Sie saßen in den Hafenkneipen und heulten.
In ihrem neuen Buch „Auf den Wogen von Meeren und Mächten“ setzen sich Gerstenberger und Welke u.a. mit der These des US-Soziologen Erving Goffmn auseinander, der 1957 meinte, dass Schiffe wie Gefängnisse, Waisenhäuser, Kasernen und psychiatrische Kliniken „Totale Institutionen“ seien. Die beiden „Küstendenker“ haben gute Argumente gegen diese These, u.a. dass Millionen Arbeitslose nur zu gerne auf einem Schiff arbeiten würden. Mehrmals zitieren sie aber Seeleute, die das Arbeiten und Wohnen auf ihrem Schiff „schlimmer als ein Gefängnis“ empfinden.
Die Entwicklung ging in Deutschland in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vom selbstbewußten Seemann, der unterwegs eigene Geschäfte machte, zum abhängigen Proletarier, der sich höchstens noch an der Ladung ein wenig schadlos hielt. (So wie im Übrigen auch die Hafenarbeiter: Wem es nicht gelang, beim streng kontrollierten Entladen z.B. von Whisky mindestens eine Kiste beiseite zu schaffen, der taugte nichts).
100 Jahre später wurden mit dem Ausflaggen der westdeutschen Handelsflotte (und Ende des 20. Jahrhunderts auch der DDR-Flotte) die gewerkschaftlich organisierten deutschen Seeleute mehrheitlich durch fast rechtlose und unterbezahlte Filipinos ersetzt. In Manila gibt es sogar deutsche Personalvermittler und eine Ausbildungsstätte, wo sie lernen, wie man auf den Kreuzschiffen Betten bezieht und Handtücher in Herzform faltet. Allein der US-Marktführer Carnival Cruise Line beschäftigt 100.000 Filipinos, seine Rostocker Kreuzfahrtmarke „Aida“ 13.500. „Die Schifffahrt ist heute ein radikal internationalisiertes Gewerbe.“ Seit 1990 haben klamme Reedereien einige 1000 Schiffe aufgegeben, ihre Mannschaften mußten sehen, wo sie bleiben. Im Golf von Mexiko wurden 2010 hunderte von „abandoned ships“ einfach versenkt. Neuerdings bieten sich chinesische Arbeitslose für noch weniger Lohn als die Filipinos an.
„Ironischerweise haben die sozialen Strukturen an Bord deutscher Handelsschiffe erst in jüngster Zeit eine fast vollständige Übereinstimmung mit Goffmans ‚Totaler Institution‘ erreicht,“ schreiben Gerstenberger und Welke. Und mit der Ablösung der Stückgutfrachter durch Containerschiffe hat sich nicht nur die Aneignung von Teilen der Fracht erledigt, sondern fast auch die Landgänge der Mannschaft.
Selbst mit den Kapitänen, die einige Jahrhunderte selbstherrlich das Gesetz an Bord verkörperten, ging es bergab. Auf den Forschungsschiffen sowieso: Während sie früher den Wissenschaftlern sagten, was sie zu tun hatten, geben heute die Wissenschaftler ihren Kapitänen Anweisungen. Auf den Handelsschiffen sagen ihnen die Manager ihrer Schiffseigner über Funk, wo sie wann was zu tun haben.
Der Schriftsteller Landolf Scherzer heuerte 1977 als „Produktionsarbeiter“ auf dem Fang- und Verarbeitungsschiff „ROS 703 Hans Fallada“ an. Die DDR hatte von Lizenzhändlern eine kanadische Fanglizenz – mit Mengenbeschränkung – gekauft. Als sie in ihrem Fanggebiet ankamen, waren dort schon zwei andere DDR-Fangschiffe sowie zwei polnische, ein dänisches, ein bulgarisches, und vier westdeutsche. Als sie nach Wochen noch immer keine großen Rotbarsch-Schwärme gefunden hatten, kam aus der Kombinatszentrale in Rostock die Anweisung: „Noch 4 Tage vor Labrador fischen, dann nach England dampfen und im Hafen von Falmouth Makrelen, die englische Fischer verkaufen, verarbeiten.“ Für ein Kilo zahlten sie dann 5 Mark. Auf der Weiterfahrt nach Rostock mußten die Fische an Bord sortiert, gewaschen, geköpft, filetiert und gefrostet werden. In den Läden kostete das Kilo dann 1 Mark 40.– Fast schon ein staatliches „Gastmahl“, wie Scherzer in seinem Buch „Fänger und Gefangene“ schrieb, das 1998 noch einmal verlegt wurde – ergänzt um Interviews mit seinen ehemaligen Bordkollegen, die nach Abwicklung der DDR-Fischfangflotte fast alle arbeitslos geworden waren.
Die Flotte war gleich nach der Wende von der Unternehmensberatungfirma Roland Berger per Gutachten „versenkt“ worden, schon 1976 war sie wegen der Erweiterung der Fischereizonen vor allem um Island „aus der Nordsee“ geflogen, wie Holger Teschke in seinem Buch „Heringe“ (2014) schreibt. Die westdeutsche Fischfangflotte wurde an die Isländer verkauft, die nun Deutschland „just in time“ beliefern. Seitdem ist Bremerhaven die westdeutsche Stadt mit der höchsten Arbeitslosigkeit.
.

Drei Kinder auf dem Topf
.

Lehrerin mit einer Mädchenklasse
.

Drei Schulmädchen
.

Drei Mädchen vor Lenin-Denkmal
.

Drei Pionierinnen
.

Drei Frauen für Putin und Medwedew
.

Drei gutgelaunte Moskauerinnen
.

Drei Einkäuferinnen in Moskau (1982)
.
Staub
Man unterscheidet zwischen Hausstaub und Feinstaub bzw. Ultrafeinstaub. Die Feinstäube haben eine Korngröße kleiner als zehn Mikrometer, Ultrafeinstaub eine, die kleiner als 0,1 Mikrometer ist. Weil beide die Gesundheit schädigen, sind sie laut Wikipedia „Gegenstand zahlreicher Forschungsarbeiten“. Der Hausstaub wird dagegen als eine „Mischung aus unterschiedlichen anorganischen und organischen Stoffen“ bezeichnet. Weil er aber meist Weichmacher aus Kunststoffen enthält, ist der Hausstaub ebenfalls gesundheitsschädlich, und für Leute mit Asthma oder einer Stauballergie sehr unangenehm, besonders der darin enthaltene Kot der an sich harmlosen Hausstaubmilben, die so winzig sind, dass man sie mit bloßen Auge nicht sieht.
Der Hausstaub entsteht beim Handwerken, Bettenmachen und Kochen und wird mit der Kleidung in die Wohnung getragen. Er sammelt sich gerne unter Schränken und Diwane, in Klumpen nennt man ihn Staubmaus. Die Feinstäube entstehen im Autoverkehr und in Industrieanlagen. Also drinnen und draußen atmen wir Staub ein – und das ist nicht gut.
Der Leiter des „Wissenschaftszentrums Umwelt“ an der Augsburger Universität, Jens Soentgen, hat in seiner Reihe „Stoffgeschichten“ u.a. ein Buch über „Staub – Spiegel der Umwelt“ veröffentlicht, das einen Überblick über die aktuelle Staubforschung bietet und das Phänomen Staub von der Astrophysik bis zur Kriminologie erhellt. Im Staub fand die Forschung noch viel mehr als oben angedeutet: Sandkörner aus der Sahara, Salzpartikel vom Meer und kosmische Teilchen. „Moderne Analytiker mit ihren hochsensiblen Geräten können aus wenigen Krümeln Staub ganze Geschichten herauslesen. Sie zeigen auch, dass Staub nicht nur ein negativer Umweltfaktor ist. Für viele natürlichen Prozesse, wie etwa den Wasserkreislauf ist er unerläßlich.“
Außerdem verschafft er Legionen von Putzfrauen und Putzmännern Arbeit und damit Einkommen. Eine Freundin von mir geht z.B. gerne auf Privatparties, wo sie dann im passenden Moment mit dem Finger über eine Kommoden- oder Schrank-Oberfläche wischt und dabei wie nebenbei zum Gastgeber sagt: „Hier müßte auch mal wieder Staub gewischt werden.“ Das hat ihr schon oft zu einer neuen Putzstelle verholfen.
Leo Tolstoi notierte am 28. Februar 1897 in seine Tagebuch: „Ich wischte den Staub im Zimmer ab, und nachdem ich ringsherum gegangen war, kam ich zum Diwan und konnte mich nicht erinnern, ob ich ihn schon abgewischt hatte oder nicht. Da diese Bewegungen gewohnte und unbewußt sind, konnte ich mich nicht erinnern.“ Derart vergeht das ganze komplizierte Leben vieler Menschen „unbewußt“, meint Tolstoi, und es ist gerade so, „wie wenn dieses Leben nicht gewesen wäre“.
Das passiert wohl jedem von uns nahezu täglich, dass man eine Gewohnheit – wie das Ausstellen des Herds, das Ausschalten des Lichts oder das Abschließen der Wohnungstür – „unbewußt“ erledigt, und sich dann nicht mehr erinnern kann, ob man es wirklich getan hat. Viele Leute kehren noch mal um und kontrollieren es, manche sogar mehrmals. Für Tolstoi sind diese unbewußt durchgeführten Gewohnheiten „gerade so, wie wenn dieses Leben nicht gewesen wäre“, denn für ihn gibt es nur dann ein „Leben, wenn das Licht des Bewußtseins es durchleuchtet. Bewußt ausgeführte Handlungen sind Handlungen, die wir als freie Wesen ausführen. Folglich liegt die Freiheit im Bewußtsein.“
Tolstoi will mit dem Staubwischen auf das „Freiheitsbewußtsein“ hinaus, am Ende dieses Tagebucheintrags schreibt er jedoch: „Es schien mir klarer, als ich es dachte“. Er hat sich vergaloppiert, wie man so sagt, denn er kommt zu dem Ergebnis: „Hätte ich kein Bewußtsein und keine Freiheit, so könnte ich mich des Gewesenen nicht erinnern.“ Aber er konnte sich ja gerade trotz Freiheit und Bewußtsein nicht erinnern, ob er den Diwan bereits abgestaubt hatte.
Vielleicht hilft uns hierbei sein Zeitgenosse Charles Darwin weiter: In einem Streitgespräch zwischen ihm und seinem französischen Kollegen Georges Cuvier über die Frage, wie der Wolf zum Menschen kam und dabei zum Hund wurde, nahm Darwin an, dass die Hinwendung des Wolfs zum Menschen als eine freie Willensentscheidung begann, dann durch die Übung zur Gewohnheit wurde und sich durch dauernde Wiederholung schließlich in einen Instinkt verwandelte, der aus dem wilden Tier einen treuen Hund machte. „Problem gelöst!“ schrieb er anschließend in sein „Notebook“. Aus der Freiheit entwickelte sich für Darwin die Unfreiheit (der Instinkt).
Von dieser Idee ausgehend kann man vielleicht sagen, dass unser Bewußtsein die Gewohnheiten – Tätigkeiten, die wir ständig (fast automatisch) ausführen – ins „Unbewußte“ abdrängt, damit wir uns besser auf Neues konzentrieren können. Wir verschaffen uns freie Kapazitäten im Denken, indem wir immer wieder zur Gewohnheit gewordene Handlungen quasi bewußtlos erledigen. Im Gegensatz zu Tolstoi würde ich sogar sagen, dass wir dadurch an Freiheit gewinnen, die wir jedoch gerade nicht unserem Bewußtsein verdanken. Vielleicht sollte ich aber auch noch hinzufügen: Es schien mir klarer, als ich es dachte.
.

Mädchen mit Lenin-T-Shirt
.
Überwachungskapitalismus
So nennt die US-Wissenschaftlerin Shoshana Zuboff das, was auf uns zukommt – wobei sie zuvörderst an die elektronische Überwachungstechniken denkt, die ständig vervollkommnet werden. So besitzen die Ehemänner in Saudi-Arabien z.B. ein Smartphone, dass Alarm gibt, wenn eine ihrer Ehefrauen sich dem Flughafen nähert. Anderswo sind elektronische Fußfesseln – für Gefangene im Freigang – beliebt.
Letzten Endes braucht aber auch die totale Überwachung Staatsdiener, die handfest eingreifen, also Polizisten, die den Überwachten oder Verdächtigen dingfest machen, d.h. festnehmen.
Und das ist die Schwachstelle aller Systeme. So wurden wir z.B. mit unserem manilagrünen Audi nie bei Verkehrskontrollen angehalten – zu spießig. Umgekehrt werden türkische und arabische Autofahrer besonders häufig von der Polizei gestoppt.
Der jüdische Schriftsteller und spätere Redakteur des Hessischen Rundfunks, Valentin Senger überlebte mit seiner Familie, weil ein Polizist in einer Frankfurter Meldestelle den Eintrag „mosaischer Glaube“ einfach löschte. Wer das heute angibt, der muß nur noch „Kultussteuern“ zahlen.
Am Souveränsten war unser Ortspolizist in Brundorf: Wenn er einen Bauernsohn zur Musterung für die Bundeswehr melden mußte, ging er erst zu dessen Vater. Wenn der sagte, er bräuchte seinen Sohn unbedingt auf dem Hof, dann meldete er ihn nicht. Wenn der Abgabetermin für das Dieselrückzahlungsformular nahte, ging er zu den Bauern und füllte sie mit ihnen aus. Er besuchte regelmäßig meinen Vater, der für ihn einen Schnaps bereithielt, irgendwann zückte er sein Notizbuch und sagte: „Schorse, kann ich Dir mal mein neues Gedicht vorlesen?! Einmal druckste er herum: „Was Unangenehmes diesmal, jemand hat dich angezeigt, weil Du Dein Haus schwarz gebaut hast.“ Mit Hilfe des Dorfpolizisten kam mein Vater aber gimpflich davon.
Drei Mal bin ich betrunken gefahren und angehalten worden, einmal hatte ich sogar einen kleinen Unfall verursacht, ein andern Mal eine halbe Fahrerflucht versucht, aber jedesmal taten die Polizisten so, als wäre quasi alles in Ordnung.
Im Vogelsberg lebend beschlossen wir eines Nachts leicht angetrunken nach Frankfurt zu fahren. In Wächtersbach hielt uns ein Polizist an, weil ein Scheinwerferlicht nur halb brannte. „Wo wollt ihr denn hin?“ fragte er. Als wir murmelten: „nach Frankfurt“, sagte er: „Nix da, ihr habt getrunken und das Licht ist kaputt. Umdrehen, ihr fahrt jetzt nach Hause.“
Mein bayrischer Halbbruder lud mich einmal auf ein Dorffest ein, wo ausschließlich „Maß Bier“ ausgeschenkt wurde (in 1, 069 Litergläsern). Ich sagte, dass ich noch fahren müsse, er meinte daraufhin: „Bis zu drei Maß darfst Du hier trinken, da sagen die Polizisten nichts.“
Auch im bayrischen Bischofsheim wurde mir in einer Kneipe gesagt: „Keine Gefahr, die Polizei hält Dich nicht an, nur wenn oben im Walddorf die ‚Bösen Onkelz‘ spielen, werden ausnahmslos alle kontrolliert.“
Zur Zeit der RAF-Fahndung lebte ich in einer Landkommune in der Wesermarsch, die mehrmals von der „politischen Polizei“ (heute BKA) durchsucht wurde. In der Scheune stieß die Truppe auf mehrere Marihuanapflanzen. Lachend meinten sie: „Das wäre ja was für unsere Kollegen von der Rauschgiftfahndung.“ Sie verrieten es denen aber nicht. Von einem erfuhr ich später, dass sie diese Kollegen für dumm hielten.
In der Wannseekommune „dealte“ einer von uns mit Haschisch. Mehrmals wurden wir von Polizisten heimgesucht, sie fanden aber nie etwas. Er versteckte das Zeug immer in einer kaputten Straßenlampe, aber sie wußten sowieso nicht, was sie suchten – irgendetwas Belastendes. Irgendwann kam einer der Polizisten privat vorbei – er setzte sich zu uns und kiffte mit, er sagte nicht viel, fühlte sich vielleicht auch etwas unwohl, kam aber immer mal wieder zum Kiffen vorbei.
Am Seltsamsten war ein Grenzpolizist am Grenzübergang Helmstedt/Marienborn. Gewöhnlich fragten die Grepos, ob man Waffen oder Funkgeräte dabei hatte, er fragte jedoch den Fahrer: „Was ist denn das, es riecht so komisch?“ Wir antworteten: „Haschisch“. Und wie wirkt das? Wollte er wissen. Es entspann sich daraufhin ein längeres Informationsgespräch. Als alles gesagt war, schenkten wir ihm ein Stück Haschisch. Irgendwann, als wir wieder mal nach Westberlin zurück fuhren, hatte „unser“ Grepo erneut Dienst. Er grüßte uns wie alte Bekannte – und wir gaben ihm erneut ein Stück. Dann fragte er, was da auf dem Aschenbecher läge. Eine Purpfeife für Haschisch antworteten wir und reichten sie ihm. Er besah sie sich so genau, dass wir sie ihm schließlich schenkten. Als ich das einer DDR-Dissidentin erzählte, war sie entsetzt, wie unmoralisch wir uns gegenüber der DDR-Staatsgewalt verhalten hatten. Dabei waren wir hocherfreut gewesen, dass einer von den „Organen“ sich so menschlich verhalten hatte.
Und dann gibt es noch eine Autobiographie von einem Weddinger Polizisten, der Personenschützer von Willy Brandt wurde. Jedesmal, wenn man „Cognac-Willy“ auf einer Versammlung von SPD-Genossen abfüllte, ging es nach einiger Zeit in den Saal zu ihm und sagte laut: „Herr Brandt, der Wagen ist vorgefahren.“ Obwohl der die ganze Zeit vor der Tür stand. Aber Willy Brandt verstand, sagte „Letzte Runde“ und verschwand mit ihm.
Das mögen alles Kleinigkeiten sein, aber sie sind wichtig, um den immer unmenschlicheren Systemen zu entkommen.
.

Bäuerin mit Sense auf Fahrrad
.
Polizist werden
Man kennt den uralten Witz: Ein Polizei-Bewerber wird mit der Begründung abgewiesen, dass er „zu klein für den Polizeidienst“ sei, worauf er vorschlägt, er könne doch „Kleinkriminelle bekämpfen“.
In Berlin wurde 2017 tatsächlich eine junge Frau, die sich für den Polizeidienst beworben hatte, mit der Begründung abgelehnt, sie sei mit ihren 1 Meter 54 zu klein. Sie legte Widerspruch gegen diese Entscheidung ein, der jedoch vom Verwaltungsericht abgelehnt wurde.
Werden ansonsten alle, die groß, stark und staatsdumm genug sind, als Polizeibeamte akzeptiert? Mitnichten! In Berlin hatte ein 40jähriger Bewerber vor weniger als einem Jahr Haschisch geraucht, bei der obligaten Blutuntersuchung kam das heraus – und er wurde abgelehnt, mit der Begründung: Der Wirkstoff THC, der noch in seinem Körper ist, mache ihn zum Autofahren ungeeignet, das zähle aber zu den wesentlichen Aufgaben eines Polizisten. Der Bewerber klagte dagegen, wurde jedoch vom Verwaltungsgericht abgewiesen.
Hier besteht der Witz darin, dass die die es geschafft haben, Polizisten zu werden, in der Regel wie blöd kiffen – sagen „Kenner der Scene“.
Auf dem „juraforum.de“ erzählte ein Bewerber, dass er beim persönlichen Gespräch erwähnt hatte, als Jugendlicher zwei Mal – wegen Beleidigung und Körperverletzung – angezeigt worden zu sein, letzteres sei wegen Geringfügigkeit eingestellt worden. Man bescheinigte ihm, für den Polizeidienst geeignet zu sein. Nachdem er seine schriftliche Bewerbung eingereicht hatte, wies man ihn jedoch ab, mit der Begründung, dass er die zwei Anzeigen darin verschwiegen habe. „Ich finde dies eine Frechheit,“ schrieb er.
Die Tochter einer Lichtenberger Jugendamtsmitarbeiterin wurde bei der Polizei nicht eingestellt, weil sie trotz guter intellektueller und körperlicher Fähigkeiten „zu sehr berlinerte“. Haste Töne? Mutter und Tochter waren sich sicher, dass die Ablehnung einen anderen Grund hatte, nämlich: weil die Mutter in der Partei „Die Linke“ aktiv war.
Ein anderer Bewerber wurde zunächst „unter Vorbehalt“ akzeptiert und sollte beim „Zentralen Objektschutz“ (ZOS) anfangen. Vier Tage vorher bekam er jedoch per mail eine Absage: Der Polizeiarzt hatte seine Tätowierungen auf dem Unterarm begutachtet, man fand sie zu „sexistisch“, das bezog sich auf die kleinen Brüste der eintätowierten Jagdgöttin Diana. Auf sein Angebot hin, die Brüste überarbeiten zu lassen, wiederholte die Polizei brieflich ihre Ablehnung, wobei es nun nicht mehr um die Brüste ging, sondern um die ganze Tätowierung: „Die Motive beeinträchtigen auf Grund ihrer Größe die Repräsentationsziele der Polizei Berlin und erwecken keinen achtungs- und vertrauenswürdigen Eindruck,“ hieß es.
Ähnliches passierte einer Bewerberin für den gehobenen Polizeivollzugsdienst: Sie wurde abgelehnt, weil sie auf einem Unterarm das auf Französisch eintätowierte Zitat „Bitte bezwinge mich“ trug. Als sie gerichtlich gegen diese Entscheidung vorging, entschied das Verwaltungsgericht Darmstadt: Ein eintätowiertes Zitat aus einem Roman auf dem Unterarm ist Grund genug, dass die Bundespolizei Bewerber ablehnen kann. Eine Polizistin darf „keine Ansätze für Provokationen bieten“, in anderen Worten: Sie soll die Gesetzesbrecher bezwingen und nicht diese auffordern, sie zu bezwingen. Irgendwie logisch.
.

Fünf Rentnerinnen diskutieren auf einem Karussell (von Dmitry Vrubel)
.

Frauenbrigade bei der Ernte
.

Eine Köchin bringt Erntearbeitern das Essen aufs Feld
.

Eine Traktoristin macht Pause (1981)
.
„Kellnerlächeln“
Die Wirtschaftssubjekte (Produzenten) sind Objekte/Dinge, sind die „Ware Arbeitskraft“, „Humankapital“, es gibt für sie einen „Arbeitsmarkt“. Es ist ferner die Rede von der „Verdinglichung des gesamten gesellschaftlichen Lebens“ (Cornelius Castoriadis) in der Ersten Welt bzw. von dem „kolonisierten Ding“ (Frantz Fanon), dem Algerier in der „Dritten Welt“.
Die Verdinglichung der Lebensverhältnisse, das bedeutet laut Marx, dass wir ein sachliches Verhältnis zu Personen und ein persönliches zu Sachen entwickeln. Hier einige Werbesprüche aus der Spätphase des Kapitalismus, in der von allem zu viel da ist:
Das Messerfachgeschäft Deutschmann: „Have a Knife Day“
Der Reifenservice Hankoog: „Sei eins mit Deinem Reifen und die Straße wird eins mit Dir.“
Das Suzuki Motorrad: „Warum sollte ich laufen? Ich habe doch zwei gesunde Reifen!“
Das Motorrad von BMW: „Motorradfahrer erkennen Insekten am Geschmack“
Die Supermarktkette Lidl: „Wir sind wieder Frische-Sieger!“
Die Programmzeitschrift tv14: „Schneller Besser Fernsehen“
Wie war das aber am Anfang – als alles in Trümmer lag und alles rar war? Nach 1945 listete der Dichter Günter Eich, als er sich noch in englischer Kriegsgefangenschaft befand, die ihm verbliebenen „letzten Dinge“ in einem kurzen Gedicht mit dem Titel „Inventur“ auf: Mütze, Mantel, Rasierzeug, Brotbeutel, Socken, Handtuch, Zwirn…Es war nicht mehr viel übrig geblieben.
In Erwin Strittmatters Heimatort Bohsdorf in der Niederlausitz sah die „Stunde Null“ 1945 so aus, dass die Dagebliebenen und bis dahin Zurückgekehrten, die wenigen Überlebenden, sich auf dem Dorfplatz „Unter Eechen“ trafen, alle noch brauchbaren Dinge aus den zerstörten Häusern zusammentrugen – und sie gerecht unter sich aufteilten. Die Idee dazu hatte der alte Grubenwächter Nickel. Eine Frau, die diesen kurzen aber „vollkommenen Kommunismus“ nicht miterlebt hatte, sah später eine andere in ihrer Samtjacke herumlaufen: „Eine Frechheit, denkt sie. Daheim beschwichtigt sie später ihr Mann, er will nicht, dass seine Frau gegen die edle Stunde aufmuckt.“
Aus Strittmatters Romantrilogie „Der Laden“ wissen wir ferner, was für persönlichkeitsdeformierende Folgen der Handel hat: So durfte Strittmatter z.B. als Kind nie etwas Kritisches über jemanden im Dorf sagen: „Alles unsere Kundschaft. Ich sehe, was ich sehe, aber Mutters Laden macht mich zum Parteigänger, ich soll nur sehen, was dem Geschäft nicht schadet. Diese Nötigung verfolgt mich mein Leben lang: Andere verlangen von mir, daß ich sehe, was sie wünschen.“ Immer hieß es: „Der Loaden, der Loaden“ – geht vor. Selbst der jähzornige Vater durfte seine Beschimpfungen nie „bis zur Feindschaft ausweiten. Der Laden! Der Laden!“ Immer wieder mußte Strittmatter dort die Mutter hinterm Tresen vertreten. Die Eltern standen mit der Bäckerei und dem Laden in Konkurrenz zum Nachbarn – dem Mittelmüller. Eines Tages beschließt dieser, sein Brot den Kunden frei Haus zu liefern: „Siehe, der Service, den sich der Mittelmüller ausdachte, hat Erfolg.“ Strittmatter und sein Großvater begannen daraufhin ebenfalls, das Brot auszuliefern: „Wir gewinnen unsere Brotkunden auf den drei Vorwerken zurück und wir gaunern der Konkurrenz einige Kunden ab.“ Strittmatter lernte Mundharmonika, woraufhin seine Mutter ihn prompt im Ladengeschäft als „Kundenservice“ einbaute: „Jeder Schichtler, der jahrsüber sein Bier im Laden getrunken hat, erhält an seinem Geburtstag ein Sonderkonzert“. Als das Anschreiben-Lassen überhand nimmt, muß er für seine Mutter ein Schild für den Laden malen: „Borgen tun wir morgen“. „Meine ausgezeichnete naive Mutter bedachte [jedoch] nicht, daß jemand, der ein Theaterplakat liest noch lange nicht ins Theater geht.“ Die Jungs des Mittelmüllers kauften mit von ihrem Vater geklauten Geld im Laden von Strittmatters Mutter Süßigkeiten und Getränke – und veranstalteten bei ihr auf dem Hof ein Fest: „Meine Mutter steht hinter der gerafften Gardine, sieht unserem Treiben zu und ist nicht unglücklich über das schöne Sonntagsgeschäft. Ich muß an das denken, was Großtante Maika gesagt hat: Wer Geschäfte macht, den hat der Deibel schont am Ursche.“
Dennoch gilt auch weiterhin: „Meine Schwester und ich knicksen und dienern, und wir grüßen jedermann im Dorfe, und tun wir es nicht, werden wir getadelt. Wir grüßen, grüßen: Der Loaden, der Loaden!“ So machen ihn seine Eltern „zum Mitsklaven ihres Ladens“ – und noch zu den Genossen später war er so „freundlich, auch wenn sie mich erniedrigten“ – dass seine Geliebte ihn einen „niederschlesischen Neurotiker“ schimpfte.
An anderer Stelle spricht Strittmatter von seinem „Kellnerlächeln“, dass er sich in jungen Jahren angeeignet hatte oder aneignen mußte – und das er nicht wieder los wird, „obwohl wir unsere Gesellschaft doch revolutionieren,“ schrieb er 1972. Die später in der DDR geborenen Kellnerinnen und ihr schlechtgelauntes Nichtlächeln konnte der Dramatiker Heiner Müller deswegen als eine „echte Errungenschaft des Sozialismus“ bezeichnen, aber seit 1990 wird ihnen das verlogene „Kellnerlächeln“ wieder übergeholfen. Denn es gilt nun das Gebot: Verkaufen, verkaufen, verkaufen.
Double-Bind: In der Pankower Rathauspassage trat eine Frau aus dem „Douglas“-Laden und sagte zu einem Mann „Nein heißt Nein“, gleichzeitig verströmte sie das Armani-Parfüm „Si.
.

Junge Kasachin mit Leninband lehnt Koran ab
.

Drei Tadschikische Mädchen mit Grenzsoldaten (1977)
.

Moskauer Passantinnen (1996)
.

Drei Frauen aus Moskau
.

Drei Frauen aus sowjetischer Zeit
.
Animismus
Die Kamtschatkabären gehören zu den größten Braunbären, sie können aufgerichtet bis zu drei Meter groß werden. 2018 hatte eine junge französische Ethnologin, Nastassja Martin, in einem abgelegenen Teil der Halbinsel Kamtschatka eine heftige Begegnung mit einem Kamtschatkabären: Sie hatte eine Studie über das in Alaska lebende kleine Volk der Gwich‘in und seinen Widerstand gegen die westliche Zivilisation verfaßt und war dann auf Kamtschatka auf eine kleine Gruppe von Ewenen gestoßen, die nach dem Zerfall ihrer Sowchose der Zivilisation den Rücken gekehrt hatten und (wieder) in die Wälder gegangen waren, wo sie als nomadische Jäger, Sammler und Holzschnitzer lebten. Sie machten die Forscherin mit dem (schamanistischen) Bärenkult bekannt. Nastassja Martin interessierte sich so sehr dafür, dass sie von ihnen bald „matuscha“ (Bärin) genannt wurde. Nachdem sie bei einer Bergwanderung ein blutiges Zusammentreffen mit einem Bären gehabt und es überlebt hatte, wurde sie von ihnen „miedka“ (eine vom Bären Gezeichnete) genannt: „Es bedeutet, dass deine Träume gleichzeitig auch seine sind,“ erklärten sie ihr.
Nach ihrer „Begegnung“ mit dem Bären war sie mit einem Hubschrauber zur nächstgelegenen Unfallstation geflogen worden, wo man sie notdürftig zusammennähte, dann wurde sie im Krankenhaus von Petropawlowsk operiert und schließlich in einem Pariser Krankenhaus noch einmal und noch einmal und noch einmal, wobei sie zeitweise ein begehrtes Anschauungsobjekt für angehende Chirurgen wurde. „Die Frau mit dem Bären,“ hatten schon die Krankenschwestern in Petropawlowsk sie genannt.
Auch nach den ganzen chirurgischen Eingriffen blieb ihr Gesicht zerstört. Die 29jährige war nicht mehr die selbe; sie zog sich von Freunden, Bekannten und Kollegen zurück. „Ich habe das Bedürfnis, zu denen zurückzukehren, die sich mit Bärenproblemen auskennen, die in ihren Träumen noch mit ihnen reden; die wissen, dass nichts zufällig geschieht und dass Lebensbahnen sich immer aus ganz bestimmten Gründen kreuzen.“ Von einem solchen Gedanken (dass sich hinter jedem Zufall ein tieferer Sinn verbirgt) hatte sich in den Zwanzigerjahren auch schon der Arzt Georg Groddeck bei der Psychoanalyse seiner Patienten leiten lassen.
Auf dem Flug von Petropawlowsk nach Paris wurde Nastassja Martin von einem Passagier auf ihre Verletzungen angesprochen. Sie habe mit einem Bären gekämpft, erwiderte sie nicht unstolz. Sie hatte den Bären ebenfalls verletzt, mit einem Eispickel. Sie fragte sich, ob sie nun „Halb Frau, halb Bär“ sei. Der Anthropologe Rane Willerslev erfuhr bei den sibirischen Jukagiren, dass eine solche Verwandlung bei den Jägern als sehr gefährlich gilt, weil man dadurch das Verhaftetsein mit der Identität der eigenen Spezies verlieren und eine unbemerkte Metamorphose durchlaufen könne. Darüber denkt die Autorin in ihrem Buch „An das Wilde glauben“ (2021) nach. Sie weiß, sie braucht ein „Gleichgewicht, das ein Zusammenleben der Elemente aus divergierenden Welten“ erlaubt, dass sie ihre aufgerissene „Insularität“ wiederherstellen muss. „Heute Morgen sage ich mir, ich müsse vor allem mit dem Wollen aufhören.“
Ein großer Teil ihrer Arbeit über den „Animismus“ besteht aus ihrer Krankengeschichte. Der Lehrer von Nastassja Martin, Philippe Descola, der den „Animismus“ gewissermaßen rehabilitierte, hatte gemeint, „Die Bären machen uns ein Geschenk,“ dieser Satz enthält für die Autorin den Gedanken, „dass ein Dialog mit den Tieren möglich ist.“ Ihre Romantik zielt auf eine „Ökologie ohne Natur“, wie der US-Philosoph Timothy Morton das nannte – d.h. auf eine Auflösung der Objekt-Subjekt-Trennung. Das ist nicht leicht zu verbinden mit den Rekonstruktionen ihres Selbst nach ihrer „Verwüstung“. Jeden Abend versucht sie sich zu erinnern, was in den Wochen und Stunden vor dem Kampf mit dem Bären war, „die dem Kipppunkt meines Lebens vorausgegangen sind“.
Im Pariser Krankenhaus soll sie ihre Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen. Aber sie denkt eher daran, dass sie all die „medizinischen Prüfungen durchmacht, weil es ein ‚Wir‘ gegeben hat“. Man gibt ihr Morphium. Die Operationen verlängern die Liste ihrer „in der Schlacht verlorenen Teile: Etwas Haut, meine Haare, drei Zähne, ein Stück Knochen und jetzt auch noch ein Lymphknoten“. Wie soll sie sich da vervollständigen?
Bei ihrer Rückkehr nach Kamtschatka fragen ihre Freunde im Wald sie als erstes: „Hast du dem Bären vergeben?“ Ja, das hat sie. „Er wollte dich nicht töten, er wollte dich zeichnen.“ Sie erinnert sich an ein langes Gespräch in der Jurte: „wir redeten über die Geister der Tiere, über die, die uns auserwählen, noch bevor wir ihnen begegnen.“
.

Pionierleiterin erzählt Lenin-Geschichten
.
Rauschgift
Mit den Beatniks, Hippies und den rebellierenden Studenten verbreiteten sich Cannabis und LSD sowie Mescalin und Psilocybin („Magic Mushrooms“). „Turn on, tune in, drope out!“ und hierzulande „High sein, frei sein, Terror muß dabei sein!“ hießen die Parolen. Der Psychologieprofessor Timothy Leary veranstaltete an der Harvard-Universität öffentliche LSD-Sitzungen zur „Bewußtseinserweiterung“. 1968 bat der „New York Times“-Herausgeber Arthur Sulzberger den Beat-Dichter Allen Ginsberg um einen freimütigen Text für die Seite 1. Ginsberg schrieb, dass in den Hippie-Quartieren plötzlich die Haschisch- und LSD-Verkäufer durch Heroin-Dealer ersetzt wurden. Und dies sei auf Anweisung des Staates, durch FBI und CIA, geschehen. Sulzberger war über Ginsbergs Artikel so entsetzt, dass er entgegen aller Gepflogenheiten, dazu auf der selben Seite einen Kommentar abgab. In diesem meinte er, die Regierung gegen Ginsbergs infame Unterstellung in Schutz nehmen zu müssen. Zehn Jahre später gestand er jedoch – auf der selben Seite – ein, dass Ginsburg wohl doch Recht gehabt hatte.
Seit 1953 lief in der CIA bereits ein Programm namens „MK-Ultra“, in dem es um „Gehirnwäsche“ mittels Psychodrogen (vor allem LSD) ging, wobei man davon ausging, dass die Sowjetunion in der Hinsicht bereits einen Vorsprung hatte. Als Beweis galten u.a. die im Koreakrieg gefangen genommenen US-Piloten, die im nordkoreanischen Fernsehen freimütig über die Greueltaten amerikanische Kriegsführung berichtet hatten: Das konnte nur einer Gehirnwäsche geschuldet sein.
Bei den LSD-Experimenten der CIA, in denen auch Prostituierte zum Einsatz kamen, waren die Probanden ahnungslose Krankenhauspatienten und Gefängnisinsassen, die z.T. schwere psychische Schäden davontrugen. Es waren „verbrecherische Menschenversuche“, auf Wikipedia heißt es: „Dabei wurden die wissenschaftlichen Untersuchungen von Foltermethoden der Nationalsozialisten weiterentwickelt“. Bald beteiligten sich auch etliche Ärzte und Psychiater in Kanada und England an diesem Programm, sie bekamen Geld von der CIA dafür. „Die Experimente liefen an 44 Universitäten, 12 Krankenhäusern, 3 Gefängnissen und 15 nicht näher bezeichneten ‚Forschungseinrichtungen‘.“ Der US-Autor Stephen Kinzer veröffentlichte 2019 die Geschichte von MK-Ultra in seinem Buch „Poisoner in Chief: Sidney Gottlieb and the CIA Search for Mind Control“. Der Leiter von MK-Ultra, Gottlieb, erklärte später, es ging darum, das Bewusstsein ihrer Probanden zu löschen und ihnen ein neues zu verpassen.
Das MK-Ultra-Programm bestand noch einige Jahre weiter als US-Präsident Nixon 1972 einen „War on Drugs“ ausrief (davor gab es den „War on Poverty“ von Präsident Johnson und danach den „War on Terror“ von Präsident Bush). Seit 2014 ist jedoch Cannabis (der Anbau und Konsum) in vielen US-Bundesstaaten legal und auch mit LSD und Psilocybin darf in Forschungsinstituten wieder experimentiert werden – nicht nur in den USA auch in Europa (in der Basler Uniklinik und an der Charité z.B.).
Gerade erschien ein Erfahrungsbericht der ehemaligen Spiegelreporterin Anuschka Roshani, die, in der Schweiz lebend, an einer „LSD-Session“ (Sechs 16stündige Sitzungen mit unterschiedlichen Dosierungen) in Basel teilnahm: „Gleissen. Wie mich LSD fürs Leben kurierte“. Gleichzeitig lief auf 3Sat eine Dokumentation über Psilocybin-Experimente an US-Unikliniken: „Aware“ (die noch bis zum 30.10 in der Mediathek zu sehen ist). Den Forschern geht es dabei vornehmlich um die Frage: Was ist „Bewußtsein“? Dazu äußern sich im Film auch eine australische Botanikerin, eine Schamanin aus Chiapas und ein Buddhist in Nepal. Für Anuschka Roshani bewirkte das LSD insofern eine Erweiterung des „Bewußtseins“ als sie auf ihrem „Trip“ die Bäume atmen sah – und „akzeptieren mußte, nichts auf der Welt, kein Busch, kein Strauch, keine Hummel ist seelenlos“. Ich sehe das auch so, nicht nur, weil ich bestimmt schon 50 mal einen LSD-Trip genommen habe, sondern weil ich seit 2001 Biologie studiere. Beides geht gegen meinen Anthropozentrismus. Wie anderes sieht dagegen der Pflanzenökologe Hansjörg Küster in seinem 2022 erschienenen Buch „Flora – Die ganze Welt der Pflanzen“, in dem er zehn Mal postuliert: „Die Pflanze hat keinen Willen“.
Bei den amerikanischen und den Basler Psychodrogenforschern (und wohl auch bei den in der Charité) geht das Wollen von mir aus gesehen in die entgegengesetzte Richtung: Sie wurden inzwischen am US-Pharma-Start-Up „MindMed“ beteiligt. Dieses börsennotierte New Yorker Unternehmen ist „bei der Zulassung von LSD als Medikament [gegen bald alles?] weltweit in der ‚Pole Position‘.“ Der Markt boomt. Schon entstehen in den USA laut Roshani überall „Center for the Neuroscience of Psychodelics“ und „Center for Psychedelic and Consciousness Research“. Es lockt ein „Milliardengeschäft“, denn es gibt viele Cannabis-Dealer, die sich mit der Droge – erst illegal und dann legal – „dumm und dämlich“ verdient haben und nun bereit sind, „unglaubliche Summen zu investieren“ – u.a. in „MindMed“. Dazu gehört wohl bald auch der Multimilliardär Elon Musk, denn er will das „desolate US-Gesundheitssystem mittels psychedelischer Drogen heilen“. Für mich ist das alles eine Neuauflage des MK-Ultra-Programms – mit privatem Kapital diesmal.
Desungeachtet meinten nicht wenige, die in den USA an Psilocybin-Experimenten teilgenommen hatten (noch nach zehn Jahren) und auch Anuschka Roshani kurz nach ihrer LSD-“Reise“, dass es eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Erfahrung in ihrem Leben war – mit den Worten des Surrealisten André Breton: „Das Ereignis, von dem jeder das Recht hat, eine Offenbarung des Sinns seines Lebens zu erwarten, dieses Ereignis wird nicht durch Arbeit hervorgerufen.“
.

Moskauerin posiert mit Gorki-Statue (von Dmitry Vrubel)
.
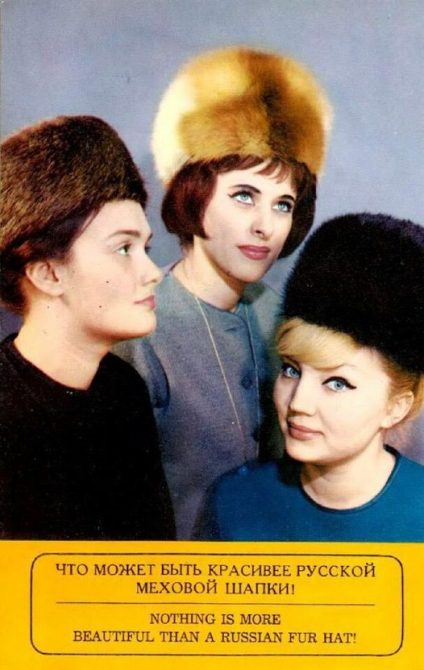
Drei Frauen werben für Pelzmützen
.

Drei Frauen auf einem Feldweg (Malewitsch)
.
Ukrainischer Ausverkauf
In der Ukraine fielen die die „Chicago Boys“, die wirtschaftswissenschaftliche Speerspitze des Neoliberalismus, als erstes nach 1991 ein. Schon bald nach ihrem Beratungseinsatz war die Ukraine laut Spiegel „das korrupteste Land Europas“ – und die ausländischen Investoren standen Schlange.
Mit dem Erfolg, dass Bauern, die in der EU 100 Hektar besaßen, in der Ukraine nun 2-3000 Hektar bewirtschaften. Allein 40 große ukrainische Agrarbetriebe sind in deutscher Hand. Ein österreichischer Bauer übernahm eine aufgelöste Kolchose und mästet dort 4500 Schweine. Einer der größten Schweinebetriebe ist in dänischer Hand.
Investoren aus Russland beteiligten sich direkt an ukrainischen Agrarbetrieben. China bewirtschaftet 100.000 Hektar Ackerland in der ostukrainischen Schwarzerderegion, das auf drei Millionen Hektar vergrößert werden soll. Neben dem Futtermittelanbau sollen darauf vor allem Schweine für den chinesischen Markt gezüchtet werden. Die chinesische Agroholding China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO) ist einer der größten Arbeitgeber in der ukrainischen Landwirtschaft und einer der größten Investoren in die landwirtschaftliche Infrastruktur (über 200 Milliarden Dollar seit 2008).
US-Investoren stiegen bisher, ähnlich wie die russischen in ukrainische Agrarbetriebe ein. Denn „selbst Land kaufen dürfen die ausländischen Unternehmen in der Ukraine nämlich nicht, schreibt „Die Zeit“, „doch die Investoren finden andere Wege. Sie können Land pachten, maximal 49 Jahre lang, zu günstigen Preisen. Sie nehmen Einfluss, indem sie Kredite an ukrainische Unternehmen vergeben, und sie beteiligen sich auch direkt an den Betrieben, zum Beispiel indem sie Aktien kaufen. Einige der ukrainischen Holdings sind an westlichen Börsen notiert, so gehören sie zumindest teilweise Anlegern aus dem Westen.“
Und diese Unternehmen weiten ihren Einfluss auf den ukrainischen Agrarsektor immer weiter aus. Nach der mit US-Hilfe und Gewalt gelungenen Absetzung von Präsident Viktor Janukowitsch 2014, der das „Assoziationsabkommen“ der Ukraine mit der EU abgelehnt hatte, das u.a. den Anbau von „Genprodukten“ vorsah, wurde eine Harvard-Businessfrau, Natalie Jaresko, Finanzministerin, die seit den 1990er Jahren in der Ukraine einen von den USA aufgelegten privaten Aktienfonds zur Förderung von Investitionen verwaltete und Geschäftsführerin von ‘Horizon Capital’ war, einer Investmentfirma in Berlin mit 11 Milliarden Dollar, die westliche Investitionen im Land betreut.
Die riesigen Schulden, die die Ukraine seit ihrer gelenkten „Orangenen Revolution“ 2004 beim IWF und der Weltbank hatte, wurden vom IWF genutzt, um den Tausch von „Natur gegen Schulden“ zu erzwingen. Man nennt das „Schuldenfallen-Diplomatie“. Auf diese Weise erwarben die drei US-Konzerne Cargill, Dupont und Monsanto 17 Millionen Hektar ukrainisches Ackerland (so viel wie ganz Italien hat). Ihre Hauptaktionäre sind die US-Investmentfirmen Vanguard, BlackRock und Blackstone. BlackRock verfügt über 10 Milliarden Dollar, Vanguard über 6 Milliarden und Blackstone über 881 Milliarden – für gewinnbringende Investitionen. Gemeinsam werden diese sechs „global player“ den Anbau von genveränderten und patentierten Nutzpflanzen durchsetzen – auf 28 Prozent des ukrainischen Landes, das nun amerikanisch ist.
„Cargill, Vertreiber von Pestiziden, Saatgut und Düngemitteln, hat inzwischen in den Bau von Getreidespeichern, Sonnenblumenöl-Fabriken und Tiernahrung investiert, daneben erwarb das Unternehmen einen Anteil von 25 Prozent plus eine Aktie an einem Getreideterminal in der Hafenstadt Noworossijsk. Außerdem verfügt es über Anteile an ‘UkrLandFarming’, dem größten Agrobusiness des Landes. Die Firma Monsanto hat die Anzahl ihres Mitarbeiterstabs in der Ukraine verdoppelt. Im März 2014, nur Wochen nach der Absetzung von Janukowitsch, investierte Monsanto 140 Millionen Dollar in den Bau einer Saatgutfabrik. Auch DuPont kündigte den Bau einer Saatgutfabrik in der Ukraine an,“ schrieb Frédéric Mousseau, Strategiedirektor des kalifornischen Oakland Instituts, 2015 auf „oaklandinstitute.org“. Er beschuldigte die USA und die Europäische Union, gemeinsam die Übernahme der ukrainischen Landwirtschaft zu betreiben. „Die Bestrebungen zeugten sowohl von der direkten Verstrickung des Westens in den Ukraine-Konflikt als auch von Verantwortungslosigkeit gegenüber den ukrainischen Bauern und europäischen Verbrauchern.“ Für Mousseau sind alle Messen in der Ukraine bereits gesungen: Die Agrarkonzerne haben ihre Investitionen derart erhöht, dass es einer „Übernahme der ukrainischen Landwirtschaft durch westliche Firmen“ gleichkomme.
.

Leningrader Standesbeamtin
.

Geschmückte Bräute im Warteraum des Standesamtes von Tallin
.
Verschwörungen
Der Begründer der Nationalökonomie, Adam Smith, behauptete 1781: „Wenn drei Geschäftsleute aus der selben Branche zusammenkommen, handelt es sich immer um eine Verschwörung gegen die Gesellschaft.“ Während der Corona-Pandemie 2020/21 wurden weitere „Verschwörungstheoretiker“ bekannt. Gemeint waren damit „Impfgegner“, „Querdenker“, „Coronaleugner“ „Aluhüte“, die allesamt als mehr oder weniger „Rechte“ galten.
Neulich las ich auf einem Parkscheinautomaten: „Verhindern sie Infektionen. Nutzen Sie unsere Parkautomaten-App.“ Man soll also wegen Corona bargeldlos zahlen. Da schon seit einigen Jahren von Politikern und Finanzmanagern gefordert wird, das Bargeld überhaupt abzuschaffen, ohne dass sie überzeugende Gründe dafür anführten, verschafft ihnen Corona nun ein scheinbar stichhaltiges Argument.
Für bargeldlose Zahlungen braucht man neben einer EC- (Electronic Cash-) Karte für das Privatkonto, eine Kreditkarte (von Visa z.B. ) und ein Smartphone (von Nokia z.B.), die EC-Karte will man demnächst allerdings auch noch abschaffen. Nicht nur die Schwarzgeldempfänger, Straßenkünstler und Bettler („Bargeld lacht“) werden alt aussehen.
Auf einem Kongress der „Neuen Gesellschaft für Psychologie“ zum Thema „Corona“ hielt u.a. der verdiente Genosse Michael Schneider einen Vortrag. Darin fragte er sich: „Welch neue Machtkonstellation hat es ermöglicht, dass die technokratische Allmachts- und Weltbeherrschungsphantasie, nämlich sieben Milliarden Menschen durchzuimpfen und über digitale Impfpässe zu kontrollieren, die das Einfallstor für die vollständige Erfassung der Identität jedes Erdenbürgers sein werden, als vermeintliches und noch dazu einziges Heilmittel gegen die „Corona-Pandemie“ den Regierungen von 178 Mitgliedstaaten der WHO aufgenötigt werden konnte?“
Zur Beantwortung berief er sich auf den laut Wikipedia in St-Petersburg lebenden „Kreml-treuen Verbreiter von Verschwörungsideologien“ Thomas Röper. Dieser habe, so Michael Schneider, „in seiner akribisch genauen Recherche ‚Inside Corona‘ das engmaschige Netz der sich über Jahrzehnte aufbauenden globalen Allianz zwischen supranationalen Organisationen wie der UN, der WHO, der Weltbank mit den mächtigsten US-amerikanischen Stiftungen, der GAVI- Impfallianz oder CEPI, deren Fäden im World Economic Forum (WEF) zusammenlaufen und die von der Bill und Melinda Gates- Stiftung unterstützt werden, nachgezeichnet.“
Michael Schneider hat das überzeugt: „Die Indizienkette, dass die genannten supranationalen Institutionen längst von den Lobbygruppen und ungeheuer reichen und einflußreichen privaten Stiftungen der US-amerikanischen Multi-Milliardärs-Riege und des Silicon Valley, d.h. von Big Data, Big Tech und Big Pharma gekapert worden sind, ist wahrlich erdrückend.“
Daneben habe Kees van der Pijl, (bis 2019 Professor für Internationale Beziehungen an der University of Sussex) in seiner Studie „Die belagerte Welt“ detailliert beschrieben, „wie sich seit 9/11 ein neuer Machtblock innerhalb der transnational herrschenden Klasse gebildet und durchgesetzt hat. Dieser neue Machtblock von Geheimdiensten, IT-Giganten und den wichtigsten Medien-Konglomeraten, der sich in den USA um die Demokratische Partei gruppiert, verfolgt eine globale Agenda. Das heißt: Wir haben es mit einer biopolitischen Machtergreifung zu tun, die auf der Ebene der Global Governance beginnt und tief in die Souveränität des Individuums eingreift.“
Das Programm dieser Horrortruppe, das sie im Windschatten der „Pandemie“ umsetzt, hat laut Schneider „nichts mit Gesundheit zu tun“, wohl aber mit Macht – Erhalt, Festigung und Ausbau.
Seine Äußerungen ähneln den Kritiken an den Coronabekämpfungs-Maßnahmen im Internet – von feministischen Historikern, Virologen, Medizinern und Juristen. Ihre Argumentationen werden weit verbreitet, auch als Bücher. Die Autoren sind desungeachtet eine Minderheit in der Kunst der Meinungsmache und werden den „Verschwörungstheoretikern“, gar den „Verschwörungsgläubigen“ zugeschlagen.
Klaus Theweleit, ebenfalls ein verdienter Genosse und Sozialpsychologe, äußerte in einem „konkret“-Interview über „das faschistische Moment der Verschwörungstheoretiker“, dass es „ihre inneren Zustände sind, mit denen sie nicht klarkommen. Sie verlegen alles nach außen.“ Für mich klang das nach dem, was bereits der nationalsozialistische Staatsrechtler Carl „Ausnahmezustand“ Schmitt schrieb: „Der Feind ist unsere eigene Frage als Gestalt“. Den Satz fand er beim expressionistischen Dichter Theodor Däubler. Ich finde, dass es Schlimmeres gibt als eine Verschwörungs-„Paranoia“: die „Anti-Paranoia“, wo nichts mehr mit irgendwas zusammenhängt.
.

Alphabetisierungsklasse für Frauen in asiatischer Sowjetrepublik
.

Teppichweberinnen (1975)
.
Mischwesen
Nicht nur Tiere ahmen andere Tiere nach, z.B. ungiftige Schlangen giftige, auch Menschen tun das. 1954 entstand in Japan ein neues Film-Genre, für das das Land inzwischen berühmt ist: den Monsterfilm, in dem Schauspieler in Kostümen von Ungeheuern agieren (Suitmation statt Animation). Das erste Ungeheuer – „Godzilla“, eine Art Riesensaurier – wurde durch Atomversuche im Pazifik geweckt und schwimmt nun auf Tokio zu, um sich zu rächen. In den darauffolgenden Filmen gesellen sich neben Godzilla noch jede Menge andere Riesengeschöpfe, sie kommen fast alle aus dem Meer. Es gibt unter ihnen Riesen-Echsen, -Krabben, -Seesterne, -Seedrachen und -Kraken.
Auch der Westen hat Monster hervorgebracht: Bekanntlich wurde Europa von Zeus in Gestalt eines Stieres vergewaltigt (einige sagen: entführt und verführt). Europa gebar daraufhin einen Sohn: Minos, ein Mischwesen: Mensch, Gott, Stier. Als König von Kreta heiratete er Pasiphae (Die für alle strahlt). Der „Beinahe-Stier“ Minos genügte ihr bald nicht mehr, sie verliebte sich in einen echten Stier. Um mit ihm geschlechtlich verkehren zu können, konstruierte der erfindungsreiche Daedalus für sie eine hohle Kuhattrappe, in die Pasiphae hineinkroch und sich begatten ließ. Aus der Vereinigung von Pasiphae und dem Stier ging der Minotaurus hervor: eine so ungute Mischung aus Mann und Rind, dass er erst in ein Labyrinth gesperrt und schließlich von Theseus, „dem Matador und Mörder“, umgebracht wurde. Noch heute wird dieses blutige Ritual jede Woche in spanischen Stierkampfarenen nachgespielt.
Die Philosophen Gilles Deleuze und Felix Guattari reden vom „Tier-Werden“ – als eine Schreibpraxis wie z.B. die von Kafka. Ein reales Tierwerden gab es bei den Leopardenmännern im antikolonialen Befreiungskampf, was die westliche Naturwissenschaft natürlich bestreitet. Bei den „Black Panther“ war es deswegen dann nur noch eine Traditionslinie, im kongolesischen Kinshasa sind die „Leoparden“ heute ein Fußballverein.
Im Westen akzeptiert man heute höchstens noch ein Tier-Werden als „Suitmation“ – in Affenkostümen etwa wie im Film „Planet der Affen“ oder in „Max mon amour“. Der Ästhetikprofessor Bazon Brock wollte es realistischer und bestand in einem Brief an den Frankfurter Zoodirektor Bernhard Grzimek darauf, einen Käfig im Affenhaus zu bekommen, da gehöre er hin, dazu verlangte er dreimal täglich Futter, die Entsorgung seiner Exkremente, einen Wärter, Schreibmaschine, Papier und zehn Zigaretten täglich. Grzimek beantwortete seinen Brief nicht.
In Prag liefen besonders viele „Suitmations“ bzw. „Creature suits“ herum: als Tiere verkleidete Straßenkünstler. 2019 wurden Menschen in Tierkostümen in Prag verboten. Bei solchen ohne pekuniäre Absichten spricht man von „Petplayern“. Diese Praxis ist auf Karnevals- und Kostümpartys, aber auch in der Sado-Maso-Szene und der Aktionskunst beliebt. Jene tragen z. B. teure Hunde- oder Pferdemasken aus Latex oder Leder, und diese lassen sich z.B. nackt an der Leine herumführen, berühmt dafür ist der russische Künstler Oleg Kulik. Die „Welt“ hat herausgefunden: „Von den Beteiligten wird allein schon die strenge Hierarchie zwischen den selbsternannten Pets und ihren Haltern als erotisch empfunden – sowohl von denen, die Befehle erteilen, als auch von jenen, die sie ausführen.“ Die meisten Teilnehmer sind Männer – entweder „Herrchen“ oder „Dogplayer“, von den letzteren sind einige nackt. Von den Petplayern lassen sich die „Zoomimiker“ unterscheiden.
Sie treffen sich u. a. auf »Furry Conventions« mit Masken und Kostümen von allen möglichen Tieren. Auf dem „Furry Convention Calendar“ sind 64 solcher Treffen weltweit aufgeführt – in Indonesien, Neuseeland, Taiwan, Madrid und Mexiko, in Schweden, der Ukraine und vor allem in den USA. In Deutschland finden sie heuer in Reutlingen und Suhl statt, 2018 gab es ein großes Treffen im Berliner Hotel Estrel. Die „Furrys“ sehen beispielsweise so aus wie ein Fuchs oder eine große Katze, beide Verkleidungen werden gerne von Frauen gewählt. In Onlineshops kann man sich entsprechend ausstatten.
Männer nehmen gerne eine Tigermaske und Pranken aus Stoff und tragen dazu Schlips und Anzug. Sie haben vielleicht „Die Tigerstrategie“ von „Deutschlands führendem Zeitmanagementexperten“ Lothar Seiwert gelesen. Es gab viele „Tiger“ auf der letzten „Eurofurence“ im Estrel-Hotel, dem weltweit ältesten Treffen, das jährlich in- und ausländische Fans von Menschen in Tiergestalten zusammenbringt. Einige der Tiger sahen wie Comictiere aus, desgleichen viele Bären, Wölfe, Papageien, Mäuse, Schakale und Pferde. Die Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) interviewte einen Wolf: „Ich habe als Furry gelernt, nicht mehr scheu zu sein,“ sagte er. Maximilian Nitschke-Stockmann, Mitorganisator der „Eurofurence“ 2018, an der über 3.000 „Furrys“ teilnahmen, meint: „Wir sind ein großer, verkuschelter Haufen.“ Der MAZ-Reporter hat herausbekommen: „Die meisten Kostüme kosten Tausende Euro, in ihnen stecken Hunderte Arbeitsstunden. Manche sind mit 3-D-Augen und Belüftungssystemen ausgestattet, eins mit integrierter Videokamera. Kostenpunkt? So teuer wie ein Kleinwagen.“
.

Schulanfängerin lernt Lesen
.

Mädchengruppe säubert Lenin-Denkmal
.
Antikapitalistische Auswüchse
Unser Coronaminister Dr. Lauterbach will im Oktober mit einem „Infektionsvorranggesetz“ in die Talkshows zurückkehren. Inspiriert hat ihn dazu der französische Gesundheitssoziologe Buno Latour, der 2021 nach dem in Frankreich verhängten „harten Lockdown“ meinte, dass für uns jetzt drei Jahrhunderte der Ökonomisierung aller Lebensäußerungen zu Ende gehen, jetzt gehe es nicht mehr nur darum, „das ‚Wirtschaftssystem‘ zu verbessern, zu verändern, grün anzustreichen oder zu revolutionieren, sondern darum, ganz und gar ‚auf die Ökonomie zu verzichten‘. Paradoxerweise – und das freut uns – bewirkt ausgerechnet die noch nicht beendete Episode der Corona-Pandemie, dass der Geist der Eingeschlossenen ‚befreit‘ und uns dadurch erlaubt wurde, der langen Haft im ‚stählernen Gehäuse‘ der ‚ökonomischen Gesetze‘ zu entrinnen, in dem wir geschmachtet hatten. Wenn man sich je von schlechter Emanzipation emanzipiert hat, dann in diesem Fall.“
.

Milchlieferantin
.
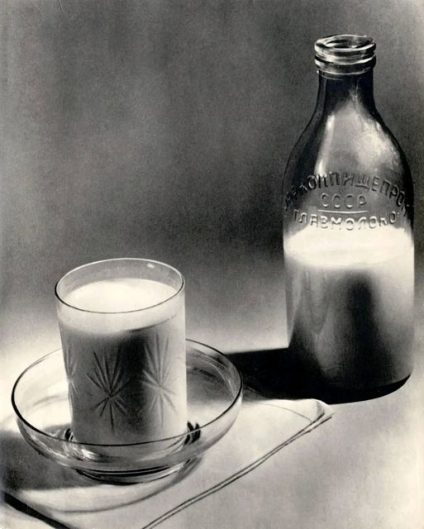
Milchwerbung (von Alexander Chlebnikow 1926)
.

Milchverkäuferin (1970)
.

Partisanin hilft einem Verwundeten (1965)
.
Vulgärmaterialismus
Alle Räder stehen still / Wenn dein starkes Gen es will! Heute erforscht die Mainstream-Biologie nicht mehr die Lebewesen, also Tiere, Pflanzen, Pilze, Einzeller und Bakterien, sie interessiert sich nur noch „für die Algorithmen der lebenden Welt“, wie der Genforscher Francois Jacob es nannte. Ein Algorithmus – bei dem jeder mit muß! Die Biologie wurde dadurch in Chemie, Physik und Mathematik aufgelöst-
20 Jahre später veröffentlichten die Mikrobiologen erste Ergebnisse. Ab etwa 2000 wurde fast täglich ein neues Gen isoliert. In den Medien war jedesmal triumphalistisch vom endlich entdeckten „Neid-Gen“, „Erfolgs-Gen“, „Schönheits-Gen“, „Eifersuchts-Gen“, „Fettmach-Gen“, „Autisten-Gen“, „Schizo-Gen“ usw. die Rede. Sogar das Magazin der Max-Planck-Institute titelte: „Singvögel mit Casanova-Gen“. Jede Lebensäußerung und sogar -einstellung war plötzlich materialistisch determiniert und die Biologie damit zur Leitwissenschaft geworden, genauer gesagt: die Genetik. Als es den Biochemikern Watson und Crick gelang, ein räumliches Modell der DNA-Doppelhelix zu erstellen, teilte ersterer der Presse mit, es sei ihnen gelungen, „den Code des Lebens zu knacken“.
Bei all diesen Anstrengungen ging es jedoch nicht um Fragen, das „Leben“ betreffend, sondern ums Geschäft: um bessere Tomaten z.B., wie die US-Biologin Lynn Margulis schimpfte, oder bessere Biere mit genetisch modifizierten Hefen und Braugerste. Solche gentechnisch veränderten Organismen (GVO) werden auch politisch auf dem Markt durchgesetzt. In den amerikanischen Supermärkten gibt es inzwischen so gut wie keine nicht genetisch manipulierten Lebensmittel mehr, außerhalb der USA muß man aber noch nachhelfen: So hat „die US-Regierung ihre Entwicklungshilfe für El Salvador aus dem Millenium-Challenge-Fonds in Höhe von 277 Millionen US-Dollar davon abhängig gemacht, dass El Salvador gentechnisch verändertes Mais-Saatgut von Monsanto kauft. Der Druck der USA, die Auszahlung der Gelder, die für die Entwicklung der Küstenregion von El Salvador gebraucht würden, an den Kauf von Saatgut zu koppeln, führte bereits zu Protesten der Bevölkerung. In diesem Zusammenhang demonstrierten Bauernorganisationen vor der US-Botschaft in San Salvador,” berichtete „amerika21.de“.
In Argentinien kam es 2014 bei der Parlamentsabstimmung über ein Umweltschutzgesetz der Provinz Córdoba zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Umweltschützern. Der Protest richtete sich gegen das Bauvorhaben des Agrarkonzerns Monsanto in der Kleinstadt Malvinas. Dort soll die weltweit größte Produktions- und Lagerstätte für genmanipuliertes Saatgut entstehen.
In Indien war es die Weltbank, die dort für die Durchsetzung von gentechnisch verändertem Baumwoll-Saatgut sorgte. Bevor der Gentechnikriese Monsanto dank der 1988 von der Weltbank verordneten Saatgut-Politik alles veränderte, bauten indische Bauern Baumwolle aus eigener Zucht zusammen mit anderen Feldfrüchten an, die sie wirksam vor eindringenden Sorten und durch Insekten übertragene Krankheiten schützten. Da die Samen der Baumwollpflanzen natürlich waren, konnten die Bauern einen Teil zurückhalten und im nächsten Jahr erneut aussäen, ohne Lizenzgebühren für neues Saatgut bezahlen zu müssen. Laut einem Bericht der indischen Zentralstelle für die Erfassung von Verbrechen (National Crime Records Bureau, NCRB) gab es von 1995 bis 2011 in Indien 290.740 Selbstmorde von Bauern, die durch die Einführung von GVO in den wirtschaftlichen Ruin und die Armut getrieben wurden.
In Afrika und Asien investiert die Bill & Melinda Gates-Stiftung in großem Stil in die Umstellung der Landwirtschaft auf GVO. 2010 erwarb sie 500.000 Monsanto-Aktien.
Monsanto arbeitet seit Jahren auch an gentechnisch-verändertem Marihuana. Der Investor und Monsanto-Aktionär George Soros hat die weltweiten Kampagnen zur Legalisierung von Marihuana mit Millionenbeträgen finanziert. Der Biotechnologie-Konzern Monsanto bereitet sich darauf vor, in das Milliarden-Geschäft mit Marihuana einzusteigen. Er will die Cannabis-Pflanzen, ähnlich dem gentechnisch veränderten Mais- und Sojapflanzen, immun gegen sein Unkrautgift Roundup zu machen. Roundup steht im Verdacht, bei Menschen tödliche Nierenerkrankungen und schwerwiegende Nervenschäden auszulösen.
2012 erteilte das Europäische Patentamt (EPA) der US Firma Altor ein Patent auf einen genveränderten Schimpansen – für Medikamenten-Tests. Nach Ansicht der Tierschützer verstößt die Patentierung eines dem Menschen technisch angeähnelten Affen gegen die ethischen Grenzen des Europäischen Patentrechts. „Es ist für mich eine schockierende Vorstellung, dass eine Firma in einem Menschenaffen nur noch ein technisches Instrument sieht,“ sagte die Schimpansenforscherin Jane Goodall und erhob Einspruch gegen die Patenterteilung.
Kürzlich berichtete die „unabhängige bauernstimme“, dass Bayer/Monsanto und Dow/DuPont/Pioneer in den letzten Jahren 1550 Patentanmeldungen auf Pflanzen angehäuft haben, bei denen neue Gentechniken eingesetzt wurden. Die beiden Konzerne „kontrollieren bereits jetzt 40 Prozent des globalen kommerziellen Saatgutmarkts“. Die „bauernstimme“ schrieb: „Um ihre Patente zu erhalten, verwischen Saatgutkonzerne bewusst Unterschiede zwischen konventioneller Züchtung, zufälliger Mutagenese und alter wie neuer Gentechnik. Zudem werden die Ansprüche oft absichtlich weit gefasst, um einen breiteren ‚Schutz‘ zu erhalten.“
Neuerdings wird, wie auch beim Impfstoff gegen Corona, mit gentechnischen Mitteln gearbeitet, um die Malariamücke genetisch so zu verändern, dass ihre Nachkommen unfruchtbar sind – und sie als Art ausstirbt.
Hinter den ganzen Hightech-Fummeleien an den Genen steht ein vulgärmaterialistischer Reduktionismus, der die Komplexität des Lebens verneint, um schnell wirtschaftlich verwertbare Laborergebnisse zu erzielen – ungeachtet der Gefährlichkeit all dieser genetisch optimierten Organismen, wenn sie in Kontakt mit natürlichen Lebewesen kommen.
.
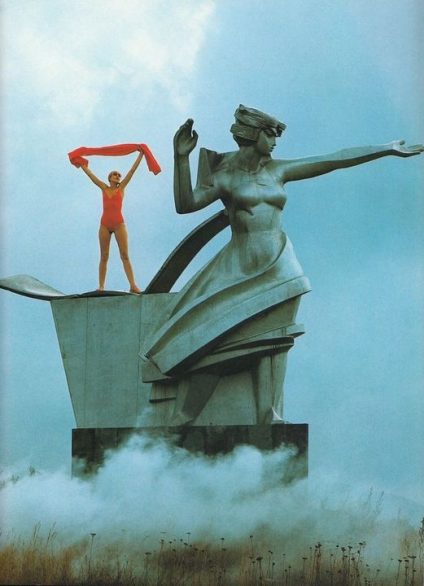
Philogynes Russland
.

Die Revolution marschiert
.
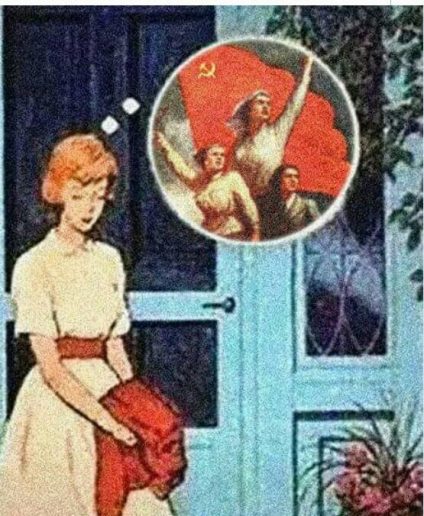
Die Amerikanerin tagträumt
.
Wohin jetzt mit den ganzen Dingen?
Kurz vor dem Jubiläum zu seinem 50-jährigen Bestehen wurde dem international renommierten Berliner Werkbundarchiv – Museum der Dinge vom Immobilienfonds Victoria Immo Properties V S. à r.l. gekündigt. Dem Museum droht der Verlust seiner Ausstellungsflächen sowie der Archiv- und Büroräume in der Oranienstraße 25.
Verantwortlich für die Kündigung ist eine Briefkastenfirma in Luxemburg, die bislang noch anonymen Spekulanten gehört. Diesen konnte es beim Rauswurf des letzten Mieters offensichtlich nicht schnell genug gehen, denn bei der Kündigung zum 30.06.2023 wurde noch nicht einmal die vertraglich vereinbarte Kündigungsfrist von einem Jahr eingehalten.















