Das obige Foto zeigt ein Fitnesscenter nahe Boston. Stairways, nein Escalator to Heaven. Der Ästhetikprofessor Peter Sloterdijk entdeckte „im Fitness-Studio ein Plakat mit einer auf dem Rücken liegenden Frau, die ruft Fit mich!“ Er beobachtete auf dem Campus der Harvard-Universität: „Um halb sieben am Morgen ist das Fitness-Studio schon voll von Trainierenden, die sich selbst antreiben, wie Akteure, die noch Größeres vorhaben.“ Im dortigen Swimmingpool herrsche wegen des Andrangs äußerste Bahnendisziplin. Die Jogger, Schwimmer und an Kraft- und SportgerätenTrainierenden sind laut Sloterdijk „Berufsevolutionäre“, denn sie gehen darwinistisch angeregt vom „Survival of the Fittest“ aus, also dass nur der Fitteste im Geschlechter- und Daseinskampf überlebt, d.h. erfolgreich ist. Sloterdijk sieht bereits ein „drohendes Übermaß an Gesundheit“ aufkommen. Ich sehe in den Bodybuildingstudios eher die durch Automatisierung von ihren Maschinen verdrängten Arbeiter, die für ihren Produktionsausstoß Stücklohn bekamen und nun für die Benutzung von Fitnessgeräten zahlen müssen. Gesund ist beides nicht. Einmal wurden die Stücke gezählt und nun die Anzahl der Übungen – und beide Zahlen müssen immer wieder übertroffen werden.
Wetterumschwung
Es gab mal ein schönes rotes Plakat mit den Köpfen von Marx, Engels, Lenin und dem von der Bundesbahn-Werbung adgebusterten Spruch „Alle reden vom Wetter. Wir nicht.“ Eine Werbung für den SDS, dem aus der SPD ausgeschlossenen „Sozialistische Deutsche Studentenbund“. Das Plakat wurde unlängst nachgedruckt. Nicht weit von meinem Schreibtisch hat jemand ein Interviewauszug an das Plakat geklebt: „Der Spiegel: ‚Herr Professor, vor zwei Jahren schien die Welt noch in Ordnung‘. Theodor W. Adorno: ‚Mir nicht‘.“
.

Der MP will die globale „Temporalmacht“ wieder in seine „Territorialmacht“ einbinden, von der sie sich mit dem Neoliberalismus „emanzipiert“ hatte. Eine Quadratur des Kreises, aber gerade damit soll der „gesellschaftlichen Selbstauflösung“ entgegengewirkt werden. Es ist jedoch viel zu spät für solche Versprechen, wie der bayrische Filmemacher Herbert Achternbusch bereits 1981 zu bedenken gab: „Da, wo früher Pasing war und Weilheim, ist jetzt Welt…“, meinte er. „Die Welt hat uns vernichtet, das kann man sagen.“
.
„Ich weiß langsam nicht mehr, was schlimmer ist, wenn ‚68‘ dran ist, wer schwerer zu ertragen ist, wenn er/sie sich über diese Zeit öffentlich äußert: die ‚68‘er-GegnerInnen oder ihre ProtagonistInnen,“ schrieb Ines Lehmann 2008 auf der „SDS-Website ‚isioma.net‘“. Ab Ende der Siebziger bezeichneten sich selbst ehemals rechte Gegner des SDS u.a. an der Westberliner „Freien Universität“ (FU) als „68er“, aber seit den Neunzigern wird die Studentenbewegung für alle möglichen gesellschaftlichen Mißstände verantwortlich gemacht.
Als ich Anfang 1969 nach Westberlin zog, waren meine Mentoren im SDS Ines Lehmann und Thomas Bachmann. Sie wohnten in einer Charlottenburger WG, in der jeden Nachmittag Ruhe herrschte, weil jeder irgendetwas Theoretisches las. Thomas Bachmann ist 2022 gestorben, Ines Lehmann ist Taxiunternehmerin und Übersetzerin, wie ich einem taz-Bericht über eine Veranstaltung in der Freien Universität zur Erinnerung an den „30. Jahrestag des Tomatenentwurfs“ (1998) entnehme. Sie war 1968 gegen den Auszug der Frauen aus dem SDS gewesen, der mit einem Tomatenwurf eingeleitet wurde. Ines Lehmann meint nun: „Ich würde heute wieder so handeln: Ich konnte mir damals ein Leben ohne den SDS nicht vorstellen.“ 1974 traf ich sie kurz in Lissabon, wo sie sich in der „Nelkenrevolution“ exponierte. Später bekam ich mehrere dicke Bände von ihr: Sie war vielsprachig und hatte darin Presseartikel aus vielen Ländern über das portugiesische Ereignis ausgewertet.
Auf der „68erinnen-Gala der Reflexion“ in der FU erfuhr man: „Die Tomatenwerferin Sigrid Damm-Rüger ist tot. An ihrer Stelle sprach ihre Tochter Dorothee. Sie, die Tochter, habe die Bedeutung des Tomatenwurfs erst auf der Beerdigung der Mutter begriffen, als Frauen einen Kranz mit Tomaten niedergelegt hätten.“
2008 polemisierte Ines Lehmann, die zu der Zeit wieder in Lissabon lebte, auf der SDS-Website „mit wachsendem Zorn, ja mit Empörung“, gegen „die in diesem Jahr besonders lauten Verlautbarungen von ‚68er‘- ProtagonistInnen.“ Sie nennt Namen: „Nachdem dem Nazi Horst Mahler und dem nazinahen Bernd Rabehl in den Medien jetzt nicht mehr so viel Raum für ihre 68er-Geschichtsinterpretationen eingeräumt wird wie früher, treten nun andere Herrschaften in die so freigewordenen Fußstapfen, Wenn mann schon den Kampf ‚für die Sache‘, d.h. die Außerparlamentarische Opposition, ihren Einsatz für eine andere Politik und Gesellschaft verloren hat, so will mann nun wenigstens noch den Kampf um ihre Interpretation gewinnen, um so noch in die Geschichte eingehen zu können….“
Vor allen anderen ärgern Ines Lehmann jene Altlinken, „die ‚Kraft ihres Wortes‘ ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, also medienabhängige Herrschaften wie der Schriftsteller Peter Schneider, der taz-Journalist Christian Semler usw., aber auch verrentete SPD-Journalisten wie Tilman Fichter.“
Die Autorin holt weit aus: „Wie haben wir unsere Eltern, Lehrer, Professoren an den Pranger gestellt, sie wegen ihrer uns bzw. sich selbst verschwiegenen, mehr oder weniger großen Nähe zum Nationalsozialismus angeklagt, sie verlassen, uns von ihnen getrennt usw.! Und nun das!“
Dem inzwischen verstorbenen Semler wirft sie vor, über die Gründung seiner maoistischen „KPD/AO“ (Aufbauorganisation) 1970 nur „larmoyant zu plaudern“ statt „selbstkritische Reflexion“ zu betreiben. Über Fichter, der in die SPD eintrat, „die damals unser schärfster Gegner war und deren ‚Berufsverbote-Politik‘ zig GenossInnen in ein gesellschaftliches und politisches Abseits bugsierte,“ schreibt sie: Er „schwadroniert heute immer wieder über ein Nichtvorhandensein einer Frauenbewegung im SDS. Dabei waren es „gerade die Frauen im sog. ‚antiautoritären‘ SDS, eben jene emanzipatorischen Kräfte, die diese männerbündische Eliteeinheit der studentischen Intelligenz ‚von sich selbst‘ befreit haben!“
Zwei Monate nach dem Tomatenwurf sprengte der Frankfurter „Weiberrat“ die letzte Delegiertenkonferenz: „danach war es dann aus mit dem SDS, dem entscheidenden Motor von ‚68‘. Leider habe ich an diesen Aufständen nicht teilgenommen, weil mir das Schicksal des SDS, mit dem ich mich damals völlig kritiklos identifizierte, wichtiger war als der Befreiungskampf der Frauen.“
.

.
Lügen
Im „Deutschen Hygienemuseum“ sahen wir uns die Ausstellung über „Lügen“ an. Dem Namen „Hygiene“ quasi dauerverpflichtet und zudem im konservativen Dresden domiziliert, nahmen die Volks-„Fakes“ im Internet darin einen breiten Raum ein – und zwar so wie die Staats- und Kapital-Medien dieses „Problem“ sehen. Nichtsdestotrotz ist die ausgestellte Problemdarstellung, die sich sicher einem „Brainstorm“ mit Fakeforschern und -experten verdankt, bei dem man wiederholt in die Breite des Themas „Lügen“ ging, durchaus sehenswert, mit allerlei Mitmach-Möglichkeiten.
Gleich am Anfang begrüßt einen der Schauspieler Martin Wuttke, er begleitet einen auch durch die Ausstellungsabteilungen – in unterschiedlicher Verkleidung, aber nur auf Video. Das jedoch so gut, dass einige Besucher seinen Anweisungen folgten, so als könnte er das im Video zur Kenntnis nehmen. Solcherart Verunsicherung bewirkte die „Authentizität“ des Lügenexperten spielenden Wuttke oder vielmehr allein das Minenspiel dieses Mimen, denn man sah nur seinen Kopf auf der Leinwand und hörte dazu seine einleitenden Erklärungen über die Lüge.
Es ist aber auch ein vertracktes Thema. Ich vermisste in der Ausstellung eine größere Beschäftigung mit den Lügen der Politiker. Von Bismarcks Emser Depesche über den Nazi-Überfall auf den Sender Gleiwitz, den Tonkin-Zwischenfall der Amis vor der Küste Vietnams bis zu Angela Merkels Versicherung an die Adresse Polens, dass auch ihr Land von der Ostsee-Pipeline profitieren werde usw..
Die Lüge fängt ja schon damit an, dass man einerseits ermahnt wird, immer ehrlich zu sein und andererseits sich bei der Tante für das schöne Geschenk bedanken soll, obwohl man es schrecklich fand. Nicht die Lüge sondern dieser Zwiespalt (Double-Bind) macht einen zu schaffen. Dem einen mehr , dem anderen weniger. Im kostenlosen Beiheft, das Peter Moosleitners „P.M.-Magazin“ plagiiert und sich „F.M.“ nennt, findet man das Faksimile eines Artikels, der einem ähnlichen Double-Bind nachgeht: „Darf man einen Orgasmus vortäuschen?“.
In Dresden erwarb ich das Buch „Die Goldküste – eine Irrfahrt“ der in Berlin lebenden US-Journalistin Isabel Fargo Cole. Es ist ihr Bericht über eine organisierte Reise mit ihren Eltern zu den „Hotspots“ von Alaska, u.a. nach Klondike, wo der „Gold Rush“ stattfand, ein Ort, den die Autorin nicht nur durch Charlie Chaplins Film „Goldrausch“ kannte: ein Vorfahre von ihr war dort sogar reich geworden. Sie vermutet jedoch, dass dieser Teil ihrer Familiengeschichte ein Fake ist.
Wie nebenbei streift Cole, die während der Trumpregierungszeit durch Alaska tourte, etliche weitere gewissermaßen uramerikanische Fakes. Sie sind fast das durchgehende Element in ihrer Recherche. Eins hat mir besonders gefallen: Einer der Goldsucher, Richard Willoughby, pflegte die Mitsommernacht auf dem Muir-Gletscher an der Glacier-Bay zu verbringen. 1888 kam er mit einem Foto zurück, das Teile einer Stadt im Nebel zeigte. Dazu erklärte er, dass es sich wahrscheinlich um die Luftspiegelung einer russischen Stadt in Sibirien handeln würde. Er führte Neugierige sogar auf den Gletscher – und manche bezeugten seine Spiegelung, die er „Silent City“ nannte. Abzüge vom Foto verkaufte er „für 75 Cent das Stück“. Als der Schwindel aufflog, das Foto zeigte Bristol im Industriedunst, tat das jedoch Willoughbys Beliebtheit keinen Abbruch…Es wurde sogar eine Straße in Juneau, der Hauptstadt von Alaska, nach ihm benannt.
Cole meint, das Geschäftemachen ist für die Amerikaner etwas derart „Natürliches“, dass sie sogar 1951 den Indigenen in Alaska und anderswo jahrzehntelang ihren „Potlatch“ verboten haben. Dabei verschenkt jemand auf einem Fest seinen gesamten Besitz und bekommt dafür einen neuen Abschnitt auf dem Totempfahl, manche brachten es auf mehrere Abschnitte. Man kann diese Sitte, eine gefährliche Unsitte in den Augen der christlichen US-Missionare, als „Anökonomie“ bezeichen, die auch die ganzen US-Agrarkollektive im 19 Jahrhundert charakterisierte: Sie wurden allesamt vom Staat verboten.
Einige von Coles lokalen Reiseführern waren Indigene, von einer erfuhr sie, dass sie ihr nicht alles erzählen könne – z.B. „die Geschichte eines fremden Klans darfst du nicht erzählen, denn du könntest etwas falsch darstellen“. Unter dieser Prämisse geriete der ganze Profi-Journalismus unter Fake-Verdacht. Aber wie erzählte man etwas vielen Beteiligten, fragte Cole sie, die Geschichte eines Krieges z.B.: „Gibt es manchmal Streit um diese Frage?“ Antwort: „O ja! Dauernd!“ Das vermisste ich auch auf der Ausstellung, den dauernden Streit über solche Lügen, gerade in Dresden.
Ein Beispiel; Neulich postete ich auf Facebook einen albernen Fotowitz: Es zeigte einen ungarischen Archäologen, der ein komplettes Meerjungfrauen-Skelett ausgegraben hatte. Das soziale US-Medium überdeckte es sofort mit dem Hinweis „Laut unabhängigen Faktenprüfern beruhen diese Informationen nicht auf Tatsachen.“ Diese Fake-Detektive haben natürlich recht, denn es hat nie Meerjungfrauen mit Fischschwänzen gegeben, aber wie politisch-korrekt-verblödet müssen die Amis seit Richard Willoughby geworden sein, um so etwas nicht mehr als Witz begreifen zu können?
P.S.: Es gibt mehrere gute Bücher, in denen es um Lügen geht: „Die Abenteuer des Joel Spazierer“ von Michael Kohlmeier z.B.. oder das neue Buch von „Klaus Theweleit „a-e-i-o-u – Die Erfindung des Vokalalphabets auf See, die Entstehung des Unbewußten und der Blues“, in dem es u.a. um den „größten Lügner“ Homers Odysseus geht. Aber an solche Lügen-Geschichten traut sich das Hygiene-Museum wahrscheinlich gar nicht ran.
.

.
Welt im Griff
Es geht um die USA – mit ihrem Be-griff „Manifest Destiny“: „Dieser Begriff aus dem Jahr 1845 bezeichnet die Vorstellung, dass die Vereinigten Staaten von Gott dazu bestimmt sind, ihre Herrschaft auszuweiten und Demokratie und Kapitalismus auf dem gesamten nordamerikanischen Kontinent zu verbreiten,“ heißt es in eigener Sache auf der US-Plattform „history.com“. Schon seit langem faßt die USA ihren notwendigen Einflußbereich jedoch sehr viel weiter – weltweit. Zunächst bezeichnete sie ganz Südamerika als ihren „Hinterhof“, inzwischen ist der bundesdeutsche Militärstützpunkt Ramstein ihr „weltweit größter außerhalb der USA“ und allein der Bundesnachrichtendienst (BND) liefert dem US-Geheimdienst NSA monatlich 500 Millionen Datensätze. Experten schätzten 2004 Wikipedia zufolge die Gesamtzahl der „Stützpunkte“, auf die die USA jederzeit zurückgreifen können, auf ungefähr 1000 weltweit.
Andererseits kann man sagen, dass die Amerikaner das einstige Land der Indianer noch immer nicht „übernommen“ haben, sie haben sich darauf nicht „geerdet“. Amerikareisende wie der Kulturforscher Michael Rutschky und viele andere Nochnichtamerikaner hat dieses vermeintliche Unvermögen verwundert, die Amerikaner haben keine „Heimat“, es sind, anders als die wenigen begüterten, weitgereisten und gebildeten Europäer „Weltbürger“ neuen Typs, und das auch wenn sie noch so tumb und lokalborniert sind. Sogar halbwegs gebildete US-Bürger meinen, mit ihrer Sprache und ihrem Stil überall auf der Welt durchzukommen, und dabei womöglich noch den amerikanischen Weltbegriff zu verbreiten – zum Wohle der Einheimischen, es ist nämlich faktisch ihre Welt.
In Istanbul, Berlin und Poona trifft man immer wieder Amerikaner, die oft sogar schon seit Jahren Englischlehrer dort sind, aber so gut wie kein Wort Türkisch, Deutsch oder Marathi sprechen. Dafür ist Kalifornien inzwischen das „Weltzentrum“ des Buddhismus, behaupten nicht nur die Amerikaner, sondern auch buddhistische Asiaten. In den USA selbst ist der „New York City Marathon“ das weltweit „Größte“, der „Icefield Parkway“ die „schönste Fernstraße der Welt“, es gibt dort die „weltweit größten Bäume“, den „weltweit größten Geysir“, die weltweit reichsten Männer und größten Konzerne, die weltweit besten Universitäten (was natürlich grober Unfug ist!) und laut SZ sind „die Amis auch die dicksten“ und haben die weltweit höchste Anzahl an Gefängnisinsassen. Im „Lexikon der Geographie“ heißt es: „Gegenwärtig entsprechen die USA am besten dem Bild einer Weltmacht.“ Belegt wird dies mit Folgender Dummbeutelei: „Die USA belegen mit einem Score von 100 den ersten Platz in der Kategorie ‚Power‘ im Best Countries Ranking 2022 des Nachrichtenmagazins U.S. News und werden somit als mächtigstes Land der Welt bewertet.“
Die USA sind angeblich auch die „weltweit größte Spielernation“ (das Streben nach Glück), weswegen der ehemalige US-Präsidentenberater Zbigniew Brzezinski nach Auflösung der Sowjetunion seine Ausführungen über die Weltherrschaft (dem „US-Leadership“) als „Das große Schachspiel“ betitelte. Und ein weiterer Präsidentenberater, Henry Kissinger, etwa zur selben Zeit verkündete: „Wer Zentralasien beherrscht, beherrscht die Welt“.
Den Weltrekord im Aufstellen von „Weltrekorden“ hält auch ein Amerikaner mit 424 Rekorden: Ashrita Furman. Die meisten sind angemaßt oder so idiotisch wie diese: Die längste Unterwasserjonglage (20 Minuten) mit drei Bällen durchtgeführt, Die längste Strecke mit den schwersten Schuhen der Welt (146 Kilogramm) zurückgelegt, die größte Wippe der Welt (25 Meter) gebaut, fünf Kilometer in Rekordzeit mit Schwimmflossen gelaufen, in einer Minute 40 Liegestütze auf einem Elefanten geschafft usw..
Aber auch der Amerikaner Sean Adams ist nicht ohne: Er schaffte es, 3850 Wörter in einer Minute zu lesen. Wenn man in Amerika die „13 schönsten Frauen der Welt“ ermittelt, sind wie selbstverständlich die meisten weiße Amerikanerinnen. Obwohl American Football fast ausschließlich in den USA gespielt wird, kämpfen die dortigen Teams um den „World Cup“. Bei einem Kneipenspiel gewannen die Amerikaner den „World Cup der Tischfußballer“. Ein paar Amis, die aus Spaß Esel halten, veranstalten jährlich einen Wanderwettbewerb mit ihnen – und natürlich geht es dabei um die „Weltmeisterschaft“. Einer der Beteiligten, Jon Katz, hat ein ganzes Buch darüber geschrieben: „Simon und ich“ (2019).
Die Süddeutsche Zeitung wollte es genauer wissen: „In den USA ist alles immer mindestens großartig, darunter geht es selten, darüber immer. Aber ist das Land überhaupt noch das Land der Superlative?“ Antwort: „Wer länger als fünf Minuten in Amerika ist, wird einen Amerikaner findet, der schwört, Amerika sei die großartigste Nation der Welt. ‚Welcome to the greatest nation on earth!‘ schreien schon die Anzeigentafeln, kaum ist man aus der Flughafenhalle.“
Das alles ist nicht schön! Noch weniger allerdings, dass das sich stolz „Exportweltmeister“ nennende Deutschland allen Scheiß der Amis nachäfft und sich seine Politik, sein Wirtschaften, seine Kultur usw. als eine Art Vasallenstaat von ihnen freiwillig (!) vorschreiben läßt. Es gibt hier kaum noch einen Einzelhändler, Künstler oder Wissenschaftler, der seinen Laden, seine Kunst, seine lauen Thesen nicht auf Angloamerikanisch präsentiert und annonciert. Und viele Doktorarbeiten werden inzwischen gleich auf Amerikanisch geschrieben.
.

.
Prager Ironie
Laut Michel Foucault erhebt sich die Ironie – und ist subversiv, während der Humor sich fallen läßt – bis auf das Schwarze unter dem Fingernagel. Für den tschechischen Schriftsteller Bohumil Hrabal ist die Ironie eine Art von Naivität, “die aber so verbohrt ist, dass sie nicht nur unfähig ist, das eigene Anderssein zu erfassen, sondern in der einmal eingeschlagenen Richtung verharrt und auf diese Weise das Leben bereichert”.
Als “Nährboden” brauche speziell die Prager Variante eine soziale “Mischung”, wie sie bis zum Einmarsch der Deutschen in Prag bestand. Diese haben dann jedoch erst alle Juden umgebracht und mußten schließlich selbst aus Tschechien verschwinden. Deswegen könne man “von der Prager Ironie nur noch historisch sprechen. Ihre Wortführer waren der Proletarier Jaroslav Hasek und der Intellektuelle Franz Kafka, beide sind im gleichen Jahr in Prag geboren und im gleichen Jahr gestorben. Und ihre Werke bilden nicht nur das theoretische Fundament der Prager Ironie, sondern sind auch ihr Ausdruck…Sie sind eine Art negative Mystik dieses Zeitalters ohne Gott, um mit Georg Lukacs zu sprechen”.
Den Schwejk-Autor bezeichnete Hrabal sogar einmal als seinen “erstgeborenen Sohn, Erfinder der Kneipengeschichte und genialer Lebemann und Schreiber, der die prosaischen Himmel durch Menschengeruch humanisierte und die Schriftstellerei anderen überließ”. Aber auch Kafka wird für Hrabal zu einem Vorgänger. Mit ihm sowie auch mit Hasek teilt er zudem eine völlige Kritiklosigkeit: Ein Satz von Hrabal, der auf fast jedem Klappentext seiner bei Suhrkamp erschienenen Bücher zu finden ist, lautet: “Diese Welt ist schön, zum Verrücktwerden schön! Nicht, dass sie es wäre, aber ich sehe sie so.”
“Groß und revolutionär ist nur das Kleine, das ‘Mindere’. Haß gegen alle Literatur der Herren. Hinwendung zu den Knechten, zu den kleinen Angestellten,” so charakterisierten die Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari in ihrem Buch über “Die kleine Literatur” am Beispiel des in Prag deutsch schreibenden tschechischen Juden Franz Kafka dessen Werk. So läßt dieser z.B. den Affen im “Bericht für eine Akademie” sagen: “Es geht nicht um die wohlgeformte Bewegung geradewegs hinauf zum Himmel oder geradeaus nach vorn, es geht nicht mehr darum, die Decke zu durchbrechen, es geht nur noch um ein ‘sich in die Büsche schlagen’, irgendwo, sogar auf der Stelle, unverzüglich; es geht nicht um Freiheit als Gegensatz zur Unterwerfung, sondern ganz einfach um einen Ausweg.” Es handelt sich also bei Kafka, für den die Literatur “eine Angelegenheit des Volkes” ist, darum, “ein Klein-Werden zu schaffen”. Bei Hasek ist es die Konzentration auf das kleine Frontschwein und bei Hrabal dann auf die kleinen Leute – ihre Geschichten und “schwarzen Chroniken”, wobei er schon sehr früh mit gutem Beispiel voranging: So leerte er z.B. einige Jahre lang just am 1. Mai, da sich in Nymburk der Festzug zum Tag der Arbeit dem Marktplatz näherte, die Güllegruben dort, so daß anschließend die ganze Gegend stank.
Laut Deleuze/Guattari gewinnt in “kleinen Literaturen” schließlich alles kollektiven Wert, wobei das Politische jede Aussage ansteckt. Hrabal schreibt über seine Eltern, die in ein Alterheim außerhalb von Nymburg einzogen, einem umfunktionierten Schloß des Grafen Spork. Hier endeten all jene, deren Zeit mit der Verstaatlichung der Betriebe 1948 und der darauffolgenden sozialistischen Umgestaltung des Landes abgelaufen war. Hrabals Vater Francin, der Brauereiverwalter, war zuvor vom Betriebsrat ebenso entlassen worden wie der Brauführer, den weder die Arbeiter noch die Geschäftsleitung gemocht hatten: “Wir teilen uns ab heute die Arbeit selber ein,” sagten sie ihm. Die Aktien der Firma teilte man unter den Werktätigen auf, ebenso alle Deputat-Obstbäume der leitenden Angestellten. Selbst die Betriebsleiter-Wohnung auf dem Brauereigelände mußten die Hrabals verlassen und die Mutter verlor ihre langjährige slowakische Hausangestellte, Anka aus Budecko, die ihr im betrunkenen Zustand immer gedroht hatte: “Einmal wird es andersherum kommen, dann sind wir die Herren!” Und so kam es dann ja auch – aber Hrabals Mutter war weit davon entfernt, das zu bedauern: “Es ist gut, dass es keine Mägde mehr gibt”. Ähnlich sah das auch ihr Mann, dem in der Brauerei gesagt wurde, dass seine gütige Menschenführung besonders perfide gewesen sei, weil sie dem Klassenkampf die Spitze genommen habe – “verstehen Sie?!”. Er erwiderte: “Ich verstehe nicht, aber ich habe begriffen…”. Nämlich, wie seine Frau es ausdrückte, “dass bei uns diesmal die Reichen zahlen müssen, und nicht, wie nach dem Ersten Weltkrieg die Armen”. Trotzdem – murmelte sie später, zahnlos und zottelig, im Altersheim: “…ein so schöner Anfang und dann ein solches Ende”.
.

.
Leben
Ironischerweise nennt sich die mit Computern und Gentechnik operierende Biologie heute „Life Sciences“, obwohl sie mit dem „Leben“ so gut wie nichts zu tun hat. Das Wort „Leben“ taucht in den Biologiebüchern schon gar nicht mehr auf. Die Lebenswissenschaftler erforschen „nicht mehr das Leben, sondern die Algorithmen des Lebendigen“, stellte der französische Genetiker und Nobelpreisträger Francois Jacob klar. Der kürzlich verstorbene Wissenssoziologe Bruno Latour hielt dagegen die ganze Genetik für einen ärmlichen „Reduktionismus“, räumte jedoch ein, dass dieser in der Industrie durchaus Sinn ergebe, d.h. Gewinn verspreche.
Die US-Biologiehistorikerin Lilly E.Kay hat überschlagen, dass in ihrem Land „mindestens 80 Prozent der Molekularbiologen an eigenen kommerziellen Biotech-Unternehmen beteiligt sind“. Einer dieser hybriden Forscherunternehmer – der Gründer der Biotech-Unternehmensberatung Bain & Company, Bill Bain, schrieb in der Zeitschrift „Nature Biotechnology“: „Die meisten Anstrengungen in der Forschung und in der biotechnologischen industriellen Entwicklung basieren auf der Idee, dass Gene die Grundlage des Lebens sind, dass die Doppelhelix die Ikone unseres Wissens ist und ein Gewinn für unser Zeitalter. Ein Gen, ein Enzym, ist zum Slogan der Industrie geworden… Kann das alles so falsch sein? Ich glaube schon, aber ich bin sicher, das macht nichts. Denn die Hauptsache ist, dass es funktioniert: Manchmal funktioniert es, aber aus den falschen Gründen, manchmal wird es mehr Schaden anrichten als Gutes tun … Aber die beobachtbare Wirkung ist unbestreitbar … Wir müssen nicht das Wesen der Erkenntnis verstehen, um die Werkzeuge zu erkennen…Inzwischen führen die Genom-Datenbanken, die geklonten Proteine und anderes Zubehör der funktionalen Genetik zu Werkzeugen, Produkten, Einsichten, Karrieren und Optionen an der Börse für uns alle.“ Darum geht es den Biologen, nicht nur in den USA: Anerkennung Karriere, Reichtum, Prominenz – alles auf Kosten ihrer Forschungsobjekte.
.
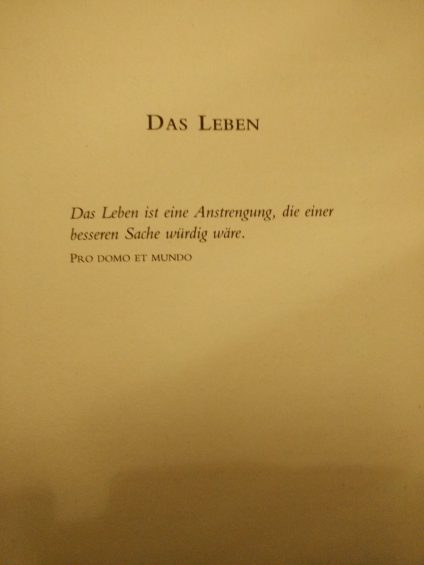
.
Ein besonders übles Beispiel ist für mich der australische Zoologe und Direktor des „South Australian Museum“ Tim Flannery, der „mehr Arten als Darwin benannt hat,“ wie sein deutscher Verlag betont. Dazu mußte er fast schon manisch eine Südseeinsel nach der anderen durchforsten – mit Fallen (in denen er u.a. Beutelratten fing) und Netzen, in denen sich Flughunde verfingen. Ihre Bälger wurden für Museen und zur Artbestimmung präpariert, das Fleisch bekamen die für ihn tätigen indigenen Träger und Jäger. Sein Buch darüber hat den Titel: „Im Reich der Inseln – Meine Suche nach unentdeckten Arten und andere Abenteuer im Südpazifik“ (2013). Die Lebenweise der „unentdeckten Arten“ interessierte ihn nicht. Es ging ihm darum, ihr „Erstentdecker“ und „Bestimmer“ zu sein. Bei der Lektüre des Buches über seine Sammlung bedrohter Säugetiere auf den Südseeinseln fragte ich mich, ob es nicht eher geboten wäre, diese immer seltener werdenden Tiere auf den Inseln am Leben zu lassen und zu beobachten, statt die letzten für die Wissenschaft aus Ehrgeiz zu töten.
Ganz anders die DDR-Biologin Carmen Rohrbach: Sie arbeitete, vom Westen freigekauft, ab 1977 als Verhaltensforscherin am Max Planck Institut für Verhaltensphysiologie in Seewiesen und erforschte ein Jahr lang das Verhalten von Meerechsen auf einer der Galapagosinseln. Bei der Abreise war sie sich sicher: „In meinem Beruf als Biologin werde ich nicht weiterarbeiten. Zu deutlich ist mir meine fragwürdige Rolle geworden, die ich als Wissenschaftlerin gespielt habe. Ich kann nicht länger etwas tun, dessen Sinn und Nutzen ich nicht sehe.“ Sie erlebte zwar ein wunderbares Forschungsjahr auf „ihrer“ kleinen unbewohnten Insel, „doch ich habe es auf Kosten der Meerechsen getan, gerade dieser Tiere, die die Friedfertigkeit und das zeitlos paradiesische Leben am vollkommensten verkörpern. Ausgerechnet diese Tiere mußte ich mit meinen Fang- und Messaktionen verstören und belästigen. Da ich nun einmal diese vielen Daten gesammelt habe, werde ich sie auch auswerten und zu einer Arbeit zusammenstellen. Diese Arbeit wird zugleich der Abschluss meiner Tätigkeit als Biologin sein, denn ich kann nicht länger etwas tun, dessen Sinn und Nutzen ich nicht sehe. Und erst recht könnte ich es nicht mehr verantworten, Tiere in Gefangenschaft zu halten und womöglich sogar mit ihnen zu experimentieren… Ich werde nach Deutschland zurückkehren und versuchen, eine Aufgabe zu finden, die mir sinnvoll erscheint.“ Sie wurde dann eine Reiseschriftstellerin.
2019 nahm mich eine junge Frau von Würzburg aus in ihrem Auto mit nach Berlin. Als ich hörte, dass sie Biologin war, wollte ich ihr gleich eine Geschichte über ein Lama erzählen, aber sie unterbrach mich: „Tiere oder Pflanzen interessieren mich nicht! Ich forsche an einem Hormon, und wenn ich meine Doktorarbeit fertig habe, forsche ich für den Rest meines Lebens an zwei Hormonen.“
.

.
Tod
2000 erschien ein Buch von Ilya Zbarski, dem Sohn des Gründers des Lenin-Mausoleums Boris Iljitsch Zbarski: „Lenin und andere Leichen“. Mit den „anderen“ sind die im sowjetischen „Weltzentrum der Einbalsamierung“ (nach ägyptischem Vorbild) für die Ewigkeit präparierten Leichen von Stalin, Dimitroff, Ho Chi Minh und weiteren kommunistischen Führern gemeint. Nachdem den Einbalsamierern 1991 achtzig Prozent ihres Jahresbudgets gekürzt worden waren, hatte der Moskauer Bürgermeister Juri Luschkow dem Laboratorium empfohlen, sich mit einem „Ritual Service“ halbwegs selbständig zu machen, also auch Einbalsamierungsaufträge von eher antikommunistischen Neureichen anzunehmen: „Angesichts der rasant ansteigenden Kriminalität – 25.000 Morde allein im Jahr 1996 – kam der Vorschlag wie gerufen“, schreibt Ilya Zbarski. Die optische Wiederherrichtung dieser Privatverbrecher kostete dann – je nachdem, wie übel sie zugerichtet waren – zwischen 1.500 und 10.000 Dollar. Den bisher teuersten Verewigungsluxus leistete sich der Präsident der größten russischen Erdölgesellschaft, Lukoil, Wagit Alekperow, bereits zu Lebzeiten: Für 250.000 Dollar ließ er sich ein Mausoleum in Form des Tadsch Mahal bauen.
In den USA leisten sich die Reichen einen ähnlichen Verewigungsluxus – wie die Machthaber ja schon seit tausenden von Jahren. Im Themenheft „Erden“ der „Schriften zur Verkehrswissenschaft“ (2022) spricht die Kulturwissenschaftlerin Salome Rodeck in ihrem Beitrag „Recycelte Körper“ vom „American way of death“: Zum Einen geht es dort den Reichen darum, ihre „körperliche Integrität nach dem Tod möglichst lange zu erhalten“, wobei einige sich – krank und marode – zu Lebzeiten einfrieren lassen, in der Hoffnung, dass sie dereinst lebend und gesund wieder aufgetaut werden können. Zum Anderen begreift man alle Menschenleichen mehr und mehr als Sondermüll, weil Erd- und vor allem Feuerbestattungen viel Energie verbrauchen und beide Entsorgungsverfahren Kohlendioxid, Dioxin, Quecksilber, Schwermetalle und Mikroplastik freisetzen.
„Die Bestattungspraktiken sind nicht mehr von größeren ökologischen Fragen zu trennen“, schreibt Rodeck. Nachhaltig wäre ein „Recycling“ der menschlichen Überreste. Würde man die Toten irgendwo ablegen, wie die Inuit und die Parsen es tun, könnte ein großer Teil von Raubtieren und Vögeln gefressen werden und der Rest von Bakterien, Würmern und Käfern. Das wäre eine ökologische Wiedergeburt, die naturgemäß von Biologen favorisiert wird. Sie verfügen, dass ihre Leiche nackt und ohne Sarg eingebuddelt wird, denn die Kleinlebewesen suchen und finden sie auch unter der Erde. Daneben gibt es in den immer mehr USA Firmen, die versprechen, den Gestorbenen in einen Baum zu verwandeln, indem sie z.B. seine Asche zusammen mit Baumsamen eingraben. „Der Körper soll Teil der Natur werden,“ sich wieder in den „natürlichen Kreislauf des Lebens“ einfügen, nennt Rodeck das.
Zu den Firmen, die dies erledigen, zählt sie „Bios Urn Environment SL“, „Return Home“, „Coeio“ und „Recompose“. Letztere offeriert eine „Kompostieranlage“, mit der tote Körper „in nur 30 Tagen in fruchtbaren Humus umgewandelt“ werden, wobei sie dieses ihr Kreislaufmodell des Lebens laut Rodeck mit „Glaubensvorstellungen“ (u.a. von Indianerhäuptlingen) quasi philosophisch angereichert haben. Die Firma „Coeio“ bietet einen „Infinity Burial Suit“ an, der mit einem „Biomix“ bestehend aus Bakterien und Pilzmyzelien beschichtet ist. Diese sollen auch die toxischen Stoffe im menschlichen Körper, u.a. 200 giftige Chemikalien, in harmlosere Stoffe umwandeln. Überhaupt erhofft man sich im Anthropozän (und „Coeio“ besonders) viel von den „Infinity Mushrooms“. Dem Tod, meint Rodeck, „kommt damit tatsächlich eine lebensspendende Qualität zu“, was genaugenommen jedoch schon im Moment des Sterbens eintritt, indem dieser Mensch aufhört zu produzieren und zu konsumieren, keine Ressourcen mehr verschwendet, keine Angehörigen, Untergebenen und Tiere mehr quält usw., kurzum: keinen ökologischen Fußabdruck mehr willentlich hinterläßt.
Im Monotheismus wurde einst der Tod herbeigesehnt, um in den Himmel zu kommen, wo das ewiges Leben lockte, im Anthropozän wird von diesen und weiteren US-Bestattungsfirmen mit Hilfe neuerer naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und indigenen Glaubensvorstellungen „ein Gefühl der Verbundenheit allen Lebens, die dem Tod einen Sinn geben kann“, erzeugt. Wem diese Idee als Sterbender nicht genügt, dem kann man in den USA auch noch mit Psychodrogen (LSD und Psilozybin) die „Todesangst“ nehmen. Und „trauern“ muß man um so jemanden auch nicht mehr, denn er lebt ja weiter, wenn auch in schleimigen Pilzen, stinkenden Würmern und Käfern, wobei letztere jedoch früher oder später von schönen bunten Vögeln gefressen werden. Auf diese etwas umständliche, aber natürliche Weise kommt selbst der ungläubigste Amerikaner gelegentlich dem Himmel nahe, wenigstens mit einem Teil seiner Moleküle.
.

.
Klopapier
Die Nazis setzten einst bei den Toiletten die „Flachspüler“ durch. Demgegenüber benutzen die meisten anderen zivilisierten Völker Tiefspüler. Der Naßzellenforscher Guillaume Paoli spricht deswegen bei dieser Form der Entsorgungs-Zwischenlagerung von einem „deutschen Sonderweg zum Gully“, der nur langsam – infolge der Amerikanisierung – verschwindet. Der Klobecken-Hersteller Reuter schreibt über die Vor- und Nachteile: Beim Flachspüler fallen die Exkremente auf Keramik, man kann sie inspizieren, aber es stinkt. Beim Tiefspüler fallen die Exkremente ins Wasser, es kann spritzen, aber es werden Gerüche vermieden.
Die technologische Zukunft besteht hierbei aus einer bei Annäherung an das Becken über einen photolektrischen Mechanismus ausgelösten Wasserspülung, bzw. beim Aufstehen vom Becken: „Das ist eine ’neue Aussage‘ und die Gewißheit, dass es keine Ohnmacht gibt, außer durch Depression,“ meinte dazu der Philosoph J.F.Lyotard, dem diese Klobecken und Urinale, die er das erste Mal auf der Toilette des Fachbereichs Informatik der Universität Aarhus benutzte, sogleich Beweis dafür waren, dass wir in der „Postmoderne“ angekommen sind. Mit den „All-Gender-Toiletten“ verschwinden diese neumodischen Urinale allerdings wieder – aus Schamgründen.
Noch weiter geht eine Wasserspülung bei den Sitztoiletten, die das Toilettenpapier ersetzt, diese Neuheit hat sich aber noch nicht richtig durchgesetzt. Auch die sauteuren Toilettenbecken, deren Sitz mit Plastikfolie bezogen ist, die nach jeder Benutzung automatisch eingezogen und dann wieder „frisch“ bezogen werden, ist nur etwas für paranoische Reiche, die Angst haben, dass sich beim Kacken Keime an ihrem Arsch festsetzen.
Mir war es mehrmals eine große Freude, wenn ich auf der Frankfurter Sanitärmesse den Verkäufern in Schlips und Anzug zusah und –hörte, wie verdruckst sie Interessenten diese Neuheit anpriesen und dafür nach Worten mit nichtanaler Konnotation suchten. In Deutschland ist der Analcharakter dominierend, worauf allein schon die immer noch rigide Sauberkeitserziehung und die vielen daraus später resultierenden Schimpfwörter wie Scheiße, Kacke, Arschloch hinweisen. Die Amis mögen lieber genital orientierte Schimpfwörter. Bei den männlichen Opel-Kadettfahrern bestand lange Zeit die Gewohnheit, auf der Hutablage eine Klopapierrolle für alle Fälle mitzuführen, der von ihrer Frau ein kleiner bunter gehäkelter Hut übergestülpt wurde.
Während der Corona-Pandemie wurde das Klopapier in Deutschland knapp, während es in den Nachbarländern Kondome und Alkoholika waren. Der westdeutsche Klopapierhersteller Hakle verbuchte in der Zeit Rekordumsätze, als der Viruskrieg jedoch vom Ukrainekrieg abgelöst wurde – und die Papierpreise aufgrund des Embargos gegen Russland stiegen, mußte Hakle Insolvenz anmelden. Selten hat eine Konzernpleite so viele Presseberichte erfahren, beim Toilettenpapier geht es den Deutschen an die Substanz. Man durchforstete die Hakle-Geschichte und fand heraus: Der jüdische Kunsthändler Max Stern mußte 1937 seine Gemäldesammlung fürn Appel und n Ei, wie man so sagte, versteigern lassen, u.a. schleppte damals auch der Hakle-Chef Hans Klenk einige Bilder für sein stilles Örtchen ab. 2016 brachte seine Firma ein „Dekor-Toilettenpapier, 3-lagig, EM-Edition, mit Rasenduft“ sowie ein „Toilettenpapier 3-lagig, EM-Edition, 3-fach sicher mit Fußballdekor.“ auf den Markt. Hakles Pressestelle ließ verlauten: „Als sehr bekannte Toilettenpapiermarke bieten wir unseren Kunden Abwechslung, wenn es um Dekor oder Duft rund ums stille Örtchen geht.“ Daran versuchen sich auch immer wieder „Start-Ups“, u.a. Witzesammler und -verkäufer, die Toilettenpapier mit Witzen auf jedem Abschnitt anbieten. Früher oder später gehen ihnen jedoch die Witze aus.
Beim Toilettenpapier gab es einen Ost-West-Unterschied: „Hart, rau und hauchdünn: Das war das Klopapier der DDR. Während es im Osten ein einheitliches graues Krepp-Papier mit nur einer Lage gab, glänzte der Westen seit Mitte der 1980er-Jahre mit dreilagigem Luxuspapier. Nicht selten landete ein solches weiches Luxus-Objekt im Westpaket oder wurde bei Besuchen von der Verwandschaft mitgebracht – wohl nicht zuletzt aus Eigennutz,“ berichtete der MDR.
Bei den Schulpfadfindern mußten wir uns auf Wanderungen kleine Stöckchen zum Arschabwischen suchen, sie waren noch härter als Krepp-Papier oder Zeitungspapier, wie es in meiner Familie noch lange nach dem Krieg benutzt wurde. In einem von Nazifrauen geleiteten Kindererholungsheim auf Borkum bekamen wir zum Scheißen jedesmal nur drei einlagige Klopapier-Abschnitte: Ich habe unter dieser blöden Sparsamkeit gelitten. Jetzt las ich in einem Buch der Extremsportlerin Birgit Lutz, die mehrmals zum Nordpol wanderte und Grönland durchquerte, dass auch in ihrer Gruppe jeder aus Gepäck-Platzgründen nur täglich drei Klopapier-Abschnitte verbrauchen konnte. Als sie unterwegs im Eis eine größere Gruppe traf und einer ihr eine ganze Rolle Toilettenpapier schenkte, war sie vor Freude schier aus dem Häuschen.
P.S.: Louise Erdrich berichtet in ihrem neuen Roman „Jahr der Wunder“, dass auch in Minneapolis und Umgebung das Klopapier während der Corona-Pandemie oft ausverkauft war.
.

.
Stadt Land im Fluß
Laut dem Ökologen Josef Reichholf öffnen sich die Städte der Natur, während sich die Dörfer ihr gegenüber verschließen. Aber was hält man davon: Der französische Bauernrebell José Bové meinte vor einigen Jahren, dass die Ausbildungsstätten für Landwirte geradezu überlaufen sind, weil so viele junge Franzosen Bauern werden wollen. Die Agraruniversität Hohenheim riet ihren Absolventen, die keine Höfe erben würden, sich zusammen zu tun, um gemeinsam einen landwirtschaftlichen Betrieb zu kaufen und zu bewirtschaften.
Wie diese Empfehlung aufgenommen wurde, weiß ich nicht, wohl aber, dass in den deutschen Agrarzeitschriften jede Menge Gesuche stehen von Leuten, die einen Hof suchen, während der schlickige TV-Sender RTL sich bloß für „Bauer sucht Frau“ interessiert. Sicher auch ein Problem, aber das größere sind Versicherungs – und Wohnungsbaukonzerne, Aldi-Erben, holländische Großbauern und internationale Konsortien, die aus spekulativen Gründen gleich tausende Hektar auf einmal u.a. in Brandenburg und Sachsen-Anhalt kaufen: Landgrabbing nennt sich diese Riesensauerei.
Ich erinnere mich noch an einen Fall in den Achtzigerjahren, da wollte ein Lehrer in der Eifel ein paar Weiden für eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft kaufen. Das wurde ihm verweigert, weil er kein Landwirt sei. Er klagte dagegen – verlor aber in jeder Instanz. Der Frankfurter „Informationsdienst für unterbliebene Nachrichten“ fand, dabei werde dreist das uralte „Kochener Landrecht“ praktiziert, dem Lehrer müsse geholfen werden. In Ostdeutschland ist das heute anders, aber noch schlimmer.
Manchmal gelingt es jedoch heute auch Leuten, sich eine Landwirtschaft aufzubauen ohne einen Pfennig Geld. Erwähnt sei Anja Hradetzky und ihr Mann Janusz. Sie besaß nur einen Hütehund und er ein Auto. Er kam von einem polnischen Hof und studierte an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, sie lernte nach dem Abitur Rinderherden-Management in Kanada. Beide waren arbeits- und mitttellos. Sie pachteten vom Nationalpark an der Oder Wiesen, erwarben dafür einen DDR-Weide-Melkstand und mieteten in Stolzenhagen (Wandlitz) eine Wohnung und Ställe. Dann verkauften sie Anteilscheine für ihre zukünftigen Kühe. Es kamen 50.000 Euro zusammen. Davon kauften sie 2015 von süddeutschen Bio-Höfen einen Bullen und 27 Kühe, zwei bekamen auf der neuen Weide sogleich drei Kälber, die bei ihren Müttern blieben. Dann ging das Melken los: die Milch wurde an eine Molkerei verkauft, ein Teil von privat als Rohmilch verkauft und Käse produziert. Zudem trafen sie sich „mit 24 anderen Jungbauern, die entlang der Oder genauso wie wir einen Hof aufbauten“ – und gründeten das „Bündnis Junge Landwirtschaft“.
In ihrem Buch „Wie ich als Cowgirl die Welt bereiste und ohne Land und Geld zur Bio-Bäuerin wurde“ (2019) schreibt Anja Hradetzky: Die meisten in ihrem Bündnis „waren mit Hartz IV gestartet. Oder dem Geld ihrer Eltern.“ Ihr Mann und Kindsvater Janusz steuerte das Motto für ihre Agrikultur bei: „Wochenmarkt statt Weltmarkt“.
Erwähnt sei ferner die bayrische Neubäuerin Maria Rossbauer. Sie lernte erst Hotelfachfrau, studierte dann Neurobiologie und wurde schließlich Journalistin in Hamburg, heiratete und bekam drei Kinder. Sie hat bereits mehrere Bücher geschrieben, das letzte hat den Titel: „Großstadtbäuerin. Mein Vater, sein Land und ich“ (2022). Maria Rossbauer hat noch drei Geschwister, die alle ebenfalls in irgendeiner Stadt leben und arbeiten. Ihre Eltern sind Akademiker, der Vater Landwirt. Als er ihnen mitteilte, dass er seine (viehlose) Landwirtschaft an sie vererben wolle, um sich mit 81 zur Ruhe zu setzen, beschlossen seine vier Kinder, in der Stadt wohnen zu bleiben, aber den Hof gemeinschaftlich als eine GbR zu bewirtschaften, d.h. alle vier Wochen sich auf ihren Äckern und ihrem Wald nützlich zu machen, aber die Hauptarbeit gegen Bezahlung Nachbarn und Verwandten mit ihren modernen Großgeräten zu überlassen.
Vordergründig arbeitet sich die Autorin derweil in die schwierige, auch stark staatlich reglementierte, dafür aber mit Prämien für alles mögliche gesegnete Landwirtschaft ein, sie macht sogar einen „Motorsägen-Kurs“ mit. In ihrem Buch heißt es: „42 Prozent des Einkommens eines Haupterwerblandwirts kommen aus Prämien und Subventionen“. Dafür gibt die EU in den nächsten sieben Jahren 387 Milliarden Euro aus. Nicht nur wer Blumen am Ackerrand sät, bekommt heute eine Finanzhilfe, sondern ebenso, wer Ackerunkräuter in seine Felder einbringt.
Im Hintergrund der Erbengemeinschaft wirkt auch immer noch ihr Vater, der ihnen telefonisch oder per mail erklärt, was als nächstes anliegt und wie das am Besten erledigen ist, denn sein Credo war, „dass man Dinge ‚mit der warmen Hand‘ vererben muß“, also noch munter und nachhaltig sein sollte, wie man heute vielleicht sagen würde, oder mehr segnend als verliebt, wie Nietzsche sich eine Verabschiedung vorstellte. Am Schluß dankt Maria Rossbauer ihrem Vater dafür, „dass du uns allen eine Heimat gegeben hast. Weil das ist nicht das Land. Das bist Du“. Er lächelt dazu auf dem Umschlagfoto mit einer nicht mehr gebrauchten alten Mistgabel in der Hand.
P.S.: Der Ökologe Josef Reichholf veröffentlicht demnächst im „oekom Verlag“ ein Buch über „Stadt Natur“, nach „Fluß Natur“ und „Wald Natur“.
.

.
Das Klimadilemma
2020 driftete die „Polarstern“ des Bremerhavener Instituts für Polar- und Meeresforschung mit Daten sammelnden Menschen aus 20 Ländern um den Pol herum, wobei nach alter sowjetischer Methode Flugzeuge, Hubschrauber und Eisbrecher „eingebunden“ waren und alle drei Monate 100 Wissenschaftler ausgetauscht wurden. Es ging dabei um den anthropogenen Klimawandel, die Forscher verorteten die relevanten Daten dazu jedoch nicht in der kapitalistischen Warenproduktion, sondern in arktischem Wind und Wetter. 140 Millionen Dollar kostete die „Mammutexpedition“, 70 Millionen zahlte die BRD. Um sich nicht lumpen zu lassen, verliehen die Amis der Fotografin des Instituts, die auf der „Polarstern“ mitfuhr, für ein Foto von zwei Eisbären, die an roten Forschungswimpeln schnuppern, den „World Press PhotoAward“. Bei den Amis hat jeder Furz Weltniveau und jeder gentechnische Fortschritt bekommt den Nobelpreis.
2022 machte sich auch das Expeditionsschiff „Cape Race“ des Meeresforschers und „Mare“-Herausgebers Nikolaus Gelpke auf in die Arktis rund um Spitzbergen. Mit an Bord war die Arktisenthusiastin und Journalistin Birgit Lutz, die daraufhin einen „Nachruf auf die Arktis“ veröffentlichte. Obwohl ich die Klimaforschungsstudien nicht mehr lesen kann, weil sie ein ödes Genre bilden – aus Zahlen, Daten und Alarmismen, die intellektuell wenig anspruchsvoll sind, fand ich ihr dickes Buch sehr lesenswert, zumal die Autorin neben vielen Fotos und Fachjargonerklärungen lauter Interviews mit Energieökonomen, Gänse- und Krillforschern, Glaziologen, Klimafolgenforschern, Philosophen und Tiefseeforschern darin aufnahm.
Der Biologe will mit seiner langjährigen Gänseforschung veranschaulichen, „‚wie in einem Ökosystem alles mit allem zusammenhängt“ und dass der „Klimawandel unser größtes Problem ist, er wird das Leben von Milliarden Menschen verändern“. Dann sagt er: „Für lange Zeit liebten die Menschen meine Geschichten. Sie sagten, ach, das ist so schön, dass du immer mit einem positiven Ende aufhörst. Aber jetzt denke ich, ich verliere diese Positivität. Ich kann nicht mehr zuversichtlich sein. Weil wir nichts tun’. (Weint und sagt lange nichts)“
Über weite Strecken des Buches geht es tatsächlich um Optimismus versus Pessimismus. Ersteres brachte Birgit Lutz bereits im Untertitel ihres Buches zum Ausdruck: „Noch können wir die Welt retten“. Ich habe ihre vier Arktisbücher gerne gelesen, sie begann eher sportlich und radikalisierte sich dann immer mehr. Die von ihr interviewten Professoren bleiben jedoch meist staatstragend, indem sie die Politiker mit ihren Daten munitionieren wollen, obwohl sie ständig auch das „Wir“ – also alle, die ganze Weltbevölkerung – im Mund führen. Das hört sich dann von einem Professor für Regenerative Energiesysteme so an: „Wir müssen handeln, d.h. dass wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten müssen und das tun, was die Klimaforschung empfiehlt: die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad, möglichst 1,5 Grad, zu begrenzen.“
Der Schiffseigner Gelpke ist pessimistisch: „Denn um etwas so Großes wie den Klimawandel zu bekämpfen – dafür braucht es ein Wir-Gefühl“. Einige Forscher haben ihre Optimismus vorübergehend aus der von Greta Thunberg angestoßenen Jugendbewegung geschöpft, aber nicht einmal gedanklich kommen diese Naturwissenschaftler darauf, dass das „Wir“ nur heißen kann: Klassenkampf (was laut Rosa Luxemburg Bürgerkrieg meint). Ein solches „Wir“ läßt sich natürlich nicht einpökeln wie Salzherige, aber an die „Politiker“ zu appelieren, die ihre Wähler bei der Stange müssen und ihnen nur sehr begrenzt Verzicht auferlegen dürfen, ist weltfremd. Zumal man doch mit dem Philosophen Hans Blumenberg grundsätzlich bezweifeln darf, „dass aus wissenschaftlichen Mitteilungen für die Wahrnehmung gelernt wird, denn schließlich geht für uns immer noch die Sonne auf und unter“. Und „Wir“ lesen zwar gerne Bücher über den Klimawandel, die Arktis und die Eisbären, sofern wir überhaupt lesen können, aber doch auch tausend andere Bücher, wobei fast 90 Prozent heutzutage Amiromane sind, in denen es meist um sexuell konnotiertes Menscheln geht.
Zur Wirkungslosigkeit des „Wir“ und der „Politik“ gehören laut Birgit Lutz auch und vor allem die jährlich mit Milliarden Dollar finanzierten Lobby-Organisatoren der Mineralölkonzerne und US-Milliardäre, wie z.B. das US-„Heartland Institute“, deren Slogan lautet: „Doubt is our product“. Sie säen (mit gekauften Wissenschaftlern) Zweifel: Ja, sagen sie z.B., die Verschmutzung der Meere mit Plastik ist ein großes Problem, aber die Plastikproduktion zu verbieten, das bringt nichts, wir müssen das Plastik „recyceln“. Und das heißt, dass sie auch noch Recyclingsfirmen gründen und damit doppelt verdienen, während „wir“ uns immer mehr farbige Mülltonen in den Hof stellen müssen. Kurzum: Die Ökonomen haben die Welt soweit verändert, dass die Philosophen sie nicht mehr interpretieren können. Und darunter leidet die ganze Arktisforschung, und nicht nur sie.
.

.

.
„Magister Schivelbusch“ (so nannte ihn Peter Hacks)
In dem Nachruf der Jungen Welt auf den Kulturhistoriker Wolfgang Schivelbusch wurden bereits einige seiner Arbeiten erwähnt. Für mich war sein Buch „Die Kultur der Niederlage“ (2001) wichtig. Es geht darin um den amerikanischen Süden 1865, um Frankreich 1871 und Deutschland 1918. Mit keinem Wort wird die jüngste deutsche Niederlage der sozialistischen DDR erwähnt und doch ist sie darin ständig anwesend.
Man hat schon oft auf die Ähnlichkeit zwischen der Plantagensklaven-Ökonomie der Südstaaten und der ostelbischen Junkerherrschaft hingewiesen, aber nicht, dass nach der Niederlage der DDR und der Zerstörung ihrer ökonomischen Grundlagen, diese wie der US-Süden einem umfangreichen „reconstruction-“ und „reeducation“-Programm unterworfen wurde, von dem vor allem die Kriegsgewinnler aus dem Westen (Norden) profitierten. „Sie müssen lernen, sich besser zu verkaufen,“ lehrten sie z.B. den „Umschülern“ – weswegen die Kultur der Ostler bzw. Südstaatler trotzig fortbestand.
Und so flattert die Fahne der Konföderierten heute an vielen märkischen Vorwerken. Im Film „Ausfahrt Ost“ porträtierten zwei BRD-Filmerinnen arbeitslose Ostler in der Trucker-Raststätte „Hungriger Wolf“ bei Magdeburg, die sich als rebellische Südstaatler begreifen. Und so wenig wie damals der Süden die Sklaverei bereute, will sich heute ein Großteil der DDRler vom Sozialismus distanzieren. Auch die Verlaufsformen nach der Niederlage ähneln sich: Zunächst dominierten die (ritterlichen) Jointventures, dann ging es nur noch um „Abwicklung“ und strengstes Wirtschaftsregiment. Dazwischen seufzte z.B. ein Treuhand-Manager auf einem Betriebsrätekongress in Ostberlin: „Ich muß unbedingt mal wieder Ostweiber beschlafen“. Auch der Ku-Klux-Klan begann einst als eine „Institution der Ritterlichkeit und Menschlichkeit“.
Derweil versank der Süden in Armut. Der Staat Mississippi gab ein Fünftel seines Nachkriegshaushaltes für Prothesen für Schwerbehinderte aus, auch die Hoffnung auf frische, arbeitswillige Einwanderer zerschlug sich bald: Allein „New Jersey nahm doppelt so viele auf wie der gesamte Süden“, schreibt Schivelbusch. Bald sprachen die ersten neuen Meinungsführer des Südens jedoch von einem „New South“. Auch solche Sprüche kennt man zuhauf von den führenden Mutmachern im Osten. Einer von diesen im Süden, Grady, behauptete: „In den Wäldern zwischen Virginia und Texas tummeln sich die Kapitalisten aus Neuengland auf der Jagd nach Investitionsobjekten; man kann kaum einen Schuss abgeben, ohne einen von ihnen zu treffen.“ Die Reisejournalisten aus dem Norden waren dagegen eher entsetzt über „die Ruinenlandschaft der Städte und Plantagen“.
All das kennt man aus der DDR als diese verschwand und immer mehr Westler über die leergeräumten Ost-Immobilien herfielen. Auch dass dann immer mehr Yankees den Charme der Beautiful Loser im Süden entdeckten – und ein ganz neues Beziehungsdrama-Genre (bis hin zu „Vom Winde verweht“) entstand – hat seine heutigen Parallelen: u.a. Botho Strauß in der Uckermark und die ganzen Adligen, die sich in alte märkische Schlösser krallen, mit Musikabenden am Kamin von Dresdner Quartetten dargeboten. „Der Süden wurde für diese alternden Piraten so etwas wie eine späte Leidenschaft, an die sie ihre Reichtümer verschwendeten“, schreibt C. Vann Woodward. Hier und heute gestehen die Ost-Edelimmobilienbesitzer aus dem Westen der FAZ, dass sie ihr ganzes Vermögen in die Sanierung stecken und auch schon acht Platanen an der Auffahrt neu gepflanzt hätten.
Dies alles führte dazu, dass man die Vergangenheit nostalgisch verklärte. So wie ein Mitarbeiter des Deutschen Historischen Museums rückblickend meinte: Gegenüber dem neuen Direktor Stölzl war „unser Chef doch der reinste Menschenfreund“, wurde bereits in „Onkel Toms Hütte“ der gute, willensschwache alte Plantagenbesitzer dem aus dem Norden zugewanderten sklavenschindenden Bösewicht entgegengesetzt. Aber, „was vor der Niederlage Macht, Substanz, Überzeugung, Religion war, wird für den Sieger nun Ornament, Spiel, Unterhaltung“ (Schivelbusch). Die „Eskapismusindustrie“ (á la MDR) blühte. Kurzum: Es wurde immer übler und ökonomischer. In der Idiotenzeitung für den Ostler „Super“ Titelte der spätere Bild-Kolumnist Franz-Josef Wagner: „Angeber-Wessi mit Bierflasche erschlagen. Ganz Bernau ist glücklich.“
2000 heißt es in einer Reportage des „Freitag“ über das Mansfelder Land: „Noch nie in der 800-jährigen Bergbaugeschichte war das Gebiet so tot wie heute. Junge Leute verlassen die Stadt, gehen über den Harz in den anderen Teil Deutschlands. In manchen Monaten beträgt die Arbeitslosigkeit bis zu 50 Prozent.“
2005 schickte dagegen die ARD ihren altgedienten Reporter Fritz Pleitgen in die Region, um „Erfolgsgeschichten“ aufzuspüren: Da „baut ein Winzer auf einer Braunkohlenhalde ertragreich Wein an,“ und dort „die Nonnen des Zisterzienser-Ordens im Kloster Helfta, die in Luthers Eisleben für ein Comeback der Katholischen Kirche gesorgt haben“.
Ich interviewte 2010 die im Kampf gegen die Abwicklung der Kaligrube in Bischofferode engagierte evangelische Pastorin Christien Haas: „Es ist eine deprimierende Situation,“ meinte sie, und „daß jetzt nach der Niederlage so viel rückwärtsgewandtes Zeug im Eichsfeld passiert: Schützenvereinsgründungen, Traditionsumzüge und sogar Fahnenweihen…“ Kann es sein, dass die „Kultur der Niederlage“ massenhaft rassistische Reaktionäre gebiert?
.

Zwei Fliegen mit einer Klappe
.
Viagra
In den 80er Jahren trafen sich im Rahmen von »Citizen Diplomacy« US-amerikanische und sowjetische Jugendliche in Moskau und diskutierten ihre Vorurteile, moderiert von einem US-Lehrer und einer Sowjetpädagogin. Als einer der amerikanischen Jugendlichen von den sowjetischen Jugendlichen wissen wollte, wie sie es mit dem Sex halten würden, antwortete die Pädagogin: »In der Sowjetunion gibt es keinen Sex!« Großes Gelächter auf beiden Seiten, aber die Frau hatte recht: Sex ist eine US-Erfindung, die in den USA nicht nur in bald jedem Formular abgefragt wird (als Frage nach dem Geschlecht), sondern auch für besonders geistloses Ineinander- und Auseinanderschieben der Geschlechtswerkzeuge steht. Nicht, dass es keinen Spaß macht, aber es ist viel zu einfach. Früher hätte man gesagt: zu entfremdet oder zu egomanisch. Sex hat man mit Prostituierten oder bei prostitutionsähnlichen Zusammentreffen, die womöglich noch mit brust- und lippenvergrößernden Maßnahmen sowie mit Reizwäsche, Viagra, Alkohol oder Kokain »angefeuert« werden. Die israelische Soziologin Eva Illouz hat sich in mehreren Büchern über diese Formen des »Aufgeilens« ausgelassen, sie heißen u. a. »Gefühle in Zeiten des Kapitalismus«, »Der Konsum der Romantik«, »Wa(h re Gefühle«.
Seit etwa einem Jahr bekomme ich täglich ein oder zwei Angebote gemailt – für PDE-5-Hemmer, eine Gruppe gefäßerweiternder Substanzen. Der ursprünglich als Blutdrucksenker vom US-Konzern Pfizer erforschte Wirkstoff Sildenafil löste unter dem Namen Viagra »eine zweite sexuelle Revolution aus«, meinte der NDR Info vor knapp einem Jahr. Ich würde eher meinen: Viagra hat die erste sexuelle Revolution, die mit der Antibabypille und der antiautoritären Bewegung begann, in schlechten Konsum verwandelt.
Bei den mir gemailten Angeboten, die mir die fiktiven Alice Schwarzer, Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Günter Grass oder Lolita schickten, handelt es sich um rezeptfreie Viagra-Ersatzpillen, die mir mit extrem dummen, sexistischen Sprüchen verkauft werden sollen.
Auf der Internetplattform docplayer.org heißt es: »Der Vertrieb illegaler Arzneimittel über das Internet und damit die Gefährdung der öffentlichen Gesundheit wächst laufend. Heute sind mehr als 95 Prozent der im Internet vertriebenen Arzneien Fälschungen oder Substandard. Der Internethandel mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln ist in Österreich verboten. So betraf ein Großteil der Fälschungen, die beispielsweise 2008 analysiert wurden, vor allem: PDE-5-Inhibitoren Viagra und andere Erektionshilfen. Davon wies mehr als die Hälfte Gesundheitsrisiken für den Konsumenten auf.«
Ich selbst komme gar nicht erst in Versuchung, Viagra oder eines der Ersatzmittel zu kaufen, weil ich weder die für Onlinegeschäfte notwendigen Bankkarten besitze noch eine Krankenversicherung, um für ein Rezept zum Arzt gehen zu können. Wichtiger noch: Erektions- oder Potenzprobleme sind für mich Beziehungsprobleme und keine, die man chemisch lösen sollte. Aber natürlich, wenn man auf dumpfes Rein-Raus-Rammeln steht und das irgendwann nicht mehr »funktioniert«, dann helfen vermutlich nur gefäßerweiternde Substanzen von Pharmakonzernen, Kurpfuschern oder kriminellen Startups.
Deren Mails lesen sich dann z. B. so: »hoege suesse Maedchen zureiten (…) da wird man richtig depressiv, wenn ploetzlich die Steh- und Manneskraft fehlt und man nichts dagegen unternehmen konnte, so wie es frueher der Fall war. Das ist gluecklicherweise endlich anders, denn Probleme mit dem ›hart‹ werden sind mit moderner Medizin fuer den Mann rasch und ausgezeichnet zu beheben! Auch der vorzeitige Hoehepunkt wird ab sofort durch moderne Praeparate sicher vorgebeugt. Also endlich wieder ein Sexualleben auf das Sie sich freuen koennen, ohne andauernd daran zu denken, dass Sie wieder einmal viel zu frueh gekommen sind. Einfach unglaublich, dass man dafuer noch so viel bezahlt obwohl es bei uns, inkl. kostenloser Lieferung direkt nach Hause, immer noch guenstiger ist?«
P.S.: „Vögeln war gestern“, sagt Dietlinde und meint damit Kopulationstechniken.
.

.
Viagra-Komödien
Ich bekomme ständig Werbemails für „Hive – der selbsttragende Hängemattenständer für zwei Personen“, wobei ich nicht weiß, ob das nicht auch wieder irgendwas mit „Sex“ zu tun hat. Aber egal. In der „Zeitschrift für Psychoanalyse ‚Riss‘“ (Nr. 95) findet sich ein Beitrag der Professorin an der Berliner Internationalen Psychoanalyse Universität (IPU) Insa Härtel über „Biochemische Impotenzlösungskompetenz? Filmische Viagra-(Un)-Fälle“. Die Amis haben nämlich inzwischen schon die ersten wahnsinnig lustigen Filme über die „blaue Pille für den Mann“ gedreht, die es nun hierzulande ernsthaft psychoanalytisch auszudeuten gilt. Eine Aufgabe, der sich Insa Härtel gerne gewidmet hat, denn die Psychoanalyse ist ja eine „Sexualtheorie“, was bereits Lenin laut seiner Frau bemängelt hat, desungeachter wurde sie mit Trotzki und Joffe kurzzeitig fast eine Staatswissenschaft.
Inzwischen ist sie zwar selbst hierzulande etwas außer Konjunktur geraten, dafür ist Viagra so etwas wie eine Staatspille geworden. Es gibt wohl kaum noch eine Politikergruppe, die ins Ausland reist, ohne Viagra im Gepäck. Vorbilder waren diesbezüglich die Ausflüge des VW-Betriebsrats und einiger VW-Manager zu Prostituierten in Tschechien, Spanien, Mexiko und Brasilien für 2,7 Millionen Euro und der Ausflug von Managern der Hamburg-Mannheimer Versicherung zu Budapester Prostituierten für 83.000 Euro. In beiden Fällen zahlte der Arbeitgeber ihre Viagra-Rationen. Bei den demokratischen Kräften kommt wahrscheinlich der Steuerzahler dafür auf.
In dem Film „Austin Powers in Goldmember“ (2002) hat eine der Hauptfiguren, Nigel, einen „Viagra-Unfall“: Ihm ist eine Pille im Hals stecken geblieben und dadurch kommt es zur „Sexualisierung des steifen Halses“, schreibt Ilsa Härtel. „Bedingung für das Gelingen des Scherzes sind das Schillern des ‚Steifen‘“. Der Scherz ist eine Replik auf den profitabelsten Porno aller Zeiten, den es sogar auf Plattdeutsch gibt: „Deep Throat“ (1972), in dem die Hauptfigur Linda Lovelace ihre Klitoris im Hals hat und dort gar nicht oft genug zum Orgasmus kommen kann. In ihrer Autobiographie schrieb sie 1980, dass ihr Ehemann und Zuhälter sie zu dem „tiefen Fellatio“ gezwungen habe.
Eine Sorte Film – „alternde Männer, die erstaunliche körperliche Höchstleistungen vollführen“ – wurde laut Ilsa Härtel „Viagra Cinema“ genannt. In dem Film „Love & Other Drugs“ (2010) geht es um einen Pharmavertreter, Jamie, der diese Pillen verkauft. Bei einer „Pyjama-Party“ verabreicht eine Frau ihm „eine geballte Dosis Viagra“. Am Morgen erwacht er mit einem „schmerzhaften Riesenpenis“, worauf er seinen Bruder bittet, ihn ohne dumme Witze zu reißen ins Krankenhaus zu fahren. Nur die Kinobesucher sollen darüber lachen. Härtel schreibt: „In dieser Sequenz beschwört das angeschwollene Organ noch einmal das Mysterium des glorifizierten Penis – und gibt diesen zugleich einer aufgeblasenen Lächerlichkeit preis.“
Auch hierzu gab es zuvor einige frauenverlächerlichende Pornos mit Blondinen-Dialogen wie „Rauchst Du auch immer nach den Vögeln?“ „Ich hab noch nie nachgekuckt,“ aber Härtel kommt auf den Psychoanalytiker Sandor Ferenczi zu sprechen, der die Erektion als „unvollständig gelingende Loslösungstendenz des mit Unlustqualitäten beladenen Genitals vom übrigen Körper“ bezeichnete. Die Autorin meint, dass die im US-Film „biochemisch bis an den Rand überspannte ‚Autonomietendenz‘“ für Ferenczi „auf Organe von Tieren beziehbar“ ist, die ihren Penis „vom übrigen Körper“ loslösen.
Es gibt mehrere Tierarten, die das tun, Schnecken z.B., die sich als Hermaphroditen zunächst einigen müssen, wer Weibchen und wer Männchen ist, bevor das eine Tier seinen „Liebespfeil“ lanzenartig in den Fuß des anderen stößt. Noch losgelöster ist das Sexualorgan bei den männlichen Kraken: Diese senden ihren „umgestalteten Begattungsarm auf große Reise durch das Meer. Der Tentakel findet selbstständig den Weg zur weiblichen Krake und in ihr Geschlechtsorgan, die Mantelhöhle. Dort legt er das Samenpaket ab,“ heißt es auf „focus.de“. Dazu muß man wissen, dass Kraken Teile des Gehirns in ihre Tentakeln quasi ausgelagert haben. Sie besitzen damit einen denkenden Penis, der sich nicht so leicht verirrt. Härtel zitiert die Philosophin Alenka Zupancic, die von einem „abkoppelbaren Genießen“ spricht.
Das Gegenteil ist in einer US-Komödie auch möglich – mittels Viagra: „Sex on demand“ um sich das Genießen zu verkneifen. In „Little Fockers“ (2010) hat Jacks Frau im Gegensatz zu ihm Lust auf „Sex“, er schluckt daraufhin das Potenzmittel und bekommt eine „Erektion mittels pharmazeutischer Hilfe, um sich das Verlangen nach Geschlechtsverkehr in gewisser Weise vom Leibe zu halten,“ schreibt Ilsa Härtel. Abschließend meint sie, dass auch ihr Artikel über diese Viagra-Unlustfilme „von dem Versuch getragen“ ist, „das erregt Peinliche nicht nur zu genießen, sondern autotomisch [das Abwerfen von Körperteilen bei Bedrohung] ebenso dringend wieder loszuwerden – sei es in Gestalt des Films, der biochemischen Erfindung oder der Theorie“.
.

Die „Baywatch“-Schauspielerin Pamela Anderson schreibt in ihrer Autobiographie: „Meine Brüste hatten eine fabelhafte Karriere, ich bin einfach immer nur mitgetrottet.“
Ihr Lookalike Ina Werner aus Friedrichshain, die eine Weile in der Harald-Schmidt-Show mitmachte, erzählte in einem „Spiegel“-Interview, wie es ist, ein „Busenwunder“ zu sein.
„Die Sphäre der Sexualität ist kaum noch von der Sphäre der Produktion zu unterscheiden,“ heißt es in dem Essay „Was ist sexuelles Kapital?“ der israelischen Soziologinnen Eva Illouz und Dana Kaplan.

.
Animiert
Man kennt inzwischen die japanischen Manga-Comics, als Film „Anime“ genannt, die mit ihren „Merchandising“-Produkten ganze Hallen auf der Leipziger Buchmesse füllen. Wer sich als Comic-Figur, als „Cosplayer“ kostümiert, hat auf der Messe freien Eintritt. Es gibt aber dezidierte Anweisungen, wie lang z.B. ein Schwert sein darf, aus welchem Material usw.. Die jungen Mädchen in den japanischen Comics haben alle riesige Brüste und sind meist mit Bikinis und kleinen Manga-Accessoires bekleidet. Auf Facebook kann man sich solche „tollen asiatischen Mädchen“ auch per Mausclick konstruieren – aus verschiedenen Gesichtern, Körpern und Beinen.
Es gibt diese Comicmädchen auch als Anime-Pornos (in 2D und 3D), wobei die übergroßen Penisse entweder Monstern oder afrikanischen bzw. afroamerikanischen Männern gehören, wenn es sich um Jungs handelt sind es oft Weiße und sie sind eher lieblos gezeichnet. Bei den Penissen und dementsprechend bei den Präservativen gibt es drei Größen: kleine für Asiaten, mittelgrosse für Weiße und grosse für Schwarze. Logischerweise reicht weissen Amerikanern oft das „mittelgroß“ nicht, weswegen einige ihren Penis künstlich vergrößern lassen. So eine Operation kostet rund 15.000 Dollar, wie es in einem langen Artikel des „New Yorker“ (vom 3. Juli 2023) mit dem Titel „Inside the Penis-Enlargement Industry“ heißt. Darin geht es vor allem um den Urologen Elist in Beverly Hills, den man auch den „Thomas Edison of penis surgery“ nennt. Er offeriert seinen Patienten (oft aus der Schwulen-Scene kommend) „Large, Extra Large“ und „Extra Extra Large“ Penisse. Daneben geht es um einen seiner Patienten, Mick. Außerdem wird auch noch der Urologe Ed Zimmerman aus Las Vegas erwähnt, der bekannt war für seine „HapPenis injections“ und sich seit 2021 als „TikTok’s ‚DickDoc'“ bezeichnet. Aus dem Artikel im „New Yorker“ geht hervor, dass die mit verlängertem Penis herumlaufenden US-Männer in der Mehrzahl seelisch und körperlich schwer daran leiden, die Autorin sprach jedoch auch mit neun Männern, die damit zufrieden sind. Der Urologe Elist ist auch optimistisch, dass seine chirurgische Penisverlängerungsmethode bald weltweit akzeptiert wird. Der Andrang in seiner Praxis ist jedenfalls enorm. Der Artikel endet mit einem seiner Patienten, Kevin. Er erzählte der Autorin, dass er fünf Mal bei Elist unterm Messer lag und u.a. zwei „upgrades“, eine „revision“ und ein „removal“ bekam, aber „sein Penis funktioniert noch immer nicht“.
Zurück zu den Manga-Mädchen: Ihre stets riesigen Brüste (manche groß wie Melonen) deuten zum Einen daraufhin, dass die postpubertären „Zeichner“ extrem oral fixiert sein müssen und zum Anderen, dass diese Manga-Mädchen Role-Models sind, was in Japan, China, Singapur, Thailand, Vietnam und Südkorea dazu führt, dass viele Teenager davon derart beeindruckt sind, dass sie sich ihre Brüste vergrößern lassen wollen. In Südkorea werden weltweit die meisten Schönheitsoperationen durchgeführt. Ohnehin gibt es in diesen asiatischen Ländern eine große Zustimmung zu Schönheitsoperationen. Leider fühlen sich die auf diese Weise aufgepumpten Brüste anschließend wie mit Fahrradschläuchen überzogene Halbkugeln aus Hartgummi an, also scheußlich. Aber man soll sie auch nicht berühren, denn es ist für ihre Trägerin nicht (mehr) angenehm. Sie sollen bewundert werden.
Auf dem chinesischen „tik tok“-Kanal treten solche Mangamädchen nun real in Erscheinung – im Großstadtgetümmel spazieren gehend, wie auf einem „Catwalk“, von allen Seiten angestaunt und photographiert. „Are they real?“ heißt diese Parade auffälliger junger chinesischer Frauen aus Singapur und China. Die Frage stellt sich wirklich, denn diese dünnen langbeinigen Teenager in engen Kleidern haben auch alle riesige Brüste und eine Wespentaille. Es sind lebendige Mangamädchen – ihr Lächeln wirkt manchmal sogar noch echter als das von den in 3D gefakten und manche tragen Manga-Kostümteile.
.

Unecht

Echt

Lebensecht (Silikon-Puppe)
In Berlin gibt es ein „Cybrothel“ – wo „Sex of the Future“ geboten wird. Für 350 Euro kann man sich dort eine Nacht lang mit einer von elf Silikon-Puppen „vergnügen“, und sich dabei von einem Pornofilm anregen lassen. Auf Wunsch liegen Kondome parat. „Alle Puppen sprechen fließend Deutsch und Englisch.“ Paare sind willkommen. Durch den „Buchungsprozess“ führt „Kokeshi“ – eine „analoge KI“: Sie ist „eine authentische Persönlichkeit und du kannst interaktiv mit ihr spielen.“ Demnächst gibt es aber auch „kokeshi.ai“.
.
Ich erinnere ein Interview mit der Berliner Künstleragentur von Frau Fieting in den Neunzigern, die vor allem Doppelgänger, „Look-Alikes“ managte. Im Neuköllner-Monster Hotel von Eduard Strelinsky („Estrel“) finden regelmäßig „Look-Alike“-Contest statt. Über ihre „Pamela Anderson“-Doppelgängerin erzählte Frau Fieting, dass die ihre Authentizität auch dadurch erreiche, dass sie stets mit einer Fantruppe erscheine: „Die rennen ihr bei Dreharbeiten bis aufs Mädchenklo nach. Außerdem hat sie die selben Hobbys wie die wahre Pamela. Unlängst war sie ganz verzweifelt, weil sich in Hollywood alle Frauen ihre Brüste vergrößern ließen und sie das eigentlich nicht wollte.“ Rosemarie Fieting bestärkte sie darin: „Du wirst Dir doch Deinen schönen Busen nicht kaputt machen“. In den „Reels“ von Facebook zeigen sich jene im Bikini, die sich eine solche Vergrößerung zwecks Attraktivitätssteigerung geleistet haben.
Für den kleinen Geldbeutel tut es neuerdings auch das Aufblasen der Lippen, wenn man die zunehmende Zahl von Frauen mit dicken Lippen (mit „Entenschnabel“) für einen Trend hält. Mit Revolax aufgespritzte Lippen kosten zwischen 120 („Normale Technik“) und 200 Euro („Russian Lips“, „Davinci Lips“).
Vorausgegangen ist dem die Mode der „tattos“ und der „tatto“-Künstler, deren Preise nach oben keine Grenze haben. Hinzu kamen dann noch immer mehr Piercing-Möglichkeiten. Neuerdings wird in U-Bahnen für die Entfernung von „tattos“ geworben, was auch nicht billig ist.
Ebenfalls in den Neunzigerjahren hörte ich eine Abiturientin rufen, als ihre Mutter aus dem Bad kam: „Iih, Mutti ist ja behaart!“ Da war also schon das Schamhaar-Entfernungs-Muß bis zu den Teenagern in Unna durchgedrungen. Auch wenn einer sich tatoolos zeigt, bekommt er zu hören „Was! du hast kein tatoo?!“ Eine Bekannte überraschte ihren Freund zu seinem Geburtstag mit einer tätowierten Rose auf dem Hintern.
Diese Moden und ähnliche entstehen aus einer nachahmenden Distinktion. Für den Soziologen Gabriel Tarde war die Nachahmung, das, was die Gesellschaft zusammen hält. Mimikry! Man erforscht sie zumeist bei den Tieren: Wenn z.B. ein ungefährliches Tier sich im Aussehen und Verhalten einem gefährlichen anähnelt. Wikipedia nennt die „Mimesis“ Nachahmung, was im Griechischen einst „mittels einer Geste eine Wirkung erzielen“ bedeutete. Als Mimesis bezeichnet man in den Künsten das Prinzip der Nachahmung im Sinne der Poetik von Aristoteles, im Unterschied zur ‚imitati‘“.
.
Entweder projiziert der juvenile Mangafan seine Wunschbilder auf reale Personen:

.
Oder das Leben ahmt in der juvenilen Manga-Scene die pubertäre Kunst nach:

.
Später werden dann amerikanische Schauspieler nachgeahmt:

Während die Literaturforschung von einem „Iconic“ bzw. „Visual Turn“ spricht, bezeichnet der Sozialphilosoph Ulrich Sonnemann die Bildsucht als „Okulartyrannis“. Dieser Begriff trifft sich mit den Dokumentar-Analysen des boomenden Fortbildungs- und Umschulungssektors, die der Filmemacher Harun Farocki seit der Wende gemacht hat. In den vor allem im Osten entstandenen Bildungszentren wird den Arbeitslosen u.a. beigebracht, wie man sich richtig bewirbt, d.h. besser verkauft. Es sind videogestützte Auftritts-Schulungen, in denen das wirkliche (d.h. das neue westliche) Leben geübt werden soll – für eine Gesellschaft, die laut Farocki „vollständig auf ihr Abbild hin organisiert ist“.
.

„Ohne genau zu wissen warum, interessierte ich mich seit einigen Wochen intensiv für Brüste. Selbst meine bescheidenen Malkünste reichten aus, um mich scharf zu machen. Zwei in zwei Sekunden gezeichnete pralle Beutel mit jeweils einem dunkel gekrickelten Kügelchen erregten mich maßlos. Ich war süchtig nach dieser hochwirksamen, äußerst primitiven Höhlenmalerei und zeichnete das zum Symbol kondensierte Brustpaar in alle meine Hefte auf der letzten Seite. Aber natürlich durfte es da nicht bleiben, mußte vielmehr nach kurzer Betrachtung zu einem unverfänglichen Bild umgestaltet werden. Doch auch da blieben meine zeichnerischen Fähigkeiten weit hinter der Vielfalt meiner Einfälle zurück. Ich gab mir Mühe, das Brüstepaar, das sich in dieser Schlichtheit auch Knackis gerne mit einer Nadel auf den Handrücken tätowieren, bis zur Unkenntlichkeit abzuwandeln. Brüste als Schlappohren von Hunden, als florales Ornament, als Wolken, als Gesicht unter doppelt geschwungener Frisur. Doch sosehr ich sie auch in Motiven versteckte, ich sah sie, es blieben Brüste. Es war unmöglich, ihren sexuellen Schlüsselreiz auf mich auszulöschen. Gerne zeichnete ich zu einem ersten Brustpaar ein zweites größeres dazu und dann noch ein weiteres, wiederum pralleres. Ich zeichnete mich hinein in ein Paradies der Riesenbrüste, und die Größenrelationen befeuerten meine gierige Vorstellungskraft. Wäre ich Michelangelo gewesen, ich hätte das Gewölbe der Sixtinischen Kapelle mit Hunderten Brüsten verziert. In allen Größen und Formen hätte ich sie mir in den Himmel aus Stein gehängt, um darunter zu lustwandeln.“ (Joachim Meyerhoff: „Die Zweisamkeit der Einzelgänger“, Köln 2019)
.
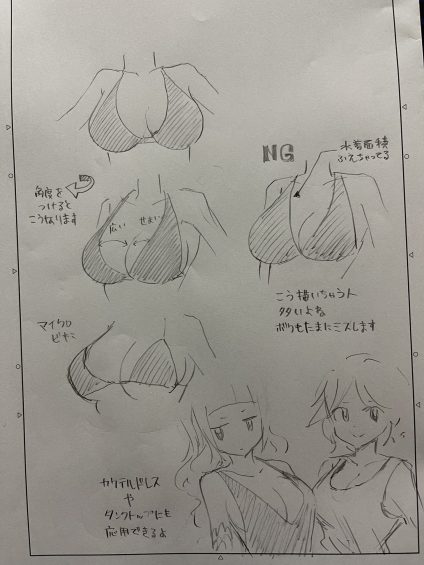
„Dass ‚Fairy Tail‘-Autor Hiro Mashima ein Fan von gezeichneten Brüsten ist, lässt sich in seinen Werken nur schwer übersehen. Damit auch andere Zeichner diese Körperteile ordentlich darstellen können, veröffentlichte der Mangazeichner nun eine Hilfestellung auf seinem Twitter-Account. Anlässlich des ‚Oppai no Hi‘ (‚Busen-Tag‘) am 1. August wollte Mashima einige Anfänger dabei unterstützen, ihre Zeichenkünste zu verbessern.“ (anime2you.de“)
„Ein Aspekt von weiblichen One Piece Charakteren ist tatsächliche die große Oberweite. Nun wollten zwei 10-jährige Fans dem ganzen auf den Grund gehen und haben Eiichiro Oda gefragt, wieso er die Charaktere mit großen Oberweiten zeichnet. So hieß es in der Frage:
„Wir haben festgestellt, dass Robin riesige Brüste hat. Wir haben es dann von der Seite betrachtet, und Nami hat auch riesige Brüste. Warum haben sie beide so große Brüste? Und könnte es eine Vorliebe von Oda-san sein? Das war eine Frage von uns beiden 10-Jährigen. P.N. Sakucchan & Yuzu-chan“. Darauf antwortete Eiichiro Oda: „Ich sage das immer wieder, aber ich erwecke nur die Träume der Jungen zum Leben!“ (phanimenal.de)
.
Das „Prinzip der Nachahmung“ gilt auch bei den „Look-Alike-Contests“ im Hotel Estrel. Mich interessierte daran zunächst, dass es ein Medienphänomen ist, d.h. die Doppelgänger entstehen wesentlich über die Medienpräsenz der Originale. Seien es die Queen, Clinton, Einstein oder Freddy Mercury. Und natürlich Marilyn Monroe. Eine ihrer Doppelgängerinnen hat sich sogar so wie ihr Vorbild umgebracht. Wenn ihr Vorbild stirbt, müssen ihre Doppelgänger viel Geld für Schönheitsoperationen ausgeben, damit sie so bleiben wie ihr „Star“ war. Eine Zeitlang liebäugelten wir mit der Erklärung dieses psychosozialen Phänomens der Nachahmung, die von dem englischen Botaniker Rupert Sheldrake stammt, der ebenfalls eine Medientheorie dazu entwarf, an der er seit 40 Jahren feilt. Seine „morphogenetische Theorie“ geht von einem „Feld“ aus, das via „morphogenetische Resonanz“ dem Leben Form und Farbe gibt. Es ist eine antigenetische Theorie, die eher eine (esoterische?) Art von Bio-Funkwellen favorisiert. „Are they real?“ fragte ich mich. Desungeachtet: Wenn man einmal auf die „Nachahmung“, auf „Mimikry und „Mimesis“stößt, dann sieht man sie überall am Werk. Bei den Haarfrisuren, den getrimmten Bärten, beim Parfum, den Hochzeitsfeiern und Beerdigungsabläufen. Manchmal kann man sogar sagen, wann dieses oder jenes Detail in Mode oder aus der Mode gekommen ist und bei welcher diese oder jener „stehengeblieben“ ist, auch intellektuell.
.

2D und 3D
.
Mimikry/Mimese (1)
Für den französischen Soziologen Gabriel Tarde war wie erwähnt die „Nachahmung“ alles – in der Gesellschaft. Er definierte gar die Gesellschaft „als eine Gruppe von Wesen, die sich gegenseitig momentan nachahmen“.
Für die holländische Philosophin Eva Meijer „unterstreicht Mimikry die Verbundenheit: Indem sie einander nachahmen, verstehen sich Menschen besser.“ Als Beispiel erwähnt sie (in:„Die Sprachen der Tiere“ 2018) u.a. das Sich-Ähnlich-Werden von Herr und Hund, „obwohl die Formen von Gesicht und Körper unterschiedlicher kaum sein könnten“.
Holländische Biologen beobachteten in Zimbabwe, dass die Schimpansin Julie 2007 anfing, mit einem Grashalm hinterm Ohr herumzulaufen, woraufhin es ihr immer mehr Schimpansen in ihrer unmittelbaren Umgebung und dann auch darüberhinaus nachtaten. Laut Eva Meijer war dies „das erste nachweisliche Beispiel einer Mode“ bei Tieren. Als Julie 2013 starb, ebbte sie ab, einige Schimpansen hängen ihr aber noch immer an.
Bei Julie handelte es sich um einen typischen „style-leader“, vergleichbar etwa dem Fernsehstar Sue Ellen aus der Fernsehserie „Dallas“, deren Frisur von Zigmillionen Frauen nachgeahmt (kopiert) wurde: eine fast globale Mimikry.
„Bis heute war Sue Ellen die interessanteste Figur im Fernsehen der 80er Jahre. Viele Menschen haben sich mit ihr identifizieren können,“ schreibt das Münchner Mimikry-Journal „Die Bunte“, das wesentlich mit dazu beitrug, die „Sue Ellen“-Frisur auch hierzulande durchzusetzen.
Heute ist es die Schauspielerin Scarlett Johansson. Mit ihr passiert jedoch etwas anderes: Sie spielt die Hauptrolle in der Realverfilmung der japanischen Manga-Story „Ghost in the Shell“. Computer-Effekte sollen sie etwas japanischer aussehen lassen, damit die zigmillionen Manga-Fans in Asien nicht allzu sehr enttäuscht sind, denn auch in den Nebenrollen wurden nicht viele Asiaten untergebracht. Die Original-Story von Masamune Shirow aus dem Jahr 1989 wurde schon in Anime-Filmen und Serien erzählt und als Videospiel verbreitet. Umgekehrt wurde auch Scarlett Johansson schon in zig Manga- und Hentai(Porno)-Stories (in 2D und 3D) kopiert, nicht nur in den japanischen, sondern auch in den koreanischen und chinesischen Mangas bzw. Hentais:
.



„Weil gängige künstliche Intelligenzen mit riesigen öffentlich verfügbaren Datensätzen trainiert werden, werden die Fälschungen besser und akkurater, je prominenter eine Person ist,“ schreibt der „Spiegel“. „In der Geschichte neuer Technologien war es oft die Erotikindustrie, die am schnellsten auf Innovationen aufsprang. Ob 3D-Videos, 4K-Auflösung oder virtuelle Realität: Immer verstanden Pornoproduzenten am besten, wie sich Illusionskunst zur maximalen Befriedigung einsetzen läßt. Sogenannte Deepfakes sind in wenige Monaten zur heißesten Ware der Onlinepornografie aufgestiegen.“
.
„Seit den 1990er Jahren sind diese neben Animes und Computerspielen ein erfolgreiches kulturelles Exportgut Japans“, heißt es auf Wikipedia. In den Siebzigerjahren begann sich eine organisierte Fanszene mit eigenen Veranstaltungen und Publikationen zu entwickeln, die wiederum auf die professionelle Szene wirkte. Im Herbst 2000 erkannte die japanische Regierung Manga und Anime offiziell als eigenständige, förderungswürdige Kunstform an und das Medium wurde zum Pflichtstoff im Kunstunterricht, wobei man auf eine Darstellung des Mangas als traditionelle japanische Kunst Wert legte.
Jedoch gab es sowohl 2002 als auch ab 2010 auch staatliche Bemühungen, sexuelle Darstellungen von unter 19-Jährigen zu beschränken und die Jugendschutzgesetze wieder strenger auszulegen, was zu großen Protesten in Teilen der Zeichner- und Fanszene führte. Auch Debatten um die Wirkung von Gewaltdarstellungen auf Jugendliche und Kinder kamen nach Gewalttaten immer wieder auf. 2015 kam es zu Kritik an sexuellen Darstellungen vor allem Minderjähriger in einigen Mangas, nun vor allem von außen mit der Motivation, international gegen Kinderpornografie vorzugehen.
Der erste abendfüllende Anime-Film „Momotaro Umi no Shimpei“ kam 1945 kurz vor der von den Amerikanern mit Atombomben erzwungenen Kapitulation Japans in die Kinos. Die in schwarz-weiß erzählte Geschichte von Tieren, die eine Pazifikinsel naczh der anderen von den europäischen Kolonialmächten befreien und ihnen die japanische Kultur bringen“.
Pornografie ist in Japan stark geprägt von der unter der amerikanischen Besatzung entstandenen Gesetzgebung, die die Darstellung des erwachsenen Genitalbereichs und andere „anstößige“ Inhalte unter Strafe stellte. Dies wurde von vielen Künstlern umgangen, indem die Figuren und ihre Genitalien kindlich gezeigt wurden. Zusammen mit einem Ideal von erstrebenswerter Jugend, Naivität und Unschuld beförderte das die Entstehung vieler erotischer und pornografischer Geschichten mit kindlichen Figuren und die Etablierung der Genre Lolicon (Abkürzung für Lolitakomplex). „Auch wenn die Auslegung der Gesetze gelockert wurde, blieb diese Strömung erhalten. Andere Wege, die Zensurgesetzgebung zu umgehen, sind die Verwendung von Balken oder Verpixelung wie im Film, Auslassungen oder von Symbolbildern mit Früchten, Tieren und anderem.“
Die Verpixelung der Geschlechtswerkzeuge in den Pornos setzte ihrer Verbreitung in Europa und in den USA Grenzen: Das mochten die Männer dort nicht, es erregte sie nicht. Ähnlich war es mit den realen japanischen Pornos, in denen die Frauen stets einen leidenden Gesichtsausdruck beim Vögeln mit Männern machten, während sie im Westen dabei eher lachten, rauchten oder eine Freundin küssten.
Die Autoren von Mangas werden Mangaka genannt. Schätzungen zufolge gibt es in Japan etwa 2500 Mangaka. „Von diesen können jedoch nur etwa 20 % als professionelle Zeichner von ihrer Tätigkeit leben. Darüber hinaus gibt es eine große Zahl an Amateurzeichnern, die außerhalb der Verlage veröffentlichen. Während bis in die 1960er Jahre fast ausschließlich Männer als Manga-Zeichner tätig waren, sind in dem Beruf heute auch viele Frauen tätig und ähnlich erfolgreich wie ihre männlichen Kollegen.“
.

Vier erfolgreiche Manga-Zeichnerinnen
.
Unter den Manga- und Hentai-Fans gibt es Wissenschaftler, die darüber forschen, Familien, die keine Mangaserie im Fernsehen verpassen, Sammler von Manga-Heften, -Büchern, Anime-Filmen und Videospielen sowie auf Anime-Pornos (Hentais) spezialisierte Mangaliebhaber. Daneben gehen auch die dazugehörigen Merchandising-Produkte weg wie warme Semmeln. Die Industrie denkt sich immer wieder neue aus. Das neueste sind kleine großbrüstige Mangamädchen als Wackelfiguren fürs Armaturenbrett.
In den Neunzigerjahren kamen in Japan mit dem Manga- und Anime-Boom auch in den USA und in Europa als weitere Fangruppe die Cosplayer auf: „Beim Cosplay stellt der Teilnehmer eine Figur aus einem Manga, Anime, Film, Viedospiel oder anderen Medien durch ein Kostüm und Verhalten möglichst originalgetreu dar.“
„Cosplay wird überwiegend zum eigenen Vergnügen und für Wettbewerbe auf Conventions betrieben. Eine mögliche Einnahmequelle sind der Verkauf von selbst geschneiderten Kostümen und jeglicher Art von Zubehör sowie das Modeln oder das Mieten für Events. Nur ein kleiner Teil der Cosplayer betreibt das Hobby, um damit Geld zu verdienen. Generell ist der Bezug zu Japan unter Cosplayern stark verwurzelt, man findet darunter auch viele Fans der Lolicon(Lolita)-Mode.“
Die letzteren sieht man in Massen auf der Leipziger Buchmesse, wo es zwei Hallen voll mit Manga-Merchandising-Produkte gibt und Cosplayer freien Eintritt haben. In Berlin treffen sie sich zur Kirschblüte in den Marzahner „Gärten der Welt“, wo sie sich Photographieren und Filmen lassen. In Düsseldorf, Kassel, Dortmund und Frankfurt gibt es weitere Cosplay-Events oder gar -Meisterschaften.
„Die größte Cosplay-Veranstaltung ist das vom japanischen Fernsehsender TV Aichi jährlich in Nagoya organisierte World Cosplay Summit, ein Wettbewerb für Cosplayer mit internationalem Teilnehmerfeld. Etwa seit dem Jahr 2000 entstehen in Japan zunehmend Cosplayrestaurants. In Etablissements für männliche Kunden sind die Kellnerinnen als Dienstmädchen, Krankenschwestern o.ä. verkleidet. In Etablissements für ein weibliches Zielpublikum tragen die Kellner Butlerkostüme. Daneben gibt es auch Cosplay-Bordelle, die erotische Rollenspiele anbieten.
Wenn es ausgehend von Japan eine spielerische Verwandlung der Manga-Fans in ihre Comic-Helden gibt, dann kennt man umgekehrt in den USA prominente Schauspieler, die eine Rolle als Superheld übernehmen und sich in eine physische Verkörperung der Comicfigur verwandeln müssen.
„Durch das Aufkommen von Computeranimation und der Digitalisierung kam es zu einer Umwälzung der Produktionsprozesse und Vermarktungswege. Diese halfen, Kosten in Produktion und Vertrieb zu senken, die Verknüpfungen mit anderen Medien zu stärken und neue, insbesondere Nischen-Zielgruppen und solche im Ausland zu erschließen. Neue Studios entstanden, die sich auf die Nutzung von Computern und auf 3D-Animationen spezialisierten. Im Wesentlichen blieb trotz Digitalisierung die bis dahin kultivierte 2D-Bildsprache jedoch erhalten.
International waren erotische Anime zeitweise kommerziell deutlich erfolgreicher und verbreiteter als andere Genres, was zur Legende führte, alle Anime seien pornografisch. Dieser Eindruck ist jedoch auch Ergebnis der Stereotypen des westlichen Publikums und wirkte vermutlich auch auf die japanischen Produktionen zurück, die wiederum an amerikanischen Filmen orientierend den Frauen größere Brüste und den Männern mehr Muskeln gaben. Nacktheit kann darüber hinaus auch jenseits sexueller Szenen vorkommen, in Alltags- oder Kinderserien, da es in solchen Situationen in Japan nicht als anstößig gilt. Außerdem werden Nacktheit, sexuelle Anspielungen wie auch Fäkalhumor in einigen Comedy-Animes gern eingesetzt.
Das Charakterdesign ist stark vom Manga beeinflusst und entspricht beispielsweise oft dem Niedlichkeitskonzept Kawaii – ursprünglich der japanische Ausdruck für „liebenswert“, „süß“, „niedlich“, „kindlich“ oder „attraktiv“. Mittlerweile steht er für ein ästhetisches Konzept, das Unschuld und Kindlichkeit betont und sich auf alle Bereiche der japanischen Gesellschaft ausgedehnt hat. In westlichen Sprachen hat sich Kawaii als Bezeichnung einer japanisch beeinflussten Niedlichkeitsästhetik etabliert.“
Laut einer im Jahr 2013 durchgeführten Studie arbeiten japanische Anime-Zeichner im Durchschnitt 10 bis 11 Stunden pro Arbeitstag bzw. 263 Stunden pro Monat bzw. 4,6 freie Tage/Monat. Animatoren verdienen pro Jahr durchschnittlich (Mittelwert) 3,3 Millionen Yen (ca.
23.000 €) bzw. am häufigsten (Modalwert) 4,0 Mio. Yen (28.000 €), angefangen bei Einstiegspositionen wie Zwischenzeichnern mit 1,1 Mio. Yen (8000 €) über Schlüsselzeichner mit 2,8 Mio. Yen (20.000 €) und Storyboarder/3D-Animatoren mit 3,8 Mio. Yen (26.000 €) bis zu Regisseuren mit 6,5 Mio. Yen (45.000 €). Zeichner werden häufig nach einem Schema bezahlt, bei dem sie zusätzlich zu einem festen Lohn noch nach fertiggestellten Einzelbildern bzw. -szenen bezahlt werden. Dieses entstand in den 1960er Jahren nach mehreren Arbeitskämpfen vor allem bei Tōei Animation, in denen um gerechte und überhaupt zum Leben ausreichende Bezahlung gerungen wurde. Zur damaligen Zeit wurden bis zu 13.500 Yen pro Monat gezahlt.
Am schlechtesten verdienten freiberufliche Frauen nur mit Oberschulabschluss, die meist kolorierten, mit etwa 5.000 Yen im Monat. Generell wurden Frauen grundsätzlich schlechter bezahlt und wurden für höhere Positionen nicht in Betracht gezogen, was sich teilweise bis heute erhalten hat. Für die Koloration von Zeichnungen oder Hilfsarbeiten waren dagegen oft Frauen tätig, auch weil es heißt, sie hätten ein besseres Gefühl für die Farbe.
Die Arbeitsbedingungen in der Branche verbesserten sind ab den 1990er Jahren in einigen Bereichen, da mit der aufkommenden Videospiele-Industrie den Animatoren erstmals eine Alternative offen stand, die oft bessere Bezahlung und Bedingungen versprach. Zugleich führte die Digitalisierung dazu, dass ganze Berufsgruppen entfielen oder deutlich andere Fähigkeiten für Tätigkeiten wie Kolorierung benötigt wurden.
Als in den 1980er Jahren erstmals Computeranimationen eingesetzt wurden, gehörte die japanische Filmwirtschaft zu den ersten Anwendern. Seitdem wird immer wieder mit 3D-Animation experimentiert. Anders als in den USA konnte die Computeranimation aber nicht die traditionelle 2D-Ästhetik ablösen, reine 3D-Animationsfilme bleiben eine Seltenheit. Sie hatten wenig Publikumserfolg und sind aufwändig in der Herstellung. Stattdessen werden 3D-Animationen als Effekte in Szenen klassischer Animation eingesetzt, beispielsweise Lichteffekte und am Computer animierte Bildelemente werden in einer Weise gerendert, die sie wie handgezeichnet erscheinen lässt.
Besonders letzteres ist seit Ende der 1990er Jahre durch neue Software einfacher umsetzbar geworden und wurde daher zunehmend in Bildelementen eingesetzt, die mit der Hand gezeichnet zu aufwändig oder nur schwer zufriedenstellend umzusetzen sind. Insbesondere die Charaktere aber bleiben handgezeichnet und die Ästhetik der traditionellen Cel-Animation wird beibehalten; wobei Zeichnungen digitalisiert und anschließend als Computergrafik koloriert und animiert werden. Zugleich bringt der Einsatz von Computern neue Möglichkeiten für die Einbindung von Fotografie und Rotoskopie. Seit den 2010er Jahren ist der Produktionsprozess in nahezu allen Studios vollständig digitalisiert: Von Skripten über Skizzen, Zeichnungen, Kolorierung und Schnitt findet alles an Computern statt. Die Herstellung findet nicht nur in Japan statt, sondern aus Kostengründen auch in anderen asiatischen Ländern, Amerika und Europa. Die wichtigsten Nachunternehmer sitzen in Korea, China und Thailand.
Auch gleichberechtigte Koproduktionen gab es in der Geschichte des Mediums immer wieder. So beispielsweise mit europäischen Sendern in den 1970er Jahren. Seit in den 1990er Jahren das Interesse an Anime in westlichen Ländern zugenommen hat, kommen auch solche Koproduktionen wieder häufiger vor, vor allem mit amerikanischen Firmen. Auf der anderen Seite arbeiten japanische Studios, insbesondere solche auf Zuarbeiten spezialisierte, auch Produktionen in anderen Ländern zu, vor allem amerikanischen. 2002 erhielt der japanische Animefilm ‚Chihiros Reise ins Zauberland‘ einen Goldenen Bären auf der Berlinale und im Jahr darauf einen Oscar in Hollywood.“ Erfolgreich war auch eine Anime-Serie nach der Vorlage des Schweizer Kinderbuchs „Heidis Lehr- und Wanderjahre“.
„Die Produktion und Veröffentlichung von Animes ist oft eng mit anderen Medien verknüpft. In der Vergangenheit basierten fast alles Animes auf erfolgreichen Mangas. Ab den 2000er Jahren hat die Zahl der Adaptionen von Computerspielen und japanischen Romanen deutlich zugenommen. Es wird aber auch umgekehrt nach dem Erfolg eines Animes ein entsprechender Manga gezeichnet.“ Dies erinnert an Woody Allen, der in einem seiner Filme Mia Farrow kritisierte, weil sie aus Filmen Romane mache.
.

Shintoistische Verabschiedungszeremonie für kaputte Roboterhunde
.
Wladimir Kaminer besuchte kürzlich das Filmstudio Babelsberg, anschließend berichtete er:
„Heute werden die Filme hauptsächlich digital gedreht, die hinterhältige Künstliche Intelligenz (KI) übernimmt langsam, aber sicher die Filmbranche. Ursprünglich war es eigentlich ganz anders gedacht. In meiner Kindheit in der Sowjetunion war viel von der Roboterisierung der Arbeitsprozesse die Rede, es ging in erster Linie darum, dass die Maschinen uns die schwere Arbeit abnehmen, Straßen fegen, Röhren legen und Brücken bauen. Sie sollten Post austragen und Brote backen, während wir von der lästigen Pflicht des Frühaufstehens und der körperlichen Anstrengung befreit uns dem Kaffeetrinken widmen und kreativen Tätigkeiten nachgehen.
Genau das Gegenteil ist dabei herausgekommen: Die KI übernimmt die kreativen Berufe, sie möchte malen, dichten, Musik machen, Bücher schreiben und tanzen. Und wir sollen fegen und backen. In Babelsberg hat sich die KI ein eigenes digitales Studio aufgebaut, ein kleiner Raum mit weissen Wänden und Böden wie in einer Irrenanstalt. In die Wände hat man 36 Kameras installiert, die von jedem Mensch schnell eine digitale 3D-Kopie erstellen und abspeichern können.
Abschließend wird dieser abgespeicherte Mensch durch die Landschaften seiner Wahl geschickt, er kann sprechen und Grimassen schneiden, er kann sich selbst Regieanweisungen ausdenken. Die Modelle werden immer echter, die Stars aus Hollywood haben sich leichtsinnig digital klonen lassen und wissen gar nicht mehr, wie viele sie jetzt sind. Es ist wohl schon vorgekommen, dass irgendwelche künstlich erzeugten Clooneys von sich behaupteten, sie seien die echten. Die Schauspieler sind verständlicherweise in Panik und patentieren ihr Aussehen, damit sie, wenn sie schon nicht mehr mitspielen, dann in Zukunft mindestens die Tantiemen fürs Benutzen ihres Aussehens bekommen – Almosen, die uns die künstliche Intelligenz großzügig überläßt. Manche digitalen Clone zucken noch ab und zu ungefragt mit dem linken Auge, doch die Entwickler sind sich sicher, so schnell wie die Maschinen rechnen, wird bald ein geklonter Schauspieler nicht mehr vom echten zu unterscheiden sein. Zurzeit hinkt es noch ein wenig bei der Stimmwiedergabe, erzählten mir die Macher. Eine Stimme ist schwieriger zu berechnen als das Aussehen. Wenn jemand klar und deutlich wie ein Nachrichtensprecher spricht, dann ist so eine Stimme nachzumachen kein Problem. Doch einen russischen Akzent kann die KI zum Beispiel noch nicht glaubwürdig imitieren.“Fraglich bleibt auch, ob die Fans von berühmten Schauspielern auch an die digital geklonten ihr Herz und ihren Verstand verlieren. „Man muß abwarten, wir sind aber optimistisch,“ meint ein KI-Experte.
.

Frisch aus der Fake-Maschine AI.

Früher hat das Beten noch geholfen. Man wußte oder ahnte, ein Gebet nimmt nicht im Quadrat seiner Entfernung ab. Zur Sicherheit formte man auch noch hoffnungsfroh eine nackte Frau dazu, auf einer Art Klitoris stehend und umrahmt von einer welligen Vagina.
Der bayrische Rundfunk berichtete: „Am 30. Oktober 1938 saßen zahlreiche Hörer in den USA vor ihren Geräten und genossen entspannt die Tanzmusik, die die Radiosender des CBS-Netzwerks zu bieten hatten. Bis das Programm plötzlich für eine Eilmeldung unterbrochen wurde. Auf dem Planeten Mars habe es Explosionen gegeben, Gaswolken bewegten sich auf die Erde zu. Dann wieder Tanzmusik. Wenig später die nächste Eilmeldung: Sonderbares Flugobjekt in New Jersey gesichtet. Und wieder Musik. Kurz danach berichtet ein Reporter live, wie ein Außerirdischer seiner Kapsel entsteigt und mit einem Feuerstrahl alles umnietet. Fliehende Menschen, Schreie, und … Ende der Übertragung . Während des Programms wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass es sich um Fiktion handelte. Nämlich um das Hörspiel eines 22-Jährigen namens Orson Welles. Der junge Regisseur hatte den Roman „Der Krieg der Welten“ aus dem Jahr 1898 in eine für damalige Zeit geniale Radiofassung gebracht. Welles hatte mit der Crew des New Yorker Mercury Theaters die Invasion von Außerirdischen als Reportage inszeniert.“
Einen ähnlichen Fake konnte man sich unlängst im Internet ansehen: Eine Erdbeben-Katastrophe mit tausenden Toten. Wenn man Radioberichten glaubt, dann glaubt man erst recht Bilder und Videos, die mittels KI „echt“ gemacht wurden. „Die Täuschungsmacht der neuen Technologie sei kaum zu überschätzen,“ meint der „Faktenchecker“ Eliot Higgins, den der Spiegel in seiner Ausgabe vom 8.Juli 22023 im Aufmacher über künstliche Intelligenz „Das Ende der Wahrheit“ zitiert. Darin heißt es über die Deepfake-Maschinen und ihre Bilderflut: „Stirbt damit die Wahrheit also tatsächlich? Und stirbt mit dem Wahren das Schöne und Gute gleich mit? Das sind düstere Fragen.“
Diese „Okulartyrannis“ unserer Gesellschaft begann jedoch nicht mit Film, Fernsehen, Computer oder KI sondern mit der Malerei in der Renaissance, d.h. mit der Zentralperspektive, die eine räumliche Darstellung in 2D ermöglichte. Damals übrigens schon für Pornographisches: „Leda mit dem Schwan“, „Der Raub von Europa“, kurz: alle Verführungs- bzw. Vergewaltigungsszenen von Zeus beispielsweise. Die Maler waren es leid, immer diese langweiligen biblischen Szenen zu malen, meinte der Medienwissenschaftler Friedrich Kittler.
.

So geht das laut Albrecht Dürer mit der Zentralperspektive. Der russische Priester und Wissenschaftler Pawel Florenski meinte – in Verteidigung der Ikonenmalerei: „Die Zentralperspektive ist eine Maschine zur Vernichtung der Wirklichkeit“.
.
Mimikry/Mimese (2)
In einem langen Artikel berichtete die FAZ 2020 über ein englisches Mimikry-Forschungsprojekt. Einleitend heißt es dort: „Gute Tarnung kann Leben retten. Je besser sie ausfällt, desto größer ist die Chance, dass ein Jäger seine Beute schlichtweg übersieht. Kein Wunder also, dass die Evolution zahllose Designs hervorgebracht hat, die sich ziemlich perfekt in ihre natürliche Umgebung einfügen.“ Dazu zitierte der Autor den Naturforscher und Sammler tropischer Tiere, vor allem Insekten, Alfred Russel Wallace. Er schrieb in seinem Werk „Mimicry, and Other Protective Resemblances Among Animals“ (1867) über die Tarnungsfähigkeit von Schmetterlingen: „Wir finden Darstellungen von Blättern in allen Stadien des Zerfalls, unterschiedlich gefleckt, von Mehltau befallen und löchrig . . . .“ Das wollten die Wissenschaftler um Leah M. Costello und Innes C. Cuthill von der University of Bristol genauer wissen und experimentierten dafür mit künstlichen Schmetterlingen, deren Flügel aus Pappe bestanden, als Körper diente ein toter Mehlwurm. „Wenn kleine Vögel wie Meisen oder Rotkehlchen eine derartige Beute entdeckten, schnappten sie sich den nahrhaften Happen. An der Zahl der abgezupften Mehlwürmer konnten Costello und ihre Kollegen ablesen, wie auffällig oder unauffällig die Pappflügel waren. Flügel mit ausgestanzten Löchern boten eindeutig eine bessere Tarnung als solche ohne Löcher. Dabei machte es keinen Unterschied, ob die Pappfalter an Zweigen oder in Brombeerhecken plaziert waren. (…) Ein löchriger Flügel wäre für einen umherfliegenden Schmetterling allerdings von großem Nachteil, schließlich würde es die Aerodynamik verschlechtern. Dieses Hindernis entfällt, wenn ein Loch nur vorgetäuscht wird, sei es durch fehlende Schuppen oder Farbschattierungen. Schließlich haben falsche Löcher eine ähnlich gute Schutzwirkung wie echte“ – d.h. sie sind ähnlich nützlich.
Der Basler Zoologe Adolf Portmann hat gegenüber dem Nützlichkeitspostulat der meisten Biologen bei der Mimikry/Mimese auf eine zweckfreie „Selbstdarstellung“ bestanden – d.h. bei der Nachahmung: z.B. einer ungiftigen Schlange, die farblich einer giftigen zum Verwechseln ähnelt oder bei den Scheinaugen eines Schmetterlings und sogar bei den Blüten von Pflanzen.
Der Kulturwissenschaftler Peter Berz erwähnt neben Portmann den Soziologen Roger Caillois und den Entomologen Paul Joseph Victor Vignon. Letzterer hat sich mit Laubschrecken befaßt, die Blätter imitieren, ihre Deckflügel ahmen jedoch nicht intakte Blätter nach, sondern wie die Schmetterlings-Attrappen aus Pappe in Bristol solche im Zustand der Zersetzung. „Aber für welchen Adressaten mit welch scharfen Sinnen ist diese Perfektion?“ fragt sich Berz. „Handelt es sich überhaupt um Nachahmung? Im Unterschied zur morphologischen Ritualisierung der Verhaltensbiologie löst sich gerade in der scheinbar exzessivsten Nachahmung die Nachahmungsfunktion als solche auf, das heißt: der Bezug von Vorbild und Nachahmer. Am Ende steht der Überschuss einer eigenständigen ‚künstlerischen‘, ja theatralischen Formproduktion.“
Roger Caillois hat dieses „Künstlertum“ in seiner Theorie der Mimikry in eine „allgemeine Theorie“ weiter gedacht. Es ist, als ob die Natur Ähnlichkeiten ungeachtet des Aufwandes und der Nützlichkeit herzustellen „versucht“. Produziert die Natur also Kunst? Caillois hat die Mimikry sowie die ihr verwandte Mimese in seinem Buch „Méduse & Cie“ (2007) tatsächlich als eine ästhetische Praxis begriffen: So versteht er zum Beispiel die falschen Augen auf den Flügeln von Schmetterlingen und Käfern als „magische Praktiken“, die abschrecken und Furcht erregen sollen – genauso wie die „Masken“ der sogenannten Primitiven. Und die Mimese überhaupt als tierisches Pendant zur menschlichen Mode. „Es gibt nur eine Natur“ – soll heißen: dass die Formen und Verhaltensweisen sogar der Insekten genauso wie bestimmte ästhetische Vorlieben und Faszinierbarkeiten der Menschen sich auf eine gemeinsame Basis zurückführen lassen: auf den Formenvorrat einer bildnerischen Natur, deren spielerisch zweckfreies Wirken sich im Naturreich ebenso niederschlägt wie in der vom Naturzwang freigesetzten Sphäre menschlicher Imagination.
Der französische Insektenforscher Jean-Henri Fabre lehnt zwar alle „Mimikry/Mimese-Theorien ab, spricht aber ähnlich wie nach ihm Caillois von einer „Insektenästhetik“. Damit meint er keine Nachahmung, sondern eigenständige künstlerische Werke, die er mit den buntbemalten Zweigpavillons und den mosaikausgelegten Balzplätzen der australischen Laubenvögel vergleicht: „Ich glaube zumindest bei der Lehmwespe die Neigung zu erkennen, ihr Werk zu verschönern.“ Gemeint sind u.a. die vom Lehmwespen-Weibchen gebauten Nester in Form kleiner Amphoren, „wie von einer Töpferscheibe“, in denen sie jeweils bis zu sieben Zellen für ihre Eier einrichten. „Die Kuppel der Lehmwespe ist die Arbeit eines Künstlers,“ schreibt er (in: „Erinnerungen eines Insektenforschers“ Band II). Für den Kuppelmantel wählt sie sorgfältig kleine Steinchen aus: „Wenn sie welche aus durchscheinendem Quarz sieht, läßt sie alles andere liegen.“ Und in der Wölbung zementiert sie „sonnengebleichte Schneckenhäuschen“ ein. „Wozu diese Feinheiten?“ fragt er sich. Für die Festigkeit des Werkes und den Schutz ihrer Eier bzw. der heranwachsenden Larven vor Feinden und Unwetter sind sie überflüssig, obendrein würde sie ohne diesen Gebäudeschmuck schneller fertig werden.
Für ihre Mimikry berühmt sind vor allem die Schwebfliegen. Viele Arten haben ein hummel-, wespen-, hornissen- oder bienenähnliches Aussehen – „angenommen“, wie die Insektenforscher sagen. Als Darwinisten gehen sie dabei wie die alten Naturtheologen stets von der Nützlichkeit aus – und die besteht bei der Mimikry für sie darin, dass ein harmloses Tier sich einem wehrhaften aus einer ganz anderen Art in Form, Farbe, Geräusch etc. angleicht. Das ist so einleuchtend, dass Woody Allen darüber einen seiner schönsten Filme drehte: „Zelig“.
Der Tierfilmer Horst Stern erwähnt in seinem Buch „Tiere und Landschaften“ (1973) einen weiteren „Trick“ der Schwebfliegen: Sie imitieren auch die großen Fühler der Wespen, indem „sie bei Gefahr die Vorderbeine an den Kopf heben, mit ihnen wie mit Fühlern zittern und sie auch ein wenig geknickt halten“.
In ihrem Hauptwerk „Tausend Plateaus“ (1993) postulieren die Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari: „Nachahmung ist die Ausbreitung einer Strömung“. Das gilt sowohl für soziale Bewegungen als auch für Modetrends – sofern sie sich wirklich ausbreiten und nicht bloß medial behauptet werden. Man denke nur an das jüngst epidemisch gewordene Tätowieren, Piercen und Nazifrisurenschneiden. Wenn jemand früher z.B. mit einer Schlaghose in der Schule ankam, sagten wir (in Bremen) – halb anerkennend halb ironisch: „Das mimt!“
„Frauen beherrschen Mimikry gut, besser als Männer. Selbst Parodien,“ heißt es in dem Roman „Elizabeth Costello“ (2004) von J.M. Coetzee. Für unsere Mitschülerinnen einst galt das vor allem in bezug auf ihre „Wohlanständigkeit“. Während wir Jungs damit prahlten, was wir z.B. bei Karstadt alles zu klauen gedächten, wobei es jedoch nie dazu kam, entrüsteten sich die Mädchen über unsere kriminellen Neigungen, klauten aber ohne groß darüber zu reden wie die Raben Lippenstifte, Parfüm, Unterwäsche, Ohrringe, Bikinis etc..
Für Caillois ist die Mimikry das tierische Pendant zur menschlichen Mode, die man ebenfalls als eine “Maske” bezeichnen könnte. Wobei das Übernehmen einer Mode “auf eine undurchsichtige Ansteckung gründet”.
Dieser menschliche Nachahmungswunsch äußert sich zumeist im Übernehmen eines Styles (mittels Textilien, Schuhe, Haarfrisuren etc.). Man kann ihn annehmen und auch wieder ablegen („Wir machen aus Punk Prunk“ – damit bewarb der Kaufhof einst seine nachgemachten Punkklamotten, die er aber schon lange nicht mehr im Angebot hat). Bei den Tieren und Pflanzen ist das anders: Es ist höchst unwahrscheinlich, dass eine ungiftige Schlange wie die Milchschlange eine hochgiftige wie die Korallennatter studiert, um ihr Aussehen nachzuahmen. Oder vielleicht tut sie es doch?
Der Reptilienexperte Robert Mertens hat 1956 eine genetische Erklärung dafür vorgeschlagen. Dazu heißt es im Internetforum „scinexx.de“: „Die hochgiftigen Korallenschlangen fielen – das ließen Interpretationen seiner Beobachtungen erkennen – als Vorbilder für die Mimikry aus, weil ihr Biss für Feinde wie kleine Raubtiere oder Vögel in kürzester Zeit absolut tödlich war. Wenn die Fressfeinde aber im Nu starben, konnten sie auch nicht lernen, solche auffällig gemusterten gefährlichen Schlangenarten in Zukunft zu meiden. Deshalb kamen ausschließlich die mäßig giftigen Korallenschlangen als Modell für die Ausbildung dieser Mimikry-Form in Frage. Nur ihre Bisse konnten Feinde überleben und anschließend Rückschlüsse für ihr Verhalten daraus ziehen. Die beiden anderen Gruppen, die hochgiftigen und die ungiftigen, waren in diesem Fall Nachahmer und haben sich im Laufe der Evolution vom Aussehen her an die mäßig giftigen Korallenschlangenarten angepasst.“
Mertens meint, mit den biologischen Gemeinplätzen „Evolution“ und „Anpassung“, das heißt Mutation und Selektion, diese Mimikry, also die Annäherung der beiden Schlangen an eine dritte, die weder ganz ungiftig noch höchst giftig ist, erschöpfend erklärt zu haben. In Wirklichkeit erklärt er sie überhaupt nicht. Er hat bloß die mit der Genetik ergänzte Evolutionstheorie von Charles Darwin auf seine Schlangen gemünzt: „Wie für die Entstehung aller Arten nahm Darwin auch in Bezug auf Mimikry-Systeme an, dass sich die Nachahmung von Vorbildern nach und nach auf dem Wege der selektiv begünstigenden Verstärkung entsprechender Mutationen herausgebildet hat.“ (Wikipedia) In die moderne Biologie übersetzt heißt das: Die ungiftige und die giftige Schlangen nähern sich aus Gründen der Nützlichkeit in kleinsten Schritten (Nuancen) dem Aussehen der mäßig giftigen immer weiter an, womit sich ihre „Überlebenschancen“ erhöhen. Und das geht so weit, dass diese Annäherung erst zu einem epigenetischen Phänomen wird und sich dann bei ihnen auch genetisch verankert, so dass sie ihr verändertes Aussehen an ihre Nachkommen vererben können, die es wiederum an ihre Nachkommen weitergeben.
Diese Erklärung der Mimikry ist genauso unbefriedigend (ideologisch) wie die Mimikry-Theorie des Zoologen Wolfgang Wickler, der sich dabei vor allem auf die Putzerfische konzentriert hat, wobei er mit den Begriffen Signal-Sender und -Empfänger argumentiert. Er gilt als deutscher Putzerfischexperte. In seinem Hauptwerk „Mimikry – Nachahmung und Täuschung in der Natur“ (1982) schreibt er, dass die Putzerfische perfekte Imitatoren gefunden haben, die sich auf ihre Behandlungsstationen am Riff einschleichen, wo sie es jedoch nicht auf das Säubern ihrer „Kunden“ abgesehen haben, sondern im Gegenteil: nur schnell kleine Stücke von ihnen abbeißen wollen. Es sind „Falsche Putzerlippfische“, die nach getaner Tat flüchten, während die „echten Putzerfische“ sich entschuldigen, wenn sie aus Versehen mal zu grob waren. Sie putzen die Fische, die wie wir beim Zahnarzt warten, bis sie dran kommen, auch im Maul – und schwimmen dann aus den Kiemen wieder raus. „Aquarienbeobachtungen bestätigen, daß verschiedene ‘Korallenfische’ den Räuber Aspidontus für den Putzer Labroides halten. Sie verwechseln dieselben Merkmale wie wir,“ heißt es im Internetportal „researchgate.net“ in einer Rezension von Wicklers „Mimikry“-Buches: „Wie er zu seiner Mimikry-Bedeutung kommt und wieviel daran Präadaptation ist, wird ausführlich besprochen. Die Putzkunden müssen wahrscheinlich die Putzer erst kennen lernen und suchen nach Merkmalen, um den Putzer vom Nachahmer zu unterscheiden. Deshalb muß dieser jede Abweichung vom Vorbild vermeiden und ahmt alle Altersstufen und Lokalrassen genau nach. Die Lokalrassenbildung des Putzers kann man als Ausweichentwicklungen vor dem Nachahmer deuten.“ Der Foucault-Assistent Francois Ewald gab zu bedenken: „Es gibt nie genug Fakten und immer zu viel Deutung. Die Akte durch Deutung sind am gefährlichsten für die Freiheit“. Das gilt vielleicht auch für die Fake-Putzerfische.
.

.
Drogen
Kürzlich wurde der UNO-Drogenbericht veröffentlicht, noch kürzlicher starb ein Mädchen in Altentreptow an einer zu starken Designerdroge namens „Blue Punisher“. Bisher kannte man an synthetischen Drogen, die in den letzten Jahrzehnten beunruhigten: Crystal Meth und dann Cocolino, beides Amphetamin-Derivate. Angeblich kamen sie aus Tschechien. In Bayern auf dem Land war Crystal Meth besonders weit verbreitet. Jetzt erfuhr man:
„In der Ukraine, waren im Jahr vor Beginn des Kriegs 79 Amphetamin-Labore von den Behörden stillgelegt worden – die höchste Zahl weltweit. Seit der russischen Invasion Anfang 2022 sei die Zahl der Beschlagnahmungen von synthetischen Drogen in der Ukraine angestiegen, während der Markt für solche Substanzen in Nachbarländern gewachsen sei, berichtete Chefanalystin Angela Me vom United-Nation-Office-on-Drugs-and-Crime“ (UNODC). ‚Dies ist eine Gefahr, die wir als eine Folge des Kriegs sehen‘,“ sagte sie der „Zeit“.
Sind es diese ukrainischen Labore, die von der russischen Regierung als US-finanzierte Fabriken für biologische Waffen bezeichnet und angegriffen wurden? Diese Drogen sind aber doch eher chemische Waffen und eingesetzt werden sie nicht von Staaten, sondern von privaten Herstellern (mit einigen Chemiekenntnissen) und geldgierigen Händlern (Pusher, Dealer, Rauschgiftbanden, Drogenbarone, Cosa Nostra), die jedoch – in den USA, in Lateinamerika und Asien – oft mit Regierungspersonen und ganzen Behörden zusammenarbeiten.
Neuerdings zieht auch noch eine andere synthetische Droge wieder an: das von einem Chemiker des Basler „Sandoz“-Konzerns im Labor erfundene LSD, weil es erneut in vielen Forschungseinrichtungen, z.B. in der Charité und am Uniklinikum in Basel, aber auch in England und Nordamerika mit Heilungsabsichten „kontrolliert verabreicht“ werden darf. Der durchgeknallte Elon Musk will mit LSD sogar das gesamte marode US-Gesundheitssystem „heilen“ und die großteils autistischen Yuppies im Silicon Valley nehmen gerne täglich „Microdosing LSD“, um sich vorm Bildschirm Flügel wachsen zu lassen. Gleichzeitig muß Red Bull jedoch in den USA 10 Dollar Entschädigung an jeden Red-Bull-Trinker zahlen. Der Salzburger Konzern hatte in seiner Werbung zu viel versprochen: „Red-Bull-Trinkern wachsen in Wahrheit gar keine Flügel“, schreibt „Die Welt“. „Deutschland amüsiert sich. Werbung sollte man besser nicht zu wörtlich nehmen.“ Die „Neue Welt“-Faktenhuber in den USA argumentierten mit der „Wahrheit“, die Ösi-Anwälte mit dem gewöhnlichen „Metapherngebrauch“ in der „Alten Welt“. Am Ende unterlag die hiesige Geisteswissenschaft, wie so oft. Das aber nur quasi am Drogenrand.“If you want to be a High-Flyer in Science you must be in America a good Fact-Gather and in Germany oder Europe a brilliant Theorist,“ sagte der US-Professor an der Uni Bremen Fred Abraham gerne, denn hier haben wir laut Adorno die großartige lange Geschichte der spekulativen Philosophie gehabt. Nun aber nicht mehr.
Den Verfassern des UN-Drogenberichts beunruhigt etwas anderes: „dass weltweit etwa 296 Millionen Menschen zu Drogen greifen. Besonders alarmierend ist laut den Experten die Situation in der Ukraine“ und in Afghanistan. In den letzten zehn Jahren sei die Zahl der Drogenkonsumenten weltweit um fast ein Viertel gestiegen.
Das UNODC warnte laut „Die Zeit“ im Besonderen „vor der Verbreitung von chemischen Drogen wie Methamphetamin, Amphetamin, Fentanyl und auch vor den vielen neu entwickelten Substanzen am Markt. ‚Die Herstellung von synthetischen Drogen ist billig, einfach und schnell‘, hieß es. Dieser hochflexible Sektor des Rauschgiftgeschäfts sei für Behörden schwerer aufzuspüren, weil er anders als etwa Kokain und Heroin nicht an bestimmte Anbaugebiete und Wachstumszyklen gebunden sei.“
Und auch weil einige Behörden mit diesen Drogen selbst operiert haben bzw. einen Teil der Gewinne aus dem Drogenhandel für sich beanspruchten. In der Frühzeit der CIA z.B. war es ihre Abteilung „MK-Ultra“, die unwissenden Bürgern LSD verabreichten, um ihre Gehirne umzupolen. Das Programm wurde auf etliche Kliniken und Universitäten verteilt. Viele ihrer Opfer erlitten dabei bleibende Schäden, einige starben.
Dann unterstützte „die CIA den Schmuggel von Kokain durch die Contras in die USA, der ebenfalls der Finanzierung des brutalen Guerilla-Kampfes“ diente“ – gegen die linken „Sandinistas“ in Nicaragua,“ wie es im Deutschen Spionagemuseum heißt.
Zuvor, während der amerikanischen Anti-Vietnamkriegs-Bewegung, war Folgendes passiert: Der „New York Times“-Herausgeber Arthur Sulzberger hatte 1968 den Beat-Dichter Allen Ginsberg um einen freimütigen Text für die Seite 1 gebeten. Ginsberg berichtete dann, dass in den Hippie-Quartieren plötzlich die Haschisch- und LSD-Verkäufer durch Heroin-Dealer ersetzt worden seien. Und dies sei auf Anweisung des Staates und seiner bewaffneten Organe geschehen, nachdem das Militär und die Harvard-Universität Haschisch und LSD als für den US-Imperialismus kontraproduktiv eingestuft hätten. Sulzberger war über Ginsbergs Artikel so entsetzt, dass er entgegen aller seriöser Gepflogenheiten, dazu auf der selben Seite in einem Kommentar Stellung nahm. In diesem meinte er, die Regierung gegen Ginsbergs infame Unterstellung in Schutz nehmen zu müssen. Zehn Jahre später gestand er jedoch – auf der selben Seite ein, dass Ginsburg wohl doch Recht gehabt hatte.
Zuletzt verbreitete sich in den USA das Opioid und sein synthetisches Pendant Fentanyl sowie vor allem das Heroin beigemischte Opioid Carfentanyl. „Neue Droge in den USA“, titelte der Tagesspiegel 2017: „10.000 mal stärker als Morphium. ‚Noch nie haben wir so viele Tote gesehen‘, zitierte die ‚Washington Post‘ einen Rauschgift-Fahnder im Bundesstaat Ohio.“
Für das UNODC sind „die meisten Fälle von Sucht und Erkrankungen“ denn auch „weiterhin auf Opioide – natürliche Opiate und ihre künstlichen Varianten – sowie auf Cannabis zurückzuführen.“ Von den 128.000 Drogentoten im Jahr 2019 entfielen fast 70 Prozent auf die Konsumenten von Opioiden.
Der in immer mehr Staaten der USA inzwischen legale Anbau und Verkauf von Cannabis hat hat viele zuvor illegale Anbauer und Dealer zu Millionären gemacht, die nun ein Milliardengeschäft wittern und viel Geld in das US-Pharma-Start-Up „MindMed“ investieren. Dieses börsennotierte New Yorker Unternehmen ist bei der Zulassung von LSD als Medikament (gegen bald alles?) weltweit in der „Pole Position“. Der Markt boomt. Schon entstehen in den USA überall „Center for the Neuroscience of Psychodelics“ und „Center for Psychedelic and Consciousness Research“. Die amerikanischen und Basler Psychodrogenforscher (und wohl auch die in der Charité) wurden inzwischen an „MindMed“ beteiligt. Die Ex-Dealer halten auch reden – z.B. auf den Bedrliner Cannabis-Kongressen. Der Eintritt kostet dort 700 Euro.
Und dann ist da noch die von der Bill & Melinda Gates Stiftung langsam unterwanderte Weltgesundheitsgeneration der UNO (WHO). Die Stiftung und die mit ihr kooperierenden Chemiekonzerne (u.a. Monsanto) tüfteln an neuen gentechnisch erzeugten Drogen (Medikamenten), mit denen sie die ganze Menschheit beglücken wollen. Man könnte glatt vermuten, dass UNODC und UNOWHO einen geheimen Drogenkrieg gegeneinander führen.
.

.
Zur Drogen-Situation in Afghanistan schrieb die taz (am 30.6.2023):
„Im Ergebnis der anhaltenden Bemühungen des Islamischen Emirats ist der Anbau von Opiummohn im Land ausgetilgt worden.“ Etliche Expert*innen bestätigen diese Aussage von Talibanchef Hebatullah Achundsada aus seiner Botschaft zum am Mittwoch begonnenen islamischen Opferfest.
Als Hebatullah im April 2022 den Mohnanbau sowohl zur Herstellung von Opium wie generell den Gebrauch, Transport und Handel aller illegalen Narkotika unter Strafe stellte, herrschte Skepsis: Meinte er es wirklich ernst? Immerhin gehörten viele Opiumbauern und -händler sowie in den Handel verwickelte Transportunternehmer zu den Hauptstützen der Islamisten während ihres Aufstands gegen den US-geführten Afghanistan-Einsatz seit 2001.
Hebatullah machte auch fast sofort schon einen Rückzieher: Da gerade die Mohnernte begonnen hatte, gewährten er den Bauern noch einmal zwei Monate Aufschub. Damit konnten sie diese Ernte noch ungestört einbringen. Laut UNO waren das 6.200 Tonnen, 80 Prozent der Weltopiumproduktion und die drittgrößte Menge seit Beginn ihrer Erhebungen 1995 und zugleich ein Drittel mehr als im Vorjahr. Daraus wurden 95 Prozent des Heroins auf den Europas Märkten gekocht.
Im vergangenen Sommer erneuerte der Talibanchef das Verbot. Zur Bekräftigung schickte er seine Kämpfer zu Bauern, die – ebenfalls im Zweifel ob seiner Pläne – wieder Opiummohn anpflanzten. Zunächst gab es Widerstand, aber nachdem die Taliban einige Pflanzer töteten, wurde klar: Das Verbot gilt.
Viele erinnerten sich, dass die Taliban während ihrer ersten Herrschaft 2001 mit denselben Methoden die Produktion fast auf null gedrückt hatten.
Zum Ende der Sommeraussaat 2022 gab es „nur noch kleine Inseln des Mohnanbaus“, sagt David Mansfield, ein führender Drogenexperte zu Afghanistan. Die Opiumproduktion sei auf ein Niveau gesunken, „das man seit 2001 nicht mehr gesehen hat“.
In der Südprovinz Helmand, woher etwa die Hälfte des afghanischen Opiums stammt, fiel die dafür genutzte Fläche von 120.000 auf unter 1.000 Hektar. Vor dem UN-Sicherheitsrat sagte die UN-Sondergesandte für Afghanistan, Kirgistans Ex-Präsidentin Rosa Otunbajewa, Mitte Juni, Hebatullahs Dekret sei „effektiv durchgesetzt“ worden.
Die Taliban erreichten, was sich die internationale Staatengemeinschaft während ihres zwanzigjährigen Einsatzes in Afghanistan vorgenommen, aber nicht geschafft hat.
Im Gegenteil: Unter ihren Augen stieg Afghanistans Opiumproduktion auf zeitweise über 9.000 Tonnen im Jahr, obwohl allein die USA zwischen 2002 und 2017 8,62 Milliarden Dollar zur angeblichen Bekämpfung der dortigen Drogenwirtschaft ausgaben.
Doch tolerierten sie zugleich, dass vieler ihrer afghanischen Verbündeten – von den notorischen Warlords bis zur Familie des langjährigen Präsidenten Hamid Karsai – den Großteil der afghanischen Drogenprofite einsteckten. Gleichzeitig verwiesen sie wider besseres Wissen ausschließlich auf die Taliban, die als Juniorpartner auch daran partizipierten.
Der „Test für die Antidrogenpolitik der Taliban“ werde erst ab 2024 kommen, schreiben Jelena Bjelica und Fabrizio Foschini vom Thinktank Afghanistan Analysts Network. Vor allem werde die krisenhafte Wirtschaft dadurch weiter schrumpfen. Müsste das Verbot gewaltsam gegen weiterverarmende Afghan*innen durchgesetzt werden, könnte das die Stabilität des Taliban-Regimes untergraben.
.

.
Myrhoroder Schweine
In der Sowjetunion wurde die Wirtschaft zum Teil so organisiert, dass die einzelnen sozialistischen Länder bestimmte Wirtschaftsgüter für alle produzierten, die ihnen traditionell sowie vom Klima und Boden her lagen: So war Weissrussland das Kartoffelland, Moldawien das Wein- und Tomatenland und die Ukraine produzierte Weizen, Mais und Schweine. Es kursierten viele Witze über die Ukrainer und ihre Vorliebe für Speck – am Liebsten von ihrer eigenen Fettschweinrasse: dem Myrhoroder Schwein.
Diese meist grau-gefleckte Rasse wurde nahe der Stadt Myrhorod in der Oblast Poltawa vom Agronomen A.F. Bondarenko gezüchtet, indem er ukrainische kurzohrige Buntschwein-Sauen mit Ebern aus englischen Rassen (Berkshire-, Yorkshire- und Tamworth-Schweinen) kreuzte. Dazu kreierte er den „Poltawa Speck“. Seine Myrhoroder-Rasse wurde 1940 offiziell als Rasse anerkannt. Sie gilt als gut an das ukrainische Steppenklima- und -futter angepaßt – jedoch nicht an die Afrikanische Schweinepest (ASP).
Bereits 2007 war das ASP-Virus „aus Afrika, vermutlich über den Schwarzmeerhafen von Poti, nach Georgien eingeschleppt worden und hat sich seither über mehrere Trans-Kaukasische Länder nach Russland, Weißrussland und die Ukraine eingeschleppt, teilte das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit. Als ursprüngliches „Erregerreservoir“ gelten Warzen- und Buschschweine sowie auch Zecken, die selbst nicht am ASP-Virus erkranken. Außerhalb der Familie der Echten Schweine ist das Virus ungefährlich. Bei den Schweinen ist die Ansteckungsgefahr mit ASP geringer als mit der Europäischen Schweinepest (ESP), beides sind jedoch anzeigepflichtige Tierseuchen. Und für beide wird das Wildschwein als Überträger angenommen.
Die deutschen Jäger schießen sie nun wie blöd ab, denn es traten auch hier die ersten ASP-Fälle in Schweinebetrieben auf, obwohl ein mehrere hundert Kilometer langer „Schutzzaun“ an der Oder infizierte Wildschweine eigentlich abhalten sollte, aus Polen einzuwandern, damit „Deutschland eine ‚weiße Zone‘ ohne ASP-Gefahr“ bleibt, wie „topagrar.com“ schrieb.
In der Zeitschrift „FuturZwei“ (2022) erinnert sich die mecklenburgische Bäuerin Anja Hradetzky (Autorin des Buches „Wie ich als Cowgirl die Welt bereiste…und ohne Land und Geld zur Bio-Bäuerin wurde“ – 2019), an die Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen, nachdem im Nachbardorf der erste Ausbruch in Deutschland registriert worden war: „Zeitweise wurde uns wegen der afrikanischen Schweinepest sehr spontan gesperrt. Die Sperrung war für uns eine Katastrophe. Total übertrieben. In Polen läßt man die Tiere einfach durchseuchen. Am Ende gibt es eine gegen die Schweinepest resistente Population. Seitdem denken die hier, überall müssten Zäune gebaut werden. Sogar in einem Nationalpark, der eine Flussniederung ist, bauen die Zäune! Mitten durch die Flächen! Da kommt nichts mehr durch: keine Rehe, keine Hirschkälber, keine Dachse, keine Biber und all die anderen wilden Tiere auch nicht. Und die kleinen Schweinebauern werden unter Druck gesetzt, bekommen so starke Auflagen, dass sie von heute auf morgen aufgeben müssen. Die kleine Schweinehaltung, wo die Schweine noch in der Erde wühlen dürfen, wird komplett ausgerottet. Nur die Großen überleben.“
Im Januar 2015 hatten die ukrainischen Veterinärbehörden die Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) informiert, dass im Jagdrevier Desnyansko-Starogutsky ein totes Wildschwein gefunden wurde, das an der Afrikanischen Schweinepest starb. Im Juli wurden bereits 60.000 Zucht- und Mast-Schweine gekeult, nachdem festgestellt worden war, dass in einer der größten ukrainischen Schweinefarmen „Kalita“ ASP ausgebrochen war. „Der direkte Schaden wurde auf 7 Mio. Dollar veranschlagt. Das Unternehmen ist gegen ASP nicht versichert, weil weder in- noch ausländische Versicherungsunternehmen bereit waren, das Risiko einzugehen,“ wie die „Zentrale Markt- und Preisinformationen GmbH“ mitteilte. „Der Schaden für das Unternehmen geht aber noch weiter. Die Quarantänezeit für Zuchttiere erstreckt sich über ein ganzes Jahr, bevor wieder Tiere ausgestallt [verkauft] werden können. Für die ukrainische Wirtschaft vergrößert sich der Schaden noch dadurch, dass die florierenden Exporte von Schweinefleisch nach Russland 2015 gesperrt wurden. Sie betrafen rund 93 % der Ukrainischen Exporte.“ Ebenfalls 2015 mußte ein „ukrainischer Großbetrieb“ 95.000 Schweine töten.
Die Ukraine importierte selbst tonnenweise Schweinefleisch – u.a. aus Deutschland. Umgekehrt wurde mit Beginn des Krieges das aus der Ukraine kommende Futter für die hiesigen Schweine knapp. Deswegen fordern jetzt die Großschlachterei Tönnies und die Schweinezüchter-Verbände höhere Preise. Selbst den Bio-Bauern geht das aus der Ukraine stammende „Öko-Tierfutter“ aus: „Für gentechnikfreies Futter gibt es keine anderen Lieferanten,“ so der Präsident des Landvolks Niedersachsen.
Aber es fehlt auch an Futter für die Schweine in der Ukraine, wie „agrarheute.com“ 2022 mitteilte: Wegen des Krieges „bittet der Verband der ukrainische Schweinezüchter um Hilfe in Form von Schweinefutter und Tierarzneimittel.“ Er wandte sich an Organisationen der Schweinehaltung in der ganzen Welt und bat um humanitäre Hilfe für die 1.400 heimischen Schweinehalter.
Die rechtsextremen „Asow-Kämpfer“, die Mariupol verteidigen, tunken derweil ihre Patronen, die sie gegen muslimische Einheiten aus Tschetschenien einsetzen, in Schweinefett, berichtete „Die Zeit“ 2022.
In den vergangenen 30 Jahren ist der Schweinebestand in der Ukraine von etwa 20 Millionen Tieren auf gut sechs Millionen Tiere geschrumpft. Ein Grund dafür ist laut „landwirt-media.com“, dass viele kleine Schweinehalter aufgegeben haben. „In der Ukraine werden immer noch rund 40 % des Schweinefleisches in sogenannten Hinterhofhaltungen produziert. Viele Familien haben ein paar Schweine für den Eigenbedarf und den Verkauf auf kleinen Märkten. Während professionelle Schweinebetriebe in der Ukraine oft mehrere Tausend Tiere halten.“
So z.B. der Betrieb des „weichenden Erben“ eines Landwirts aus Österreich. Er übernahm eine aufgelöste Kolchose wo er nun 4500 österreichische Schweine hält. Einer der größten Schweinehaltungsbetriebe in der Ukraine ist in dänischer Hand und vernutzt dänische Schweine. 2019 wurde der Betrieb von der Afrikanischen Schweinepest heimgesucht.
Etwa 40 ukrainische Agrarbetriebe sind in deutscher Hand, die meisten bewirtschaften jeweils etwa zwei- bis dreitausend Hektar Land. Investoren aus den USA steigen gerne direkt in ukrainische Agrarbetriebe ein. Für Frédéric Mousseau, Strategiedirektor des kalifornischen Oakland Instituts, ist die Sache bereits klar, die Agrarkonzerne haben ihre Investitionen derart erhöht, dass es einer „Übernahme der ukrainischen Landwirtschaft durch westliche Firmen“ gleichkomme.
Aber auch die östlichen sind nicht untätig: So erwarb z.B. China 100.000 Hektar Ackerland in der Schwarzerderegion, das auf drei Millionen Hektar vergrößert werden soll. Neben dem Futtermittelanbau sollen darauf vor allem Schweine für den chinesischen Markt gezüchtet werden. Die chinesische Agroholding China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO) ist einer der größten Arbeitgeber in der ukrainischen Landwirtschaft und einer der größten Investoren in die landwirtschaftliche Infrastruktur (über 200 Milliarden Dollar seit 2008).
Das Myrhoroder Schwein befindet sich noch immer auf der Liste der etwa 100 Schweinerassen, die es weltweit gibt – ist jedoch 2018 laut der Ukrainischen Akademie für Agrarwissenschaften ausgestorben, und zwar durch die Afrikanische Schweinepest (ASP). Das Verschwinden der Myrhoroder Schweine ist für die Wissenschaftler besonders tragisch, denn diese Rasse war eine der ersten, die von ukrainischen Forschern entwickelt wurde: Alle vier Schweinehaltungsbetriebe der Nationalen Akademie für Agrarwissenschaften, die Myrhoroder züchteten, fielen laut agrarheute.com „der Seuche zum Opfer. ‚Damit wurde das gesamte genetische Potenzial dieser Rasse ausgelöscht‘, heißt es in einer offiziellen Regierungserklärung.“
.

.
Deutsche Träume
Es gibt eine aktuelle Studie über die häufigsten Träume in Deutschland. Erstellt hat sie die Immobilienplattform „Rentola.com“. Dahinter verbirgt sich ein „multi-internationales Team“ das derzeit laut eigener Aussage in einem Dutzend Ländern aktiv ist und bereits in diesem Jahr „50 Millionen [Immobilien-] Nutzer auf der ganzen Welt“ erreichen will. Aus ihrer „Datenstudie“ ergibt sich, dass die deutsche Bevölkerung am häufigsten von Angst und Unsicherheit träumt (46.57%), was sich vor allem durch Träume über Zähne zeigt. Wie man (wikipedia) seit Sigmund Freuds Buch „Die Traumdeutung“ weiß, streben im Traum inakzeptable Wünsche, die mit infantilen Wünschen in Verbindung stehen, nach Erfüllung. Da deren direkte Erfüllung jedoch für den Träumer unangenehm ist, werden die Wünsche in einer entstellten Weise als erfüllt dargestellt, was ein Kompromiss ist.
Bei den Zahn-Träumen muß man unterscheiden: Die Menschen unter 38 knirschen Nachts mit den Zähnen, weil sie die Anforderungen der Gesellschaft und ihre eigenen Wünsche nicht in Einklang bringen können. Dies Zähneknirschen, wenn es heftig ist und oft vorkommt, wird vom Traum aufgegriffen, der nicht selten in aggressive Situationen mündet und dann u.U. zum Alptraum wird. Bei den Menschen über 40 beziehen sich die Zahnträume dagegen auf eine drohende Zahnlosigkeit und die enormen Kosten für Zahnersatz, vor allem dann, wenn sie schon keine Weisheitszähne mehr haben und andere wackeln und rauszufallen drohen. Es sind Verlustangst-Träume. Auch das kann alptraumartige Formen annehmen, vor allem dann, wenn die Träumer tagsüber vom Fremdgehen phantasieren, und sie das im Alptraum realisieren, wobei die Männer mit einer „Vagina dentata“ (bezähnte Vagina) zu tun bekommen und die Frauen mit einem „Pene con spine (dornenbewehrtem Penis). Im Alptraum gibt es keinen Kompromiss, nur ein Aufwachen mit Schrecken. Was man jedoch auch als Kompromisslösung bezeichnen kann, denn weiter zu träumen wäre noch schrecklicher.
Nun gibt es aber eine weitere aktuelle Traum-Studie, ebenfalls von einem Unternehmen, das nicht gerade vom Fach ist: „bestonlinecasinos.com“. Dabei handelt es sich um ein Start-up von vier jungen Leuten (zwei mit Bart, eine Frau, die „jedes Automatenspiel anhand der Hintergrundmusik erkennt“ und ein Testberichtverfasser mit einer „Leidenschaft für Casino Spiele“). Die vier „stehen für verantwortungsvolles Spielen“. Das heißt wohl: Jemand hat zwei vernachlässigte Kinder und eine Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs, dann ist er ein verantwortungsloser Spieler, wenn er hunderte von Euro in Daddelautomaten oder Online-Gewinnspiele steckt. Ist dieser Jemand aber ein Millionär, der monatlich 1000 Euro verspielt und nicht mehr, dann ist das verantwortungsvoll. Und dazu steht „bestonlinecasinos.com“?
Nun zur Traum-Studie, die diese Firma in Auftrag gegeben hat: Danach träumen die meisten Deutschen vom „Fremdgehen“, am zweithäufigsten ist eine Traum-„Hochzeit und am dritthäufigsten traumhafter „Sex“. Hier wäre „Hochzeit“ der – alptraumvermeidende – Kompromiss. Das Start-up-Team hat die „Traumexpertin Inbaal Honigman“ um Deutung gebeten. Wenn man auf ihre Internetseite geht, erfährt man jedoch bloß: „Ich bin schon mein ganzes Leben lang Hellseherin und benutze Tarot-Karten, seit ich 20 Jahre alt bin. Ich verwende Tarot, Astrologie, Handlesen, Hellsehen und andere Methoden der Weissagung.“
Vielleicht deutet man nicht fehl, wenn man z.B. die „spirituelle Deutung“ des Traums „Sex Fremdgehen“ googelt: „Das Traumbild ‚Sex fremdgehen‘ interpretiert die spirituelle Traumdeutung als Irrweg. Der Träumende läuft falschen Zielen und Idealen hinterher. Er begeht geistigen Selbstbetrug und vertraut seinem eigenen Seelenplan nicht,“ heißt es auf „traum-deutung.de“. Über das Kompromiß-Traumbild „Hochzeit“ steht dort: „Der Träumer, der im Schlaf heiratet, will im realen Leben alles Alte hinter sich lassen, möglicherweise sogar eine bestehende Beziehung.“
Der Nachteil dieser ganzen Traumrumdeuterei hier ist, dass er überall gültig ist bzw. sein soll. Was aber sind denn nun genuin deutsche Träume? Die Süddeutsche Zeitung schreibt: „Viele Menschen plagen sich in der Nacht am meisten mit der Arbeit. 55 Prozent aller Arbeitnehmer träumen vom Job, fast ein Drittel soll sogar einmal in der Woche Albträume haben. So lautet zumindest das Ergebnis einer Auswertung von Suchanfragen eines auf Lebensläufe spezialisierten Online-Portals, das sich cvapp.de nennt.“ Konret auf die Deutschen bezogen heißt es in der SZ: „Deutsche träumen offenbar davon, ohne Hose zur Arbeit zu gehen. Dies bedarf jedoch einer weitaus genaueren Analyse: Bedeutet dieser Albtraum nun tiefe Unsicherheit, gibt es da vielleicht doch einige Probleme im Job? Oder ist es ein Zeichen, dass es vielleicht an der Zeit wäre, eine neue Hose zu kaufen?“ Oder eine Immobilie weit draußen.
.

.
ZDF: Totalausfall von 18 Puma-Schützenpanzern im Einsatz an der ukrainischen Front.
NZZ: Zerstört und aufgegeben – Dutzende westliche Panzer bei ukrainischer Offensive offenbar verlorengegangen.
.
Schinkenschneidemaschinen
Eine Bekannte erwarb ein Frauenkloster, in dem sie im Keller eine verrostete Schinkenschneidemaschine fand – so groß und hoch wie ein Bürostuhl. Sie ließ das Monstrum reparieren und nahm es in Betrieb. Anders die noch größere Schinkenschneidemaschine im Frühstücksraum eines Dresdner Hotels, in dem wir übernachteten, die nur Dekoration zu sein schien. Von meiner südeuropakundigen Freundin erfuhr ich, dass in Spanien fast alle Restaurants, in denen Serrano-Schinken von der Decke hängen, auch Schinkenschneidemaschinen irgendwo rumstehen haben, einige nur als Antiquitäten. Wie teuer ist so eine Maschine? Das Geschäft für Küchenaccessoires »Deutschmann« in Pankow, das mit dem Spruch »Have a Knife Day« wirbt, führt keine Schinkenschneidemaschinen. In einem Internettestbericht erfahre ich jedoch, dass die Schinkenschneidemaschinen von Berkel die besten seien – und die teuersten: Sie kosten bis zu 10.000 Euro.
Erfunden hat sie der Rotterdamer Fleischermeiste Wilhelmus Adrianus van Berkel, 1898 gründete er die weltweit erste Fabrik für Aufschnittmaschinen. Er exportierte sie bald in die ganze Welt. Dann gründete er Fabriken in anderen Städten, die erste in Chicago. Am Anfang der Berkel-Maschinenproduktion stand laut Wikipedia »das Modell A von 1898. Dieses wurde kontinuierlich weiter verbessert und an die Wünsche der Fleischereien angepasst«.
Es gibt sogar ein Museum für die Schinkenschneidemaschinen von Berkel: sinnigerweise in Parma, von wo der italienische Parma-Schinken stammt. Das Museum heißt »La Bottega del Restauro«, sein Gründer Icilio begann vor 20 Jahren mit der »Reparatur und dem Verkauf antiker Berkel-Schwungradschneider«, sein Sohn verkauft heute restaurierte Schinkenschneidemaschinen an Sammler in der ganzen Welt. Zum Parma-Schinken sei noch erwähnt, dass es für seine Herstellung strenge Regeln gibt. 2018 wurde bekannt, dass die Muttertiere der Schweine, von denen die Schinken stammen, heimlich mit Samen dänischer Eber befruchtet wurden, was laut Die Welt »ein absolutes No-Go« ist. »Die Betrüger wurden nicht nur verurteilt; zudem verloren beinahe eine Million Schinken die Bezeichnung Parma-Schinken und mussten vom Markt genommen werden.« 2019 traten vier Inspektoren des Instituts »Parma Qualità« (IPQ), das die Produktionsketten kontrolliert, zurück. »Zu den Mitgliedern des IPQ gehören mit den Züchtern und Schlachthöfen ausgerechnet die Betriebe, die von dem Institut überwacht werden sollen.« Es gab da also einen Interessenkonflikt. Die Kennzeichnung der Schinken als Parma-Schinken wurde gestoppt. Am Parma-Schinken hängen direkt 5.000 Arbeitsplätze und 50.000 weitere in der Zulieferindustrie.
Neben Italien gehört Spanien mit zu den größten europäischen Schinkenproduzenten. »Statistisch gesehen kommen im katalanischen Osona sieben Schweine auf einen Anwohner«, heißt es auf »riffreporter.de«. 2020 wurden in Spanien 56 Millionen Tiere geschlachtet. »Immer wieder machen Tierschutzorganisationen mit erschütternden Videos auf die unhaltbaren Zustände in den industriellen Zuchtanlagen aufmerksam und fordern, wie Greenpeace, einen sofortigen Genehmigungsstopp.« Aber »die Beharrungskräfte sind stark«.
Von Costa-Nachrichten, einem Medienkonzern in Ippen, der an den spanischen Küsten mehrere Wochenzeitungen für Touristen herausgibt, wurde der »Schinkenexperte« und »professionelle Schinkenschneider« Pepe Catalá 2022 interviewt: »Wenn ich schneide, bin ich in meinem Element und glücklich – wie ein Musiker, der ein Instrument spielt«, sagte er. »Ein Experte erkennt die Eigenheiten jedes Exemplars und weiß, wie man das Optimale aus jedem Schinken herausholt.«
Es gibt drei Klassen spanischen Schinkens im Spitzenfeld, die alle von der Rasse Cerdo Ibérico stammen. »Beim Jamón Ibérico de Cebo lebt das Schwein im Stall und wird mit Getreide und Hülsenfrüchten gefüttert«, erklärte der Schinkenschneider. »Er kostet je nach Gewicht rund 200 Euro.« Beim Jamón Ibérico de Cebo de Campo, der rund 225 Euro kostet, erhalten die Schweine dasselbe Futter. »Doch sie werden auf der Weide gehalten, fressen also auch Gras, Kräuter , Würmer und Schnecken. Zudem trägt die Bewegung dazu bei, dass sich das Fett im Fleisch verteilt, der Schinken also von feinen Fettäderchen durchzogen ist.« Der Star unter den Schinken in Spanien, der 300 bis 400 Euro kostet, sei der Jamón Ibérico de Bellota. »Da lebt das Schwein in den letzten Monaten – also normalerweise von Oktober bis Februar – auf Wiesen mit großen Steineichen, wo es Eicheln frisst.« Pepe Catalá schneidet deren Schinken nicht maschinell, sondern mit einem Messer: „Schinkenschneiden ist eine Show“, sagt er. „Die Zuschauer bezahlen mich dafür“.
.
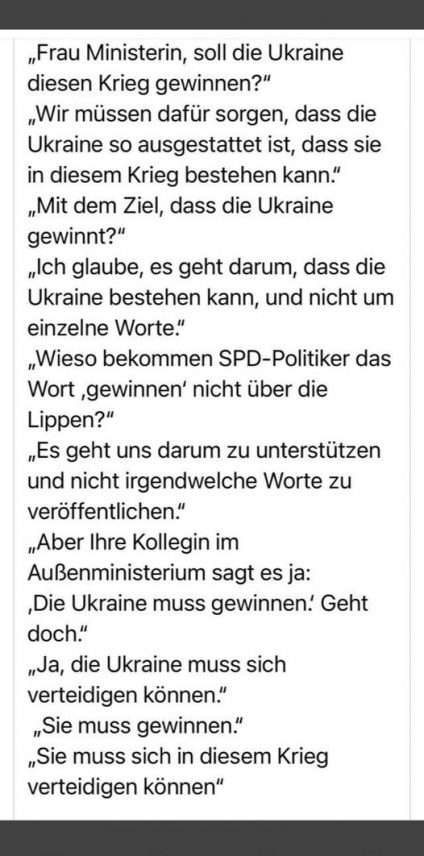
Undeutliche deutsche Worte
.

Deutliche amerikanische Worte
.
Beitrittsgebiets-Prosa
Nach dem Film über die „Ost-taz“ las ich noch einmal die Bücher „Das letzte Jahr – Begegnungen“ von Martin Gross und „Der Osten ist eine Erfindung des Westens – Wie die Konstruktion des Ostens unsere Gesellschaft spaltet“ von Dirk Oschmann. Gross ist ein freier Autor aus dem Schwarzwald. Der in Gotha geborene Oschmann lehrt Germanistik in Leipzig. Gross’ Buch erschien 1992 im Ostberliner Basisdruck-Verlag und wurde 2020 vom Leipziger Verlag „Spector Books“ erneut veröffentlicht – mit verändertem Untertitel: „Aufzeichnungen aus einem ungültigen Land“. Das Buch von Oschmann mit dem Motto von Nietzsche „Alle verschwiegenen Wahrheiten werden giftig“ geht auf seinen in der FAZ 2022 veröffentlichten Artikel zurück, in dem er die anhaltende Diskriminierung der Ostdeutschen in bezug auf Löhne, Renten, Führungspositionen etc. kritisierte. Im Buch stellte er dann „Auge um Auge“ die Geringschätzung der „Ostler“ durch die „Westler“ als eine Gefahr für die „Demokratie“ dar, wenn diese die zuvor von der kommunistischen „Diktatur“ Gebeutelten weiterhin „diskursiv zurichten“, d.h. um ihre „Chancenteilhabechancen“ bringen und dadurch „die Ungleichheit naturalisieren“.
Oschmanns Wutbuch erschien im Ullstein-Verlag, den der Springerstiefel-Konzern 2003 dem schwedischen Medienmulti Bonnier verkaufte. „Natürlich ist der Westler Gross, der das Jahr 1990 zwecks Recherchen in Dresden verbrachte, nicht frei von Überheblichkeiten, aber warum veröffentlichte dann ausgerechnet ein gegenüber solchen Zumutungen aus dem Westen allergischer DDR-Dissidenten-Verlag seine Wende-Notizen?
Zu Oschmanns wichtigsten Zitatenlieferanten gehört der Schriftsteller Klaus Wolfram, der Lektor im Basisdruck-Verlag ist und in dessen Zeitschrift „Abwärts“ veröffentlicht (so wie ich nebenbeibemerkt auch). Es existiert also ein ziemliches Durcheinander zwischen den beiden Büchern, ihren Autoren und Verlagen, fast könnte man dabei von einer gelungenen Wiedervereinigung sprechen, was jedoch von beiden Autoren mit Zahlen, Daten, Fakten, Anekdoten und Beobachtungen widerlegt wird. Von Gross bereits 1990, Oschmann erlebte das Wendejahr als Student in Jena.
Dort bezogen damals die an die Uni berufenen konservativen bis reaktionären West-Juristen und –Mediziner Villen am Berg und brachten bis zu zwölf Assistenten mit, so dass sogar der CDUler im Akademischen Senat schimpfte: „Wir sind doch keine Familienzusammenführungs-Einrichtung“. Ich weiß das von einem Pastor, der in seiner Gemeinde auf halbem Wege zwischen den oben wohnenden Ehefrauen der Westler und den unten im Tal lebenden Ost-Frauen vermitteln mußte: „Meine Predigt ist jedesmal ein Ritt über den Bodensee,“ meinte er. Oschmann meint, dass es vor allem die ostdeutschen Männer sind, die der Westen diskriminiert, während „die ostdeutschen Frauen tendenziell eher gefeiert werden“. Besonders infam fand er 2019 den Spiegel-Titel „So isser, der Ossi“.
Obwohl der Professor den „kicker“ liest und „11 Freunde“ abonniert hat, sieht er im Fußballspiel seltsamerweise keine Realmetapher für „kommunikatives Handeln“: Der Ball ist das Thema, beide Seiten können (und müssen sogar) damit dribbeln, abgeben, sich freischießen usw., aber irgendwann muß er ins Tor gekickt werden, d.h. übersetzt: „publish or perrish!“. Fuß- und Kopfarbeiter haben im Wesentlichen die selbe Aufgabe. Oschmann sieht allerdings, dass die Westler ständig ballverliebt rumdribbeln, ohne abzugeben, dazu zitiert er Klaus Wolfram, der „treffend“ von einem „‚Selbstgespräch‘ des Westens über den Osten“ spricht. Es ist zu schade, dass Oschmann „Die Kultur der Niederlage“ von Schivelbusch nicht gelesen hat!
Der Schriftsteller Gross sieht vor Ort, wie die Westler die Ostler mit Waren, Werbung und Politikern blitzkriegartig an die Wand drücken. So geht er z.B. zu einem „Billigmarkt“ auf der Grünen Wiese: „alles gigantisch! Eine fußballfeldgroße Fläche“ – drei Zelte, zwanzig Kassen. Bis zu 300 LKW liefern täglich Nachschub, der aus den Kartons heraus verkauft wird: Alles, Waschmittel und sogar Toilettenpapier aus dem Westen. So gehen anscheinend sämtliche Geschäftsleute von dort vor, denn der Verkaufsleiter erzählt ihm: „Es gibt in ganz Europa keine Großzelte mehr, alles steht bereits hier irgendwo in der DDR!“ Man könnte sie höchstens noch aus den USA beziehen. Als Gross in einer Kantine zwischen Personenschützern (aus dem Westen und der „Stasi“) sitzt, die einem West-Politiker zugeordnet sind, hört er, wie die Body-Guards aus dem Westen über den Osten lästern: „Und für das Klopapier müßte man eine Schmerzenszulage erhalten“. Die Verwalterin des „Forums“ klagt über die neuen bürokratischen Vorschriften: Sie darf nicht mehr auf der Bank einfach eine Rechnung, für Reinigungsmittel z.B., aus ihrem Etat bezahlen, sondern muß erst zum Rathaus, wo das aber niemand zu entscheiden wagt. Endlich: Mit der Unterschrift geht sie zurück zur Bank. „Da stehen dann hunderte Leute, die z.B. 20 Mark abheben wollen, weil sie für ihre Kinderkrippe Klopapier brauchen“. Alle kommunalen Einrichtungen müssen die „Deutsche Bank“ benutzen, die dazu 1990 in jeder „Ernst-Thälmann-Strasse“ der DDR eine Filiale, z.T. in Containern, eröffnete. Ab 1991 wurde das DDR-Klopapier endgültig knapp. Als der Staat 2020 das erste „Lockdown“ ankündigte, wurde in ganz Deutschland wie oben bereits erwähnt auch das BRD-Klopapier knapp.
.

.
Kaugummi
„Mensch, hier gibt es ja Millionen von weißen Flechten auf den Gehwegplatten,“ erstaunte sich ein Freund, der mich in Berlin besuchte. Mit seinem Schweizer Messer kratzte er eine der Flechten ab. Das runde Stück betrachtend erklärte er: „Flechten sind eine Symbiose aus einem Pilz und einer Alge. Kürzlich entdeckte man, dass auch noch mindestens ein Bakterium dazugehört.“ Ich kratzte dann ebenfalls einen runden weißen Fleck ab. Es war ein plattgetretenes Kaugummi. Die ganze Stadt war mit Flechten und Kaugummis quasi gepflastert. „Gibt es denn überhaupt noch Leute, die Kaugummis kauen?“ Fragte mein Freund.
Ja, aber sie werden weniger. Am Anfang, als die Amis 1945 kamen, hatten zunächst die Soldaten großzügig den Kindern „Wrigleys Spearmint“ geschenkt. In einer Packung waren fünf Streifen. Wir kauten sie stundenlang. Man konnte sie schon bald in vielen Läden kaufen für 50 Pfennig die Packung – und kaufte sie auch wie blöd. Das Kaugummikauen sollte gut gegen Stress sein und der Pfefferminzgeschmack gut gegen Mundgeruch. Der Westfälische Anzeiger schreibt: „‚Wrigley‘s Spearmint Gum, Gum, Gum…Nimm die echte große Frische’, sang es in den 1980ern aus jedem TV-Werbeblock. Zu sehen waren aktive Menschen, die mit einer übergroßen Packung des Kult-Kaugummis durch prächtige US-Kulissen liefen. Glücklich sahen sie dabei aus.“
Aber jetzt gibt es das Kaugummi nicht mehr. Die Zeitung aus dem Ruhrgebiet weiß, warum: „Wegen der ständig sinkenden Nachfrage hat der US-Konzern Mars den Kaugummi-Klassiker vom deutschen Markt genommen, auch seine Streifenkaugummis der Marken Extra und Orbit“. Dafür gibt es nun in den Spätkaufläden haufenweise Wrigleys Dragees in vielen Geschmacksrichtungen. Seit 2004 auch wieder Kaugummis der Marke „Hubba Bubba“ von Wrigley. Sie bestehen aus einer Kaumasse, die weicher und dehnbarer ist als die von anderen Kaugummis. Wer sich am Wettbewerb um die größte „Hubba Bubba-Blase“ beteiligt und den „Weltrekord mit 58,4 Zentimetern Blasendurchmesser knackt“, gewinnt „tolle Preise“.
In Automaten und an Kiosken gab und gibt es auch deutsche Kaugummis: bunte Kugeln, die aber nicht so „authentisch“ schmeckten, dennoch haben wir sie ab und zu gekauft. Sie enthielten Sammelbilder und man konnte damit auch große Blasen machen. Im Schulunterricht durften wir bald kein Kaugummi mehr kauen, erst recht keine knallenden Blasen damit machen.
Die Kugeln, in mehr als 20 Farben, stammten ab 1978 aus Bernburg, wo die DDR die komplette Kaugummi-Produktionsanlage der Pinneberger Firma „OK“ übernahm. Produziert wurde fortan für Intershops, als Bückware und den Export (80 Prozent der jährlich produzierten 2000 Tonnen gingen in den Westen). 1993 wurde der VEB Beikowa vom Stuttgarter Bäcker Thomas Wohlgemuth übernommen, der aber „statt der einst 180 Mitarbeiter nur noch 24 beschäftigt. Es ist „Deutschlands einzige Kaugummi-Fabrik“, meint die BILD-Zeitung.
Ich kaute gerne „Hollywood“-Kaugummis mit Mentholgeschmack, die von der Pariser Firma „Kréma“ hergestellt wurden, u.a. von meiner BDM-Tante Anneliese, die mir die Streifen nach Deutschland schickte. Sie hatte 1946 in Bremen einen französischen Zwangsarbeiter geheiratet. Als die beiden sich 1955 trennten, fing sie als Bandarbeiterin bei „Kréma“ an. „Fraîcheur de vivre“ lautete der Werbespruch für „Hollywood“-Kaugummis, die ein US-Soldat in Frankreich einführte, der 1941 an der Invasion in der Normandie teilgenommen hatte.
Auf der Internetseite „sweets.ch“ heißt es, dass er als Generalvertreter für den US-Kaugummi-Hersteller Beech-Nut nach Frankreich zurückkehrte. „1952 rief er die Kaugummi-Marke ‚Hollywood‘ ins Leben. 1955 fusionierte das Unternehmen mit Kréma, die unter anderem die Marke Malabar besass. 1958 wurden Hollywood-Kaugummis zum ersten Mal auf Plakaten beworben. Das Sujet thematisierte den amerikanischen Traum. Zehn Jahre später waren Hollywood Chewing Gums zum ersten Mal im TV zu sehen. 1963 kaufte General Foods Kréma-Hollywood. 1968 lancierte das Unternehmen die zuckerfreie Linie ‚Hollywood Light‘. 15 Jahre später folgte die Linie ‚Hollywood Blancheur‘. 1990 wurden Kréma, Hollywood, Malabar und Kiss Cool im neuen Unternehmen Kraft Jacobs Suchard zusammengefasst. Zehn Jahre später verkaufte Kraft Foods sein Kaugummi- und Süswarengeschäft an Cadbury. Weitere zehn Jahre später kaufte Kraft Foods Cadbury und übernahm die von General Foods geerbten Marken wieder. Seit der Abspaltung der Kraft Foods-Gruppe, 2012, gehört Hollywood „Mondelēz International“ – ebenfalls ein US-Süßwarenkonzern.
Kaugummi hat uns im Westen neben Hollywood-Filmen, Coca Cola, Marlboro und Jeans den „American Way of Life“ nahe gebracht, der nun so oder so zu Ende geht, denn um ihn weltweit für alle durchzusetzen, bräuchten wir fünf Planeten Erde, schreiben Deborah Danowski und Eduardo Viveiros de Castro 2023 in ihrem Buch „In welcher Welt leben?“ .
.
.
Frankfurter
Bis in die Neunzigerjahre existierten in Westberlin 900 Bordelle – so viele wie Banken in Frankfurt. Dort gibt es aber nicht nur extrem viele „Banker“, sondern auch „Frankfurter Würstchen“: eine Brühwurst aus Schweinefleisch in einem Dünndarm vom Schaf. Ich hatte dort ein Jahr lang für jeweils fünf Tage im Monat einen guten Job: Zunächst suchte ich drei Tage lang in jeder Frankfurter Bibliothek nach wissenschaftlichen Studien, egal in welcher Sprache, sofern sie eine Zusammenfassung auf Englisch besaßen. Dann machte ich daraus eine Art Bildzeitungs-Artikel. Wenn z.B. die Theologen anhand neuer Bibelfunde herausgefunden hatten, dass die Goten doch nicht vom Norden, sondern vom Süden gekommen waren, dann titelte ich: „Schade, Goten kamen nicht vom Norden“ usw..
Gelegentlich zählte ich quasi auch noch zur Personage der „Karl-Marx-Buchhandlung“. Ein paar Mal kam dort ein großer, gut aussehender Mann rein in einem sandfarbenen Maßanzug. Er erzählte mir, dass er in Bonn Personenschützer beim Kanzlers Helmut Schmidt gewesen sei. Der SPD-Politiker wäre seinen Bewachern gegenüber fast kollegial gewesen und hätte z.B. in der Pförtnerloge manchmal Cognac mit ihnen getrunken. Aber dann kam Helmut Kohl und der hätte sie wie ein Duodezfürst seine Bediensteten behandelt. Das habe er nicht ausgehalten und gekündigt. Nun wäre er bei der Polizei und nebenbei noch gelegentlich Dressman. Für ersteres sei Frankfurt ein schlechtes Pflaster, weil es zu viele Fixer und im Bahnhofsviertel zu viele Möchtegernzuhälter gäbe, beide würden für viel Ärger sorgen und immer mehr werden. Für letzteres sei Frankfurt aber ein guter Standort, weil es hier so viele amerikanische Werbeagenturen gäbe, die ihn immer mal für Fotos oder Werbefilme buchen.
Eine Buchhändlerin erzählte mir, dass ihr Onkel ein Promi-Proktologe am Westhafen sei und ein Mittel erfunden habe, das als rektalen Einlauf verabreicht wird und euphorisierend und leistungssteigernd wirke, man dürfe es aber nur einmal im Monat anwenden. Und das reiche vielen Managern und Bankern nicht. Sie würden deswegen seinen Bademeister mit hohen Summen bestechen, damit er ihnen vor wichtigen Verhandlungen oder Sitzungen noch schnell ein Klistier verpasse.
In einer Kneipe im Bockenheimer Viertel lernte ich Klaus-Dieter kennen. Er war Jurist, beschäftigte sich aber mit ganz anderen Dingen, kiffte gerne und versuchte polnisch zu lernen. Wir trafen uns mitunter unverabredet . Aber dann lernte er eine Lehrerin kennen und die setzte ihn wieder auf die Spur, d.h er nahm einen Job in einer Wirtschaftskanzlei an. Auf dem Weg ins Büro kam er morgens am Hotel „Hessischer Hof“ vorbei. Um sein vorheriges Bohème-Leben nicht ganz untreu zu werden, frühstückte er dort – immer umsonst, denn man war dort so vornehm, dass ihn keiner nach seiner Zimmernummer fragte.
Er erzählte mir lustige Geschichten über seine Arbeit, die vor allem aus Gesprächen mit mittelständischen Unternehmern bestand. Er mußte ihnen eigentlich nur zuhören, während sie in ihren Chefzimmern hinter einem dicken Schreibtisch saßen und ihm ihr Leid klagten: Sie hatten Manager für die verschiedenen Geschäftsbereiche eingestellt und alles lief rund, aber darüber war ihre Ehe „zum Kotzen“ geworden, ihre Kinder waren aus dem Ruder gelaufen und wenn sie mal in ihrem Unternehmen eingriffen, dann gab es sofort Ärger, weil alles durcheinander kam und sie ihre leitenden Angestellten mit viel Mühe wieder beruhigen mußten. Zuhause wie in ihrer Firma waren sie nur noch Frühstücksdirektoren und fühlten sich überflüssig und elend. Ihre Suaden waren Klaus-Dieters täglich Brot – für einige hundert DM pro Sitzung. Damals eröffneten etliche arbeitslose Philosophen in Frankfurt eine „philosophische Praxis“, in der sie sich solche Unternehmer als gut betuchte Klienten wünschten, aber es kam so gut wie keiner, so dass diese hochdiskursiven Start-Ups schnell wieder verschwanden.
Im Vogelsberg, wo ich damals wohnte, zählte Daniel, ein ehemaliger israelischer Panzerfahrer, zu unserer links-alternativen Scene. Er versuchte sich in allen möglichen Geschäften: bedruckte T-Shirts, Autoersatzteile, Deals mit den griechischen Pelzhändlern am Frankfurter Bahnhof usw.., aber nichts klappte richtig. Im Gegensatz zu den Geschäften seines Bruders, die jedesmal guten Gewinn abwarfen. So fing der z.B. an, an einem winzigen Stand auf dem Bahnhof frischgepressten Orangensaft zu verkaufen – und zahlte schon bald für seine sechs Quadratmeter 5000 DM Miete: Sie richtete sich nach dem Umsatz, der demnach erheblich war. Die Bildzeitung interviewte ihn als „Deutschlands erfolgreichsten Jungunternehmer“, zuletzt fragte sie ihn, was er sich wünschen würde. „Einen Saftstand auf der Messe“, antwortete er – und bekam prompt ein Angebot von der Messeleitung. Schon bald hatte er vier solche Saftstände und ließ seine Jaffa-Orangen von Mitarbeitern auspressen.
.

.
Der berühmte Zoodirektor
Als ich 2020 im Frankfurter Zoo war, sah ich große Reliquien seines ersten Nachkriegsdirektors, des westdeutschen TV-Stars Dr. Bernhard Grzimek. Er hat maßgeblich, auch finanziell, zur Gründung des Serengeti-Nationalparks in Kenia und Tansania beigetragen. Und hat sich dort auch begraben lassen, neben seinem Sohn, der beim Zählen der Gnu- und Zebraherden im zukünftigen Nationalpark mit seinem Flugzeug abgestürzt und gestorben war. Das Flugzeug mit Zebrastreifen steht heute im Frankfurter Zoo. Hierzulande hat man Grzimek seine Mitarbeit als Experte im Landwirtschaftsministerium der Nazis vorgeworfen. Weil er dazu bei der Entnazifizierung falsche Angaben gemacht hatte, mußte er kurzzeitig seinen Direktorenposten räumen.
Nun wird er rund um den Serengeti-Nationalpark kritisiert, denn dazu wurden 1959 die dort lebenden Massai umgesiedelt. Ebenso im Ngorongoro-Krater, ein weiterer Nationalpark, wo die Vertreibung der Massai noch im Gange ist. 5000 sind schon weg, die letzten 5000 werden durch Zerstörung ihrer kommunalen Einrichtungen zum Wegzug gedrängt. Grzimek ging es darum, so große Wildtier-Schutzzonen wie möglich einzurichten. Die ersten waren nur für weiße Großwildjäger gewesen, mit Grzimek kamen auch weiße Touristen. Zunehmend jetzt auch weiße Studentinnen, die sich in den afrikanischen Nationalparks und Rehabilitationszentren für Nashörner und Elefanten nützlich machen und dafür nur wenig zahlen müssen. Noch heute werden viele Parks erweitert und neue eingerichtet. Daneben gibt es auch viele private – von reichen Weißen und westlichen Konzernen.
Deren Primat des Artenschutzes kollidiert aber zunehmend mit den Anstrengungen afrikanischer Länder, ihre artenreichen Gebiete in eigener Regie zu verwalten und zu vermarkten. Noch immer besteht ein Großteil der Parkleiter und ihren staatlichen Vorgesetzten aus Weißen. Und das Geld für ihre Budgets kommt aus Europa und Amerika. Es wird vor allem zum Kauf von Waffen gegen Wilderer verwendet.
2022 organisierte der kenianische Naturschützer Kaddu Sebunya einen „Kongress für Afrikas Schutzgebiete“ in Ruandas Hauptstadt Kigali. Das erste Mal, dass sich Regierungsvertreter von 52 afrikanischen Staaten und Manager der rund 8.500 Naturschutzgebiete des Kontinents im eigenen Kreis und nicht unter der Ägide ausländischer Naturschutzorganisationen trafen. „Afrikanischen Experten ist die Deutungshoheit über den Naturschutz seitens der ‚Ersten Welt‘ schon lange ein Dorn im Auge: Sie führen deren Denkweise auf den Kolonialismus zurück – und dessen Verständnis des Naturschutzes als ‚Festung‘,“ berichtete die Frankfurter Rundschau. „Europäer sehen Afrikas Bevölkerung als größten Feind der großartigen Fauna und Flora ihres Kontinents. Afrikas Nationalparks sind ausschließlich auf die Bedürfnisse ausländischer Touristen ausgerichtet – ob sie mit Fotoapparaten oder Repetiergewehren kommen. Dagegen kommen Afrikaner und Afrikanerinnen in den Reservaten vornehmlich als tanzende Mädchen in Baströckchen, als Kellner oder höchstens als Spurensucher vor. Solange die Interessen und Bedürfnisse der einheimischen Bevölkerung nicht berücksichtigt werden, könne Naturschutz nur scheitern, meint Sebunya. Unter anderem müsse die Ökonomie in den Regionen um die Parks auf die Schutzgebiete abgestimmt werden, sagt er, als Sozialwissenschafter: Denn nichts ist für wilde Tiere gefährlicher als arme und unzufriedene Menschen“.
Über die Perspektiven der Artenschutz-Gebiete in Afrika hatten ein Jahr zuvor drei Naturwissenschaftler ihre Überlegungen u.a. als „Open-Access-Paper“ in den kalifornischen „Academia Letters“ veröffentlicht: Der Biologe Eric Djom Nana vom Kameruner Institut of Agricultural Research for Development sieht die Entwicklung der Wildtier-Reservate pessimistisch, was er in seiner Studie schon im Titel ausdrückte: „Das Paradigma des Naturschutzes in Zentralafrika ist gescheitert“. Diese These war ihm quasi Voraussetzung dafür, dass man über Alternativen nachdenken müsse.
Ähnlich sah das der südafrikanische Zoologe Mduduzi Ndlovu von der Universität in Mpumalanga: Man müsse neue Weg zum Schutz von Wildtieren und -pflanzen gehen. Er schlägt konkret einen „Mixed-Land-Use“ vor, d.h. er fragte sich: „Könnte ein auf den ländlichen Communities basierender Tierschutz ein solches Modell dafür sein?“ Konkret dachte er dabei an die Integration von Rinderherden der Ngunis in die Reservate für Spitzmaulnashörner.
Der nigerianische Umweltforscher Jonathan Chukwujekwu Onyekwelu an der TU von Akure, Abteilung Forst- und Holz-Technologien, setzt auf die unter den afrikanischen Menschen weit verbreitete Angst vor den Göttern, die zur Heiligung der Friedhöfe führte – und die deswegen zur Erhaltung der Biodiversität beitragen, d.h. Rückzugsgebiete für bedrängte Arten sein könnten. Dabei sah Onyekwelu allerdings eine Gefahr im Wechsel der Glaubenssysteme: „Die Leute glauben nicht mehr an die (alten) Götter, das entheiligt die Friedhöfe, wodurch aus diesen Standorten für Wildtiere und – pflanzen Immobilien werden könnten.“
In den Industrieländern macht man aus verlassenen Immobilien, die radioaktiv oder chemisch verseucht sind, Naturschutzgebiete. So demnächst auch die „Todeszone“ um das AKW Tschernobyl zum „Radioökologischen Biosphärenreservat Tschernobyl“, das so groß wie Luxemburg und das Saarland ist. In den USA gibt es 3000 verseuchte Gebiete, die nicht betreten werden dürfen, außer von Biologen und „Rangern“. Sie umfassen z.T. hunderte Quadratkilometer. Ihre Entgiftung ist unfinanzierbar. Desungeachtet hat sich dort eine reichhaltige Flora und Fauna angesiedelt, die geschützt wird oder werden soll. In Tschernobyl u.a. Przewalski-Pferde – kein Mensch weiß, wie sie da hingefunden haben. Sie haben sogar einen verlassenen Stall – besetzt, wenn man so will.
.

.
Naturschutz-Miseren
Statt der europäischen und amerikanischen Trophäenjäger suchen jetzt vermehrt die noch reicheren arabischen Jäger die Nationalparks heim. Darüberhinaus fließt immer mehr Geld „aus Anti-Terror-Budgets, u.a. von den Amerikanern, in den Naturschutz. So viel, dass private Sicherheitsunternehmen nach Afrika kommen. Typen, die vorher für das amerikanische Militär im Irak oder in Afghanistan gearbeitet haben. Keiner dieser Leute ist in Polizeiarbeit ausgebildet. Alles, was sie können, ist töten. Sie kommen nach Afrika, um Menschen zu töten. Weil es zu viel Geld gibt. Schutzgebiete sind ein unglaublich primitives und gewaltsames Mittel des Naturschutzes“, meint der kenianische Autor Mordecai Ogada , der 2016 eine Kritik des Naturschutzes in Kenia mitveröffentlichte: „Die große Naturschutz-Lüge“, 2020 interviewte ihn die Zeitschrift „Geo“ zu seiner These „Naturschutz ist der neue Kolonialismus“.
„Als die etwa 70.000 Massai sich im Sommer 2022 weigerten, ein 1500 Quadratkilometer großes Gebiet im Bezirk Loliondo (östlich des Serengeti- und nördlich des Ngorongoro-Nationalparks) zu verlassen, schoss die tansanische Polizei mit scharfer Munition und tötete einen Angehörigen der Volksgruppe, deren stolze Hirten in keinem Werbeprospekt der Serengeti fehlen,“ schrieb „Le Monde dplomatique“. Die Verwaltung der tansanischen Region Arusha hatte das Gebiet in Loliondo einem Jagdunternehmen der Vereinigten Arabischen Emirate zur Nutzung überlassen: als Großwildjagdgebiet für Ölscheichs, deren Geld die Regierung in der tansanischen Hauptstadt Dodoma überzeugt hatte. Schon seit 1992 veranstaltet dieses Jagdunternehmen Großwildjagden in Tansania, u.a. mit Treibjagden vom Hubschrauber aus und dem Anlocken mit Salzlecksteinen. Nun sollen in Loliondo auch noch fünf Luxushotels entstehen. „Ein unbegreiflicher Vorgang, meint der Geschäftsführer der African Wildlife Foundation, Kaddu Sebunya: Wir müssen die Art und Weise, wie Naturschutz auf unserem Kontinent betrieben wird, von Grund auf verändern“.
Ogada erwiderte auf die Frage von „Geo“: Wer lügt? „Sobald jemand denkt, er wäre ein Retter: Das ist der Moment, an dem alles schiefgeht. Es gibt keine Heilsbringer. Man muss nicht nach Afrika gehen und Elefanten retten. Naturschutz in Afrika ist eine Form von Selbstverwirklichung – geworden. Gott sei Dank hat Jeff Bezos, der reichste Mann der Welt, noch kein Interesse an der afrikanischen Tierwelt gezeigt. Er würde uns den Rest geben. 2018 haben weiße Tourismus-Investoren die Regierung um eine Genehmigung gebeten, für teure Restaurants Tiere schießen zu dürfen. Und eine Arbeitsgruppe des Ministers ist bizarrerweise zu dem Schluss gekommen, dass man das erlauben sollte. Bisher ist das nicht umgesetzt worden. Aber es ist doch verrückt, dass jemand es für politisch tragfähig hält, den Touristen Impala-Steaks zu servieren, während ein schwarzer Dorfbewohner erschossen wird, wenn er bloß den Nationalpark betritt. Wilderer werden in Kenia immer wieder erschossen, aber manchmal trifft es auch jemanden, der einfach nur durch ein Schutzgebiet läuft.“
Die chinesischen Interventionen in Afrika tangieren die Nationalparks bisher nur am Rande – buchstäblich, denn sie errichten höchstens Industrieobjekte und Bergwerke zu nahe an den Tierreservaten oder sie planen eine Eisenbahntrasse zwischen Mombasa Port und der Hauptstadt Nairobi sowie in Richtung der Nachbarländer durch den Nairobi Nationalpark. Die Umweltschützer sehen dadurch die dortige Tier- und Pflanzenwelt bedroht und verklagten die Regierung.
Im Internetorgan der „gemeinnützigen Denkfabrik“ Deutschlands „Young Initiative on Foreign Affaris and International Relations“ wägt eine Autorin das zwischen Ökonomie und Ökologie ab – und schreibt über die „Standard Gauge Railway (SGR) – die chinesische Projektleitung, die auch an der Finanzierung der Milliarden teuren kenianischen Bahnlinie „erheblichen Anteil“ hat: „Infrastrukturprojekte [bergen] stets ökologische und soziale Risiken. Die SGR ist insofern ökologisch bedeutend, als dass das moderne Zugsystem CO2-Emissionen im Vergleich zum Autoverkehr reduziert“.
Die der Falkenjagd frönenden Saudis zog es 2010 in das Ölland Aserbaidschan. Der Physiker und „Geopoet“ Alexander Ilitschewski schrieb 2016 ein Buch „Der Perser“ – über seinen einstigen Schulkameraden in Baku, der inzwischen Leiter der Wildhüter-Brigade des Nationalparks “Sirvan“ an der Küste des kaspischen Meeres geworden war. Aufgrund der immer maßloser von den müßigen Saudis betriebenen Falkenjagd waren die Trappen auf der arabischen Halbinsel und in Marokko ausgerottet worden. Deswegen erkauften sie sich bei der aserbaidschanischen Regierung das Recht, mit ihren Falken im Trappen-Schutzgebiet zu jagen. „Sie wollen mit 100 Falken kommen. Das macht für die Dauer ihres Jagdausflugs 2000 Trappen“, rechnete „der Perser“ seiner Rangertruppe vor. Heimlich brachten sie daraufhin so viele Zuchttrappen wie sie fangen konnten auf eine unbewohnte iranische Insel im Kaspischen Meer. Die Falken konnten nur noch wenige Trappen im Nationalpark erwischen. Die Saudis beschwerten sich bei der Regierung in Baku. Diese veranlaßte den Umweltminister, den Nationalpark „Sirvan“ zu schließen. Fortan waren die Wildhüter arbeitslos. Und der Perser führte mit Ilitschewski lange Gespräche über die Weltläufte.
.
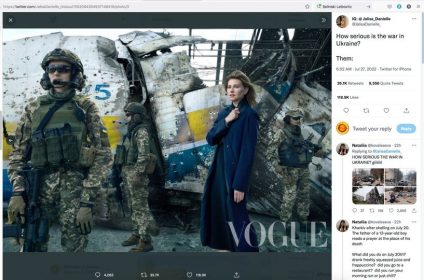
Olena Selensky posiert für Vogue
.
Paradiesvertreibung
Aus dem Paradieses vertrieben mußten die ersten beiden Menschen sich draußen schweißnaß durchkämpfen. Noch lange danach wurde die von Europäern „unberührte Wildnis“ als gefährlich wahrgenommen. Das hat sich jedoch am Ende der Aufklärung im 18. Jahrhundert verändert. Der Umwelthistoriker William Cronon thematisiert dies in seinem Buch „Uncommon Ground: Rethinking the Human Place in Nature“ (1995). Die „Wildnis“ wurde positiv besetzt, zunächst von der Romantik und dann von den zahlreich sich artikulierenden Naturschützern. Die ersten Tierschutzgesetze gab es in England bereits 1822 und zwei Engländerinnen gründeten 1898 den ersten Vogelschutzbund „The Royal Society for the Protection of Birds“.
Im Gegensatz etwa zu Novalis, der als Dichter und Ingenieur Ende des 18. Jahrhunderts noch Romantik und Bergbau verbinden konnte, betrachteten 100 Jahre später die aktivistischen Naturfreunde während der stürmischen Industrialisierung und Kolonialisierung das weltweite und emsige Wirken der Weißen vor allen anderen als naturzerstörerisch. Von den Indigenen nahmen sie zunächst noch an, dass diese „in Harmonie mit der Natur“ leben würden. Und sei es nur, weil deren bescheidene Kräfte (Jagdwaffen, Rodungen, Landwirtschaft) die „Wildnis“ nicht völlig denaturieren konnten.
Im Maße die Indigenen jedoch von den Weißen „berührt“ und in den kapitalistischen Warenverkehr einbezogen wurden, was zugleich bedeutete, dass ihre „Kräfte“ wuchsen (Gewehre, Kleidung, Fernsehen, Pick-up-Trucks, Motorboote, Smartphones etc.), wurden sie aus den „wilden“ Landschaften vertrieben – von all jenen, die diese „mit Mühe zu bewahren versuchen“, wie die Philosophin Deborah Danowski und der Anthropologe Eduardo Viveiros de Castro das in ihrem Buch zur Klimakatastrophe: „In welcher Welt leben?“ (2023) über die Naturschützer schreiben. Die beiden brasilianischen Autoren erinnern darin an den „Indio in Jeans, der ‚nicht mehr Indio‘ sei und daher nicht mehr der Erde [und der Wälder] bedürfe, sondern der ‚Staatshilfe‘, wie die Großgrundbesitzer meinen – mit der stets enthusiastischen Unterstützung jener ‚engagierten‘ Medien, die gleichzeitig interessengeleitete Partner und servile Klienten des Kapitals sind“.
Die Vertreibung der Indigenen aus ihren Stammesgebieten, Reservaten und unzugänglichen Wäldern „spielt Machthabern in die Hände, die nichts mit denen der Präservationisten [Naturschützer] zu tun haben“. Für diese basierte die „Wildnis“ dann auf einer „grundlegenden Opposition zwischen ‚Leben‘ (dem unerschöpflichen Überfluß von Formen und einem subtilen Gleichgewicht der Kräfte) und ‚Menschheit‘ (als ‚antinaturale‘ Spezies per se oder lediglich in ihrer modern-industriellen Form), die als das Leben beschmutzend und es qualitativ wie quantitativ vermindernd gedacht wird“.
In letzter Zeit mehren sich jedoch die Verteidiger der vertriebenen oder von Vertreibung bedrohten Indigenen, was man u.a. an der Arbeit von Organisationen wie „Survival International“, das „Oakland Institut“ und der Zahl der Bücher zum Problem feststellen kann. „Die Naturschutzgebiete bedecken heute etwa ein Achtel der Landflächen des Planeten: rund 19 Millionen Quadratkilometer. Vor allem in den so genannten Entwicklungsländern schossen Nationalparks und Tierreservate in den vergangenen drei Jahrzehnten wie Pilze aus dem Boden – ihre Zahl verfünffachte sich dort“, berichtete das Wissenschaftsportal „spektrum.de“ 2008, das Beispiele erwähnt, wo sich Geschäftsleute an den Rändern von Naturschutzgebieten ansiedelten, um am Öko-Tourismus zu verdienen, während die dort lebenden Indigenen in die Slums der Städte abwanderten. Was einst die Verfasser der brasilianischen Staatsdoktrin zur Eingeborenenpolitik pathetisch veröffentlichten, klingt heute bloß noch zynisch: „Unsere Indianer sind Menschen wie wir alle. Aber das Leben in der Wildnis, das sie in den Wäldern führen, setzt sie Elend und Leid aus. Es ist unsere Pflicht, ihnen dabei zu helfen, sich aus ihrer Zwangslage zu befreien. Sie haben ein Recht darauf, sich in den Stand der Würde eines brasilianischen Staatsbürgers zu erheben, um ganz am Fortkommen der einheimischen Gesellschaft teilzunehmen, und um in deren Annehmlichkeiten zu kommen.“
2013 bezeichnete die brasilianische Kabinettschefin Gleisi Hoffmann die Verteidiger der verfassungsmäßigen Rechte der Indios an ihrem Land als „Minderheiten mit irrealen ideologischen Projekten“.
Genauso reden auch die indischen Politiker über „ihre“ Indigenen, die sie oft „Maoisten“ und mit Militär jagen. Bedeutend sensibler geht man auf dem Subkontinent mit den Wildtieren um. Auf „downtoearth.org.in“ heißt es z.B.: „Wir haben einigen Grund zum Stolz, denn Indien ist das einzige Land weltweit, in dem die Menschen und ihr Vieh in nächster Nähe von Raubtieren leben“. So haben z.B. um Bombay (Mumbai) herum inzwischen rund 40 Leoparden ihren Lebensraum. Nachts streifen sie durch die Stadt und jagen Strassenhunde, die sie fressen – etwa 1500 im Jahr.
.

.
Kokain
Das Rauschgift wird aus der Kokapflanze gewonnen. In Peru ist besonders viel Koka im Umlauf. „Neben seinen Nachbarländern Kolumbien und Bolivien zählt das südamerikanische Land zu den grössten Kokainproduzenten der Welt,“ klärte uns die Neue Zürcher Zeitung 2022 auf. Die Pflanze enthält ein Dutzend Alkaloide, darunter 0,5 bis 1,1 Prozent Kokain. „Die getrockneten Kokablätter werden in Wasser und Schwefelsäure aufgeweicht und zu einer breiigen Masse zerstampft. Mit Kerosin, Kalk, Natriumcarbonat und anderen lösenden Substanzen wird Kokapaste aus dem Brei gewonnen und getrocknet. Aus einem Zentner Koka lässt sich rund ein Kilo Paste gewinnen. Das Rauchen der Kokapaste ist in Lateinamerika weit verbreitet und stellt ein gravierendes gesellschaftliches und medizinisches Problem dar,“ berichtete die NZZ 1995. Sodann wird aus der Paste „unter Zusetzung von Äther oder Aceton, Ammoniak und Pottasche die Kokainbase herausgefiltert. Aus einem Kilo Paste lässt sich rund ein halbes Kilo Base gewinnen, aus dem sich mit Hilfe von Salzsäure und Äther bis zu 400 Gramm Kokainhydrochlorid extrahieren lassen. Das Kokain genannte Hydrochlorid wird geschnupft, wobei es über die Nasenschleimhäute in den Blutkreislauf gelangt, oder intravenös gespritzt wird.“
Etwa 90 Prozent der Kokablätter in Peru werden illegal angebaut und an Drogenhändler verkauft. Die Regierung will nun ihre Politik der Verfolgung der Kokainhändler ändern: Der Staat soll die gesamte Kokaernte aufkaufen. Der Tagesspiegel meldete 2022, dass die peruanische Polizei etwa 2,2 Tonnen Kokain beschlagnahmt hat, die in Spargelkisten versteckt waren. Diese Menge hat der Staat also schon mal günstig bekommen. Aus Italien berichtete die Tagesschau 2023: „Die Behörden haben vor der Küste Siziliens knapp zwei Tonnen Kokain sichergestellt. Die Rauschgiftpakete trieben im Meer. Der Drogenfund zählt zu den größten des Landes.“ Ebenfalls 2023 erwischte die italienische Polizei an einer Südtiroler Mautstelle zwei Dortmunderinnen mit 46 Kilo Kokain. Im Jahr zuvor hatte sie in der „Drogenproblem-Stadt“ Triest bei einer Razzia 4,3 Tonnen Kokain beschlagnahmt. 3000 Portionen Kokain sollen dort täglich verkauft werden. Mit der Razzia wurden gleichzeitig 38 Menschen in Italien, Slowenien, Kroatien, Bulgarien, den Niederlanden und Kolumbien festgenommen. Der „Straßenwert“ der 4,3 Tonnen Kokain soll 240 Millionen Euro betragen.
In Berlin wird Kokain neben anderen Drogen vor allem in den Clubs konsumiert. Man hat die Droge noch in der Spree nachweisen können. Der Wiener Philosoph Fahim Amir schreibt in seinem Buch „Schwein und Zeit“ (2018), dass der Technoclub „Berghain“ zwar die „Fahne des Undergrounds hisst“, aber der „echte Underground“ wäre unter dem Club in der Kanalisation. Die dort lebenden Tiere würden „in wahren Duschen von Hormonen und anderen potenten Molekülen“ baden. Unter dem Berghain gäbe es vermutlich „amphetamingedopte Ratten, die vor sich hin raven, hochfrequent kopulierende Kakerlaken auf Kokain, kuscheltrunkene von aneinander abrutschende Kröten auf MDMA oder Ketamin-Mäuse in psycho-aktiver Dissoziation“.
Drogenexperten schätzen, dass Kokain immer mehr „im Kommen“ ist. Viele Konsumenten würden es sich auch auf die Genitalschleimhäute schmieren. Ansonsten gilt Kokain als Autoverkäufer- und Springer-Journalisten-Droge. In Berlin werden immer mehr Menschen wegen Besitz oder Handel mit Kokain verknackt. Z.B. ein Arzt, der sich in seiner Praxis als Kokainhändler betätigte und mit einem Großeinsatz der Polizei verhaftet wurde. 2023 wurde ein 32jähriger und „sein Komplize“ mit 8 Kilogramm Kokain festgenommen. Die beiden sollen die Menge laut Tagesspiegel „in die Hauptstadt geschmuggelt haben“. Kurz darauf wurden hier vier Männer festgenommen, die Kokain aus Südamerika nach Berlin geschmuggelt haben. Die Polizei fand bei ihnen 13 Kilogramm und eine Schußwaffe.
Der Berliner Rechtsanwalt Oliver Rabbat sprach sich in einem Zeitungsinterview für eine Legalisierung aller Rauschdrogen aus. Denn er verstehe nicht, „warum wir die finanziellen Gewinne bei den Drogendealern lassen, aber der Staat die Verluste trägt. Wir reden über einen Milliardenmarkt, der von den Feinden der Gesellschaft besetzt wird. Wir sprechen über globalen Waffenhandel und Korruption. Über ganze Staaten, die den Bach runtergehen. Und wenn wir legalisieren, warum muss das Zeug bei uns angebaut werden? Warum beziehen wir unser Gras nicht aus Marokko oder aus Südamerika? Wir verkaufen Waffen nach Mexiko, die Kartelle bringen dort Richter und Journalisten um, gleichzeitig bauen wir Mauern um uns auf.“ Für Rabbat ist es „logisch“, dass eine Legalisierung des Kokains auch die Lebensqualität in Mittel- und Südamerika verbessern würde.
Der angeblich für 40.000 Euro monatlich für den Springer-Verlag gelegentlich tätig gewesene Autor Benjamin von Stuckrad-Barre stellte gerade im BE seinen Enthüllungsroman über Sexorgien, Macht- und Kokainmißbrauch im Springer-Verlag vor. Die Berliner Zeitung schrieb: „Für die Zuschauer ist der zerbrechliche, aber energiegeladene Autor heute der Fisch im Aquarium. Auch weil viele Leute zwar koksen, aber dieses Thema – anders als der Autor – ungerne in der Öffentlichkeit ausbreiten. Schließlich ist Drogenkonsum immer noch ein Tabuthema“. War es eine Kokser-Veranstaltung?
.

.
Gegen den Wind kämpfen
Die tropischen Stürme werden Hurricanes genannt. Sie suchen mit der Klimaerwärmung immer öfter und heftiger die beiden Amerikas heim. Das gilt auch für die rotierenden Stürme im Indischen Ozean, Zyklone genannt. Beim Wirbelsturm „Gilbert“ wurden 1988 Windgeschwindigkeiten bis zu 295 kmh gemessen. Er richtete Schäden in Milliardenhöhe an. Der US-Präsident Donald Trump war bekanntlich ein Klimawandelleugner, als windiger Unternehmer gehörte er damit auf quasi natürliche Weise zu den Akzelerationisten, die entgegen den Reduktionisten und Umweltschützern den Kapitalismus beschleunigen wollen. Sie versprechen, mit Hightech, Gentech, Geoengineering und ähnlich fortschrittlichem Zeug alle mit dem Anthropozän auftretenden Probleme lösen zu können.
Es ist dies ein naiv-optimistisches Ingenieurdenken, wie es in Kalifornien quasi Zuhause ist. Herausragend ist dabei der Thinktank „Breakthrough Institute“. Ihre „Technophile des Füllhorns“ genannten Gründer veröffentlichten 2007 das preisgekrönte Buch „Durchbruch: Vom Tod des Umweltschutzes zur Politik des Möglichen“. Ihnen zufolge hätten die Umweltschützer sich „vorstellen“ sollen, „dass die Lösung der globalen Erwärmung in der Befreiung und nicht in der Restriktion der ökonomischen Aktivität und des technologischen Fortschritts liegt“. Ihre eher pessimistischen brasilianischen Kritiker Deborah Danowski und Eduardo Viveiros de Castro nennen deren Wollen eine „eugenische Monströsität, eine ökopolitische Barbie, die wir ‚Dankbarkeit der Reichen‘ taufen könnten“.
Schon der Harvard-„LSD-Papst“ Timothy Leary sah in den „Kaliforniern“ die Avantgarde der Menschheit. Der Akzelerationist Trump ist zwar kein Kalifornier, aber er hat, weswegen ich ihn hier auch erwähne, die Möglichkeit erwogen, Bomben in die Zentren der Wirbelstürme zu werfen, um die Hurricanes zu zerstreuen und damit unschädlich zu machen, notfalls mit Atombomben. Seine Idee löste „Spott und Irritationen“ aus, hieß es auf t-online. Konventioneller Sprengstoff würde es zunächst auch tun, hieß es unter Technik-Freaks.
Als ich einmal im Berliner Patentamt vorbeischaute, machte mich eine der netten Damen am Informationsdesk auf eine vermarktungsreife Erfindung aufmerksam, auf das Patent „DE 4220695 C2“. Vielleicht könne ich die Patentinhaberin journalistisch ein bißchen unterstützen. Es handelte sich dabei um eine Milchindustrielaborantin mit dem Schwerpunkt Mikrobiologie und in einem zweiten Beruf Wirtschaftskauffrau, die bei der Reichsbahn Cottbus gearbeitet hatte und dann von der Bundesbahn übernommen worden war, in die Abteilung Materialwirtschaft.
Sie hatte schon mehrere Patente angemeldet, in diesem Fall handelte es sich um ein Verfahren und eine Vorrichtung – gedacht als Einbau in Spezialflugzeugen – zur Bekämpfung von Wirbelstürmen. „Das ist weiter nichts als eine Sprengung der Wolken mittels einer Methan-Propan-Verbindung,“ erklärte mir die Patentinhaberin. Über ihre Erfindung hatte sie schon vor der Wende nachgedacht.
Das DDR-Patentamt sah sich 1989 zwar nicht (mehr?) in der Lage, ihr dabei „Hilfestellung“ zu leisten, verwies sie jedoch an den Meteorologischen Dienst in Potsdam. Von dort schrieb man ihr: „Wirbelstürme treten in unseren Breiten nicht auf, so dass das Ausmaß der damit verbundenen Naturgewalten und die im Gefolge auftretenden Schäden für uns nicht nachvollziehbar sind. Um so lobenswerter, dass Sie sich Gedanken über ihre Bekämpfung gemacht haben.“ Trotz des ironischen Untertons stellten die Wissenschaftler der Erfinderin Literatur zur Verfügung.
Beim Westberliner Patentamt half man ihr später „weitaus engagierter“, wie sie sagte. Die Prüferin dort hätte sie „regelrecht geschunden“, damit sie auf mögliche Fragen der Presse und anderen Interessenten antworten könne. Die Frage, ob sie mit ihrem Sprengverfahren z.B. auch Hurricanes bekämpfen wolle, beantwortete sie mit Ja. In Deutschland sei vielen nicht klar, dass die Worte „Wirbelsturm“, „Hurrikan“, „Zyklon“ und „Taifun“ alle das gleiche Wetterphänomen beschreiben. „Mit welchem Namen Wissenschaftler diese Stürme bezeichnen, hängt davon ab, in welcher Region sie auftreten,“ heißt es auf „nationalgeographic.de“. „Im Atlantik werden die Stürme als ‚Hurrikane‘ bezeichnet, nach dem karibischen Gott des Bösen“. Auch Zyklone können „böse“ werden: So zählte man nach dem 2023 Tropensturm „Zyklon ‚Freddy‘“ im Südosten Afrikas mehr als 460 Tote. Weil noch immer zahlreiche Gegenden von Erdrutschen abgeschnitten sind rechnen die internationale Hilfsorganisationen mit einem gewaltigen Hilfsbedarf für Madagaskar, Mosambik und Malawi, wo allein 500.000 Menschen von „Freddy“ in Mitleidenschaft gezogen wurden, mehr als 183.000 Menschen wurden obdachlos.
Die Sprengung von Wirbelstürmen, wie sie der Erfinderin und dem US-Präsidenten vorschwebte, stieß hierzulande bisher auf kein Interesse, obwohl auch in Mitteleuropa die Stürme immer heftiger werden, vor allem an der Nord- und Ostseeküste. Aber dort geht man nach wie vor bei Sturmfluten auf den Deich und schaut schweigend über die aufgewühlte See. 2020 wurden in Kiel beim Orkan „Victoria“ Geschwindigkeiten von 115 kmh gemessen und 2022 sorgte der Orkan „Ylenia“ für Schäden in Höhe von 500 Millionen Euro. Die Stürme sind laut „Spiegel“ in den letzten 30 Jahren um bis zu 50 Prozent stärker geworden. Die Zunahme führt zu steigenden Versicherungsprämien, versichert uns ein Sprecher vom „Bund der Versicherten“.
.

Drei Mädchen für Putin und Medwedew
.
Querulanten/Enthüller
1973 gründete sich in Frankfurt/Main der „Informationsdienst zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten“ (ID). Daraus entwickelte Dr. Richard Herding später das „Projekt Alltag“, in dem man sich „pressewirksam“ um „Querulanten“ kümmerte – nicht um Meinungs- sondern um Interessens-Querulanten. Das waren in Bedrängnis geratene Menschen, die sich hilfesuchend u.a. an das Projekt wandten, weil die sonstigen Medien nicht an solchen „Einzelfällen“ interessiert waren. Die von ihnen nur mit spitzen Fingern angefaßten Briefe landeten im Papierkorb. Bei ihnen mußten jede schriftliche Klage mindestens einen Trend anzeigen, weswegen die häufigsten Worte dieses Journalismus „immer mehr“ und „zunehmend“ waren und sind.
Wenn man aber die Briefe dieser Menschen, oft mit Hand geschrieben, gründlich las, enthielten sie doch oft detaillierte Darstellungen z.B. des allgemeinen Elends im Knast, in der Psychiatrie, im Altersheim oder im Falle von Mobbing in einem Dorf oder an der Uni (siehe dazu z.B. das gerade erschienene Buch „Alptraum Wissenschaft“ der Laborbotanikerin Anne Christine Schmidt). Es sind Enthüllungsberichte. Die am System leidenden und sich mit solchen „Kassibern“ an die Öffentlichkeit wendenden Briefschreiber waren erst verfluchte „Muckraker“ und sind nun in der „neuen Unübersichtlichkeit“ (Habermas) von vielen ermunterte „Whistleblower“.
Ich habe immer mal wieder über „Querulanten“ berichtet, wobei ich dieses schon seit dem normannischen Recht abfällig gemeinte Wort beibehielt. Auch die deutschen Behörden und Richter benutzten es, seit Ende der Naziherrschaft allerdings nur noch hinter vorgehaltener Hand. In den USA gab es nicht einmal das Wort Querulant, es wurde erst von deutschen Emigranten dort eingeführt, wohingegen die Schweizer Behörden sogar eine „Querulanten-Kartei“ anlegen wollten.
Hier erwähne ich nun einen polnischen Querulanten, der aus Angst, auf eine schwarze Liste von Spediteuren zu geraten, anonym bleiben möchte. Er kann nur schlecht Deutsch schreiben, ich habe seinen Brief deswegen beim Abschreiben verbessert. Er enthält einen Skandal, aber man müßte ihn nachrecherchieren. Leider ist mein Geigerzähler kaputt, so dass auch die Möglichkeit besteht, dass es sich dabei um einen antiukrainischen Fake handelt. Vor dem Hintergrund des mainstreamigen Solidar-Schwurbels und den begeisterten Polit-Pilgerreisen zu Selensky halte ich es jedoch für möglich, dass der Inhalt des maschinengeschriebenen Briefs durchaus wahr sein kann. Immerhin ist die „Todeszone“ um das Atomkraftwerk Tschernobyl so groß wie Luxemburg und das Saarland zusammen – und besteht aus besten Anbauflächen:
„Sehr geehrte Damen/Herren
Ich habe viele Jahre für eine polnische Spedition als LKW-Fahrer gearbeitet. Seit September 2022 transportiere ich regelmäßig Getreide aus der Ukraine nach Polen, Deutschland und in die Slowakei. Es ist eine harte Arbeit mit tagelangen Wartezeiten an den Grenzen und schlechter Bezahlung. Hinzu kommt, dass ich immer öfter radioaktiven Weizen aus der Region nordwestlich von Kiew transportieren muß. Durch Zufall nur habe ich erfahren, dass das Getreide stark abstrahlt, weil es mit Cäsium und Strontium kontaminiert ist, oft hat es über 100.000 Becquerel und müßte eigentlich als Sondermüll gelten. Mein Schwager hat die Strahlung dieses Weizens immer wieder gemessen, und meint, man dürfte es nicht einmal als Viehfutter verwenden.
Wir haben uns immer wieder bei unseren Chefs beschwert , die aber drohten uns bloß mit Entlassung, wenn wir das bekannt machen würden. Der Weizen war außerdem noch übermäßig mit Pestiziden belastet und stank, dazu war er oft schimmelig, weil er zu lange in Hallen gelagert worden war. Beim Abladen an Mühlen und Mehlfabriken sagten wir nur, der Weizen ist Ostware, es gab anders als bei Weizen aus Deutschland keine Kontrollen. Wir hatten Papiere dabei, die den verseuchten ukrainischen Weizen als polnischen Weizen auswiesen, was an der Grenze keine Probleme machte. Unsere Chefs meinten, die Getreidetransporte würden gut bezahlt werden, es sei ein gutes Geschäft.
Wir belieferten Großmühlen in Berlin, Mannheim, Schweinfurt, Ulm, Ergolding. Von meinen Kollegen erfuhr ich, dass sie nicht mehr nach Polen und in die Slowakei fahren, weil die Lieferungen radioaktiv verseucht und voller Pestizide seien, außerdem würden die Bauern dort mit ihren Traktoren gegen das Billiggetreide aus der Ukraine kämpfen. Deswegen gehen jetzt alle Transporte nach Deutschland. Dort wird nichts kontrolliert, sondern die Ladung nur mit deutschem Weizen vermischt. Angeblich würde man danach im Mehl keine Gifte mehr nachweisen können.
Ich habe trotzdem mit dem Job Schluss gemacht – aus gesundheitlichen Gründen, aber die Leute in Deutschland essen weiterhin dieses Mehl und das damit gebackene Brot.“
Hinzugefügt sei, dass ich in Mitte der Siebzigerjahre während meiner Arbeit in verschiedenen Landwirtschaftlichen Betrieben dabei half, dass mein Chef nicht unwesentliche Mengen an quecksilbergebeiztem Saatgut, das beim Ausbringen auf den Acker übrig geblieben war, auf den Weizenberg in seiner Lagerhalle kippte. Auf meinen Einwand: „Das Zeug ist doch gesundheitsschädlich“, meinte er: „Das vermischt sich – bis zur Unkenntlichkeit“.
.

Mitkämpferin
.
Gemeinsam Essen
Wenn in Indien jemand stirbt, treffen sich an seinem Todestag seine Freunde und essen gemeinsam seine einstigen Lieblingsspeisen. Bevor sie zulangen, muss jedoch eine Krähe kommen und sich etwas davon nehmen. Normalerweise entdecken diese klugen Vögel jeden noch so kleinen Nahrungsbrocken sofort (ich habe das in Bombay mit Käsestücken getestet). Aber wie es der Zufall will, läßt sich keine dieser allzu oft diebischen Krähen blicken, wenn man mal eine braucht. Für nicht wenige Hindus verkörpern natürlich auch Krähen die Seelen von Verstorbenen. Die Leute, die mir das erzählt haben, waren zwar ungläubige Linke, auf eine Krähe, die sich den ersten Bissen schnappt, warteten sie aber dennoch bei solchen Essen im Gedenken an einen oder eine Tote(n). Auch wenn alles kalt wurde.
Auf Wikipedia heißt es: „Gemeinsames Essen als Ausdruck von Geselligkeit ist im Hinduismus kein verbreitetes Konzept. Gegessen wird alleine, an einem zuvor gereinigten Platz. Speisereste einer anderen Person gelten als in hohem Maße unrein. Diese zu essen, stellt einen Akt der Unterwürfigkeit dar“. Zwar ist das hinduistische Kastensystem aufgeweicht, nicht zuletzt durch Ghandi, der die 4000 Kasten auf vier „Varnas“ (farblich unterschiedene Stände) reduzieren wollte. Am Ende seines Lebens sprach er sich sogar, wie Arundhati Roy in mein „Mein aufrührerisches Herz“ (2023) schreibt, „für die gemeinsame Mahlzeit zwischen den Kasten aus“.
Gleichzeitig verlangte die Reinheit seines „Satyagrahi“ (Ghandis „Strategie der gewaltlosen Durchsetzung des als wahr erkannten“), dass er allen Vergnügen und (sexuellem) Verlangen abschwor. „Sogar Essen bekam sein Fett ab“, heißt es bei Roy, die ihn zitiert: „Essen ist ein so schmutziger Akt wie die Reaktion auf den Ruf der Natur“.
„Sein ganzes Leben lang schrieb Ghandi viel über ‚Latrinenreinigung‘ als religiöse Pflicht. Es schien unwichtig, dass die Menschen im Rest der Welt kein solches Theater um ihre Exkremente machen“. Auf einem Kongreß 1925 hatte Ghandi in seiner Eingangsrede gemeint: „Wenn ich überhaupt eine Stelle suchen würde, dann die eines Bhangi“ – eines städtischen Unberührbaren (auch „Dalit“ genannt), den er zu den „Müllarbeitern“ zählte. „Ich mag den Weg des Dienens, deswegen mag ich den Banghi. Ich habe persönlich nichts dagegen, gemeinsam mit ihm zu essen, aber ich verlange nicht von euch, dass ihr mit ihm esst oder ihn heiratet.“
Als es damals im Bundesstaat Kerala zu „direkten Aktionen von Unberührbaren“ kam, reiste der Kongressführer und Ghandis erster Stellvertreter an. Die „besorgten Hindus aus privilegierten Kasten“ beruhigte er mit den Worten: „Der Mahatmaji will das Kastensystem nicht abschaffen, sondern nur die Unberührbarkeit. Ihr müsst nicht mit ihnen gemeinsam essen. Er will, dass ihr die sogenannten Unberührbaren anseht, wie ihr eine Kuh oder einen Hund oder andere Geschöpfe anseht“.
Die vielen in den Textilfabriken von Bombay arbeitenden Unberührbaren (meist aus Maharashtra stammend) organisierten sich in einer ersten kommunistischen Gewerkschaft. Sie wurden nur in schlecht bezahlten Spinnabteilungen beschäftigt, „weil in den Abteilungen, in denen gewebt wurde, die Arbeiter die Fäden mit dem Mund halten mussten und der Speichel der Unberührbaren als unrein galt“. 1928 rief ihre Gewerkschaft den ersten Streik aus. Der von indischen Unternehmern finanzierte und von amerikanischen Klerikalen als zweiter Jesus gepriesene Ghandi schimpfte: „Hinduistische und muslimische Arbeiter haben sich selbst entehrt und erniedrigt, indem sie den Fabriken fernblieben“.
Mehrmals besuchte Ghandi in Delhi eine Kolonie von Valmiki-Arbeitern. Der Spiegel berichtete 2007 über drei dort arbeitende „Kanalarbeiter“, die seit ihrer Geburt zur Kaste der Valmiki gehören: „den Benachteiligten der indischen Gesellschaft. Seit Jahrhunderten müssen ihre Mitglieder die schmutzigsten und gefährlichsten Arbeiten des Subkontinents übernehmen. In der ständischen Hierarchie – eigentlich gesetzlich abgeschafft – gibt es für sie praktisch keine andere Möglichkeit zu überleben.“
In der Valmiki-Kolonie weigerte sich Ghandi 1946, „mit der Gemeinde zu essen“. Roy zitiert einen Ghandi-Historiker: „Als ein Dalit Ghandi Nüsse gab, verfütterte er sie an seine Ziege und sagte, dass er sie später zu sich nehmen würde, in der Ziegenmilch“. Ghandis Essen bestand aus Nüssen und Körner, „er nahm nichts von den Dalits“.
Während der „Muslimherrschaft“ (im Mogulreich von 1526 bis 1858) war die unterste, schwarze „Varna“ (Diener, Knechte,Tagelöhner) bereits „befreit“ worden. „Nicht nur das, sie erlaubten auch gemeinsames Essen und Eheschließungen mit ihnen“.
Nach der Unabhängigkeit mußte die regierende Kongreßpartei neben den Hinduisten und den „Unberührbaren“ auch die Muslime als dritte große Wählerschaft ansprechen. Das Problem war dabei laut Roy, dass die Muslime „von den Kasten-Hindus auf der Reinheit-Unreinheit-Skala als ‚mleccha‘ – unrein eingestuft wurden; gemeinsames Essen und Trinken war verboten“.
P.S.: Nicht um das gemeinsame Essen der Inder, sondern um das gemeinsame Essen der Indianer geht es in dem o.e. Buch „Das Jahr der Wunder“ von Louise Erdrich – natürlich nicht nur. Die Handlung spielt in ihrem Buchladen voller Literatur von Indigenen, in dem es spukt.
.

.
Amerikanismen
Selbst die kleinste Kunstgalerie betitelt ihre Ausstellungen inzwischen auf Englisch – „In the heart of the West“ oder „Diversity United“ zum Beispiel. Die Hiesigen sprechen bis auf wenige alle Englisch und von den Ausländern, Touristen, die meisten – wird gesagt, und darauf hingewiesen, dass die Sprache in den sozialen Medien sich sowieso angloamerikanisiert.
Kürzlich fand am Brandenburger Tor eine „Demo“ statt, bei der nur noch englische Wörter auf den Transparenten standen – mit den Forderungen der Teilnehmer. Bei ihren Fotos auf Facebook konnte ich es nicht unterlassen, mich über diesen um sich greifenden PC-Trend zu mokieren. Woraufhin mich jemand streng anging, was ich denn für ein Typ sei: in der taz publiziere, RT gucke und eine arische Sprache verlange.
Ich verstand, das Deutsche war für ihn Nazisprache. Das konnte ich noch nachvollziehen: Als ich in Nordafrika war, begrüßte man mich, wenn man hörte, dass ich Deutsch sprach, mit „Hitler gutt!“. Und ein mir bekannter polnischer Bauer, der Zwangsarbeiter bei den Deutschen war, verläßt jedesmal den Raum, wenn jemand Deutsch spricht. Auch dass die Nazis sich als „Arier“ begriffen und SS-Expeditionen ausrüsteten, um im Himalaja und in Afghanistan nach Ur-Ariern zu suchen, wußte ich, aber nicht, was eine „Arische Sprache“ sein sollte. Auf Wikipedia gibt es sie sogar im Plural: Die indoiranischen Sprachen, früher als „arische Sprachen“ bezeichnet, bilden einen Primärzweig des Indogermanischen. Die indoiranische Sprachfamilie besteht aus den Hauptzweigen Iranisch, Nuristani, Indoarisch, die von insgesamt über eine Milliarde Menschen gesprochen werden.
Die arischen Sprachen entwickelten sich vor den germanischen. Meine Forderung nach Protest-Parolen auf Deutsch war aber nicht Altdeutsch-Nationalistisch gemeint noch bedeutete sie „Deutsche helfen Deutschen“. Diese bierernste AfD-Parole hatten wir übrigens 1990 als ironisches Logo der Treuhandanstalt in der taz veröffentlicht: Es bestand aus den zwei sich umfassenden Händen des SED-Emblems und um den Rand herum stand „Deutsche helfen Deutschen Treuhand“.
Mein Wunsch nach Vermeidung von Anglizismen war höchstens altmodisch erzieherisch: Die Passanten sollen aufgeklärt werden über die Notwendigkeit dieser oder jener Forderung: „Mieten runter!“, „Kein Impfzwang!“ oder „Keine Rinderzucht auf Regenwaldböden!“ zum Beispiel. Auch „Höhere Gehälter für Pflegepersonal“ vermittelte sich doch den Vorübergehenden und den Polizisten viel eindeutiger als „Higher salaries for Caregivers!“. Beim Wort „Pflegepersonal“ hat man hier sofort konkrete Bilder vor Augen. Ärgerlich benamt sind selbst die Boxen an Parkanlagen, denen man Plastiktüten zum Aufsammeln von Hundescheiße entnimmt: „Dogstations“.
Vor einiger Zeit hatte ich schon zu bedenken gegeben, dass diese Anglifizierung der deutschen Sprache doch im Zuge des amerikanischen Imperialismus geschieht. Ein Kollege antwortete mir kurz: US-Imperialismus – „darauf habe ich nur gewartet“. Das hörte sich an wie: Der Imperialismus ist doch längst aus der Mode.
Ein anderer Kritiker verortete mich nicht bei den Ariern oder bei den „Antiimps“, sondern bei den Gender-Gegnern wie etwa den Berliner Linguisten Peter Eisenberg, der davon ausgeht: „Die Genderfraktion verachtet die deutsche Sprache“ – aber nicht zwangsläufig auf amerikanischem Englisch. Im Gegenteil: Zwar kommt der Genderism aus den USA, aber hierzulande ist es wesentlich ein Deutsch-Schreib- und –Titelproblem. Er, Eisenberg, sei zwar kein „Hardliner“, doch er müsse die Sprache, die er liebt, verteidigen. Etwa gegen den Genderstern, sagte er. Die deutsche Sprache „lieben“, davon kann bei mir keine Rede sein.
Ich verstehe, dass durch den täglich ins Deutsche hinzukommende Anglizismus, „unsere“ Sprache peu à peu mit neuen Bedeutungen aufgeladen wird: z.B. von „Dauerlauf“ (Schweiß, stinkig, unschön aber sportlich) zu „Jogging“ (technisch und modisch ausgerüstet, entstressend, schön) oder von „Heimarbeit“ zu „Homeoffice“. In umgekehrter Richtung geschieht das auf den Philipinen, die lange eine US-Kolonie waren und es etliche englischsprachige Zeitungen gibt: Fast täglich ersetzen diese ein englisches Wort durch ein Tagalog-Wort.
Wenn man aber guten Willens ist, kann man die hiesige Angloamerikanisierung (bei der aus Entschuldigung „Sorry“ und aus Genau! „Exactly“ wurden), auch als „Deep Antifa“ verstehen. Die gegen Neonazis vorgehende Antifa wäre demnach eine eher oberflächliche Variante dieses „Kampfes“, während die zunehmende Ersetzung der deutschen Wörter durch Anglizismen in die Tiefe ginge, in das Denken mit Wörtern – deswegen: „Deep Antifa“. Ich halte eine solche PC-Arbeit an der Sprache jedoch für überschätzt.
An der mit egalitärem Geist gegründeten Bremer Universität duzten sich alle, aber schon den ersten jungen DozentInnen Ende der Siebzigerjahre gelang es, ihr Duzen distanzierter klingen zu lassen als ein Siezen und dazu jede Menge Anglizismen „von drüben“ einzuflechten. Fast so wie die Modemacherin Jil Sander, die der FAZ mitteilte: „Mein Leben ist eine giving-story. Ich habe verstanden, daß man contemporary sein muß, das future-Denken haben muß…Und für den Erfolg war mein coordinated concept entscheidend, die Idee, daß man viele Teile einer collection miteinander combinen kann. Aber die audience hat das alles von Anfang an auch supported. Der problembewusste Mensch von heute kann diese Sachen, diese refined Qualitäten mit spirit eben auch appreciaten. Allerdings geht unser voice auf bestimmte Zielgruppen.“
Immer seltener trifft man auf Leute, die noch einen ganz anderen spirit appreciaten – wie z.B. ein Kneipenbesitzer bei Husum, der seinen Cocktail nicht „Sex on the beach“, sondern „Geschlechtsverkehr am Wattenmeer“ nennt.
.

.
Genau!
In Vorträgen oder bei längeren Ausführungen hört man immer öfter das 1977 von Eckard Henscheid geprägte „Genau! So als will der Redner damit sagen, dass er mit dem zuvor Gesagten zufrieden ist. Leider warte ich als Zuhörer dabei nur noch auf das nächste „Genau!“ und höre nicht mehr auf das übrige Gesagte. Bei den jungen Amerikanern breitete sich zur selben Zeit ein laufend eingeschobenes „like“ in ihren Erzählungen aus. Sie waren nicht wütend, sondern like [irgendwie] wütend. Ihre Psychotherapeuten macht das wahnsinnig.
Von einer Bekannten, bei der ich vergessen hatte, etwas für sie zu erledigen, hörte ich 2022 das erste Mal „Alles gut!“ Im Internet erfuhr ich dann zweierlei: Zum Einen wurde die Wendung in zig angloamerikanischen Einträgen dem Deutschland-Touristen erklärt, d.h. wann und wo es angebracht ist und wo und wann nicht, zum Anderen waren diese zwei Worte bereits von allen Intelligenzblättern kritisiert worden, allerdings nur in seiner Frageform: „Alles klar?“ Was nach Meinung der Journalisten soziale Kälte und Gleichgültigkeit bedeute, also dass der so Fragende alles andere als eine ehrliche Antwort von seinem Gegenüber erwarte, ähnlich wie bei der Frage „Na, allet schick?“ oder „alles Paletti?“
Neulich erstellten meine Freundin und ich eine Liste möglicher Antworten auf solche Pseudofragen, die man auch als Antwort zurückgeben kann – mit Ausrufezeichen: „Ja, alles paletti!“ oder „Kein Problem!“ oder „Null Problemo!“, „Alles in Butter!“, „logo!“ , „klaro!“ „alles ok!“, „in Ordnung!“, „Alles im grünen Bereich!“ oder „Alles Roger!“. Es kam Einiges an Phrasen zusammen und bei meiner Freundin Freude auf: „Schön, zur Abwechslung mal ein produktiver Abend und kein konsumistischer,“ sagte sie. „Jetzt müssen wir noch herausfinden, wann die Phrasen aufkamen und wie sie sich verändert haben – oder auch nicht.“
Die Wendung „Alles Paletti“ ist laut dem Wiktionary „seit dem 20. Jahrhundert bezeugt“, so hieß hieß 1985 ein TV-Spielfilm nach einer Novelle von Leonhard Lentz. Der 1887 gestorbene Autor war ein Altphilologe und Gymnasialprofessor. Die im Fußball-Milieu angesiedelte Filmhandlung bezeichnet das Lexikon des internationalen Films als „Humorvolle und ironische Schilderung der Nöte eines Heranwachsenden, ebenso einfühlsam wie leichthändig erzählt.“
Das umgangssprachlich saloppe „Null Problemo“ heißt so viel wie „Das ist kein Problem“, meint der „Redensarten-Index“ und erklärt dazu: „Diese seltene Redewendung wird bei Bilanzierung einer Unternehmung verwendet. Der erste Beleg aus dem Jahr 1911 weist auf einen Ursprung in der Börsensprache hin: „Die Ohio-Aktien sind in Amsterdam gekauft und in Berlin verkauft und und trotz der hohen Spesen geht das Geschäft – wie man zu sagen pflegt – Null auf Null auf“.
Da hat also eine neodeutsche Bedeutungsverschiebung stattgefunden mindestens eine Erweiterung. Denn laut „universal-lexikon.de-academic.com“ hat „dieser besonders in der Jugendsprache verwendete Ausdruck die Bedeutung von ‚kein Problem‘. Er stammt aus der deutschen Synchronisation der US-Fernsehserie ‚Alf‘, in der ein Wesen von einem anderen Stern bei einer US-Familie lebt und durch eigenwilliges Verhalten, seine Vorliebe für Katzen als Hauptgericht und eine schnodderige Ausdrucksweise für Komik und Unterhaltung sorgt.“ Karin Schrag schreibt in ihrem blog „Null problemo, oder: Sei kein Alf!“, dass, wo immer sie auch ist, „im Gespräch mit der Klassenlehrerin, im Hotel in den Bergen, auf dem Campingplatz im Ausland: Ein Ausdruck begegnet mir immer und überall. Es ist ein Ausdruck, der auf den ersten Blick positiv erscheint. Ein Ausdruck, der mir sagen will: ‚Es ist alles in Ordnung!‘ Und doch bringt er Probleme mit sich – allein deshalb, weil Probleme Teil von ihm [Alf] sind.“
Der Ausdruck „Alles in Butter“ ist laut Wikipedia eine Redewendung und bedeutet etwa „Alles in Ordnung“. Sie bezieht sich wahrscheinlich auf frühere Hinweise, dass Speisen mit guter Butter anstatt billiger Fette zubereitet wurden oder wie heute mit teurem Bio-Olivenöl.
.

.
Briefmarken und Chinchillas
Ein Bremer hatte eine gute Geschäftsidee. Sowas gibt’s. Der in Berlin lebende Schriftsteller Peter Kohle (Nomen est Omen?) annoncierte in einer Philatelisten-Zeitschrift, dass er eine komplette Sammlung Briefmarken von afrikanischen Staaten besäße und sie umständhalber abgeben müsse. Ihm wurden daraufhin z.T. erhebliche Summen angeboten. Das könnte also funktionieren, dachte er sich. Seine Freundin und er kauften sich einen VW-Bus, bauten ihn aus und fuhren nach Afrika. Sie besuchten alle 54 Staaten und kauften deren Briefmarken, mehrere von jeder Marke.
Als die beiden Afrikareisenden wieder in Berlin angelangt waren, setzte Kohle erneut eine Anzeige in eine Philatelisten-Zeitschrift: Habe einen kompletten Satz Marken von allen afrikanischen Staaten zu verkaufen. Und weil er mehrere von allen besaß – wurde er damit zum Millionär. Gleichzeitig schrieb er einen Bericht über ihre Afrikatour, die er unter dem Titel „Afrika -Patt Problem“ veröffentlichte. Im Vorwort schrieb er: „…Die Besonderheit der folgenden Berichterstattung liegt in der Alltäglichkeit, in dem Irrsinn der Normalität, in dem täglichen Drama…“
Weniger Glück als Geschäftsmann hatte ein Altonaer namens Jörg Böttcher, der mit Frau und Kind in Teltow auf einem Resthof lebt und bei einem Besuch des Kirschblütenfests zwei Dithmarscher kennenlernte, die eine „tolle Geschäftsidee“ hatten: In seinem leeren Schweinestall könnte er wunderbar Chinchillas züchten, meinten sie. Chinchillafelle gelten neben dem Zobel als einer der wertvollsten Pelze im Rauchwarenhandel. Damit könne er reich werden: zwischen 100 und 150 Euro bekäme man für ein Fell. Und das Futter – Gräser, Blüten, Kräuter – koste so gut wie nichts. Die Dithmarscher boten sich sogleich an, ihm neun Paare zu verkaufen – pro Tier verlangten sie 250 Euro. Nähme er alle, bekäme er einen Mengenrabatt und müsse nur 4000 Euro insgesamt zahlen.
Jörd Böttcher wollte erst einmal Näheres über Haltung und Pflege von Chinchillas wissen: Es sind südamerikanische Nagetiere. Diese auch Wollmäuse genannten Tiere werden bis zu 35 Zentimeter lang. Die Weibchen können bis zu drei Mal im Jahr zwei bis vier Junge bekommen, die schon mit etwa acht Monaten geschlechtsreif sind.
Seine Frau, Marina Klose, war skeptisch, sie wollte erst einmal ein Tier sehen. Kein Problem: Die beiden Dithmarscher hatten in ihrem Auto ein Pärchen in einer Box dabei. Als sie den beiden die Tiere zeigten, waren sie begeistert – und machten den Deal sogleich perfekt.
Als die wertvollen Pelztiere angeliefert wurden, wuchs die Begeisterung noch, denn es waren zwei schwangere Weibchen dabei – und alle 18 lebten sich gut im Schweinestall ein. Im „Chinchilla-Lexikon“ las das Ehepaar: „Manche halten Chinchillas einfach nur aus Profitgier, andere aber haben sich das Ziel gesteckt, Qualität statt Quantität zu züchten. Grundsätzlich kann man aber sagen das nicht das teuerste Tier das beste Chinchilla ist. Jedoch ist auch gleichzeitig zu sagen, dass das günstigste Tier nicht immer das günstigste Tier ist. So müsse man für ein Persian Royal Angora Chinchilla momentan weit über 2000 € bezahlen. Und das wäre noch günstig!“
Im Geiste rechnete das Ehepaar sich schon die ungeheuren Gewinne aus. Und dann vermehrten sich die Tiere auch wirklich sehr gut. Als sie die ersten zum Verkauf anboten, machte man ihnen jedoch wenig Hoffnung, dass sie mehr als 25 Euro pro Tier bzw. Fell bekämen. Ein große Enttäuschung, doch loswerden mußten sie die Tiere, denn sie hatten schon bald zu viele. Mehrere Händler, die sich ihre Chinchillas persönlich ansahen, winkten ab: Das Fell war ihnen nicht gut genug. Zuletzt bot das Ehepaar die Tiere „fürn Appel undn Ei“ Zoologischen Handlungen an.
Unterm Strich war ihre Chinchillazucht ein Minusgeschäft. Immerhin konnten sie aber nun bei Gesprächen über Geschäftsideen am Start-Upper-Stammtisch in Teltow mitreden. Ihre Chinchilla-Pleite interessierte alle.
.

.
Hausarbeiten
„Doing the Dirty Work. Migrantinnen in der bezahlten Hausarbeit in Europa“ hieß 2006 eine Studie der englischen Soziologin Bridget Anderson. In Berlin fand die Autorin es „besonders bemerkenswert, dass Putzfrauen, die in Zeitungen inserieren, hier klarstellen: ,No Sex‘, womit sie deutlich machen, dass sie ein Angebot von ,Hausarbeit‘ für missverständlich halten“.
Nach der Wende und dem Zuzug von wohlhabenden Westlern erhöhte sich der Bedarf an „Dienstleistern“. In Westberlin gab es sehr viele Schuhläden – mit gutaussehenden Schuhverkäuferinnen. Wenn sie älter wurden, ersetzte man sie gerne durch jüngere. Vier dieser vorzeitig gekündigten Schuhverkäuferinnen (mit „Niedrigrente“) fingen als Putzfrauen an. Weil das aber auch nicht viel einbrachte, eröffneten sie ein Bordell – mit sich als „Modelle“. Daneben stellten sie eine alte Frau aus einem Zirkus als Telefonistin ein und einen Studenten, der sie zu den Freiern fuhr. Eine, Rita, erzählte der ukrainischen Prostituierten Lilly Brand (in: „Transitgeschichten“ 2006), dass sie fast nur Professoren als Kunden hätte, und bis zu vier oder fünf täglich wäre es noch ganz gut. Oft würden sie sich nur mit einem unterhalten wollen. Ihre früheren Putz-Kunden hätte sie an eine polnische Putzfrau abgetreten.
1998 veröffentlichte die polnische Soziologin Malgorzata Irek eine Studie über diese Frauen: „Der Schmugglerzug Warschau-Berlin-Warschau“. Bei den in Berlin arbeitenden unterschied sie zwischen den „Putzfrauen der ersten Generation“, die bis etwa 1990 aus einem staatlich „ausgewählten Personenkreis“ bestanden, und den „Putzfrauen der jüngeren Generation“, die danach kamen und auch „einen Hauch vom Kapitalismus spüren“ wollten. In Berlin wurden sie in einem „Netz“ tätig, das die Älteren vor ihnen aufgebaut hatten – und wofür sie auch Abgaben verlangten. Über ihre Kunden äußerte z.B. eine, die von der Arbeit Ekzeme an ihren Händen bekommen hatte: „Das kommt vom Essig. Diese Kühe wollen alles ökologisch haben.“ Die Berliner Professorenwerden allerdings auch von den polnischen Putzfrauen geschätzt: „Sie sind nicht pingelig und eigentlich braucht man überhaupt nicht gründlich sauber zu machen“.
Die polnischen Putzfrauen sind oft „überqualifiziert. In der Studie „Die ganze Welt zu Hause. Cosmobile Putzfrauen in privaten Haushalten“(2006) der ungarischen Soziologin Maria S. Rerrich heißt es: „Hier findet nicht nur ein ‚brain drain‘ aus den Heimatländern der Frauen statt. Es handelt sich auch um einen ‚brain waste‘ in Deutschland, also die vielfache Verschwendung von Humankapital“ – wenn die Frauen hier gezwungen sind, sich als Putzfrauen in irgendwelchen Wohnungen, Hotelzimmern und Büros zu verschleißen – nachts oft und schlecht bezahlt.
Während die polnischen Putzfrauen hier als „Selbständige“ einen Status als „Unternehmerinnen“ anstreben, kämpfen die polnischen Putzfrauen in den USA um kleine Arbeitserleichterungen. 2002 verdingte sich die US-Journalistin Barbara Ehrenreich als Putzfrau in Kalifornien. In ihrem Bericht „Working Poor“ schreibt sie, dass der US-Putzfrauenmarkt von großen Reinigungsfirmen beherrscht wird. Die Putzfrauen bekommen ihre Kunden fast nie zu sehen – nur durch die Einrichtungsgegenstände, die sie sauber halten müssen, können sie sich ein Bild von ihnen machen. Der eine hat eine große Bibliothek über Zen-Buddhismus, der andere sein Badezimmer zu einem Nassorgiencenter ausgebaut …Die Putzfrauen tragen grelle grün-gelbe Arbeitskleidung und ihre Arbeitsgänge sind von der Reinigungsfirma mit der Stoppuhr ausgetüftelt. Sie dürfen nicht fluchen und kein Glas Wasser trinken – der Kunde könnte sie mit Aufnahmegeräten überwachen. Als Ehrenreich sich für eine Kollegin einsetzen will, die sich nach einem Arbeitsunfall nicht getraut hatte, zur Ambulanz zu gehen, scheitert sie: „Dies war der absolute Tiefpunkt in meinem Putzfrauenleben, und wahrscheinlich nicht nur in dem.“
.

Brachfeld in der Ukraine mit zerschossenem Panzer aus WKII oder WKIII
.
Startup-Fieber
Die Innovationsberater-Firma „Startup Genome“ fand heraus, Berlin ist die Startup-Metropole Deutschlands. 2020 schaffte diese nachgesellschaftliche Projektwelt hier bereits 19.000 Billigjobs. Fast im Monatstakt werben inzwischen neue Bringdienste in den U-Bahnhöfen. Ich vermute, dass dahinter jedesmal Millenials stehen, die ständig an ihren Smartphones rummfummelten, sich nächtens Fastfood und Softdrinks kommen ließen und dann die tolle Idee eines Bringdienst hatten. Dazu stellten sie einen Schwarm armer Schweine als Ausfahrer ein.
„Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald,“ hieß ab 1955 der Werbespruch der ersten Schnellrestaurantkette – mit Broiler To Go im Angebot. Ähnlich lautet nun der Spruch der Lieferfirma „Wolt“: „Berlin erreicht Herd-Immunität“. In den LPG der DDR gab es auch schon einen Lieferdienst, d.h. die Fahrer brachten den Mitarbeitern täglich Essen aufs Feld.
Es gibt wahre Startup-Moden: Nach den Fastfood-Lieferdiensten warben neue Bankgründungen in den U-Bahnhöfen, sie nannten sich Smartphone-Banken: Alle Geldgeschäfte wurden bei ihnen angeblich „easy“ erledigt – mittels „financial technology“. Deswegen hießen sie auch „Fintech-Banken“. Eine Wirtschaftszeitung unkte: „‘Es reicht nicht, Fantasien zu verkaufen‘ – ruppiges Börsenklima für Fintechs“.
Nach den Finanz-Startups kamen die Finanzamt-Startups. Eins nennt sich „taxfix“: Es will die jährliche Steuererklärung für uns erledigen. Als wenn es nicht schon genug Steuerberater gäbe. Das Problem dabei ist, bevor sie eine Steuerrückzahlung für uns erreichen, wollen sie erst mal selbst Geld von uns haben. Die taxfixer werben dafür mit dem kessen Spruch: „Schluss mit Steuer-blablablabla-erklärung“.
Noch abstoßender sind die Startups der Drogendealer. Kurando z.B., das uns „Medikamente in 30 Minuten“ liefern will: „Free delivery…“ Oder „Mayd“, das ebenfalls verspricht, uns blitzschnell z.B. Schmerztabletten zu liefern. Ihre Renner sind angeblich nicht-rezeptpflichtige Potenzmittel. Mayd kooperiert mit Apotheken. Diese nehmen die Bestellungen auf und stellen die Ware zur Abholung bereit. Mayd hat bloß die Fahrer, die sie ausliefern. Wir haben es also auch hier mit einem oder mehreren Cleverles (in Sneakers und Kapuzenpullis?) zu tun. Sie sitzen in ihrer Computer-Zentrale und stellen einen, mehrere oder ganz viele Arbeitslose bzw. besessene Sportler ein, die bei Wind und Wetter durch die Stadt jagen – und dabei ständig ihr Startup-Smartphone am Ohr haben.
Auf „businessinsider.de“ heißt es: „Mayd ist nicht das einzige deutsche Startup mit dieser Idee. Nach der aktuellen Seedrunde ist es allerdings das am besten finanzierte.“ Eine „Seedrunde“, das sind Samenspender, namentlich die Startups „468 Capital“, „Earlybird“ und „Target Global“. Laut eines Linkedln-Posts des Mayd-Gründers haben daneben auch bekannte „Business Angels“ wie die Gründer der Startups „Amorelie“, „Auto1, „Aitme“ und „Flixbus“ in seine Lieferfirma investiert – insgesamt 13 Millionen Euro.
Mayd war so erfolgreich als Drogendealer, dass seine Vertragsapotheken nicht nachkamen mit den Bestellungen. Einige Start-Upper haben bereits Lieferdienst und Apotheke verbunden: die Versandapotheke „DocMorris“ z.B., die 2000 von einem holländischen Apotheker und einem deutschen Ingenieur gegründet wurde und jetzt dem Schweizer Konzern „Zur Rose Group AG“ gehört.
Für den Apothekerverband ist die Strategie von DocMorris nur Augenwischerei. „Es gibt jetzt schon viele Einkaufsgemeinschaften von Apotheken. Diese kaufen bei Großhändlern billiger ein und unterbieten oft die Preise von DocMorris,“ sagte die Sprecherin der „Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände“ dem Leiter des „News-to-be-smart-Rooms“ bei „BurdaForward“, was der „Bunte“-Besitzer Hubert Burda als „digitales Medienhaus der Zukunft“ bezeichnet. Sein „Forward“ läuft wahrscheinlich auf eine „Bunte für die Startupper-Class“ raus.
.

.
Schwachstellen
Im Zweizwerge-Verlag Berlin erschien vor einiger Zeit die Autobiographie eines Polizisten: Er las auf der Wache täglich die taz – um seine BZ und Bild lesenden Kollegen zu provozieren, dann wurde er Kontaktbereichsbeamter (KOB) im Wedding, wobei er hoffte, aus der Bevölkerung heiße Tips für irgendwelche schweren Delikte zu bekommen, er wurde aber geradezu überhäuft von Denunziationen, was er zunächst schätzte, aber schnell merkte er, dass an all diesen Anschwärzungen nichts dran war. Enttäuscht gab er seinen KOB-Job auf – und wurde Personenschützer bei Willy Brandt, den er sehr schätzte und vor allem davor schützte, dass der regierende Bürgermeister ständig besoffen gemacht wurde. Jedesmal, wenn man „Cognac-Willy“ auf einer Versammlung abfüllte, ging er nach einiger Zeit in den Saal zu ihm und sagte laut: „Herr Brandt, der Wagen ist vorgefahren.“ Obwohl der die ganze Zeit vor der Tür stand. Aber Willy Brandt verstand, sagte „Letzte Runde“ und verschwand mit ihm.
Die US-Wissenschaftlerin Shoshana Zuboff nennt das, was auf uns zukommt „Überwachungskapitalismus – wobei sie zuvörderst an die elektronische Überwachungstechnik denkt, die ständig vervollkommnet wird. So besitzen die Ehemänner in Saudi-Arabien z.B. ein Smartphone, dass Alarm gibt, wenn eine ihrer Ehefrauen sich mit ihrem Smartphone dem Flughafen nähert.
Letzten Endes braucht aber auch die totale Überwachung Staatsdiener, die handgreiflich werden, also Polizisten, die den Überwachten oder Verdächtigen festnehmen.
Und das ist die Schwachstelle aller Systeme. Der jüdische Schriftsteller Valentin Senger überlebte mit seiner Familie, weil ein Polizist in der Meldestelle den Eintrag „mosaischer Glaube“ einfach löschte. Wer das heute angibt, der muß nur noch „Kultussteuern“ zahlen.
Am Souveränsten war unser Dorfpolizist: Wenn er einen Bauernsohn zur Musterung für die Bundeswehr melden mußte, ging er erst zu dessen Vater. Wenn der sagte, er bräuchte seinen Sohn unbedingt auf dem Hof, dann meldete er ihn nicht. Wenn der Abgabetermin für das Dieselrückzahlungsformular nahte, ging er zu den Bauern und füllte sie mit ihnen aus. Er besuchte regelmäßig meinen Vater, der für ihn einen Schnaps bereithielt, irgendwann zückte er sein Notizbuch und sagte: „Schorse, kann ich Dir mal mein neues Gedicht vorlesen?! Einmal druckste er herum: „Was Unangenehmes diesmal, jemand hat dich angezeigt, weil Du Dein Haus schwarz gebaut hast.“ Mit Hilfe des Dorfpolizisten kam mein Vater aber gimpflich davon.
Mein bayrischer Halbbruder lud mich einmal auf ein Dorffest ein, wo ausschließlich „Maß Bier“ ausgeschenkt wurde (in 1, 069 Litergläsern). Ich sagte, dass ich noch fahren müsse, er meinte daraufhin: „Bis zu drei Maß darfst Du hier trinken, da sagen die Polizisten nichts.“
Auch im bayrischen Bischofsheim wurde mir in einer Kneipe gesagt: „Keine Gefahr, die Polizei hält Dich nicht an, nur wenn oben im Walddorf die ‚Bösen Onkelz‘ spielen, werden ausnahmslos alle kontrolliert.“
Am Seltsamsten war ein Grenzpolizist am Grenzübergang Wannsee/Dreilinden. Gewöhnlich fragten die Grepos, ob man Waffen oder Funkgeräte dabei hatte, er fragte jedoch den Fahrer: „Was ist denn das, es riecht so komisch?“ Wir antworteten: „Haschisch“. Und wie wirkt das? Wollte er wissen. Es entspann sich daraufhin ein längeres Informationsgespräch. Als alles gesagt war, schenkten wir ihm ein Stück Haschisch. Als wir wieder mal nach Westdeutschland fuhren, hatte „unser“ Grepo erneut Dienst. Er grüßte uns wie alte Bekannte – und wir gaben ihm erneut ein Stück. Dann fragte er, was da auf dem Aschenbecher läge. Eine Purpfeife für Haschisch antworteten wir und reichten sie ihm. Er besah sie sich so genau, dass wir sie ihm schließlich schenkten. Als ich das einer DDR-Dissidentin erzählte, war sie entsetzt, wie unmoralisch wir uns gegenüber der DDR-Staatsgewalt verhalten hatten. Dabei waren wir hocherfreut gewesen, dass einer von den „Organen“ sich so menschlich uns gegenüber verhalten hatte.
Das mögen alles Kleinigkeiten gewesen sein, aber sie sind wichtig, um den immer unmenschlicheren Systemen zu entkommen.
.

.
Geldbeschaffungsmaßnahmen (eine Endlos-Serie)
Weil der Lotto-Beirat uns keine NGBK-Ausstellung über „ABM“ (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) finanzieren wollte, organisierten wir auf dem Pfefferberg eine „Messe über GBM“ (Gelbeschaffungsmaßnahmen), dabei dachten wir jedoch noch nicht an kriminelle GBM – so wie diese hier, die mir fast täglich gemailt werden:
„Wollen Sie Ihre Niere für Geld verkaufen? Unser Krankenhaus ist spezialisiert auf Nierenchirurgie / Transplantation und andere Organ-Behandlung. Wir suchen dringend Nierenspender mit oder ohne Pass und bieten Ihnen einen Betrag von $ 950.000 US Dollar. Jeder Interessierte sollte uns Kontaktieren per E-Mail: ubth11@gmail.com oder WhatsApp +2347063061652“
Eine seriöse Bank (bei der ich gottlob kein Konto habe) schrieb: „Guten Abend Helmut Höge wir müssen Sie davon in Kenntnis setzen, dass es zu 3 fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen gekommen ist. Um möglichen Schaden zu vermeiden, haben wir ihren Kontozugang vorsorglich gesperrt. Damit Sie weiterhin im vollen Umfang die Vorteile des OnlineBankings müssen Sie sich anhand ihrer Daten verifizieren. Hier klicken. Mit freundlichen Grüßen Deutsche Bank Sicherheit“. Auf diese Weise verloren zwei Freunde gerade 9800 Euro.
Ich erhielt ohne gespielt zu haben folgenden „Glückwunsch“:„Gewinnnummer: 662268891132/ Referenznummer: 666475896. Sie haben 1 Mio. € in der laufenden PCH Lotterie vom 16. November 2020 gewonnen. Für Ansprüche geben Sie unten Ihre Angaben ein: Voller Name: .. Wohnadresse: … Geschlecht:.. Beruf:.. Land:.. Mobile: …Herzlichen glückwunsch! (Verlagsclearingstelle) Private Universität Witten/Herdecke gGmbH, Alfred-Herrhausen-Straße 50, 58448 Witten“
Im Internet findet man zur „PCH-Lotterie“ folgenden Eintrag: „Wer auf diese Einleitung eines Vorschussbetruges reingefallen ist, darf sich darauf ‚freuen‘, am Telefon von einer gut geübten Betrügerbande belabert zu werden, damit er eine Vorleistung nach der anderen bezahle – immer schön über Western Union und Konsorten, denn diese „Lotterieveranstalter“ mit ihren Millionengewinnen benutzen keine Bankkonten. Das den Betrügern so zugesteckte Geld wird irgendwo auf der Welt anonym abgeholt…“
Ein „Daniel“ schrieb mir: „Hallo, Finanzmittel bis zu 15.730 Euro sind derzeit verfügbar, bitte bestätigen Sie Ihre Anmeldung hier, um loszulegen. Damit wird es Ihnen noch leichter fallen, in 3 Monaten zum Millionär zu werden. Steigen Sie jetzt ein, so lange die Finanzierung noch verfügbar ist. Unsere Daten zeigen, das Helmut Höge unsere Internetseite aufgerufen und darum gebeten hat, ihn zu kontaktieren.“ Das kann doch nicht sein, das wüßte ich doch!
Ein „Betriebsleiter“ schickte folgende mail: „Herzliche Glückwünsche: Ihre Mitmach-E-Mail hat Ihnen die Summe von 2.000.000 € eingebracht: Spende von Oxfam Aid, für weitere Informationen kontaktieren Sie uns mit Ihrem Qualifikationsnummer OXG / 111/461/BDB. Ich habe keine Mitmach-E-Mail geschickt.
Mein „Freund Olaf“ bat um Hilfe: Man hatte ihn am Londoner Flughafen ausgeraubt: „Geld, Flugticket…alles weg! Bitte schick mir schnell 300 Euro, damit ich nach Berlin zurückkommen kann.“ Ich löschte Olafs mail sofort, mit schlechtem Gewissen allerdings.
Am Einträglichsten ist vielleicht immer noch tränenseliges Menscheln: „Mein Name ist Petra Kothe, deutscher Herkunft und ich lebe in Frankreich. Ich glaube an Gott und habe gelernt, vom Zweifel zum Licht zu gelangen. Ich leide an einer schweren Krankheit, Kehlkopfkrebs, und ich habe eine Summe von 800.000 Euro, die ich einer vertrauenswürdigen und ehrlichen Person geben möchte. Ich besitze ein Rohölimportgeschäft in Frankreich und habe meinen Mann vor 6 Jahren verloren, wir haben keine Kinder. Ich möchte diesen Betrag spenden, bevor ich sterbe, da meine Tage aufgrund des Vorhandenseins dieser Krankheit gezählt sind. Ich würde mir jedoch von ganzem Herzen wünschen, dass Sie mein Geschenk annehmen und mit Gottes Hilfe alles gut wird.“
.

.
Nicht-menschliche Nachbarn
Die auf der Nordhalbkugel lebenden Tiere und Pflanzen wandern wegen der Klimaerwärmung in Richtung Arktis und die auf der Südhalbkugel lebenden in Richtung Antarktis, so der Befund des Politologen Benjamin von Brackel in seinem Buch „Natur auf der Flucht“ (2021). Eine weitere Wanderbewegung von Tieren und Pflanzen ist die vom Land in die Stadt. In Berlin leben inzwischen viel mehr Arten als im weiten Umland. Hier müssen sie sich nach neuen Lebens- und Wirtschaftsweisen umsehen – und sich möglichst an die Menschennähe gewöhnen. Der Ökologe Josef Reichholf meint, dass die Dörfer sich der Natur verschließen und die Städte sich ihr öffnen.
Am Wannsee z.B. kommen Badende und Wildschweine bereits ziemlich gut miteinander aus. Vor einiger Zeit besuchten wir ein Café am Schildhorn. Als wir auf den Parkplatz zurückgingen und ich das Auto aufschloß, drängt mich eine Wildsau zur Seite und sprang auf den Fahrersitz, wo sie in der Mittelkonsole was Eßbares suchte, aber nichts fand. Grummelnd zog sie sich zurück und drängte mich dabei erneut zur Seite. Dabei sah ich etwa sechs Frischlinge hinter mir, die auf ihre Mutter warteten. Am Rupenhorn wohnt die Veterinärin Dr. Malone, die täglich zwei Wildsauen mit Wasser versorgt, weil diese wegen eines Zauns nicht mehr an den Wannsee gelangen können. Sie sind schon fast handzahm geworden, was den Obrigkeitsdenkern allerdings nicht gefällt: Die Wildtiere sollen den Menschen meiden.
Kürzlich stand ich Nachts an der Ampel am Görlitzer Bahnhof und wartete auf grünes Licht als ich einige Meter neben mir einen Fuchs sah, der ebenfalls die Skalitzer Strasse überqueren wollte. Er wartete auch und als die Ampel grün wurde, gingen wir beide los. Anscheinend glaubte er zu Recht, dass er sicherer über die Straße gelangte, wenn er sich nach mir richtete. Im Prinzenbad, im Wannsee-Schulungsheimgarten von Verdi, auf einem Kreuzberger Schulhof und im Hinterhof vom Haus der Kulturen Welt stellte sich regelmäßig ein Fuchs ein, wenn die Leute dort ihr Essen bzw. Pausenbrot auspackten oder den Grill anschmissen. In höflicher Entfernung warteten sie darauf, etwas abzubekommen. Auf einem Neuköllner Spielplatz sollten die Ratten vernichtet werden; statt Gift auszulegen hoffte man hier aber auf die Hilfe von einem Fuchs, der dann dort auch tatsächlich auf Rattenjagd ging. Auch auf dem Prager Platz in Wilmersdorf holt sich ein Fuchs immer mal wieder eine Ratte. Manchmal allerdings auch ein Kaninchen. Sie werden auf den offenen Hinterhöfen in der Prinzregentenstrasse von den Anwohnern mit Gemüseresten gefüttert. Im Palast der Republik lebte zuletzt ein Fuchs, als der Palast abgerissen wurde, verschaffte man ihm ein neues Domizil in der Tiefgarage am Alexanderplatz, das er auch annahm.
Ähnlich klug und urban verhalten sich die Krähen z.B. auf dem Hackeschen Markt und an den zwei Imbißständen am Mehringdamm: Sie hoffen dort auf Brot- und Fleischreste. Anderswo haben die Krähen von den Flaschensammlern gelernt und durchsuchen die orangenen Abfallkörbe an den Straßenrändern.
Dreister als Füchse sind die Waschbären, bislang trauten sie sich jedoch nur bis in die Außenbezirke Spandau, Reinickendorf, Marzahn und Treptow.
Im Engelbecken brütet eine Schwänin gleich neben den Cafétischen und ist so durch die Nähe der Gäste vor Eierdieben und sonstigen Feinden geschützt.
Ein Eichhörnchen springt regelmäßig von einem Baum auf den Balkon des taz-Autors Kuhlbrodt, wo er Futter für das Tier hinlegt. Im Prenzlauer Berg kam im letzten kalten Winter ein Eichhörnchen durch die offene Tür einer Küche im Erdgeschoß, wo wir zu fünft saßen. Sofort wurden ihm einige Nüsse hingelegt, es wollte aber nicht fressen, sondern sich nur aufwärmen.
In der Alten Schönhauser Strasse in Pankow hängen an den Balkonen einige Nistkästen für Meisen. Bei einer Mieterin fliegen sie in das Zimmer, wenn die Balkontür offen ist und schauen ihr bei der Arbeit zu. Weil dort auch ein Elsternpaar sein Revier hat, fallen ihm oft die flügge gewordenen Jungmeisen zum Opfer. Bisher haben die Meiseneltern die Mieterin vergeblich gebeten, ihre Jungen vor den Elstern zu schützen.
Tauben und Spatzen muß man hier nicht erwähnen: Sie leben schon seit ewigen Zeiten in Berlin und kennen viele Überlebensmöglichkeiten. Derzeit nähern sich Goldschakale der Stadt.
.

.
Vergangenheitsvergegenwärtigungen
In den frühen Siebzigerjahren hatten wir uns noch manchmal den Spaß erlaubt, wenn der Tagesspiegel mal wieder Verleumderisches über eine linke Aktivität berichtet hatte, ein Flugblatt mit dem Logo des Tagesspiegels zu drucken und es auf dem Kudamm und an der TU zu verteilen, in dem dieser sich für seine bösartige Berichterstattung bei seinen „lieben Lesern“ entschuldigte – was am nächsten Tag einen noch böseren Bericht des Tagesspiegels zur Folge hatte.
Ende der Achtzigerjahre verging uns der Spaß. Das begann schon einen Tag nach Öffnung der Mauer: Da traten Willy Brandt, Walter Momper, Hans-Dietrich Genscher und Helmut Kohl vor dem Schöneberger Rathaus auf und langweilten uns mit getexteten Jubelreden. Als sie dann auch noch die Deutschlandhymne anstimmten, wurde es uns (immerhin waren wir mehr als 10.000) zu viel: Wir pfiffen und buhten sie fast einstimmig nieder, so laut. dass sie ihren Gesang abbrechen mußten. Der Sender Freies Berlin (SFB) nahm alles auf. Als er es sendete, war von den tausendfachen Pfiffen und Buhrufen nichts mehr zu hören. Eine tolle Leistung der SFB-Techniker, die dafür Überstunden abrechnen durften.
Die schon bald in Auflösung begriffene DDR wurde dann fast ausschließlich unter dem Aspekt der „Stasi“ thematisiert und die materielle Substanz der DDR grundsätzlich als „marode“ beschrieben. Dazu wurden bald auch sämtliche DDR-Bürger als von den Kommunisten infantilisiert begriffen.
Die Ostberliner Publizistin Daniela Dahn hat in ihrem Buch „Tamtam und Tabu“ (2022) zusammen mit Rainer Mausfeld die übelsten medialen Lügen gesammelt. Z.B. vom „Spiegel“ Hans Modrows Auslassungen in Davos am Rande des Weltwirtschaftstreffens über den nahen Zusammenbruch der DDR: „Auf Anfrage sagt Hans Modrow heute, er habe kein Wort davon gesagt.“ Am 10. 2. 2023 starb er. In einem langen Spiegel-Bericht über die angeblichen Machenschaften Schalck-Golodkowski findet sich am 20.12.1989 das Faksimile einer Rechnung für ein Diamanten-Collier im Wert von knapp 10.00 DM für Margot Honecker, die das jedoch nie besessen hat, wie sie wiederholt versicherte.
Die Bild-Zeitung der Springerstiefelpresse ging natürlich noch weiter: „Von wegen nett und bieder: Modrow ließ das Volk prügeln“, titelte sie sowie: „Honecker hatte 100 Millionen auf dem Konto“ , „Der flotte Egon“ (Krenz) fuhr einen „Jaguar“ und trieb es mit „feschen Mädels aus der FDJ“, „Leitende Stasi-Offiziere stahlen aus BRD-Briefen an DDR-Bürger in den letzten drei Jahren 65 Millionen DM“ – auch dies eine Lüge der Bild-Zeitung, die nach der Kohlreise zu Gorbatschow einen 34tägigen „Countdown-Abreißkalender“ – bis zur „Freiheitswahl“ druckte.
Günter Wallraff erzählte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) zum Tag der deutschen Einheit 2022, dass Wolf Biermann nach seiner Ausbürgerung 1976 bei ihm einzog und die beiden daraufhin von der Bild-Zeitung „dauerüberwacht“ wurden – mit einer „Fangschaltung“, was die beiden jedoch erst später von einem bei Springer in Ungnade gefallenen Bild-Redakteur erfuhren, der ihnen die Abhörprotokolle vorlegte. Der „Whistleblower“ wurde seitdem seines Lebens nicht mehr froh: Man bedrohte ihn mehrfach, schlug ihn zusammen und am Ende wurde er tot in seiner Wohnung aufgefunden. Er war CSU-Mitglied gewesen und „Zuträger für den von Nazis und Amis nach dem Krieg gegen den Kommunismus gegründeten Bundesnachrichtendienst (BND). Sein Mörder war wahrscheinlich laut Wallraff in der FAS „ein noch lebender Nachrichtenhändler, der auch in Krisengebiete Waffen flog“ (was jetzt alle EU-Staaten tun).
2019 hatte „Die Zeit“ die Ergebnisse der wohl letzten größeren Umfrage unter Ostdeutschen mit der Schlagzeile veröffentlicht: „Die staatliche Willkür in der DDR war auch nicht schlimmer als heute“, das meinten über 70 Prozent der Befragten und 41 Prozent behaupteten, „man konnte in der DDR offener reden“. Etwas lockerer sah das ein Müllmann von der Berliner Stadtreinigung, wo man den Ost- und Westbetrieb zusammengelegt hatte. Er meinte auf die Frage des SPD-Politikers Norbert Gansel, der in den Parlamentsferien bei der BSR arbeitete, ob seine Tätigkeit nun anders geworden sei: „Eijentlich hat sich nischt jeändert ausser det Jesellschaftssystem.“
.

.
Der ideale russische Präsident (von Wladimir Kaminer)
Als die postsowjetischen Eliten einen nüchternen Nachfolger für den ewig betrunkenen Boris Jelzin brauchten, der den Erwartungen der Bevölkerung entsprechen, gegen die Eliten aber nicht aufmucken würde, starteten zwei führende Meinungsforschungsinstitute spaßeshalber eine großangelegte Umfrage: Anhand von 25 Helden aus bekannten Filmen und Büchern sollten die Russen auswählen, wen sie gerne als Präsident ihres Landes sehen würden. Die Liste der Kandidaten war umfangreich: Don Quichotte, Scherlock Holmes, Hamlet, der Baron von Münchhausen, Rambo und sogar der von von Bruce Willis gespielte John McClane war dabei, der aber auf der Liste nicht unter seinem Namen, sondern als „Hauptdarsteller aus der Serie „Harte Nuss“ firmierte: Der amerikanische Actionfilm „Die Hard“ der in Deutschland als „Stirb langsam“-Trilogie bekannt ist, lief nämlich in Russland erfolgreich unter dem Titel „Die harte Nuss“. Die Meinungsforscher hatten Bedenken, dass sich nicht alle russischen Zuschauer den Namen des von Bruce Willis verkörperten Helden gemerkt hatten. Doch die Russen wollten sowieso weder Sherlock Holmes noch die harte Nuss als nächsten Präsidenten sehen, die meiste Zustimmung in beiden Meinungsumfragen bekam erstaunlicherweise der SS Standartenführer Max Otto von Stierlitz, der coole Hauptheld der beliebtesten sowjetischen Fernsehserie „Siebzehn Augenblicke des Frühlings“.
In dieser Serie schleuste sich der sowjetische Spion Oberst Isaev als SS-Offizier getarnt in die obersten Etagen der Wehrmacht ein, um einige‘Geheimnisse des Dritten Reiches zu erkunden. Das Genre des Films war nicht Action, sondern ein so genanntes „Betriebsdrama“. In den zwölf Serien des Films wurde so gut wie nicht geschossen, die meiste Zeit saßen die berühmtesten Schauspieler des Landes in Naziuniformen verkleidet in ihren Büros und sortierten Papiere oder gingen auf ein Zigarettchen einander besuchen. Mal saß unser Held Stierlitz beim Gestapo-Chef Müller, mal kam der NSDAP-Vorsitzender Martin Bormann zu ihm zum Plaudern. Die ganze Führungsetage des Dritten Reiches glich im Film einer Schlangengrube, jeder intrigierte gegen jeden. Die sowjetischen Zuschauer konnten in den Intrigen auf dem Bildschirm sofort ihre Arbeitsorte erkennen, ihre Betriebe, ihre Büros, die Interessenkollisionen zwischen den Parteigenossen, den munteren Kollegen der Staatssicherheit und des bürokratischen Apparats. Sie waren wie in jedem großen und kleinen Betrieb der Sowjetunion gut nachvollziehbar. Sogar mein Vater, der als stellvertretender Leiter der Abteilung Planwesen in einem Betrieb der Binnenschifffahrt tätig war, konnte sich mit Stierlitz identifizieren.
Die Atmosphäre in der Planungsabteilung des Dritten Reiches schien von der Situation in seinem Betrieb abgeschrieben zu sein, nur dass die Darsteller im Film eben Naziuniformen trugen, und ab und zu einander mit „Heil Hitler“ grüßten. Genau wie die sowjetischen Bürger waren die Filmdarsteller an die Dreifaltigkeit ihres Seins gewöhnt: Sie dachten nicht das, was sie sagten, und taten nicht das, was sie dachten. Und jeder Zuschauer fühlte sich ein wenig wie Stierlitz. Max Otto war nicht nur ein Kundschafter, nicht nur Spion, er war der Vertreter des Guten in einer absolut bösen, feindlichen Welt. Er durfte niemals die Wahrheit sagen und seine wahren Absichten nicht offenbaren. Er wusste natürlich, diese Ordnung ist dem Untergang geweiht und der unvermeidliche Untergang spiegelte sich in seinem müden ironischen Lächeln wider. Dieses Lächeln, eroberte die Herzen des sowjetischen Publikums, so als wollte jeder mit Stierlitz sagen: „Ich gehöre nicht hierher, auch wenn ich mit den anderen zusammen den Hitlergruß mache, das ist bloß Tarnung.“ Ich glaube, sehr viele Kommunisten in der Sowjetunion haben sich ähnlich gefühlt, bloß was konnten sie tun?
In den ganzen zwölf Serien hat Max Otto von Stierlitz dem Dritten Reich auch nicht sonderlich geschadet, er wusste ja, diese unrechte Ordnung wird auch von alleine kaputt gehen. Er wollte bloß den Schaden der Katastrophe begrenzen und diejenigen vielleicht retten, die noch zu retten waren. Damit hat der Film den Nerv der Zeit getroffen. Die Stierlitz-Witze und seine Sprüche haben die sowjetische Folklore stark bereichert. Einen Satz hörte ich auch zuhause oft. Am Ende jeder Serie blieb Stierlitz nämlich in seinem Büro, um in Ruhe über die Ereignisse des Tages nachzudenken, in diesen wenigen Augenblicken konnte er sich ein wenig von seinem Nazidasein entspannen und dachte laut auf Russisch nach, was in dem Film mit einer Voice-Off Stimme wiedergegeben wurde. Bevor er das tat, schickte er noch für alle Fälle seine Sekretärin nach Hause, damit sie ihn nicht beim Russischdenken erwischte. Zu diesem Zweck ging Stierlitz an die Tür seines Büros, öffnete sie und rief: „Sie können gehen, Barbara“. Dieser Satz hat sich vielen Menschen eingeprägt. Auch bei meinem Vater. Wenn er an seinem freien Samstag in der Küche saß und meine Mutter sich beschwerte; „Es ist erst halb drei und Du machst schon die zweite Flasche Wein auf“ sagte Papa mit Stierlitz-Stimme: „Sie können jetzt gehen, Barbara.“
Beide Meinungsumfragen waren eindeutig: Die Bürger wollten keinen Don Quichotte im Kreml sehen und keinen John McClane. Ein halbes Jahr später wurde der Nachfolger des alten kränkelnden Präsidenten der Öffentlichkeit präsentiert: Ein unauffälliger Mann, ein ehemaliger Kundschafter, der früher in Deutschland spioniert hatte, niemals sein Gegenüber direkt anschaute und etwas müde, ironisch lächelte.
.

.

.
Eiderdaunen
Der englische „Finanzanalyst“ Edward Posnett hatte eine Idee, die ihn bewog, ein „Naturanalyst“ zu werden, also quasi die Seite zu wechseln. Er saß im Londoner Finanzzentrum „Canary Wharf“ in den ehemaligen Docklands, dem Umschlagplatz für die Rohstoffe aus den Kolonien, und beschäftigte sich mit Zahlen voller versteckter Bedeutungen – über „Millionen-Dollar-Ölgeschäfte in Afrika, Skandale um kriminelle Wertpapiergeschäfte, Bestechungsvorwürfe im nordamerikanischen Baugewerbe…“ In der Mittagspause dachte er über die Waren nach, die in den Docklands einst angelandet wurden: „Elfenbein, Zuckerrohr, Baumwolle, Tierfelle“ – und über den „Prozess der Kommerzialisierung der Natur“. Diese Ausbeutung, die quasi naturgemäß mit der Ausrottung vieler Arten einherging und -geht, ließ in ihm die Frage aufkommen: Gibt es auch eine Kommerzialisierung der Natur ohne Ausbeutung?
Weil er genug Geld verdient hatte, machte er sich auf die Suche. Zunächst studierte er auf Island die Ernte von „Eiderdaunen“. Sie stammen vom Brustgefieder der Eiderenten, dienen zur Auspolsterung ihrer Nester und werden von den Menschen wegen ihrer Eigenschaft, besonders weich zu sein und gut zu wärmen, hochgeschätzt. Über die letzten 350 isländischen Eiderentenbauern veröffentlichte er 2015 einen Bericht, dem 2020 ein Buch mit dem Titel „Die Kunst der Ernte“ folgte. Er ging dafür in Asien den Produkten „Essbare Vogelnester“ und „Katzenkaffee“, auf Sardinien der „Muschelseide“, in Südamerika der „Vikunjafaser“, den „Tagua“-Nüssen und dem „Guano“-Dünger nach. Auch den „Eiderdaunen“ widmete er sich in seinem Buch noch einmal – mit Sympathie für seine sieben „Gegenstände“, die bis auf die Früchte der Tagua-Palme alle von Tieren stammen. Gibt es eine nicht-ausbeuterische, nicht-zerstörerische Verwertung von Rohstoffen/Ressourcen? fragte er sich. Bei den „Eideraunen“ kam Edward Posnett ihr am nächsten.
Die Eiderenten brüten an den abgelegenen Westfjorden Islands auf den Ländereien der Eider-Bauern und manchmal sogar in ihrem Haus. Die Bauern warten – „so will es die Etikette“ – bis die Eiderenten-Jungen ihre Nester verlassen haben. Dann sammeln sie die Daunen darin ein. Für einen Kilo müssen sie 60 Nester leeren, die Daunen werden von ihnen getrocknet und gereinigt, um Schmutz und Seetank zu entfernen – und dann an einen „Zwischenhändler“ verkauft.
Ein dort lebender Pastor verglich die Eiderdaunen mit dem Kokain aus den Anden: „Wir [die Daunensammler] bekommen nur einen Bruchteil des Preises, den das Produkt dann kostet, wenn es auf die Straßen Tokios gelangt.“ Tatsächlich bekommen die Eiderbauern einen niedrigeren Prozentsatz vom Einzelhandelspreis als ein afrikanischer Kaffeebauer, erfuhr Posnett von einem isländischen Geschäftsmann. Was von außen betrachtet wie ein nettes, kleines, nostalgisch-friedliches Gewerbe wirke; sei „in Wirklichkeit ein Krake aus Monopol und Manipulation“.
Desungeachtet sind „Umweltschützer, Ökonomen und Ornithologen“ laut Posnett „von der isländischen Daunenernte begeistert. Die Beziehung zwischen den Menschen, die die Daunen ernten, und den Eiderenten ist von unwiderstehlicher Schlichtheit: Kümmert sich ein Mensch um diese Tauchenten, kommen immer mehr zum Nisten und erhöhen somit die Daunenmenge, die ihr menschlicher Beschützer einsammeln kann“.
Auf der abgelegenen Insel Vigur erfuhr der Autor, dass die Bauern dort oft und gerne alle möglichen Seevögel jagen und essen, aber Eiderenten sind tabu: „Sie machen mehr als ein Drittel des Familieneinkommens aus“. Wenn die Inselbewohner Seemöwen erlegen, schützen sie damit gleichzeitig auch die Gelege der Eiderenten. Posnett erfuhr von einem Eiderbauern, dass die Norweger einst ebenfalls entlang ihrer Küste Eiderdaunen „geerntet“ hätten, „aber mit der Entdeckung des Erdöls in der Nordsee begannen die Menschen sich aus abgelegenen Küstengebieten zurückzuziehen. Die Eiderenten wollten mit, weil sie sich von den Menschen beschützt fühlten. Sie wollten lieber mit Katzen und Hunden zusammenleben als mit Seemöwen.“ Auf Island wollen sie mit den Daunensammlern zusammenleben, die über eine „ans Mystische grenzende Fähigkeit verfügen, die Enten zu verstehen,“ wie der britische Autor Gavin Maxwell schrieb.
Bei einem pensionierten Mathematiklehrer, der einst der größte Eiderdaunenproduzent Island war, kam er dahinter, was der „Preis“ der Natur für dieses nachhaltig produzierte Naturprodukt ist: Die brütenden Eiderenten werden von den Eiderbauern vor allem gegen Füchse geschützt, indem sie diese erbarmungslos verfolgen. Der Lehrer rekrutiert jedes Jahr im Frühling eine „Privatarmee aus Eiderdaunenbauern. Gemäß seinen schriftlichen Anordnungen fahren sie, bewaffnet mit Gewehren und Walkie-Talkies, in ihren Autos los, um Füchse zu jagen.“ Ohne Füchse „wäre die Eiderdaunenernte so prosaisch wie das Einkassieren der Miete“. Wenn Flughunde und Wickelbären die einzigen nicht-parasitär lebenden Säugetiere sind, weil sie als Fruchtfresser weder Pflanzen noch Tiere töten oder verletzen, dann sind die Füchse jagenden isländischen Eiderbauern das Gegenteil. „Die besten Wirte sind manchmal auch die besten Parasiten“, meint der Philosoph Michel Serres. In Deutschland werden nebenbeibemerkt jährlich 500.000 Füchse erschossen, besonders viele in Niedersachsen, wo die Bauern seit 2022 unter einer großen Mäuseplage leiden. Anscheinend will man in diesem konservativen Bundesland keinen Zusammenhang darin sehen.
.

Klimaanlagen an einem Haus
.
Buddha sah eines Tages, wie ein Falke eine Taube schlug. Sie tat ihm leid und er rettete sie. „Ich muß aber auch leben,“ sagte der Falke. Buddha nahm daraufhin eine Waage und setzte die Taube auf die eine Seite, auf die andere legte er ein Stück seines Armes, das er sich abschnitt. Die Waagenseite mit der Taube blieb unten, auch als Buddha immer mehr Teile von seinem Körper abschnitt und auf die andere Seite legte. Erst als er sich dazustellte, glichen sich die Gewichte auf beiden Seiten aus. Dieses Gleichnis soll zeigen, dass alle Lebewesen gleich viel wiegen.
Als Buddha die Erde verlassen wollte, kamen sie zu ihm, um ihn zu verabschieden – in folgender Reihenfolge:
Ratte
Ich hatte mal einen zahme Ratte, die ich zusammen mit einem Meerschweinchen und einem Kaninchen auf einer Insel im Moor hielt, wo wir wohnten. Sie konnte schwimmen und tat das auch gern, wenn sie nicht gerade die Insel untertunnelte oder schlief.
Ursprünglich sollte sie im Aquarium des Bremer Überseemuseums an Schlangen verfüttert werden. Sie war weiß und tauchte gern; wenn sie hochkam, war ihr Kopf voller brauner Pflanzenteile. Wir hatten den Eindruck, dass sie am liebsten schwamm und tauchte, wenn wir Besuch aus der Stadt hatten, der davon sehr beeindruckt war.
Für die Chinesen ist die Ratte im Tierkreiszeichen charmant, gesellig, einfallsreich.
Ochse
Gemeint ist ein Wasserbüffel. Der Autor Aravind Adiga erinnert sich: „An der Tür steht das wichtigste Familienmitglied: die Wasserbüffelkuh. Sie war bei Weitem die Fetteste in unserem Haus, und so war es auch bei allen anderen Familien des Dorfes. Den ganzen Tag fütterten die Frauen sie mit frischem Gras; das Füttern war ihre Hauptbeschäftigung im Leben. Alle Hoffnungen dieser Frauen richteten sich auf den Leibesumfang der Büffelkuh. Gab sie genug Milch, konnten die Frauen etwas davon verkaufen, und am Ende des Tages war vielleicht ein bisschen Geld übrig. Sie war wohlgenährt, ihr Fell glänzte, über ihrem haarigen Maul stand eine Ader hervor, und von ihren Lefzen hingen lange, dicke, perlmuttfarbene Speichelfäden. Den ganzen Tag lag sie in ihrem dicken Scheißhaufen. Sie war die Haustyrannin!“
So gaben die Frauen zum Beispiel seinem Vater erst nach der Büffelkuh zu essen. Früh am Morgen band der Vater sie von ihrem Pfahl los und zusammen mit seinem Sohn brachte er das dicke Tier an einen Wassergraben, damit es sein Morgenbad nehmen konnte. „Die Büffelkuh watet hinein und kaut an den Seerosenblättern. Währenddessen geht über ihr, dem Vater, und mir und meiner Welt die Sonne auf. Es ist kaum zu glauben, aber manchmal vermisse ich diesen Ort.“ Die Männer arbeiten im Reisfeld mit Wasserbüffelbullen, die kastriert sind.
Ochsen verkörpern die Eigenschaften stur, geduldig, beharrlich.
Tiger
Die US-Dompteurin Mabel Stark arbeitete zeitweilig mit 20 Tigern. Sie meinte: „Tiger mögen nur Menschen, die einen stärkeren Willen als sie haben“. Mit dem von ihr großgezogenen Tiger „Rajah“ lebte sie in ihrem Wohnwagen zusammen, er schlief in ihrem Bett, ebenso wie ihr dritter Ehemann. In der Manege bestand ihre berühmteste Nummer darin, dass sie den Tigern den Rücken zukehrte und Rajah sie plötzlich von hinten ansprang, zu Boden warf und mit ihr rang. Mit der Zeit entwickelte sich daraus bei dem Tiger ein Paarungsakt. Weil sein Samen auf ihrem schwarzen Lederkostüm unschön aussah, wechselte sie in ein weißes Kostüm, das sie bis zum Ende ihrer Karriere 1968 trug.
Tiger werden als durchsetzungsfähig, abenteuerlustig und unabhängig charakterisiert.
Hase
Hasen gibt es auf allen Kontinenten, sie leben im freien Feld und flachen Mulden. Neugeborene Hasen sind Nestflüchter, haben bereits Fell und können sehen. Häsinnen boxen laut WWF gern mal einen Verehrer um. Und sie können zweimal gleichzeitig schwanger werden, bis zu 80 km/h schnell werden, drei Meter weit und zwei Meter hoch springen und sehr gut schwimmen.
Sie sind quasi Wiederkäuer, das heißt sie kauen ihre ausgeschiedenen Kotkugeln noch einmal durch. Hasen lassen sich nicht zähmen. Auf der Flucht schlagen sie ihre typischen Haken, ändern also mehrfach abrupt die Richtung. In den buddhistischen Ländern wird der Hase verehrt, und wenn man einen sieht, wird einem „ganz kühl ums Herz“.
Hasen werden als distanziert, klug, diskret charakterisiert.
Drache
Man sagt in China, ein Chinese ist ein Drache, zwei Chinesen sind ein Wurm – und bei den Japanern ist es umgekehrt. Unter den Tieren gibt es heute nur noch den kleinen bis zu zwanzig Zentimeter langen Flugdrachen, der in Südostasien lebt. Er ist ein Insekten fressender Baumbewohner. Die von den ausgebreiteten verlängerten Rippen getragene Flankenhaut wird als Flughaut benutzt, mit der er von Baum zu Baum gleiten kann.
Den Drachen charakterisieren die Chinesen als aktiv, launisch und vielseitig.
Schlange
In der Berliner Volksbühne machten einmal fünf Pythonschlangen Theater. Die Pythons wirkten bühnenerprobt. Sie balancierten auf einer Bambusstange und bewegten sich langsam auf den Schultern ihres Besitzers Rainer Kwasi. Die größte, eine etwa fünf Meter lange gelbe Python, spielte die Hauptrolle in einem Film. Man sah, wie sie züngelnd die ganze Volksbühne erkundete – bevor sie sich im Roten Salon dem zahlreich erschienenen Publikum zeigte.
Derweil erklärte man uns das multifunktionale Sinnesorgan „gespaltene Schlangenzunge“, dazu hat die Python eine Art drittes Auge auf der Stirn, mit der sie etwa Infrarotstrahlen wahrnehmen kann. Im Übrigen sei ihr gesamtes Sensorium so ausgeprägt, dass sie sehr feine Informationen über den Menschen wahrnehmen könne – „vielleicht mehr als wir über sie“.
Von den Chinesen wird die Schlange als sensibel, unabhängig und ab und an als faul charakterisiert.
Pferd
Früher gehörte dem die Welt, der ein gutes Pferd und eine Stunde Vorsprung hatte. Heute sind Pferde aus Chrom und Stahl gemacht, und kleine dicke Männer reiten sie. Nach wie vor gilt jedoch laut Adorno, dass „der Gestus Münchhausens, wie er sich und sein Pferd am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht, zum Schema einer jeden Erkenntnis wird, die mehr sein will als bloßer Entwurf“.
Im Internet findet man dagegen mehrere Fotos, auf denen eine Reiterin verzweifelt versucht, ihr Freizeitpferd aus einem Sumpf zu ziehen, in dem es stecken geblieben ist. Pferde sind im Gegensatz zu Eseln Fluchttiere und drehen mitunter durch.
Pferde werden im Chinesischen als aufmerksam, kontaktfreudig und eloquent charakterisiert.
Ziege
Von den Ziegen ist ein beträchtlicher Teil verwildert, also frei. „Schafe zu bewachen ist ein Kinderspiel, verglichen mit dem Ziegenhüten“, meint der Ökologe Josef Reichholf. Er sieht einen Unterschied zwischen den zwei Tierarten vor allem in ihrem Grad an Eigensinnigkeit. Die schwäbische Schäferin Ruth Häckh bewundert Ziegen, aber „aus Sicht des Schäfers sind sie eigentlich unmöglich. Wie Schafe hüten lassen sie sich jedenfalls nicht, dafür sind sie zu ausgeprägte Individualisten.“
Schafe fressen Gras, Ziegen lieber Blätter, die sie sich suchen. Dazu springen sie über Zäune und plündern Gärten. Für Ruth Häckh gibt es „keinen wirtschaftlichen Grund, Ziegen zu halten. Sie tun aber der Seele gut, sie steuern sozusagen ein abenteuerliches Element bei“.
Das trifft sich mit der chinesischen Charakterisierung der Ziege: kreativ, künstlerisch, großzügig.
Affe
Der französische Kardinal Melchior de Polignac soll zu dem im Pariser Jardin du Roi gezeigten Menschenaffen einst gesagt haben: „Sprich – und ich taufe dich!“ Die indigene Dayakbevölkerung auf Borneo behauptet, dass diese von ihnen „Waldmenschen“ genannten Orang-Utans nicht sprechen, weil sie sonst arbeiten müssten. Die einheimischen Angolaner unterstellen den Schimpansen ebenfalls mutwilliges Schweigen. Der amerikanische Primatenforscher Robert Yerkes ging davon aus, dass sie unfähig sind, Gedanken durch Laute wiederzugeben, dennoch haben sie viel zu erzählen: „Vielleicht können sie sich eine einfache nichtlautliche ‚Zeichensprache‘ aneignen.“ Das taten sie auch, schon bald gab es Menschenaffen, die über 100 Wörter in der Gebärdensprache beherrschten. Eine Primatenforscherin brachte einem Bonobo statt Handzeichen eine Reihe von Symbolen („willkürliche geometrische Formen“) auf einer elektronischen Tastatur bei, mit deren Hilfe sowie mit Gesten und Lauten er mit den Menschen kommunizieren sollte. „Eine Methode, die eine normale, gesellige Unterhaltung nicht gerade fördert“, kritisierte der Gebärdensprachlehrer Roger Fouts, der eine „computerfeste Schimpansin“ namens „Lana“ erwähnt, die traurige Sätze wie „Bitte, Maschine, kitzle Lana“ tippte.
Affen werden als einfallsreich, lustig, gesellig charakterisiert.
Hahn
Der Pater Athanasius Kircher hypnotisierte 1646 einen Hahn, danach auch noch andere Vögel, aber mit Hühnern war es am leichtesten, so leicht, dass auch Leute wie Helmut Kohl, Al Gore und Werner Herzog es Kircher nachgemacht haben. Einmal hypnotisiert, bleiben die Hühner so lange liegen, bis der Hypnotiseur sie ein paarmal mit dem Finger anstupst. „Sie scheinen so etwas wie die Stars der Tierhypnose zu sein“, schrieb die Nordwest-Zeitung, die gleich eine ganze Reihe von Hühner-Hypnotiseuren erwähnte.
Aber wozu macht man so etwas Unsinniges? Wir hatten zu Hause sechs Hühner und einen Hahn, der sehr umsichtig war. Er rief die Hennen, wenn er etwas zu fressen fand, und verteidigte sie mutig gegen Feinde, aber nicht gegen uns: Dass wir den Hennen täglich die Eier aus dem Nest klauten und seine Schar sich deswegen nicht vergrößerte, nahm er schicksalsergeben hin.
Der Hahn wird als ordentlich, gewissenhaft und ehrenhaft charakterisiert.
Hund
Er kann nicht so gut sehen wie wir, dafür viel besser riechen, was ein anderes Weltbild ergibt als eines, das auf optischen Eindrücken beruht. Nietzsche hatte wohl recht, als er sagte: „Ich erst habe die Wahrheit erkannt – indem ich sie roch. Mein Genie liegt in meinen Nüstern.“ Was manch Engländer für die einzig angemessene Wahrnehmungsweise eines Philosophen hielt.
Inzwischen ist es jedoch mit unserem Geruchssinn nicht mehr weit her, deswegen nimmt man dafür gerne Hunde. Mit ihrer feinen Nase müssen sie immer mehr erschnüffeln: Trüffel und Drogen, Bomben, Vermisste und Leichen. Man kann ihre Nase auf alles trainieren. Eine Gruppe in Deutschland phänomenologisch ausgebildeter Reporter aus den USA um Robert Ezra Park gründete 1920 die Chicago School of Sociology, in ihr gehört das „Nosing Around“ bis heute zum Unterrichtsprinzip.
Hunde werden als ehrlich, zuverlässig und fürsorglich charakterisiert.
Schwein
„Als aufs Land geschickter jugendlicher Intellektueller hatte ich Schweine gezüchtet“, schreibt Wang Xiaobo in seiner Geschichte eines Schweines, „das so geschickt wie ein Steinbock war, es sprang mit einem Satz über den Zaun des Schweinestalls hinweg. Deshalb trieb es sich überall herum und blieb nie im Stall.“
Es war sein Lieblingsschwein, „weil es sich nichts vorschreiben ließ und solch ein freies und unbändiges Leben führte. Unsere Leiter veranstalteten speziell deswegen eine Sondersitzung und erklärten den Schweinbruder zum bösen Element, das die Frühlingsarbeit sabotiere. Sie beschlossen, Mittel der proletarischen Diktatur gegen ihn einzusetzen.“
Aber das Schwein konnte entkommen und mied fortan die Menschen. Xiaobo meint dazu: „Nun habe ich vierzig Jahre gelebt. Außer diesem Schwein habe ich in meinem Leben noch kein anderes Wesen getroffen, das es wie dieses Tier gewagt hätte, dem vorgesehenen Leben die Stirn zu bieten. Ganz im Gegenteil, ich habe viele Menschen getroffen, die das Leben anderer mit Inhalten zu versehen versuchen und Menschen, die ein von anderen vorgegebenes Leben führen und damit glücklich sind. Aus diesem Grund kann ich dieses Schwein, das seine eigenen Wege ging, nicht vergessen.“
Schweine gelten als hilfsbereit, gefühlvoll und treu.
P.S.: Im AbL-Verlag erschien gerade ein Buch von Christa Iversen: „Bauer Witthus im Jahr des Schweins“.
.




