
.
#TeslaTakedown: Protest in Berlin-Mitte am Samstag 5.4. um 12 Uhr + Breite Kampagne für Demokratie kritisiert Musk Unter dem Motto #TeslaTakedown rufen zahlreiche Organisationen und Bündnisse zu einer Kundgebung am Samstag den 5.4. um 12 Uhr vor dem Tesla Showroom in Berlin-Mitte auf. Unter #TeslaTakedown protestieren Menschen weltweit gegen Elon Musks Angriffe auf die Demokratie. Seit im Januar die ersten Proteste in den USA stattfanden, wird mittlerweile weltweit vor Tesla Verkaufsräumen und Fabriken demonstriert. In Deutschland fanden im Laufe der letzten Tage bereits in verschiedenen Städten erste Proteste statt, am heutigen Tag beispielsweise in Strausberg. Die Demonstrierenden stellen sich gegen Elon Musk, den reichsten Menschen der Welt, der rechte Parteien unterstützt.
.

.
Elon Musk, das ekpathische Frontschwein von Trump, meinte kürzlich:„Die grundlegende Schwäche der westlichen Zivilisation ist Empathie.“
Darauf Donald Trump laut Tagesschau: „Elon macht einen großartigen Job, aber ich würde gerne sehen, dass er aggressiver wird“.
J.D. Vance mit Frau auf dem Weg nach Grönland: „Wir werden uns ansehen, wie die Dinge dort laufen. Im Namen von Präsident Trump wollen wir die Sicherheit der Menschen in Grönland wieder stärken, weil wir glauben, dass dies für die Sicherheit der ganzen Welt wichtig ist.“
Die Nichte von Donald Trump, Mary L. Trump, schreibt in ihrem Buch „Amerikas Alptraum – Warum Donald Trump nicht zu stoppen ist“: „Donald ist von seinem Instinkt her ein Faschist, der aufgrund seiner Unfähigkeit, über sich selbst hinauszublicken, beschränkt ist…Es ist an der Zeit, unseren Körper aufs Spiel zu setzen.“
Die Tochter von Elon Musk Jenna Wilson hat ihn auf ihre Weise aufs Spiel gesetzt: Sie ist jetzt eine „Transfrau“, wie sie sagte. Über ihren Vater äußerte sie in einem Interview mit „Teen Vogue“: „Er ist ein erbärmliches Kind“.
Die Aktie von Musk Unternehmen Tesla, die Mitte Dezember 2024 einen Höchststand von fast 480 US-Dollar pro Aktie erreichte, ist bis heute auf rund 248,71 US-Dollar abgestürzt – ein erschreckender Rückgang von 48 %. Dies entspricht einem Marktwertverlust von über 800 Milliarden US-Dollar und macht Tesla in diesem Jahr zu einer der Aktien mit der schlechtesten Performance.
Auf die Forderung einiger Tesla-Aktionäre, Elon Musk müsse als Unternehmenschef von Tesla zurücktreten, antwortete er: „Ich gehe nirgendwo hin, Tesla wird wieder auferstehen.“ Sodann hob er das Zukunftspotenzial von Tesla hervor, insbesondere in den Märkten für Robotaxis und humanoide Roboter, und pries das kommende Cybercab und den Optimus-Roboter als bahnbrechend an.
Schon im Wahlkampf drohte Trump, Grönland notfalls mit Gewalt zu vereinnahmen. Es geht dabei vor allem um die Rohstoffe auf der Insel. Als er jetzt den NATO-Generalsekretär empfing, wiederholte er noch einmal seine Drohung: „Ich denke, es wird passieren, dass ich Grönland annektiere.“
Noch mal zur Empathie (von „David Attenboroug Fans“):
.

.
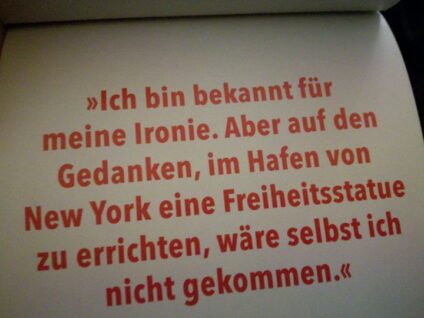
Zitat von Mark Twain
.

.

.

.
Weitere US-Idiotismen
Über 80% aller US-Biologen sind Eigentümer oder Teilhaber von Firmen, die ihre Forschungsergebnisse vermarkten, so die US-Biologiehistorikerin Lilly E. Kay. Vor dem Zweiten Weltkrieg haben die Biologen noch „„ohne jegliches kommerzielles Interesse geforscht,“ meint die US-Mikrobiologin Lynn Margulis. Ihre Kollegen „interessieren sich heute nicht mehr für die Geschichte des Lebens auf der Erde, sondern vor allem dafür, bessere Tomaten zu machen,“ kritisierte sie.
Gleichzeitig versprechen uns die angloamerikanischen Naturwissenschaftler mit ihren albernen Erkenntnissen das Blaue vom Himmel. So tönt z.B. der Biologe Semir Zeki in seinem Buch „Glanz und Elend des Gehirns“ (2010): „Mein Ansatz ist von der Wahrheit bestimmt, von der ich denke, dass sie unumstösslich ist: dass jede menschliche Handlung von der Organisation und den Gesetzen des Gehirns bestimmt ist und dass es deshalb keine wahre Kunst- und Ästhetik-Theorie geben kann, außer wenn sie auf Neurobiologie beruht“ – also auf einem höchst fragwürdigen Forschungsansatz.
Dieser Schwachsinn ist unter aller Kritik, ebenso die folgenden Gedanken des US-Physikers Michio Kaku. In seinem Bestseller „Wettlauf um die Zukunft“ (2023) geht es ihm darum, „wie der Quantencomputer die Probleme der Menschheit lösen wird“. So einen kindischen Unsinn will man doch nicht lesen!
Ebensowenig den US-Bestseller für den sich das „manager-magazin“ erwärmt: „Die digitale Revolution: Verheißungen einer vernetzten Welt – die Folgen für Wirtschaft, Management und Gesellschaft“ (1996) von Don Tapscott, den Vorsitzenden der wirtschaftsstrategischen Denkfabrik „nGenera Insight“. Tapscott prophezeit in seinem Buch: Die neuen Medien werden eine völlig neue Ökonomie hervorbringen, die die alten Wertschöpfungsketten durch -netze ersetzt und eine neue Unmittelbarkeit erlauben. Zudem werden in den Unternehmen Kommandohierarchien obsolet, wobei „zunehmend Kapital durch Geist geschaffen wird“ – Kreativität, die nicht mehr von oben „beaufsichtigt und befohlen“ wird. „In der modernen Wissensökonomie sind Lernen und Arbeiten hundertprozentig identische Aktivitäten“, deswegen werden die neuen „Unternehmen die zukünftigen Universitäten sein“. Als Beispiel erwähnt Tapscott die Universität des Konzerns McDonalds, in der 2006 „eine Million Menschen lernten“, er nennt sie die „Net-Generation“.
Diese hier zitierten Ami-Wissenschaftsutopien sind grauenhafte Dystopien. Manchmal ist so ein nach Ruhm, Ehre und Reichtum gierender Dumpfbeutel aber ohne es zu wollen, ehrlich genug, um das selbst zu sehen. Z.B. der Genetiker und Berater von Biotech-Unternehmen, William Bain in der Zeitschrift „Nature Biotechnology”: „Die meisten Anstrengungen in der Forschung und in der biotechnologischen industriellen Entwicklung basieren auf der Idee, dass Gene die Grundlage des Lebens sind, dass die Doppelhelix die Ikone unseres Wissens ist und ein Gewinn für unser Zeitalter. Ein Gen, ein Enzym, ist zum Slogan der Industrie geworden…Kann das alles so falsch sein? Ich glaube schon, aber ich bin sicher, das macht nichts. Denn die Hauptsache ist, dass es funktioniert: Manchmal funktioniert es, aber aus den falschen Gründen, manchmal wird es mehr Schaden anrichten als Gutes tun…Aber die beobachtbare Wirkung ist unbestreitbar…Wir müssen nicht das Wesen der Erkenntnis verstehen, um die Werkzeuge zu erkennen…Inzwischen führen die Genom-Datenbanken, die geklonten Proteine und anderes Zubehör der funktionalen Genetik zu Werkzeugen, Produkten, Einsichten, Karrieren und Optionen an der Börse für uns alle.”
Ironischerweise nennt sich die mit Computern und anderen Hightech-Geräten operierende Biologie heute „Life Sciences“, obwohl sie mit dem „Leben“ so gut wie nichts zu tun hat. Das Wort „Leben“ taucht in den Biologiebüchern schon so gut wie gar nicht mehr auf. Die Lebenswissenschaftler erforschen heute „nicht mehr das Leben, sondern die Algorithmen des Lebendigen“, stellte der französische Genetiker und Nobelpreisträger Francois Jacob klar.
Der kürzlich verstorbene französische Wissenssoziologe Bruno Latour hielt dagegen die ganze Genetik für einen ärmlichen „Reduktionismus“, räumte allerdings ein, dass sie in der Industrie durchaus Sinn ergebe, d.h. Gewinne verspreche. Mit „Industrie“ ist in gewisser Weise die nahezu weltweit angloamerikanisierte Biologie gemeint, die mit ihren Geräten „objektiv verwertbare Erkenntnisse“ liefert. Ähnlich wie Latour sieht das auch der deutsche Philosoph Gregory Fuller: „Mit der Gentechnik erreichen wir den Höhepunkt unserer Verachtung gegenüber allen natürlichen Wesen,“ schrieb er in „Das Ende – von der heiteren Hoffnungslosigkeit im Angesicht der ökologischen Katastrophe“ 1993.
.

.

.
Fegen (1)
Mir erzählte Oi-Ok Shu, eine koreanische Krankenschwester, jetzt Rentnerin, die gelegentlich das koreanische Buddhakloster in der Oranienstraße besuchte, dass dort eine “Intensivmeditation” stattfand, bei der die Teilnehmer sich rund um die Uhr im Zentrum versammeln. Morgens gehen sie dann als erstes in den Görlitzer Park, um dort – „etwas Gutes zu tun, d.h. die Wege zu fegen – und damit gleichzeitig der eigenen Erleuchtung näher zu kommen”. Denn wenn man diese nicht erreiche, dann werde einem – laut Frau Shu – „jeder Grashalm zur Falle”.
Nanu: fegen?! dachte ich – und begann sofort in Gedanken loszurattern: Mao – „Für alles Reaktionäre gilt, daß es nicht fällt, wenn man es nicht niederschlägt. Es ist die gleiche Regel wie beim Fegen: Wo der Besen nicht hinkommt, wird der Schmutz nicht von selbst verschwinden!”
Und dann die chinesische Kulturrevolution – Wie viele Intellektuelle und Kader hat es damals gegeben, die man zwecks Umerziehung zum Fegen, als Pförtner oder Hausmeister abkommandiert hatte? Die „Narben-Literatur” ist voll von Klagen über diese entehrende Tätigkeit, mit der die Betreffenden ihr falsches – reaktionäres – Bewußtsein ändern sollten.
Außerhalb Chinas und der von oben gesteuerten Kulturrevolution wurde jedoch ebenfalls gefegt wie verrückt – im Westen allerdings eher auf freiwilliger Basis, aber mit dem selben Ziel: um von unten nach oben alles umzudrehen – die Kacke des Seins umzugraben! Ich erinnere mich noch, z.B. das Georg-von-Rauchhaus tagelang gefegt zu haben, ebenso den Republikanischen Club, die Alte TU-Mensa bis zum Erbrechen, das Audimax der TU einmal und auch die Diskothek “Dschungel” sowie mindestens zwei Mal Teile des zugefrorenen Wannsees, um eine schneefreie Fläche zum Eishockey-Spielen zu schaffen.
Auf dem Höhepunkt dieser ganzen Fegerei gab es nicht nur mehrere französische Filme, in denen Straßenfeger eine tragende Rolle spielten (“Themroc” z.B.), sondern auch Joseph Beuys Fegeaktion in Neukölln, wo er hinter der Revolutionären 1.-Mai-Demonstration die Karl-Marx-Straße wieder besenrein machte. Sein damals dort zusammengefegter Dreck ist heute längst unbezahlbar.
Auf dem Höhepunkt meiner Fegeleidenschaft baute ich einmal bei einem Bauern einen ausrangierten Heuwender mittels 12 Piasawa-Besen zu einer Kehrmaschine um – und konnte fortan jeden Samstag seinen Hof mit dem Trecker fegen. Dem Bauer gefiel die Konstruktion. Genau das Gegenteil passierte mir dann während der umgedrehten Kulturrevolution – Wende genannt – in der DDR, auf einer LPG: Dort fegte ich einmal einen Stallgang auf der Rindermast sehr langsam und gründlich, aber eigentlich nur, um mich weiter mit einem Kollegen zu unterhalten, der noch mit Füttern beschäftigt war. Irgendwann stand er hinter mir und sagte – in einem Ton als würde ein Arbeiterverräter zurechtgewiesen: „Laß gut sein, wenn du es zu sauber machst, dann stecken sich das die da oben bloß wieder an den Hut!” Bei einer ähnlichen Gelegenheit meinte ein anderer Kollege, dafür sei die und die Brigade zuständig – nicht wir. Auf meinen Einwand, dass diese doch aufgelöst sei, entgegnete er: “Darüber müssen die da oben sich einen Kopp machen!”
Seitdem habe ich eigentlich nie mehr so richtig gefegt. Höchstens Staubsaugen. So wird es auch in China jetzt sein, dass man die Leute gegebenenfalls zum Staubsaugen verdonnert. Das Fegen war während der Kulturrevolution eine derart harte Umerziehungsmaßnahme, dass die Betreffenden meistens Nachts aufstanden, um damit fertig zu sein, bevor die ersten Nachbarn wach wurden und sie auf der Gasse sahen – so sehr schämten sie sich! Daran sieht man, wie wichtig gerade das Fegen ist!
Bei mir ist es noch immer so, dass ich – umgekehrt – mit niemandem liiert sein möchte, der seine Wohnung fegen (oder staubsaugen) läßt: So etwas gehört sich einfach nicht! Das macht man selber oder läßt den Dreck liegen! Jemanden für so etwas anzustellen, ist eine gemeine Verschwendung anderer Leute Lebenszeit!
In der Wende versprach Gregor Gysi, als er zum PDS-Vorsitzenden gewählt wurde, die Partei mit „hartem Besen auszukehren” – und einen solchen hielt er dann auch in die ARD-Kamera. Da war das Fegen aber längst zu einer Metapher geworden. So wie bei der Bürgerinitiative, die am 1. Mai hinter einer Neonazi-Demo die Straße „medienwirksam” sauber fegte. Wenig später, am Tag der Kapitulation, fand in der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg eine Diskussion über eben diesen Bezirk statt, in dem heute immer mehr Leute ihre Lofts und Flats von Putzfrauen fegen lassen. U.a. sprachen Papenfuß, Kuttner und Schappi (Wawerzinek) darüber, wie es dort früher war. Interessanterweise hatten alle drei auch mal als Hausmeister gearbeitet – und als solche regelmäßig, z.B. eine Kita, ausfegen müssen. In Erinnerung war ihnen jedoch vor allem das allmorgendliche Anheizen des Zentralofens geblieben, aber Heizer müssen zwischendurch auch immer mal fegen.
SPD-Vorständler kümmern sich gerne im Sommerloch um Großbetriebe – und gehen besuchsweise an die Basis. Nachdem so einer, aus Hessen, einmal bei der Berliner Stadreinigung gearbeitet hatte, fragte er einen Ostkollegen, ob sich seine jetzige Tätigkeit bei der BSR im Vergleich zu früher wesentlich unterscheide. Dieser antwortete: „Eijentlich hat sich nüscht jeändert – außer det Gesellschaftssystem”.
.

.
Fegen (2)
In einem Moabiter Ballsaal traf ich einmal eine quasi allein tanzende Chinesin – mit Blumen im Haar. Sie verdiente ihr Geld als Putzfrau in einem Bioladen. „Manchmal findet man beim Fegen Münzen“. In der Kulturrevolution war sie für drei Jahre aufs Land geschickt worden, wo sie in einer Gemüsebrigade arbeitete. Während der ganzen Zeit hatte sie auf eine Rehabilitation durch ihre Grundeinheit gewartet, die ihr die Rückkehr an die Universität ermöglicht hätte. Die sie jedoch ablehnen wollte, um sich weiter durch die Landarbeit zu „reformieren”. Ich sah ein Photo aus jener Zeit, auf dem sie wie eine stolze Rotgardistin aussieht, die ihren Blick über Rübenfelder bis an den Horizont schweifen läßt. Ihre Rehabilitation kam jedoch nicht – und das stürzte sie fast in Verzweiflung: Sie wollte endlich einmal „Nein!” sagen – aber man gab ihr keine Chance. Als sie dann doch die Produktionskommune verließ, die wenig später schon wie alle anderen aufgelöst wurde, war es mehr ein leises Verschwinden – zurück in die Stadt, nach Shanghai. Und ähnlich ging es dann auch weiter, bis nach Berlin: über einen Schwager, der inzwischen in Amsterdam lebte.
Ich fragte sie, wo sie so gut Tanzen gelernt hätte. Ich meinte sogar gesehen zu haben, dass sie die Männer vor allem nach ihrem Tanzvermögen taxiert hatte. „Während der Kulturrevolution und auch schon davor wurde in China immer viel getanzt und gesungen”, antwortete sie, und heutzutage laufe dort nichts ohne Karaoke. Da ich nicht besonders gut tanzen und schon gar nicht singen kann, nahm ich an, dass es meine China-Begeisterung gewesen war, die sie dazu bewegt hatte, sich mit mir an der Theke noch weiter zu unterhalten. Später verabredeten wir uns für den nächsten Tag in einem China-Restaurant am See. Dort winkte sie allen vorbeifahrenden Touristen auf den Ausflugsschiffen zu – während sie gleichzeitig weiter aß, mit Stäbchen. Ich fragte sie nach dem Essen, warum es im Chinesischen so viele Nautikmetaphern gäbe: vom Großen Steuermann angefangen – über den Schiffbruch im Sozialen bis zum individuellen Glück, das mit geblähten Segeln umschrieben wird und der neuen Politik der Geschäftemacherei, die „Ins Meer tauchen” heißt. Sogar in der Literatur über die Verbannung der Intellektuellen aufs Land und zum Fegen heißt es – z.B. von einem solchen, den Gu Hua schilderte, er habe morgens auf der Straße „seinen Besen geschwungen, als rudere er auf einer Bühne im Boot”…
Das sei ihr noch gar nicht aufgefallen, wahrscheinlich weil in Shanghai als Hafenstadt immer schon alles Intime zugleich auch maritim gewesen sei, überdies wäre ihr Vater bei der Marine gewesen. Und selbst während ihrer Landverschickung, fügte sie hinzu, habe sie ständig mit Wasser zu tun gehabt: Entweder bekamen die Gemüsepflanzen nicht genug, dann mußten sie Brunnen graben oder zu viel, dann mußten Entwässerungsgräben angelegt werden. Ich erzählte ihr daraufhin, dass in der Endphase der Kulturrevolution ein Neuköllner Maoist namens Thomas Kapielski einmal eine Landverschickung von Künstlern aus Westberlin organisiert hatte – in die Lüneburger Heide. Viele würden noch heute von diesem Arbeits-Wochenende auf dem Dorf reden, ebenso einige Bauern dort. Ich selbst hätte einmal einen freiwilligen Arbeitseinsatz von 60 Linken bei einer Landkommune in der Wesermarsch organisiert.
Ob ich etwa der Meinung wäre, dass die Worte des Großen Vorsitzenden bis hierher wirksam geworden seien, fragte sie mich daraufhin ironisch. „Ja, aber noch wirksamer waren wohl die dadurch in Bewegung geratenen chinesischen Massen, zu denen u.a. Du gehörtest”. Im übrigen habe es auch in Berlin nicht an Mao-Bibeln gemangelt. 1969 hätte z.B. allein die so genannte Kommune I tausende von Exemplare aus der Ostberliner chinesischen Botschaft nach Westen geschmuggelt, wo sie dann während einer Vietnam-Demonstration an der Gedächtniskirche umsonst verteilt wurden.
Und in Ostberlin ließ eine ebenfalls maoistisch inspirierte Kommune ihren individuellen Solibeitrag für Vietnam nicht mehr vom Stipendienkonto abbuchen, sondern ging als Kollektiv in die Fabrik, zu Narva, um anschließend vom Gehalt ein Fahrrad zu kaufen, das sie der Vietkong-Botschaft übergaben. Auch wäre dort genauso antirevisionistisch die Überwindung bürgerlicher Verhaltensweisen sowie die Aufhebung der Trennung von Hand- und Kopfarbeit diskutiert worden. Es gab sogar einen Abwaschplan. Das sei ja gerade das Merkwürdige, fügte ich hinzu, dass wir vielleicht seit der Kulturrevolution von Peking ferngesteuert werden – bis hin zu Deng und seiner Modernisierungs-Parole „Bereichert Euch!”
„Mit dem kleinen Unterschied, dass uns die Mao-tse-tung-Ideen eingehämmert wurden, während ihr sie heimlich unter der Bettdecke studiert habt”, sagte sie. „Würdest du noch einmal eine Wandzeitung aufhängen?” fragte ich sie – schon fast verschwörerisch. „Nein,” antwortete sie, „ich bin doch eine moderne Frau, heute würde ich meine Angriffe ins Netz stellen. Und das mache ich auch”. Ich war enttäuscht: Wie konnte man sich nur so leicht von den großen Schriftzeichen verabschieden, von Pinsel und Tusche? „Und mit Besen arbeite ich auch nicht mehr, ich hab nur noch einen Staubsauger und einen Handfeger,“ fügte sie hinzu.
.
.
Fegen (3)
Mein Professor, der marxistische Erkenntnistheoretiker Alfred Sohn-Rethel, besuchte während der Kulturrevolution u.a. den Güterbahnhof von Nanking. Wieder zurück in Bremen meinte er, der Zentralcomputer würde dort nicht mehr gegen die Eisenbahner eingesetzt werden, sondern sie würden ihn in ihrem Sinne nutzen. Dies galt ihm als ein Beweis dafür, dass die chinesischen Genossen auch im industriellen Bereich versuchten, die Trennung von Hand- und Kopfarbeit aufzuheben, nicht nur, indem sie die gebildete Jugend aufs Land schickten – gemäß den berühmten „3 Mits: Mit den Bauern leben, arbeiten und lernen!“ Um die sogenannten „3 Trennungen“ – von der Praxis, vom Volk und von der körperlichen Arbeit – zu überwinden.
Kürzlich hat der junge Schriftsteller Yu Hua im Zusammenhang seines Bestsellers „Brüder” die These aufgestellt, dass die von Deng Xiaoping 1978 eingeleiteten “4 Modernisierungen”, mit denen der kollektive Altruismus zugunsten einer egoistischen Profitsucht abgelöst wurde, ohne die antiautoritäre Kulturrevolution unmöglich gewesen wäre. Erst diese trieb den Chinesen das 2500 Jahre lang eingedrillte hierarchische Denken von Konfuzius aus. In Berlin eröffneten die Chinesen allerdings vor einiger Zeit zusammen mit der einstigen Maoismus-Hochburg FU ihr erstes Kulturzentrum ausgerechnet unter dem Namen „Konfuzius-Institut”.
Es geht in China immer noch um ein Schwanken zwischen Altruismus und Egoismus. Ersterer kulminierte während der Kulturrevolution propagandistisch im vorbildlichen Menschen Lei Feng, der sich als “kleine Schraube der Revolution” begriff – und danach auch handelte, u.a. mit einem Besen. Von seinen altruistischen Taten kündete u.a. ein in Westdeutschland zu maoistischen Zeiten, 1973, veröffentlichter chinesischer Comicroman. Zur gleichen Zeit hatte Joschka Fischer für den Voltaire-Verlag einen theoretischen Text über die “Aufhebung der Trennung von Hand- und Kopfarbeit” in der Großen chinesischen Kulturrevolution übersetzt – es handelte sich dabei um einige Kapitel einer Doktorarbeit aus Harvard.
Den jungen Soldaten Lei Feng und sein kurzes Leben nahm sich 2000 Jürgen Kuttner für seine erste Volksbühnen-Inszenierung vor – nicht zuletzt, weil „uns Ostler doch immer noch der ganze SED-Staat um die Ohren gehauen wird, aber den ehemaligen Maoisten im Westen man die chinesischen Verbrechen nie vorwirft.” Kuttner dachte dabei an die Gräuel der Kulturrevolution – und deswegen nun Lei Feng: als ein Comicmärchen-Stück. Inzwischen ist dieser Volksbefreiungsarmist in China sogar zu einem „Popstar” geworden, wie die FAZ schreibt.
Statt US-gentechnisch argumentiert man dort gegen den um sich greifenden Egoismus – eben chinesisch: so brachte z.B. die Firma Shanda ein Computerspiel mit dem Titel „Von Lei Feng lernen” heraus, bei dem derjenige gewinnt, der am meisten anderen Menschen geholfen hat, also der Altruistischste. Und um noch deutlicher zu werden, hat man im renovierten Revolutionsmuseum am Tienamenplatz ein Wachsfigurenkabinett eingerichtet – mit „offiziell anerkannten nationalen Helden” (aus Vergangenheit und Gegenwart). Am Ende der illustren Parade, „wo der Besucher in die Zukunft entlassen wird”, stehen sich auf der einen Seite Lei Feng und auf der anderen Seite der Microsoftgründer Bill Gates gegenüber: Das Politische und das Private – der Revolutionär und der Idiot: Idiot in der alten griechischen Bedeutung von Privatmann – jemand, der sich nicht um die Polis, sondern bloß um seine Privatgeschäfte, den oikos, bekümmert.
Der US-Präsident Coolidge sagte es einmal – positiv – so: „Americas Business is the Business!” In diesem Sinne dürfte Bill Gates der allergrößte Idiot sein – wohingegen die kleine Schraube der Revolution Lei Feng bis zur Selbstopferung das genau entgegengesetzte Prinzip verkörperte. Die chinesische KP selbst versucht, sich dazwischen auszubalancieren. Während gleichzeitig immer mehr KP-Politiker die polis zu ihrem oikos machen und die Kopfarbeiter wieder auf die Handarbeiter herabsehen.
Erinnert sei nur an die Literaturdozentin Yue Daiyun, die während der Kulturrevolution zur Arbeit auf dem Land verurteilt wurde – zusammen mit den Intellektuellen der Pekinger Universität. Sie sollten am Poyang-Sees „ein Projekt zur Umwandlung der Sommerschlammflächen des Sees in festes Land beginnen“. In ihren Erinnerungen schreibt sie: „Manche Intellektuelle fühlten sich wirklich allen anderen in der Gesellschaft überlegen; und einige, besonders die Männer unter den Akademikern waren wirklich vollkommen hilflos – sie konnten nicht einmal Teewasser heiß machen, so sehr waren sie es gewöhnt, von anderen versorgt zu werden“.
.

.

.

.
Folgenreiche Anfänge
„Das Prinzip des Privateigentums, des Warentauschs, ist die Negation von Gesellschaft.“ (Alfred Sohn-Rethel) Der von Herodot so genannte „Demokratie-Begründer“ Kleisthenes mußte – im 6.Jhd. v.Chr. in Athen – von den unteren Klassen gezwungen werden, zuzulassen, dass auch vermögenslose Bürger in Staatsämter gewählt werden durften. Für den Altphilologen George Thomson zeigte dies bereits „den Mittelstandscharakter der Revolution“, zudem war die neue Verfassung dem früheren „Stammesmodell“ nachgebildet – und verbarg so die Tatsache, dass mit ihr die „letzten Überreste der urtümlichen gesellschaftlichen Verhältnisse hinweggefegt worden waren,“ d.h. die Warenbesitzer traten sich nunmehr in der „‚Freiheit‘ des offenen Marktes als Gleiche gegenüber.“
Diese allgemeine „Gleichheit vor dem Gesetz“ (isonomia) bezeichnete bereits Diodoros aus Agyrion im 1. Jhd.v.Chr. als Mogelpackung, da sie ohne „Gleichheit des Eigentums“ (isomoiria) durchgesetzt wurde. Infolgedessen hatte sich laut Thomson „der Klassenkampf, weit davon entfernt, beendet zu sein, noch verschärft.“ Es standen sich nun nicht mehr Adlige und Bürger, Mitglieder einer menschlichen Gesellschaft, gegenüber, sondern Sklavenhalter und Sklaven, wobei letztere „aus der Gesellschaft Ausgestoßene“ und zugleich „Schöpfer ihres Wohlstands“ waren. Dadurch entstand eine Spaltung zwischen Konsumtion und Produktion, zwischen Theorie und Praxis. Die „Ersten Philosophen“, von denen nicht wenige Kaufleute waren, mithin Sklavenhändler, verdanken dieser Trennung von Hand- und Kopfarbeit ihre Existenz.
Das beginnt mit Parmenides: „Er ist der Mann, der unveränderliche und rein begrifflich formulierte Gesetze anstelle anschaulicher Ereignisfolgen setzt und der so Wirklichkeit und Welterfahrung, Denken und Anschauung, Wissen und Handeln entschieden voneinander trennt,“ wie Paul Feyerabend in seiner „Naturphilosophie“ (2018) schreibt. Parmenides begründete damit unsere westliche Wissenschaft – mit ihm beginnt die Philosophie, wie Hegel meint.
Als nächster politischer Reformer trat im 6.Jhd.v.Chr. der Kaufmann Solon auf den Plan. Seine Leistung bestand laut Thomson darin, „die Gesellschaft von der Natur geschieden und als ein sittliches Ordnungsgefüge erklärt zu haben“. Die „isonomia“ ohne „isomoiria“ tastete er nicht an, wiewohl er erkannte, dass der Reichtum „kein Maß“ hat und die „Geldgier der Bürger die Stadt zerstören“ könnte. Gleichzeitig sprach er jedoch davon, dass einer, der sich alles leisten kann, nicht reicher ist als ein anderer, der nur genug zu essen hat. Deswegen wollte er Reichtum und Gerechtigkeit nicht gegeneinander ausspielen, „da diese niemals zu erschüttern ist, während das Geld beständig von einem Menschen zum anderen hinüber wechselt.“
Mir drängte sich dieser ganze Demokratie-Widersinn erstmalig als einkommensloser 18jähriger auf, als ich wegen abgefahrener Reifen an meinem alten VW 160 DM Strafe zahlen mußte, die ich nicht hatte. Während z.B. mein beim Staat angestellter Vater eine solche Summe aus seiner Brieftasche hätte bezahlen können – abgesehen davon, das die Reifen an seinem Auto nie abgefahren waren, weil er immer genug Geld hatte, um sie rechtzeitig zu wechseln. Anders gesagt: Die gerechte – für alle gleiche Strafgebühr – war (und ist) eine schreiende Ungerechtigkeit. In Finnland hat man jetzt durchgesetzt, dass die Höhe der Strafmandate sich nach dem Einkommen der damit Belangten richtet:
.

.
In Deutschland helfen einstweilen nur Klebeaktionen:

.
Keine Wahl
2001 schlenderte ich die Einkaufsstraße der mongolischen Hauptstadt entlang. Als ich an einem Terrassencafé vorbeikam, sah ich in nächster Nähe von mir ein Pärchen vor zwei Cocktails sitzen: eine junge Mongolin und ein etwa 22jähriger amerikanischer Volontär des Konzerns „Ivanhoe Mines“, wie ich etwas später erfuhr. Ivanhoe ist der Titel eines Kreuzritter-Romans von Sir Walter Scott. Der Bergbaukonzern gleichen Namens hat eine Goldmine in der Mongolei ausgebeutet. Weil er glaubhaft machte, dass er dazu 15 Jahre benötigte, gewährte die Regierung ihm 5 Jahre Steuerfreiheit. Er benötigte jedoch nur viereinhalb Jahre, um alles Gold aus der Mine zu lösen – und weg war er. Dieser „Betrug“ erboste die Mongolen derart, dass es zu gewalttätigen Auschreitungen in der Hauptstadt kam. Inzwischen gehört der Konzern dem noch größeren Bergbaukonzern „Rio Tinto“, der in der Wüste Gobi eine riesige Gold- und Kupfermine ausbeutet.
Zurück zum mongolisch-amerikanischen Pärchen auf der Caféterrasse: Während die junge Mongolin auf der Caféterrasse etwas gelangweilt die Passanten betrachtete, hatte er sich in ein Buch vertieft. Ich spinne nicht: Es war „The White Man’s Burden“ („Die Bürde des Weißen Mannes“ 1899) – ein Poem von Rudyard Kipling, in dem er die Amerikaner zur Kolonisierung Kubas und der Philipinen aufrief, was er als einen humanitären Akt darstellte. Ausgerechnet diesen „Klassiker“ las nun dieser Amischnulli in der Mongolei, während gleichzeitig einen Steinwurf davon entfernt drogenkranke Straßenkinder in der Kanalisation hausten, Frauen an der Landstraße ihre Muttermilch verkauften und die US-Botschafterin in Ulaanbaatar der mongolischen Regierung sagte, was diese als nächstes tun muß.
Sprung – April 2014: Um Russland wie weiland 1918 von White Man’s Nations zu umzingeln, besuchte der US-Verteidigungsminister die Mongolei und bat die Regierung, eine Militärbasis im Land errichten zu dürfen. Der mongolische Verteidigungsminister bedauerte, dass er das nicht genehmigen könne, die Verfassung gäbe das noch nicht her. Aber westliche Experten sind sich sicher: „Wir werden die Mongolei bald nicht mehr wiedererkennen.“ Ja, denn schon werden aus reichen Nomaden seßhafte „Farmer“, die für das Hüten ihres Viehs arme viehlose Nomaden beschäftigen. Für sie ist nun der weiße Mann mit seiner Privateigentumsidee die Bürde.
Die US-Botschafterin in der Mongolei gibt in der dortigen Zeitung laufend politische Ratschläge. In einem Interview meinte sie: „Uns ist es egal, welche Partei an die Macht kommt. Sie haben sowieso keine Wahl.“
.

.

.

.
Beschichtungsstoffe
Bei Oranienburg fand ich im Sperrmüll einen großen Tisch mit einer Arbeitsfläche aus grünem Linoleum. Das kannte ich bisher nur als Bodenbelag. Es besteht aus Leinöl, Korkmehl, Naturharzen und Jutegewebe und ist kompliziert herzustellen.
Die erste Linoleumfabrik in Deutschland wurde laut Wikipedia 1882 als „German Linoleum Manufacturing Comp.“ in Delmenhorst gegründet. Die zweite Delmenhorster Linoleumfabrik „Anker-Marke“ wurde zehn Jahre später 1892 gegründet, und die Linoleumfabrik „Adler-Marke“ 1893 in Maximiliansau.
Beim PVC (Polyvinylchlorid) gibt es hartes und weiches – beides ist ein thermoplastisches Polymer. Ab 1935 produzierte die I.G. Farben PVC. Man kennt den Werbespruch der in Sachsen-Anhalt einst ansässigen VEB Chemische Werke Buna: „Plaste und Elaste aus Schkopau“. Das Buna-Werk in Schkopau erwarb nach der sog. Wende der PVC-Hersteller Westlake Vinnolit bei München. 2020 hieß es in einer Firmenmitteilung: „Vinnolit GmbH & Co. KG hat heute am Standort Schkopau Konsultationen mit dem Betriebsrat über die Schließung der dortigen Pasten-PVC-Anlage eingeleitet. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren die mangelnde Wirtschaftlichkeit und die fehlende langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Standorts. Die Kunden werden weiterhin von den größeren, rückwärtsintegrierten Vinnolit-Standorten Burghausen, Gendorf und Köln beliefert.“
Das Linoleum wurde aber nicht nur durch PVC ersetzt, sondern auch durch die billigeren Bodenbeläge Stragula und Balatum. Infolge der BRD-Krise in den Sechzigerjahren kam es zu einem drastischen Produktionsrückgang. „Hatten 1960 Linoleum und ähnliche Bodenbeläge wie Stragula und Balatum noch einen Marktanteil von über 50 %, so fiel er bis 1969 auf rund 10 %. Als Folge mussten alle deutschen Werke bis auf das Werk in Delmenhorst schließen oder die Produktion von Linoleum einstellen. Im Zuge des wachsenden Umweltbewußtseins stieg jedoch ab den Achtzigerjahren die Nachfrage nach Bodenbelägen aus natürlichen Rohstoffen und damit auch die nach Linoleum, wobei einer der heute größten Hersteller die DLW AG (Deutsche Linoleum Werke) ist, die seit 1938 in Bietigheim ihren Sitz hat.
Daneben gab es schon seit den Dreißigerjahren den „dekorativen Schichtstoff“ Resopal, der als „High Pressure Laminate“ hergestellt wird. In der BRD wurde er vor allem durch den Einsatz in Küchen, bei Frühstücksbrettchen und Nierentischen aus den 50er-Jahren bekannt. Das Patent dafür wurde 1930 von der Hermann Römmler AG in Spremberg angemeldet. Abnehmer für die Schichtstoffplatte sind laut Wikipedia „u. a. Küchenhersteller. Resopal wird aber auch im Innenausbau, in Nasszellen, in Verkehrsmitteln (Züge, Kreuzfahrtschiffe), im Krankenhaus, im Ladenbau, in Schulen, Sportstätten und im Laborbereich eingesetzt. Es wird in Möbeln und Türen verbaut sowie zur Herstellung von Fußböden genutzt.“
1938 übernahm der Schweizer Konzern „Brown, Boveri & Cie (BBC) die Spremberger Firma, deren Anlagen die sowjetische Besatzungsmacht 1946 demontierte. Wenig später nahm die BBC die Produktion in ihrem Großumstädter Werk (in Hessen) wieder auf.
Gorki hatte einmal vorgeschlagen Biographien von Fabriken zu schreiben. Heute kann man nur noch Biographien von Werkstoffen bzw. Produkten schreiben, denn die Fabriken wechseln immer schneller Besitzer und Namen: 1987 übernahm die schweizerische Forbo AG die Mehrheit an der BBC-Tochter. 1997 wurde Resopal von der Premark FEG GmbH & Co. KG gekauft. Seit 1998 gehört das Unternehmen zum weltweit operierenden Laminathersteller Wilsonart, Temple/Texas, der Teil des ITW-Konzerns (Illinois Tool Works) ist. 2012 wurde Resopal Teil der Wilsonart International LLC, die zu 51 Prozent dem Fondsverwalter Clayton, Dubilier & Rice und noch zu 49 Prozent dem ITW gehört.
Trotz Demontage des Spremberger Werks nahmen einige Meister dort mit vom russischen Kommandanten überlassenen kaputten Maschinen die Produktion vor Ort wieder auf. Ihr Resopal nannten sie nun Sprelacart. „Die Großumstädter glaubten nach der Wende die Firma Sprela für kleines Geld kaufen zu können,“ schreibt Wikipedia. „Dem verweigerte sich die Treuhand jedoch. Die Gläubiger bestellten einen Insolvenzverwalter, der in den Papieren von Sprela ein so großes Potential erkannte, dass er selbst als Unternehmensberater das Werk kaufte. Als die Amerikaner in Großumstadt bei Resopal einstiegen und Personal abbauten, kehrten Ingenieure, die vorher bei Römmler in Spremberg waren, zurück. Mit doppeltem KnowHow und einer diplomatischen Firmenleitung überholte der Umsatz von Sprelacart und Laminat bis heute die Großumstädter Resopal-Platten.“ SPRELA ist damit eines der wenigen DDR-Betriebe, die überlebt haben.
.

.

.
Plüsch
Der Plüsch ist ein Gewebe oder Gewirke mit sehr weicher Haptik. Aber warum wird alles immer plüschiger, puscheliger, kuscheliger? Die Frauenzeitschrift „Elle“ und die Männerzeitschrift „Mens Health“ verrieten: „Die besten Stellungen für Kuschelsex“ – „für noch mehr Spaß“. Dabei geht es beim Kuschelsex gerade nicht um „Stellungen“, deswegen ist das Genre „Kuschelporno“ („Cuddle Porn“) ein Etikettenschwindel, denn es sind normale Pornos, vielleicht grad mal eine Nuance kuscheliger und werden „Cuddle Fucking“ genannt.
In der U-Bahn sprach jemand ein Mädchen mit „Hallo Puschel!“ an. Ein Puschel ist laut Duden eine weiche Quaste oft aus Plüsch. Auf „Amazon“ findet man „eine große Auswahl an Puschel für verschiedene Zwecke und Anlässe“. Ein „Plüsch-Kaufhaus“ bietet „über 3000 hochwertige Kuscheltiere“ an.
Die juvenilen Rucksackträger lassen bunte Puschel oder Kuscheltiere an ihren „City-Bags“ raushängen, sog. „Puschelanhänger“, und schlafen neben „Kuscheltieren“. Diese sind häufig aus Plüsch und werden daher auch als Plüschtiere bezeichnet. In Frank Schulz Roman „Amor gegen Goliath“ (2024) war das einschneidendste Erlebnis des späteren „Womanizers“ Philipp Büttner die Trennung von seinem Teddybär. Meine alte Tante hat immer noch ihren Plüschteddy von „Steiff mit Knopf im Ohr“. Ihm fehlt inzwischen die halbe Schnauze und vom vielen Waschen ist ihm das Fell mürbe geworden, gar nicht mehr kuschelig. Im Roman „Matisse“ (2015) des Geopoeten Alexander Ilitschewski fand der „Straßenmensch“ Wadja einmal im Moskauer Müll einen solchen „Plüschbär mit abgerissener Nase, der ein hicksendes Gejaul von sich gab“.
Für Puschel, auch Püschel, Bommel oder Pompon genannt, findet man im Internet Bastelanleitungen. In einer Anime-Serie heißt das Eichhörnchen Puschel und bei „ticketonline“ kann man sich Eintrittskarten sichern, um „Puschelgeschichten live auf der Bühne zu erleben“. Hausschuhe, Türstopper, Deko-Engel, Anorakkrägen, Autositze – alles muß puschelig sein. Auf „puschel-wiki“ werden 26 Puschelarten aufgelistet: von „Berufspuschel“ über „Gruselpuschel“ und „Tierpuschel“ bis zu „Zwergpuschel“. Ehrlich gesagt verstehe ich diese Puschelarten alle nicht. Vielleicht haben sie etwas mit der „Puschelfarm“, einem Browsergame, zu tun und werden dort sogar „produziert“.?
Ich favorisiere jedoch eine andere Herkunft dieses ganzen Kuschelkitsches, eine global-ökonomische Erklärung. Meine Freundin wollte jedoch nicht auf meine Vermutung eingehen, dass ein rotchinesischer Textilkonzern den europäischen Markt mit Billigplüsch überschwemmt, ganze Schiffladungen, die in Hamburg angelandet und dann hier zu Plüschdecken und diversen Puscheln verarbeitet werden.
Sie, die erst beim Aufwachen Alpträume hat, vertrat stattdessen eine andere Plüschtheorie: Danach hat die Erosion des Sozialen, das Fading-Away aller Top-Down-Entscheidungen, die Klimaerwärmung, das Artensterben, das ganze Plastik im Meer, die wachsende Atomkriegsgefahr, der nahezu globale Rechtsruck, die gestiegenen Benzin- und Flugpreise, die Miet- und Strompreissteigerungen sowie die haarsträubend-deduktiven Narrative der bürgerlichen Politik und Presse etc. im Verein mit der Natürlichen Intelligenz (NI) und der Künstlichen Intelligenz (KI), dazu geführt, dass immer mehr Menschen sich angesichts der wachsenden Zahl komplexer „Konflikte“ nur noch „Einkuscheln“ und mit immer mehr Plüschobjekten umgeben wollen. Das „Cuddeln“ wäre damit Weltflucht und nicht wie das „Grooming“ bei den Affen eine Verstärkung der sozialen Beziehungen. Es gibt stattdessen immer mehr „Kuscheltherapien“, eine heißt „Kuschelhimmel“.
Obwohl: Eine Kollegin verriet mir neulich, dass ihr 17jähriger Sohn von seiner Freundin verlassen worden war und tagelang depressiv im Bett lag mit seiner Plüscheule im Arm, zu der er Sätze sagte wie „Du bleibst mir doch treu, oder?“ „Du verläßt mich nie!“ Wenn die Angst vor Konflikten, die Hilflosigkeit und scheinbare Ausweglosigkeit so weit gedeiht, dass die Handlungsmacht auf die Dinge übergeht, auf Plüschtiere z.B., dann stellen diese vielleicht auch so etwas wie eine soziale Bindung zu ihrer „Bezugsperson“ her.
.

.

.

.

.
Poller
Es droht eine neue Pollerwelle. Bisher gab es vier in Berlin, das heißt: nur in Westberlin, dem Osten war das dafür verwendete Metall zu wertvoll, um es für industriell hergestellte Poller zu verschwenden. Es gab dort nur individuelle von Hausmeistern gebastelte.
Die erste Westberliner Pollerwelle in den achtziger Jahren war dem zunehmenden Parkdruck geschuldet. Weil die lebenden Polizisten im Westen, im Gegensatz zu den Vopos im Osten, nicht ständig Falschparker aufschreiben wollten, entschied man sich für stumme Polizisten: eben für Poller. In Kreuzberg durchgehend für in Ungarn hergestellte „Wellmann-Poller“, von den Lokalpolitikern „Kreuzberger Penisse“ genannt, die wegen des Randale-Tourismus ankerverstärkt geliefert wurden.
Die zweite Welle kam mit den „modernen“ elektronisch versenkbaren Pollern, mit denen man ganze Innenstadtbezirke absperren kann. Lieferanten bekommen eine Art Fernbedienung. Weil jedoch immer mal wieder ein Pkw noch schnell durchfahren wollte und dann von einem hochfahrenden aufgespießt wurde, installierte man noch kleine Ampeln daneben, in Leipzig zum Beispiel.
Die dritte Welle kam nach Terrorangriffen mit Lkws gegen Massenveranstaltungen auf Plätzen und bestand neben besonders stabilen versenkbaren Pollern aus temporären Betonquadern.
Die vierte Welle sollte die sich derzeit üppig vermehrenden RadfahrerInnen schützen, weswegen man diese „Protektionselemente“ nennt.
Deren Formenvielfalt will der Senat nun zugunsten eines einheitlichen Berlin-Pollers ausmerzen, wozu er die Verpollerung aus der Bezirksverantwortung nehmen möchte.
Das Vorbild ist hierbei Amsterdam, wo man mit diesen „Amsterdammertjes“ auch die Stadt bewirbt und sie zum Beispiel als Souvenirs (etwa in Form von Schlüsselanhängern) kaufen kann. Dort gibt es jedoch auch ein „Entpollerungsprogramm“ – von einem Berliner Architekten, der den Ku’dammpoller entwarf.
.

Foto: Stefanie Peter
.

.

.
James C. Scott
In den Siebzigerjahren zogen in Westdeutschland etliche Linke aufs Land, so auch ich – in eine Landkommune. Und weil dort in landwirtschaftlicher Hinsicht alles anders gemacht werden sollte, kam bei mir der Wunsch auf, erst einmal die normale (moderne) Landwirtschaft kennen zu lernen. Dazu arbeitete ich – von Nord nach Süd – bei diversen Mittelbauern als Betriebshelfer.
Sie hatten im Durchschnitt alle etwa 100 Hektar und Milchvieh. Danach wollte ich auch noch die sozialistische Landwirtschaft kennen lernen und bewarb mich – vergeblich – in drei Botschaften von sozialistischen Ländern. Aber einige Jahre später „fiel die Mauer“ und meine Freundin und ich wir stellten uns im November 1989 bei einer LPG Tierproduktion in Saarmund vor. Am 1. Dezember fingen wir als Rinderpfleger im Nachbardorf an, wo die Brigade für Kälber, Färsen, Jungbullen und etwa 60 Schweinen zuständig war. Jeden Morgen um 5 fuhren wir mit unserem alten Audi aus Kreuzberg los und zogen in der LPG Blaumann und Stiefel an, die man uns zugeteilt hatte. Die Brigade bestand aus 10 Leuten und wir arbeiteten uns nicht tot, so oft es ging saßen wir im Sozialraum, tranken Kaffee und diskutierten die Zeitläufte.
Das hielten wir bis zu den Märzwahlen 1990 durch, aber theoretisch beschäftige ich mich auch weiterhin mit Landwirtschaft. In diesem Zusammenhang stieß ich auf den Anthropologen James C. Scott. Er war Leiter des Programms für Agrarstudien an der Yale-Universität und betrieb nebenbei eine kleine Landwirtschaft in Connecticut. Und sein Buch, das mich begeisterte, hieß – übersetzt: „Die Kunst, nicht regiert zu werden“ und war eine „Anarchistische Geschichte der kleinen Völker im Hochland von Südostasien“. Scott hatte in den Sechzigerjahren ein Jahr an der Universität von Rangoon in Burma gelehrt und u.a. ein Buch über den Fluß Irrawaddy veröffentlicht. Daneben mehrere Bücher über die bäuerliche Wirtschaftsmoral, die Waffen der Schwachen und den Widerstand gegen das Beherrscht-Werden. Ins Deutsche übersetzt sind bis jetzt nur seine Bücher „Die Mühlen der Zivilisation – eine Tiefengeschichte der frühesten Staaten“ und „Applaus dem Anarchismus“.
Gleich im ersten Applaus-Kapitel berichtet Scott, dass er im Spätsommer 1990 sechs Wochen in einer LPG bei Neubrandenburg arbeitete. Er hatte ein Stipendium im Westberliner Wissenschaftskolleg und um vorab sein Deutsch zu verbessern, kam er auf die Idee, auf einem Bauernhof zu arbeiten. Ein Freund von ihm hatte einen Schwager, der Leiter einer LPG in Pletz war und ihm dort Arbeit sowie Kost und Logis verschaffte. Die LPG-Mitarbeiter begegneten ihm jedoch mit so großem Mißtrauen, dass die Arbeit für ihn ein „Alptraum“ wurde. Man vermutete, er sollte bei ihnen im Dienst holländischer Investoren oder des neuen Staates (der Treuhand?) spionieren.
Die LPG war auf den Anbau von „Stärkekartoffeln“ spezialisiert, die als „Stärkebasis für osteuropäische Kosmetika“ dienten. Für diese war jedoch der Markt zusammengebrochen und so verrotteten die Kartoffeln neben den Bahngleisen. Die LPG-Mitarbeiter fragten sich darob, ob nicht alle „das blanke Elend erwartete“ und welche Rolle Scott dabei womöglich spielte. Außerdem, ob seine „schwächlichen Deutschkenntnisse“ nicht die Arbeitsabläufe gefährden könnten: „Würde ich die Schweine zum falschen Tor hinauslassen, so dass sie auf das Feld eines Nachbarn gerieten? Würde ich den Gänsen das Futter geben, das für die Bullen gedacht war? Würde ich immer daran denken, das Tor zu schließen, wenn ich in der Scheune arbeitete…Ich hatte ihnen, das ist wahr, in der ersten Woche mehr als genügend Grund zur Beunruhigung gegeben.“
Das war bei meiner Freundin und mir in der LPG nicht der Fall – im Gegenteil. In „unserer“ Brigade herrschte ein arbeiterliches, kein bäuerliches Bewußtsein und damit kamen gelegentlich wir ins Grübeln: Wenn ich z.B. die Stallgasse bei den Färsen allzu sauber fegte, sagte mein Kollege Bernd: „Mach es nicht zu ordentlich, sonst stecken die da oben sich das an den Hut.“ Oder wenn ich am Tor, an dem der Traktorfahrer ein Stück Putz weggerissen hatte, meinem Kollegen Michael vorschlug, dass wir das doch nebenbei wieder verputzen könnten, sagte der: „Das muß die Maurerbrigade machen.“ Ich entgegnete, dass er als Maurer doch wüßte, das diese Brigade aufgelöst sei. Woraufhin er nur sagte: „Da müssen die da oben sich einen Kopp drüber machen.“
Umgekehrt wollte es mir nicht in den Kopp, dass der Traktorfahrer Jens uns nasses vergammeltes Stroh zum Einstreuen brachte. Damit würden die Tiere schon nach 10 Minuten wieder im Mist stehen. „Ja, aber nasses Stroh läßt sich leichter mit Traktor ausmisten,“ meinte er.
.

.

.

.

.
Lamarckismus/Lamarxismus
Dabei geht es um einen tragischen Helden: den Biologen Paul Kammerer, der den Lamarckismus gegen den Darwinismus stark machen wollte. Von 1902 bis 1926 experimentierte er in der Biologischen Versuchsanstalt „Vivarium“ im Wiener Prater mit Amphibien, um den Nachweis zu führen, dass sich Erfahrungen vererben können. Er scheiterte: Ein Prüfer des Zentralorgans der Darwinisten „Nature“ wies nach, dass sein Präparat einer Geburtshelferkröte, die den Einfluß einer veränderten Umweltbedingung auf den Organismus beweisen sollte, verfälscht worden war.
Unbeeindruckt von diesem Wissenschaftsskandal bot die Sowjetunion, gedrängt u.a. von den lamarckistischen Biologen um Boris Kusin und den Dichter Ossip Mandelstam, Kammerer ein eigenes Institut in Moskau an. Der international gefeierte, durch den Fälschungsvorwurf jedoch entehrte Amphibienforscher zog es jedoch vor, sich im Wiener Wald zu erschießen.
Der sowjetische Volkskommissar für das Bildungswesen, Anatoli Lunatscharski, und seine Frau drehten daraufhin 1928 mit Geldern aus der deutschen Arbeiterbewegung einen Spielfilm über Kammerer: „Salamandra“ – in dem der linke Lamarckist von rechten Darwinisten und Jesuiten in den Selbstmord getrieben, jedoch im letzten Moment von Lunatscharski persönlich gerettet und in die Sowjetunion gebracht wird, wo er frei forschen kann und dafür vom Staat alle Unterstützung bekommt. Der Film wurde in Deutschland verboten.
2017 veröffentlichte der Wiener Soziologe Klaus Taschwer eine Geschichte der Biologischen Versuchsanstalt „Vivarium“, die – von jüdischen Wissenschaftlern initiiert und finanziert – mit dem Einzug der Nazis in Österreich für immer abgewickelt worden war: „Experimentalbiologie im Wiener Prater“. Der Gründer und Leiter, Hans Leo Przibram, starb in Theresienstadt, seine Frau beging Selbstmord.
Bereits 1971 versuchte der Schriftsteller Arthur Koestler Kammerer als Wissenschaftler mit einer Biographie „Der Krötenküsser“ zu rehabilitieren. 2010 wurde sein Buch wieder neu aufgelegt. Im Nachwort schreiben die Herausgeber: „Kammerer ist eine Art Gegenheld zur etablierten Wissenschaft.“
2019 hat der einst am Münchner Institut für Experimentelle Chirurgie forschende Arzt und Schriftsteller Michael Lichtwarck-Aschoff sich in seinem Buch „Der Sohn des Sauschneiders Oder ob der Mensch verbesserlich ist“ erneut den „Fall Kammerer“ vorgenommen. Es wird den genialen Biologen vielleicht auch nicht rehabilitieren, aber dafür ist sein „Roman“ genial. Der Autor erzählt darin die Geschichte des Wiener „Vivariums“ aus der Sicht einiger dort beschäftigter Hilfstierpfleger, die vom Land kommen, in ihrer Dorfsprache – dem „Steinbüchlton“ und zugleich im „Vivariumton“. Sie bringen ihr eigenes lamarckistisches Anliegen mit in die Versuchsanstalt: Sie wollen Kühe ohne Hörner, die diese doch domestiziert nicht mehr brauchen. Wenn die Menschen gut zu ihnen sind, u.a. mit ihnen zusagender Musik, bilden sich ihre Hörner in einer freundlichen Umwelt vielleicht zurück – und sie vererben dann sogar ihre „Hornlosigkeit“. Tatsächlich wird auf diese Weise ein Kalb ohne Hörner geboren und schon bald ist Steinbüchl das „Dorf der Hornlosen“. Dies Buch ist auch eine Parodie auf den amerikanischen Neodarwinismus, denn dieser „produziert“ seit 2018 hornlose Rinder mittels Gentechnik.
Boris Kusin lernte Mandelstam in Armenien kennen, wo der Biologe auf der Suche nach einer Art Cochenilleschildlaus war, aus der man den roten Farbstoff Karmin gewinnt, den die Sowjetunion nicht länger aus dem Westen importieren wollte. Es gab sie dort auch, aber die armenische Laus lieferte zu wenig Farbstoff. Immerhin begeisterte Kusin dort Mandelstam für die Biologie. Zurück in Moskau gründeten sie dazu einen kleinen Arbeitskreis.
Mandelstam wurde 1938 nach Wladiwostok deportiert und starb unterwegs, während man Kusin nach Kasachstan verbannte. Von dort holte ihn 1956 der Polarforscher Iwan Papanin, nachdem er als Leiter der Hauptverwaltung Nördlicher Seeweg in Rente gegangen und Reorganisator der lamarckistischen Forschungsstation „Borok“ an der künstlichen Wolgainsel „Darwin“ geworden war. Kusin wurde sein wissenschaftlicher Leiter dort. „Borok“ war ein Gutshof gewesen, den Sawwa Morosow geerbt hatte, der jedoch als Bolschwik ins Ausland flüchten mußte und erst mit der siegreichen Revolution zurückkehrte und den Gutshof zurück bekam, den er dann der Wissenschaft übereignete. Papanin machte daraus die größte limnologische Forschungsstation der Welt – sie existiert noch heute, auch einige unveröffentlichte Manuskripte von Kusin liegen dort noch „begraben“. Irgendwann wird man sie hervorholen und veröffentlichen – wenn sie nicht vorher auf dem Müll landen.
.

.

.
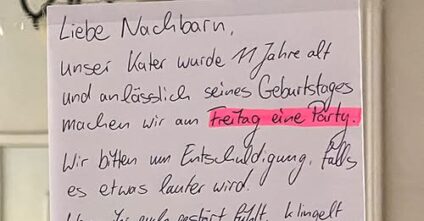
.
Anthropause
Dieser ganze, inzwischen schon fast globale Rechtsruck, der vielleicht mit der unseligen „Wiedervereinigung“ einsetzte und die linke Bewegung endgültig ins Abseits drängte, hat micht bewogen, eine Anthropause einzulegen. Selbst die zaghaften Ansätze eines ökologischen Denkens und Planens werden derzeit ad acta gelegt zugunsten eines parteienübergreifenden Ausländerabschiebewillens. Was dieses biodeutsche Wollen unter den ganzen Ausländern mit deutschem Pass anrichtet, kann man noch gar nicht abschätzen.
Die Anthropause ist für mich nichts Neues. Ich hatte sie schon einmal eingelegt – als die Bremer Schülerbewegung verebbte und verschiedene Wirtschaftsbetriebe, in denen ich gearbeitet hatte, mir nur „Bullshit Jobs“ gewährten. Weswegen ich dann als Hilfpfleger im Bremer Tierpark arbeitete, der einem indischen Großtierhändler gehörte. Dort war ich u.a. für 12 indische Flughunde verantwortlich. Sie waren mir die liebsten Tiere, die ich zu versorgen hatte, obwohl ich jeden Tag einen ganzen Eimer Obstsalat für sie zubereiten musste. Und nicht nur für sie. Aber die Flughunde erwiesen sich als äußerst dankbare Abnehmer. Obwohl Früchte- und Nektarfresser hatten sie spitze Zähne, ihr Gesicht war eher fuchs- als hundeartig, jedoch feiner und kleiner. Sie hatten ein schönes Gesicht, sie sahen überhaupt schön aus, rotbraun mit dunklen großen Flügeln, an denen sich jeweils ein hakenähnlicher Daumen befand, mit dem sie wild herumfuchtelten, um sich möglichst schnell vorwärts zu hangeln und in den Fruchtsalat zu stürzen.
Irgendwann gingen sie auf Transport – in den Tierpark eines Ostblocklandes. Ich war damals noch davon entfernt, die Flughunde in der Perspektive einer „Ökologie ohne Natur“ wahrzunehmen, wie der Philosoph Timothy Morton das nennt; er meint damit, dass eine wahre Ökologie die Trennung zwischen Kultur und Natur aufgelöst hat, und womit ich erst einmal nur meine, dass man dazu einem Tier dauerhaft sehr nahe kommen muss, was bei mir nicht der Fall war.
Die japanische Anthropologin Chihiro Hamano ist dem im Rahmen einer Feldforschung in Deutschland über Mensch-Tier-Verbindungen nachgegangen. Ihr Bericht darüber heißt „Saint Zoo“ (2023). Sie geht davon aus, „dass sich die Persönlichkeit von Tieren innerhalb der Beziehung zu ihnen entwickelt“. Am Ende schreibt sie: „Sich im Entdecken von Persönlichkeit zu üben ist eine Form von ‚Liebe‘, wie ich nun erfahren habe“. Dabei ist sie zu ähnlichen Schlüssen wie der holländische Biologe Midas Dekkers gekommen. In seinem Buch „Geliebtes Tier“ (2003) heißt es über den Unterschied zwischen Tierschutz und Naturschutz: „Die erste Voraussetzung für eine Beziehung besteht darin, dass man den anderen als Individuum betrachtet. Bei Naturschützern ist das nicht der Fall. Die lieben einen Regenpfeifer als Repräsentanten aller Regenpfeifer und sagen: ‚In dieser Gegend kommt der Regenpfeifer vor‘. Um ein Tier lieb zu haben, muss man es als Individuum ansehen. Dann erst tritt eine persönliche Beziehung an die Stelle einer versachlichten. Eine ganze Tierart kann man nicht lieb haben, das einzelne Tier aber sehr wohl.“ Im Idealfall entsteht daraus ein „Ich-Du“-Verhältnis im Sinne des Philosophen Martin Buber.
Dies könnte auch die Tierrechtlerin Hilal Sezgin unterschreiben, aber in Ethik geschult geht sie trotzdem aufs Ganze, wobei sie jedoch einräumen muss, dass sie bei ihren „Begegnungen mit Wildtieren immer wieder an die Grenzen“ nicht nur ihrer „praktischen Möglichkeiten“ stößt, „sondern eben auch an die Grenzen ethischen Nachdenkens,“ wie sie in ihrem Buch „Vom fordernden und beglückenden Leben mit Tieren“ (2023) über die Mitbewohner ihres Tierhofs in der Lüneburger Heide schreibt. Weil „ihre“ Tiere dort eines natürlichen Todes sterben können, werden sie immer älter und auch kränker, was Hilal Sezgin bisher ein Vermögen an Medikamenten und Operationen gekostet, aber auch ihre Gedanken über Tiere und das Zusammenleben mit ihnen enorm geschärft hat.
In meiner Familie war das ähnlich bei einem Hund, einer Katze und einem Sperling der Fall, im Bremer Tierpark war es dann ein Pfleger bei den Hornträgern, ein ehemaliger Bauer, der keinen Feierabend kannte und z.B. Tage vor der Geburt im Stall einer Antilope schlief, um ihr notfalls sofort helfen zu können. Soweit ich das beurteilen konnte, fanden die hochträchtigen Antilopen das auch tatsächlich hilfreich. Wie so viele Tierliebhaber hatte er mit Menschen nicht mehr viel im Sinn. Weil ich mich im Rahmen eines kleinen Arbeitskreises seit 1999 vor allem mit Biologie beschäftige, lag es nahe, erneut eine Anthropause einzulegen, auch wenn ich mich jetzt praktisch bloß um zwei Katzen kümmere. Mit Jaroslav Hasek könnte ich trotzdem sagen: „Ich habe die Seite gewechselt und bin jetzt bei den Tieren“. Oder auch Ossip Mandelstam zitieren: „Ich habe mein Schach auf die Biologie gesetzt, damit das Spiel ehrlicher werde.“
.

.
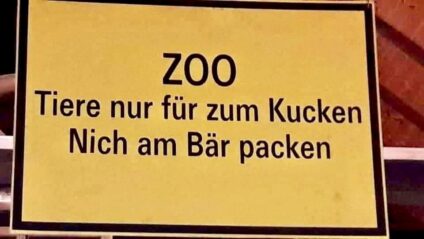
.
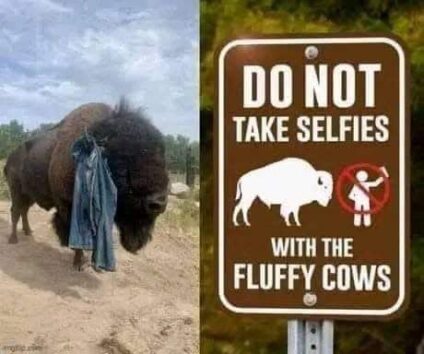
.

.
Ubermenschen
Der „Übermensch“ (mit „ü“) ist ein Idealmensch, der laut Wikipedia über das gewöhnliche Leben eines als normal abgewerteten Menschen hinausgewachsen ist oder hinausstrebt. Dieser „homme supérieur“ taucht bei vielen Denkern auf – bei Augustinus, Dante, Luther, Dostojewski, Sri Aurobindo etc. Berühmt wurde vor allem Nietzsches „Übermensch“, der einen neuen Menschentypus propagierte. Ebenso später der Harvardprofessor und LSD-Propagandist Timothy Leary für den 1988 der Mensch von Morgen ein Kalifornier sein wird – ein Ubermensch (mit „u“).
Nicht nur der Weltkonzern „Uber“ hat sein Hauptquartier in San Francisco. Hinter diesem Unternehmen steckt laut Wikipedia das Kapital von Benchmark Capital, Goldman Sachs, Google Ventures, First Round Capital, Menlo Ventures und Lowercase Capital. Auch der Springer-Verlag hat sich an Uber finanziell beteiligt. Ebenso mit 500 Millionen Dollar der von Elon Musk mitgegründete kalifornische „Bezahlfreund“ (PayPal), der bis 2015 zum kalifornischen Konzern „eBay“ gehörte. Ferner beteiligen sich der japanische Automobilhersteller Toyota sowie ein Konsortium des japanischen Unternehmens Softbank an Uber. Das chinesische Internetunternehmen Baidu will smit 600 Millionen US-Dollar bei Uber einsteigen.
Die Uber-Produktpalette umfasst u.a. UberEats, das Fastfood von McDonald’s ausliefert. Im Uber-PR-Beirat sitzt der ehemalige BILD-Chefredakteur Kai Diekmann. Die Berliner Mercedes-Benz-Arena heißt jetzt Uber-Arena.
Seit Ende 2019 darf Uber über seine App in ganz Deutschland vorerst keine Beförderung per Mietwagen mehr anbieten. Dies entschied das Langericht Frankfurt/Main mit sofortiger Wirkung. Beobachtungen zeigen jedoch laut Wikipedia, „dass Uber dieses Gerichtsurteil weitestgehend ignoriert und dies auch öffentlich bekundet.“
Weitere kalifornische Ubermenschen, die eine globale Plusmacherei anstreben, ist der in Palo Alto lebende Mark Zuckerberg, der viertreichste Mann der Welt. Er betreibt mit seiner Firma „Meta (Über) Platform“ u.a. „Facebook“. Dann ist da noch „Google“ mit Sitz in Mountain View Kalifornien, gegründet von Larry Page und Sergey Brin, die Platz 13 und 14 auf der Forbes-Liste der reichsten Männer belegen.
Der Hauptsitz des Apple-Konzerns befindet sich im kalifornischen Cupertino. Ihr Gründer Steve Jobs lebte in San Francisco und starb 2011 in Palo Alto Kalifornien. Der Apple-Konkurrent Microsoft hat sein Konzernhauptquartier in Seattle Washington. Dessen Gründer Bill Gates besitzt mehrere Häuser in Kalifornien. Seine Stiftung, zur weltweiten Verbesserung der Gesundheitsversorgung, deren wichtigste Mitarbeiter (von 1500) erst einmal mit der Beeinflussung oder Unterwanderung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschäftigt sind, ist mit über 60 Milliarden Dollar die weltweit größte Privatstiftung. Sie hat ihren Sitz ebenfalls in Seattle. Dort befindet sich auch der Amazon-Konzern von Jeff Bezos.
Dieser besitzt außerdem noch ein Raumfahrtunternehmen nahe Seattle: „Blue Origin“ genannt. Zudem gehört ihm die einflußreiche Tageszeitung „Washington Post“ und die Biotechnologiefirma „Altos Labs“, ein Silicon Valley Unternehmen, in dem es um Unsterblichkeit geht, d.h. wo über Lebensverlängerungsmöglichkeiten geforscht wird. Bezos war der erste Ubermensch, dessen Vermögen die 200 Milliarden Dollar Marke überschritt.
Mehr als doppelt so groß ist heute das Vermögen von Elon Musk, Gründer des Raumfahrtunternehmens Space X und des Elektroautounternehmens Tesla sowie des Mikrobloggingdienstes X (vormals Twitter). Seine Firmensitze sind verstreut, er behauptet, alle seine sieben Häuser in Kalifornien verkauft zu haben und inzwischen mal hier und mal dort zu wohnen, zuletzt vor der Präsidentenwahl im Haus von Trump in Florida.
Anfänglich waren die meisten der hier erwähnten kalifornischen Ubermenschen noch vom New Age Spiritualismus und vom Buddhismus angetan sowie von der posthippiesken Atmosphäre in San Francisco. Inzwischen wird diese jedoch von ihren Entwicklern und Managern im nahen Silicon Valley weggentrifiziert. Das einzige, was sie beibehalten, sind LSD-Mikrodosen, die sie ständig einwerfen, um noch profitablere Ideen umzusetzen.
Der „Freitag“ berichtete gerade, dass der Tech-Standort Silicon Valley lange als „links und woke“ (d.h. liberal und halbwegs sozial) galt, aber nun haben sich die dortigen Unternehmer dem „Trumpismus verschrieben“.
Zu den Silicon Valley Konzernen gehören auch noch Cisco und Oracle und im kalifornischen Santa Clara der KI-Entwickler Nvidia (lateinisch Neid), der 2024 zum „wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt“ aufstieg. Als 2025 der chinesische Chip-Entwickler „DeepSeek“ mit einem „KI-Assistenten“ auf den Markt kam, fiel der Nvidia-Börsenwert jedoch um fast 600 Milliarden Dollar. Zuvor hatte das chinesische Videoportal TikTok bereits Facebook den Rang abgelaufen und soll in den USA verboten werden.
Morgan-Stanleys Hightech-Analystin, Mary Meeker, wies bereits 2011 in einer Präsentation vor Silicon-Valley-Chefs darauf hin, dass inzwischen sechs der 15 größten Internet-Aktiengesellschaften in Asien angesiedelt sind. Trumps Regierungsprogramm sieht eine 500-Milliarden-Investition für ein „Mega-KI-Projekt“ (Der Freitag) vor, um in wirtschaftlicher und militärischer Hinsicht China weiterhin Paroli zu bieten. Das erklärt vielleicht, warum die kalifornischen Ubermenschen Trump-Follower wurden.
.

.
Ukrainischer Ausverkauf
In der Ukraine fielen die „Chicago Boys“, die wirtschaftswissenschaftliche Speerspitze des Neoliberalismus, als erstes nach 1991 ein. Schon bald nach ihrem Beratungseinsatz war die Ukraine laut Spiegel „das korrupteste Land Europas“ – und die ausländischen Investoren standen Schlange.
Mit dem Erfolg, dass Bauern, die in der EU 100 Hektar besaßen, in der Ukraine nun 2-3000 Hektar bewirtschaften. Allein 40 große ukrainische Agrarbetriebe sind in deutscher Hand. Ein österreichischer Bauer übernahm eine aufgelöste Kolchose und mästet dort 4500 Schweine. Einer der größten Schweinebetriebe ist in dänischer Hand.
Investoren aus Russland beteiligten sich direkt an ukrainischen Agrarbetrieben. China bewirtschaftet 100.000 Hektar Ackerland in der ostukrainischen Schwarzerderegion, das auf drei Millionen Hektar vergrößert werden soll. Neben dem Futtermittelanbau sollen darauf vor allem Schweine für den chinesischen Markt gezüchtet werden. Die chinesische Agroholding China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO) ist einer der größten Arbeitgeber in der ukrainischen Landwirtschaft und einer der größten Investoren in die landwirtschaftliche Infrastruktur (über 200 Milliarden Dollar seit 2008).
US-Investoren stiegen bisher, ähnlich wie die russischen, in ukrainische Agrarbetriebe ein. „Selbst Land kaufen dürfen die ausländischen Unternehmen in der Ukraine nämlich nicht, schreibt „Die Zeit“, „doch die Investoren finden andere Wege. Sie können Land pachten, maximal 49 Jahre lang, zu günstigen Preisen. Sie nehmen Einfluss, indem sie Kredite an ukrainische Unternehmen vergeben, und sie beteiligen sich auch direkt an den Betrieben, zum Beispiel indem sie Aktien kaufen. Einige der ukrainischen Holdings sind an westlichen Börsen notiert, so gehören sie zumindest teilweise Anlegern aus dem Westen.“
Und diese Unternehmen weiten ihren Einfluss auf den ukrainischen Agrarsektor immer weiter aus. Nach der mit US-Hilfe und Gewalt gelungenen Absetzung von Präsident Viktor Janukowitsch 2014, der das „Assoziationsabkommen“ der Ukraine mit der EU abgelehnt hatte, das u.a. den Anbau von „Genprodukten“ vorsah, wurde eine Harvard-Businessfrau, Natalie Jaresko, Finanzministerin, die seit den 1990er Jahren in der Ukraine einen von den USA aufgelegten privaten Aktienfonds zur Förderung von Investitionen verwaltete und Geschäftsführerin von ‘Horizon Capital’ war, einer Investmentfirma in Berlin mit 11 Milliarden Dollar, die westliche Investitionen im Land betreut.
Die riesigen Schulden, die die Ukraine seit ihrer gelenkten „Orangenen Revolution“ 2004 beim IWF und der Weltbank hatte, wurden vom IWF genutzt, um den Tausch von „Natur gegen Schulden“ zu erzwingen. Man nennt das „Schuldenfallen-Diplomatie“. Auf diese Weise erwarben die drei US-Konzerne Cargill, Dupont und Monsanto 17 Millionen Hektar ukrainisches Ackerland (so viel wie ganz Italien hat). Ihre Hauptaktionäre sind die US-Investmentfirmen Vanguard, BlackRock und Blackstone. BlackRock verfügt über 10 Milliarden Dollar, Vanguard über 6 Milliarden und Blackstone über 881 Milliarden – für gewinnbringende Investitionen. Gemeinsam werden diese sechs „global player“ den Anbau von genveränderten und patentierten Nutzpflanzen durchsetzen – auf 28 Prozent des ukrainischen Landes, das nun amerikanisch ist.
„Cargill, Vertreiber von Pestiziden, Saatgut und Düngemitteln, hat inzwischen in den Bau von Getreidespeichern, Sonnenblumenöl-Fabriken und Tiernahrung investiert, daneben erwarb das Unternehmen einen Anteil von 25 Prozent plus eine Aktie an einem Getreideterminal in der Hafenstadt Noworossijsk. Außerdem verfügt es über Anteile an ‘UkrLandFarming’, dem größten Agrobusiness des Landes. Die Firma Monsanto hat die Anzahl ihres Mitarbeiterstabs in der Ukraine verdoppelt. Im März 2014, nur Wochen nach der Absetzung von Janukowitsch, investierte Monsanto 140 Millionen Dollar in den Bau einer Saatgutfabrik. Auch DuPont kündigte den Bau einer Saatgutfabrik in der Ukraine an,“ schrieb Frédéric Mousseau, Strategiedirektor des kalifornischen Oakland Instituts, 2015 auf „oaklandinstitute.org“. Er beschuldigte die USA und die Europäische Union, gemeinsam die Übernahme der ukrainischen Landwirtschaft zu betreiben. „Die Bestrebungen zeugten sowohl von der direkten Verstrickung des Westens in den Ukraine-Konflikt als auch von Verantwortungslosigkeit gegenüber den ukrainischen Bauern und europäischen Verbrauchern.“ Für Mousseau sind alle Messen in der Ukraine bereits gesungen: Die Agrarkonzerne haben ihre Investitionen derart erhöht, dass es einer „Übernahme der ukrainischen Landwirtschaft durch westliche Firmen“ gleichkomme. Den Rest der ukrainischen Ressourcen werden sich die westlichen Staaten und Konzerne nach Beendigung des Krieges auch noch holen – es gab bereits eine „Geberkonferenz“, die in Wahrheit eine „Nehmerkonferenz“ war.
.

.
Naturkosten 1
In einer Talkshow erzählte ein Millionär, dass er für die Operation seiner Katze 18.000 Euro bezahlt hätte. Das Publikum maulte: Wie kann man für ein schnödes Tier so viel Geld ausgeben. Die Tierschützerin Karen Duve meinte: Wenn er sich von dem Geld ein schickes Auto gekauft hätte, würde das keiner kritisiert haben.
Zwei Zootierpfleger erzählten mir, dass es in der DDR private Züchter von Papageien, Königsittichen, Trakopanfasanen etc. gab. Die beiden hatten sie auf gesucht, um im Tiertausch Nachzuchten für den Zoo zu bekommen, dabei erfuhren sie, daß fast alle diese Vögel durch Eierschmuggel über die Westdeutsche-Westberlingrenze gelangt waren. Ein Königssittichpärchen kostete im zuchtfähigem Alter 15.000 bis 20.000 Ost-Mark. Die Eier wurden für ein Taschengeld in Australien Nestern entnommen und dann von jemanden aus Gefälligkeit im Flugzeug mitgenommen. Die Oma, die in den Westen fahren durfte, hat dann z.B. von ihren Verwandten „Wachteleier“ geschenkt bekommen.
Die brasilianischen Spix-Aras sind wildlebend ausgestorben, aber in einigen Zoos und bei privaten Haltern leben noch weltweit 160, berichtete „spektrum.de“. Einer kostet etwa 100.000 Dollar. 2011 meldete die Märkische Oderzeitung: Die letzten Spix-Aras leben in einer Papageienzucht-Einrichtung in 15566 Schöneiche. Sie gehören zur „wertvollen ‚Reservepopulation‘ des Vereins zur Erhaltung bedrohter Papageien“. Sie werden dort „umsorgt von Pflegerinnen, Tierärzten und Biologen, geschützt hinter Sicherheitstoren und Stahlzäunen, überwacht von Kameras und abgeschirmt von blickdichten Hecken,“ schrieb die Süddeutsche Zeitung 2018.
2015 wurden in Schöneiche vier Spixaras geboren, der Vereinsvorsitzende Martin Guth („Ich komm aus‘m Osten. Papageien waren schön bunt“) schickte zwei der Jungvögel zwecks Auswilderung nach Brasilien. Sie wurden von der brandenburgischen Umweltministerin am Flughafen Tegel medienwirksam verabschiedet.
Die Schweizer „Handelszeitung“ berichtete, dass der Schweizer Geschäftsmann „R.M.“ 2008 in Brasilien verhaftet wurde, nachdem man 10 Papageieneier in den Taschen seiner speziellen Weste gefunden hatte. Er habe die Eier zum Züchten erhalten, verteidigte R.M. seine „Dummheit“.
Die Journalistin Anja Rützel besuchte einen bayrischen Kurs in „Bibermanagement“ und berichtet darüber in ihrem Buch „Saturday Night Biber“ (2017). Gleich auf der ersten Folie des Kursleiters stand: „Bibermanagement ist Menschenmanagement“. Dazu gehöre auch ein sensibler „Bibertourismus“, der die Tiere nicht stört oder vertreibt. „Das Schlimmste, was passieren kann, ist wenn ein Biberproblem am Stammtisch landet,“ meinte der Kursleiter. Zur Not müsse man eine „Biberumsiedlung“ vornehmen, was rund 7000 Euro pro Tier koste.
2018 schickte die BBC den Biologen Mark Carwardine und den Satiriker Douglas Adams mit einem Kamerateam auf eine „Reise zu den aussterbenden Tieren unserer Erde“, 1991 erschien ihr Bericht „Die letzten ihrer Art“ darüber. Ihre Recherchen führten sie u.a. nach Mauritius. Dort wurden sie vom Ornithologen Richard Lewis und dem Biologen Carl Jones abgeholt, die mit viel Geld von Spendern eine Rettungsstation für bedrohte Tierarten auf Mauritius betreiben. Anfangs machten sie bei der kostspieligen Aufzucht und anschließenden Auswildung der seltenen Mauritiusfalken und Rosentauben Fehler: Die Inselbewohner fingen sie alle oder schossen sie ab und aßen sie auf. „Wir konnten es einfach nicht fassen“.
Das BBC-Team wurde von der Botanikerin Wendy Strahm begleitet, die ihnen eine Pflanze – als die letzte ihrer Art – zeigte: eine wilde Kaffeesorte (Ramus mania). Sie galt als ausgestorben – bis ein Schüler dort doch noch eine Pflanze am Straßenrand entdeckte. Um ihre Abholzung zu verhindern, wurde sie schnell eingezäunt, aber dadurch wurden die umliegenden Bewohner auf sie aufmerksam. Sie stiegen über den Zaun und rissen kleine Äste, Blätter und Rindenstücke ab. „Da der Baum etwas Besonderes war, wollte jeder ein Stück davon haben“. Ihm wurden plötzlich Heilkräfte angedichtet. Vor dem Zaun wurde deswegen noch ein Stacheldrahtzaun errichtet. „Dann mußte der erste Stacheldrahtzaun von einem zweiten Stacheldrahtzaun eingezäunt werden und dann der zweite von einem dritten, bis das Gehege sich über knappe 2000 Quadratmeter erstreckte. Schließlich wurde auch noch ein Wächter eingestellt, um die Pflanze zu schützen.“. Im Botanischen Garten von England, Kew Garden, versuchte man unterdes „mit Ablegern dieser einen Pflanze zwei neue Pflanzen zu kultivieren“, um sie irgendwann auszuwildern.
.

.
Naturkosten 2
Seit dem Siegeszug des Neoliberalismus gibt es einen Trend zur Rehabilitierung des Wolfes. Nach der Wende wimmelte es in der Berliner Treuhandanstalt von westdeutschen Privatisierungsmanagern und Investoren, die „Wolf“ mit Vor- oder Nachnamen hießen. „Die benehmen sich schlimmer als Kolonialoffiziere“, meinte der kurz darauf erschossene Treuhandchef Detlev Rohwedder, wobei man sofort einen „Russen“ als Täter annahm. Den Privatisierungsmanagern standen auf ostdeutscher Seite überforderte Betriebsräte gegenüber, die nicht selten Friedbert, Christfried oder Lammfromm hießen, einer sogar Feige mit Nachnamen. Kein Witz, sondern ein Fall von Namensmagie im ausklingenden 20. Jahrhundert. Die sich im 21. mit Wolfowitz, Wolfensohn etc. sogar noch steigerte.
Im Maße die Brandenburger in den Neunzigerjahren wegen der Abwicklung ihrer Betriebe gen Westen abwanderten, gelang es dort verschiedenen Raubtieren von Polen aus einzuwandern. Im Januar 2000 kam der erste (dreibeinige) Wolf über die Oder . Er wurde eingefangen und in den Tierpark Schorfheide verbracht. Der Tagesspiegel titelte: „Die Angst vor dem Osten oder Sibirien ist unheimlich nah“.
2003 wurde der Wolf zum „Tier des Jahres“ gekürt. Im Monitoringjahr 2022/2023 wurde die Wolfspopulation in Deutschland bereits auf etwa 1.400 bis 2.500 Tiere geschätzt, offiziell sollen es 185 Rudel, 45 Paare und 22 Einzeltiere sein.
Aber nun geht es ans Reduzieren: Die Jäger töteten eine Wölfin aus dem Herzlaker Rudel; dann die Mutterwölfin des Burgdorfer Rudels, ferner eine Wölfin aus dem Rodewalder Rudel (das 1,25 Millionen Euro Schaden verursachte); in der Hohen Rhön wurde eine falsche Wölfin (GW3092f) erschossen; im Rudel Schermbeck wurde die Wölfin Gloria als „Problemwölfin“ zum Abschuß freigegeben; ebenso eine Wölfin ohne Rudel in Schleswig-Holstein (die Jäger verlangten jedoch, anonym zu bleiben). Die grüne Umweltministerin Steffi Lemke verkündete, sie wolle Abschüsse von Wölfen erleichtern.
In den USA hat man bereits Erfahrung mit dem Abschießen, Auswildern und wieder Abschießen von Wölfen. Im Yellowstone-Nationalpark wurden 1916 die ersten Park-Ranger durch den US-Kongress eingestellt, sie sollten gegen die Wilderer vorgehen (die bis dahin vom Militär gejagt wurden), zugleich sollten sie aber auch Pumas, Luchse, Rotluchse, Koyoten und andere Fleischfresser ausrotten, 1926 erschossen sie den letzten Wolf im Park. Dort vermehrten sich dann jedoch die Wapitihirsche derart, dass die Ranger bis 1970 tausende umsiedelten oder erschossen. Danach stieg ihre Zahl aber wieder so an, dass sie die Weiden- und Pappelsetzlinge abfraßen. Für 117 Millionen Dollar wurde daraufhin 14 in Kanada gekaufte Wölfe im Park ausgesetzt, woraufhin sich langsam wieder eine ökologische Vielfalt einstellte.
2012 verfügte der US-Kongress aufgrund von Eingaben der Jäger, dass die Wölfe von der Liste der bedrohten Arten gestrichen wurden. Bereits sechs Monate später hatten Jäger und Fallensteller von geschätzten 1700 Wölfen 550 getötet. Darunter befanden sich auch 7 Wölfe mit Senderhalsbändern, die ihnen Forscher im Yellowstonepark angelegt hatten. Auf „HuntWolves.com“ war zuvor verraten worden, wie die Jäger deren Funkstrahlen orten und für sich nutzen können.
Unter den von ihnen erschossenen Tieren befand sich die berühmte Wölfin „Null-Sechs“, Anführerin eines Rudels im Lamar-Tal. Die New York Times widmete ihr einen langen Nachruf. Weil sich ihr Rudel danach zerstreute, verringerte sich der vor allem auf das Lamar-Rudel fokussierte Wolfs-Tourismus und die Zahl der Sponsoren für die teuren GPS-Halsbänder für die Parkwölfe und für deren Erforscher. Sie fragten sich: Warum sollen wir weiter Geld für Wölfe geben, wenn diese doch erschossen werden? Der Parkverwaltung entstand dadurch ein finanzieller Schaden von 11 Millionen Dollar.
2020 veröffentlichte der Journalist Nate Blakeslee „Die wahre Geschichte des berühmtesten Raubtiers von Yellowstone: Die Wölfin“. Darin heißt es: „Die Jäger konnten 100 Wölfe außerhalb des Parks abschießen. Ohne dass es jemandem auffiel. Aber erschoss man einen Parkwolf, den die Menschen kennen und lieben gelernt hatten, redeten plötzlich der ganze Staat über die schlimme Jagd auf Wölfe.“ Ebenfalls 2020 erlaubte Trump zum Entsetzen der Wildhüter das Erschlagen von jungen Wölfen und Bären.
Anfang 2025 meldete die Presse im In- und Ausland auch noch den Tod der Wölfin „907f“ im Yellowstonepark. Sie war die Leitwölfin des Junction Butte Rudels und wurde knapp 12 Jahre alt. Die halbblinde und hinkende Wölfin starb Heiligabend nach einem Kampf mit einem anderen Rudel. Die Parkverwaltung sprach von einem „großen Verlust“.
.

.
Genpolitik
1820 wurden in England die menschlichen Lebensgrundlagen dem selbstregulierenden Markt untergeordnet – mit der definitiven Liberalisierung der Arbeits-, Boden- und Geldmärkte. Die Zerstörung der Allmende (des Gemeinschaftseigentums) und die Atomisierung der Dorfgemeinschaften kam um 1860 zum Abschluß. Theoretisch gerechtfertig wurde diese “schöpferische Zerstörung” von den drei Liberalen Jeremy Bentham, Herbert Spencer und Thomas Malthus.
Sie lieferten Charles Darwin die tragenden Begriffe für seine Evolutionstheorie, die 1859 veröffentlicht wurde: Er übernahm von Jeremy Bentham den Utilitarismus, den dieser begründet hatte: das Prinzip der Nützlichkeit. Daneben entwickelte Bentham panoptische Gefängnisse und Arbeitshäuser. Nach ihm dienten alle Lebensäußerungen eines Individuums der Nutzenmaximierung. Vom Philosophen Herbert Spencer übernahm Darwin die Vorstellung vom Überleben des Tüchtigsten: dem “Survival of the fittest”. Spencer kreierte einen Sozialevolutionismus, indem er naturwissenschaftliche Erkenntnisse auf die Gesellschaft übertrug. Von Thomas Malthus übernahm Darwin den Populationsbegriff und die Idee der Konkurrenz als treibende Kraft der Entwicklung: der „Evolution“. Der Nationalökonom Malthus hatte berechnet, dass die Bevölkerungszahl exponentiell steige, die Nahrungsmittelproduktion in derselben Zeit aber nur linear. Die erheblichen sozialen Probleme seiner Zeit betrachtete Malthus in erster Linie als Folgen einer zu großen Bevölkerung. Er empfahl, die Armenhilfe einzuschränken, sie sei wider die ‘Naturgesetze’. Denn direkte Hilfe würde seiner Meinung nach die Armen nur ermutigen, noch mehr Nachkommen zu zeugen – und so neue Armut schaffen. „Damit leitete er einen Wandel in der britischen Armenpolitik ein: weg von Almosen, hin zu Zuchthäusern” – so das “manager-magazin”. Einen vorläufigen Höhepunkt erreichte diese asoziale englische Weltanschauung mit Margret Thatchers berühmten Ausspruch: „Ich kenne keine Gesellschaft, nur Individuen.”
Gleichzeitig erlebte die angloamerikanische Biologie mit Richard Dawkins Gen-Reduktionismus und seinen einfältigen Computer-Lebewesen-Vergleichen einen abscheulichsten Tiefpunkt. Der Evolutionsbiologe saß an der Universität Oxford auf dem Lehrstuhl für „Public Understanding of Science“ und sollte seinen „Ultradarwinismus“ unter die Leute bringen. In seinem Hauptwerk „Das egoistische Gen“ begriff er die Gene als evolutionäre Treiber und das ganze Lebewesen als „schwerfälligen Roboter“: „Individuen sind nur als Vehikel für das Überleben der Gene von Bedeutung”. Dem Gen als „Zielpunkt der natürlichen Selektion” widmete er ein Gedicht: „Ein wanderndes egoistisches Gen/Sagte: ‘Körper hab ich schon viele gesehn./Ihr denkt, ihr seid schlau,/Doch ich weiß ganz genau:/Ich lebe ewig, und ihr müsst vergehn’.”
Diese Sichtweise ist nahezu identisch mit der Weltsicht der preußischen Junker, namentlich den Ständen des Kurmärkischen Kreises wie das Haus des Grafen Finckenstein und das des Ludwig von der Marwitz, die erst gegen Napoleon und dann gegen die „Stein-Hardenbergschen Reformen“ kämpften – vor allem gegen deren Aufhebung der Erbuntertänigkeit der Bauern.
Für Hardenberg hatte der Adel seine „politische Bedeutung“ schon lange eingebüßt. Aufklärung und Bürgertum hatten dessen ideologischen Grundlagen zerstört. Nur der Landadel hielt noch stand. In ihm war „das patriachalische und Familienwesen noch so fest gegründet, dass das bloße Lesen noch keinen Eindruck machte,“ wie Marwitz schrieb. Die Familie als Genealogie ist hier das konservierende Element, „in der das einzelne Glied“ Hannah Arendt zufolge „als diese bestimmte Person mit ihrem persönlichen Schicksal kaum eine Rolle spielte. Dennoch ist der einzelne unersetzbar wichtig als Vertreter des Standes und als Garant der Unsterblichkeit des Geschlechts.“
Dass dieser Einzelne in der Erbfolge aber „ein Recht auf sein persönliches Leben“ und den Anspruch „glücklich zu sein“ geltend macht, hält Marwitz für eine „grundfalsche Prämisse“ der modernen Zeit, aus der „die ganze Teufelei, die seitdem Europa auf den Kopf gestellt hat“ resultiert. Der Einzelne ist für ihn bloß der momentane Repräsentant des „dauernden und unveränderlichen Interesses des Standes als einer moralischen, sonach unsterblichen Person“.
Aus dem Stammbaum der Adelsgeschlechter wurde die Anthropogenese der Evolution. „Das Geheimnis des Adels ist die Zoologie,“ kann Marx deswegen sagen. Sein „Egoistisches Gen“ lebt, sofern kein „Junkerland in Bauernhand“ gerät, für die Ewigkeit, während der jeweilige Sprecher des „Adelsnestes“ es nur für den Augenblick repräsentiert. Er hat sonst nichts anderes zu tun. Der letzte Sproß des Gens derer von Marwitz, Hans-Georg (geb. 1961), bekam nach Auflösung der DDR den Gen-Stammsitz Gut Friedersdorf fürn Appel und n Ei zurück. Das galt auch für den letzten Sproß des Hauses Finckenstein, Karl Wilhelm (geb.1923), der 1990 das Landschloss seiner Familie in Alt Madlitz zurück bekam. Mit Dawkins könnte man solche rückwärtsgewandten Restitutions- und damit Kontinuitätsvorgänge auch als „Rache der Gene“ bezeichnen.
.

.
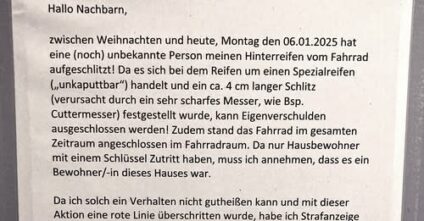
.
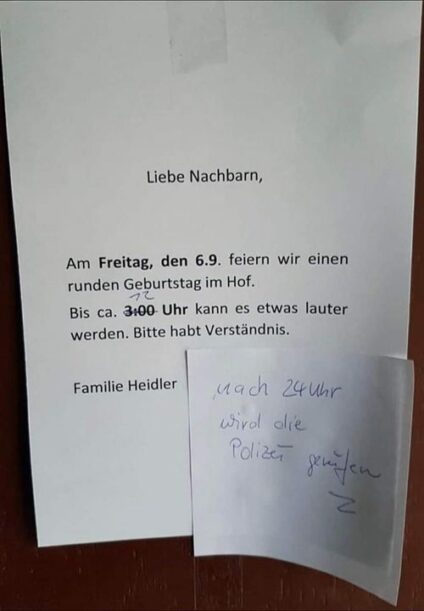
.
Gentechnik
Ab etwa 2000 wurde fast täglich ein neues Gen isoliert. In den Medien war jedesmal triumphalistisch vom endlich entdeckten „Neid-Gen“, „Erfolgs-Gen“, „Schönheits-Gen“, „Eifersuchts-Gen“, „Fettmach-Gen“, „Autisten-Gen“, „Juden-Gen“ usw. die Rede. Sogar das Magazin der Max-Planck-Institute titelte: „Singvögel mit Casanova-Gen“. Jede Lebensäußerung und -einstellung war plötzlich biologisch determiniert und die Biologie damit zur Leitwissenschaft geworden. Als es den Biochemikern Watson und Crick gelang, ein räumliches Modell der DNA-Doppelhelix zu erstellen, teilte ersterer der Presse mit, es sei ihnen gelungen, „den Code des Lebens zu knacken“.
2021 hat die US-Zeitschrift „The New Yorker“ einen 11 Seiten langen Text über die Pro-und-Contra-Diskussion eines Buches der US-Psychologin Kathryn Page Harden: „Die Gen-Lotterie – Wie Gene uns beeinflussen“ veröffentlicht. Dieses „bahnbrechende Buch bietet eine kühne neue Vision einer Gesellschaft, in der es allen gut geht…“
Harden arbeitet auf dem Gebiet der „Verhaltens-Genetik“, u.a. gründete sie das „Texas Zwillings Projekt“. Sie untersucht den Einfluß der Gene auf Charaktereigenschaften (Neurotizismus, Verträglichkeit) und Lebensumstände (wie Bildungs-Errungenschaften, Intelligenz, Einkommen, Kriminalitätsanfälligkeit). Der „New Yorker“ fragte sich: „Kann Harden die Linken davon überzeugen, dass Gene wichtig sind – und die Rechten, dass die Gene nicht alles entscheiden?
Weil sich herausstellte, dass man eben nicht alles mit den Genen erklären kann, kreierten israelische Mäuse-Forscherinnen die „Epigenetik“: Eine nicht-genetisch bedingte Vererbbarkeit erworbener Eigenschaften. Es ist dies alles die ewige Diskussion „Angeboren oder Anerzogen“ – ein Lavieren zwischen Neodarwinismus und Lamarckismus.
2009 veröffentlichte der Biologe Bernhard Kegel das Buch „Epigenetik“. Darin heißt es: Man hätte den Begriff des „Gen“, der gerade hundert Jahre alt wurde, gebührend feiern sollen, „denn ob dieser Begriff seinen nächsten runden Geburtstag noch erleben wird, ist fraglich“: Das „genzentrische Weltbild“ war allzu simpel. „Selbst Craig Venter, der vor wenigen Jahren mit seinen Sequenzierrobotern an vorderster Front der biomedizinischen Forschung stand, muss heute eingestehen: ‚Im Rückblick waren unsere damaligen Annahmen über die Funktionsweise des Genoms dermaßen naiv, dass es fast peinlich ist‘. ‚Wir müssen blind gewesen sein‘, seufzte der Entwicklungsgenetiker Timothy Bestor von der New Yorker Columbia Universität angesichts eines ganzen ‚Universums‘ ungeahnter und unerwarteter Phänomene. Über Vererbung und Evolution muss neu und intensiv nachgedacht werden‘.“
Der französische Wissenssoziologe Bruno Latour hielt die ganze Genetik für einen ärmlichen „Reduktionismus“, er räumt jedoch ein, dass er in der Industrie durchaus Sinn macht – also Profite. Und mit Industrie ist vor allem die angloamerikanische Biologie gemeint: über 80% aller US-Biologen sind Geschäftsführer oder Teilhaber von Firmen.
Die Genkritikerin Silja Samerski sagte in einem Interview: „Das ,GEN‘ ist nichts anderes als ein Konstrukt für die leichtere Organisation von Daten, es ist nicht mehr als ein X in einem Algorithmus, einem Kalkül. Aber außerhalb des Labors wird es dann zu einem Etwas, zu einem scheinbaren Ding mit einer wichtigen Bedeutung, mit Information für die Zukunft… über das sich anschaulich und umgangssprachlich reden lässt. Es ist jedoch sehr fraglich, ob man umgangssprachlich über Variablen von… oder Bestandteile eines Kalküls oder Algorithmus sprechen kann, ob sich also überhaupt außerhalb des Labors sinnvolle Sätze über ,GENE‘ bilden lassen, die von irgendeiner Bedeutung sind. Wenn aber solche Konstrukte in der Umgangssprache auftauchen und plötzlich zu Subjekten von Sätzen werden, mit Verben verknüpft werden, dann werden sie sozusagen in einer gewissen Weise wirklich.“
Wie wirklich hat der Berater von Biotech-Unternehmen William Bains in der Zeitschrift „Nature Biotechnology“ angedeutet: „Die meisten Anstrengungen in der Forschung und in der biotechnologischen industriellen Entwicklung basieren auf der Idee, dass Gene die Grundlage des Lebens sind, dass die Doppelhelix die Ikone unseres Wissens ist und ein Gewinn für unser Zeitalter. Ein Gen, ein Enzym, ist zum Slogan der Industrie geworden…Kann das alles so falsch sein? Ich glaube schon, aber ich bin sicher, das macht nichts. Denn die Hauptsache ist, dass es funktioniert: Manchmal funktioniert es, aber aus den falschen Gründen, manchmal wird es mehr Schaden anrichten als Gutes tun…Aber die beobachtbare Wirkung ist unbestreitbar…Wir müssen nicht das Wesen der Erkenntnis verstehen, um die Werkzeuge zu erkennen…Inzwischen führen die Genom-Datenbanken, die geklonten Proteine und anderes Zubehör der funktionalen Genetik zu Werkzeugen, Produkten, Einsichten, Karrieren und Optionen an der Börse für uns alle.“ Und darum geht es!
.

.
Das amerikanische Bilderinventar in Europa
Die Besetzung der DDR als Neuland dauert bis in die Gegenwart an und „ist in starkem Maße von einem europäischen Diskursgeflecht überzogen, was nachvollziehbar ist, wenn man bedenkt, dass die Langfristigkeit und Sichtbarkeit dieser Diskurse mittels ihrer Verschriftlichung sichergestellt wurden,“ schreibt die Literaturwissenschaftlerin Ana Pizarro, die mit dem spanischen Conquistador gleichen Namens weder verwandt noch verschwägert ist. Ihr Statement erinnert an einen kanadischen Indigenen, der von einem Bayreuther Ethnologen über die Büffeljagd ausgefragt, antwortete: „Unsere Vorfahren haben die Bison geheiratet, sie haben ihre Lebensweise kennengelernt, und sie haben diese Kenntnisse von Generation zu Generation weitergegeben. Die Weißen schreiben alles in ein Buch, um es nicht zu vergessen.“
Ostelbien „ist wie eine große Mauer“, in die laut Pizarro „unzählige Geschichten eingeflochten sind“. Es muß natürlich heißen, dass das Land von einer großen Mauer umgeben war, allerdings nur nach Westen hin, und dass erst seit ihrem Verschwinden „unzählige Geschichten“ dort eingeflossen sind. Dieses Land gilt es auf gut lateinamerikanisch zu erobern.
Weiter heißt es in der Monografie der chilenischen Femme de Lettres: „Die Länder, die bei diesem amerikanischen Beutezug miteinander konkurrierten, spornten ihre Vertreter zu dem Abenteuer an, diese Region des [europäischen] Kontinents zu erforschen.“ Bei diesem „Beutezug“ hatten die amerikanisierten „Besserwessis“ dank einer klugen Politik der Treuhandanstalt, die das Land und seine Reichtümer als erste verschriftlicht hatte, um es besser durchzuprivatisieren, eine Rangliste aufgestellt, die festlegte, welche Länder sich zuerst und welche sich zuletzt in Ostelbien bedienen durften. Als erste kamen die westelbischen Wirtschaftsmächte dran, dann folgten andere Länder mit ebenso eindrucksvollen militärisch-industriellen Komplexen. Priorität wurde auch der Rückgabe der einst enteigneten jüdischen Besitztümer eingeräumt, diese wurde jedoch durch ein „Investitionsvorranggesetz“ listig ausgehebelt.
Wie der Literaturwissenschaftler Ottmar Ette irgendwo anmerkt, hat jedes An-sich-Reißen sein „Vor-Gewußtes“, verweise jedes An-sich-Reißen auf ein anderes. „Es war nicht nur die Lust daran, Unbekanntes zu entdecken,“ schreibt Ana Pizarro, die das An-sich-Reißen zu einer besonders reizvollen Tätigkeit machte; „es war die Möglichkeit, in ihr den Intertext zu lesen, die Persönlichkeiten anderer An-sich-Reißer wiederzuerkennen sowie auf andere außergewöhnliche Wesen oder Tiere zu treffen“.
„Außergewöhnlich Wesen“, dass waren einerseits die emanzipierten Ostfrauen, die „den besseren Sex“ hatten, wie eine Studie der US-Ethnologin Kristen Ghodsee ergab. Angeblich hatten sie „doppelt so viele Orgasmen“ wie die westelbischen Frauen („ich muß unbedingt mal wieder Ostweiber beschlafen,“ meinte deswegen ein Treuhandmanager zu einem Kollegen auf einer Betriebsräte-Konferenz in der Kongreßhalle am Alexanderplatz). Andererseits waren die „außergewöhnlichen Wesen“ feindliche Ostmänner. Sie betranken sich, grölten und schwangen „Baseballschläger“ gegen Andersdenkende, obwohl sie nie Baseball gespielt hatten und die Spielregeln nicht kannten. Zu den „außergewöhnlichen Wesen“ zählte aber auch die „Stasi“, die noch gefährlicher war, weil nach wie vor „der Russe“ irgendwie hinter ihr stand. Angeblich war jeder zweite Ostelbier ein Stasispitzel, was den Umgang mit ihnen besonders prickelnd machte, da man nie wußte, ob oder ob nicht.
Und „Tiere“ – das waren die in Westelbien längst ausgestorbenen Biber, Seeadler, Großtrappen, Wölfe. Letztere drängten allerdings sofort über die verschwundene Mauer nach Westen rein, um dort Tod und Verderben zu bringen oder sich schlicht als Schäferhunde getarnt in den Weichbildern der rechtsrheinischen Städte einzurichten. Für einige Tiere waren diese jedoch nur Zwischenstationen auf dem Weg nach Süden.
Umgekehrt gab es das Selbe jedoch auch unter den An-sich-Reißern. Der Drang nach Osten eröffnete laut Ana Pizarro „der Fantasie einen Raum des Bekannten-Unbekannten und verursachte von jeher einen virtuellen Transformationsprozess“ – im An-sich-Reißer selbst und in denjenigen, die sehnsüchtig auf seine Einschätzungen, Berichte und Kompromate warteten. Erwähnt sei der Wirtschaftsredakteur der „Woche“, Peter Morner. Er schrieb angesichts all der Schätze, die im Osten darauf warteten, privatisiert zu werden – wie im Delirium: „Bangemachen gilt nicht. Auf also nach Sibirien – ohne Zaudern, ohne Angst!“
.

.
Endzeit-Geraune
Man sprach vor etlichen Jahren schon von der „German Angst“. Jetzt bescheren die ganzen Kriege und Krisen den Deutschen eine Realangst oder jedenfalls sind die Praxen der Verhaltenstherapeuten und Tiefenpsychologen geradezu überlaufen, wie mir der Berliner Atemtherapeut Christoph Großheim berichtete. Man nimmt auch die Veröffentlichungen von Apokalyptikern wieder wahr.
Ich erinnere mich, dass ein Friedensaktivist, ich glaube, er hieß Kohl, 1982 ein Buch publizierte, in dem er die Folgen einer atomaren Verstrahlung in Oberhessen, dort wo im NATO-Jargon der „thüringische Balkon auf die hessische Taille“ stößt, schilderte. Ein fürchterliches Buch: der Autor suhlte sich geradezu in halbverbrannten und verstrahlten Toten. Dazu muß man wissen, dass der März-Verleger Jörg Schröder, der damals dort lebte, zuvor, 1980, in der Zeitschrift „Transatlantik“ eine Geschichte veröffentlicht hatte, in der es um „Atomminendepots an der DDR-Grenze“ ging. „Alle vierzig Kilometer entlang der Grenze hat die Nato Munitionsdepots eingerichtet, die auch Atomwaffen enthalten. In als Wasserwerke getarnten Sprengstoffbunkern lagern zusammen mit konventionellem Sprengstoff hochradioaktive Atomminen, die für die entlang der Grenze ausgehobenen Atomminenschächte bestimmt sind.“ Die Amerikaner, die diese Atomminen vom Typ „Golf“ dort im Angriffsfall zünden wollten, um die Rote Armee zu stoppen, hatten die Gegend als „Ground Zero“ ausgewiesen. Das war kein Endzeit-Geraune, sondern eine erschreckende Tatsache, die durch Jörg Schröders Bericht die darniederliegende Friedensbewegung noch einmal beflügelte.
Es gab schon früher apokalyptische Phantasien – u.a. von Arno Schmidt, der 1951 eine Erzählung „Schwarze Spiegel“ veröffentlichte. Darin schildert er in Tagebuchform als „der letzte Mensch“, wie er sich aus den menschenentleeren Dörfern Sachen holt, die er für den Bau und die Einrichtung einer Hütte in der Lüneburger Heide braucht. In seinen anderen frühen Erzählungen klagte er bereits, dass es trotz Krieg zu viele Menschen gäbe und dass die Rote Armee den letzten Zug beschoss, in dem er und einige andere Leute flüchten wollten.
Ganz anders das 1938 auf Englisch und 1971 auf Deutsch erschienene Kinderbuch „Die grüne Wolke“ von Alexander Neill, dem Gründer des antiautoritären Internats „Summerhill“. Die Grüne Wolke schwebt über der Erde und versteinert alle Menschen – bis auf acht Internatsschüler und ihren Lehrer Neill, die sich in einem Luftschiff oberhalb der grünen Wolke befanden. Als „die letzten Menschen auf der Erde“ wollen sie daraufhin eine neue Ordnung für sich schaffen. Jedes Kapitel in dem Buch ist eine Episode, die Neill seinen Schülern vorm Einschlafen erzählt. Wenn einer ihn kritisiert, weil er darin zu schlecht weggekommen ist, läßt Neill ihn in der nächsten Episode sterben.
Die Berliner Kulturanthropologin Luise Meier ist weniger rabiat in ihrem halbutopischen Roman „Hyphen“ (2024) vorgegangen und ihre Endzeit ist auch nicht durch Massenvernichtungswaffen oder grüne Wolken entstanden: Die Handlung spielt in naher Zukunft zwischen Rügen und Marzahn und beschreibt Selbstorganisationsformen und vernetzte Wirtschaftsweisen, die in der BRD bereits seit einigen Jahrzehnten real existierten, jedoch aufgrund der marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen oft nicht weit kamen. Dem hat Luise Meier nun vorgebeugt, indem sie die „Energieschranke des Kapitals“ (Sandrine Aumercier) derart radikal in Szene setzte, dass das Kapital verschwand, weil die Energieversorgung (Strom, Gas, Öl) zusammengebrochen ist – und mit ihr alle „Top-down“-Institutionen. Diese werden nun aber nicht durch „Bottom-up“-Einrichtungen ersetzt. Die lokalen Initiativen verbleiben in der Horizontalen und verdichten sich dort. Dabei ahmen sie Pflanzenwurzeln (Roots) und Pilzhyphen (sic) praktisch nach, die als Verbündete Mykorrhizen bilden. Mit dem vorläufigen Endergebnis: Ein „Großteil beschreibt sich trotz aller Entbehrungen und traumatischen Erfahrungen, besonders in den ersten Monaten und Jahren, heute als zufriedener als vor 2025“ (dem Jahr des ersten Stromausfalls, der endgültige erfolgte 2027). Diese Zufriedenheit hat laut Luise Meier ihren Grund „eindeutig“ in der „Zunahme von Selbstwirksamkeit oder ‚Sinn‘“ sowie in der „Abnahme von Erfahrungen der Konkurrenz und Isolation“ (die jedoch in der Wirklichkeit 2024-25 zunehmen und den Psychotherapeuten viele Klienten zutreiben).
Eher metaphorisch reden derzeit 600 russische und 15 Belarussische Atomwissenschaftler von „Endzeit“, weil man ihnen in der „European Organization for Nuclear Research“ (CERN bei Genf) gekündigt hat. Eine Embargo-Maßnahme. Von „wahren apokalyptischen Zuständen in der Heimat“ berichten dagegen die nach Deutschland geflüchteten Ukrainerinnen den nach 1991 hierher emigrierten Russinnen, bei denen sie eine Anstellung als Putzfrau, Köchin, Pflegerin oder Kindermädchen fanden – und das sind nicht wenige.
Aber wie apokalyptisch ist das denn – was die US-Mathematikerin Cathy O’Neill in ihrer Studie „Weapons of Math Destruction“ (2016) herausfand? Sie schildert darin die Anwendung von Algorithmen in Versicherungen und bei Stipendienvergabestellen, die Arme, Schwarze und Leute aus „schlechten Wohngegenden“ diskriminieren – und damit laut O’Neill „die Demokratie unterminieren“.
.

.

.
Solschenizyn
Als Mitte der Siebzigerjahre Alexander Solschenizyns Hauptwerk „Der Archipel Gulag“ auf Deutsch erschien, wurde er sogleich von der Springerstiefelpresse vereinahmt, die ja schon immer gewußt hatte, dass die Kommunisten allesamt Verbrecher sind.
Für uns Linke, die 1967/68 den Höhepunkt der antiautoritären Studentenbewegung und in den Siebzigerjahren dann den Zerfall dieser Bewegung in unterschiedliche Gruppen und Kollektive erlebten, waren Solschenizyns Bücher damit tabu. Nichtsdestotrotz schenkten alle möglichen westdeutschen Eltern ihren studentischen Kindern die drei Bände des „Archipel Gulag“. Diese sollten damit von ihrer Neigung zum Kommunismus geheilt werden. Aber so einfach ging das nicht. Erst als in den Achzigerjahren der „stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse“ wirkte, freundeten die Linken sich langsam mit der „sozialen Marktwirtschaft“ an und sogar mit der elenden „Plusmacherei“.
1987 meinte der Bewegungshistoriker Hans-Dieter Heilmann, der 1962 in den Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) eingetreten war: „So ist das eben – damals waren wir zu zwölft. Und heute sind wir wieder zwölf“. 1989 fingen wir beide in einer LPG als Rinderpfleger in der Vormast an. Nach den Märzwahlen 1990 kauften wir wie blöd und für fast Nichts DDR-Bücher aus den abgewickelten Betrieben, deren Bibliotheken aufgelöst wurden.
Ein ebenfalls abgewickelter Leipziger Philosoph eröffnete zusammen mit seinem Freund ein Antiquariat in Kreuzberg, wo ich oft hinging. Der Laden lief gut: „Wir können unseren Frauen damit das Studium finanzieren,“ meinte er in den Neunzigern. Zwanzig Jahre später klagte er: „Niemand kauft mehr Bücher. Inzwischen müssen unsere Frauen uns finanzieren.
In den Neunzigern eröffneten viele Antiquariate und ich sichtete ihre Bücherbestände. Dabei fiel mir auf, dass überall reihenweise Solschenizyns Gulag-Bände standen – alle ungelesen. Das waren die elterlichen Belehrungsgeschenke für ihre linken Söhne und Töchter gewesen, die diese in ihre Bücherregale gestellt und nie angerührt hatten. Ich kaufte mir für ein paar Mark die drei Bände – und war begeistert von diesem Autor und seiner Ironie, mit der er die Schrecken der Arbeitslager schilderte.
Der Humor läßt sich fallen, bis auf das Schwarze unter dem Fingernagel, die Ironie erhebt sich und ist subversiv. Daraufhin las ich auch noch die anderen Bücher von Solschenizyn – sie kosteten alle Nichts.
1963 hatte er in seiner Erzählung „Matrjonas Hof“ den Anfang mit einer neuen, nicht mehr heroisch-sozialistischen „Dorfliteratur“ gemacht, im Jahr darauf wurde er dafür für den Leninpreis vorgeschlagen. Schon in seinem zuvor veröffentlichten Lager-Bericht „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“ war es ihm darum gegangen, dass man gute handwerkliche Arbeit leisten sollte – auch und gerade unter den widrigsten Umständen. In einem weiteren Lager-Bericht ging es dann um eine dreiköpfige Brigade in einem kleinen Gulag-Luxus-Lager bei Moskau, die an einer abhörsicheren Telefonanlage für Stalin arbeitete. Sie bestand aus dem Mathematiker Solschenizyn, dem Sprachwissenschaftler Lew Kopelew und dem Ingenieur Dimitri Panin. Solschenizyn hat ihre intellektuelle Zwangsarbeit in seinem Buch „Der erste Kreis der Hölle“ beschrieben, Kopelew in „Aufbewahren für alle Zeiten“ und Panin in den „Notebooks of Sologdin“. Aus seinem altrussischen Arbeitsbegriff folgte für Solschenizyn später: „Es geht nicht darum, immer mehr zu verdienen, sondern immer weniger zum Leben zu brauchen.“
Nachdem Solschenizyn 1970 den Nobelpreis für Literatur bekommen hatte, geriet ein Jahr später sogar sein auf viele Bände angelegtes „Rotes Rad“ über den 1. Weltkrieg und die Revolution auf die Spiegel-Bestsellerliste. Auch die ersten drei dieser Bände las ich mit Begeisterung. Als die Sowjetunion aufgelöst wurde und die DDR verschwand, stellte der Verlag leider die Übersetzung des vierten Band ein. Und Solschenizyn stellte die weitere Arbeit am „Roten Rad“ angeblich „aus Altersgründen“ ein.
Wegen des im Ausland veröffentlichten „Archipel Gulag“ war er 1974 ausgewiesen worden. Zunächst fand er Aufnahme bei Heinrich Böll. Über mehrere Stationen ließ er sich schließlich in Vermont nieder. 1994 kehrte er nach Russland zurück. Ab seinem Aufenthalt in den USA wurde er in seinen Reden und Schriften immer reaktionärer und nationalistischer. 1995 bekam er ein eigenes Fernsehmagazin, das jedoch wegen schwindender Popularität bald wieder eingestellt wurde. 1999 übte er zu meiner Freude Kritik am Einsatz der NATO in Jugoslawien: „Unter den Augen der Menschheit ist man dabei, ein großartiges europäisches Land zu zerstören, und die zivilisierten Regierungen applaudieren“.
Solschenizyn traf sich mehrmals mit Putin und nach seinem Tod 2008 suchte seine zweite Frau die Nähe des Präsidenten. Der Moskauer Verlag „Wremja“ bringt derzeit das auf 30 Bände angelegte Gesamtwerk Solschenizyns heraus.
.

.

.
Sexualisierung
Eine US-Studie ermittelte: Wenn man gesund bleiben will, sollte man mindestens 18 mal im Monat vögeln („Sex haben“). Hierzulande veröffentlichte die AOK einen Artikel mit der Überschrift „Darum ist regelmäßiger Sex gesund“. Er mindert „Schlafstörungen, Stress, Schmerzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Prostatakrebs und steigert die Fruchtbarkeit“.
Die Zeitschrift „Focus“ versuchte dagegen nachzuweisen, dass Vögeln auch ungesund sein kann. Die Tantralehrerin Regina Heckert zählte 10 Situationen auf, „in denen Sex krank machen kann“: Machtkampf um Sex/ Orgasmen vortäuschen/ Zu viel „schnellen Sex“ in Swingerclubs den Männern zuliebe, läßt Frauen „schließlich jede sexuelle Aktivität verweigern“/ Leistungsdruck im Bett/ Männer die nächtelang im Internet sexuelle Kicks suchen, lassen bei ihrer vernachlässigten Partnerin „Wut“ aufkommen/ Heimlich außerhalb der Beziehung neue Lust suchen, läßt Schuldgefühle, Stress und Angst entdeckt zu werden, aufkommen/ Sexuelle Gewalt/ Reibungsschmerzen nach dem Sex läßt die Lust verschwinden.
Auf „aerzteblatt.de wurde 2020 eine Umfrage-Studie „Gesundheit und Sexualität in Deutschland“ veröffentlicht, in der es um „Geschlechtsspezifische Effekte“ geht. Danach sind dickleibige Frauen „sexuell weniger aktiv als normalgewichtige“. Und Frauen, die ziemlich viel Alkohol trinken und/oder rauchen, sind sexuell aktiver als abstinente Nichtraucherinnen. Hinzugefügt sei, dass auch attraktive Frauen und Männer sexuell aktiver sind als nicht so attraktive. Dabei tut sich laut Susan Sontag ein Paradox auf: „Schön zu sein macht einen einzigartig, außergewöhnlich. Aber schön zu sein bedeutet auch, einer Norm oder Regel zu entsprechen.“
Weil „Schönsein“ sich erst einmal auf einen visuellen Eindruck bezieht, muß man etwas für sein Äußeres tun. Der Ästhetikprofessor Peter Sloterdijk entdeckte „im Fitness-Studio ein Plakat mit einer auf dem Rücken liegenden Frau, die ‚Fit mich!‘ ruft.“ Er beobachtete auf dem Campus der Harvard-Universität: „Um halb sieben am Morgen ist das Fitness-Studio schon voll von Trainierenden, die sich selbst antreiben, wie Akteure, die noch Größeres vorhaben.“ Die Jogger, Schwimmer und an Geräten Trainierenden sind laut Sloterdijk „Berufsevolutionäre“, denn sie gehen darwinistisch angeregt vom „Survival of the Fittest“ aus, also dass nur der Fitteste im Geschlechter- und Daseinskampf überlebt, d.h. erfolgreich ist.
Über das Fitnesstraining hinaus gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, die Attraktivität zu steigern: In den Clips von Facebook und TikTok führen täglich Dutzende junge Frauen ihr vermeintlich verführerisches Aussehen vor, dass sie mit aufgespritzen Lippen, vergrößerten Brüsten und Hintern, sowie mit Tätowierungen, künstlichen Fingernägeln und knappsten Bikinis erreichten. Das alles kostet ein Vermögen, es ist eine Investition in Schönheit, die man deswegen auch zeigen muß, d.h. mit der man für sich wirbt. Die israelische Soziologin Eva Illouz hat sich in mehreren Büchern über diese Formen des Aufbrezelns ausgelassen, eins heißt „Wa(h)re Gefühle“.
Der Sozialphilosoph Ulrich Sonnemann sprach von „Okulartyrannis“ in einer Gesellschaft, die laut dem Filmemacher Harun Farocki „vollständig auf ihr Abbild hin organisiert ist“. Die „plastisch“ Verschönerten sind „neuzeitliche Monaden“, die „auf sich selbst mit den Blicken der anderen sehen“, sich also „als Gesehene sehen“, meint Jürgen Manthey (in: „Wenn Blicke zeugen könnten“ 1983). Die “Baywatch”-Schauspielerin Pamela Anderson schreibt in ihrer Autobiographie: “Meine Brüste hatten eine fabelhafte Karriere, ich bin einfach immer nur mitgetrottet.”
Derzeit werben in den Clip-Serien der sozialen Medien Transsexuelle – gefilmt in den Rotlichtbezirken Bangkogs sowie in US-Fitnessclubs – für sich. Die „BZ“ machte neulich mit der Schlagzeile auf: „So viele Geschlechter kennen Berliner Clubs“ – nämlich „über 50“. Wobei es allein für „Transpersonen 26 Kategorien“ gibt. Die Zahlen stammten aus dem Club „Münze“ am Molkenmarkt, für den man Tickets im Vorverkauf erwerben und dazu ein „Benutzerprofil“ auf Englisch anlegen muß. Noch vor Inkrafttreten des neuen Selbstbestimmungsgesetzes haben in Berlin 1200 Menschen beantragt, ihr Geschlecht und ihren Vornamen behördlich ändern zu lassen; 117 sind es in Augsburg.
Mit der globalen LGBTQ+-Bewegung (Lesbian/ Gay/ Bisexual/ Transgender/ Queer/ Sich anders sexuell Identifizierende) könnte diese mit Glück (d.h. wenn sie sich nicht sofort kapitalistisch verwerten läßt) das Primat des weißen hollywoodesquen Schönheitsideals aufbrechen – in eine zunehmende Zahl („+“ ) neuer Schönheitsideale. Leider sind alle LGBTQ+-Erscheinungen sexuell ausgeprägt, insofern noch „repressiv entsublimiert“ (Marcuse). „Die Sphäre der Sexualität ist kaum noch von der Sphäre der Produktion zu unterscheiden,” heißt es in dem Essay „Was ist sexuelles Kapital?” von Eva Illouz und Dana Kaplan.
.

.

.
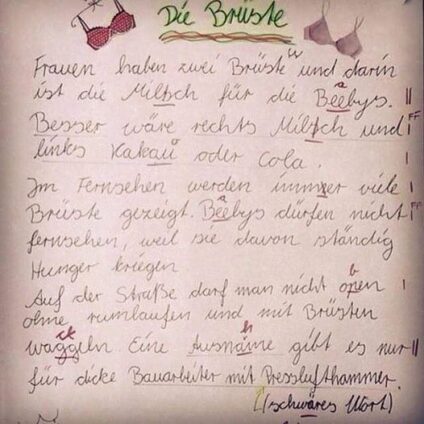
.
Neosexuell werden?
Die Prostitution war einmal der verfemte Teil der gezähmten weiblichen Sexualität in Ehe und Familie. Mit der Auflösung der selben und der Ausbeutung auch noch der mütterlichsten Fähigkeiten, wie „emotionale, kommunikative und soziale Kompetenzen“, wird inzwischen jedem angeraten: „Sie müssen sich besser verkaufen!“ Für viele Frauen (aber auch Männer) bedeutet dies, buchstäblich ihre Haut zu Markte zu tragen, zur Not sogar das eine oder andere Organ.
Indem so die Prostitution sich ebenfalls globalisiert und auch räumlich mobilisiert, wird sie nahezu ununterscheidbar von anderen prekären Beschäftigungen – und umgekehrt. Dazu trägt nicht zuletzt auch die ungeheure Medienproliferation bei, mit der selbst die Mitwirkung in einem Pornofilm glamourös geworden ist: Der erste Pornoweltstar Linda Lovelace (Deep Throat) mußte noch von seinem Zuhälter/Regisseur gezwungen werden, öffentlich zu behaupten, es habe ihr Spaß gemacht, aber schon Debbie Harry (Blondie) nahm man es ab, dass es „Fun“ sei, fürs Ficken auch noch bezahlt zu werden, ebenso später Paris Hilton.
„Die Pornographie seit den Neunzigerjahren hat dagegen ihre eigene politische Ökonomie zum Inhalt. Der pornographische Diskurs verwirft den weiblichen Körper nicht mehr (um ihn in einem seltsamen Jenseits, dem Pornotopia der Literatur wie des ‚Rotlichtmilieus‘ und allen ihren Romantisierungen, zu restaurieren), er fügt ihn vielmehr in den Mainstream ein…Pornographie ist die letzte große Illusion der Teilhabe der unnützen Menschen am System,“ meint Georg Seeßlen, der die „alte ‚Elendsprostitution‘ – vorwiegend in der Form der sexuellen Ausbeutung der proletarischen Frau durch den bürgerlichen Mann oder der kolonialisierten Frau durch den kolonialistischen Mann“ – nur noch für einen „Störfaktor“ hält in der Entwicklung der globalen Prostitution, „die den Wert des ‚fuckable‘ Menschen nicht durch institutionellen Zwang, sondern durch Marktkonkurrenz bestimmt“.
Seeßlen vermutet, dass die neue pornographische Sexualität, die auch den Krieg und die Folter „genußvoll“ mit einschließt, auf folgende Kernaussage hinausläuft: „Dein Körper gehört dir, nicht wie ein geistiges oder historisches Eigentum, sondern wie ein Auto oder ein Bankkonto. Er gehört dir wie Waren im Kreislauf, du kannst ihn verkaufen, vermieten, drauf sitzenbleiben, ihm Mehrwert abtrotzen oder ihn verspekulieren. Je neosexueller du bist, desto weniger kannst du Heimat in ihm haben, aber desto mehr Profit kannst du ihm entnehmen.“ Im Grunde ist bereits die gesamte (US-)Kulturindustrie ein einziges „Body-Shaping“, wie die New York Times anläßlich der Oscar-Verleihung vermutete: Mit chemischen, pharmazeutischen und chirurgischen Mitteln sozusagen „jung und attraktiv bleiben“, um sich den eigenen Warenwert zu erhalten bzw. zu steigern.
Auf sich selbst bezogen hat das die Bestsellerautorin Sophie Passmann in ihrem Buch „Pick Me Girls“ (2023) beschrieben: „Girls“, die alles tun, um begehrenswert zu sein und zu bleiben: „Der männliche Blick ist die höchste Währung“, meint die Autorin. Sie ließ sich tätowieren, dann die Augenringe mit Hyaluron unterspritzen und anschließend die Lippen aufspritzen sowie einige Fettpolster absaugen. Auf eine Brustvergrößerung mit Silikon-Implantaten, wie sie von Hollywood-Schauspielerinnen verlangt wird, verzichtete die Radiomoderatorin, die 320.000 „Follower:innen“ hat.
Silikon war ursprünglich ein Werkstoff, der vom US-Militär zu elektrischen Isolierung verwendet wurde. „In der Geschichte der Schönheitschirurgie wird Silikon direkt mit Sex verbunden. Das Material sei zunächst an japanischen Prostituierten verwendet worden, die es sich injizieren ließen, um damit dem Wunsch US-amerikanischer Soldaten nach großen Brüsten entgegenzukommen. In der Literatur dazu ist etwas verklausuliert die Rede davon, dass die Silikoninjektionen später als Schwarzmarktangebot an US-amerikanische Frauen ‚in der Unterhaltungsindustrie‘ vermarktet worden seien. Artikel aus dezidiert feministischer Perspektive sprechen von ‚sex slavery‘, schreibt Anja Zimmermann, Mitherausgeberin der „Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur (FKW), in ihrem Buch „Brust – Geschichte eines politischen Körperteils“ (2023).
Im selben Jahr veröffentlichte die marxistische Philosophin Theodora Becker ihre Dissertation unter dem Titel „Dialektik der Hure – Von der ‚Prostitution‘ zur ‚Sex-Arbeit‘“. Sie argumentiert weitgehend historisch und geht davon aus, dass die Prostitution in der bürgerlichen Gesellschaft ein unlösbarer Widerspruch ist: Die Männer brauchen sie einerseits, aber andererseits sind die sie ausübenden Frauen verächtlich, tendenziell betrügerisch. Dass es in der Frauenbewegung schon seit langem Bestrebungen gibt, die Prostituierten als „Sex-Arbeiterinnen“ (Sozialhygienikerinnen) quasi zu rehabilitieren, findet sie ihrerseits verachtenswert. Ihr neoromantisches Ideal läuft eher auf das Gegenteil hinaus: auf die „Hure“ als Künstlerin.
.

.

.
Leben
Für das Leben ist eigentlich die Biologie zuständig, insofern sie die Lehre oder Wissenschaft vom Leben ist, aber sie wurde inzwischen in Physik und Chemie aufgelöst. „Das Leben lebt nicht,“ klagte Theodor W. Adorno im amerikanischen Exil (in: „Minima Moralia“ 1951). Er dachte dabei an das entfremdete Leben. An das, was Marx im Kapitalismus wahrnahm, dessen „ungeheure Warenansammlung“ ein „sachliches Verhältnis zu Personen“ und ein „gesellschaftliches Verhältnis der Sachen“ hervorbringt.
Der in Deutschland gebliebene Dichter Gottfried Benn schimpfte über die Reduktion des Lebens: „Was fruchtbar ist, allein ist wahr – das legen sie sich so aus, die Eierstöcke sind die größten Philosophen.“ Nicht die Eierstöcke, aber die Gentechnik hatte der Philosoph Vilem Flusser im Blick, als er meinte: „Alle Kunst ist bisher bloß Vorkunst. Die wahre Kunst beginnt mit der Gentechnik, wenn diese in der Lage ist, reproduktive Werke zu schaffen,“ also Kunstwerke, die sich aus sich heraus vermehren können.
Bevor man sich über die Reproduktionsfähigkeit Gedanken macht, müßte man jedoch erst einmal wissen, was „das Leben“ ausmacht. Ab 1907 diskutierte man dazu den „Élan Vital“ des Philosophen Henri Bergson. Bald war der „Vitalismus“ laut Wikipedia ein Sammelbezeichnung, für Lehren, die als Grundlage alles Lebendigen eine Lebenskraft oder einen besonderen „Lebensstoff“ als eigenständiges Prinzip, annahmen. Aber der „Stoff“ ließ sich nicht finden.
1944 versuchte sich der Physiker Erwin Schrödinger in seinem Buch „Was ist Leben“ erneut an der Frage, wobei er sich auf „die lebende Zelle“ konzentrierte. Er diskutierte sie im Hinblick auf „Probleme der Vererbung, der Natur des Gens (als ein aperiodischer Kristall), der Mutation, der Stabilität lebender Systeme im Licht des Entropieprinzips und ob das Leben auf physikalischen Gesetzen beruht oder eine Eigengesetzlichkeit hat,“ wie es in einer Zusammenfassung seines Buches heißt.
2021 veröffentlichte der Biochemiker Paul Nurse erneut ein Buch mit dem Titel „Was ist Leben“ und hatte dafür ebenfalls fünf Antworten parat: „die Zelle, das Gen, Evolution durch natürliche Selektion, das Leben als Chemie und das Leben als Information.. Nurse erhielt 2001 den Nobelpreis für seine Forschung über die Zellteilung und -reifung. Ich las sein Buch und warf es in die Ecke: Es enthält nichts, was seit 50 und mehr Jahren über den Lehrstoff für Biologiestudenten im ersten Semester hinausgeht. Und ich kann es nicht mehr hören: Evolution qua Mutation und Selektion. Es gibt hunderte ernsthafte Biologen, die das längst als viel zu grobschlächtig erkannt haben, ähnlich ist es mit der völlig überbewerteten Rolle der Gene im Lebensprozeß.
Im Buch „Epigenetik“ (2009) des Biologen Bernhard Kegel heißt es: Man hätte den Begriff des „Gen“, der gerade hundert Jahre alt wurde, gebührend feiern sollen, „denn ob dieser Begriff seinen nächsten runden Geburtstag noch erleben wird, ist fraglich“: Das „genzentrische Weltbild“ war allzu simpel. „Selbst Craig Venter, der vor wenigen Jahren mit seinen Sequenzierrobotern an vorderster Front der biomedizinischen Forschung stand, muss heute eingestehen: ‚Im Rückblick waren unsere damaligen Annahmen über die Funktionsweise des Genoms dermaßen naiv, dass es fast peinlich ist‘. ‚Wir müssen blind gewesen sein‘, seufzte der Entwicklungsgenetiker Timothy Bestor angesichts eines ganzen ‚Universums‘ ungeahnter und unerwarteter Phänomene. Über Vererbung und Evolution muss neu und intensiv nachgedacht werden’.“
Dieses Eingeständnis verdankt sich nicht zuletzt der Endosymbiontentheorie der US-Mikrobiologin Lynn Margulis, deren Buch „Die andere Evolution“ 1999 neu veröffentlicht wurde. Sie schreibt: „Mutationen sind äußerst selten und meist schädlich. Die Evolution kommt vor allem durch Symbiosen zustande.“ Die Symbioseforschung, die in Russland begann, ist schon über 140 Jahre alt. Bekannt wurde sie zunächst durch einige Flechtenforscher (Flechten bestehen aus einer Alge, einem Pilz und einer Bakterie) und dann durch Kropotkins Werk „Die gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt“ (1902). Aber die Symbiosen wurden von den geharnischten Darwinisten immer wieder als Ausnahmen begriffen, und sogar – in der DDR z.B. – völlig abgelehnt. Die meist männlichen Biologen fokussierten sich auf die „Konkurrenz“ innerhalb und zwischen den Arten. Aber seit dem Hochkommen der feministischen Biologinnen vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo eine neue Symbiose entdeckt wird. Im Bremer Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie gibt es um die Symbioseforscherin Nicole Dubilier einen ganzen Forschungsbereich über Symbiosen.
Dass das Leben mit winzigen einzelligen Algen begann, die andere marine Lebewesen inkorporierten – bis so komplexe Organismen wie Pflanzen und Tiere daraus hervorgingen, ist mittlerweile fast unbestritten, zumal wir selbst ja zu einem großen Teil aus Bakterien, Pilzen und Viren bestehen. Aber „das Leben“ in ihnen allen ist damit immer noch nicht klar. Was jedoch die ganzen Darwinisten, die Schrödinger- und Nurse-Follower angeht, da gilt der Seufzer des Essayisten Erich Heller (in: „Enterbter Geist“ 1981): „So demokratisch sind wir in unseren Denkgewohnheiten geworden, dass wir bereit sind, ein Plebiszit von Tatsachen über die Wahrheit entscheiden zu lassen.“
.

.
„Das Leben“
Indem ausgehend von den USA „das Leben“ als „Code“ am Beispiel der Viren und mithilfe von Kybernetik und Informationswissenschaften im Rahmen der amerikanischen Kriegsforschung begriffen, d.h. „geknackt“ wurde, konstituierte sich nach und nach fast weltweit eine Molekularbiologie, für die „lebendige Entitäten“ wie (programmierte) Computer funktionieren. Während umgekehrt unsere Computer von immer mehr (deprogrammierenden) Viren überfallen werden. Dergestalt wurden Mensch und Maschine wesensgleich; ihre Austauschbarkeit war gegen Ende des Zweiten Weltkriegs nahezu besiegelt. „Die neue Semiotik wurde in den neuen Bedeutungsregimen des industriell-militärisch-akademischen Komplexes und der Kultur des Kalten Krieges formuliert“, schreibt die Wissenschaftshistorikerin Lilly Kay.
Ab 1970 forschte der Neurobiologe Humberto Maturana an Heinz von Foersters „Biological Computer Laboratory“ in den USA. Von dort aus gab er den „Artificial Intelligence-Forschern“ zu bedenken, sie „ahmten biologische Phänomene nach. Wenn man (aber) biologische Phänomene nachahmt und dabei nicht zwischen den Phänomenen und seiner Beschreibung unterscheidet, dann ahmt man am Ende die Beschreibung des Phänomens nach.“ Seine Überlegungen gipfelten 1975 in dem Buch „Autopoietic Systems“.
Diesen Begriff – Autopoiesis – griff der Marxist Robert Kurz auf, um damit die bisherige „reale Selbstzweckbewegung der permanenten Verwandlung von Arbeit in Geld“ zu beschreiben, die zur bloßen Erscheinung von etwas anderem degradiert wird, „nämlich der autopoietischen Bewegung des entkoppelten Finanzkapitals und seiner creatio ex nihilo in der Zirkulation von Eigentumstiteln“. Dieser „potenzierten Verkehrung von Wesen und Erscheinung“ entspricht laut Kurz auch faktisch einer Verkehrung von materieller Produktion und Wertform als Geldform: „Nicht mehr die Realakkumulation trägt einen Finanzüberbau, sondern das Recycling von substanzloser Geldform generiert zunehmend überhaupt erst materielle Produktion, indem die Gewinne aus den Preisbewegungen der Eigentumstitel als Kaufkraft reale Güter nachfragen.“
Mit der Verselbständigung des Finanzkapitals wird die materielle Produktion“ zu einem „Nebeneffekt“, von dem jedoch „das Wohl und Wehe von Betrieben und Regionen abhängt, die nicht aus ihrem ‚Standort‘ aussteigen können, so wenig wie ein Mensch aus seinem Körper ‚aussteigen‘ kann“. Kurz spricht von einer „Finanzblasenökonomie der Globalisierung“ – als Folge eines großen Strukturumbruchs am Ende der fordistischen industriellen Ära, der seitdem immer mehr Arbeitslose und an der Peripherie sogar Zusammenbrüche von ganzen Nationalökonomien hervorrief.
„Die Ursache besteht eindeutig darin, dass in der dritten industriellen Revolution der Mikroelektronik der Effekt der ‚Freisetzung‘ von Arbeitskraft die für die neuen Technologien notwendige Anwendung zusätzlicher Arbeitskraft nicht nur weit übertrifft, sondern erstmals in der kapitalistischen Gesellschaft auch die Produktion des ‚relativen Mehrwerts‘ aushebelt. Die ‚Entsubstantialisierung‘ des Kapitals tritt damit in ein historisches Reifestadium.“
Nur scheinbar geriert es sich dabei neokolonialistisch, in Wirklichkeit streift es alle einstigen Territorialisierungen und Raumbeherrschungswünsche ab. So wie es der Philosoph Emmanuel Lévinas nach dem ersten bemannten Weltraumflug noch glückhaft empfand: „Mit Gagarin wurde endgültig das Privileg der Verwurzelung und des Exils beseitigt“. Seitdem gäbe es keine „Heimat“ mehr. Nach Auflösung der Sowjetunion gab einer der letzten MIR-Kosmonauten jedoch bereits zu bedenken: „Wir haben unser Hauptproblem nicht gelöst. Wir können in den Weltraum fliegen, dort arbeiten und wieder zurückkehren, aber wir haben keine natürliche menschliche Betätigung im Weltraum – im Zustand der Schwerelosigkeit – gefunden. Bis jetzt haben wir keine produktive Tätigkeit dort oben entwickeln können. Ich empfinde das als persönliches Versagen.“
Ähnlich geht es nun den Global Playern und ihren Topmanagern, nur dass sie dies als Befreiung ansehen: „Wir sind keine japanische Firma. Wir sind ein globales Unternehmen, das seinen Sitz nur aus historischen Gründen in Japan hat,“ beteuert der Sony-Präsident und ein BASF-Manager meint: „Wir haben zwar einen gesellschaftlichen Auftrag, weil wir hier unsere Wurzeln haben und weil wir uns – auch – als deutsche Staatsbürger sehen. Aber wir haben den Patriotismus ein bißchen übertrieben.“ Der BMW-Chef gab bereits Anfang der Neunzigerjahre unumwunden zu: „Wir sind gezwungen, unsere betriebswirtschaftlichen Probleme zu Lasten der Volkswirtschaft zu lösen“. Inzwischen transnationalisieren sich selbst schon kleine mittelständische Betriebe, indem sie immer mehr Bereiche und Funktionen in Billiglohnländer verlegen. Robert Kurz spricht von einer zunehmenden „Gesellschaftsunfähigkeit des Kapitalismus“ und kritisiert in diesem Zusammenhang den Philosophen Peter Sloterdijk, der gegenüber dem „Globalen“ und seiner Barbarisierung der Verhältnisse für einen „Wohlfühlraum“ von Privilegierten plädiert: einen „Lokalismus“, der den „Existentialismus reformuliert“.
.

.

.
Schöner Sterben
Das scheint hierzulande ein echtes Anliegen der Bevölkerung zu sein, denn im Internet findet man zu den Stichworten „Schöner Sterben“ und „Gutes Sterben“ 340.000 Suchergebnisse. Es gibt einen im Altersheim spielenden „Tatort“-Krimi“: „Schöner Sterben“ und einen Krimi mit dem Titel „Schöner sterben auf Sylt“. Auf „deutschlandfunk.de“ heißt es: „Forscher untersuchen, wie sich die Vorstellung vom Tod gewandelt hat und was ‚gutes Sterben‘ ist.“ In den Hospizen und Sterbekliniken bemüht man sich angeblich praktisch darum.
Auch bei Aufführungen von „Madame Butterfly“ in der Wiener Staatsoper und von Verdis Oper „Troubador“ in Stuttgart ging es laut Kritik um „schöner Sterben“. Eigentlich geht es in fast allen Opern darum, vor allem wenn es sich um Frauen handelt, die am Ende sterben: z.B. in „Tosca“, „La Traviata“, „Carmen“, „Aida“, „Turandot“, „Lucia de Lamamour“, „Tristan und Isolde“ und „Othello“.
Derzeit läuft in den Kinos der Film „The Room Next Door“ von Pedro Almodóvar. Er besteht fast nur aus Dialogen – zwischen zwei Frauen (gespielt von Julianne Moore und Tilda Swinton). Letztere in einer schönen Doppelrolle als Mutter und Tochter. Dazu mußte sie als Mutter jedoch erst einmal sterben – an Krebs, fast schon eine Modekrankheit der Überdomestizierten.
Was in diesem Filmfall noch einmal sichtbar wird, denn es geht darum, wie man als Angehörige der oberen Mittelschicht noch schöner an Krebs sterben kann, wenn man auch seinen Tod (mittels einer Giftpille) selbst bestimmt und für seinen letzten Lebensabschnitt eine gute Freundin hat, die einem Beistand leistet und das in einer „traumhaft schönen Villa im Wald“, wo die Freundin sich neben der zum Sterben bereiten Krebskranken im „Room Next Door“ einquartiert. Die Erkrankte läßt in ihrem Zimmer die Tür auf. Wenn sie die Pille genommen hat und stirbt, macht sie ihre Tür zu, so dass die Freundin bescheid weiß und ihr der Anblick der Toten erspart bleibt. Alles in diesem Film, in dem der Krebs im Mittelpunkt und die Personen um ihn herum voller Mitgefühl zart und klug, sind, handelt vom „Schöner Sterben“ – von Almodóvar genauso inszeniert wie Sterbeforscher sich das „Gute Sterben“ vorstellen, nämlich in voller „Autonomie und Selbstbestimmung“.
Wie inzwischen jeder Deutsche weiß, rüsten wir uns derzeit erneut für einen großen Krieg, der noch einmal gegen „die Russen“ geht: „Jeder Schuß ein Russ“ – und natürlich auch umgekehrt. Deswegen kommt die deutsche Kriegspropaganda auch nicht drumherum, dass dabei massenhaft tote Deutsche anfallen würden/werden. Schon jetzt müssen alle Soldaten vor ihrem Einsatz in „Krisengebieten“ ihr Testament machen. Ihre psychische Betreuung übernehmen tradtionell die Militärseelsorger.
Neben der Bundeswehr-Zeitschrift „Y“ (aktuell mit dem Beitrag „Wie TikTokt die Bundeswehr“) und dem Verbandsmagazin „Bundeswehr Journal“ („Zukunftsvision: Flugzeugträger unter europäischer Flagge“ und „Frauen in der Bundeswehr: Quote noch immer nicht erreicht“), die sich eher um das Bewußtsein und Wohlbefinden der gemeinen Soldaten „kümmern“, gibt es noch das online-magazin „katholische-militaerseelsorge.de“ und das „JS – Die evangelische Zeitschrift für junge Soldaten und Soldatinnen“. In der ersteren geht es u.a. darum „Den Ängsten einen Ort [zu] geben“. Zu diesem Thema referierte die Soziologin Dr. Hilke Rebenstorf eine „Studie des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr“.
Die wichtigste Erkenntnis daraus: „Die Militärseelsorge findet ungemein hohen Zuspruch unter den Soldaten, nämlich zu 91 Prozent. Mehr als die Hälfte der Soldaten und Soldatinnen hat die Angebote der Militärseelsorge schon in Anspruch genommen, insgesamt 75 Prozent der Befragten bewerten ihre persönlichen Erfahrungen mit Militärseelsorgern positiv. Die absolute Verschwiegenheitspflicht der Militärseelsorgenden ist für die Befragten von zentraler Bedeutung. Auch deren Unabhängigkeit und ihre Stellung außerhalb der militärischen Hierarchie sind entscheidend.“
Aus der noch unveröffentlichten Studie geht also vor allem hervor, dass die Seelsorger beiderlei Konfessionen schon im Vorfeld des neuen großen Krieges, so er denn kommt, um mehr Einfluß, Personal, Gelder und Geltung „ringen“, denn: Sie sind für die für Deutschland notfalls zum Sterben bereiten Menschen in Uniform besonders wichtig wichtig.
Die evangelische „JS“ (Nr. 11/2024) macht sich dazu schon auf dem Cover Gedanken: „Leben mit dem Tod“ steht dort auf dem Foto einer blonden jungen Frau im olivgrünen T-Shirt, die melancholisch guckt, denn : „Ihr Vater war Soldat und starb in Mali. Tochter Kimberly führt seine Mission auf ihre Art fort“. Soll wohl heißen, dass nun auch sie bereit ist, für Deutschland zu sterben, denn ein Held ist einer, der nicht überlebt hat – und einen „süßeren Tod“ (auch ein Filmtitel) gibt es angeblich nicht.
.

.

.

.
Flösse bauen
„Das Alter spielt keine Rolle, außer beim Käse,“ sagte sie, als er an der Reihe war, bedient zu werden und ihre wiederholte Aufforderung, 14 Euro 86 zu zahlen, mit der Bemerkung quittiert hatte: „Ich habe Sie gerade nicht gehört, ich werde wohl alt“. Sie hatte einen weißen Kittel an, in dem sie aussah wie eine Zahnärztin, vor allem mit ihrer hellblauen Mundschutzmaske. Die Schriftstellerin A.L.Kennedy spricht von einer „Käseärztin“.
Da er der letzte in der Reihe gewesen war, redeten sie weiter miteinander, zunächst über Weichkäse, einkaufsbezogen, dann übers Wetter und über Urlaubstage am Meer, während er das Eingekaufte einpackte. Man könne noch baden, meinte sie und blickte ihn mit strahlenden Augen an: Hinreißend, er versuchte sie sich im Badeanzug vorzustellen. Das lenkte ihn ab, so dass er vergaß, worüber sie weiter geredet hatten.
Als ein neuer Kunde kam, verabschiedete er sich, aber wenig später traf er sie vor der Einkaufspassage wieder, sie hatte Feierabend. Er lud sie in ein Café ein. „Warum nicht,“ sagte sie. Dort war er dann so fasziniert von ihrem Lachen und ihrer Mimik, dass er wieder kaum registrierte, über was sie sich eigentlich unterhielten. Bevor sie sich verabschiedeten, fragte er sie, ob er ihr seine Telefonnummer geben dürfe, „ja, warum nicht“ sagte sie wieder, etwas ironisch diesmal. Er schrieb ihr die Nummer auf den Kassenbon. Vielleicht könnten sie sich noch einmal treffen und sich dazu telefonisch verabreden. Sie nickte und zog zu seiner Überraschung eine Visitenkarte aus ihrer Tasche. Sie hieß Elvira Schmied und bezeichnete sich darauf tatsächlich als Käsefachverkäuferin.
Am Samstag rief er sie an und fragte, ob sie mit ihm zum Essen in ein Restaurant gehen würde. Nein, sie hatte bereits anderes vor. Er war verunsichert: Vielleicht fand sie ihn nicht attraktiv genug, zu alt…Aber am darauffolgenden Tag rief sie umgekehrt ihn an und lud ihn zu sich nach Hause ein, in ihre kleine Wohnung, sie hätte gekocht. Sie aßen in der Küche. Sie zeigte ihm dann ihr Wohn- und Schlafzimmer. Es lag dort nur eine große Matraze. „Mein Floß,“ sagte sie.
Das kannte er, eine alte Freundin hatte eine Art Hochbett besessen, dass sie ihr Floß nannte. Er war zweieinhalb Tage auf ihrem Floß geblieben, dann mußten sie sich wieder ihren Pflichten der Welt gegenüber stellen. Mist! Nie mehr dieses Floß verlassen! Nur noch sich lieben, höchstens noch rauchen, trinken, essen, schlafen…
Nach einem Kaffee, als er die Käsefachverkäuferin verließ und auf den Bus wartete, fiel ihm ein, dass am Tag des Milizionärs im sowjetischen Radio immer das Lied „Auf dem kleinen Floß“ gesungen wurde. Ob das heute immer noch so war? Es handelte davon, dass nur ein solches Floß uns durch alle Irrungen und Wirrungen des Lebens bringen kann, ein Floß – als Inbegriff der Liebe – und einer schönen Reise zu zweit.
Er hatte auch noch andere Erinnerungen an ein Floß. In der Schule hatten die Lehrer einmal eine dünne Broschüre verteilt. Darin ging es um zwei Jugendliche, die sich mehrere Benzinfässer zusammengebunden hatten und dieses Floß an der Elbe zu Wasser ließen. Die Strömung trug sie immer weiter – bis in die Nordsee, die sie dann verschluckte.
2020 hatte er an einer Journalistenreise zu einem schwedischen Gebirgsfluß teilgenommen. Am Flughafen Oslo stieg die Gruppe in einen Kleinbus um, der sie nach Mittelschweden brachte. Der Platz am Fluß war ein ehemaliges Lager von Flößern, das jetzt dem Tourismus diente. Die Journalisten sollten dort ein Floß bauen und damit ein paar Kilometer flußabwärts treiben. Die eine Hälfte der Journalisten mußte ins Wasser gehen und die andere Hälfte ihnen Baumstämme hinrollen, die dann im Wasser zusammengebunden wurden. Drei Lagen Stämme. Dann nahmen alle darauf Platz, die Reiseleiterin hatte Nudelsalat und Kaffee dabei. Das Floß war langsam und er war hungrig. Von seinem Nudelsalat hatte er aber neun Erben übrig gelassen, die er ins Wasser werfen wollte, aber die Reiseleiterin sagte: „Nein, die kommen in die Biotonne“. Die sind hier aber öko, dachte er.
Nach zwei Stunden gingen sie in einer Bucht an Land, wo für die Taue, das Geschirr und die neun Erbsen Kisten und Abfallcontainer standen. Sie bauten das Floß auseinander und wurden dann wieder von einem Kleinbus abgeholt, der sie am Fluß entlang und am Lager der Flößer vorbei in ein Hotel brachte. Für den Floßauf– und –abbau und die kurze Floßfahrt hatten sie sieben Stunden gebraucht. Die Busfahrt dauerte dagegen nur 20 Minuten. Was für ein Irrsinn, dachte er. Am nächsten Tag ging es wieder zurück zum Flughafen der norwegischen Hauptstadt, ein weiterer Irrsinn. Auf dem Rückflug las er in der FAZ, dass es auch eine „Floß GmbH“ gäbe, eine westdeutsche Unternehmensberatungsfirma für „IT-Security“.
.
.
.
Bewegtes Leben
Neulich stieß ich auf einem Friedhof in Neukölln auf einen Grabstein, der dem dort „Ruhenden“ – einem Bäckermeister – ein „bewegtes Leben“ bescheinigte. War sein Leben deswegen so bewegt, weil er auf vielen Bahnhöfen „Backshops“ eröffnet hatte und dazu ständig unterwegs gewesen war? Mir fielen dazu bloß zwei Merksätze von Adorno ein: „Das Leben lebt nicht!“ und „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“. Könnte man demnach bei dem zu Lebzeiten so umtriebigen Bäckermeister von einer „Falschen Bewegung“ ausgehen?
Ich will mich nicht über ihn lustig machen. Ist mir doch noch die schöne „Rede an das Volk“ eines kommunistischen Bäckermeisters aus Darmstadt in Erinnerung, der damit einen Wettbewerb des Hessischen Rundfunks gewann – als beste „Rede an das Volk“. Damals gefiel uns auch noch die Rede eines reichen Justitiars aus dem Taunus, die sich um zwei Schlüsselbegriffe drehte: um „Kreatibilililität“ und „Individualililität“, wie er sie nannte. Er gewann keinen Preis damit.
„Falsche Bewegung“, so hieß 1975 ein Film von Wim Wenders, in dem dieser aus Goethes doppeltem Bildungsroman „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ und „Wanderjahre“ einen „Road-Movie“ machte. Wer „Wanderjahre“ einlegt, muß sich natürlich „bewegen“. Das habe ich auch mal gemacht, indem ich bei verschiedenen Bauern arbeitete und mich dabei von Nord- nach Süddeutschland „bewegte“, später noch mal vom Brennerpass in die Toskana. Danach sprach ich auch von „Lehr- und Wanderjahren“. Später, d.h. im November 1989, habe ich meinen Arsch noch einmal hoch gekriegt und bin mit einer Freundin täglich von Kreuzberg nach Saarmund in eine LPG gefahren, wo wir in der Rinder-Vormast eingesetzt wurden – und bis nach den Märzwahlen blieben.
Schon 1975 wollte ich in einer LPG arbeiten, als das nicht ging, fragte ich in der kubanischen Botschaft nach, ob ich in einer ihrer berühmten Rinderzuchtanlagen arbeiten könnte, was ebenfalls nicht ging, und dann in der sowjetischen Botschaft, ob ich in einer Kolchose arbeiten könne. Ja, wurde mir gesagt, aber ich müßte eine Landwirtschaftslehre nachweisen und bräuchte eine Empfehlung vom Bauernverband. Beides konnte ich nicht beibringen, aber meine diesbezüglichen Bemühungen hatten mich bereits ganz schön „bewegt“, denn ich lebte damals in Bremen und die kubanische Botschaft war in Ostberlin, wo ich mich auch schon wegen einer Arbeit in einer LPG hinbewegt hatte, und die sowjetische Botschaft befand sich bei Bad Godesberg am Rolandseck. 1989 fragten wir den LPG-Vorsitzenden direkt. Der ersuchte daraufhin den Rat des Kreises um eine Arbeitserlaubnis für uns, aber der Rat konnte oder wollte das nicht mehr entscheiden.
Heutzutage werden einem ja selbst die freiwilligen Handlungen (Bewegungen) aufgezwungen, aber das ist natürlich nichts gegen die mit unsicheren kleinen Booten nach Europa flüchtenden Menschen aus Afrika und dem Nahen Osten, obwohl es ihnen ebenfalls um Arbeit geht. Noch extremer war es für die „von Land zu Land gejagten Flüchtlinge aus aller Herren Länder,“ schreibt Hannah Arendt über die von den Deutschen verfolgten Juden: Einst gab es „Weltbürger“, nun habe man es mit „Weltreisenden wider Willen“ zu tun.
Den Bootsflüchtlingen geht es um „Bleiberecht“, die Philosophin Eva von Redecker hat ein Buch mit dem Titel „Bleibefreiheit“ (2023) veröffentlicht. Damit will sie das andauernde Wegfahren (von Lehrern in den Schulferien z.B.) kritisieren: „Wir reduzieren Freiheit oft auf ein geometrisches Verständnis als Bewegung im Raum“.
Gerade lese ich ein „Gleichnis für einen Planeten in Aufruhr: Der Fluch der Muskatnuss“ (2023) von Amitav Gosh. Darin geht es um „Terraforming“ – beginnend mit den Sklavenplantagen und den Siedlerkolonien bis heute, wobei noch immer „Landgrabbing“ zwecks Nutzung stattfindet, was die Erde inzwischen buchstäblich „umgeformt“ hat.
Von den ersten großen Segelschiffen mit Kanonen zu den Gewürzinseln und den transatlantischen Sklavenschiffen über die Stückgutfrachter und Öltanker bis zu den modernen Container-, Fischfang-, Kriegs- und Kreuzfahrt-Schiffen findet eine gigantische Bewegung von Menschen und Waren statt. Nicht zu vergessen die ganzen Fortbewegungsmittel zu Lande und in der Luft. Goshs „Essay“ läuft auf eine Ökologie hinaus, die antikolonialistisch-indisch geschärft ist und zudem von Sympathie mit dem Denken der Indigenen und Afrikanern in den beiden Amerikas getragen wird. Auch ein Bewegt-Sein oder -Werden. Hin zu einer weniger materialistischen (zerstörerischen) Einstellung gegenüber den Lebewesen, Bergen, Flüssen und Meeren. Aber es ist eine Bewegung im Geiste – während des Corona“-Lockdowns in New York.
Anders der afroamerikanische Publizist Howard W. French, der für sein umfangreiches Buch „Afrika und die Entstehung der modernen Welt“ (2023) alle Orte auf mehreren Kontinenten aufgesucht hat, die einst für den Transport und die Arbeit der Sklaven von Bedeutung waren. Ihnen ein „bewegtes Leben“ zu bescheinigen, wäre allerdings zynisch, denn dazu braucht es einen gewissen Willen.
.
.
.
.
Plündern
Es gibt Plünderungen von oben und von unten. Die von oben sind häufiger und weiter verbreitet. Der „Zeit“-Reporter Navid Kermani berichtet in seinem Reisebuch „In die andere Richtung jetzt“ (2024) von ostafrikanischen Ländern, in denen es beide Formen des Plünderns gab und gibt. In Grand Comore, der Hauptinsel der seit 1974 unabhängigen Komoren, notierte er: „Die Stimmung ist am Boden, gerade dieser Tage sind Protesten gegen die Zentralregierung aufgeflammt, Krawalle, Plünderungen.“
Auf Madagaskar, einst ebenfalls eine französische Kolonie, erwähnt er dagegen eine Plüdngerung von oben: Der Staat das „ist eine Elite, die von der Kolonialherrschaft das Plündern übernommen hat. Eigentlich wäre Madagaskar ein reiches Land, es hat Vanille, Mineralien, Gold, Saphir, es hat phantastische Nationalparks, endlose Strände, die größte Artenvielfalt der Welt. Noch Ende der Sechzigerjahre waren die Menschen hoffnungsfroh.“ Einige gesellschaftliche Bereiche „entwickelten sich für nachkoloniale Verhältnisse ziemlich gut, allerdings waren da noch kaum Bodenschätze entdeckt, von denen eine verschwindende Minderheit um so ungenierter lebt.“
Ähnliches schreibt die junge Biologin Rebecca Gehrig in ihrem Erfahrungsbericht „Der Ruf der Lemuren“ (2024) über Madagaskar: „Die Franzosen ließen in vielen Bereichen eine ausgebrannte Insel zurück, die Regierung machte nach Ausrufung der Unabhängigkeit 1960 gerade so weiter. Nur eine Spur korrupter. Eine kleine Elite bereichert sich auf Kosten der Bevölkerung. Der Ausverkauf ging munter weiter – und geht immer weiter.“ 90 Prozent des Waldes sind bereits vernichtet. Gehrig traf drei Vietnamesen, die dort waren, um eine Schiffsladung Edelhölzer in ihr Land zu bringen, wo sie zu Möbeln verarbeitet werden. Im Süden Madagaskars brach 2021 die erste von der UNO ausgerufene „klimabedingte Hungersnot“ aus. Während Gehrigs Tour durch einige Nationalparks, in denen sie sich von den „Guides“ die Tier- und Pflanzenwelt zeigen ließ, brach in einigen Regionen der Insel die Lungen- und Beulenpest aus. Das erinnert an das alte Seemannslied „Wir lagen vor Madagaskar/ und hatten die Pest an Bord“, das immer für eine Übertreibung gehalten wurde. Nicht nur die Herrschenden bis runter zu den Polizisten plündern das Land aus, auch die verarmte Bevölkerung: Durch Abholzung der Wälder, Wilderei und Überfischung des Meeres.
In den Frontbereichen des Krieges in der Ostukraine plündern russischen und ukrainische Soldaten, aber auch die nicht geflüchteten Bewohner verlassene Häuser.
Nachdem die Sowjetunion sich aufgelöst hatte, gab es eine Hungerrevolte auf Kuba. Ein Kubaner erzählte Landolf Scherzer (in: „Buenos Dias, Kuba – Reise durch ein Land im Umbruch“ 2018): „Die Menschen schmissen mit Steinen die Fenster der leeren Geschäfte, der leeren Magazine und der Villen ein und stahlen, was essbar war. Überall lagen Steine und Scherben auf der Strasse. es wäre vielleicht zum Aufruhr gekommen. Aber dann stand Fidel auf einem LKW vor den Wütenden und schrie: Ich bin hier, um mir bei euch meine Portion Steine abzuholen. Also werft! Und keiner schmiss.“
In Falko Hennigs erstes Buch „Alles nur geklaut“ (1999) las ich, dass sein Vater Sportlehrer in Ludwigsfelde war und ständig irgendetwas aus der Schule nach Hause schleppte. Seine Frau bekam irgendwann Angst, er beruhigte sie aber – mit den Worten: „Ach was, Honecker hat doch selbst gesagt, dass wir noch viel mehr aus unseren Betrieben rausholen können.“
In New York kam es 1965 und 1977 zu zwei „Black-Outs“ (Stromausfällen). Der erste bewirkte neun Monate später einen Babyboom, der zweite führte zu Plünderungen durch die Unter- und die Mittelschicht. Erstere konzentrierte sich auf Fernseher und ähnlich große Dinge. Letztere plünderte Schmuck- und Uhrenläden aus. Die Preziosen versteckten sie am Körper, so dass die Polizei sie als Unbeteiligte davonkommen ließ, während die Ersteren fast alle verhaftet wurden.
In Westberlin wurde während der „1.Mai-Randale“ in Kreuzberg eine „bullenfreie Zone“ erkämpft, in der ein „Bolle“-Supermarkt geplündert und dann angesteckt wurde.
Während des Bürgerkriegs in Indonesien sah ich in Djakarta wie ein alter Mann aus einem Laden mühsam ein Motorrad auf die Straße schleppte, wo er es dann anzündete.
Die Armen plündern meist aus Not, die Reichen aus „Gier“, wie ein armer Fischer gegenüber Kermani meinte. Selbst von den „Nothilfen“ aus dem Ausland greift die Elite noch 20 bis 30 Prozent ab. Der „Zeit“-Reporter erklärt: „Vor allem bricht mir den Bodenschätzen der ungeschriebene Vertrag zwischen Regierenden und Regierten zusammen, weil der Staat nicht auf Besteuerung angewiesen ist, um sich zu finanzieren, und damit auch nicht auf die Zustimmung des Volks.“
.

.

.
Plündern – ein Brief an Luise
Ich würde Plünderungen weder für dystopisch noch für utopisch halten, sondern für eine Normalität, sie sind seit Jahrhunderten immer wieder vorgekommen.
Während des Bürgerkriegs in Indonesien, wo ich damals in Djakarta war, wurde z.B. von einem alten Mann ein Geschäft mit Motorrädern geplündert. Er schleppte diese Maschinen schwitzend auf die Strasse und zündete sie an – die Verbrennung fand ich verblüffend, die Plünderung selbst dagegen nur allzu verständlich. Ebenso wie das Ausplündern der Sommerhäuser von reichen Deutschen in der Toskana, was bis zum Diebstahl der (kupfernen) Regenrinnen ging.
In Indonesien haben übrigens die Bäuerinnen Golfplätze besetzt und gleich mit dem Anlegen von Gemüsebeeten begonnen.
Plündern ist meistens ja wohl nur eine Tat in der Not oder eine kleine Besitzübertragung von Dingen, d.h. von reich zu arm. Ein eigenmächtiger Ausgleich. So wie ja auch der Beschiss von reichen Touristen, die man wandelnde Geldbörsen nennt, in den armen Ländern eine Kompensation für Ungerechtigkeit ist.
Im Übrigen wurden und werden ja auch gerne „abgewickelte“ Fabriken von Plünderern aufgesucht, um noch dieses oder jenes Brauchbare da rauszuholen, bevor es auf dem Müll landet – die Plünderer bringen das Zeug zu „Sero“ oder ähnlichen Einrichtungen oder ins Ausland, wo es dringend gebraucht wird – von einer Schraube oder einem Elektromotor bis zu einem halben Fließband oder Kabel und Rohre.
Eine Schweinebauer, bei dem ich gearbeitet hatte, hat mal mit mir zusammen einen pleite gegangenen Heidehof, den der reichste, recht Getreidehändler, der schon viele Höfe in Europa besaß, gekauft, um ih nostalgisch aufzumotzen. Der Bauer war mal Betriebsverwalter bei ihm gewesen und er wußte, dass der Getreidehändler die modernen Selbstfütterungsautomaten nicht brauchte, deswegen sind wir da hingefahren mit Traktor und Anhänger und haben sie alle abgebaut – die waren mindestens 100.000 DM wert. Man kann es Diebstahl nennen, aber auch Plünderung, was juristisch allerdings keinen Unterschied macht.
Nachdem die Sowjetunion sich aufgelöst hat gab es eine Hungersnot auf Kuba. Ein Kubaner erzählte Landolf Scherzer (in: „Buenos Dias, Kuba – Reise durch ein Land im Umbruch“ 2018):
„Der Hunger in Havanna wurde damals, als Kuba ganz allein auf sich gestellt war, immer schlimmer. Die Menschen schmissen mit Steinen die Fenster der leeren Geschäfte, der leeren Magazine und der Villen ein und stahlen, was essbar war. Überall lagen Steine und Scherben auf der Strasse. es wäre vielleicht zum Aufruhr gekommen. Aber dann stand Fidel auf einem LKW vor den Wütenden und schrie: Ich bin hier, um mir bei euch meine Portion Steine abzuholen. Also werft! Und keiner schmiss.“
Wieso sagst Du übrigens, „letztlich geschieht das wahrscheinlich in Stadien“? Was kann man denn in Stadien denn groß plündern oder meinst Du, dass die Plünderer so wie in Chile die Linken in Stadien konzentriert werden?“
In New York wußten die Plünderer und auch die Nichtplünderer ja, dass der Stromausfall beseitigt werden würde. Sie glaubten also an eine schnelle Wiederherstellung „der alten Ordnung“, es war sicher mehr als eine Hoffnung, aber sie hofften, dass sie nach der Wiederherstellung der elektrischen Versorgung ein besseres Fernsehbild zu Hause hätten oder endlich einen Plattenspieler mit einem anständigen Verstärker.
Das kleine Beispiel aus Havanna eben zeigt meiner Meinung nach, dass die Plünderer 1. im Sozialismus lebten und nicht unbedingt den Kapitalismus wieder zurück haben wollten, und dass sie 2. glaubten, hofften, dass Fidel es schon schaffen werde, die Versorgung wieder zu gewährleisten, was er ja auch einigermaßen geschafft hat. Daran beteiligt war mindestens die Hälfte der Bevölkerung, weswegen man Kuba heute auch das Land der Erfinder nennt, u.a haben sie das „Urban Gardening“ erfunden, die Einrichter des „Prizessinnengartens“ am Moritzplatz und nun in Neukölln auf einem aufgegebenen Friedhof haben sich in Havanna das „Urban Gardening“ abgekuckt. Aber das ist nur ein Beispiel, im o.e. Buch von Landolf Scherzer werden weitere Erfindungen erwähnt, oft sind es ja ganz kleine und manchmal geradezu geniale.
Die westdeutsche „Bauernzeitung“ gibt es in jedem Bundesland extra, darin befinden sich regelmäßig auch sehr schöne Erfindungen von Bauern, wobei diese dann meist von Nord nach Süd in den übrigen Bauernzeitungen übernommen werden, ausgehend von der Bauernzeitung Niedersachsen.
Noch eine Frage: Kennst Du die nicht mehr existierende „Nichtkommerzielle Landwirtschaft“ – den „Karlshof“? Das war auch so eine kleine Erfindung, ein linkes Projekt auf dem Land, das auf die Mitarbeit der an Kartoffeln interessierten Stadtlinken angewiesen war.
Außerdem war die Sowjetunion, sowie auch Polen und die DDR geradezu ein Paradies wenn nicht der Plünderer dann der Leute, die staatliches Eigentum stahlen – Volkseigentum, das ihnen ja sowieso gehörte, nominell.
Ich erinnere mich an Falko Hennigs erstes, sehr mutiges Buch „Alles nur geklaut“ (1999), darin las ich, dass sein Vater Sportlehrer in Ludwigsfelde war und ständig irgendetwas aus einem Wirkungsbereich nach Hause schleppte. Seine Frau bekam irgendwann Angst, er beruhigte sie aber – mit den Worten: „Ach was, Honecker hat doch selbst gesagt, dass wir noch viel mehr aus unseren Betrieben rausholen können.“
Das gilt auch in der taz, die geringe Löhne zahlt, aber die Mitarbeiter holen dafür viel raus aus dem Betrieb, ohne schlechtes Gewissen. Die Liste der hier geklauten Dinge ist lang.
Auch der Leiter der Westberliner gelben Gewerkschaft der Angestellten hat ständig was aus seinem Büro und aus den Büros seiner Mitarbeiter nach Hause geschleppt. Und auch seine Frau, eine Tschechin, fand das nicht lustig.
Übrigens sind auch die vielen begrünten Baumscheiben eine Entwendung/Privatisierung der Nutzung von Staatsbesitz. Die Bezirksämter gingen anfangs noch dagegen vor, aber dann wurden das so viele, dass sie die Baumscheibenbegrünung der Anwohner und Gewerbetreibenden unterstützten.
Grundsätzlich gilt aber natürlich der utopische Weg der Selbstorganisation von Kollektiven, Dörfern, Hochhaus-Bewohnern etc., wie in deinem Buch entfaltet, als der bessere, sinnvollere und weiterreichende Weg zur Einkommensnivellierung.
Dazu fällt mir noch die Kritik eines Griechen, etwa 200 Jahre nach Durchsetzung der Demokratie in Athen.
Diese allgemeine “Gleichheit vor dem Gesetz” (isonomia) bezeichnete bereits Diodoros aus Agyrion im 1. Jhd.v.Chr. als falsch, halbherzig, da sie ohne “Gleichheit des Eigentums” (isomoiria) durchgesetzt wurde.
.

.

.
Durchcomputerisierte Welt
Die dritte Industrielle Revolution bereitete sich zur selben Zeit wie die Gründung von IWF und Weltbank am Ende des letzten imperialistischen „Zweiten Weltkriegs“ vor. Dazu fanden zwischen 1946 und 1953 die so genannten „Macy-Konferenzen“ statt, auf denen sich die „technokratische Wissenschaftselite der USA“, darunter viele Emigranten aus Europa, versammelt hatte – um ausgehend von der Waffenlenk-Systemforschung, der Kryptologie, der Experimentalpsychologie und der Informationswissenschaft sowie von Erwin Schrödingers 1943 erschienenem Buch „What is Life?“ Theorie und Praxis der „Circular Causal and Feedback Mechanisms in Biological and Social Systems“ zu diskutieren. Hierzu gehörten u.a. John von Neumann, Norbert Wiener, Claude Shannon, Gregory Bateson und Margret Mead, als Konferenzsekretär fungierte zweitweilig Heinz von Foerster. Im Endeffekt entstand daraus die inzwischen nahezu weltweit durchgesetzte und empirisch fruchtbar gewordene Überzeugung, dass die Gesetze komplexer Systeme unabhängig von dem Stoff, aus dem sie gemacht sind – also auf Tiere, Computer und Volkswirtschaften gleichermaßen zutreffen.
Als einer der ersten Gegner dieses bald immer mehr Wissenschaftsbereiche erfassenden Paradigmenwechsels trat 1953 der Schriftsteller Kurt Vonnegut mit seinem Buch „Das höllische System“ auf, in dem er die Massenarbeitslosigkeit produzierenden Folgen des kybernetischen Denkens bei seiner umfassender Anwendung beschrieb, die Herbert Marcuse dann als „Herrschaft eines technologischen Apriori“ bezeichnete, was der Wiener Philosoph Günters Anders wiederum zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen und Recherchen zur „Antiquiertheit des Menschen“ machte. Diese besteht nach ihm darin, dass spätestens mit dem Koreakrieg (1950-53) die rechnerischen Kalküle alle moralischen Urteile ersetzt haben. Selbst die antifaschistischen Charakteranalysen von Adorno im amerikanischen Exil fanden noch Eingang in die Macy-Konferenzen, indem man auch den „‚Antiautoritären Menschen nach Maß‘ noch zum Ziel der Kybernetik erklärte.
In dem Aufruhr-Szenario, das Vonnegut entwarf – indem er die Militärforschung des „Fathers of Cyborg“ Norbert Wiener und des Mathematikers John von Neumann weiter dachte – geht es um die Folgen der „Maschinisierung von Hand- und Kopfarbeit“, d.h. um die vom Produktionsprozeß freigesetzten Menschenmassen, die überflüssig sind und nur noch die Wahl haben zwischen 1-Dollarjobs in Kommunen und Militärdienst im Ausland, wobei sich beides nicht groß unterscheidet. Theoretisch könnten sie sich auch selbständig machen – „Ich-AGs“ gründen, wie das 1997 in Wisconsin entwickelte „Trial Job“-Modell nach Übernahme durch die rotgrüne Regierung hierzulande heißt, oder „Start-Ups“. „Reparaturwerkstätten, klar! Ich wollte eine aufmachen, als ich arbeitslos geworden bin. Joe, Sam und Alf auch. Wir haben alle geschickte Hände. Für jedes defekte Gerät in der Stadt ein eigener Mechaniker. Gleichzeitig sahnen unsere Frauen als Schneiderinnen ab – für jede Einwohnerin eine eigene Schneiderin.“
Da das nicht geht, bleibt es also dabei: Die Massen werden scheinbeschäftigt und sozial mehr schlecht als recht endversorgt, während eine kleine Elite mit hohem I.Q., vor allem „Ingenieure und Manager“, die Gesellschaft bzw. das, was davon übrig geblieben ist – „Das höllische System“ – weiter perfektioniert. An vorderster Front steht dabei Norbert Wiener. Schon bald sind alle Sicherheitseinrichtungen und -gesetze gegen Sabotage und Terror gerichtet. Trotzdem organisieren sich die unzufriedenen Deklassierten im Untergrund, sie werden von immer mehr „Aussteigern“ unterstützt. Der Autor erwähnt namentlich John von Neumann. Nach Erscheinen des Romans beschwerte sich Norbert Wiener brieflich beim Autor über seine Rolle darin. Die Biologiehistorikerin Lily E. Kay bemerkt dazu in ihrem 2002 auf Deutsch erschienenen „Buch des Lebens“ – über die Entschlüsselung des genetischen Codes: „Wiener scheint den Kern von Vonneguts Roman völlig übersehen zu haben. Er betrachtete ihn als gewöhnliche Science Fiction und kritisierte bloß die Verwendung seines und der von Neumanns Namen darin.“ Vonnegut antwortete Wiener damals: „Das Buch stellt eine Anklage gegen die Wissenschaft dar, so wie sie heute betrieben wird.“
Im Roman geht es dann so weiter, dass die von der fortschreitenden Automatisierung auf die Straße Geworfenen sich organisieren, wobei sie sich an den letzten verzweifelten Revivalaktionen der Sioux im 19. Jahrhundert orientieren: an den Ghost-Dancers, die gefranste westliche Secondhand-Klamotten trugen. Im Roman heißen sie „Geisterhemd-Gesellschaften“ – und irgendwann schlagen sie los, d.h. sie sprengen alle möglichen Regierungsgebäude und Fabriken in die Luft, wobei es ihnen vor allem um den EPICAC-Zentralcomputer in Los Alamos geht. Ihr Aufstand scheitert jedoch. Nicht zuletzt, weil die Massen nur daran interessiert sind, wieder an „ihren“ Maschinen zu arbeiten. Bevor die Rädelsführer hingerichtet werden, sagt einer, von Neumann: „Dies ist nicht das Ende, wissen Sie.“ Leider ging es jedoch erst einmal so weiter, dass heute jeder mindestens einen Handcomputer hat, der ihn trotz Vereinsamung mit der Welt „verbindet“.
.

.

.
Hyphen
„Alles wichtige passiert auf dem Land“ (Gertrude Stein)
Die Berliner Kulturanthropologin Luise Meier veröffentlichte jetzt nach ihrer analytischen Studie „MRX-Maschine“ (2018), in der sie die Marxschen Instrumente versuchsweise auf die Probleme der Gegenwart anwendete, einen halbutopischen Roman: „Hyphen“ (2024). Er spielt in naher Zukunft und beschreibt Selbstorganisationsformen und vernetzte Wirtschaftsweisen, die hier bereits seit einigen Jahrzehnten real existieren, jedoch aufgrund der marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen oft nicht weit kamen. Dem hat Luise Meier nun vorgebeugt, indem sie die „Energieschranke des Kapitals“ (Sandrine Aumercier) derart radikal in Szene setzte, dass das Kapital verschwand, weil die Energieversorgung (Strom, Gas, Öl) zusammengebrochen ist – und mit ihr alle „Top-down“-Institutionen. Diese werden nun aber nicht peu à peu durch „Bottom-up“-Einrichtungen ersetzt. Die lokalen Initiativen verbleiben in der Horizontalen und verdichten sich dort nur – ganz ohne Computerisierung.
Die Menschen – zum Beispiel zwischen Berlin-Marzahn und Rügen – organisieren ihren Alltag also neu und statt sich virtuell zu vernetzen (wie bis zum Zusammenbruch der Energieversorgung), ahmen sie eher Pflanzenwurzeln (Roots) und Pilzhyphen (sic) praktisch nach, die als Verbündete Mykorrhizen bilden. Mit dem vorläufigen Endergebnis: Ein „Großteil…beschreibt sich trotz aller Entbehrungen und traumatischen Erfahrungen, besonders in den ersten Monaten und Jahren, heute als zufriedener als vor 2025“ (dem Jahr des ersten Stromausfalls, der endgültige erfolgte 2027). Diese Zufriedenheit hat laut Luise Meier ihren Grund „eindeutig“ in der „Zunahme von Selbstwirksamkeit oder ‚Sinn‘“ sowie in der „Abnahme von Erfahrungen der Konkurrenz und Isolation“. Und was lernen wir daraus?
1. kann man bei der Lektüre von „Hyphen“ an die Vielzahl von selbstverwalteten Kollektiven denken, die sich zunächst, nach „68“, auf dem Land (im Westen) ansiedelten und dann, nach der „Wende“, vor allem im menschenausgedünnten Osten. Was hier die Landschaften mit Initiativen und Projekten sprenkelte, wird nun nach dem Zusammenbruch aller alten Gewißheiten und Gewohnheiten quasi flächendeckend zur Notwendigkeit, die unerwartet neue Freiheiten mit sich bringt – während zugleich die massive „Dingwelt“ langsam schrumpft.
2. Wird man eventuell an die derzeitige Konjunktur des indigenen Denkens erinnert, das sich uns zunehmend selbst in Form von Literatur, Theater, Film, Tanz und Musik mitteilt. Obwohl uralt, fast ausgestorben und seit Jahrhunderten schon vom westlich-kolonialen „Fortschritt“ überwunden geglaubt, hat sich dieses immer noch lebendige Denken plötzlich in unser Herz geschlichen und wirkt jetzt sogar in sozialer und ökologischer Hinsicht als vorbildlich. Wenn dieses bei der „Hyphen“-Lektüre nun mitschwingt, dann ist diese Indigenität, dieses laut Claude Lévi-Strauss „wilde Denken“, doch auch hier schon um Einiges älter als seine derzeitige Konjunktur uns weismachen will.
Erwähnt sei nur der sowjetische Polarforscher Sawwa Uspenski, der als Biologe bereits Anfang der Sechzigerjahre das Verhältnis der Tschuktschen und Inuit zu ihren „Ernährern“ (den Robben, Rentieren, Moschusochsen, Walrossen, Walen, Eisbären, Vögeln und Fischen), ihre Ökonomie also, für ökologisch vorbildlich hielt – im Gegensatz zur wenig empathischen dafür jedoch um so enthusiastischeren Ausbeutung der Polarregion durch kommunistische Stoßtrupps. Seltsam nur, dass die dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt geradezu verfallenen Sowjets Uspenski ein derartiges Forschungsergebnis damals durchgehen ließen.
3. Pessimistisch gestimmt gemahnt die „Hyphen“-Lektüre jedoch auch an die unmittelbaren Folgen der zwei großen „Blackouts“ (Stromausfälle) in New York 1965 und 1977. An der Bremer Universität wurden sie 1979 vom Dozenten Gunnar Heinsohn thematisiert und 2012 vom Wiener Autor Marc Elsberg in seinem Technik-Thriller „Blackout – Morgen ist es zu spät“ für das gegenwärtige Europa durchgespielt.
Nach dem ersten „Blackout“ kam es neun Monate später zu einem Babyboom in New York, beim zweiten plünderte die Unterschicht, vorwiegend Afroamerikaner, Geschäfte mit Braunware (Fernseher, Plattenspieler, Verstärker etc.), während die weiße Mittelschicht sich auf die Plünderung von Schmuck- und Uhrenläden konzentrierte. Die ersteren kamen mit ihren klobigen Gegenständen meist nicht weit, sie wurden von der Polizei festgenommen. Letztere versteckten die geklauten Preziosen an ihrem Körper und verließen die Tatorte unbehelligt als bloße „Bystander“.
Etwas anders verlief 1987 die Plünderung eines Supermarkts („Bolle“) in Berlin Kreuzberg, bei der die mehrheitlich aus der Mittelschicht stammenden Jugendlichen und Künstler es primär auf die Alkoholika abgesehen hatten. Um diese sicher nach Hause zu tragen, hatten sie vorher die Polizeikräfte weit genug zurückgeschlagen und sich eine „bullenfreie Zone“ erkämpft“.
Die optimistische halbe Utopie von Luise Meier werden alle, die sich inzwischen in einer Anthropause befinden, mit einer realistischeren Dystopie kontern: Der Zusammenbruch aller hochtechnoiden kapitalistischen Systeme werde dazu führen, dass sich Gangs über Gangs bilden, die plündern, Dinge und Lebensmittel horten, Einrichtungen zerstören, morden und mit Gewalt Herrschaftsansprüche durchsetzen. So wie es jetzt im Kursker Gebiet in Abwesenheit ziviler Ordnungskräfte geschieht, wo Nachbarn und russische sowie ukrainische Soldaten sich die Beute beim Plündern streitig machen. Der Historiker Harald Jähner hat Ähnliches für die Zeit unmittelbar nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Deutschlands 1945 bis 1955 in seinem Buch „Wolfszeit“ (2019) registriert.
Ein weniger dystopischer Realismus wird dagegen nicht den Zusammenbruch der Techno-Systeme ins Kalkül ziehen, sondern seine Wahrnehmung eher auf die seit den Neunzigerjahren schleichende Erosion des Sozialen, verbunden mit der leisen Agonie der Behörden und Dienstleistungsbetriebe richten, die seit den von oben dumpf befohlenen Corona-Maßnahmen epidemisch geworden sind. Anders gesagt: Die hochkomplexen Staaten werden zusehens unregierbarer, weil man es nicht geschafft hat, beim Zusammenbruch des Ostblocks und der Auflösung der Sowjetunion über die zentral-staatliche Planung hinaus zu gehen, sondern zurück zu fallen in idiotisches Privateigentum und eine unbarmherzige Monetarisierung aller Lebensäußerungen (einschließlich die der letzten Nicht-Menschen): Ein Schritt vor und zwei zurück.
Aber auch das läßt sich aus Luise Meiers „Hyphen“ entnehmen, wenn sich drei ihrer Protagonisten angesichts des bisher erreichten solidarischen Zusammenwirkens über Dörfer und Stadtteile hinweg der Gedanke aufdrängt: Es ist „‚wie Kommunismus ohne Strom’, lachte Ersan. ‚Oder Sowjetmacht minus Elektrifizierung‘, trumpfte Marianne auf. „Alle denken bei Gefahren an ‚Fight or Flight‘, aber gerade bei Frauen gibt es auch die Reaktion ‚Tend and befriend‘ – sich Kümmern und Freundschaften knüpfen’, sagte Susanne.“
Genau das habe ich 2006 in der Wüste Gobi erlebt: Nach der „demokratischen Revolution” 1989 und dem Zusammenbruch des Sozialismus wurden alle Kolchosen im Land aufgelöst und jeder Mongole bekam 100 Stück Vieh – egal, ob er als Friseur, Fahrer oder Buchhalter gearbeitet hat. Viele dieser „Ich-AGs“ gaben bald auf – besonders nach den zwei harten Wintern 1999 und 2000, als Millionen Tiere verhungerten. Es waren vor allem Männer, die als neue Nomaden scheiterten. Danach fingen sie als Händler für alles Mögliche an, scheiterten aber an den geschäftstüchtigeren Chinesen, woraufhin sie nur noch deprimiert dasaßen und sich betranken.
Inzwischen gibt es jedoch über 80 Viehzüchter-Kooperativen allein in der Südgobi – alle werden von Frauen geleitet. Und sie wandern wieder mit ihrem Vieh. Die nomadische Wirtschaftsweise ist eine ökologische Notwendigkeit, um Überweidung zu vermeiden, aber die Ökologie reicht inzwischen tiefer.
Eine Viehzüchterin berichtete: „Nach 1990 war jede Familie auf sich selbst gestellt, und sie wanderte so gut wie gar nicht. Das konnte nur durch die Genossenschaften gelöst werden. Das sind Kollektive wie im Sozialismus, aber diesmal bestimmen wir selbst, was zu tun ist. Etwas 2000 Viehzüchter haben sich bisher hier zusammengeschlossen. Schon im ersten Jahr 1999 haben wir das Positive daran gemerkt. Nach sieben Jahren können wir nun sagen, dass es richtig war. Wir haben uns kundig gemacht, wie die negative Entwicklung zustande kam. Die Wilderei hat völlig aufgehört und keine Familie sammelt mehr Feuerholz. Wir wissen heute, wie die Natur zu verbessern ist. Außerdem waren wir drei Mal im Ausland, haben viel gesehen und sind auf neue Ideen gekommen.”
Ein Viehzüchter meinte: „Früher wurde alles von oben organisiert, dann kam plötzlich die Marktwirtschaft. Wir sind die ersten in der Mongolei, die aus dem Dunkeln rausgekommen sind. Unser Beispiel macht inzwischen Schule.“
Eine Viehzüchterin ergänzte: „Es gibt auch große Veränderungen im Verhältnis zwischen Mann und Frau. Die Frauen waren vorher immer nur zu Hause mit Kindern, haben wenig untereinander geredet. Und die Männer waren nicht gut genug ausgebildet, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können, sie haben viel gegessen und getrunken und waren als Händler ohne Erfahrung. Bereits das erste Meeting mit dem Naturschutzprojekt, wo die Idee des Zusammenschließens begründet wurde, hat uns die Augen geöffnet. Seitdem hat es viele Veränderungen in unserem Leben gegeben. Ich bin selbst ein Beispiel dafür: Obwohl eine einfache Viehzüchterin habe ich mich in den letzten Jahren sehr verändert und mein Leben verbessert. Wir sind 35 Familien, 144 Menschen und haben 7000 Tiere. 1999 ging es nur sechs Familien gut, der Rest war arm. Wir hatte keinen Zugang zu Informationen und waren zerstreut.”
Eine andere Viehzüchterin erzählte: „Den Anfang haben fünf Frauen gemacht – sie sind raus aus den Gers [das mongolische Wort für Jurten]. Dann kamen mehr dazu. Wir haben Einfluß auf die Männer genommen. Und mit ganz kleinen Sachen angefangen, uns gegenseitig zu helfen. Das war ein langsamer Prozeß. Wir haben z.B. Zäune gemeinsam repariert, die Weiden von Tierkadavern gesäubert, mit Behörden verhandelt, Kurse im Gemüseanbau für uns organisiert…Dann haben wir in der Kreisstadt für Geld gearbeitet und den armen Familien dafür Vieh gekauft, damit wir alle gleich viel haben. Unser Fähigkeit zu kooperieren hat sich immer mehr verbessert.. Gleichzeitig mußten wir die Balance zwischen Familie und Kollektiv finden.”
Ein alter Viehzüchter wirft schließlich noch ein: „Die Frauen haben die Ideen, die Männer setzen sie um.” Die Frauen lachen, korrigieren ihn aber nicht.
Sage also keiner, dass die Geschichten in Luise Meiers „Hyphen“ bloß ausgedacht sind.
.

.
Klasse
Neuerdings spricht man von „Klassismus“, wenn jemand den Klassenbegriff ins Spiel bringt. Also wenn einer meint, Ressourcen, Güter, Privilegien und Positionen seien nicht zufällig verteilt, sondern weisen „ein systematisches Muster“ auf . Das ist das der Kern dessen, „was man eine Klassengesellschaft nennt“, meint Oliver Nachtwey in einem Nachwort zu E.O.Wrights Buch „Warum Klasse zählt“ (2023), eine US-marxistische Analyse, die nun als „Meilenstein der Klassentheorie“ aus dem 20. Jahrhundert beworben wird.
Im 21. sind es dann zunächst französische Autoren, die erzählen, dass und wie ihre Herkunft aus der Arbeiterklasse es ihnen schwer machte, in der „Pariser Gesellschaft“ Fuß zu fassen. Dies galt vor allem für den Soziologen Didier Eribon und sein überaus erfolgreiches Buch „Rückkehr nach Reims“ (2009, auf Deutsch 2016), dessen Arbeitereltern sich im Laufe der Zeit politisch von links nach rechts orientierten, was gleichzeitig einem allgemeinen „Klassendrift“ entsprach. Auch die französische Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux hat mit gleich mehreren autobiografischen Büchern ihren „Lebensweg vom Arbeiterkind zur Schriftstellerin“ geschildert, wie Wikipedia schreibt. Ihr Vater war jedoch Kneipenbesitzer und ihre Mutter besaß einen kleinen Lebensmittelladen. „Nicht mehr in der Fabrik arbeiten müssen, keinen Chef haben, der dir auf den Wecker geht, sieh Dich nur um, die armen Schweine mit ihren Henkelmännern, die vor ihrem Chef buckeln…“ Sie finanzieren ihrer Tochter Schule und Universität, die wünscht sich jedoch eher, dass sie als Arbeiter in eine Fabrik gehen statt ihre Krüppelexistenz als Selbständige in einem Armenviertel aufrecht zu erhalten.
Ausführlich beschreibt Ernaux das in ihrem 1974 veröffentlichten Buch „Die leeren Schränke“, das erst 2023 auf Deutsch erschien. Hierzulande liest man also quasi das erste Buch zuletzt, was den falschen Eindruck hinterläßt, dass Ernaux sich immer mehr radikalisierte, indem sie in „Die leeren Schränke“ ihren Hass auf ihre ungehobelten Eltern und ihre Scham im Gymnasium angesichts der aus besseren Kreisen stammenden Mitschülerinnen erzählt, während sie jedoch in Wahrheit zunehmend feinsinniger in ihren späteren Büchern über ihre Herkunft urteilt.
Ich hasste etwa zur selben Zeit als Jugendlicher ebenfalls meine Eltern, die Schule und dass ich immer zu wenig Geld hatte – bis ich dank der linken Bewegung ab 1967 nicht mehr so werden wollte wie alle. Ernaux schrieb über ihre Eltern: „Ich sehnte mich nach Diskretion, Zurückhaltung, Taktgefühl. Stattdessen Eile, Exzeß, Dreck, Essengeräusche. Ich hätte sie nicht danach bewerten sollen. Aber für mich [als 15/16jährige] war das der Unterschied.“
Der Soziologe Franz Schultheis schrieb 2020 über sie: „In Frankreich hatte Ernaux parallel zu Bourdieus ‚Die feinen Unterschiede‘ vor fast vier Jahrzehnten eine wahlverwandte und in vielerlei Hinsicht ergänzende literarische Sicht auf die französische Klassengesellschaft entwickelt. Es ist erstaunlich, wie spät man sie im deutschsprachigen Raum entdeckt hat. In den 1980er Jahren, als Bourdieus und Ernaux’ Gesellschaftsanalysen in Frankreich zum Standardrepertoire des intellektuellen Lebens gehörten, feierte die deutsche Mainstream-Soziologie das ‚Ende der Klassengesellschaft‘ und den Fahrstuhl nach oben für alle. Jetzt, fast 4 Jahrzehnte danach, scheint man sich angesichts wachsender gesellschaftlicher Ungleichheiten beim Zugang zu allen Formen an Lebens-Chancen zu besinnen und die Schwerkraft gesellschaftlicher Reproduktionen neu zu entdecken.“
Mitte der 1980er Jahren kam eine „Arte“-Redakteurin von einem „Princeton“-Forschungsaufenthalt in den USA zurück und schwärmte davon, dass jetzt die Arbeiter dort alle Aktien kaufen würden, aus deren Gewinnen sie ihren Kindern das Studium finanzieren. Dass sie das nur können, wenn sie als „Aktionäre“ dazu beitragen, ihre eigenen Arbeitsplätze weg zu rationalisieren, kam ihr nicht in den Sinn.
Etwas später kam dieser neoliberale Idiotentraum auch hier an – indem u.a. der beliebte DDR-Arbeiterdarsteller Manfred Krug Werbung für die Telekom-Aktie machte – und damit im Osten tausende, die ihm gutgläubig folgten, ins Unglück stürzte: Sie verloren ihre Abfindungen, die sie bei der Abwicklung ihrer Betriebe bekommen hatten, als die hochgelobten „T-Aktien“ von 100 auf 10 Euro abstürzten. „Das hat viele Privatanleger traumatisiert“, berichtete die Tagesschau 2021. Deswegen (?) mehren sich nun auch im Deutschen Sprachraum die autobiographischen Berichte von Studierten über ihre Arbeitereltern. Da jedoch gleichzeitig immer weniger Arbeiterkinder studieren können (die Hans-Böckler-Stiftung des DGB spricht von „einem eindeutigen Rückschritt im Bemühen um soziale Chancengleichheit“), ist das Ende dieses neuen literarischen „Klassismus“ wohl „vorprogrammiert“, wie man heute zwar gedankenlos sagt, aber unbeabsichtigterweise damit für einmal richtig liegt.
.

.
Neues zum Klassenbegriff
Der kürzlich verstorbene Wissenssoziologe Bruno Latour und der dänische Soziologe Nikolaj Schultz haben 2022 ein „Memorandum ‚Zur Entstehung einer ökologischen Klasse‘“ veröffentlicht. Sie meinen, die marxistische Definition von Klassen liegt im Verständnis ihrer materiellen Bedingungen. „Will die ökologische Klasse diese Tradition als Erbschaft übernehmen, muß sie diese marxistische Lektion akzeptieren und sich ebenfalls im Verhältnis zu den materiellen Bedingungen ihrer Existenz definieren.“
Zwar bleibt die Analyse in Begriffen dieser ökologischen Klasse materialistisch, „aber sie muss sich anderen Phänomenen als der alleinigen Produktion und der alleinigen Reproduktion ausschließlich der Menschen zuwenden“. Das „Neue Klimaregime“ zwingt sie, sich auch Tieren und Pflanzen bis hin zu den Mikroorganismen im Boden, im Wasser und in der Luft zuzuwenden. Der bisherigen Ökonomie ging es um den Einsatz der Ressourcen zum Zwecke der Produktion. Aber, so fragen sich die beiden Autoren, „existiert auch eine Ökonomie, die in der Lage ist, sich zurück zu wenden in Richtung des Erhalts der Bewohnbarkeitsbedingungen der terrestrischen Welt?“
Anders gesagt: „Man konnte stets auf die Energien bauen, die mit der Losung entfacht wurden ‚Vorwärts!‘ Aus der Sicht des alten Modells klingt die Losung heute dagegen eher wie ‚Alles zurück!‘“ Für die ganzen jungen Klimaaktivisten und klimapolitisch argumentierenden Wissenschaftler mag diese Parole stimmig sein, für die Politiker der demokratischen Parteien ist sie jedoch trotz ihrer Lippenbekenntnisse und Sonntagsreden unannehmbar, denn sie wurden gewählt, um das Wohl der Volkes, mindestens ihrer Wähler, zu mehren. Und nicht, um sie mit immer neuen finanziellen Belastungen zu konfrontieren. Die „mobilisierenden Werte“ waren bislang „Wohlstand, Emanzipation und Freiheit“. Für die beiden sich um die ganze Welt Sorgen machenden Soziologen gibt es „keinen Staat der Ökologisierung: Keine Beamtin, kein Abgeordneter, vermag anzugeben, wie der Wechsel von ‚Wachstum‘ – und dessen damit einhergehenden Elendsformen – zur Prosperität – und den damit verbundenen Opfern – gelingen kann.“ Das kann für sie nur in Form von Basisbewegungen praktisch geschehen, die sie vorerst wie „in einem dichten Nebel“ nur erahnen können.
Laut der „tagesschau“ hat bereits der Wärmepumpenplan des grünen Wirtschaftsministers Habeck der rechten Partei AfD einen „besorgniserregenden“ Aufschwung beschert, wie eine Studie ermittelte. Man kann das auch so wie Latour und Schultz ausdrücken: „Die Zahl getöteter Umweltaktivisten ist heute höher als die der Gewerkschaftler.“ Die beiden Autoren scheinen davon auszugehen, dass sich die Zunahme des Gewichts der „ökologischen Klasse“ in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen an dieser Todesstatistik quasi messen läßt. Ähnlich könnte auch „Die letzte Generation“ argumentieren, wenn sie die Zahl ihrer verhafteten Aktivisten und die zunehmenden Repressionen gegen sie in Anschlag brächte – als Indikator für das Wirksam-Werden ihrer Protestaktionen.
Als der Wissenssoziologe Bruno Latour ,bereits vor Jahren, verkündete: „Es gibt keine ökonomische Utopie mehr, nur noch eine ökologische“, erntete er wenig Widerspruch. Es ist ja auch wahr, dass die Ökologiebewegung – inklusive Parteien, Gesetze, Verordnungen, Forschungsinstitute, Lehrstühle, NGOs, „Fridays for Future“, Naturschutzbeauftragte Umweltbundesamt- und -ministerien – eine enorme „Karriere“ gemacht hat. Der Soziologe Harald Welzer gibt jedoch zu bedenken: Gleichzeitig werde jedes Jahr „ein neues Weltrekordjahr im Material- und Energieverbrauch“ angezeigt.
Auch Latour und Schultz müssen in ihrem „Memorandum“ zugeben: „Seit Längerem sind Beobachterinnen und Beobachter verwundert, dass weder die Gewissheiten noch die Bedrohungen jene Mobilisierung der Massen nach sich ziehen, die angesichts der Dringlichkeit angemessen wäre. Dabei läuten die Alarmglocken schon seit 40 Jahren; seit 20 Jahren schrillen sie in den Ohren aller; und seit dem letzten Jahrzehnt – zumal während des letzten Jahres – hat die Gefahrenlage nach der unmittelbaren Erfahrung von Abermillionen von Menschen die Stufe Rot erreicht.“
Die ökologische Klasse versucht zwar wie die Arbeiterbewegung „den öffentlichen Raum von unten zu füllen, aber sie trat damit zu einem Zeitpunkt an, als „das politische Leben seinen Tiefpunkt erreicht hat“.
Erkennbar daran, dass die Regierungen der westlichen Industriestaaten zwar bei der Corona-Epidemie blitzschnell Medikamente und Testzentren finanzieren konnten (auch wenn dabei Milliarden durch Betrug verloren gingen); wie sie auch beim darauffolgenden Ukrainekrieg blitzschnell Waffenlieferungen, Embargos, neue Energielieferanten, Grenzöffnung für Flüchtlinge, neue Häfen etc. in die Wege leiteten (obwohl auch dabei durch Betrug und Korruption Milliardensummen verschwanden). Aber noch bei der kleinsten – Opfer verlangenden – Klima-Maßnahme kommt nach endlosem Hin und Her nur ein nichtsnutziger Kompromiss zwischen Ökonomie und Ökologie heraus.
.
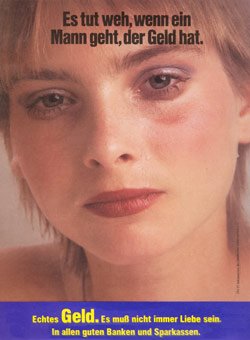
.

.

.
Arbeiterklasse
In der Zeitschrift „konkret“ (10/2024) schreibt Nelli Tügel: „Die Arbeiterklasse galt vielen als verschwunden“, die Marxsche „Kapital“-Analyse gelte nicht mehr, so wurde gesagt, stattdessen ist von „Multitude“, „Unterschicht“, „Subalterne“ und „Prekariat“ die Rede. Seit Didier Eribons „Rückkehr nach Reims“ und ähnlichen Autobiographien auch deutscher Autoren, die sich aus einem Arbeiterhaushalt zu Soziologen oder Schriftstellern hochgearbeitet haben, habe die Arbeiterklasse jedoch ein „begriffliches Comeback“ erlebt. Zumal der Kapitalismus sich ja auch im Kern nicht verändert habe, d.h. „die private Aneignung von Mehrwert“, so dass die „lohnabhängige Klasse“, global gesehen, sogar wächst, „sie ist heute so groß wie noch nie zuvor“. Man müsse deswegen nach wie vor darauf bestehen: „Wer seine Arbeitskraft zu Markte tragen muß, der gehört zur Arbeiterklasse“.
Nicht die Arbeiterklasse ist also verschwunden, sondern nur bestimmte Branchen in einigen Regionen. Sie sind in „Billiglohnländer“ abgewandert. So gab es z.B. in Westberlin eine Spinnerei, die Kunstfaser verarbeitete. Als sich in Chile Pinochet an die Macht putschte und die Stundenlöhne auf umgerechnet 90 Pfennig gesenkt wurden, verlagert man die „Spinne“ sofort nach dort.
Ich arbeitete kurz im „Industriesalon“ in Oberschöneweide, wo man die materiellen Hinterlassenschaften des dortigen Industriegebiets zusammenträgt. Danach besuchte ich einige Industriemuseen. Das Ledermuseum in Offenbach, die Eisenbahn-, Fahrrad-, Textil- oder Luftfahrt-Museen in Bayern und die Musealisierungen der Zechen im Ruhrgebiet, die ähnlich wie die Hafen-Lagerhallen in Bremerhaven zu Event- und Amüsierorten umgestaltet wurden. Daneben hat man die Stollen der Bergarbeiter zu „Besucher-Bergwerken“ erklärt. Überall dominiert der Stolz auf die Produkte und Herstellungsweisen, es waren genaugenommen Ausstellungsorte für deutsche Ingenieurskunst.
Anders in Polen, wo ich (wie in der JW am 24.9. und 1.10. erwähnt) das Bergarbeitermuseum in Kattowitz, das Werftarbeitermuseum in Danzig und das Textilmuseum in Lodz besuchte.
Das Kattowitzer Museum entstand auf dem Gelände der abgewickelten „Zeche Katowice“, es umfasst vier oberirdische und drei unterirdische Stockwerke und nennt sich „Schlesisches Museum“. 1940 wollten die Deutschen schon einmal ein „Schlesisches Museum“ eröffnen. Das fast fertige Gebäude sollte ein „Denkmal des polnisch-jüdischen Hochmuts“ werden, es wurde jedoch laut Wikipedia 1944 „abgebrochen“ und die Exponate zerstreut. Gut möglich, dass einige im 2006 von Westdeutschen eröffneten „Schlesischen Museum“ in Görlitz landeten, das im schönsten Haus der Stadt untergebracht ist.
Die ganze spätgotisch-barocke Altstadt wurde nach der Wende mit Kamelhaarpinseln renoviert und gehört nun westdeutschen Emeritierten. In den Plattenbauten drumherum brüten Neonazis Böses aus. Die Polen im Museumsbeirat vermuteten auch bei der Vertriebenenpräsidentin Erika Steinbach als Beirätin Böses. Es wurde heftig gestritten. Steinbach, die seit 2022 AfD-Politikerin ist, mußte gehen, bekam aber 2021 ein Vertriebenenmuseum in Berlin.
Während das Schlesische Museum in Görlitz nun grob gesagt die im Auftrag von preußischen Adligen und Fabrikbesitzern hergestellten Luxuswaren ausstellt und mit der Vertreibung der Deutschen aus Schlesien endet, behandelt das Schlesische Museum in Kattowitz die industrielle Entwicklung Schlesiens ab 1945, wobei es sich auf den Anteil der Bergarbeiter am Wiederaufbau Polens konzentriert. Ich kam dort mit einem ehemaligen Bergarbeiter ins Gespräch: „Wir sind mit unserem Museum zufrieden,“ meinte er.
Das zweite – ebenso riesige – Museum in Danzig feiert die Tätigkeit der Werftarbeiter und ihren Kampf für die unabhängige Gewerkschaft „Solidarnosc“. Dieses Museum und das in Kattowitz sind keine Industriemuseen, geschweige denn „Industriesalons“, sondern Arbeitermuseen.
Anders das aus einer Textilkunstsammlung hervorgegangene Textilmuseum in der Textilstadt Lodz. Dieses ähnelt den Industriemuseen in Westdeutschland und den vielen Industriemuseen in Ostdeutschland, in denen man aus den „abgewickelten“ Betrieben die materiellen Hinterlassenschaften sammelte. Erwähnt seien hier nur das „Technische Museum der Hutindustrie“ in Guben und das „Nähmaschinenmuseum“ in Wittenberge. Dieses ist ebenfalls der Ingenieurskunst gewidmet, daneben zeigte es vorübergehend aber auch Kunst, und zwar von der Künstlerinnengruppe „Endmoräne“. Auch das ist typisch für die stillgelegten Betriebe: dass sie von Künstlern genutzt werden – bis sich eine neuer Investor zeigt, bis dahin gehören sie meist einer Bank.
.

.
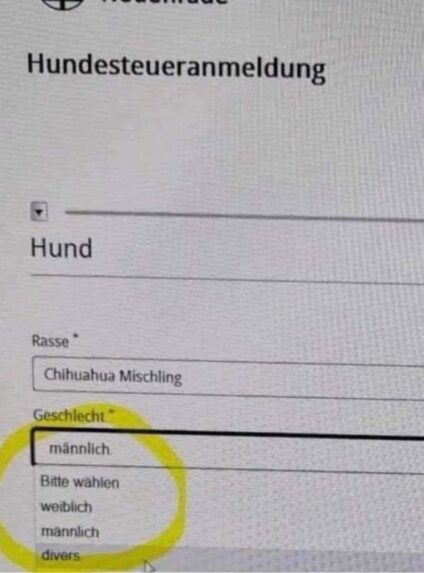
.
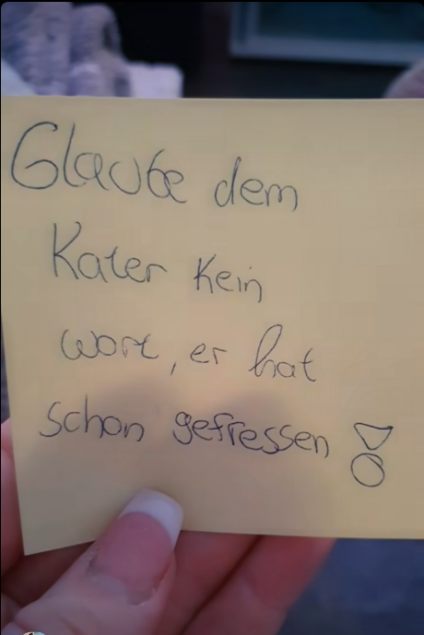
.
Plattmacher-Kapitalismus
Der Kapitalismus hat schon immer, wo er hin(ge)langen konnte, alles platt gemacht, einer seiner Ideologen, Joseph Schumpeter, nannte das eine „schöpferische Zerstörung“. Aber mit dem amerikanischen Internet wird jetzt erneut die „Kacke des Seins“ umgegraben. Der US-Präsident Calvin (!) Coolidge sagte 1925 in einer Rede: „The chief business of the American people is business. They are profoundly concerned with producing, buying, selling, investing and prospering in the world.” Kurz: „The business of America is the business“. Und nun ist erstmalig ein Präsident dort an der Macht, der die Politik nur als Business begreifen kann. Inzwischen heißt dieses „Geschäft“, das weltweit alle historisch entstandenen sozial-ökonomischen Strukturen zerstört: „Plattformkapitalismus“.
Zwar haben einige Leute in Berlin jüngst schon mal einen Verein gegründet, der ein „Museum des Kapitalismus“ (in der Köpenicker Strasse 172) betreibt, aber das war zu voreilig. Der letzte kapitalistische Schrei – „Plattformen“ – ist leider noch lange nicht reif für seine Musealisierung. Im Gegensatz zu den Museen der polnischen Arbeiterklasse, von denen ich zwei – für die Werftarbeiter und für die Bergarbeiter – kürzlich erwähnte. Ein drittes in Lodz, das bereits 1975 gegründete „Zentrale Textilmuseum“ ging aus einem Kunstmuseum hervor und thematisiert nur die Produkte und nicht die Textilarbeiter, dabei hatten im März 1989 4000 Textilarbeiter in Lodz noch gegen die Abwicklung ihrer Fabrik „Portex“ gestreikt und und der Aufstand der schlesischen Weber 1844 wurde damals sofort von Schriftstellern, Philosophen, Journalisten und Künstlern thematisiert, u.a. von Heinrich Heine mit seinem dann in Preußen verbotenen Gedicht „Die armen Weber“ und Gerhart Hauptmann mit einem sozialen Drama: „Die Weber“.
Der „barbarische Manchesterkapitalismus“ von damals könnte aus „heutiger Perspektive“ jedoch „fast ein Sehnsuchtsort sein“, schreibt das „Philosophie Magazin“ 2021 in einem Artikel über „Die neue Macht des Plattformkapitalismus“, in dem „Wertschöpfung mit Daten“ betrieben wird, wobei „die Plattformen nicht auf Märkten operieren, sondern sich selbst als Märkte anbieten“ – z.B. „Uber“ mit seinen weltweiten Taxi- und Lieferdiensten und die Plattform „Amazon“, über die schier alles verkauft wird oder die sozialen Medien wie „Facebook“ und Suchmaschinen wie die des Konzerns „Google“, der heute allwöchentlich eine Firma aufkauft.
Erwähnt seien außerdem die Plattformen „Airbnb“, die Unterkünfte sowie Ferienhäuser vermittelt, und „Booking.com“ für Hotelvermittlungen. Die Besitzer solcher Immobilien müssen für jede Vermittlung eines Gastes zahlen. Sie schimpfen natürlich, wie auch die Buchverlage über Amazon, weil sie so hohe Gebühren dafür zahlen müssen. Ähnlich funktioniert auch die Plattform „eBay“, das 2002 den börsennotierten Onlinedienstleister „PayPal“ („Bezahlfreund“ auf Deutsch) für 1,5. Milliarden Dollar erwarb, über den die meisten „eBay“Kunden ihre Waren bezahlen.
Derzeit wirbt eine neue Plattform auf Berliner U-Bahn-Plakaten in englischer Sprache (!) für Klempner. Die Idee kommt über „Temu“ aus den USA, das für Waren aus China gedacht ist. Man klickt die „Plumber“-Plattform an, sucht sich – etwa wegen eines verstopften Klos – einen Klempner auf einer Liste aus und der muß dann bestimmte Prozente seines Honorars an das Unternehmen abgeben. Er muß kein Handwerker mehr sein, sondern ist einfach ein Selbstständiger (eine Ich-AG) und die Handwerkskammer kann ihn mal.
Als Selbstständiger (Subunternehmer?) ist es schwer, einen Arbeitskampf zu führen. Bereits kurz nach der Wende gab es eine Protestdemonstration von ausgebildeten Ostberliner Kammerjägern gegen die global operierende englische Aktiengesellschaft „Rentokil“, die jeden einstellt, der sich zutraut, mit Ungeziefervernichtungsgiften umzugehen.
Es gibt inzwischen Dutzende Bücher über den „Plattformkapitalismus“. Der finanzökonomisch argumentierende Kulturwissenschaftler Joseph Vogl führte in einem Interview über sein Buch „Kapital und Ressentiment. Eine kurze Theorie der Gegenwart“ (2021) aus: „Plattformunternehmen liefern so etwas wie neue soziale Infrastrukturen. Der vorsorgende Staat soll durch fürsorgliche Unternehmen abgelöst werden. Und die Wertschöpfung wird durch die Besetzung ehemaliger Regierungsaufgaben komplettiert und gesichert.“
Bei vielen Plattformen sind US-Investmentgesellschaften beteiligt, u.a. BlackRock, die ein Vermögen von 10 Billionen Dollar verwaltet (der deutsche Staatshaushalt verfügt „nur“ über 1,3 Billionen). Kürzlich stiegen „BlackRock“ und „Fidelity“ wegen des eskalierenden Ukrainekriegs beim Waffenhersteller „Rheinmetall“ ein. Wie Joseph Vogl gehen sie von einer „neuen Vorkriegszeit“ aus. Das Philosophie Magazin meint: „Solange weder das Internet abgeschaltet noch der Geldverkehr eingestellt wird, bleibt Vogls Kritik des Plattformkapitalismus Pflichtlektüre“.
Aber was tun? „Um irgendwo anzufangen, kann man ja zunächst den Empfehlungen von Digitalexperten gegen ‚Infodemien‘ im Netz folgen: Friktionen erhöhen, Geschwindigkeit reduzieren, Abkühlzeiten einschieben, Pausen verlängern, Rauschen verstärken, Kreisläufe stören, Automatismen unterbrechen, Abschalten,“ rät Joseph Vogl.
.

.

.
Animiert
Man kennt inzwischen die japanischen Manga-Comics, als Film „Anime“ genannt, die mit ihren „Merchandising“-Produkten ganze Hallen auf der Leipziger Buchmesse füllen. Wer sich als Comic-Figur, als „Cosplayer“ kostümiert, hat auf der Messe freien Eintritt. Es gibt aber dezidierte Anweisungen, wie lang z.B. ein Schwert sein darf, aus welchem Material usw.. Die weiblichen Teenager in den Comics haben große Brüste und sind knapp bekleidet. Es gibt sie auch als Anime-Pornos.
Auf dem chinesischen „tik tok“-Kanal treten die Mangamädchen nun real – im Großstadtgetümmel spazieren gehend – auf. „Are they real?“ heißt diese Parade auffälliger junger chinesischer Frauen. Die Frage stellt sich wirklich, denn diese dünnen langbeinigen Teenager in engen Kleidern haben alle enorme Brüste. Es sind verlebendigte Mangamädchen – ihr Lächeln ist sogar noch echter.
Ich erinnere ein Interview mit der Berliner Künstleragentur von Frau Fieting in den Neunzigern, die vor allem Doppelgänger, „Look-Alikes“ managte. Im Neuköllner-Monster Hotel von Eduard Strelinsky („Estrel“) finden regelmäßig „Look-Alike“-Contest statt. Über ihre „Pamela Anderson“-Doppelgängerin erzählte Frau Fieting, dass die ihre Authentizität auch dadurch erreiche, dass sie stets mit einer Fantruppe erscheine: „Die rennen ihr bei Dreharbeiten bis aufs Mädchenklo nach. Außerdem hat sie die selben Hobbys wie die wahre Pamela. Unlängst war sie ganz verzweifelt, weil sich in Hollywood alle Frauen ihre Brüste vergrößern ließen und sie das eigentlich nicht wollte.“ Rosemarie Fieting bestärkte sie darin: „Du wirst Dir doch Deinen schönen Busen nicht kaputt machen“. In den „Reels“ von Facebook zeigen sich jene im Bikini, die sich eine solche Vergrößerung zwecks Attraktivitätssteigerung geleistet haben.
Für den kleinen Geldbeutel tut es neuerdings auch das Aufblasen der Lippen, wenn man die zunehmende Zahl von Frauen mit dicken Lippen für einen Trend hält. Mit Revolax aufgespritzte Lippen kosten zwischen 120 („Normale Technik“) und 200 Euro („Russian Lips“, „Davinci Lips“).
Vorausgegangen ist dem die Mode der „tattos“ und der „tatto“-Künstler, deren Preise nach oben keine Grenze haben. Hinzu kamen dann noch immer mehr Piercing-Möglichkeiten. Neuerdings wird in U-Bahnen für die Entfernung von „tattos“ geworben, was auch nicht billig ist.
Ebenfalls in den Neunzigerjahren hörte ich eine Abiturientin rufen, als ihre Mutter aus dem Bad kam: „Iih, Mutti ist ja behaart!“ Da war also schon das Schamhaar-Entfernungs-Muß bis zu den Teenagern in Grimma durchgedrungen. Auch wenn einer sich tatoolos zeigt, bekommt er zu hören „Was! du hast gar kein tatoo?“ Eine Bekannte überraschte ihren Freund zu seinem Geburtstag mit einer tätowierten Rose auf dem Hintern.
Diese Moden und ähnliche entstehen aus einer nachahmenden Distinktion. Für den Soziologen Gabriel Tarde war die Nachahmung, das, was die Gesellschaft zusammen hält. Mimikry! Man erforscht sie zumeist bei den Tieren: Wenn z.B. ein ungefährliches Tier sich im Aussehen und Verhalten einem gefährlichen anähnelt. Wikipedia nennt die „Mimesis“ Nachahmung, was im Griechischen einst „mittels einer Geste eine Wirkung erzielen“ bedeutete. Als Mimesis bezeichnet man in den Künsten das Prinzip der Nachahmung im Sinne der Poetik von Aristoteles, im Unterschied zur ‚imitati‘“. Von Mimesis spricht man in der Biologie, wenn Tiere oder Pflanzen das Aussehen ihrer Umgebung nachahmen.
Das „Prinzip der Nachahmung“ gilt auch bei den „Look-Alike-Contests“ im Hotel Estrel. Mich interessierte daran zunächst, dass es ein Medienphänomen ist, d.h. die Doppelgänger entstehen wesentlich über die Medienpräsenz der Originale. Seien es die Queen, Clinton, Einstein oder Freddy Mercury. Und natürlich Marilyn Monroe. Eine ihrer Doppelgängerinnen hat sich sogar so wie ihr Vorbild umgebracht. Wenn ihr Vorbild stirbt, müssen ihre Doppelgänger viel Geld für Schönheitsoperationen ausgeben, damit sie so bleiben wie ihr „Star“ war. Eine Zeitlang liebäugelten wir mit der Erklärung dieses psychosozialen Phänomens der Nachahmung, die von dem englischen Botaniker Rupert Sheldrake stammt, der ebenfalls eine Medientheorie dazu entwarf, an der er seit 40 Jahren feilt. Seine „morphogenetische Theorie“ geht von einem „Feld“ aus, das via „morphogenetische Resonanz“ dem Leben Form und Farbe gibt. Es ist eine antigenetische Theorie, die eher eine (esoterische?) Art von Funkwellen favorisiert. „Are they real?“ fragte ich mich. Desungeachtet: Wenn einem einmal die „Nachahmung“ aufstößt – die „Mimikry und „Mimesis“, dann sieht man sie überall am Werk. Bei den Haarfrisuren, den getrimmten Bärten, beim Parfum, den Hochzeitsfeiern und Beerdigungsabläufen. Manchmal kann man sogar sagen, wann dieses oder jenes Detail in Mode oder aus der Mode gekommen ist und bei welcher diese oder jener „stehengeblieben“ ist, auch intellektuell.
.

.
Musealisierung der Arbeiterklasse
Während des Werftarbeiterstreiks auf der Danziger Lenin-Werft 1980-81, aus dem die Solidarnosc-Gewerkschaft hervorging, wurde der Regisseur Andrzej Wajda aufgefordert, einen Film über die Bewegung zu drehen, womit er sofort begann. Die Streikenden hatten 21 Forderungen, die staatliche Zensurbehörde verlangte von Wajdas Film dann 21 Kürzungen. Seine Produzentin riet ihm, die Zensur zu ignorieren – und ihn sogleich, während der Ausrufung des Kriegsrechts in Polen 1981, bei den Filmfestspielen in Cannes einzureichen, wo er mit der „Goldenen Palme“ ausgezeichnet wurde. Der Film hat den Titel „Der Mann aus Eisen“ und beginnt mit den studentischen „März-Unruhen 1968“ und dem „Aufstand der Arbeiter 1970“, deren getötete Kämpfer 1980 mit einem riesigen Denkmal vor dem Tor der Lenin-Werft geehrt wurden.
Der Solidarnosc schlossen sich nach und nach andere gesellschaftliche Gruppierungen an, daneben gab es seit 1976 das von Intellektuellen, u.a. von Jacek Kuron gegründete „Komitee zur Verteidigung der Arbeiter“ (KOR). Kuron wurde enger Mitarbeiter des Arbeiterführers Lech Walesa und nach dem „Systemwechsel“ 1989 Arbeits- und Sozialminister. Der KOR-Gründer Antoni Macierewicz wurde Verteidigungsminister.
Der Kampf gegen die kommunistische polnische Regierung wurde von der katholischen Kirche mitgetragen, vor allem vom Vatikan und dem polnischen Kardinal Karol Wojtyla, der 1978 zum ersten nicht-italienischen Papst gewählt wurde. Als „Johannes Paul II.“ nutzte er die Vatikanbank zur Geldwäsche von Mafia-Vermögen, um die polnische Oppositionsbewegung mit Zigmillionen Dollar zu unterstützen.
1989-90 kam es auch zur Auflösung der DDR und anderer sozialistischer Staaten sowie 1991 zur Auflösung der Sowjetunion, wobei die neoliberalen „Chicago-Boys“ sich zunächst die Ukraine vornahmen. 18 Jahre nach dem triumphalistischen „Mann aus Eisen“ war der sozialistische Ostblock quasi zurückkapitalisiert, die Arbeiterklasse entmachtet und der kommunistische Rocksänger und Baggerfahrer im Lausitzer Braunkohlerevier (heute Vattenfall) Gerhard Gundermann konnte mit einem Film „Das Ende der Eisenzeit“ (1999) verkünden. Der arbeiterliche „Stahlinismus“ wich digitalisierten Dienstleistungsgesellschaften.
Die Lenin-Werft wurde wie viele andere Werften geschlossen, dafür aber 2007 ein riesiges Arbeitermuseum aus rostigem Stahl auf dem Gelände errichtet. Es war politisch derart umstritten, dass ständig seine Direktoren zurücktreten mußten. In diesem „Europäischen Centrum der Solidarnosc“ (ECS) wurde die Geschichte des polnischen Widerstands gegen den Kommunismus multimedial aufs Feinste aufbereitet. Im zweiten Stock befindet sich das „Solidarnosc-Zentralarchiv“ und das Büro von Lech Walesa.
Finanziert wurde das Museum von der EU (mit 51 Mio Euro) und vom Danziger Bürgermeister Bogdan Adamowicz, den man 2019 ermordete. Das ECS wird heute von über einer Million Menschen jährlich besucht. Die Neue Zürcher Zeitung schrieb 2019, dass „Polens Regierung dem Solidarnosc-Museum an den Kragen will“ – und die Zuschüsse um 40% kürzte. Der sozialdemokratische „Vorwärts“ nannte es 2023 einen „Ort demokratischen Denkens und Handelns“.
Ebenfalls 2007 wurden auch die polnischen Bergarbeiter musealisiert: Auf dem Gelände der abgewickelten „Zeche Katowice“ entstand für 100 Mio Euro ein vier oberirdische und drei unterirdische Stockwerke umfassendes „Schlesisches Museum“. Man hat viele Bergwerke in Schlesien touristisch umgenutzt, aber aus dem in Kattowitz wurde eine ganze multimediale „Kulturzone“.
Schlesien war besonders, denn nachdem Preußen das Land im 18. Jahrhundert in drei Kriegen den Österreichern abgenommen hatte, bemächtigten sich die preußischen Adligen der Ländereien und ließen es von Polen bearbeiten. Als sie unter ihren Äckern die Bodenschätze entdeckten, mutierten sie zu Kohlebaronen und ihre Landarbeiter zu Bergarbeitern.
Und nun „verändert sich das Profil Schlesiens erneut: weg von der Bergbau- und Schwerindustrie hin zu Dienstleistungen,“ erklärte die für Investitionen in der Regionalregierung zuständige Izabela Domagala dem Deutschlandfunk 2020. Ich kam einmal im Schlesischen Museum mit einem arbeitslosen Bergarbeiter ins Gespräch: „Wir sind mit unserem Museum zufrieden,“ meinte er. Politisch wurde um die Museumskonzeption heftig gestritten, „so dass mehrere Museumsdirektoren gehen mußten,“ berichtete Deutschlandfunkkultur.
1940 wollten die Deutschen schon einmal ein Schlesisches Museum eröffnen. Das fast fertige Gebäude sollte ein „Denkmal des polnisch-jüdischen Hochmuts“ werden, es wurde jedoch bis 1944 laut Wikipedia „abgebrochen“ und die Exponate zerstreut. Gut möglich, dass einige im 2006 eröffneten „Schlesischen Museum zu Görlitz“ landeten, das im schönsten Haus der Stadt untergebracht ist.
Die ganze spätgotisch-barocke Altstadt wurde nach der Wende mit Kamelhaarpinseln renoviert und gehört nun westdeutschen Emeritierten. In den Plattenbauten drumherum brüten Neonazis Böses aus. Die Polen im Museumsbeirat vermuteten auch bei der Vertriebenenpräsidentin Erika Steinbach als Beirätin Böses. Es wurde heftig gestritten. Steinbach, die seit 2022 AfD-Politikerin ist, mußte gehen, bekam aber 2021 ein Vertriebenenmuseum in Berlin.
Das Museum in Görlitz ist im Wesentlichen mit den Werken deutscher Hochkultur in Schlesien bis 1945 angefüllt. Während das Museum in Kattowitz genaugenommen erst da anfängt, wobei die Kulturschaffenden vor allem polnische Arbeiter waren.
.

.
Gemeinsam Essen
Wenn in Indien jemand stirbt, treffen sich an seinem Todestag seine Freunde und essen gemeinsam seine einstigen Lieblingsspeisen. Bevor sie zulangen, muss jedoch eine Krähe kommen und sich etwas davon nehmen. Normalerweise entdecken diese klugen Vögel jeden noch so kleinen Nahrungsbrocken sofort (ich habe das in Bombay mit Käsestücken getestet). Aber wie es der Zufall will, läßt sich keine dieser allzu oft diebischen Krähen blicken, wenn man mal eine braucht. Für nicht wenige Hindus verkörpern natürlich auch Krähen die Seelen von Verstorbenen. Die Leute, die mir das erzählt haben, waren zwar ungläubige Linke, auf eine Krähe, die sich den ersten Bissen schnappt, warteten sie aber dennoch bei solchen Essen im Gedenken an einen oder eine Tote(n). Auch wenn alles kalt wurde.
Auf Wikipedia heißt es: „Gemeinsames Essen als Ausdruck von Geselligkeit ist im Hinduismus kein verbreitetes Konzept. Gegessen wird alleine, an einem zuvor gereinigten Platz. Speisereste einer anderen Person gelten als in hohem Maße unrein. Diese zu essen, stellt einen Akt der Unterwürfigkeit dar“. Zwar ist das hinduistische Kastensystem aufgeweicht, nicht zuletzt durch Ghandi, der die 4000 Kasten auf vier „Varnas“ (farblich unterschiedene Stände) reduzieren wollte. Am Ende seines Lebens sprach er sich sogar, wie Arundhati Roy in mein „Mein aufrührerisches Herz“ (2023) schreibt, „für die gemeinsame Mahlzeit zwischen den Kasten aus“.
Gleichzeitig verlangte die Reinheit seines „Satyagrahi“ (Ghandis „Strategie der gewaltlosen Durchsetzung des als wahr erkannten“), dass er allen Vergnügen und (sexuellem) Verlangen abschwor. „Sogar Essen bekam sein Fett ab“, heißt es bei Roy, die ihn zitiert: „Essen ist ein so schmutziger Akt wie die Reaktion auf den Ruf der Natur“.
„Sein ganzes Leben lang schrieb Ghandi viel über ‚Latrinenreinigung‘ als religiöse Pflicht. Es schien unwichtig, dass die Menschen im Rest der Welt kein solches Theater um ihre Exkremente machen“. Auf einem Kongreß 1925 hatte Ghandi in seiner Eingangsrede gemeint: „Wenn ich überhaupt eine Stelle suchen würde, dann die eines Bhangi“ – eines städtischen Unberührbaren (auch „Dalit“ genannt), den er zu den „Müllarbeitern“ zählte. „Ich mag den Weg des Dienens, deswegen mag ich den Banghi. Ich habe persönlich nichts dagegen, gemeinsam mit ihm zu essen, aber ich verlange nicht von euch, dass ihr mit ihm esst oder ihn heiratet.“
Als es damals im Bundesstaat Kerala zu „direkten Aktionen von Unberührbaren“ kam, reiste der Kongressführer und Ghandis erster Stellvertreter an. Die „besorgten Hindus aus privilegierten Kasten“ beruhigte er mit den Worten: „Der Mahatmaji will das Kastensystem nicht abschaffen, sondern nur die Unberührbarkeit. Ihr müsst nicht mit ihnen gemeinsam essen. Er will, dass ihr die sogenannten Unberührbaren anseht, wie ihr eine Kuh oder einen Hund oder andere Geschöpfe anseht“.
Die vielen in den Textilfabriken von Bombay arbeitenden Unberührbaren (meist aus Maharashtra stammend) organisierten sich in einer ersten kommunistischen Gewerkschaft. Sie wurden nur in schlecht bezahlten Spinnabteilungen beschäftigt, „weil in den Abteilungen, in denen gewebt wurde, die Arbeiter die Fäden mit dem Mund halten mussten und der Speichel der Unberührbaren als unrein galt“. 1928 rief ihre Gewerkschaft den ersten Streik aus. Der von indischen Unternehmern finanzierte und von amerikanischen Klerikalen als zweiter Jesus gepriesene Ghandi schimpfte: „Hinduistische und muslimische Arbeiter haben sich selbst entehrt und erniedrigt, indem sie den Fabriken fernblieben“.
Mehrmals besuchte Ghandi in Delhi eine Kolonie von Valmiki-Arbeitern. Der Spiegel berichtete 2007 über drei dort arbeitende „Kanalarbeiter“, die seit ihrer Geburt zur Kaste der Valmiki gehören: „den Benachteiligten der indischen Gesellschaft. Seit Jahrhunderten müssen ihre Mitglieder die schmutzigsten und gefährlichsten Arbeiten des Subkontinents übernehmen. In der ständischen Hierarchie – eigentlich gesetzlich abgeschafft – gibt es für sie praktisch keine andere Möglichkeit zu überleben.“
In der Valmiki-Kolonie weigerte sich Ghandi 1946, „mit der Gemeinde zu essen“. Roy zitiert einen Ghandi-Historiker: „Als ein Dalit Ghandi Nüsse gab, verfütterte er sie an seine Ziege und sagte, dass er sie später zu sich nehmen würde, in der Ziegenmilch“. Ghandis Essen bestand aus Nüssen und Körner, „er nahm nichts von den Dalits“.
Während der „Muslimherrschaft“ (im Mogulreich von 1526 bis 1858) war die unterste, schwarze „Varna“ (Diener, Knechte,Tagelöhner) bereits „befreit“ worden. „Nicht nur das, sie erlaubten auch gemeinsames Essen und Eheschließungen mit ihnen“.
Nach der Unabhängigkeit mußte die regierende Kongreßpartei neben den Hinduisten und den „Unberührbaren“ auch die Muslime als dritte große Wählerschaft ansprechen. Das Problem war dabei laut Roy, dass die Muslime „von den Kasten-Hindus auf der Reinheit-Unreinheit-Skala als ‚mleccha‘ – unrein eingestuft wurden; gemeinsames Essen und Trinken war verboten“.
.
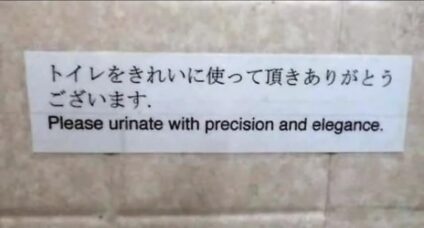
.
Phishing for Compliments (1)
Hallo, Sie haben eine Spende von zwei Millionen US-Dollar (2.000.000 $) gewonnen.
Ich bin Harry H. Stine. Ich bin einfach ein Bauer und ein amerikanischer Milliardär. Ich bin der Gründer und Eigentümer von Stine Seed.
2017 habe ich den Giving Pledge unterzeichnet und mich damit den 154 anderen Milliardären angeschlossen, die versprochen haben, mindestens die Hälfte ihres riesigen Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden.
Sie können auf dieser seriösen Website mehr über das Spendenversprechen lesen:
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Giving_Pledge
Sie können zur Bestätigung auf diesen Websites/Links nachsehen:
Also dachten mein Team und ich, wir könnten Familien nutzen, die Arbeiterklasse und eigene Unternehmen sind eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen und die Auswahl der Gewinner muss unparteiisch und zufällig erfolgen und darf nur auf Glück beruhen.
Einige unserer Ziele sind unten aufgeführt:
Armutsbekämpfung
Flüchtlingshilfe
Katastrophenhilfe
Globale Gesundheit
Bildung
Stärkung von Frauen und Mädchen
Medizinische Forschung
Kunst und Kultur
Strafrechtsreform
Ökologische Nachhaltigkeit
Stärkung bereits bestehender Unternehmen
Ich bin derzeit in den Kategorien Wohltätigkeitsorganisationen, Einzelpersonen und Unternehmen oder Körperschaften, Sie haben also in einer dieser Kategorien gewonnen. Ich mache das aus reiner Herzensgüte und fühle mich verpflichtet, meinen Reichtum mit glücklichen Gewinnern auf der ganzen Welt zu teilen, ohne Vorurteile, ohne Rassendiskriminierung, ohne ethnische Vorurteile. Wir haben viel karitative Arbeit in Afrika und vielen anderen Ländern geleistet. Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen unter:
harryhstinefoundation@outlook.com
Bitte beachten Sie, dass ich diese gute Arbeit ernst nehme. Daher beantworte ich derzeit alle E-Mails persönlich und verwende wie jeder andere eine normale Domain-E-Mail.
Nochmals herzlichen Glückwunsch zu Ihrem großartigen Gewinn der Spende in Höhe von 2.000.000 USD.
Mit freundlichen Grüßen
Harry H. Stine
Hallo, mein Liebster,
Ich möchte, dass du diesen Brief sehr sorgfältig liest, und ich muss mich entschuldigen, dass ich dir diese Nachricht aufgrund der Dringlichkeit dieser Angelegenheit ohne formelle Einleitung per E-Mail geschickt habe. Ich bin froh, dich zu kennen, aber Allah, der Allmächtige, kennt dich besser und weiß, warum er mich an dieser Stelle an dich verwiesen hat. Zunächst habe ich deine E-Mail und Kontaktdaten bei meiner Online-Suche nach einem guten nächsten Angehörigen gesehen, weil ich meinen letzten Wunsch unbedingt verwirklichen wollte, bevor ich bald sterbe.
Ich schreibe Ihnen diese E-Mail mit schweren Tränen in den Augen und großer Trauer im Herzen. Mein Name ist Frau Feyza Olcay Ýbrahim. Ich kontaktiere Sie aus meinem Heimatland, der Türkei. Ich möchte Ihnen das sagen, weil mir nichts anderes übrig bleibt, als es Ihnen zu sagen, da es mich berührt hat, mich Ihnen anzuvertrauen. Ich bin mit Herrn Yusuf Ýbrahim verheiratet, der acht Jahre lang beim türkischen Generalkonsulat in Toronto, Kanada, gearbeitet hat, bevor er bei dem Erdbeben in der Türkei am 6. Februar 2023 starb, bei dem 50.783 Menschen ums Leben kamen. Wir waren elf Jahre lang verheiratet und hatten keine Kinder.
Er starb nach dem Erdbeben der Stärke 7,8 in der Türkei. Er wurde Opfer eines Gebäudeeinsturzes und konnte nicht überleben. Zu Lebzeiten meines verstorbenen Mannes hatte er einen Betrag von 10.850.000,00 € (zehn Millionen achthundertfünfzigtausend Euro) auf einer Bank hier in der Türkei hinterlegt. Dieses Geld liegt derzeit noch auf der Bank. Vor seinem plötzlichen Tod stellte er es für den Import von Gold aus Papua und Indonesien zur Verfügung. Kürzlich teilte mir mein Arzt mit, dass ich aufgrund einer erneuten Krebserkrankung die nächsten drei Monate nicht überleben würde. Am meisten beunruhigt mich mein Schlaganfall. Nachdem ich von meinem Zustand erfahren hatte, beschloss ich, Ihnen dieses Geld zu übergeben, damit Sie sich um die unterprivilegierten Menschen kümmern können. Sie werden das Geld so verwenden, wie ich es Ihnen hier befehle.
Ich möchte, dass Sie 60 Prozent des Gesamtbetrags für Ihren persönlichen Gebrauch und für Ihren Einsatz und Ihre Hingabe für die Wohltätigkeitsarbeit verwenden, während 40 Prozent des Geldes an die Wohltätigkeitsarbeit, bedürftige Menschen von der Straße und auch an das Waisenhaus gehen. Ich bin als Waise aufgewachsen und habe niemanden als Familienmitglied. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Haus Allahs, die Moschee, von den Mitteln unterhalten wird. Ich tue dies, damit der allmächtige Allah mir meine Sünden vergibt und meine Seele annimmt, denn ich habe so sehr unter dieser Krankheit gelitten. Sobald ich Ihre Antwort erhalte, werde ich Ihnen die Kontaktdaten der Bank hier in der Türkei mitteilen und den Bankdirektor anweisen, Ihnen eine Vollmacht auszustellen, die Sie als aktuellen Begünstigten des Geldes auf der Bank ausweist, sofern Sie mir versichern, dass Sie entsprechend den hierin dargelegten Anweisungen handeln werden.
In der Hoffnung auf Ihre Antwort werde ich Sie dann so bald wie möglich zur Bank begleiten, um das Geld auf Ihr Bankkonto zu überweisen, sofern Sie es ernst genug meinen, das Projekt in Angriff zu nehmen und sich auch dafür einsetzen, denn ich glaube, ich kann Ihnen ehrlich vertrauen.
Mit freundlichen Grüßen.
Frau Feyza Olcay Ýbrahim
feyzaybrahim62@gmail.com
Dieser Phisher hat sich dagegen keine Mühe gegeben:
Deutsche Kreditbank: Ihre Karte ist gesperrt 396985675 / 7234BD
Guten Morgen,
Beim letzten Update unserer Anwendung ist mit Ihrer DKB-Karte ein Fehler aufgetreten. Aus diesem Grund haben wir Ihre Karte gesperrt. Um Ihre Karte wieder zu aktivieren, aktualisieren Sie bitte Ihre Mobiltelefonnummer.
.

.
Das haben wir nun aus den fast flächendeckenden Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), die in massenhafte Umschulungsmaßnahmen (UBM) mündeten, welche im Wesentlichen aus Computerkursen bestanden. Sie wurden flankiert von aufmunternden Zurufen diverser Politiker: „‘Heimat, Hightech, Highspeed’ – dafür arbeiten wir,“ sagte der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, während der bayrische CSU-Ministerpräsident tönte, „Hightech und Heimat“ seien in seinem Bundesland bereits „vereint“. Gelegentlich heiße es auch noch „Laptop und Lederhose, „Rosenkranz und Raumfahrt“, „Leberkäs und Laser“, „Gigabit und Gamsbart“, „WLAN und Weißbier“, „KI und Knödel“, ergänzte der Herausgeber des bayrischen „Unternehmer-Magazins“. Die rotgrüne Bundesregierung entschied sich unterdes für den Satz: „Das Leitbild der KI-Strategie ist ein europäisches KI-Ökosystem für Innovationen“.
Im Endeffekt brachte dieser ganze Computerscheiß bloß neue Verbrechen hervor, die sogenannte „Cyber-Kriminalität“. Gut, man kann das für einen Fortschritt halten, dass die Gangster nun keine Handarbeiter mehr sind, die mit Gewalt Geldschränke knacken oder mit einer Knarre barsch Bargeld fordern. Stattdessen sind es jetzt Kopfarbeiter, die sich zu Hause am Computer als Hacker versuchen oder Erpressungsmails verschicken. Solche z.B.:
„Kriminalpolizei: Verwarnung Strafanzeige Nr. 20060024
Diese Nachricht ist die letzte Warnung in Bezug auf die sehr ernste Beschwerde, die gegen Sie vorliegt. Wir bitten Sie, sich innerhalb von 48 Stunden ausschließlich über die in der Strafanzeige angegebene E-Mail-Adresse mit uns in Verbindung zu setzen, damit wir Ihre Erklärungen zu den Ihnen vorgeworfenen Taten hören können. Nach Ablauf dieser Frist wird ein Haftbefehl gegen Sie ausgestellt und Sie müssen mit einer Gefängnisstrafe rechnen.
Anhang: Anklageordner“
Oder solche:
Schwerkraft-Spion: Letzte Warnung. Ihr System wurde geknackt. Wir haben alle Informationen von Ihrem Gerät auf unsere Server kopiert. Außerdem haben wir das Video von Ihrer Kamera aufgenommen, in dem Sie einen Pornofilm ansehen. Mein Virus hat Ihr Gerät über eine Website für Erwachsene infiziert, die Sie kürzlich besucht haben. Ich kann Einzelheiten mitteilen, falls Sie nicht wissen, wie es funktioniert. Ein Trojaner-Virus gewährt mir vollständigen Zugriff und Kontrolle über Ihr Gerät. Dadurch kann ich Ihren Bildschirm sehen, die Kamera und das Mikrofon aktivieren, und Sie werden nicht einmal davon erfahren. Ich habe ein Video von Ihrem Bildschirm und der Kamera aufgenommen und ein Video erstellt, in dem ein Teil des Bildschirms Sie beim Masturbieren zeigt und ein anderer Teil ein Pornovideo zeigt, das Sie zu diesem Zeitpunkt angesehen haben. Ich kann die gesamte Liste Ihrer Kontakte auf dem Telefon und in den sozialen Netzwerken sehen. Ich kann dieses Video mit nur einem Klick an alle Kontakte in Ihrem Telefon, per E-Mail und in den sozialen Netzwerken senden. Darüber hinaus kann ich die Daten Ihrer E-Mail und Ihrer Messenger an jeden senden. Dies würde Ihren Ruf ein für alle Mal ruinieren. Falls Sie solche Konsequenzen verhindern möchten, gehen Sie wie folgt vor: Überweisen Sie 4700 EUR (EURO) auf mein Bitcoin-Wallet. (Wenn Sie nicht wissen, wie das geht, geben Sie in Google als Suchbegriff „Bitcoin kaufen“ ein.) Mein Bitcoin-Wallet (BTC-Wallet): bc1qhax5rjay9vrtf8d3d38wndfu5mz87fyekw0r2e. Sofort nach Gutschrift der Zahlung werde ich Ihr Video löschen und Sie nicht mehr belästigen. Sie haben 50 Stunden (etwas mehr als 2 Tage), um die Zahlung zu tätigen. Ich erhalte eine automatische Benachrichtigung über das Lesen dieses Briefes. Der Timer wird auch automatisch gestartet, sobald Sie diese E-Mail gelesen haben. Versuchen Sie nicht, sich irgendwo zu beschweren – mein BTC- Wallet kann nicht zurückverfolgt werden und eine E-Mail, die Ihnen den Brief gesendet hat, wird automatisch erstellt – jede Antwort wäre sinnlos. Sollten Sie versuchen, diese E-Mail mit jemandem zu teilen, sendet das System automatisch eine Anfrage an die Server und diese beginnen, die gesamten Informationen an soziale Netzwerke zu senden. Das Ändern der Passwörter von sozialen Netzwerken, einer E-Mail und des Geräts wäre ebenfalls sinnlos. die gesamten Daten wurden bereits auf den Cluster meiner Server heruntergeladen. Kontaktieren Sie mich per E-Mail ‚jafar_script@outlook.com‘ und senden Sie eine Kopie an ‚tbens091627652@gmail.com‘ mit dem Betreff: *RESTOREKEYPC9273730* Nach diesen Schritten erhalten Sie per E-Mail den Schlüssel und ein Entschlüsselungs-Tutorial. Ich wünsche Ihnen viel Glück und machen Sie nichts Dummes. Denken Sie an Ihren guten Ruf.“
Bei manchen verbrecherischen Mails weiß man nicht einmal, ob sie überhaupt verbrecherisch sind. Zum Beispiel diese:
Hallo, ich sende Ihnen eine E-Mail bezuglich der Unterstutzung bei der sicheren Aufbewahrung einiger Pakete. Ich werde Ihnen weitere Einzelheiten mitteilen, sobald Sie mich uber meine personliche E-Mail-Adresse (siehe oben) kontaktieren.
Ihre Diensthabenden
Generalmajorin Diana Holland“
Will sie wirklich helfen? Gewiß ist nur, dass die Tastatur der Generalmajorin keine Umlaute hat und dass ich Pakete nie aufbewahre, sondern bei Empfang sofort aufreiße und den Inhalt an mich nehme.
Ich habe kein PayPal-Konto, bekam jedoch folgende mail:
„Konto vorübergehend gesperrt
Lieber Kunde, Wir haben ungewöhnliche Aktivitäten in Ihrem Konto festgestellt und einen Anmeldeversuch von einem unbekannten Gerät blockiert.
Details: IP-Adresse: 18.1.100.78. Standort: Indien
Bitte sichern Sie Ihr Konto, indem Sie innerhalb von 24 Stunden auf den unten stehenden Link klicken, da Ihr Konto sonst möglicherweise deaktiviert wird, um die Sicherheit der Gemeinschaft zu gewährleisten: Link unten.
Dieser Prozess ist wichtig, um regulatorische Standards einzuhalten und Ihre Vermögenswerte zu schützen.“
.

.
Phishing for Compliments (3)
Diese kleine Chronik erlaubt einen Einblick in die praktische Intelligenz, wobei sich manchmal alte Geldbeschaffungsmaßnahmen mit neuester Technologie verbinden – so wie hier:
So geht’s aber auch:
„Wollen Sie Ihre Niere für Geld verkaufen? Unser Krankenhaus ist spezialisiert auf Nierenchirurgie / Transplantation und andere Organ-Behandlung, werden dringend in der Notwendigkeit für O + ve, A + ve und B + ve Nierenspender mit oder ohne Pass und wir bieten Ihnen eine schöne Menge von maximalem Betrag $ 950.000 US Dollar. Jeder Interessierte sollte freundlich Kontaktieren Sie uns per E-Mail: ubth11@gmail.com oder WhatsApp +2347063061652“
Der folgende Betrugsversuch ist nicht mehr neu – mails von scheinbar seriösen Banken. Eine (bei der ich gottlob kein Konto habe) schreibt mir z.B.:
„Guten Abend Helmut Höge wir müssen Sie davon in Kenntnis setzen, dass es zu 3 fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen gekommen ist. Um möglichen Schaden zu vermeiden, haben wir ihren Kontozugang vorsorglich gesperrt. Damit Sie weiterhin im vollen Umfang die Vorteile des OnlineBankings müssen Sie sich anhand ihrer Daten verifizieren. Hier klicken. Mit freundlichen Grüßen Deutsche Bank Sicherheit“
Die bereits auf vielen Internetseiten als Betrüger bezeichnete „Fin Tech“ behelligte auch mich:
„Lieber Freund, Hören Sie aufmerksam zu und ich werde Ihnen zeigen, wie Sie wirklich große Gewinne mit Hilfe des Internets machen können. Vor einigen Monaten rollten sich meine Freunde vor Lachen auf dem Boden als ich ihnen sagte, dass ich mir ein profitables Online-Geschäft aufbauen will. „Ja sicher, toll Gelegenheit“ sagten sie alle, da ich absolut keine Website-Design-Fähigkeiten hatte und auch nichts von HTML verstand und keine Programmierkenntnisse besaß… ich hatte in der Tat nicht viel Computer-„Know-how“ (das habe ich auch immer noch nicht). Ihr Lachen verwandelte sich schnell zu Erstaunen, nachdem ich FinTech beigetreten bin und die Gewinnflut nicht mehr endet. Sie könnten Monate (und Tausende Dollar) verschwenden, um zu versuchen, herauszufinden, was über das Internet tatsächlich funktioniert. Oder Sie könnten sich die Frustration, Zeit und die Fehler ersparen, indem Sie meinem Beispiel folgen. Hier ist der Link damit Sie einen Blick auf das neue Programm werfen können Sie werden es nicht bereuen! Mit freundlichen Grüßen Lukas Kolditz“
Hier ist eine Geldbeschaffungsmaßnahme, die mich mit ihrem Nachsatz ins Grübeln brachte:
„Hallo, Finanzmittel von bis zu 650.730 Euro sind derzeit verfügbar, bitte bestätigen Sie Ihre Anmeldung hier, um loszulegen. Damit wird es Ihnen noch leichter fallen, in 3 Monaten zum Millionär zu werden. Steigen Sie jetzt ein, so lange die Finanzierung noch verfügbar ist. Grüße, Daniel. Unsere Daten zeigen, das Helmut Höge unsere Internetseite aufgerufen und darum gebeten hat, ihn zu kontaktieren.“ Das kann doch nicht sein, das wüßte ich doch!
Um ohne zu arbeiten an Geld zu kommen, muß man nur Mails wie die folgenden beantworten:
„Der Fonds der Susanne Klatten Family investiert in ein breites Spektrum von Branchen, Kontinenten und Anlageklassen, darunter direktes Private Equity, Immobilien, alternative Energien, Finanzinstrumente und Start-ups der Grundstoffindustrie, die von der Familie zu Fundraising-/Investitionszwecken initiiert wurden. Deshalb wurden Sie für eine Spende/Investition von 7,5 Millionen Euro ausgewählt. Grüße Susanne Klatten Familienfonds“
Am Sichersten scheint immer noch der Geldbeschaffungsweg über das uralte sexuell konnotierte Menscheln – nun über Email an zigtausend Adressaten gleichzeitig gerichtet:
„Hallo!!! Es tut mir Leid, dass ich Euch Schreibe, mit einer kleinen Verzögerung. Ich hoffe, dass ich dir interessant und du willst eine ernsthafte Beziehung? Ich hoffe, dass wir gemeinsame Interessen fur die Zukunft. Ich Suche einen ernsten Mann, der bereit ist an der Beziehung. Wenn du dann andere Interessen dazu, dann konnen wir uns besser nicht treffen. Ich brauche nur ein ernster und anstandiger Mann, der eine ernsthafte Beziehung haben mochtest. Mein name ist Elena, ich bin 29 Jahre alt und mit meinem Alter habe ich keine Zeit fur Spielchen! Ich die ernste und anstandige Frau, ohne schadliche Gewohnheiten. Wenn Sie Interesse an der Fortsetzung der Bekanntschaft, schreiben Sie mir bitte. Ich freue mich, dich kennen zu lernen! Warte auf deine Briefe. Elena!“
Mal was Nettes:
„Grüße vom Welteliteimperium der Illuminaten.
Möchten Sie Teil einer Gruppe netter Menschen sein, die danach streben,
Ihr Wissen zu erweitern, um persönliches Wachstum zu erreichen?
Möchten Sie reich sein?, mächtig und berühmt.
Brauchen Sie Schutz in Ihrer Arbeit oder Ihrem Geschäft, um mehr
Aussichten für das zu haben, was Sie tun?
Falls JA! Dann können Sie Ihre Träume verwirklichen, indem Sie Mitglied
des großen Illuminatenimperiums werden.
Sobald Sie Mitglied sind, können all Ihre Träume und Herzenswünsche
vollständig erfüllt werden.
Wenn Sie daran interessiert sind, Mitglied der großen
Illuminatenbruderschaft zu werden,
melden Sie sich von Ihrem privaten E-Mail-Konto aus bei uns, um weitere
Informationen zum Beitritt zu den Illuminaten zu erhalten.
Bitte antworten Sie nur auf unsere direkte Rekrutierungs-E-Mail an:
Bitte beachten Sie: Stellen Sie sicher, dass alle Ihre Antworten direkt
und ausschließlich an die oben angegebene E-Mail-Adresse gesendet
werden. Weitere Anweisungen zu unserem Mitgliedschaftsprozess finden Sie hier:
Die Illuminaten.“
.

.
Parlament der Natur
Der Direktor des Max-Planck-Instituts für biologische Intelligenz Martin Wikelski fängt Tiere aller Arten weltweit ein und befestigt kleine Sender an ihnen, um ihre Wanderrouten zu verfolgen. Die den Tieren als kleine Rucksäcke umgehängten Sensoren messen darüberhinaus permanent deren Gesundheitszustand, ihre Herzfrequenz, ihre Körpertemperatur und ob sie Krankheitsträger sind. Die Daten werden dann zu einem Satelliten (bis zum Ukrainekrieg die russische Weltraumstation) übertragen – und von da aus zur Auswertung auf die Rechner der Wissenschaftler. Sein hochdotiertes Projekt nennt sich ICARUS.
Der ICARUS-Gründer hält mit der Besenderung der Fauna Erich Kästners Kinderbuch „Die Konferenz der Tiere“ (1949) für realisierbar. Darin treffen sich die Tiere zu einer großen Konferenz, um fürderhin die Geschicke der Erde zu leiten, nachdem die Menschen sich als unfähig erwiesen haben, Kriege zu vermeiden: „Die moderne Technologie ermöglicht es uns“, schreibt Wikelski, „eine repräsentative parlamentarische Onlineversammlung von Tieren abzuhalten, an der Tausende Tierarten und Hunderttausende einzelne Tiere aus der ganzen Welt teilnehmen können.“
Können sie sich denn alle untereinander verständigen und würden wir das auch verstehen? Der Wissenssoziologe Bruno Latour ist von der Taubheit der Tiere überzeugt, die sich der Aufklärung (Kant) verdanke. Ihre Stille sei jedoch „keine dem Tier wesentlichen Unfähigkeit – vielmehr ist das Schweigen gerade die Antwort der Tiere auf die Art und Weise, wie wir sie behandeln.” Ob man mit an ihnen befestigten Computern, Satelliten und Sendern ihr Schweigen brechen kann, halte ich für bloße Investorenwerbung eines amerikanisierten Plattform-Kapitalismus. Immer mehr Biologen begeistern sich jedoch für diesen technischen „Quantensprung“ im „Dialog“ mit der Natur.
Noch einen Schritt weiter gehen der Direktor des Berliner Naturkundemuseums Johannes Vogel und seine Frau, die Ururenkelin von Charles Darwin, Sarah Darwin. Beide sind Botaniker. Sie gehörten zu den Experten, die neben dem Politikjournalisten Boris Herrmann den Bundespräsidenten auf seinem Besuch der Galapagos-Inseln begleiteten. Herrmann hat die beiden Experten später interviewt und daraus ein Buch gemacht mit dem Titel: „Das Parlament der Natur. Was uns Farne, Finken und ihre Verwandten zu sagen haben“ (2025).
Im Vorwort heißt es: „Frank-Walter Steinmeier erreichte den Archipel knapp zwei Millionen Jahre nach den Riesenschildkröten, im Februar 2019.“ Diese leben nur auf den Galapagos-Inseln. Der Bundespräsident übernahm die Patenschaft für die neugeborene Riesenschildkröte Alejandra. Sarah Darwin ist die „führende Forscherin über die endemische Galapagos-Tomate“ und Johannes Vogel hat über Farne geforscht. Herrmann hält sie für ein „Traumpaar der Naturforschung…Sie kämpfen für nichts Geringeres als für die Rettung der Welt“, wobei der Direktor des Naturkundemuseums zusammen mit anderen ähnlichen Museen aus diesem Naturkunde-Cluster voller toter Tiere und Tierteile (30 Millionen Objekte allein in Berlin) eine „Weltrettungsmaschine“ bauen will – für 150 Milliarden Euro.
„Dafür haben Sarah und Johannes die Idee von einem ‚Parlament der Natur‘ entwickelt.“ Ihre „Mission“ steht in engem Zusammenhang mit der Mission des Museums und die heißt: „Eintreten für die Natur“. Soll heißen: „Indem man Menschen zusammenbringt, für Veränderungen wirbt und Veränderungen anstößt. Es ist also unsere Vision, Wissensgemeinschaften zu schaffen, die mit uns wissensbasiert ein gesundes, nachhaltiges, gutes Leben für die Menschen anstreben.“ Dabei setzt Vogel ebenfalls auf Hightech: „KI“. Zunächst baut er aber die große Saurier-Halle um für Veranstaltungen und Menschen-Konferenzen, von denen bereits viele im Museum stattfanden: Hanns Zischler stellte einzelne Tierexponate vor, ein Insektengift-Hersteller warb engagiert für den Schutz von Fliegen und in einem der Hörsäle tagt regelmäßig der Insektenforscherverein „Orion“.
Äuch Martin Wikelkski will mit seinen Sendern ein gutes Leben für die Menschen, es geht ihm darum, „wie viel wir von der Natur lernen können…auch und vor allem von dem Verhalten der Tiere. Die Verhaltensmuster, die sie entwickelt haben und die kurzfristigen Verhaltensanpassungen, zu denen sie fähig sind, werden der Menschheit den Weg in eine bessere Zukunft weisen. Ich denke, wir stimmen alle darin überein, dass eine Verbesserung unseres eigenen Wohlbefindens auf dem gesamten Planeten eine der wesentlichen Herausforderungen ist, mit denen wir es als Spezies zu tun haben.“ Und dabei sollen uns die besenderten Tiere helfen.
.

Storch Gabo aus Kirchzarten hat Afrika erreicht
.

Und dieses ganze Hightech-Gewurschtel an den Beinen soll sie nicht behindern?
.

.
Tiere im Widerstand
Ich bereitete unlängst einen lichtbildgestützten Vortrag über „Tiere im Widerstand“ vor und als gebürtiger Bremer fielen mir dazu natürlich die Bremer Stadtmusikanten ein. Sie werden meist so dargestellt: Ein Hahn steht auf dem Rücken einer Katze, diese auf einem Hund und der auf einem Esel.
Es ist ein „Volksmärchen“, das die Gebrüder Grimm 1819 veröffentlichten: Der alte Esel soll verkauft werden. Deshalb flieht er und will Stadtmusikant in Bremen werden, wo es damals tatsächlich Stadtmusikanten gab. Unterwegs trifft er auf den Hund, die Katze und den Hahn. Auch diese drei sind schon alt und sollen sterben. Sie schließen sich der Flucht des Esels an, um ebenfalls in Bremen als Musiker zu überleben. Den vieren geht es bei ihrer Flucht also um „Nein oder Nichtsein“, d.h. um die „Schwierigkeit, Nein zu sagen“, wie der Titel der Habilitationsschrift des Religionsphilosophen der FU Klaus Heinrich 1964 hieß, die ebenso wie er selbst wichtig für die Westberliner Studentenrevolte war.
Auf ihrem Fluchtweg kommen die vier Tiere durch einen Wald, in dem sie übernachten wollen, dabei entdecken sie ein Räuberhaus. Indem sie sich vor dem Fenster aufeinanderstellen und mit lautem ‚Gesang‘ einbrechen, erschrecken und vertreiben sie die Räuber. Hernach besetzen sie das Haus und setzen sich an die gedeckte Tafel, auf der alles vorhanden ist, was Veganer und Karnivoren gerne essen.
Ein Räuber, der später in der Nacht erkundet, ob das Haus wieder betreten werden kann, wird von den Tieren nochmals und damit endgültig verjagt. Den vier alten Tieren gefällt das Haus so gut, dass sie nicht mehr fort wollen und dort bleiben.
Diese Märchen-Zusammenfassung habe ich hier der von Wikipedia entlehnt. Dort heißt es weiter: „Die Geschichte ist dem Literaturtyp der Tierfabel verwandt und sie zeigt die Merkmale einer Gesindeerzählung: Die Tiere entsprechen den im Dienst bei der Herrschaft alt gewordenen, abgearbeiteten und durch den Verlust an Leistungskraft nutzlos gewordenen Knechten und Mägden. Mit ihrem Aufbruch, ihrem Zusammenhalt und Mut schaffen sie das fast Unmögliche. Sie entkommen ihren Besitzern und überlisten die Bösen, schaffen sich ein Heim und somit ein neues Leben…Das Märchen ‚Die Bremer Stadtmusikanten‘ ist ein Musterbeispiel für den Erzähltypus ‚Tiere auf Wanderschaft‘“ – und wie ich finde, für den Erzähltypus „Tiere im Widerstand“.
Zumal heute, da es etliche Kühe und Kälber gibt, die vom Schlachthof flüchteten und sich im Wald Hirschen bzw. Bisons anschlossen oder in einem Gnadenhof aufgenommen wurden. Daneben gibt es auch Eisbären, die verlassene Hütten von Polarforschern besetzten und Füchse in leerstehenden Fabriken.
Der Satz des Esels im Märchen: „Etwas Besseres als den Tod findest du überall“, mit dem er die anderen drei Tiere überredet, sich ihm anzuschließen, wurde immer wieder von Schriftstellern aufgegriffen, u.a. von Carl Zuckmayer, Günter Bruno Fuchs, Nicolas Born und Janosch.
Wikipedia behauptet nun: „Mit ‚Bremen‘ im Titel des Märchens ist eindeutig die Hansestadt Bremen gemeint“ – in dessen Überseehafen die Auswanderer sich nach Amerika einschifften.
Das Märchen stammt jedoch aus dem „Bremer Grund“ im sogenannten hessischen Hinterland und gelangte von dort mit den armen Auswanderern nach Bremen, wo sie auf ein Schiff warten mußten – und bis dahin von den Bremern schamlos ausgebeutet wurden: So mußten sie u.a. Unsummen für bloße Schlafplätze in Schweineställen zahlen. Überdies eigneten sie sich auch noch ihr Märchen aus dem Bremer Grund an – in Form von Erzählungen, Denkmälern, Medaillen, Souvenirs, als Ziel von Stadtführungen, als Stadtlogo und sogar in den Grünphasen der Bremer Ampeln.
Auf der Internetseite „bremen.de/tourismus“ heißt es: „Auf der Suche nach einer sicheren Zukunft machten sich die Stadtmusikanten einst auf den Weg nach Bremen. Die Hoffnung auf ein gutes Leben in der schönen Weserstadt teilen nicht nur aktuell, sondern seit je her zahlreiche Menschen, die aus allen Teilen Deutschlands und der Welt nach Bremen kamen und kommen. In der Tradition einer weltoffenen Hansestadt betrachtet Bremen Zuwanderung als Bereicherung und lebt eine aktive Kultur des Willkommens.“
Das bekannteste Denkmal dort für die vier Bremer Stadtmusikanten, die das ja nie waren, weil sie in Hessen blieben, schuf 1953 der Bildhauer Gerhard Marcks. Es steht auf dem Marktplatz neben dem Rathaus. Ein anderes Kunstwerk in einer Galerie, das die vier Stadtmusikanten 1993 zeigte, fanden die Bremer nicht so toll: Die polnische Künstlerin Katarzyna Kozyra hatte die vier Tiere ausgestopft und aufeinander gestellt. Heute steht diese Skulptur in einer Warschauer Galerie. Eine weitere Plastik – in Leipzig – zeigt die vier Stadtmusikanten, wie sie den letzten Räuber (einen Wessi?) vertreiben.
.

.

.
Partisanen
2007 fasste ich einige Texte über Wölfe, Partisanen und Prostituierte in einem Buch („WPP“ genannt) zusammen. Die drei haben vieles gemeinsam: Sie „arbeiten“ vorwiegend Nachts und sie lösten einander quasi ab. So wurden z.B. die einstigen Wolfpfade in den Wäldern Osteuropas erst von Partisanen (die gegen die Deutschen kämpften) und zuletzt von Schlepperbanden benutzt, die vor allem junge Frauen über die Grenzen schmuggelten, um hernach im Westen als Prostituierte tätig zu werden. In vielen Ländern Afrikas waren die Bordelle zudem Hauptstützpunkte der „Rebellen“.
Im Abschnitt „P“ – „Partisanen“ – habe ich von den Arbeiten der am 25.Januar gestorbenen Schriftstellerin Ingrid Strobl viel gelernt. Als Faustregel für die Partisanenliteratur gilt vielleicht: Je professioneller desto leidenschaftloser – und so ist oft auch die Wahrheitsfindung in solchen Werken: allzu seicht, wenn nicht gar verlogen oder ideologisch borniert. Ingrid Strobl ist eine feministische Partisanin aus der Arbeiterklasse, die einst für die Antiautoritären aus der „Bewegung 2. Juni – Rote Zora“ einen Wecker kaufte für ein Bombenattentat – und dafür fünf Jahre ins Gefängnis kam. Für die Innsbrucker Literaturwissenschaftlerin gilt nicht nur für die Partisanenliteratur nach 1945 sondern auch für die „gute Arbeiterliteratur“ aus den Zwanzigerjahren, die „vermeintlich authentisch“ war, dass „diese ganzen ‚Arbeiterdichter‘… das war alles Kitsch. Das war ein Mißbrauch der Arbeiter“.
Im Gegensatz zu den Autoritären der RAF, die in jedem Gefängniswärter einen Handlanger der Faschisten sahen, pflegte Ingrid Strobl mit den „Schließerinnen“ im Knast ein entspanntes Verhältnis. Sie sah in den weiblichen Justizvollzugsbeamtinnen eher Frauen und Arbeiter. In ihrem „Rechenschaftsbericht“ „Der Wecker, der Knast und ich“ (2020) erzählt die einstige „Emma“-Redakteurin, wie sie in ihrer Zelle das Buch „Sag nie, du gehst den letzten Weg“ übersetzte: Die Geschichte von „Frauen im bewaffneten Widerstand gegen Faschismus und deutsche Besatzung“, die ein „Bestseller“ wurde. „Das hat mir erspart, bis heute Anwalts- und Prozesskosten abzuzahlen. Es war die erste Monografie zum Thema,“ erklärte Ingrid Strobl in einem Interview 2020, da war sie beim WDR quasi „für die schweren Fälle zuständig: Heroinabhängige, Prostituierte, Arme“.
Im Knast hatte sie auch noch den 2. Teil über Osteuropa und die jüdischen Frauen geschrieben. Außerdem übersetzte sie dort die Erinnerungen der polnischen Ghettokämpferin Chaika Grossman. Besonders ergiebig war für sie die Quellenlage beim einstigen partisanischen Bermudedreieck zwischen Litauen/Weißrußland und Polen/Galizien: „Nirgendwo sonst haben so viele beteiligte Frauen während oder kurz nach dem Krieg schriftliche Zeugnisse über den jüdischen Widerstand hinterlassen,” meinte sie, die darüberhinaus viele der Überlebenden befragte. Kommt noch hinzu, dass es z.B. etliche Bücher gibt über die Wilnaer Stadtguerilla-Gruppe, insbesondere den späteren „Rächern” um Abba Kovner, Ruzka Korczak und Vitka Kempner (alle drei gelangten später nach Palästina, wo sie sich einem Kibbuz anschlossen). Von Ingrid Strobl kam dazu 1998 eine vergleichende Studie: „Die Angst kam erst danach“. Es ist hochinteressant, auf diese Weise nach und nach die ganze Partisanengruppe kennen zu lernen.
“Die Scheidelinie zwischen Geschichte und Fiktion ist das erste Hindernis auf dem Weg zu einer gerechten Erinnerung,” meinte Paul Ricoeur. Der weißrussische Kriegsveteran und Schriftsteller Wassil Bykau, der sich ähnlich wie sein Landsmann Ales Adamowitsch mit nichts anderem als mit dem Partisanenkampf gegen die Deutschen beschäftigte, gab, als er wegen Auseinandersetzungen mit „seiner” Regierung in Minsk im Exil in Köpenick lebte, der Zeitung “Russkij Berlin” ein Interview. Darin meinte er: „Bis vor kurzem durfte man die ganze Wahrheit über den Krieg nicht sagen. Das lag nicht an der Zensur oder am dogmatischen Sozialistischen Realismus, die natürlich auch die Literatur unterdrückten, sondern an dem besonderen Charakter des gesellschaftlichen Bewußtseins in der Sowjetunion, das nach dem Krieg eine fast süchtige Beziehung – nicht zur Wahrheit des Krieges, sondern zu den Mythen des Krieges hatte: das betraf die Helden, die Flieger, die Partisanen usw..“
„Diese schönen Mythen waren auch für die Veteranen annehmbar, obwohl sie ihren eigenen Erfahrungen widersprachen. Die Wahrheit über den Krieg war nutzlos und sogar amoralisch. Schon die kleinste Annäherung an die Wahrheit wurde sofort als ein Attentat auf das Allerheiligste – den Kampf für die Freiheit und Unabhängigkeit der Heimat – aufgefaßt. Die Autoren, die über den Zweiten Weltkrieg schrieben, waren jedoch begabte und durchaus zu Selbstopfern bereite Menschen, die der Wahrheit in ihren Büchern auf der Spur waren. Ihre Werke hatten deswegen auch oft ein schweres Schicksal. Die russische Umschreibung für jahrelanges Druckverbot. Das ist jedoch nur allzu verständlich, wenn man bedenkt, daß diese Wahrheit nicht nur in Redaktionsstuben, sondern auch im Krieg selbst erobert werden mußte.“
.

.
Weltretter
1982 hatte Joseph Beuys anläßlich der 7. Kassler „documenta“7000 Eichen und 7000 Basaltstelen gepflanzt. Man sah darin eine lokale Begrünungsaktion, denn Beuys sprach von „Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“. Sie zielte aber aufs große Ganze. Der Anthroposoph Beuys war ein Weltretter bzw. –verbesserer.
Zu seinem 100. Todestag 2021, finden an vielen westdeutschen Orten Beuys-Feiern statt, die wahren Erben der Beuysschen Eichen-Basaltstelen-“Pflanzaktion“ in weltrettender Absicht sitzen jedoch in angloamerikanischen Laboren. Sie nennen sich „Geoengineers“, es geht ihnen darum, das Klima erwärmende CO2 zu reduzieren. Zum Einen drängen sie darauf, anderthalb Milliarden „Eichen“ zu pflanzen, die CO2 aufnehmen. Und zum Anderen zur Nutzung von Basalt-Bergwerken, die abgesaugten Stickstoff aufnehmen und durch Versteinerung binden sollen.
Schon gibt es auf Island und in der Schweiz solche Anlagen, die zum Teil mit dem in der Luft gesammelten Stickstoff Gemüsegewächshäuser betreiben. In Deutschland machte das die Stickstoff produzierende Chemiefabrik SKW vor. Anlässlich des 500. Jahrestags des Anschlags der 95 Thesen durch Martin Luther an die Tür der Schloßkirche in Wittenberg präsentierte das im Wittenberger Ortsteil Piesteritz ansässige Stickstoffwerk 2017 eine „Luther-Tomate“, die es in den Werksgewächshäusern mit Stickstoff aufzieht. Hier deutete sich die Erweiterung der von Beuys in Kassel „gepflanzten 7000 Eichen und 7000 Basaltstelen“ ins Globale an.
Die für den „New Yorker“ arbeitende Journalistin Elizabeth Kolbert hat diese Geoengineers für ihr 2021 auf Deutsch erschienenes Buch „Wir Klimawandler. Wie der Mensch die Natur der Zukunft erschafft“ besucht – und auch gleich die „Schwachstellen“ ihrer Weltrettungsprojekte benannt. In ihrem Buch geht es „um Menschen, die Probleme zu lösen versuchen, die Menschen beim Versuch, Probleme zu lösen, geschaffen haben“.
Der „Gruppe von Negativ-Emissions-Technologen“, die vorschlägt, anderthalb Milliarden „Eichen“ zu pflanzen, „was 200 Milliarden Tonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre binden könnte“, wird von ihr entgegen gehalten: „Bäume sind dunkler. Wenn wir z.B. die Tundra aufforsten würden, würde es die von der Erde absorbierte Energiemenge erhöhen“ – also sogar eher zur „Erderwärmung“ beitragen. „Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, wäre, mit der CRISPR-Technologie genmodifizierte hellere Bäume zu schaffen.“ Also sie künstlich zu albinisieren. „Soweit ich weiß, hat das bisher niemand vorgeschlagen, doch es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein,“ meint Elizabeth Kolbert.
Eine weitere Gruppe von Geoengineers will zwecks Verlangsamung der Erderwärmung Kalzit-, Sulfat- oder Diamant-Partikel in der Stratosphäre versprühen, die das Sonnenlicht zurückstrahlen. Dafür hat sie schon mal ein Flugzeug, den Stratospheric Aerosol Injection Lofter, kurz SAIL genannt, konstruiert. Mit dem will man im ersten Jahr 100.000 Tonnen Schwefel versprühen. Leider würde dies „das Erscheinungsbild des Himmels verändern. Er wäre nicht mehr blau, sondern weiß.“
Wenn man jetzt auch noch das Anthropozän-Phänomen der zunehmenden Zahl von quasi-natürlichen Albinogeburten bei Wildtieren und -pflanzen quer durch alle Arten – von der Eidechse bis zum Elefanten und vom Hanf über Mammutbäume bis zum Ahorn – dazu zählt, kann man sich in etwa ein Bild machen: Kein Schnee im Winter mehr, aber ganzjährig weisse Mischwälder mit weissen Tieren unter weißem Himmel.
Der „documenta“-Erklärer Bazon Brock hat es vielleicht schon geahnt, als er in einer Diskussion mit Joseph Beuys über das Konzept „Gesamtkunstwerk“ diesem vorwarf: „Ihr könnt so viele Konzepte vertreten wie ihr wollt, sobald ihr uns zwingt, diese Konzepte eins zu eins in der Wirklichkeit zu realisieren, wird es totalitär.“
Bei dem Künstler Beuys bestand dazu keine Gefahr, auch wenn er später mit der Rockgruppe BAP einen Wahlkampf-Spot für die Grüne Partei aufnahm – mit dem Titel: „Sonne statt Reagan“. Aber mit den technischen Weltrettungs-Projekten der amerikanischen Geoingenieure würde diese Gefahr Wirklichkeit werden.
.

.
Endzeit
Die Zeitschrift „Soziopolis – Gesellschaft beobachten“ hat gerade von Soziologen, Kriminologen u.a. alle möglichen Bücher besprechen oder interviewen lassen, deren Autoren apokalyptisch zumute war oder ist.
Wenn es stimmt, dass die Wende 89/90 der Anfang vom Ende deutscher Nachkriegsherrlichkeit war, dann gilt die Endzeit nunmehr global, jedenfalls wenn man den vielen Schriftstellern und Wissenschaftlern glauben darf, die sich mit der “Apokalypse” beschäftigt haben. Und so heißen dann auch die Obertitel ihrer Rezensionen in der Soziopolis „Bücher zur Apokalypse I“, „…II“ und „Apocalypse -wow!“.
Unter dem letzten Titel steht eine Besprechung des Buches „Geist und Müll“ von Guillaume Paoli, die der Direktor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, Stephan Lessenich, verfasst hat. Sie fängt so an: „Was für Zeiten! Die deutsche Politik ist in einen gnadenlosen Unterbietungswettbewerb um die menschenverachtendste Umgangsweise mit Geflüchteten und Zuwandernden eingetreten. Im Anbahnungsdokument einer Großen Koalition im Bundesland Hessen gerät das existenzielle Problem des Klimawandels an den Rand des Interesses, während die Unterbindung des „Genderns mit Sonderzeichen“ an Schulen, Universitäten und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in dessen Zentrum rückt.“
Lessenich streift sodann das politische Elend im Globalen: „In Argentinien schickt sich ein anarcho-autoritärer Psychopath an, fünfzig Jahre nach Pinochet im Nachbarland Chile ein neuerliches marktradikales Gesellschaftsexperiment zu vollziehen – diesmal ganz ohne Militärputsch, sondern dank absoluter Mehrheit in den Präsidentschaftswahlen. Und, apropos Präsidentschaftswahlen, in den USA steht Donald Trump schon Gewehr (aka „X“) bei Fuß, um das in seiner ersten Amtszeit Unerledigte endlich nachzuholen und die demokratische Verfassung nun wirklich nachhaltig zu schleifen.“
Danach kommt der Rezensent auf seine Eingangsfrage zurück: „Was ist hier bitteschön los?“ Guillaume Paolis sagt es uns in seinem „Plädoyer für einen aufgeklärten Katastrophismus“. Darum „Krisendiagnostiker:innen aufgepasst“, denn uns steht ‚keine Katastrophe bevor, wir stecken bereits mittendrin.‘ Wir haben den Schuss nur noch nicht gehört, obwohl es doch an jeder Ecke unüberhörbar knallt. Noch aber wähnen wir uns in unserer gewohnten Welt. ‚Eine stabile, zuverlässige Welt mit vier Jahreszeiten, vollen Supermarktregalen, Urlaubsbuchungen, Karriereplänen und für alle Pannen technische Lösungen‘.“
Es ist dies jedoch „eine Welt, die in Wirklichkeit bereits nicht mehr existiert. Noch leben wir so wie in den alten Zeiten. Doch dieses Leben ist Traum. Es ist dem Tod geweiht, aber es weiß dies noch nicht. Oder will es nicht wissen.“
Das gilt nicht für Paoli, der all die aus der Unvernunft geborenen Ideen und Ratschläge zum guten oder besseren Leben für ein „Übel“ hält: „Um gegen präsente und kommende Übel geistige Antikörper zu entwickeln“, sei es ratsam, „sich Bazillen der Negativität einzuimpfen“. Der Rezensent seufzt darob „Wenn Adorno das erleben dürfte“. Lessenich ist quasi der jüngste Erbe des Adorno-Horkheimer-Instituts, ich nehme an, er meint mit seinem Seufzer den Rat, den Adorno seinen zukünftigen Soziologen gab: „Und vergeßt nicht den ‚bösen Blick‘, sonst seid ihr verloren“ (in dieser kapitalistischen Gesellschaft).
Auch der „französisch-deutsche Philosoph, Schriftsteller und situationistische Aktivist“ Paoli (geb. 1959) hat den „bösen Blick“ (woher auch immer – für den Situationismus, die antiautoritäre Studentenbewegung und den leibhaftigen Adorno, der 1969 ebenso wie die beiden kulturrevolutionären Bewegungen starb, war er noch zu jung). Mit diesem Blick haut er aber alle möglichen Denker in die Tonne. Sein Buch ist eine mehr oder weniger polemische Rundum-Kritik. Nach der Lektüre hat man nichts in der Hand, außer das man beim „Deepreading“ (sic) der von Paoli Kritisierten diese fürderhin etwas kritischer liest. U.a. Bruno Latour, der meinte: Vergeßt die Kritik, dahinter steckt nichts mehr.
Für die Zeitschrift “Soziopolis” mit ihrem Besprechungs-Schwerpunkt „Apokalypse“ (mit „c“) ist überraschend selbst die Endzeit gekommen: Sie gehört zum Hamburger Institut für Sozialforschung des Tabakmilliardenerben Jan Philipp Reemtsma, das dieser demnächst liquidieren will, wahrscheinlich samt Verlag „Hamburger Edition” und seiner zweiten Zeitschrift “Mittelweg 36”, um die es allerdings nicht schade ist. Im Reemtsma-Institut hat sich der „böse Blick“ umgedreht: Anfänglich arbeiteten dort etliche Linke, darunter einige Anarchisten und Marxisten-Leninisten. Die wenigen Linken, die dort nach einigen Jahren als Forscher übrig blieben, richteten ihren bösen Blick dann vornehmlich auf die antiautoritäre Bewegung. Und das war keine (späte) Selbstkritik, sondern (schnöde) Distanzierung. Aber gehört das nicht auch zu den erschreckenden Zeitläuften?
Dies ist im Übrigen auch das Thema des Buches von Pankaj Mishra „Das Zeitalter des Zorns“ (2017), das für mich Ähnlichkeit hatte mit Guillaume Paolis Buch „Geist und Müll“, nur dass Mishra sich in seiner globalen Befindlichkeits-Analyse statt auf Theoretiker vor allem auf Romane stützt.
.

.
Beeinflusser
Beim Beeinflusser (Influencer auf Plattdeutsch) geht es um Kaufen, Kaufen, jedenfalls wenn der oder die Influencerin damit Geld verdienen will. Eine Studie der Universität Göttingen kam laut WDR zu dem Ergebnis, dass rund die Hälfte aller Abiturienten gerne Influencer wäre. Und die Ökonomin Barbara Engels vom Institut der Deutschen Wirtschaft fand anhand des JUNIOR-Schülerfirmenprogramms 2022/2023 heraus, dass mehr als ein Fünftel der Befragten gerne Influencer sein würden, berichtet die baden-württembergische Internetseite „bw24.de“. „Influencer bewerben in der Regel Produkte anderer Unternehmen und regen damit einen Kaufimpuls bei den Followern [ihren „Fans“] an.“ Je mehr Follower ein Influencer hat, desto eher sind Firmen bereit, Anzeigen bei ihm zu plazieren oder ihm ihre Produkte zum Bewerben anzudienen.
Laut Barbara Engels gaben 41,7 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler an, dass sie bis zu 150 Influencern folgen. Sie stellte daraufhin folgende Rechnung für die zukünftigen Influencer auf: „Wenn man als Influencer 20.000 Follower braucht, um sich zu etablieren, könnten deutsche Internetnutzer rund 500.000 Influencer am Markt halten. Da es aber auch Influencer anderer Generationen und Influencer aus dem Ausland gibt, dürfte der Markt gesättigt sein“, erklärte Engels der FAZ.
Viele Influencer seien Freiberufler, so Rebecca Wasinski von der Landesanstalt für Medien NRW im Interview mit dem WDR, und weil sich dabei Beruf und Privatleben vermische, wären sie oft überlastet, was man beispielsweise bei den Influencerinnen Louisa Dellert oder ‚Melina Sophie‘ gesehen habe. Die beiden kenne ich nicht, aber ich las kürzlich das Buch der Influencerin Sophie Passman „Pick me Girls“. Darin schreibt sie: „Ich habe viel Geld dafür ausgegeben, so auszusehen, wie ich heute aussehe.“ Sie führt ein medienbestimmtes, quasi amerikanisches Frauenleben und klärt ihre vielen Follower auf Instagram über Mode auf. In der „Zeit“ schrieb sie, dass ihre Schönheitseingriffe nicht ganz freiwillig geschehen seien, aber die Männerherrschaft mitsamt ihrer Einteilung von Frauen in attraktive und weniger attraktive Exemplare habe ihr keine andere Wahl gelassen: „Der männliche Blick ist die höchste Währung.“
Mit KI wird sich diese Sichtweise noch einmal verschärfen, denn sie wird, wie auch schon die vorangegangene Computerisierung, noch mehr Berufsgruppen arbeitslos machen. Der Spiegel zitierte im August 2023 eine Analyse des Beratungsunternehmens McKinsey zum US-Arbeitsmarkt, danach „könnten fast sechs Millionen Jobs durch KI vernichtet werden, vor allem solche von Frauen“.
In China ebenso wie in den USA gibt es immer mehr Einkommensschwache, vor allem Frauen, die eigene oder Firmen-Produkte bewerben, um sie dann im Internet als Influencer per Livestream anzubieten. Dazu heißt es im Buch der US-Chinesin Xiaowei Wang „Blockchain Hühnerfarm“ (2023): „Menschen, die vom Livestreaming leben, stehen unter hohem Druck, ein bestimmtes Aussehen zu haben. Manche Livestream-Stars lassen mehrere plastische Operationen pro Jahr über sich ergehen“ – damit sich ihr Aussehen dem globalen Hollywood-Look anähnelt bzw. ähnlich bleibt.
Die Trierer China-Forscherin Kristin Shi-Kupfer erwähnt in ihrem Buch „Digital China“ (2023) die 1985 geborene „Königin des Livestreaming“ Viya (Weiya Huang), die sie als „eine der Meisterschülerinnen des entfesselten Kommerzes des Kommunistischen Partei“ bezeichnet. „Viya war einer der größten Stars des Livestreaming-Kanals von Taobao, Chinas erste und größte E-Commerce-Plattform“. Schon bald besaß sie 18 Firmen unter ihrem Namen. Sie bietet alles an, was ihre Fans möglicherweise brauchen: „Türklingel, Teppiche, Zahnbürsten, Möbel, Matratzen“ usw..“ Im April 2020 verkaufte sie einen Raketenstart für 5,69 Millionen Euro“.
Xiaowei Wang ist sich sicher: „KI wird Pausenbrote zubereiten und Pakete packen“. Der Schriftsteller Wladimir Kaminer besuchte kürzlich das Filmstudio Babelsberg und dort eine KI-Entwicklungsfirma. Anschließend schrieb er, dass die Überwachungstechnik KI eher für etwas anderes als für Pausenbrote und Pakete eingesetzt wird: „In meiner Kindheit in der Sowjetunion war viel von der Roboterisierung der Arbeitsprozesse die Rede, es ging in erster Linie darum, dass die Maschinen uns die schwere Arbeit abnehmen, Straßen fegen, Röhren legen und Brücken bauen. Sie sollten Post austragen und Brote backen, während wir von der lästigen Pflicht des Frühaufstehens und der körperlichen Anstrengung befreit uns dem Kaffeetrinken widmen und kreativen Tätigkeiten nachgehen. Genau das Gegenteil ist dabei herausgekommen: Die KI übernimmt die kreativen Berufe, sie möchte malen, dichten, Musik machen, Bücher schreiben und tanzen. Und wir sollen fegen und backen.“
.

.
Gefühlsmenschen
Die „Autonomen“ sprachen in den Achtzigerjahren von „Gefühl und Härte“. Dies war dann auch der Titel einer Punk-LP. Seit 2000 etwa heißt es, das Zeitalter der großen „Ideologien/Narrative“ sei überwunden. Jetzt, im solipsistischen Neoliberalismus, geht es vor allem um „Gefühle“. So wollen z.B. eine linke und eine rechte Initiative, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, „Gefühle schützen“ – und fordern deswegen ein „Gesetz gegen Hassreden“. Die Initiative „Ministerium für Glück und Wohlbefinden“ rät: „Gefühle spüren, annehmen und loslassen“.
Das ging schon los mit Worten und Sätzen wie „Es sind gefühlte 2 Grad“, „gefühlte 2 Stunden Verspätung“ oder „gefühlte 200 Kilometer“. Es war und ist von „Schuldgefühlen“, „Gefühlskälte“, „gefühlsmäßig“ und „ich fühle es eben“ die Rede. In der U-Bahn hört man auf Englisch: „I feel good“, „My feelings say ‚No‘ to him“, „He doesn’t feel anything“. Die englische Psychoanalytikerin Maxine Mei Fung Chung, und nicht nur sie, will in ihren Fallgeschichten „What Women Want“ (2023) an die Gefühle ihrer Klientinnen heran; sie will „offen sein für die Unterströmung unter den Dingen, die sie zur Sprache bringen“. Bei einer Patientin mutmaßt sie: „Vielleicht fällt es Ihnen leichter, ein negatives Gefühl gegen sich selbst zu richten“ – als auf andere, die sie schlecht behandeln.
Die Nietzscheaner raten dagegen: „Werdet oberflächlich, denn dorthin kommen die Wesen der Tiefe, um zu atmen!“ Ich will hier nicht darauf hinaus, dass die Freudsche Psychoanalyse zu einer Ich-Psychologie verkommen ist, zur Lebenshilfe von Leuten, die sich diese leisten können, wie es in der „Frankfurter Schule“ von Adorno/Horkheimer hieß, in der die Psychoanalyse mit Marxismus verbunden wurde, um die Gesellschaft im Hinblick auf ihre Veränderung zu analysieren – und nicht, um Mittelschichtler mit „Gefühlsstörungen“ in jahrelangen „Talking-Cures“ zu therapieren (fit zu machen).
Es ist noch schlimmer: Immer öfter fragen irgendwelche idiotischen TV-Moderatoren ihre Gäste – z.B. eine Frau, die überfallen wurde: „Und was haben Sie da gefühlt?“ Eine Umweltaktivistin wird gefragt: „Und was tun Sie persönlich gegen die Klimaerwärmung?“ Oder einen Kanadier, der auf ukrainischer Seite gegen die Russen kämpft: „How did you feel?“
.

.
Völlig grotesk ist die Lektüre des berühmten Bergsteigers Reinhold Messner, der ein Buch über seine Durchquerung der Wüste Gobi veröffentlichte – schon im Titel „Gobi – die Wüste in mir“. Es geht darin auf 265 Seiten um seine „Gefühle“. Ich war zwei Mal in der Gobi – und nie wäre mir eingefallen, mir gerade dort Gedanken über meine Gefühle zu machen. Ein anderes Buch von Messner heißt „Mein Leben am Limit“. Dies ist inzwischen ein geflügeltes Wort geworden von Millennials, die das Wochenende im Berliner Club „Berghain“ durchtanzen.
Es könnte aber z.B. auch von Geertje Marquardt stammen, die anderthalb Jahre trainierte, um Grönland zu durchqueren. Oder Birgit Lutz, die in ihrem Buch „Unterwegs mit wilden Kerlen: Eine Frau erobert die Arktis“ berichtet, dass und wie sie fünf Mal von einer russischen Driftstation zum Nordpol wanderte. Beiden Frauen ging es um die enorme Leistung, d.h. um Erfahrung und ihre „Gefühle“ bei diesem Extremsport im ewigen Eis, wo es sonst nichts gibt, und wenn doch, dann heißt es, schnell weiterstolpern, weil sonst die Vorräte nicht reichen. Solche Anstrengungen dienen dem „Austesten der Ich-Grenzen“, es sind „Ich-Unternehmen“, die massenhaft auch für viel Geld von Managern gebucht werden, wie das „Manager-Magazin“ 2018 berichtete, das dabei von „Limit Skills“ und „Erfolgsstrategien“ spricht.
Gegenüber diesen ganzen amerikanisch-profitabilisierten Ichigkeiten postulierte der französische Dichter Antonin Artaud bereits: „Das Ich ist eine Sauerei!“ Und „Alles Schreiben ist eine Schweinerei!“ (1925) Der französische Ethnologe Claude Lévi-Strauss erklärte: „Das Ich hat nicht einmal Platz zwischen Uns und dem Nichts“. In der Psychotherapie soll es zwischen dem eigenen Begehren und den Anforderungen der Anderen (der Gesellschaft) vermitteln. Da ist ein starkes Ich nur nützlich, und es läßt sich auch stärken, so dass der Patient hernach glücklicher ist, bewusster lebt, seelisch ausgeglichener ist usw.. So jedenfalls das Versprechen der „Seelenklempner“.
Aber nicht nur die Psychotherapie, in Kalifornien geriet selbst der Buddhismus, der eigentlich zur Überwindung der Ichigkeit (aller Selbstbezogenheiten) entstand, zu einer „Ich-Technik“ – einer Ich-Anreicherung oder zu einem „Ich + Ich“, wie ein Popsong 2010 beim Bundesvision Song Contest hieß, der auf Platz 3 kam: Eine Millennial-Antwort auf das Hauptwerk „Ich und Du“ des Religionsphilosophen Martin Buber 1923?
.

.
Micky Maus
Plötzlich tragen alle Teenager T-Shirts und Hemden mit Micky Maus drauf. Das wünschen sich jedenfalls die Modeketten, Desigual, Zara, Mango, HM etc.. In ihren Online-Verkaufsktalogen ist es schon so weit. Und das gab uns Rätsel auf. In der Vergangenheit hatte der Disney-Konzern jede Entwendung seiner Comicfiguren geahndet, mindestens abgemahnt. Hatten die Modeketten etwa die Rechte an Micky Maus gekauft oder hatte der Disney-Konzern sie ihnen sogar überlassen – als Werbemaßnahme, denn die Donald- und Micky Maus-Hefte sind bei den Millenials und ihren Nachgeborenen nicht mehr sonderlich gefragt.
Die Nachkriegsgeneration, zu der ich gehöre, ist dagegen mit dieser amerikanischen „Schundliteratur“ sozialisiert worden. Wir kannten keinen Ödipuskomplex, weil unsere geschlagen heimgekehrten Väter nach 45 keine Überzeugungskraft mehr aufbrachten, dafür mußten wir jedoch hilflos mit ansehen, wie unsere Mütter unsere erste Heftchensammlung vernichteten.
Es gab seit 1951 „Micky Maus Magazine“ und dann „Donald Duck“-Hefte, „Donald Duck & Co“, Donald-Taschenbücher etc.. Micky Maus war und ist ein elender Klugscheisser, zumal vor dem Hintergrund seines tumben Freundes Goofy, was schon dessen Name besagt. Aber Donald Duck, der zunächst 1931 als ein Freund von Micky Maus in Erscheinung trat, hatte mehr drauf: Sein Zeichner Carl Barks schuf ab 1952 eine ganze Entensippe um ihn herum, und daneben noch etliche andere Querdenker, wie den guten und den böse Erfinder Daniel Düsentrieb und Hugo Habicht sowie die verbrecherische „Panzerknackerbande“. Sie alle wirkten im Universum „Entenhausen“.
Donald, der sich in allen möglichen Berufen, sogar als Politiker, versucht, scheitert in jeder seiner Geschichten. Wenn er doch einmal Erfolg hat, dann ist das Erreichte ganz anders als das Erträumte, so dass es auch einem Scheitern gleichkommt. Aber Donalds Credo und damit das der international organisierten „Donaldisten“ lautet: „Scheitern, wieder aufstehen, wieder scheitern, wieder aufstehen usw. aber nie aufgeben!“ Die „Deutsche Organisation nichtkommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus“ beschäftigt sich in ihren Periodika nur mit den von Barks gezeichneten Geschichten, deren Sprechblasen von der Germanistin Dr. Erika Fuchs ins Nachkriegsdeutsche übertragen wurden. In ihrer Heimatstadt Schwarzenbach an der Saale ehrte man sie mit einem „Erika-Fuchs-Haus – Museum für Comic und Sprachkunst“. Einer, der heute für das FAZ-Ressort „Geisteswissenschaften“ zuständige Donaldist Patrick Bahners, wurde von Erika Fuchs als Antiquar in Entenhausen integriert. Bahners hat über die vielschichtigen Univerumsforschungen der Donaldisten 2014 das schöne Buch „Entenhausen – die ganze Wahrheit“ im FAZ-Verlag veröffentlicht.
Der kämpferische, aber etwas cholerische Donald hatte 1943 mit dem Donald-Duck-Zeichentrickfilm „Der Fuehrer’s Face“ einen Oscar für sein Auftreten gegen Hitler und dessen Regime bekommen. Im Jahr zuvor hatte er bereits Propaganda für den Krieg gegen Deutschland gemacht – mit dem Zeichentrickfilm „Donald Gets Drafted“. Kurzum: Donald ist trotz seines autoritären Charakters ein Antifaschist, während Micky Maus zwar „politisch korrekt“ ist, aber man glaubt ihm nicht, er ist außerdem extrem witzlos. Und hat auch einen anderen Zeichner.
Kann man sagen, dass die Micky Maus-Figur wie die Faust aufs Auge auf die Mode der jetzigen Teenager passt? Aber wie ist sie dorthin gekommen? Unter „Micky Maus Copyright“ findet sich folgender Eintrag: „Das Urheberrecht Micky Maus gehört nun allen. Die frühe Version der Micky Maus aus dem Kurzfilm ‚Steamboat Willie‘ (1928) ist nicht mehr durchs US-Urheberrecht geschützt.“ 95 Jahre besaß der Disney-Konzern die Rechte an ihm. Daraus folgere ich, dass die Modeketten aus Spanien und anderswo darauf nur gewartet haben – und ihre Designer sofort beauftragten, Micky Maus auf allen Produkten zu platzieren.
Der Verdacht drängt sich auf, dass es sich dabei um eine Verschwörung handelt, um eine Micky Maus Verschwörung. Was machen zwei Mädchen mit Micky Maus auf der Brust, wenn sie sich begegnen? Grüßen sie sich, zwinkern sie sich zu? Wir müssen mit der Aufklärung bis zum Frühjahr warten, dann sind sie nicht mehr so eingemummelt und man sieht ihre Micky Mäuse. Es ist dies eine internationale „Mädchenmode“. Machen die Jungs sie irgendwann mit – oder kontern sie mit „Minnie Maus“ – der ewigen Verlobten von Micky Maus oder gar mit dessen treudoofen Freund Goofy? In Albanien brachte man eine ganze Briefmarkenserie mit Goofy-Motiven heraus. Es gibt ihn auch noch als ständig lachenden „Supergoof“. Was für „Asterix“ der Zaubertrank sind für „Supergoof“ die Erdnüsse in seinem Garten. „Es passiert ihm aber regelmäßig, dass die Nüsse plötzlich aufhören zu wirken, während er sich noch in der Luft befindet,“ heißt es auf „Duckipedia“. Bei Micky Maus wirken die Erdnüsse gar nicht.
.

.
Lonely Planet
So heißt ein australischer Reiseführer für „Individualreisende“, vor allem für junge Leute („Backpacker“): „Komm mit zu den aufregendsten Städten, entlegensten Winkeln und zu den absoluten Geheimtipps…“ heißt es auf dessen Internetseite. Die Gesamtzahl der „Einsamen Planeten“-Ausgaben liegt bei etwa 650, die Gesamtauflage bei etwa 55 Millionen. Der Titel verdankt sich einem akustischen Mißverständnis und hätte eigentlich – basierend auf einem US-Song – „Lovely Planet“ heißen müssen, zumal der Planet, den die Backpacker abgrasen, alles andere als „lonely“ ist. Er ist aber auch nicht mehr „lovely“.
Eher gilt das für den Reiseführer „Ortskunde“ (2009) des Westberliner Künstlers und Geographen Thomas Kapielski, der dabei von einer „Kleinen Geosophie“ spricht, wohl weil sein „Planet“ nur den deutschsprachigen Raum umfasst. Als Schriftsteller, Musiker, Maler und Zeichner kommt er mit seinem „Bauchladen“, wie er das nannte, viel herum. Und „Lonely“ trifft es auch, denn er nimmt die Einladungen meistens alleine wahr.
Zur Autostadt Wolfsburg z.B.., wo er erfuhr, dass dort ein „Rolltreppenfest“ stattfand. Und in der Kreisstadt Itzehoe, dass dort ein Mann aus Laboe eine „Rolltreppenfahrt seiner Wahl“ gewann. „Er konnte sich zwischen Rolltreppen bei Karstadt, Hertie und denen des Holstein-Center-Itzehoe entscheiden.“ Bei Karstadt, fand Kapielski heraus und schrieb es in seinen Eintrag „Itzehoe“, gab es das „Fahrtreppenmodell Verlino – ‚das Allroundtalent für Kaufhäuser, Einkaufszentren, Flughäfen, Messen etc:‘ von Thyssen-Krupp“. Im Kaufhaus Hertie glitt man zu den einzelnen Verkaufsetagen mit dem „modernsten Fahrtreppentyp, den Competence 110 der Fa. Kone“. Und im Holstein-Center-Itzehoe konnte man sogar zwischen zwei verschiedenen Rolltreppen-Modellen wählen: „das Modular Moving Walkway von Otis und die Fahrtreppe 9300 AE für Geschäftsgebäude von Schindler“.
Bei den „Lonely Planet“-Reiseführern fragt man sich manchmal: Woher hat der Autor diese oder jene „Information“ bloß? – Und man ihm einfach glauben muß, so ist es mitunter auch in Kapielskis „Ortskunde“. Sein Eintrag „Itzehoe“ z.B. endet mit der „Information“, dass der Rolltreppenfahrt-Gewinner dort anscheinend alle Fahrtreppenmodelle ausprobierte, „anschließend spendierte [ihm] die Itzehoesche Kulturdezernentin Frau Dr. Hobl-Brühl Bananen-Split und gab freimütig Presseauskünfte“. War Kapielski bei ihrer Pressekonferenz dabei oder erfuhr er das bei einem Kneipengespräch in dieser „Mittelstadt beiderseits der Stör“? Viele Ortseintragungen in seinem Buch beginnen oder enden mit einem oder gar mehreren Kneipen-Hinweisen und geben Auskunft über die dort geführte Biersorte, gegebenenfalls mit einer knappen Aufzählung der Speisen, die der Autor dort zu sich nahm. Im Eintrag „Itzehoe“ hat er uns allerdings keinen Kneipentipp hinterlassen.
Das darf ich hier vielleicht ergänzen: „Die Marktklause“. Dort werden – bis heute – Biere der „Dampfbierbrauerei Zwiesel“ angeboten. Ich weiß das deswegen, weil ich vor langer Zeit in Itzehoe wegen Fahnenflucht vor Gericht stand. Ich sollte unweit der Stadt in eine Luftwaffenkaserne der Bundeswehr einrücken, hatte es aber vorgezogen, nach Stockholm auszuweichen, wo ich jedoch kein Auskommen fand und deswegen nach Westberlin fuhr, dessen Bewohner die vier Alliierten für nicht wehrpflichtig erklärt hatten. Dort wurde ich Hilfserzieher in einem Kinderheim. Damals zogen viele Fahnenflüchtige nach Westberlin. Als das dem Senat zu bunt wurde, leistete er „Amtshilfe“, d.h. die Fahnenflüchtigen wurden verhaftet und in die BRD ausgeflogen, wo sie sich vor einem Gericht zu verantworten hatten. Anschließend holten die Feldjäger sie ab und steckten sie erst einmal in eine Arrestzelle. Weil das nicht ganz rechtens war, fand jeden Freitag eine Protestdemonstration statt, wobei jedesmal etliche Kudamm-Geschäfte „entglast“ wurden. Zur besseren Koordinierung verteilte Christian Ströbele jedesmal Megaphone an die Kolonnenführer.
Weil ich zwar „freiwillig“ – mit der Bahn – zum Itzehoer Gericht gefahren war, aber die Feldjäger fürchtete, wurde ich von einigen Genossen begleitet. Ich bekam drei Jahre auf Bewährung und eine nicht unerhebliche Geldstrafe, zahlbar an einen Bundeswehr-Verband, aufgebrummt, die ich abstottern konnte. Und da mich anschließend keine Feldjäger in Empfang nahmen, gingen wir in die „Marktklause“, wo ich einen ausgeben mußte. So war das.
Hinzugefügt sei, dass sich in den „Lonely Planet“-Reiseführern die üblichen „Geheimtipps“ für Rucksacktouristen finden (Burgen, Schlösser, Museen etc.), während die „Ortskunde“ von Kapielski eher etwas für Reisende mit Aktentasche ist, wobei ein kleines Latinum, das ich jedoch nicht habe, durchaus das Verständnis seiner vielen religionsgeschichtlichen Eintragungen erleichtert.
.

.

Subtile Solidarität (1)
.

Subtile Solidarität (2)
.
Nashörner
Die Klimaforscher Werner Krauß und Hans von Storch warnten ihre Kollegen 2013 im Buch „Die Klimafalle“, sich der Politik anzudienen. Die Wissenschaft, die den Staat unterstützt, wird mit diesem vom Markt geschluckt. Die Politiker sind zudem gar nicht in der Lage, etwas gegen die Klimaerwärmung zu tun, denn sie sind verpflichtet, dem Wohle des Volkes zu dienen, höchstens können sie sich für solche Ökoprojekte engagieren, die ökonomisch profitabel sind oder das versprechen. Aber „wenn sie die Ökologie ökonomisieren, fügen sie bloß einer schwindelerregenden Vielfalt eine weitere hinzu,“ gibt der Wissenssoziologe Bruno Latour in seinem Buch „Kampf um Gaia“ (2017) zu bedenken.
Und die Wirtschaft? Der Chef von Shell z.B., Wael Sawan, ist den Anteilseignern verpflichtet, deswegen muß er genau prüfen, ob sein Konzern in diese Richtung „weiter aktiv bleiben“ will. „Wir wollen unbedingt weniger Kohlenstoff emittieren, aber der Weg dahin muss profitabel sein.“ Investitionen im fossilen Bereich bringen „mindestens 15% Rendite“, aber solche in „erneuerbare Energie nur 5-8%“.
Shell ist wie so viele andere große Konzerne ein „global Player“, Nutznießer der von Reagan und Thatcher angestoßenen „Globalisierung“. Diese wollen manche Linke und NGOs (Greenpeace z.B.) auch für sich reklamieren, was sich etwa in der Parole „Lokal handeln – Global denken“ zeigt oder in der Idee einer „Weltregierung“. Aber, sagt Latour, „genau dieser Utopie dürfen wir nicht auf den Leim gehen. Wir stoßen hier wieder auf die Figur des ‚Globus‘, die nicht nur unmöglich, sondern moralisch, wissenschaftlich und politisch tödlich ist…Sollten sie sich wundern, dass man den ‚Wald‘ sprechen läßt [wie u.a. der Anthropologe Eduardo Kohn in: „Wie Wälder denken“ – 2023], dann müssen Sie sich auch darüber wundern, dass ein Präsident als Vertreter von ‚Frankreich‘ spricht.“
Zwar müssen wir dem Staat „die Flötentöne beibringen“, aber wichtiger noch ist, wenn die „Demokratie neu beginnen soll“, dass dies „von unten her“ geschieht. Und das trifft sich laut Latour gut, denn „es gibt nichts Niedrigeres als den Boden“. Und der ist für uns „Erdverbundene“ (im Gegensatz zu den zum Mars flüchtenden Ami-Milliardären) unabdingbar. Alle Bodenforscher sind sich darin einig. (Siehe dazu den Überblick von Christiane Grefe und Tanja Busse „Der Grund“ – 2024): „Wie wir mit dem Land, mit den Flächen umgehen, ist die zentrale Zukunftsfrage.“
Die Vernachlässigung dieser „Grundlage“ zeigt, dass wir nie materialistisch genug gedacht haben. Und wenn doch einmal, dann wurde es ganz idealistisch – furchtbar falsch. 2016 veröffentlichten der Journalist John Mbaria und der Ökologe Mordecai Ogada eine Kritik des Naturschutzes in Kenia („The Big Conservation lie“). In einem „Geo“-Interview sagte Ogada: „Man muss nicht nach Afrika gehen und Elefanten retten. Naturschutz in Afrika ist eine Form von Selbstverwirklichung geworden. Gott sei Dank hat Jeff Bezos, der reichste Mann der Welt, noch kein Interesse an der afrikanischen Tierwelt gezeigt. Er würde uns den Rest geben.“
Immer wieder werden Dorfbewohner als Wilderer erschossen. „Geld aus Anti-Terror-Budgets, u.a. von den Amerikanern, fließt in den Naturschutz. So viel, dass private Sicherheitsunternehmen nach Afrika kommen. Typen, die vorher für das amerikanische Militär im Irak oder in Afghanistan gearbeitet haben. Keiner dieser Leute ist in Polizeiarbeit ausgebildet. Alles, was sie können, ist töten. Sie kommen nach Afrika, um Menschen zu töten. Weil es zu viel Geld gibt. Schutzgebiete sind ein unglaublich primitives und gewaltsames Mittel des Naturschutzes“.
Als Beispiel erwähnt Ogada eine NGO, die in Kenia ein Schutzgebiet für Nashörner eingezäunt hat: „Dort gibt es gutes Weideland und dauerhaft Wasser. Wegen des Zauns können aber die Menschen dort ihre Herden nicht mehr tränken. Sie zerschneiden den Zaun und werden verhaftet. Das ist ein Konflikt, den es ohne Zaun nicht gäbe. Naturschutz ist nicht nur Biologie. Er ist Soziologie, Geschichte, Politik, Anthropologie. Diese Nashörner leben nicht auf einer einsamen Insel. Und somit trägt die Wissenschaft zur Apartheid bei. In den Anzeigen sieht man weiße Touristen, Savanne bis zum Horizont und sonst keine Menschen. Sie lassen mit Photoshop Dörfer verschwinden und preisen ein Produkt an, das nicht existiert. Naturschutz ist der neue Kolonialismus. Früher nahm man den Afrikanern das Land mit Gewalt ab. Heute ist das nützlichste Werkzeug, um an Land zu kommen, ein Nashorn.“
.

.

.
Altruismus – Egoismus
Vor einiger Zeit wurden die Leipziger Schimpansenforscher durch eine Notiz in „Nature“ weltberühmt: Sie hatten experimentell bewiesen, dass auch Affen zu „altruistischem Verhalten“ in der Lage sind. Bisher ging die „Nature“-Forschung davon aus, dass dies nur dem Menschen eigen ist – eine Kulturleistung sozusagen, denn ansonsten herrsche unter den Lebewesen ein wüstes Hauen und Stechen (Competition). Dabei gilt dies im Gegenteil eher für angloamerikanisierte Gesellschaften, wo sogar die „Gewerkschaft“ ein schmutziges Wort ist, das man in Gegenwart von Vorgesetzten nicht in den Mund nehmen darf und in Harvard ist es den Studenten bei Strafe verboten, zusammen zu arbeiten. Deswegen erfand man in England auch das Survival of the Fittest – als Lebensprinzip, das Darwin dann laut Marx bloß auf die Natur übertrug. Die ganze Welt – Natur und Kultur – ein einziges riesiges Fitness-Center!
Die großartige Leipziger Altruismusentdeckung ließ den Tübinger Entwicklungsbiologen keine Ruhe: Der Hypothese des Anarchisten Fürst Kropotkin folgend, wonach man mit fortschreitender Mikrokopietechnik auch im bakteriellen Bereich ganz viel „gegenseitige Hilfe“ (Gewerkschaften) finden werde, entdeckten nun auch sie den Altruismus – speziell für die US-Zeitschrift „Nature“ – neu: und zwar bei den im Erdboden lebenden Myxobakterien. Wie in einem schlechten Hollywoodfilm, d.h. wie im globalisierten Neokapitalismus, gewinnen die Egoisten unter ihnen (die sich nicht zusammenschließen, um sich selbstlos fortzupflanzen), immer mehr an Boden – bis, ja bis kurz vorm Ende der ganzen schönen Bakterien-Kultur (die Forscher sprechen von einem „evolutionären Selbstmord“) wieder die Altruisten sich – einem „Phönix“ gleich – erheben und schließlich obsiegen. Durch aufopferungsvolles Kinderkriegen (Sporenbilden)! Die neodarwinistischen Tübinger machen dafür natürlich keine „Kommunikation“ oder Kooperation verantwortlich, sondern ganz dumpf-materialistisch ein vom Phönix-„Stamm“ produziertes Enzym namens „Acetyltransferase“, das sich selbstredend einer Gen-„Mutation“ verdankt. Während die FAZ kurz und gelassen blieb (mit Sporenfarbphoto), projizierte das Internetmagazin „Telepolis“ diese Altruismus-Entdeckung unter Bakterien, die leider nichts anderes tut, als den (antidarwinistisch) ausufernden Symbioseforschungen der US-Zellbiologin Lynn Margulis ein neues materialistisches Korsett zu verpassen, euphorisch – in einer Rezension – auf die menschliche Gesellschaft (zurück): „Das soziale System hat also letztendlich vom Kontakt mit den Betrügern (den Egoisten) profitiert und gelernt, sich zu verbessern.“ Wir – ein lernfähiges System, jedenfalls wenn Profit lockt!
Demgegenüber steht das ebenfalls vom Systemdenken durchdrungende chinesische „Weltbild“ der Kulturrevolution, das u.a. in dem vorbildlichen Menschen Lei Feng kulminierte, der sich als „kleine Schraube der Revolution“ begriff – und danach auch handelte. Von seinen altruistischen Taten kündete u.a. ein in Westdeutschland zu maoistischen Zeiten 1973 veröffentlichter Comic, der zuerst in Italien von Feltrinelli herausgegeben worden war. Zur gleichen Zeit hatte Joschka Fischer für den Voltaire-Verlag einen theoretischen Text über die „Aufhebung der Trennung von Hand- und Kopfarbeit“ in der Großen chinesischen Kulturrevolution übersetzt – aus dem Amerikanischen, es handelte sich dabei um einige Kapitel einer Doktorarbeit aus Harvard.
Den jungen Soldaten Lei Feng und sein kurzes Leben nahm sich 2000 Jürgen Kuttner für seine erste Volksbühnen-Inszenierung vor – nicht zuletzt, weil „uns Ostler doch immer noch der ganze SED-Staat um die Ohren gehauen wird, aber den ehemaligen Maoisten im Westen man die chinesischen Verbrechen nie vorwirft.“ Kuttner dachte dabei an die Gräuel der Kulturrevolution – und deswegen nun Lei Feng: als ein Comicmärchen.
Inzwischen ist der Volksbefreiungsarmist in China sogar zu einem „Popstar“ geworden, wie die FAZ schreibt. Statt US-genetisch mit Schimpansen und Bakterien argumentiert man dort gegen den um sich greifenden Egoismus eben chinesisch: so brachte z.B. die Firma Shanda ein Computerspiel mit dem Titel „Von Lei Feng lernen“ heraus, bei dem derjenige gewinnt, der am meisten anderen Menschen geholfen hat, also der Altruistischste.
Um noch deutlicher zu werden, hat man im früheren Revolutionsmuseum am Tienamenplatz ein Wachsfigurenkabinett eingerichtet – mit „offiziell anerkannten nationalen Helden“ (aus Vergangenheit und Gegenwart). Am Ende der illustren Parade, „wo der Besucher in die Zukunft entlassen wird“, stehen sich auf der einen Seite Lei Feng (mit seinem Armeelastwagen) und auf der anderen Seite der Microsoftgründer Bill Gates gegenüber: Das Politische und das Private – der Revolutionär und der Idiot: Iidiot in der alten griechischen Bedeutung von Privatmann – jemand, der sich nicht um die Polis, sondern bloß um seine Privatgeschäfte bekümmert. Der US-Präsident Coolidge sagte es einmal – positiv – so: „Americas Business is the Business!“ In diesem Sinne dürfte Bill Gates der weltweit größte Idiot sein – wohingegen die kleine Schraube Lei Feng bis zur Selbstopferung das genau entgegengesetzte Prinzip verkörperte. Die chinesische KP selbst versucht heute, sich dazwischen auszubalancieren – und das wird im ehemaligen Revolutionsmuseum auch jedem Chinesen geraten.
.

.

.
Weltverbesserungs-Vagabunden
Laut einer Gallup-Studie gibt es in der deutschen Wirtschaft 5,7 Millionen Beschäftigte, „die innerlich gekündigt haben“. Hinzu kommen mindestens noch einmal so viele, die keine Beschäftigung in der „deutschen Wirtschaft“ wollen. Überall werden Arbeitskräfte gesucht – und nicht gefunden, weswegen das „Bürgergeld“ gekürzt werden soll, damit die Bezieher nicht damit über den Monat kommen und dann doch entgegen ihrem Wünschen einen „Job“ annehmen müssen. Denken wir nur an die zigtausend jungen Frauen, die in Klamottenläden als Verkäuferinnen arbeiten und nichts anderes tun müssen, als immer wieder die Kleiderhaufen, die gelangweilte Kundinnen durchwühlt haben, erneut zusammenzulegen. Eine völlig sinnlose Beschäftigung, dazu noch sauschlecht bezahlt.
Ohne ihren Fortschrittsbegriff hat die kapitalistische Wirtschaft keine andere Bedeutung mehr als darin Geld zu verdienen. Aber die Unwilligkeit, die ihr Gefüge erodiert, bringt gleichzeitig hier und da Gegenentwürfe hervor. „15000 bis 20000 Deutsche werden dieses Jahr ihren Urlaub mit einem Freiwilligeneinsatz verbinden,“ schätzt eine Vermittlungsagentur.
Laura, die als Volontärin auf einer Meeresschildkröten-Rettungsstation in Costa Rica arbeitet, „um mit motivierten Menschen in Verbindung zu tretten und gemeinsam etwas von Bedeutung zu tun“, erzählt, wie sie da hingekommen ist: „Da gehst du jeden Tag zur Arbeit, legst über viele Monate Geld zur Seite, damit du irgendwohin reisen kannst, wo es schön ist, aber dann kannst du da nur zwei Wochen bleiben und gehst zurück in dieselbe Situation, aus der du gerade erst geflogen bist. Das ist doch verrückt! Und am nächsten Morgen klingelt der Wecker, und du hast dieses abscheuliche Gefühl im Bauch, dass ein neuer Tag an Dingen vor dir liegt, die du gar nicht wirklich magst. Aber du mußt sie erledigen, Tag für Tag, Jahr für Jahr, weil du ja dein Haus mit dem schönen Garten halten willst, in dem du allerdings fast nie wohnst, weil du ja ständig bei der Arbeit bist“.
Diese Wahrnehmung einer einst erstrebenswerten bürgerlichen oder kleinbürgerlichen Existenz entnehme ich dem Buch von Lars Bendels „Traum über Kopf“ (2024). Er, ein „Werbefuzzi“ und seine Freundin Anja Mäuerle, eine Spanisch-Dolmetscherin, waren zwei Jahre unterwegs in Afrika, Nord- und Mittelamerika, auf Hawaii, den Azoren und in Neuseeland, wo sie als „vagabundierende Voluntäre“ in Naturschutzprojekten und ökologischen Land- und Forstwirtschaften arbeiteten. Sie lösten ihre Haushalte auf, legten ihr Geld zusammen und begannen im südafrikanischen Nationalpark und in Botswana eine Ausbildung als Ranger. Dafür mußten sie einen „höheren fünfstelligen Betrag“ hinlegen! Die beiden begannen also als Azubis, die wie früher für ihre Lehre zahlen mußten. Auch ihre Arbeit in den darauffolgenden Projekten, jeweils für einige Monate, war etwas mehr als „ehrenamtlich“, weil sie auch dort ein bißchen was kostete. Immerhin brachte es ihnen neben Weltwissen und vielen Kenntnissen über Pflanzen und Tiere einen Buchvertrag ein.
Inzwischen kann man schon von einem ganzen Genre reden: Bücher von „vagabonding Volunteers“. Erwähnt sei Michi Schreibers Bericht „Unbändig: Wie ich nicht nur einen Affen auswilderte, sondern auch mich selbst“, Gesa Neitzels inzwischen drei Berichte über ihre Ranger-Arbeit in diversen afrikanischen Wildtier-Schutzreservaten (einer heißt „Frühstück mit Elefanten“), Kerstin Plehwes Buch „Die Weisheit der Elefanten“ über ihre Arbeit als Rangerin im Krüger-Nationalpark.
Wer sich als „Ranger“ ausbilden lassen will, muß viel Geld mitbringen. Der kenianische Ökologe Mordecai Ogada sieht das kritisch, in einem Geo-Interview meinte er: „Man muss nicht nach Afrika gehen und Elefanten retten. Naturschutz in Afrika ist eine Form von Selbstverwirklichung geworden“.
Etwas anders gelagert ist Markus Huths Erfahrungsbericht als reisender Tiersitter: „Mit 80 Viechern um die Welt“. Er passte in verschiedenen Ländern auf Haustiere auf, während ihre Besitzer verreist waren und bekam dafür etwas Geld.
Die eben beschriebenen Formen von ehrenamtlicher oder so gut wie nicht bezahlter Arbeit (was das Gegenteil von einem Job ist) sind erst einmal nur für junge Leute interessant, die nicht ganz mittellos sind, aber ziemlich anspruchslos und etwas abenteuerlustig. Im Internet finden sie die gewünschten Projektadressen. Und es werden dort immer mehr. Lars Bendels und Anja Mäuerles „Zuhause“ befand sich während ihrer Azubi- und Volontärszeit auf Instagram. Und unter ihren Lesern (Followern) gibt es sicher etliche, die es nicht bei Klicks belassen, sondern ebenfalls mehr vom Leben haben wollen – und dazu wohl erst einmal „Suchbegriffe zu Volunteers in Nationalparks und Wildtierrettungsstationen“ im Internet eingeben. Ähnliches traf auch auf eine Gruppe wandernder Zimmerleute aus Hessen zu, die ich in der Mongolei traf, wo sie von burjatischen Handwerkern Holzhausbau lernten.
.

.

.
Wir-eGs (1)
Weil die Arbeitslosen sich nicht so recht mit den sogenannten „Ich-AGs“ anfreunden wollen, versucht man potentiellen „Existenzgründern“ die „Wir-eG“ schmackhaft zu machen – also die Genossenschaft. Dazu wurde das aus dem Jahr 1889 stammende Genossenschaftsgesetz 2006 vereinfacht – und gleichzeitig den anderen Unternehmensformen angeglichen, d.h. einige seiner Besonderheiten gelöscht: Die Genossen heißen nun Mitglieder, aus dem Statut wurde eine Satzung, man braucht nicht mehr 7, sondern nur noch 3 Gründer, die jährlichen Pflichtprüfungen wurden entschärft, und außerdem eine Reihe wirklicher „Erleichterungen“ geschaffen, wie die „Financial Times Deutschland“ in ihrer Sonderbeilage über Genossenschaften schreibt. Zwar kam es daraufhin bereits zu einigen hundert Neugründungen in Deutschland, aber die meisten „Steuerberater, Rechtsanwälte und Bankangestellten“ wollen noch immer nichts von dieser Rechtsform wissen, wie der Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband (DGRV) klagt.
Selbst bei der Agentur für Arbeit und in feministischen Beratungsstellen wird immer noch z.B. einer arbeitslosen Sekretärin, die ein Café eröffnen will oder einer Floristin, die sich mit einem Blumenladen aus ihrer „Hartz IV“-Existenz „befreien“ möchte, erklärt, was sie dabei alles an Marktanalysen, Versicherungen und Finanzierungshebeln benötigt. Am Ende kommen selbst bei den simpelsten selbstgeschaffenen Arbeitsplätzen leicht Summen zwischen 30 und 80.000 Euro raus, was sich so manche Existenzgründerin, die man staatlicherseits sogar besonders fördern würde, zwei mal überlegt. So gut wie nirgends wird solchen Frauen nahegelegt, eine „gemeinschaftliche Existenzgründung“ ins Auge zu fassen. Dabei gehen die meisten „Ich-AGs“ pleite, während bei den „Wir-eGs“ die Insolvenz laut DGRV „fast ein Fremdwort ist“. Aber die Marktwirtschaftsstrategen und ihre ideologischen Steigbügelhalter sind noch immer primär auf durchsetzungsstarke Unternehmerpersönlichkeiten fixiert – und solche sind gerade in Genossenschaften „fehl am Platz“, wie der Vorsitzende der DGRV-Rechtsabteilung zu bedenken gibt, weil darin nämlich die „Basisdemokratie ganz groß geschrieben“ wird. Der Leiter der Akademie Deutscher Genossenschaften in Montabaur fügt hinzu: „Die Existenzberechtigung des Genossenschaftsunternehmens sind die Genossenschaftsmitglieder.“
In der EU wurde Anfang 2007 beschlossen, die Gründung von „beschäftigungsorientierten Genossenschaften“ zu fördern, vor allem um „lokale Ökonomien“ zu stärken. Das Land Berlin bot sich an, hierbei eine „Vorreiterrolle“ zu spielen, schreibt der Genossenschaftsexperte Jost W. Kramer von der „University of Technology, Business and Design Wismar“ in einer Studie darüber. Sie hat den Titel „Geförderte Produktivgenossenschaften als Weg aus der Arbeitslosigkeit? Das Beispiel Berlin“. Kramer hebt darin vor allem auf die Widersprüche in den Fördermaßnahmen ab, die zwar die Gründung von Produktivgenossenschaften forcieren sollen, deren Procedere jedoch gleichzeitig jeden abschreckt. War es bei den Ich-AGs noch das allzu hohe Risiko, so sind es nun bei den Wir-eGs die Hürden der behördlichen Überkomplexität – resultierend aus deren widerstreitenden Interessen und Ideologien. Kramer befürchtet denn auch, „dass die Maßnahme die beabsichtigten Ziele nicht erreicht.“ Die angehenden Genossen könnten über die Antrags-Widersprüche leicht die eigentliche Aufgabe ihres gemeinschaftlichen Unternehmens vergessen: nämlich etwas zu produzieren. Im Falle Berlins muß dies „Non-Food“ sein: Landwirtschafts- und Fischerei-Genossenschaften sind von der Förderung ausgeschlossen, dafür dürfen es nun jedoch Kulturgenossenschaften sein – heißt es im Prospekt der Investitionsbank Berlin, die dieses Senatsprogramm „abwickelt“: ein Wort, das im Osten keinen guten Klang hat.
Im Westen hat dagegen das Wort „Genossenschaft“ keinen guten Klang (mehr): Es klingt nach Funktionärssitzungen, wo man in verräucherten Räumen besoffene Entscheidungen trifft – Nach einem doch an sich überwundenen Kommunismus und überhaupt jeder „arbeiterlichen Gesellschaft“.
Anders linke Analytiker in Italien, wie z.B. Sergio Bologna und Franco Berardi (Bifo): Sie begreifen die Neigung vieler italienischer Arbeiter, die das Kapital in die „Selbständigkeit“ entließ, sich in Dienstleistungskooperativen bzw. Sozialkooperativen zu organisieren, als eine Art von Selbstbetrug. Nirgendwo in Europa gibt es inzwischen so viele Selbständige, aber auch nirgendwo so viele Genossenschaften wie in Italien.
.
.
.
Wir-eGs (2)
Als das Kreuzberger „Taxifahrer-Kollektiv“ sich in den Siebzigerjahren für die Unternehmensform „Genossenschaft“ entschied, wurde ihnen gesagt, sie seien in Westberlin die ersten Gründer wieder – seit 1945. Statistisch gesehen nahm die Zahl der Genossenschaften seit 1938 jedoch bis 2006 kontinuierlich ab. Ein anderer Brüssler Dachverband für 25 nationale Verbände – die CECOP – trägt dem bereits im Namen Rechnung – als „Europäische Konföderation von Produktivgenossenschaften, Sozialgenossenschaften und anderen Formen mitarbeiterkontrollierter Unternehmungen“.
Um den Gedanken von solchen gemeinschaftlich geführten Betrieben zu verbreiten – und gleichzeitig ihre Produkte vorzuführen, finanziert der Dachverband „Cooperatives Europe“ 2008/09 eine Art Leistungsschau europäischer Produktivgenossenschaften – in Berlin-Neukölln, Budapest, Dunaujvaros und Usti nad Labem.
Den Produkten sieht man die genossenschaftliche Herkunft nicht an, deswegen wird die Verkaufsausstellung ab dem 9. September flankiert von Filmen, Diskussionen und Dokumentationen über die Produzenten. Es handelt sich dabei um ein „Kunstprojekt“ das außerdem noch vom EU-Programm „Kultur 2007-2013“, vom ungarischen und tschechischen Ministerium für Kultur sowie von der Bundeskulturstiftung und dem Kulturamt Neukölln, finanziert wird.
Die Gegenseite schläft jedoch auch nicht. So meinte z.B. gerade Daniel Terberger, Chef der Modehandel-Verbundgruppe Katag, der von der Süddeutschen Zeitung nach dem Grund einiger Konkurse von Einkaufsgenossenschaften gefragt wurde: „Vielleicht sei es auch kein Zufall, dass vor allem solche Gruppen gescheitert seien, die genossenschaftlich organisiert waren und sich nicht in Familienbesitz befanden. ‚Wer gegenüber der eigenen Familie Rechenschaft ablegen muss, besitzt weniger Spielraum, Eitelkeiten zu pflegen, und empfindet möglicherweise größere Verantwortung‘.“
Sogar die Verfasser der Förderrichtlinien des Berliner Senats für Genossenschaftsgründungen sind noch an einer solchen Familienunternehmens-Philosophie ausgerichtet, wie Jost W. Kramer moniert, denn antragsberechtigt ist in den Richtlinien zwar die Genossenschaft, aber die Mitglieder haften für ihren rechnerischen Anteil am Förderbeitrag/Kredit „selbstschuldnerisch“. Formal „beantragt also die juristische Person eine Förderung, für die nicht sie, sondern ihre Mitglieder haften. Das steht in klarem Gegensatz zum Genossenschaftsgesetz.“ Wenn daraufhin dennoch Genossenschaften gegründet werden – und zwar wohlmöglich „ausschließlich wegen der Art und Weise ihrer finanziellen Förderung“, dann stellen diese überdies faktisch „einen Missbrauch des Genossenschaftsgedankens dar“.
In dem von Ferdinand Lassalle inspirierten „Gothaer Programm“ hieß es einst: „Die deutsche Arbeiterpartei verlangt, um die Lösung der sozialen Frage anzubahnen, die Errichtung von Produktivgenossenschaften mit Staatshilfe unter der demokratischen Kontrolle des arbeitenden Volks. Die Produktivgenossenschaften sind für Industrie und Ackerbau in solchem Umfang ins Leben zu rufen, daß aus ihnen die sozialistische Organisation der Gesamtarbeit entsteht.“ Karl Marx merkte dazu an: „An die Stelle des existierenden Klassenkampfes tritt eine Zeitungsschreiberphrase – ,die soziale Frage‘, deren ,Lösung‘ man ,anbahnt‘. Statt aus dem revolutionären Umwandlungsprozesse der Gesellschaft ,entsteht‘ die ,sozialistische Organisation der Gesamtarbeit‘ aus der ,Staatshilfe‘, die der Staat Produktivgenossenschaften gibt, die er, nicht der Arbeiter, ,ins Leben ruft‘. Es ist dies würdig der Einbildung Lassalles, daß man mit Staatsanleihen ebensogut eine neue Gesellschaft bauen kann wie eine neue Eisenbahn!“
Desungeachtet wurden dann aber doch jede Menge „Gewerksgenossenschaften, Produktivgenossenschaften ins Werk gesetzt – und dabei vergessen,“ wie Friedrich Engels rückblickend schreibt, „daß es sich vor allem darum handelte, durch politische Siege erst das Gebiet zu erobern, worauf allein solche Dinge auf die Dauer durchführbar waren.“
Es kömmt also darauf an, dass die Genossen über die Gründung ihres Gemeinschaftsunternehmens hinaus darum kämpfen, dass die gesellschaftlichen Bedingungen dafür allen entgegenkommen – sonst ist auch ihre eigene Genossenschaft zum Untergang verdammt. Die neuere Genossenschaftsforschung unterscheidet dabei drei Phasen – wobei sie den Genossenschaften eine quasi natürliche „Lebensspanne“ attestiert: Nach einer stürmischen Gründungsphase kommt eine ruhigere Konsolidierungsphase, die ihrerseits in ein langsames Siechtum übergeht.
Die Praxis vieler Genossenschaften, von denen einige immerhin schon weit über 100 Jahre existieren, hat jedoch gezeigt, dass im Gegensatz zu den Menschen die Genossenschaften mehrere „Lebensspannen“ kennen, jedenfalls dann, wenn sie sich in dem einst von Rosa Luxemburg so genannten Widerspruch zwischen sozialistischer Betriebswirtschaft und kapitalistischer Volkswirtschaft bzw. zwischen mitarbeiterfreundlichem Arbeitsklima und profitorientierten Geschäftsführung immer wieder ausbalanciert.
.

.
Helden/Heldinnen (1)
„Unglücklich das Land, das Helden nötig hat,“ schrieb Bertolt Brecht. Jetzt ist das deutsche Land endlich unglücklich, mit so ziemlich allem – von der Stationierung amerikanischer Raketen und den eskalierenden Ukraine-Gaza-Yemen-Kriegen über die Fußball-EM und die vielen Starkregen bis zu den zu hohen Mieten und der rotgrünen Regierung mit ihrem Wärmepumpengesetz, verbunden mit dem Wechsel von billigem russischen Erdgas zu teurem amerikanischen Frackingscheiß.
Und da kommen uns auch schon – quasi wie bestellt – ein paar Eventkanonen mit einer fetten Ausstellung samt Katalog über „Helden“, d.h. mit einem ganzen Fächer voller Held*innen. Es ist selbstverständlich eine „kritische“ Ausstellung, diachronisch und synchronisch sowieso, zudem legt sie nahe, dass die Wahrheit des Heldentums heute vielfältig ist, eine Multitude geradezu: Helden für jeden und in jeder Lebenslage. Solch eine Vielfalt verdanken wir, als Habenichtse, der angloamerikanischen Globalisierung (während ihre neoliberalen Profiteure allerdings eher die Einfalt preisen).
Die einen aus dem Prekariat schwärmen nun für ihre Helden im „Dschungelcamp“, für den Fußballer Lionel Messi oder für den Hitlerattentäter Stauffenberg, die anderen für einen schwulen Formel-1-Fahrer, für Donald Trump oder für den ermordeten Martin Luther King, und wieder andere für Greta Thunberg Carola Rackete oder Taylor Swift. Für kurze Zeit auch für drei junge Männer von einer freiwilligen Feuerwehr in Sachsen, die mutig alle Brände löschten, aber dann als Brandstifter entlarvt wurden. Wir wollten als Helden dastehen, entschuldigten sie sich vor Gericht.
All diese Vorbilder und noch viele mehr werden von der Ausstellung auf dem ehemaligen französischen Flugplatz in Berlin-Gatow, der nun ein „Militärhistorisches Museum“ ist, ins Feld geführt. Drumherum befindet sich auf dem Freigelände die weltweit größte Sammlung von militärischen Großgeräten. Sie umfasst Flugabwehrsysteme (Flugabwehrkanonen und Flugabwehrraketen), Radargeräte, aber auch andere Erfassungssysteme und Zielhilfen, Transport-, Schlepp- und Wartungsfahrzeuge, Fernmeldesysteme und ortsfeste Anlagen.
Für die Ausstellung sind die Veranstalter tiefschürfend in die Geschichte des Heldischen eingestiegen: Angefangen mit dem mythischen Helden Herakles, der Griechenland einst löwenfrei machte, und dem biblischen Helden David, der den Riesen Goliath besiegte, wenn man dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ glauben darf.
Aber wer ist das, der nun diese ganzen Helden derart ins Spiel bringt? Das ist zum Einen der „Sonderforschungsbereich 948 der Universität Freiburg“, von dem ich immer dachte, dass da knallharte Militärforschung betrieben wird, aber nein: doch eher weiche. Denn mit Geld von der „Deutschen Forschungsgemeinschaft“ wurde in diesem „DFG-Projekt Nummer 181750155“ zwölf Jahre lang über „Helden. Heroisierungen. Heroismen“ geforscht, d.h. gegrübelt und Material gesammelt – bis entweder das Geld ausging oder man sich sagte: Nun ist genug. Vielleicht meinte aber auch das mitbeteiligte „Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr“ in Potsdam (wo man statt in weißen Kitteln in olivfarbenen Uniformen forscht und der Leiter ein forscher Oberst ist, zusammen mit einem englischen Militärhistoriker): Jetzt müssen wir endlich mal Nägel mit Köpfen machen!
Eben eine Ausstellung. Der „Sprecher“ des Sonderforschungsbereichs, ein „klassischer Archäologe“, bekam einen neuen Job: als Sprecher des „Direktoriums des Freiburg Institute for Advanced Studies“. Und für die Gestaltung der Ausstellung gewann man (mit viel Geld?) die linke, aufklärerische „Künstlergruppe Rimini Protokoll“, wie Wikipedia das dreiköpfige Berliner „Autoren-Regie-Team“ nennt, das normalerweise eher die „Anti-Helden“ feiert/featured, denn „die Helden wurden inzwischen von Antihelden verdrängt, da diese wesentlich attraktiver zu sein scheinen. Dies liegt daran, dass sie verletzlich, unglücklich und größtenteils das Produkt einer gescheiterten Gesellschaft sind,“ wie es auf „gedankenwelt.de“ heißt und wie die Uni Kiel sie erforscht. Also eher Don Quichotte als Manfred von Richthofen.
Der sowjetische Schriftsteller Alexander Goldstein will diese Verdrängungsleistung allerdings nicht hinnehmen. In seinem Roman „Denk an Famagusta“ (2016) fragt er sich deswegen, ob „die Kultur“ nicht am Ende ist, „wenn fette Operettenballetteusen und sie beweihräuchernde Börsenspekulanten die Helden sind“? An anderer Stelle bedauert Goldstein: „Der Familienvater ist der heutige Held.“ Also wenn es um „Helden des Alltags“ geht – wird dann nicht das „Prinzip Held“ ausgehebelt? Der Polnische Theaterwissenschaftler Andrzej Wirth meint in seiner erzählten Autobiographie „Nach vorn“ (2013), dass die ungeheuerlichen Naziverbrechen eine „Entindividualisierung des Helden“ bewirkt habe, verbunden mit einer „Entindividualisierung der Situation“. An anderer Stelle spricht er dafür von einem „Heroismus des Aufhörens“, dazu erwähnt er verschiedene Theaterkollegen, die, wenn es am Schönsten war, etwas anderes unternahmen.
.

.
Helden/Heldinnen (2)
Es gab neben dem rechten Hamburger Verleger Axel Caesar Springer noch einen anderen Multimillionär, der eine Berghütte in den Alpen besaß. Aber während Springer ein eher trauriger Rechter war, der seltsame Partys in seinem Haus auf Sylt feierte und seinen Astrologen befragte, wann der günstigste Zeitpunkt für ein Geheimgespräch mit Nikita Cruschtschow wäre, dem er dann das Angebot machte, die DDR zu kaufen, war der Mailänder Multimillionär Giangiacomo Feltrinelli ein linksradikaler Verleger. Er veröffentlichte zwar das Buch „Doktor Schiwago“ von Boris Pasternak im Westen, was ihm von der CIA zugespielt wurde. Ansonsten verlegte er jedoch keine antisowjetischen sondern antikapitalistische Werke. Überhaupt ähnelte er eher dem Genfer Schriftsteller Daniel de Roulet, der „oben auf einem Schweizer Berg Axel Caesar Springers Chalet in Brand steckte,“ wie Roulet schrieb (siehe Junge Welt v. 9.7.).
Feltrinellis Berghütte in den Kärtner Bergen war sein „geheimer Zufluchtsort, zwischen den Bäumen versteckt hielt der fortschrittliche Verleger all die alten schikanösen Herrenrechte aufrecht. Man bezahlte ein Wegegeld, um passieren zu dürfen und die Wachen mit Federhut nahmen Frauen, die Holz sammelten, fest und übergaben sie der Polizei. Es war ein Gärtner, der ihn später zur Revolution bekehrte,“ schreibt der Schriftsteller Nanni Balestrini in seinem Buch „Der Verleger“ (2020), in dem es um Feltrinellis Versuch geht, 1972 einen Strommast bei Mailand in die Luft zu sprengen, bei dem er umkam.
Balestrini und mit ihm einige „Experten“ legen nahe, dass an dem Sprengstoffattentat „mindestens drei, wenn nicht sogar vier Personen, darunter auch eine Frau“ beteiligt waren. „Es gibt Gerüchte über eine ausländische Freundin des Verlegers, die Schmiere gestanden haben soll“ (so wie auch die Freundin von Roulet bei seinem Brandanschlag Schmiere stand. )
Am Ende seines Buches über Feltrinellis Tod erwähnt Balestrini einen Koffer, in dem sich ein Tonband befand, das aus einem Versteck der „Roten Brigaden“ stammte, und „auf dem ein Mitkämpfer Feltrinellis mit dem Kampfnamen ‚Gunter‘ den Ablauf der Aktion erzählte.“
„Die Roten Brigaden hatten eine eigene Untersuchung des Todes von Feltrinelli durchgeführt. ‚Gunter‘ war ein Mitglied der GAP (der 1970 von Feltrinelli gegründeten ‚Gruppo d‘Azione Partigiana’), das parallel zu dem Anschlag auf den Strommast eine zweite Aktion gegen einen weiteren Strommast ausführen sollte, um Mailand in Dunkelheit zu hüllen und dort geplante Aktionen militanter Gruppen zu erleichtern Angeblich ist ‚Gunter‘ mit einem ehemaligen Partisan namens Ernesto Grassi, der 1977 verstorben ist, identisch“ (dieser ist nicht mit dem eher rechten Mailänder Philosophen Ernesto Grassi identisch, der 1991 hochgeehrt in München starb.)
Wikipedia hat sich für eine andere Erklärung des Todes von Feltrinelli entschieden: „Nach 2010 ans Licht gekommene Indizien bestärken Zweifel an der Unfalltheorie, so die Verletzungen an der Leiche Feltrinellis, die – einem damals unterdrückten Gutachten zufolge – auf einen ‚Angriff von hinten‘ und nicht auf eine selbstverschuldete, versehentlich zu früh ausgelöste Bombenexplosion hindeuten. Auch Staatsanwalt Guido Viola will heute eine Verwicklung von Geheimdiensten in den Tod Feltrinellis nicht mehr ausschließen. Zu Feltrinellis 50. Todestag, 2022, war zumindest klar, dass er sowohl vom italienischen Geheimdienst als auch von der CIA beobachtet worden war.“
Die Familie Feltrinelli war mit Immobilien reich geworden. Giangiacomo Feltrinelli besaß neben vielen anderen Immobilien auch eine „Jugendstilvilla am Gardasee mit einem Garten aus Tausendundeiner Nacht und einem Kilometer Privatstrand“, wo er seine „prunkvollen und verrückten Partys mit Hunderten von Gästen, intellektuelle Anarchisten, Extremisten, Abenteurer jeder Couleur, und vielen schönen Frauen…“ feierte. Wenn er nicht auf seiner Yacht war oder am Gardasee Hof hielt, dann war er auf Kuba – als großer Verehrer von Ernesto „Che“ Guevara und Freund von Fidel Castro, deren Bücher er verlegte.
Den Verlag hatte Giangiacomo Feltrinelli 1954 gegründet. Nach seinem Tod übernahm seine Frau Inge Feltrinelli (1930–2018) die Leitung des Verlags, der heute von ihrem Sohn Carlo Feltrinelli geführt wird. Der Verlag hat ab 1957 in die Bereiche Buchhandel (122 Läden bis heute) sowie in den Onlinehandel und in Fernsehen investiert. Zur „Gruppo Feltrinelli“ gehört das Verlagshaus mit einer von Giangiacomo Feltrinelli gegründeten Forschungs- und Kulturstiftung, die laut Balestrini eine einmalige Sammlung linker Schriften beinhaltet.
Daneben unterstützte er auch einige linksradikale italienische Gruppen finanziell und besorgte laut Wikipedia die Pistole, „mit der am 1. April 1971 in Hamburg der dortige bolivianischen Konsul Roberto Quintanilla möglicherweise von der Deutschen Monika Ertl erschossen wurde. Quintanilla war führend an der Polizeiaktion zur Aufspürung und Ermordung Che Guevaras beteiligt gewesen.“
.

.
Helden und ihre Geliebten
Zwei Mal hatte ich mit Redakteuren zu tun, die immer wieder von ihren Freundinnen kritisiert wurden, wenn sie lasch und luschig wurden, also es ohne Not an radikalem Denken fehlen ließen. Sowohl die Redakteure als auch ich, wenn ich es denn mitbekam, begrüßten diese Kritik. Dabei ging es um männigliche Kopfarbeit (Textbearbeitungen). Es gibt aber auch Fälle, wo eine Frau ihren Freund aus Liebe zur Handarbeit (zur Tat) drängte.
Im Gegensatz zum slowakischen Widerstand gegen die Deutschen im Zweiten Weltkrieg, der in einen blutigen Partisanenkrieg gipfelte, war der tschechische Widerstand kurz: Er begann am 5. Mai 1945 und endete mit einem Waffenstillstand sowie mit dem Abzug der deutschen Wehrmacht aus Prag am 8. Mai 1945. Er dauerte also drei Tage, am nächsten Tag zog die Rote Armee in die befreite Stadt ein. Bei den Widerständlern kämpfte der Gymnasiast Josef Skvorecky. Seine Beteiligung geschah, weil er seiner Freundin imponieren wollte, wie er später in seinem Buch „Feiglinge“ (1986) berichtete. Es erschien zunächst in seinem Verlag „68 Publisher“, nachdem er mit seiner Frau ins Exil nach Kanada geflohen war, als die Rote Armee den „Prager Frühling“ 1968 mit Waffengewalt beendete.
In der amerikanischen und westdeutschen Studentenbewegung in den Sechziger- und Siebzigerjahren gab es ebenfalls etliche Linke, die militant wurden, um ihrer Freundin zu imponieren, vermute ich jedenfalls stark. Aus der Geschichte der Arbeiterbewegung und der KPDSU sowie der KPD weiß man von einigen Genossen sogar, dass sie ihrer Freundin bzw. Ehefrau in den Untergrund bzw. den bewaffneten Kampf folgten, nachdem diese sie zum Mitmachen gedrängt hatten.
2006 erschien auf Deutsch ein Bericht des Genfer Informatikers und Schriftstellers Daniel de Roulet mit dem Titel „Ein Sonntag in den Bergen“. Dazu hieß es auf dem Umschlag: „An einem schönen Sonntag im Kalten Krieg habe ich oben auf einem Schweizer Berg Axel Caesar Springers Chalet in Brand gesteckt. Wie und warum, das will ich hier erzählen.“ Weiter heißt es dort: „Zuvor aber möchte ich schildern, was mich dazu getrieben hat, diese Tat zu gestehen. Auslöser war nur eine Bemerkung, die mich im Innersten berührt hat: ‚Ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht wie mir, Tag für Tag bekämpfe ich das, wofür ich mich als junger Mann engagiert habe‘.“
Die Bemerkung stammt vom Bundeskanzler Gerhard Schröder 2003. Daniel de Roulets erfolgreicher Brandanschlag geschah 1975, die Tat war gemäß Schweizer Gesetz nach 10 Jahren verjährt. Seinen Bericht danach widmete der Autor seiner Jugendliebe, die 2005 an Krebs gestorben war. Er wurde 1944 geboren, sie vier Jahre später. Während ihrer Beziehung kritisierte sie ihn immer wieder: „Sie fand mich zu zögerlich, warf mir vor, ich hielte Sonntagsreden und trüge nichts dazu bei, unsere prachtvollen Schweizer Berge von den Mistkerlen zu säubern, die sich dort verkrochen.“
Mit der Zerstörung des Springerschen „Adlernestes“ oberhalb des noblen Gstaad, wo man im Winter nur mit dem Hubschrauber hinkam, wollte er ihr „beweisen, dass sie sich irrte“ – ihr zeigen, dass er „zur Abwechslung auch mal ein Held sein konnte“ – als „Sonntagsterrorist“, den sie einen „Textualtäter“ nannte. Sie beteiligte sich an der Tat. Als „Weihnachtsgeschenk“ für sie mietete er eine Nacht im Gstaader „Palace Hotel“ – unter falschem Namen, mit windfesten Perücken und einer gestohlenen Kreditkarte. Zuvor hatte er an der TH Zürich einen „Kurs über Dynamit“ mit praktischen Übungen und einem Zeugnis am Ende belegt. Die Brandstiftung führte er jedoch mit zwei Weihnachtskerzen und einer Tube Brennpaste im Living-Room des Chalets aus, während sie draußen „den Luftraum überwachte“.
Das Schlimmste war früh Morgens von Palace Hotel aus der Aufstieg zum Chalet. Sie brauchten dazu fünf Stunden in Eis und Schnee. „Lächelnd übernahm sie die Führung.“ Die Zerstörung des „Adlernests“ von Springer, dem vermeintlichen „Nazischwein“, nannte er „Operation Berchtesgaden“ – in Anspielung an Hitlers Alpen-Refugium. Für die Presse hatte er ein Bekennerschreiben verfaßt und in frankierten Umschlägen bereit gelegt. Der Anschlag hatte internationale Ermittlungen zur Folge, „auf unseren Kopf wurde ein Preis ausgesetzt“. Zunächst richtete sich der Verdacht natürlich (!) auf einen Russen und dann auf deutsche Terroristen. Jahre später besuchte Daniel de Roulet den Tatort noch einmal, ohne seine Freundin: Vom Springerschen Chalet keine Spur mehr, der Berg war wieder „rein und weiß“.
Es gab noch einen anderen Multimillionär, der eine ähnliche Berghütte – allerdings auf einem Kärtner Berg – besaß: den linksradikalen Verleger Giangiacomo Feltrinelli. Die Hütte war sein „geheimer Zufluchtsort, zwischen den Bäumen versteckt hielt der fortschrittliche Verleger all die alten schikanösen Herrenrechte aufrecht. Man bezahlte ein Wegegeld, um passieren zu dürfen und die Wachen mit Federhut nahmen Frauen, die Holz sammelten, fest und übergaben sie der Polizei. Es war ein Gärtner, der ihn später zur Revolution bekehrte,“ schreibt der Neoavantgardist Nanni Balestrini in seinem Buch „Der Verleger“ (2020), in dem es um Feltrinellis Versuch ging, 1972 einen Strommast bei Mailand in die Luft zu sprengen, bei dem er umkam.
Balestrini und mit ihm einige „Experten“ legen nahe, dass an dem Sprengstoffattentat „mindestens drei, wenn nicht sogar vier Personen, darunter auch eine Frau“ beteiligt waren. „Es gibt Gerüchte über eine ausländische Freundin des Verlegers, die Schmiere gestanden haben soll“. Am Ende seines Buches über Feltrinellis Tod erwähnt Balestrini einen Koffer, in dem sich ein Tonband befindet, das aus einem Versteck der „Roten Brigaden“ stammt, und „auf dem ein Mitkämpfer Feltrinellis mit dem Kampfnamen ‚Gunter‘ den Ablauf der Aktion erzählt.
Die Roten Brigaden hatten eine eigene Untersuchung des Todes von Feltrinelli durchgeführt. ‚Gunter‘ war ein Mitglied der GAP (der 1970 von Feltrinelli gegründeten ‚Gruppo d‘Azione Partigiana’), das parallel zu dem Anschlag auf den Strommast von Segrate eine zweite Aktion gegen einen weiteren Strommast ausführen sollte, um Mailand in Dunkelheit zu hüllen und dort geplante Aktionen militanter Gruppen zu erleichtern Angeblich ist ‚Gunter‘ mit einem ehemaligen Partisan namens Ernesto Grassi, der 1977 verstorben ist, identisch.“ Dieser ist nicht mit dem Mailänder Philosophen Ernesto Grassi identisch, der 1991 in München starb.
Feltrinelli besaß neben vielen anderen Immobilien auch eine „Jugendstilvilla am Gardasee mit einem Garten aus Tausendundeiner Nacht und einem Kilometer Privatstrand“, wo er seine „prunkvollen und verrückten Partys mit Hunderten von Gästen, intellektuelle Anarchisten, Extremisten, Abenteurer jeder Couleur, und vielen schönen Frauen…“ feierte. Und wenn er nicht am Gardasee Hof hielt, dann war er auf Kuba, als großer Verehrer von Ernesto „Che“ Guevara und Freund von Fidel Castro, deren Bücher er verlegte.
.

.
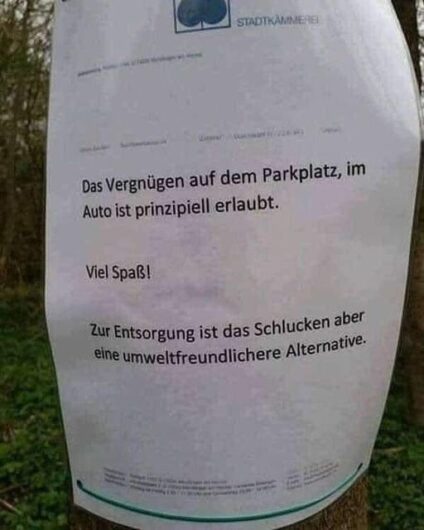
.
Politikerschellen und -schelte
Es gibt ein DDR-Satiremagazin „Eulenspiegel“ (obwohl es die DDR nicht mehr gibt) und ein BRD-Satiremagazin „Titanic“ (obwohl es auch die BRD nicht mehr gibt, weil sie sich über ganz Deutschland ausgedehnt hat).
Ein Humorvergleich – aus Platzgründen an einem Beispiel. In beiden Heften werden in ihren Juni-Ausgaben Angriffe auf Politiker und Wahlhelfer aus den Parteien thematisiert.
„Politikerdresche“ heißt der zweiseitige Text im „Eulenspiegel“, in dem die Angegriffenen „Backpfeifengesichter“ genannt werden. Über die Angreifer heißt es da, dass die einen ihren „Unmut über den Zustand der Welt“ verbalisieren (schimpfen), während andere eher zuschlagen: „Die Bevorzugung eines dieser beiden Talente erscheint willkürlich und ungerecht.“ Wenn es um die Teilhabe am politischen Geschehen geht, sollte Deutschland die Kritik, „die im Vollkontakt zum Volksvertreter ihren Ausdruck findet, nicht pauschal als unangemessen verurteilen.“
Allerdings gibt der Autor den „Prügelverächtern“ Recht: Die handfeste, gleichsam proletarische Kritik sollte den „richtigen Adressaten“ treffen. Zu oft greifen die „Schläger“ noch „weithin unbekannte Kommunalpolitiker an – arme Seelen mit Geltungsdrang und sogenanntem Gestaltungswillen, deren Handlungsspielraum meist gegen Null geht“. Darauf folgt eine lange Aufzählung von allen wichtigen Politikern – bekannt aus Funk und Fernsehen.
Der Autor unterscheidet beim „Kontakt“ also zwischen Kopf- und Handarbeitern. Da scheint noch die Old Klassenkampf-School durch, denn er fährt fort: „Wer beim Lesen all dieser Namen nicht ein einziges Mal innerlich die Faust geballt hat, werfe den ersten Stein.“
So weit die „Pro“-Handarbeiter-Seite, die 2. Seite soll dazu „Contra“ geben, ihr Autor hebt jedoch bloß auf die intellektuellen Mängel der Handarbeiter ab, die „zu selten den Wirtschaftsteil der Tageszeitung lesen und sich häufiger auf die eher schlicht gehaltenen Informationen aus Whatsapp-Nachrichten, Tiktok und Spiegel Online verlassen“. Als Demokrat sollte man aber „immer die Sichtweise jeder Seite betrachten“.
Das BRD-Satiremagazin „Titanic“ geht das Thema pragmatischer als die DDR-Satire an, indem sie einen „großen Politiker-Prügel-Planer“ veröffentlicht, ausgehend von dem Eindruck, dass mit den Angriffen die „Politikverdrossenheit“ wohl endgültig überwunden ist. Damit das auch so bleibt hat der Autor Ort und Zeit von 10 Parteitreffen recherchiert und gibt dazu jeweils Prügel-Tipps. Bis auf das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) und die FDP sind dies jedoch alles Parteien, die nach den Wahlen unter „Sonstige“ rangieren, also eher „Underdogs“, zudem „Single Issue“-Gruppen (Tierschützer z.B.), die wohl kaum Angriffe gewaltbereiter Wähler fürchten müssen.
Dazu sind die „Titanic“-Prügelvorschläge alle mehr dichterischer Natur. So schlägt sie z.B. bei der FDP vor: „Auf nach Eckernförde zum fröhlichen Liberalen-Wämmsen“ und beim BSW: „Es lechzt nach Knüppelsuppe mit Königsberger Kloppe – in Radolfzell“. Bei den acht „Sonstigen“ geraten dem Autor seine „affrond action“-Vorschläge vollends zu Lyrismen: Da wird einer Partei „Senge bis der Poppen glüht“ versprochen, für eine andere „saftige Schellen“ empfohlen, und eine dritte darf „frische Blessuren in Bitburg“ erwarten.
Beim Ost-West-Vergleich fällt auf, dass gerade die größeren Parteien und ihre Wortführer den Handarbeitern von den „Eulenspiegel“-Autoren nahegelegt werden, während die „Titanic“ CDU, AfD, SPD und Die Linke unberührt läßt, erst recht deren „Zugpferde“. Ihr „Prügel-Planer“ nimmt vor allem die Kleinen, nahezu Selbstlos-Aktiven ins Visier. Bei ihr im Westen (Frankfurt/M) hat man sich also wohl vom Klassenkampf abgewendet, mehr noch: Seit die Frankfurter Lederjacken-Fraktion von Joschka Fischer in die große Politik aufrückte, und er den Ritterschlag in Harvard bekam, wird auf die weiterhin auf Straßenpolitik beschränkten Prekären eingedroschen, wobei die „Schläger“ einen Sinn für lyrisches Haudrauf mitbringen sollen. Der „Eulenspiegel“ gefällt sich dagegen in parteiischem Abwägen eines angemessenen Zorns beim Wahlvolk in einer „gelebten Demokratie“.
Was ist für diese beiden „Printmedien“ erfolgreicher? Während die „Titanic“ laut FAZ „vor der Pleite steht“, gehören zur „Eulenspiegel Verlagsgruppe“ schon acht Buchverlage. Auch die Personalpolitik ist aufschlußreich: Während die „Titanic“ sich vom berühmt-berüchtigten DDR-Publizisten Karl-Eduard von Schnitzler („Sudel-Ede“) schnell wieder verabschiedete, stellte der „Eulenspiegel“ den proletarischen Westberliner Kaufhauserpresser Arno Funke bis heute als seinen wichtigsten Karikaturisten an. Als der noch im Freigänger-Knast saß, bekam er schon einen Arbeitsplatz in der Redaktion und dazu ein Fahrrad, das ihm allerdings bereits am 1.Tag im Gefängnis (!) geklaut wurde.
.

.
Jammerossis
„Zum ersten Mal fiel mir auf, dass es in der Leipziger Innenstadt keine öffentlichen Plätze mehr gab. Dass all die Orte, an denen man sich einst versammeln konnte, verschwunden waren…Der Osten ist überschrieben worden, schreibt Jana Hensel in „Achtung Zone“ (2009). Ähnliches geschah auch in Berlin mit dem Alexanderplatz.
2004 wurde im Osten gegen die Einführung von Hartz IV demonstriert. Diese Montags-Demonstrationen waren laut Hensel „ein jämmerliches Bild, das sich bot. Es war kein Platz mehr für sie da.“ Immerhin kamen in Leipzig noch 10.000 Demonstranten zusammen (in Hamburg waren es 30). Der Spiegel schrieb über die demonstrierenden Ostler: „Sie klagen, sie jammern. Viele hängen der Bequemlichkeit der DDR nach und haben sich an das Prinzip der Eigeninitiative nicht gewöhnt.“ Für die Schnullijournalisten der Westpresse waren die einzigen positiven Momente in der Geschichte der DDR zwei Aufstände gegen die SED-Diktatur: die der Bauarbeiter 1953 (mit Westunterstützung) und des Wir-Volkes 1989, der schon 1990 von der Kohlschen „Allianz für Deutschland“ (AfD) nachhaltig beeinflußt wurde.
Für Jana Hensel sind die Straßenproteste nach 1989 (wo es 220 gab) bis heute viel wichtiger: 1990 wurden sie zunächst weniger, aber 1991 waren es bereits 291, 1992 waren es 268 und 1993 noch mehr, nämlich 283. Die Studie, auf die sich die Autorin beruft, endet in jenem Jahr, das auch durch eine zunehmende Härte in der Auseinandersetzung mit der Unverschämtheit der BRD charakterisiert war. In Bischofferode und u.a. in der Berliner Batteriefabrik Belfa fanden Hungerstreiks statt, bei Demonstrationen gegen die Treuhand-Politik wurden Spitzel und Provokateure vom Westen eingesetzt.
Es war eine reine „Spiegelfechterei“ meinte die Narva-Justitiarin über den langen erfolglosen „Kampf“ des Berliner Glühlampenwerks gegen dessen Abwicklung durch die Treuhand. Ähnlich gingen auch die meisten anderen Widerstandsaktivitäten der anderen Ostbelegschaften aus. Die am Streik der Kalibergarbeiter in Bischofferode beteiligte Pastorin Christine Haas meinte anschließend über ihre resignierten Mitkämpfer: „Während der Auseinandersetzungen, so anstrengend sie waren, ging es fast allen gut. Danach fiel alles auseinander. Viele wurden krank, vier starben sogar. Nach der Niederlage passierte fast nur noch rückwärtsgewandtes Zeug im Eichsfeld: Schützenvereinsgründungen, Traditionsumzüge und sogar Fahnenweihen.“ Neben dem Eingang zum Kaliwerk stand noch 1996 die Büste Thomas Müntzers mit dem eingemeißelten Spruch „Die Gewalt soll gegeben werden dem gemeinen Mann”. Dies sei leider zu wörtlich genommen worden, erklärte mir der letzte Betriebsratsvorsitzende Walter Ertmer: “Die allergemeinsten haben jetzt die Macht!”
Zwischen 1991 und 1993 gab es die „Ostdeutsche Betriebsräteinitiative in die so ziemlich alle zu dem Zeitpunkt noch halbwegs existierenden, aber von gänzlicher Abwicklung bedrohten DDR-Großbetriebe ihre Betriebsräte entsandten. Die Initiative war branchenübergreifend und wurde deswegen von den Branchengewerkschaften IG Metall und IG Chemie bekämpft, gleichzeitig jedoch vom DGB materiell unterstützt: Eine typische infantilisierende „Double-Bind“-Strategie der Westgewerkschaftsorganisationen.
Aus dem „rückwärtsgewandten Zeug“ mendelten sich an vielen Orten im Osten dann die „Pegida-Montagsdemonstrationen“ heraus (20.000 Teilnehmer allein in Dresden), und diese Bewegung ging dann in der „Alternative für Deutschland“ (AfD) auf, deren Nationalismus und Ausländerfeindlichkeit sich mit ähnlichen Rechtsentwicklungen in vielen anderen, nicht nur europäischen Ländern verbindet. Didier Eribon hat in seinem Buch „Rückkehr nach Reims“ (2016) nachgezeichnet, wie aus den Linken Rechte wurden. Bei der Bundestagswahl 2017 verlor die Linke laut Hensel 400.000 Wähler bundesweit an die AfD.
2018 veröffentlichte sie zusammen mit Wolfgang Engler eine Diskussion über die bisherigen Erfahrungen von Ostdeutschen: „Wer wir sind“. Engler meint darin, „dass diese Bundestagswahl vielleicht das Ende der Nachwendezeit markiert – so wie das Jahr 1968 das Ende der Nackriegszeit markiert“ (die 68er-Bewegung hatte damals ebenfalls viele Länder erfaßt). Der Erfolg der AfD stellt für Engler, „erst einmal gänzlich wertfrei gesagt, die bisher größte Emanzipationsleistung der Ostdeutschen dar“. Eine „Emanzipation“ vom Denken der verfluchten „Besserwessis“. Bei der Europawahl 2024 war das Ergebnis noch einschneidender: Die Linke kam auf 2,7% der abgegebenen Stimmen, die AfD dagegen auf 15,9%.
.

.

.
„Deutsche Dunkelheit“
1943 erschien in den USA ein Buch mit dem Titel „Ist Deutschland unheilbar?“, zuvor hatte der Autor, ein Psychiater namens Richard M. Brickner, bereits einen Aufsatz über die deutsche „Paranoia“ veröffentlicht (die später auch als „German Angst“ bezeichnet wurde). Deutschland war für Brickner „ein Kind, das sein Gefühl des Versagens, das mittelalterliche ‚Reich‘ durch Reform oder Revolution in die Gegenwart zu transformieren und damit zu eigener Identität zu kommen und Staat zu werden, durch Aggressivität gegen sich und andere zu kompensieren versuchte,“ schreibt der Leipziger Künstler Lutz Dammbeck in seinem Buch „Seek“, das der Entstehung und Ausweitung der militärischen Elektronik in das zivile und künstlerische Leben der USA bis zur „Pax Americana“ nachgeht.
In seiner Ferndiagnose für Deutschland stellte Brickner den „friedlichen und auf Kooperation bedachten Balinesen“ (die 1935 von der mit Brickner zusammenarbeitenden Anthropologin Margaret Mead studiert worden waren), ferner den „Indianern und anderen ‚Naturvölkern‘ den preußischen Junker gegenüber: das Schreckgespenst einer Kaste, die mit ihrer Aggressivität, Arroganz und Militanz die deutsche Kultur dominierte und von klein auf erzogen und trainiert wurde, Krieg zu führen.“
Schon seit langem hatte man das von den Junkern beherrschte Ostelbien mit der Plantagensklaven-Ökonomie der Südstaaten verglichen. Und bis heute hat sich der Süden der USA nach dem Sieg des Nordens und seiner „Reconstruction“ nicht wieder ökonomisch erholt.
Ähnlich in Ostelbien: Nach Auflösung der DDR wurde ihr deindustrialiertes Territorium mit einem gigantischen „Umschulungsprogramm“ überzogen: „Sie müssen lernen, sich besser zu verkaufen,“ hieß das Erziehungsziel in ihrem zu einem „Marktstaat“ umgebauten Sozialismus. Gleichzeitig erhielten die Junker bzw. ihre Erben preisgünstig ihre Ländereien und Gebäude im Osten zurück, einschließlich vieler volkseigener Wälder.
1944 diskutierte eine Konferenz in New York die Bricknersche „These von einer kollektiven Paranoia der Deutschen“, dabei wurde ein großes Programm zu ihrer Umerziehung („Reeducation“) entworfen. Die meisten Teilnehmer (Psychiater, Psychoanalytiker, Soziologen und Pädagogen) „waren dem psychoanalytischen Konzept Freuds verpflichtet, vor allem seiner im englischsprachigen Raum dominierenden Definition von Paranoia,“ schreibt Lutz Dammbeck, der an anderer Stelle seines „Seek“-Buches nachweist, dass Freuds Paranoia-Definition „schlicht falsch“ war. Obwohl die Brickner-Konferenz „mit einem in der Sache falschen Begriff arbeitete, den sie den Reeducation-Rezepten zugrunde legte, hatten die Konzepte der USA für eine Reeducation der Deutschen nach 1945 langfristig gesehen einen scheinbar großen Erfolg“. Scheinbar.
„Der Geist des Rationalismus“ sollte nach dem Sieg der Alliierten „die deutsche ‚Dunkelheit‘ ersetzen, der Geist des Kalküls die deutsche ‚Unberechenbarkeit‘, der Geist der Toleranz den deutschen ‚Radikalismus‘, der Geist des Liberalismus die deutsche ‚Despotie‘ und der Geist einer humanitären Brüderlichkeit den deutschen ‚Rassenwahn‘.“ Dabei wollte man die Demütigung der Deutschen, wie nach dem Ersten Weltkrieg geschehen, vermeiden. Nach ihrer „Genesung“ sollten sie „Partner Amerikas in einer neuen Weltordnung“ sein, dazu musste das Land ein „Marktstaat“ werden. „Die Eigenkräfte der Wirtschaft und deren normative Kraft des Faktischen würden dann zum Anschluss Deutschlands an das westliche System einer liberalen Marktwirtschaft und eines unteilbaren freien Weltmarktes führen.“
Heraus kam dabei jedoch, dass die Westdeutschen servile Nachäffer der Amis wurden und ihre Paranoia sich im Kollektiv erneut bei „Corona“ und „Putin“ zeigte und zeigt. Schon in den Siebzigerjahren, hatte der nach Amerika ausgewichene und 1955 zurückgekehrte deutsch-jüdische Sozialphilosoph Ulrich Sonnemann dafür plädiert, Westdeutschland auf einer 870-Kilometer-Couch zu therapieren. Ich habe vorweg gegriffen.
Um für das nicht billige Projekt der Umerziehung aller Deutschen zu werben, kam Ende 1944 ein Film in die amerikanischen Kinos: „Morgen, die ganze Welt!“ Darin reist ein Hitlerjunge als Waisenkind in die USA, wo er gegen Juden, Frauen und Schulkinder von Einwanderern agiert. An ihm wird mit Hilfe einer Mischung aus Psychoanalyse und Reflextheorie/Behaviorismus „das Experiment der deutschen Umerziehung erprobt“. Er bekommt auch Prügel – von einem polnisch-stämmigen Klassenkamerad. Aber am Ende erhält er „durch den Akt eines ‚Reinforcement‘ [einer Verstärkung] die Uhr, die er sich zu Beginn des Films so sehnlich gewünscht hat. Danach bricht er zusammen. Er weint. Nun kann er neu aufgebaut werden. Der deutsche Hitlerjunge wird in die amerikanische Familie aufgenommen und amerikanisiert. Schaut her, so werden wir das machen. ‚Auch ihr könnt so wie wir sein!‘“ Ihr Deutsche!
.

.
„Gesellschaft“
Marx hielt die russische Dorfgemeinschaft (Obschtschina) 1881 noch für sozialismustauglich, wenn die Bauern sich mit der Arbeiterklasse verbündete. Er erwähnte dazu das auf Blutsverwandtschaft basierende germanische Gemeinwesen, das sich zur „ersten gesellschaftlichen Gruppierung freier Menschen“ umwandelte - hin zu einer Wahlverwandtschaft , die nicht mehr „durch Blutsbande eingeengt war“. Diese freien germanischen Dorfgemeinden gingen jedoch im Gegensatz zu den unfreien russischen unter.
100 Jahre nach Marx ist jedoch nicht nur mit der bolschewistischen Revolution und der darauffolgenden Kollektivierung der Landwirtschaft – als Basis der nachgeholten Industrialisierung – auch die russische Dorfgemeinschaft so gut wie untergegangen. Im Westen ist inzwischen sogar das Dorf selber verschwunden, wie der holländische Autor Geert Mat 1996 am Beispiel des friesischen Ortes Jorwerd zeigte; seine Studie trägt den Titel „Der Untergang des Dorfes in Europa“.
Nach Auflösung der von Marx beschriebenen „Gesellschaftlichkeit der Arbeit“ setzte sich mit der Verwandlung von Kaufmannskapital in Industriekapital, d.h. mit der Scheidung von Produzent und Produktionsmittel, langsam eine „Wiedervergesellschaftung der Arbeit“ durch, jedoch nur in ihrer abstrakten Form. Denn die Warenproduktion läßt nur eine solche zu. In ihrem „gesamten Umkreis herrscht Abstraktheit“, erklärte uns dazu der Marxist Alfred Sohn-Rethel. „In erster Linie ist der Tauschwert selbst abstrakter Wert im Gegensatz zum Gebrauchswert der Waren. Der Tauschwert ist einzig quantitativer Differenzierung fähig, und die Quantifizierung, die hier vorliegt, ist wiederum abstrakter Natur im Vergleich zur Mengenbestimmung von Gebrauchswerten. Selbst die Arbeit…wird als Bestimmungsgrund der Wertgröße und Wertsubstanz zu ‚abstrakt menschlicher Arbeit‘, menschlicher Arbeit als solcher nur überhaupt. Die Form, in der der Warenwert sinnfällig in Erscheinung tritt, nämlich das Geld,…ist abstraktes Ding und in dieser Eigenschaft genaugenommen ein Widerspruch in sich. Im Geld wird auch der Reichtum zum abstrakten Reichtum, dem keine Grenzen mehr gesetzt sind.“
Bereits die Griechen befürchteten diese Grenzenlosigkeit des Geldes. „Als Besitzer solchen Reichtums wird der Mensch selbst zum abstrakten Menschen, seine Individualität zum abstrakten Wesen des Privateigentümers. Schließlich ist eine Gesellschaft, in der der Warenverkehr den nexus rerum bildet, ein rein abstrakter Zusammenhang, bei dem alles Konkrete sich in privaten Händen befindet.“ Bzw. die nicht eher ruht, bis alles privatisiert ist. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die weltweite Privatisierung von Wasserwerken und in den Dürrezonen von Brunnen durch IWF, Weltbank und WTO sowie auch an deren Erleichterungen bei der Patentierbarkeit ganzer Organismen und Zelllinien durch Konzerne.
Für den Marxisten Robert Kurz bedeuten solche „Staatsakte“ eine Art Schlußverkauf – d.h. den Anfang vom Ende, jedenfalls der Nationalökonomien, die mit den nun transnational operierenden Betriebsökonomien obsolet geworden sind und selbst nur noch betriebswirtschaftlich agieren können – einmal, indem sie gegeneinander und bis runter zu den letzten Großgemeinden „Standortmarketing“ betreiben, gleichzeitig ihre ganze Infrastruktur verscherbeln („wenn dabei jedoch die Konkurrenz eingeführt wird, dann ist es keine Infrastruktur mehr“) und zum anderen, indem sie sich bald nur noch auf Sicherheitsaufgaben beschränken. Denn die Zonen der Verwilderung und Barbarei herrschen längst nicht mehr nur an der Peripherie, sondern ziehen sich durch die kapitalistischen Metropolen selbst.
Es ist aber kein vermeintlich „freies Land“, wie während der Ersten Industriellen Revolution in Amerika, Australien und Teilen Russlands mehr vorhanden – zum Ansiedeln von „Überflüssigen“, wie Zygmunt Baumann sie nennt. Und während es der Zweiten Industriellen Revolution noch gelang, die vom Land verdrängten Menschenmassen z.T. für das Fabriksystem zu mobilisieren, wobei sie dann mit dem Fordismus auch noch als Konsumenten in Erscheinung traten, geschieht nun mit der Dritten Industriellen Revolution das Gegenteil: das Kapital demobilisiert sie, während gleichzeitig die Ende des 19.Jahrhunderts für sie geschaffenen „sozialen Netze“ demontiert werden: Die Gesundheitssysteme werden ebenso privatisiert wie die Bildungseinrichtungen.
Einige Soziologen meinen bereits, dass es keine Gesellschaft mehr gibt, sie schlagen deswegen vor, auch auf den Begriff zu verzichten, da er analytisch irreführend geworden sei. Das erinnert an Margaret Thatcher, die zusammen mit Ronald Reagan den globalisierten Neoliberalismus beförderte – mit dem Satz „Ich kenne keine Gesellschaft, nur Individuen“.
.
.
Battlefield Engagement
„It’s the economy, stupid!“. Mit diesem Wahlkampf-Slogan gewann Bill Clinton 1992 die US-Präsidentschaftswahlen. Er gewann zwar, aber wie er richtig gesagt hatte, die Wirtschaftspolitik wird von der Wirtschaft, d.h. vom Kapital bestimmt. 2002 übersetzte mir jemand ein Interview, das die damalige US-Botschafterin in der Mongolei einer mongolischen Zeitung gegeben hatte. Darin legte sie der mongolischen Regierung eine entschiedenere Deregulierung nahe. Auf die Frage, welche Partei sie dies denn am ehesten zutrauen würde, sagte sie: „Es ist egal, welche Partei die Regierung hier stellt, sie hat sowieso keinen Spielraum.”
2007 wurde der maßgebliche Deregulierer der USA, der Vorsitzende der US-Notenbank Alan Greenspan gebeten, eine Empfehlung für die bevorstehende Präsidentenwahl zu geben. Er meinte: „Wir haben das Glück, dass die politischen Beschlüsse in den USA dank der Globalisierung größtenteils durch die weltweite Marktwirtschaft ersetzt werden. Mit Ausnahme des Themas der nationalen Sicherheit spielt es kaum eine Rolle, wer der nächste Präsident wird.“
Und selbst die „nationale Sicherheit „ wird nicht unwesentlich von den Waffenherstellern zum „Thema“ gemacht. Notfalls über solche Transmissionsriemen wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie sitzt u.a. im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik und im Förderkreis Deutsches Heer, wo auch die Wehrindustrie mitredet. „Beides sind von der Rüstungsindustrie stark beeinflusste Organisationen,“ schreibt „Lobbycontrol“. Als FDP-Politikerin ist sie Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der NATO, ferner Vorsitzende im Verteidigungsausschuss des Bundestages und fungiert im Parlament als scharfe Kritikerin des Zögerns der Bundesregierung beim Waffengang der NATO-Staaten in die Ukraine, um Russland zurück zu schlagen. Ihr Wahlkreis ist der „Rheinmetall“-Standort Düsseldorf. Der Westdeutschen Zeitung sagte sie: „Wir waren immer der Auffassung, dass wir unter keinen Umständen zulassen dürfen, dass Russland mit seinem Angriff Erfolg hat. Wenn das einträfe, dann werden weitere Angriffe in Europa folgen. Die Nachbarn Russlands sind stark gefährdet. Und irgendwann kratzt die russische Kriegsmaschinerie auch an unserm Nato-Territorium. Zurecht würden uns die Bürger vorwerfen, nicht weitsichtig genug reagiert zu haben, als noch Zeit dazu war.“
Auch der bayrische CSU-Ministerpräsident Markus Söder legt sich für „seine“ Waffenindustrie ins Zeug: „Die TAURUS-Marschflugkörper müssen zum Einsatz kommen,“ meinte er in der „Tagesschau“. Die Herstellerfirma „TAURUS Systems“ befindet sich nämlich in Bayern und sucht derzeit wegen der zu erwartenden großen Nachfrage schon mal 170 weitere Mitarbeiter für ihr „Battlefield-Engagement“, wie die Firma ihr Massenmordwaffengeschäft nennt.
Als hohe deutsche Luftwaffenoffiziere kürzlich zusammen kamen, um die Möglichkeit zu besprechen, wie die Bundeswehr die Ukraine mit TAURUS-Marschflugkörpern beliefern und „praktische Hilfe für die ukrainischen Streitkräfte gegen Ziele in Russland“ leisten könne, wurde ihr Gespräch von russischer Seite abgehört und der deutsche Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, daraufhin im russischen Außenministerium aufgefordert, eine „Erklärung“ dazu abzugeben. Auch dieser FDP-Mann ist dafür, die Ukraine mit Waffen aus dem Westen derart aufzurüsten, dass sie Russland Paroli bieten kann – und wenn die ganze Welt dabei in Scherben fällt. Über die zaghafte Friedensbewegung hierzulande äußerte er 2023: „Die Ostermarschierer sind die fünfte Kolonne Wladimir Putins, politisch und militärisch“.
Aus allen Rohren wird uns nahegelegt: Es diesmal dem Iwan aber wirklich zu zeigen. Auch die Kinder werden indoktriniert: Am 27. Februar sendete z.B. die ZDF-Kindernachrichtensendung Logo ein kleines Video, in dem TAURUS-Marschflugkörper und andere Waffen als Personen, die sprechen können, für Waffenlieferungen in die Ukraine plädierten. Ebenfalls im ZDF äußerte sich die stellvertretende Leiterin des EU-Instituts für Sicherheitsstudien, Florence Gaub, über die Gegner: „Wir dürfen nicht vergessen, dass auch wenn Russen europäisch aussehen, dass es keine Europäer sind, jetzt im kulturellen Sinne, dass sie einen anderen Bezug zur Gewalt haben, einen anderen Bezug zum Tod haben.“
Das sahen die NATO-Strategen und -Analysten 2001 noch anders: Damals erklärte uns ein Major des Verteidigungsministeriums die neue NATO-Verteidigungsdoktrin: „Sie ist nicht mehr nach Russland hin angelegt, die russischen Soldaten haben inzwischen dieselbe Einstellung zum Krieg wie wir auch – sie wollen nicht sterben! Außerdem ist die Stationierung von Raketen in Ungarn und Polen so gut wie gesichert, es geht nur noch darum, wie viel wir dafür zahlen müssen. Ganz anders sieht es jedoch bei den Arabern aus, mit dem Islam. Deswegen verläuft die neue Verteidigungslinie jetzt auch“ – rasch zog er hinter sich eine neue Landkarte auf – „etwa hier: zwischen Marokko und Afghanistan“.
Aber jetzt geht es wieder andersherum: So wie es einst der Oberst Graf Stauffenberg gehofft und geplant hatte: Noch einmal, diesmal mit den westlichen Alliierten zusammen, gegen die Russen.
Die von den Amis gehirngewaschene neue Außenministerin Baerbock sagte es so: „Wir müssen der Ukraine helfen, auch wenn wir einen Atomkrieg riskieren“. Der ehemalige Leiter der Heinrich Böll Stiftung, nunmehr Geschäftsführer des finsteren European Resilience Initiative Center, Sergej Sumlenny findet: „Der sicherste Weg zu einem nachhaltigen Frieden ist es, das nukleare Russland zu zerstören. Einige Atombomben könnten dabei explodieren, aber sie werden ohnehin explodieren.“
Die Liste der Kriegslüsternen, die so reden, wächst täglich. Vor allem angloamerikanische Kapitalfraktionen scheinen die Eskalation zu forcieren. Wohl weil einige kalkulieren: „Wir überleben das“. Wenn ein paar Milliarden Menschen oder wie viele auch immer dabei draufgehen, dem Planeten tut das nur gut. Das ist auch eine Art von Öko-Politik. Sie bereiten sich auf einen Atomkrieg vor und erwerben gleichzeitig bombensichere Villen auf Neuseeland. Eine andere Kapital-Fraktion, nennen wir sie die Silicon-Valley-Highflyer, will anscheinend auf den Mars ausweichen.
Neben immer mehr Hightechwaffen schicken die NATO-Staaten auch immer mehr Bodentruppen an die russische Grenze, getarnt als Sicherheitspersonal für die Botschaften: Im Februar 2023 waren bereits 97 Spezialtruppen aus den Nato-Ländern in der Ukraine stationiert, davon 14 aus den USA. Für diese wurde am 13.Juli 2023 verfügt, dass „das Landgebiet und der Luftraum über der Ukraine mit Wirkung vom 24. April 2022 als Gebiet für unmittelbare Gefahrenzulage“ ausgewiesen sei. Die Zulage besteht aus 225 Dollar pro Monat, zusätzlich kommen weitere 100 Dollar Erschwerniszulage pro Aufenthaltsmonat in der Ukraine hinzu.“
Einem Bericht der „New York Times“ zufolge soll die US-Regierung mit einem russischen Einsatz von Atomwaffen im Herbst 2022 gerechnet haben. Auch Olaf Scholz wusste von der Bedrohung. Die Amerikaner hatten ihn anscheinend informiert.
Egal. Seit der Antike gilt, dass sich mit dem Tod bessere Geschäfte als mit dem Leben machen lassen. „Nichts steigert Nachfragen und Umsätze schneller als Kriege, und nirgends werden mehr Gewinne gemacht als beim Wiederaufbau,“ schreibt der Regisseur Holger Teschke.
.

.

.
Paradiesvertreibung
Aus dem Paradies vertrieben mußten die ersten beiden Menschen sich draußen schweißnaß durchkämpfen. Noch lange danach wurde die von Europäern „unberührte Wildnis“ als gefährlich wahrgenommen. Das hat sich jedoch am Ende der Aufklärung im 18. Jahrhundert verändert. Der Umwelthistoriker William Cronon thematisiert dies in seinem Buch „Uncommon Ground: Rethinking the Human Place in Nature“ (1995). Die „Wildnis“ wurde positiv besetzt, zunächst von der Romantik und dann von den zahlreich sich artikulierenden Naturschützern. Die ersten Tierschutzgesetze gab es in England bereits 1822 und zwei Engländerinnen gründeten 1898 den ersten Vogelschutzbund „The Royal Society for the Protection of Birds“.
Im Gegensatz etwa zu Novalis, der als Dichter und Ingenieur Ende des 18. Jahrhunderts noch Romantik und Bergbau verbinden konnte, betrachteten 100 Jahre später die aktivistischen Naturfreunde während der stürmischen Industrialisierung und Kolonialisierung das weltweite und emsige Wirken der Weißen vor allen anderen als naturzerstörerisch. Von den Indigenen nahmen sie zunächst noch an, dass diese „in Harmonie mit der Natur“ leben würden. Und sei es nur, weil deren bescheidene Kräfte (Jagdwaffen, Rodungen, Landwirtschaft) die „Wildnis“ nicht völlig denaturieren konnten.
Im Maße die Indigenen jedoch von den Weißen „berührt“ und in den kapitalistischen Warenverkehr einbezogen wurden, was zugleich bedeutete, dass ihre „Kräfte“ wuchsen (Gewehre, Kleidung, Fernsehen, Pick-up-Trucks, Motorboote, Smartphones etc.), wurden sie aus den „wilden“ Landschaften vertrieben – von all jenen, die diese „mit Mühe zu bewahren versuchen“, wie die Philosophin Deborah Danowski und der Anthropologe Eduardo Viveiros de Castro das in ihrem Buch zur Klimakatastrophe: „In welcher Welt leben?“ (2023) über die Naturschützer schreiben. Die beiden brasilianischen Autoren erinnern darin an den „Indio in Jeans, der ‚nicht mehr Indio‘ sei und daher nicht mehr der Erde [und der Wälder] bedürfe, sondern der ‚Staatshilfe‘, wie die Großgrundbesitzer meinen – mit der stets enthusiastischen Unterstützung jener ‚engagierten‘ Medien, die gleichzeitig interessengeleitete Partner und servile Klienten des Kapitals sind“.
Die Vertreibung der Indigenen aus ihren Stammesgebieten, Reservaten und unzugänglichen Wäldern „spielt Machthabern in die Hände, die nichts mit denen der Präservationisten [Naturschützer] zu tun haben“. Für diese basierte die „Wildnis“ dann auf einer „grundlegenden Opposition zwischen ‚Leben‘ (dem unerschöpflichen Überfluß von Formen und einem subtilen Gleichgewicht der Kräfte) und ‚Menschheit‘ (als ‚antinaturale‘ Spezies per se oder lediglich in ihrer modern-industriellen Form), die als das Leben beschmutzend und es qualitativ wie quantitativ vermindernd gedacht wird“.
In letzter Zeit mehren sich jedoch die Verteidiger der vertriebenen oder von Vertreibung bedrohten Indigenen, was man u.a. an der Arbeit von Organisationen wie „Survival International“, das „Oakland Institut“ und der Zahl der Bücher zum Problem feststellen kann. „Die Naturschutzgebiete bedecken heute etwa ein Achtel der Landflächen des Planeten: rund 19 Millionen Quadratkilometer. Vor allem in den so genannten Entwicklungsländern schossen Nationalparks und Tierreservate in den vergangenen drei Jahrzehnten wie Pilze aus dem Boden – ihre Zahl verfünffachte sich dort“, berichtete das Wissenschaftsportal „spektrum.de“ 2008, das Beispiele erwähnt, wo sich Geschäftsleute an den Rändern von Naturschutzgebieten ansiedelten, um am Öko-Tourismus zu verdienen, während die dort lebenden Indigenen in die Slums der Städte abwanderten. Was einst die Verfasser der brasilianischen Staatsdoktrin zur Eingeborenenpolitik pathetisch veröffentlichten, klingt heute bloß noch zynisch: „Unsere Indianer sind Menschen wie wir alle. Aber das Leben in der Wildnis, das sie in den Wäldern führen, setzt sie Elend und Leid aus. Es ist unsere Pflicht, ihnen dabei zu helfen, sich aus ihrer Zwangslage zu befreien. Sie haben ein Recht darauf, sich in den Stand der Würde eines brasilianischen Staatsbürgers zu erheben, um ganz am Fortkommen der einheimischen Gesellschaft teilzunehmen, und um in deren Annehmlichkeiten zu kommen.“
2013 bezeichnete die brasilianische Kabinettschefin Gleisi Hoffmann die Verteidiger der verfassungsmäßigen Rechte der Indios an ihrem Land als „Minderheiten mit irrealen ideologischen Projekten“.
Genauso reden auch die indischen Politiker über „ihre“ Indigenen, die sie oft „Maoisten“ und mit Militär jagen. Bedeutend sensibler geht man auf dem Subkontinent mit den Wildtieren um. Auf „downtoearth.org.in“ heißt es z.B.: „Wir haben einigen Grund zum Stolz, denn Indien ist das einzige Land weltweit, in dem die Menschen und ihr Vieh in nächster Nähe von Raubtieren leben“. So haben z.B. um Bombay (Mumbai) herum inzwischen rund 40 Leoparden ihren Lebensraum. Nachts streifen sie durch die Stadt und jagen Strassenhunde, die sie fressen – etwa 1500 im Jahr.
.

.
Naturschutz-Miseren
Statt der europäischen und amerikanischen Trophäenjäger suchen jetzt vermehrt die noch reicheren arabischen Jäger die Nationalparks heim. Darüberhinaus fließt immer mehr Geld „aus Anti-Terror-Budgets, u.a. von den Amerikanern, in den Naturschutz. So viel, dass private Sicherheitsunternehmen nach Afrika kommen. Typen, die vorher für das amerikanische Militär im Irak oder in Afghanistan gearbeitet haben. Keiner dieser Leute ist in Polizeiarbeit ausgebildet. Alles, was sie können, ist töten. Sie kommen nach Afrika, um Menschen zu töten. Weil es zu viel Geld gibt. Schutzgebiete sind ein unglaublich primitives und gewaltsames Mittel des Naturschutzes“, meint der kenianische Autor Mordecai Ogada , der 2016 eine Kritik des Naturschutzes in Kenia mitveröffentlichte: „Die große Naturschutz-Lüge“, 2020 interviewte ihn die Zeitschrift „Geo“ zu seiner These „Naturschutz ist der neue Kolonialismus“.
„Als die etwa 70.000 Massai sich im Sommer 2022 weigerten, ein 1500 Quadratkilometer großes Gebiet im Bezirk Loliondo (östlich des Serengeti- und nördlich des Ngorongoro-Nationalparks) zu verlassen, schoss die tansanische Polizei mit scharfer Munition und tötete einen Angehörigen der Volksgruppe, deren stolze Hirten in keinem Werbeprospekt der Serengeti fehlen,“ schrieb „Le Monde dplomatique“. Die Verwaltung der tansanischen Region Arusha hatte das Gebiet in Loliondo einem Jagdunternehmen der Vereinigten Arabischen Emirate zur Nutzung überlassen: als Großwildjagdgebiet für Ölscheichs, deren Geld die Regierung in der tansanischen Hauptstadt Dodoma überzeugt hatte. Schon seit 1992 veranstaltet dieses Jagdunternehmen Großwildjagden in Tansania, u.a. mit Treibjagden vom Hubschrauber aus und dem Anlocken mit Salzlecksteinen. Nun sollen in Loliondo auch noch fünf Luxushotels entstehen. „Ein unbegreiflicher Vorgang, meint der Geschäftsführer der African Wildlife Foundation, Kaddu Sebunya: Wir müssen die Art und Weise, wie Naturschutz auf unserem Kontinent betrieben wird, von Grund auf verändern“.
Ogada erwiderte auf die Frage von „Geo“: Wer lügt? „Sobald jemand denkt, er wäre ein Retter: Das ist der Moment, an dem alles schiefgeht. Es gibt keine Heilsbringer. Man muss nicht nach Afrika gehen und Elefanten retten. Naturschutz in Afrika ist eine Form von Selbstverwirklichung – geworden. Gott sei Dank hat Jeff Bezos, der reichste Mann der Welt, noch kein Interesse an der afrikanischen Tierwelt gezeigt. Er würde uns den Rest geben. 2018 haben weiße Tourismus-Investoren die Regierung um eine Genehmigung gebeten, für teure Restaurants Tiere schießen zu dürfen. Und eine Arbeitsgruppe des Ministers ist bizarrerweise zu dem Schluss gekommen, dass man das erlauben sollte. Bisher ist das nicht umgesetzt worden. Aber es ist doch verrückt, dass jemand es für politisch tragfähig hält, den Touristen Impala-Steaks zu servieren, während ein schwarzer Dorfbewohner erschossen wird, wenn er bloß den Nationalpark betritt. Wilderer werden in Kenia immer wieder erschossen, aber manchmal trifft es auch jemanden, der einfach nur durch ein Schutzgebiet läuft.“
Die chinesischen Interventionen in Afrika tangieren die Nationalparks bisher nur am Rande – buchstäblich, denn sie errichten höchstens Industrieobjekte und Bergwerke zu nahe an den Tierreservaten oder sie planen eine Eisenbahntrasse zwischen Mombasa Port und der Hauptstadt Nairobi sowie in Richtung der Nachbarländer durch den Nairobi Nationalpark. Die Umweltschützer sehen dadurch die dortige Tier- und Pflanzenwelt bedroht und verklagten die Regierung.
Im Internetorgan der „gemeinnützigen Denkfabrik“ Deutschlands „Young Initiative on Foreign Affaris and International Relations“ wägt eine Autorin das zwischen Ökonomie und Ökologie ab – und schreibt über die „Standard Gauge Railway (SGR) – die chinesische Projektleitung, die auch an der Finanzierung der Milliarden teuren kenianischen Bahnlinie „erheblichen Anteil“ hat: „Infrastrukturprojekte [bergen] stets ökologische und soziale Risiken. Die SGR ist insofern ökologisch bedeutend, als dass das moderne Zugsystem CO2-Emissionen im Vergleich zum Autoverkehr reduziert“.
Die der Falkenjagd frönenden Saudis zog es 2010 in das Ölland Aserbaidschan. Der Physiker und „Geopoet“ Alexander Ilitschewski schrieb 2016 ein Buch „Der Perser“ – über seinen einstigen Schulkameraden in Baku, der inzwischen Leiter der Wildhüter-Brigade des Nationalparks “Sirvan“ an der Küste des kaspischen Meeres geworden war. Aufgrund der immer maßloser von den müßigen Saudis betriebenen Falkenjagd waren die Trappen auf der arabischen Halbinsel und in Marokko ausgerottet worden. Deswegen erkauften sie sich bei der aserbaidschanischen Regierung das Recht, mit ihren Falken im Trappen-Schutzgebiet zu jagen. „Sie wollen mit 100 Falken kommen. Das macht für die Dauer ihres Jagdausflugs 2000 Trappen“, rechnete „der Perser“ seiner Rangertruppe vor. Heimlich brachten sie daraufhin so viele Zuchttrappen wie sie fangen konnten auf eine unbewohnte iranische Insel im Kaspischen Meer. Die Falken konnten nur noch wenige Trappen im Nationalpark erwischen. Die Saudis beschwerten sich bei der Regierung in Baku. Diese veranlaßte den Umweltminister, den Nationalpark „Sirvan“ zu schließen. Fortan waren die Wildhüter arbeitslos. Und der Perser führte mit Ilitschewski lange Gespräche über die Weltläufte.
.

.
Der berühmte Zoodirektor
Als ich 2020 im Frankfurter Zoo war, sah ich große Reliquien seines ersten Nachkriegsdirektors, des westdeutschen TV-Stars Dr. Bernhard Grzimek. Er hat maßgeblich, auch finanziell, zur Gründung des Serengeti-Nationalparks in Kenia und Tansania beigetragen. Und hat sich dort auch begraben lassen, neben seinem Sohn, der beim Zählen der Gnu- und Zebraherden im zukünftigen Nationalpark mit seinem Flugzeug abgestürzt und gestorben war. Das Flugzeug mit Zebrastreifen steht heute im Frankfurter Zoo. Hierzulande hat man Grzimek seine Mitarbeit als Experte im Landwirtschaftsministerium der Nazis vorgeworfen. Weil er dazu bei der Entnazifizierung falsche Angaben gemacht hatte, mußte er kurzzeitig seinen Direktorenposten räumen.
Nun wird er rund um den Serengeti-Nationalpark kritisiert, denn dazu wurden 1959 die dort lebenden Massai umgesiedelt. Ebenso im Ngorongoro-Krater, ein weiterer Nationalpark, wo die Vertreibung der Massai noch im Gange ist. 5000 sind schon weg, die letzten 5000 werden durch Zerstörung ihrer kommunalen Einrichtungen zum Wegzug gedrängt. Grzimek ging es darum, so große Wildtier-Schutzzonen wie möglich einzurichten. Die ersten waren nur für weiße Großwildjäger gewesen, mit Grzimek kamen auch weiße Touristen. Zunehmend jetzt auch weiße Studentinnen, die sich in den afrikanischen Nationalparks und Rehabilitationszentren für Nashörner und Elefanten nützlich machen und dafür nur wenig zahlen müssen. Noch heute werden viele Parks erweitert und neue eingerichtet. Daneben gibt es auch viele private – von reichen Weißen und westlichen Konzernen.
Deren Primat des Artenschutzes kollidiert aber zunehmend mit den Anstrengungen afrikanischer Länder, ihre artenreichen Gebiete in eigener Regie zu verwalten und zu vermarkten. Noch immer besteht ein Großteil der Parkleiter und ihren staatlichen Vorgesetzten aus Weißen. Und das Geld für ihre Budgets kommt aus Europa und Amerika. Es wird vor allem zum Kauf von Waffen gegen Wilderer verwendet.
2022 organisierte der kenianische Naturschützer Kaddu Sebunya einen „Kongress für Afrikas Schutzgebiete“ in Ruandas Hauptstadt Kigali. Das erste Mal, dass sich Regierungsvertreter von 52 afrikanischen Staaten und Manager der rund 8.500 Naturschutzgebiete des Kontinents im eigenen Kreis und nicht unter der Ägide ausländischer Naturschutzorganisationen trafen. „Afrikanischen Experten ist die Deutungshoheit über den Naturschutz seitens der ‚Ersten Welt‘ schon lange ein Dorn im Auge: Sie führen deren Denkweise auf den Kolonialismus zurück – und dessen Verständnis des Naturschutzes als ‚Festung‘,“ berichtete die Frankfurter Rundschau. „Europäer sehen Afrikas Bevölkerung als größten Feind der großartigen Fauna und Flora ihres Kontinents. Afrikas Nationalparks sind ausschließlich auf die Bedürfnisse ausländischer Touristen ausgerichtet – ob sie mit Fotoapparaten oder Repetiergewehren kommen. Dagegen kommen Afrikaner und Afrikanerinnen in den Reservaten vornehmlich als tanzende Mädchen in Baströckchen, als Kellner oder höchstens als Spurensucher vor. Solange die Interessen und Bedürfnisse der einheimischen Bevölkerung nicht berücksichtigt werden, könne Naturschutz nur scheitern, meint Sebunya. Unter anderem müsse die Ökonomie in den Regionen um die Parks auf die Schutzgebiete abgestimmt werden, sagt er, als Sozialwissenschafter: Denn nichts ist für wilde Tiere gefährlicher als arme und unzufriedene Menschen“.
Über die Perspektiven der Artenschutz-Gebiete in Afrika hatten ein Jahr zuvor drei Naturwissenschaftler ihre Überlegungen u.a. als „Open-Access-Paper“ in den kalifornischen „Academia Letters“ veröffentlicht: Der Biologe Eric Djom Nana vom Kameruner Institut of Agricultural Research for Development sieht die Entwicklung der Wildtier-Reservate pessimistisch, was er in seiner Studie schon im Titel ausdrückte: „Das Paradigma des Naturschutzes in Zentralafrika ist gescheitert“. Diese These war ihm quasi Voraussetzung dafür, dass man über Alternativen nachdenken müsse.
Ähnlich sah das der südafrikanische Zoologe Mduduzi Ndlovu von der Universität in Mpumalanga: Man müsse neue Weg zum Schutz von Wildtieren und -pflanzen gehen. Er schlägt konkret einen „Mixed-Land-Use“ vor, d.h. er fragte sich: „Könnte ein auf den ländlichen Communities basierender Tierschutz ein solches Modell dafür sein?“ Konkret dachte er dabei an die Integration von Rinderherden der Ngunis in die Reservate für Spitzmaulnashörner.
Der nigerianische Umweltforscher Jonathan Chukwujekwu Onyekwelu an der TU von Akure, Abteilung Forst- und Holz-Technologien, setzt auf die unter den afrikanischen Menschen weit verbreitete Angst vor den Göttern, die zur Heiligung der Friedhöfe führte – und die deswegen zur Erhaltung der Biodiversität beitragen, d.h. Rückzugsgebiete für bedrängte Arten sein könnten. Dabei sah Onyekwelu allerdings eine Gefahr im Wechsel der Glaubenssysteme: „Die Leute glauben nicht mehr an die (alten) Götter, das entheiligt die Friedhöfe, wodurch aus diesen Standorten für Wildtiere und – pflanzen Immobilien werden könnten.“
In den Industrieländern macht man aus verlassenen Immobilien, die radioaktiv oder chemisch verseucht sind, Naturschutzgebiete. So demnächst auch die „Todeszone“ um das AKW Tschernobyl zum „Radioökologischen Biosphärenreservat Tschernobyl“, das so groß wie Luxemburg und das Saarland ist. In den USA gibt es 3000 verseuchte Gebiete, die nicht betreten werden dürfen, außer von Biologen und „Rangern“. Sie umfassen z.T. hunderte Quadratkilometer. Ihre Entgiftung ist unfinanzierbar. Desungeachtet hat sich dort eine reichhaltige Flora und Fauna angesiedelt, die geschützt wird oder werden soll. In Tschernobyl u.a. Przewalski-Pferde – kein Mensch weiß, wie sie da hingefunden haben. Sie haben sogar einen verlassenen Stall – besetzt, wenn man so will.
.

.
Der „Animal Turn“
In der Germanistik wurde erst ein „Cultural Turn“, dann ein „Visual Turn“ und nun in der Geschichtswissenschaft ein „Animal Turn“ ausgerufen. Letzteres war eine Zuspitzung in den „Animal Studies“, wobei inzwischen ganze Buchreihen, u.a. in der Michigan State University Press, diesem „Turn“ gewidmet sind. Gemeint ist damit eine Geschichte von unten, d.h eine Darstellung aus der Sicht von Tieren, die dabei als Subjekte wahrgenommen werden.
Derlei ist vor allem in den USA verbreitet – und mit einer ganzen Reihe von Zeitschriften, Dokumentarfilmen und Videoclips verbunden, wobei die Anarchisten wohl die ersten waren, die, inspiriert von Kropotkins Werk „Die gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt“ (1900), Nutz- und Wildtiere in ihren Fokus auf Widerstand nahmen. Auch der Anarchist Jaroslav Hasek zählt dazu. Er meinte 1910 „Ich habe mich politisch umgestellt. Ich bin jetzt bei den Tieren“ – als er Chefredakteur der Zeitschrift „Welt der Tiere“ wurde.
Auch in Deutschland gibt es „Animal Studies“, die darin entstandenen Publikationen sind jedoch noch reichlich akademisch gequält, während die Amis natürlich stark empirisch ausgerichtet sind. So veröffentlichte der Historiker Jason Hribal 2003 einen Text mit dem Titel: „Die Tiere sind Teil der Arbeiterklasse: Eine Herausforderung für die Geschichte der Arbeit“. 2007: „Tiere, Widerstandsformen und Klasse: Die Geschichte der Tiere von unten schreiben“ und 2010: „Angst vor einem Planet der Tiere: Die verborgene Geschichte der Rebellion von Tieren“.
Ich lese gerade von der „Animal Studies“-Autorin Sarat Colling das Buch „Der Widerstand von Tieren in der Äre des globalisierten Kapitalismus“ (2021). Es handelt zur Hauptsache von Tieren, die aus Farmen, Zoos und Schlachthöfen flüchteten. Viele wurden wieder eingefangen, manchmal erst nach Monaten, nur wenige blieben für immer verschwunden (frei), aber etliche landeten, nachdem man sie betäubt und eingefangen hatte, in Tierasylen (Sanctuaries), wo sie bis zu ihrem natürlichen Tod leben dürfen. Schon während ihrer Flucht bekamen sie Namen (die Kuh „Emily“ später sogar ein Denkmal neben Ghandi auf einem Pazifistenfriedhof) – und zwar von Reportern, die eine „Story“ witterten und im Übrigen der Meinung waren, dieses oder jenes Tier, dass so viel unternommen hat, um frei zu sein, hat es verdient, am Leben zu bleiben. Rinder, Schafe, Ziegen, Affen, Kamele, Papageien, Hühner und Truthähne, die ihre Freiheit erkämpften, sich dann oft in Wäldern versteckten und benamt wurden, erlangten durch die Medien den Status von Subjekten/Individuen, während all jene Tiere – Milliarden jährlich, die ihr Schicksal nicht herausforderten, sondern halbwegs friedlich in den Schlachthof gingen oder in ihrem Käfig blieben, Statistik/Objekte sind.
Auch in Deutschland sind die Medien im Falle von entflohenen Tieren meist auf deren Seite und nicht auf der ihrer Besitzer, die sie wieder haben wollen, um sie weiter auszubeuten, zu schlachten oder zu zwingen, erneut gegen Geld ein Publikum zu unterhalten. In München hatte z.B. ein Polizeitrupp eine „wild gewordene Kuh“ erschossen, die sich auf dem Schlachthof losgerissen und eine Joggergruppe auf dem Bavariaring über den Haufen gerannt hatte. Die Beamten hatten das Tier zuerst mit ihren Pistolen bewegungsunfähig geschossen – und anschließend mit zwei Gewehrschüssen getötet. Der „Spiegel“ sprach von einem „Kugelhagel“, in dem die Kuh starb. Schon am nächsten Tag wurden am Tatort Blumen hinterlegt, sowie Grablichter in Milchflaschen angezündet und mit einem Zettel „an das Kuh-Drama erinnert“, wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete. „Sie wollte leben und floh vor dem Schlachthof“, stand auf dem Zettel.
Noch parteiischer wirkte die Tierrechtsorganisation „Animal Peace“, als sie auf ihrer Internetseite „viva-vegan.info“ frohlockte: „Ein dreijähriger Bulle hat nahe Köln seinen Sklavenhalter angegriffen und tödlich verletzt. Der 61-jährige Landwirt wollte eine Schiebetür im Stall reparieren. Als am Abend der Sohn den Stall betrat, um die Kühe zu melken, entdeckte er die Leiche seines Vaters. Wir verneigen uns vor dem Held der Freiheit. Mögen ihm viele weitere Rinder in den Aufstand der Geknechteten folgen.“ Es folgten erst einmal heftige Kritik von allen Seiten und sogar eine Strafanzeige, so dass die radikalen Veganer sich gezwungen sahen, ihre Äußerung zu verteidigen: „Wir haben mit keinem einzigen Wort den getöteten Bauern verhöhnt.“ Man habe sich nur über den „Aufstand eines Geknechteten“ gefreut. „Es ist eine politische und keine persönliche Botschaft.“ Rinder seien Subjekte, „die fühlen und denken können und mit diesen Gefühlen und Gedanken ein freies und unversehrtes Leben führen wollen. Wie wir.“ Die Vegetarier/Veganer sind nicht nur gegen die Bio-Bauern, weil auch sie ihre Tiere töten, daneben bemühen sie sich auch um den Nachweis, dass Milch nicht gut für uns ist, sie ist für das Kalb da. Zudem sei auch die Milch „Produkt eines Gewaltverhältnisses“.
Die Amis im „Animal Turn“ sind natürlich durchweg Veganer, während hierzulande die Bauern und Spitzköche den Verzicht auf tierische Produkte schlicht für Schwachsinn halten. Leider nicht deswegen, weil Pflanzen und Tiere sich nicht groß unterscheiden. Es gibt nur zwei nicht-parasitär lebende Säugetiere: Flughunde und Wickelbären. Sie essen nur das, was die Pflanzen ihnen freiwillig anbieten.
.

.
Tiger (1)
Kürzlich begleitete ich meinen Philosophenfreund Anselm in den Ostberliner Tierpark. Er wollte sich u.a. die zwei jungen Sumatra-Tiger Luise und Lotte ansehen, aber man hatte sie gerade in den Westberliner Zoo verbracht. Anselm schimpfte: „Dieser verdammte Doppeldirektor von Zoo und Tierpark. Er packt auf Drängen des Zoo-Aufsichtsrates alle interessanten Tiere, und Tiger sind die philosophisch interessantesten, in den Zoo. Zurück bleiben in Ostberlin nur solche Tiere, die der Zoo nicht haben will. Eine Riesensauerei, denn der Tierpark ist der größte Europas und hat viel Platz, aber seit der Wende immer weniger Tiere, während der Zoo einer der kleinsten ist, aber von Knieriem wird er immer mehr mit Prestigebauen und Gehegen zugeballert. Dabei sollte man das Gelände besser verkaufen, es ist die wertvollste innerstädtische Immobilie, und die Tiere in den Tierpark umsiedeln. Stattdessen wird dort das Gelände Stück für Stück an Immobilienentwickler verkauft und die Tierpfleger demotiviert. Ach, diese verbrecherische Wiedervereinigung und dieser unselige Doppeldirektor.“
Anselm kritisierte dann auch mich: Ich hatte in einem Tiertext geschrieben: „Im indischen Sundabardelta wurden vor einiger Zeit mehrmals Menschen von Tigern getötet. Da die Raubtiere stets von hinten angeschlichen kamen, setzten sich die Waldarbeiter Halloweenmasken verkehrt herum auf, so dass es aussah, als hätten sie hinten Augen: Nach Einführung dieses Maskentricks wurden keine Maskenträger mehr angegriffen.“
Das stimmte zwar, meinte Anselm, aber nur zur Hälfte, denn nach einiger Zeit kamen die Tiger hinter diesen Trick, der damit nicht mehr funktionierte. Auch meine Bemerkung, dass Putin den vom Aussterben bedrohten Amur-Tiger unter seinen persönlichen Schutz gestellt habe, sei Unsinn, meinte Anselm, denn das sei doch bloß eine blöde Propagandaaktion. Ich widersprach ihm: Tiger können unterscheiden. Naturforscher, die im Fernen Osten Russlands arbeiten, behaupten, dass die Amurtiger sie nicht angreifen sondern tolerieren, weil sie ihnen wohlgesonnen seien, während sie Jägern bzw. Wilderern mitunter tagelang auflauern würden. Anselm bezweifelte das: Wenn sie sich dabei man nicht irren…
Ich erzählte ihm von einer indischen Zoologin, die einen Tiger groß zog, nicht die einzige, und ihn dann in einem Nationalpark auswilderte. Dazu mußte sie dem Tier, ein Weibchen namens Jenny, das Jagen beibringen. Zunächst übte Jenny das Fangen und Töten an kleinen Amphibien. Bei ihrem ersten richtigen „Riß“ tanzte sie noch um den Kadaver herum. Die Zoologin mußte ihn ihr mit einem Messer quasi mundgerecht zubereiten, aber dann kam die Tigerin langsam auf den Geschmack – und wurde sogar ungehalten, wenn die Zoologin hinter ihr durch den Wald stolperte und der Lärm die Beute von Jenny verscheuchte.
Anselm hatte ein Gegenbeispiel parat – vom Leipziger Zoodirektor Karl Max Schneider, der meinte, dass die Jagdfähigkeit angeboren sei: In seinem Buch „Tiere im Zoo“ habe er einen viereinhalb Monate alten Tiger aus Indonesien erwähnt, der im Wirtschaftshof aufgezogen wurde und dort eine kleine Antilope, die noch die Flasche bekam, „kunstgerecht“ riß – mit den Zähnen am Hals und den Krallen im Rücken: „Dabei hatte der Racker noch nie gesehen, wie erwachsene Tiger Beute schlagen! Und wie überhaupt in ihm das Gefühl dafür aufdämmerte…“
Ich erzählte ihm daraufhin von der amerikanischen Tigerdompteurin Mabel Stark. Sie lebte mit dem von ihr großgezogenen Tiger „Rajah“ in ihrem Wohnwagen zusammen, er schlief auch in ihrem Bett, ebenso wie ihr dritter Ehemann, der Löwendompteur Louis Roth. In der Manege bestand ihre berühmteste Nummer darin, dass sie ihren 20 Tigern den Rücken zukehrte und Rajah sie plötzlich von hinten ansprang, zu Boden warf und mit ihr rang. Mit der Zeit entwickelte sich daraus bei dem Tiger ein Paarungsakt. Weil sein Samen auf ihrem schwarzen Lederkostüm unschön aussah, wechselte sie in ein weißes Kostüm, das sie bis zum Ende ihrer Karriere 1968 trug.
Mable Stark wollte irgendwann mit ihren geliebten Tigern keine albernen Kunststücke mehr einüben, stattdessen wollte sie deren Schönheit präsentieren: Sie liefen herum, sprangen von Postament zu Postament – und taten alles wie im Fluß. Sie erwartete großen Applaus, er war aber nur verhalten „respektvoll“. Ganz anders die darauffolgende Löwennummer eines Dompteurs: „Die Tiere fletschten die Zähne, schlugen mit den Tatzen durch die Luft, der Dompteur mußte mehrmals seine Schreckschußpistole einsetzen. Als sie von ihren Postamenten runtersprangen und auf ihn losgingen „konnte er sich nur mit einem Hechtsprung durch die auffliegende Käfigtür retten.“ Das Publikum johlte und klatschte stehend.
Die Löwendompteurin beim Zirkus Busch, Tilly Bébé schrieb über ihre abendlichen Auftritte: „Diese unverkennbare Grenze zwischen Spiel und Wirklichkeit, zwischen Leben und Tod ist im Grunde die Stelle, die das Publikum interessiert.“ Aber das interessiert nicht die Tiger.
.

.
Tiger (2)
Noch einmal zu den Tigern: Was ist denn nun so philosophisch an ihnen, die der Katzenforscher Paul Leyhausen trotz ihrer Größe zu den „Kleinkatzen“ zählt, weil sie nicht brüllen und Streifen haben? Das hat die Kulturschaffenden jedoch nicht davon abgehalten, in dieser größten Raubkatze eine geeignete Metapher für die den Menschen gefährliche aber auch verführerische „Natur“ zu sehen. Der Dadaist Walter Serner behandelte 1921 dieses vormoderne „Spannungsverhältnis“ in seinem Roman über eine Verführerin, die er schon im Titel „Die Tigerin“ nannte.
Der Zirkushistoriker Werner Philipp behauptet: „Tiger riechen angenehm, ihr Geruch sei erotisierend, sagen manche Frauen.“ Meinen sie damit einen kraftvollen männlichen Geruch oder sind diese Katzen ihnen eher „Gleichnis für die Femme fatal“? wie der Ökologe Josef Reichholf vermutet. Die Männer scheint ansonsten nicht so sehr das Geschlecht, sondern eher die Gefährlichkeit der Tiger zu interessieren. So bezeichnete Mao tse Tung die USA mit ihren Atombomben einst als „Papiertiger“ und Noam Chomsky kürzlich Russland – allerdings mit Fragezeichen.
Der Philosoph Theodor W. Adorno dachte 1951 über die echten Tiger in den Zoos nach (in: „Minima Moralia“): „Der Tiger, der endlos in seinem Käfig auf und ab schreitet, spiegelt negativ durch sein Irresein etwas von Humanität zurück, nicht aber der hinter dem unüberspringbaren Graben sich tummelnde.“
Solche „Freianlagen“ stellen laut Adorno einen humanitären Fortschritt dar. Weniger fortschrittlich ist dagegen, dass allein in den nordamerikanischen „Freianlagen“ mehr Tiger als in wirklicher Freiheit leben. „Verderblich ist des Tigers Zahn, / Jedoch der schrecklichste der Schrecken, / Das ist der Mensch in seinem Wahn,“ hieß es 1799 in Friedrich Schillers „Lied von der Glocke“, im Jahr, als Napoleon die Revolution für beendet erklärte.
Die Russische Revolution nahm dann einen neuen Anlauf. Leo Trotzki schrieb 1924 in „Literatur und Revolution“: „Der sozialistische Mensch will und wird die Natur mittels der Maschine beherrschen. Natürlich bedeutet das nicht, dass der ganze Erdball liniert und eingeteilt sein wird. Es werden bleiben Dickicht und Waldungen und Auerhähne und Tiger, aber dort, wo der Mensch ihnen den Platz angewiesen haben wird. Und er wird dies so geschickt anstellen, dass sogar der Tiger den Hebekran nicht merken und sich nicht langweilen und so leben wird, wie er in Urzeiten gelebt hat. Das Bestreben, die Not, den Hunger, den Mangel zu besiegen wird eine Reihe von Jahren die herrschende Tendenz sein. Später wird der Gegensatz von Technik und Natur in einer höheren Synthese seine Lösung finden.“
– Und damit den Tigern posthum Gerechtigkeit widerfahren lassen? Angesichts der aktuellen „Krisen“ kann man mit Walter Benjamin von einem „Tigersprung in die Geschichte“ sprechen, insofern nicht das Nächstliegendste (Klimakatastrophe, Artenschwund, Armut…) „angesprungen“, sondern sich erneut in Nationalismus und Rassismus verbissen wird. Im Kern des „Tigersprungs“ ging es ihm 1940 um eine Fortschrittskritik.
Der Menschenfreund Benjamin ging dabei tigermäßig nicht so weit wie der Tierfreund Arthur Schopenhauer, der 1851 in „Parerga und Paralipomena II“ schrieb: „Der Mensch ist das einzige Tier, welches Andern Schmerz verursacht, ohne weiteren Zweck, als eben diesen. Die andern Tiere tun es nie anders, als um ihren Hunger zu befriedigen, oder im Zorn des Kampfes. Wenn dem Tiger nachgesagt wird, er töte mehr, als er auffresse: so würgt er alles doch nur in der Absicht, es zu fressen.“
Es gibt eine alte chinesische Redewendung: „Fasse einen Tiger nicht am Hintern an“. Die heutige chinesische Regierung „reitet“ gar „auf dem Tiger“ (bei ihrer Taiwan-Politik), wie der Philosoph Cajo Kutzbach meint. Während der Philosoph Peter Reiter eine „neue globale Ökonomie“ visioniert, die er „Den Tiger reiten“ nennt, will der Philosoph Julius Evola mit seinem Buch „Den Tiger reiten“ eine „Revolte gegen die moderne Welt“ anzetteln. Die Metapher stammt in allen Fällen von Friedrich Nietzsche, der 1873 in „Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne“ schrieb: „Verschweigt die Natur dem Menschen nicht das allermeiste, selbst über seinen Körper!“ Aber wer hinter das „Bewußtseinszimmer“ blickt, der ahnt, „dass auf dem Erbarmungslosen, dem Gierigen, dem Unersättlichen, dem Mörderischen der Mensch ruht, in der Gleichgültigkeit seines Nichtwissens, und gleichsam auf dem Rücken eines Tigers in Träumen hängend. Woher, in aller Welt, bei dieser Konstellation der Trieb zur Wahrheit!“
Dazu heißt es auf der Plattform „uni-stuttgart.de“: „Spätestens seit dem Einzug des Internets ist klar, dass wir alle auf einem Tiger reiten“. Meinen die Studies damit etwa das Apple-Betriebssystem „Mac OS X Tiger“?
.

.
Grenzwerte
„Über den Wolken muß die Freiheit wohl grenzenlos sein,“ sang Reinhard Mey 1974. Aber das ist sie nicht mehr. Die nationalen Territorien schützen ihre Grenzen auch über die Wolken hinaus. Der Berliner Makrosoziologe Steffen Mau hat die eher bodennahen Begrenzungen der Menschenströme in seinem Buch „Sortiermaschinen. Die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert“ (2021) thematisiert. In einer Zusammenfassung heißt es, „dass Grenzen im Zeitalter der Globalisierung von Anbeginn nicht offener gestaltet, sondern zu machtvollen Sortiermaschinen umgebaut wurden. Während ein kleiner Kreis Privilegierter heute nahezu überallhin reisen darf, bleibt die große Mehrheit der Weltbevölkerung weiterhin systematisch außen vor.“
Und was dabei für ein technischer, personeller und ethischer Aufwand getrieben wird…„Während die Mobilität von Menschen über Grenzen hinweg in den letzten Jahrzehnten stetig zunahm und Grenzen immer offener schienen, fand gleichzeitig eine in Wissenschaft und Öffentlichkeit unterschätzte Gegenentwicklung statt. Vielerorts ist es zum Bau neuer abschreckender Mauern und militarisierter Grenzübergänge gekommen. Grenzen wurden zudem immer selektiver und – unterstützt durch die Digitalisierung – zu Smart Borders. Zudem ist die Grenzkontrolle räumlich massiv ausgedehnt worden, und zu einer globalen Unternehmung geworden, die sich vom Territorium ablöst.“ Als Privatfirmen sind diese tendenziell global tätig. Steffen Mau zeigt, auf welche Weise diese neuen Sortiermaschinen Mobilität und Immobilität zugleich schaffen: Geöffnet für wenige Erwünschte, geschlossen für Millionen Unerwünschte.
Ende September stimmte der Bundeskanzler für eine EU-Asylverschärfung. Davor wurden bereits erhebliche Summen aus Europa in die nordafrikanischen Länder transferiert, damit sie die an ihren Küsten auf Schiffe wartenden Flüchtlinge davon abhalten, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Außerdem wurde die europäische Grenz- und Küstenwachen-Agentur „Frontex“, zuständig für die Außengrenzen des Schengen-Raums, vergrößert und technisch aufgerüstet. Ähnliches gilt für die Flüchtlinge aus Asien, die über den Landweg nach Europa einwandern wollen und dabei an die immer mehr befestigten EU-Außengrenzen gelangen. Selbst Moldawien wurde vor einigen Jahren schon von der EU mit grenzsichernder Überwachungs-Hightech ausgerüstet. So werden schon auf dem Glacis der Festung Europa die Flüchtlinge gestoppt.
Grund für solche und ähnliche Bevölkerungsströme ist die Globalisierung. Vom US-Kapital einst durchgesetzt, werden nun immer mehr Länder, nicht nur Europa, amerikanisiert, d.h. herkunftsmäßig durchmischt (und mit Anglizismen und kalifornischer Konsum-Elektronik ausgestattet). Indem jedoch der Grund und Boden schon lange kapitalisiert wurde (laut Marx war dies zu seiner Zeit nur noch nicht in Russland der Fall), hat man im übrigen Teil der Welt damit leben müssen, dass sich in den Gemeinschaften, Gemeinden, Dörfern usw. ohne zu fragen Fremde niederließen. Dies setzte sich fort in den Mietshäusern, wo die Eigentümer und ihre Verwaltung bestimmen, wer in ihren Häusern einziehen darf und nicht die Mieter, die mit diesen Neuzugängen klar kommen müssen. Selbst bei abstrusestem Eigenbedarf müssen die Mieter dem Wohnungsbesitzer weichen. Und auch die kleinen Hausbesitzer können nichts dagegen unternehmen, wenn nebenan z.B. extreme Widerlinge einen Neubau errichten. In den Betrieben bestimmen die Personalchefs und nicht die zukünftigen Kollegen, wer dort mit ihnen arbeitet.
Kurzum: Die städtischen und dörflichen Gemeinwesen sind derart zerstört (machtlos), dass Soziologen schon gar nicht mehr von „Gesellschaft“ reden und deswegen auch den Begriff fallen lassen wollen. Mit Mao tse Tung könnte man stattdessen vielleicht von einem „Haufen Sandkörner“ sprechen. Nur dass in China daraus eine Gesellschaft, ein Staat, eine Nation wurde, während man hier von einer zunehmenden „Atomisierung“ der Bevölkerung und einer Erodierung der Institutionen spricht.
Was halten dann aber noch die ganzen Grenzen zusammen oder ab? „Ältere Grenzen zwischen zwei Ländern fallen manchmal mit den natürlichen, teilweise nur schwer überwindbaren Hindernissen zusammen: ein Gebirge, ein Meer oder Meeresarm, eine Wüste, ein Urwald oder ein Bergland. Diese stellen im Regelfall auch die Sprach- und Kulturgrenzen dar. Flüsse hingegen bilden erst seit etwa 1800 Staatsgrenzen (neue Grenzziehungen infolge von Kriegen bzw. Friedensverträgen), da sie früher viel eher einende Handelswege als trennende Hindernisse darstellten. Zudem waren sie noch nicht begradigt und änderten nach Hochwasser ihren Verlauf, was Anlass zu Streitigkeiten gab,“ heißt es auf Wikipedia. Auf der „Tortilla-Grenze“ zwischen Mexiko und den USA gibt es auf dem Rio-Grande eine „schwimmende Mauer“. Wenn Grenzen vertraglich auf Längen- und Breitengrade festgelegt werden, wie z.B. in den USA, spricht man von „Reichsbrettgrenzen“. Sie entstanden laut Wikipedia „nicht durch jahrhundertelange Entwicklungsprozesse, sondern sind auf Willensakte in der Regel fremder Herrscher zurückzuführen (Kolonialismus)“. Und daraus speist sich nun der Flüchtlingsstrom, quasi ein kollektiver „Willensakt“ dagegen.
.

.

.
Grenzen
Das Wort Grenze kommt aus dem altpolnischen „granica“ und ist laut Wikipedia „der Rand eines physischen Raums und damit eine Trennfläche, Trennlinie oder ein Trennwert“. Seit dem „Fall der Mauer“ werden überall auf der Welt mit Beton und/oder Stacheldraht neue Grenzmauern errichtet und das Wort Grenze tritt in immer neuen Verbindungen auf: Firewall, Paywall, Rote Linie, Zustrombegrenzungsgesetz, Brandmauer, Bezahlgrenze, Verdienstgrenze, rechtliche Grenzen, Minijob-Grenze, Wenn Grenzen in einer Beziehung überschritten werden, Umgang mit Grenzüberschreitungen, Urlaub ohne Grenzen, ethische Grenze Grenzgänger…
Vor dem ersten Weltkrieg konnte man ohne Paß und Kontrollen durch ganze Europa reisen. Stefan Zweig schrieb: „Ich will die Monarchie wieder haben, und ich will es sagen. Und mehr als die alte Monarchie. Ein neues Europa, in dem man ohne Pass, von Ort zu Ort, von Hotel zu Hotel, von Bar zu Bar, zu allen Menschen reisen kann und in dem sich die alten Nationengrenzen langsam auflösen.“ Das Gegenteil ist passiert.
Der Salzburger Schriftsteller Karl-Markus Gauß schreibt in „Die unaufhörliche Wanderung“ (2020): Im Frühling 2015, als sich so viele Flüchtlinge auf den Weg machten, stand ich am Grenzfluß Pruth und wurde verhaftet, weil ich in Verdacht geraten war, illegal in die Europäische Union einreisen zu wollen.“
Das war eine Folge der Osterweiterung der EU, die in Wahrheit eine Westerweiterung war. Der Pruth trennte seit Ende des Zweiten Weltkriegs die Sowjetrepublik Moldawien von der sozialistischen Volksrepublik Rumänien und seit dem Beitritt Rumäniens zur EU wurde der Fluß eine „Außengrenze der Union“. Gauß schreibt weiter: „Um in die EU eintreten zu können, hat die Republik Moldau ihre Grenze zu aufrüsten müssen. Niemand sollte über Moldawien in die Union gelangen können. Das Land hat selbst überhaupt nichts davon, dass es für die Union den Grenzwächter gibt. Aber es muß ihn spielen, um mit der Union im Gespräch zu bleiben und ins Geschäft zu kommen. Überall in der Moldau rosten die industriellen und landwirtschaftlichen Maschinen dahin; einzig die Grenzwächter sind technologisch auf den Unionsstandard A1-plus gebracht worden.“
Mein verstorbener Freund Christian Semler begleitete einmal als Journalist eine EU-Delegation nach Moldawien, die Moldawien mit zig Millionen Euro Überwachungstechnik „beschenkte“, damit deren „Grenztruppen“ alle Leute daran hindern können, über die EU-Grenze nach Rumänien und weiter nach Westen zu gelangen.
Doris Lessing schrieb in „Rückkehr nach Afrika“ (1994): Mit ihren Eltern in Südrhodesien (später Zimbabwe) zu reisen bedeutete, dass ihr „boy“ Äste, Laub, Dornenzweige schlug um damit den Nachtplatz zu schützen – vor Leoparden z.B., aber „Wir hätten uns auch ohne die Einfriedung (!) unter die Bäume legen können, denn jeder Leopard, der sein Geld wert war, hätte darüberspringen und einen von uns wegschleppen können. Nein, diese ‚boma‘ war Ausdruck von etwas anderem, sie sollte im Grund nichts von uns fernhalten, sondern vor allem uns, Fremde in einem fremden Land, zusammenhalten.“
Das ist eine „Einfriedung“ wie sie auch der US-Anthropologe James C. Scott in die „Mühlen der Zivilisation“ (2020) diskutiert. Allerdings nicht als eine freiwillige Einfriedung: Die Mauern, mit denen die ersten Stadtstaaten im Zweistromland sich umgaben, dienten ihm zufolge nicht, um Eindringlinge von außen abzuwehren, sondern um die Bewohner im Inneren zu halten. Sie mußten dort Steuern in Form von Getreideabgaben zahlen und hätten das gerne vermieden, aber man zwang sie, in der Stadt zu leben. Eine schöne Umdrehung unserer gängigen Vorstellungen über den Ursprung von Stadtmauern.
Gauß hatte in der Schule noch gelernt, dass es „natürliche Grenzen“ gäbe, „die den Herrschaftsbereich von Staaten markieren“ – Flüsse oder Gebirge etwa. Inzwischen weiß er jedoch, dass „selbst die vorgeblich natürlichen Grenzen erfunden, künstlich gezogen, menschengemacht sind, aus Verabredung und Kampf hervorgegangen, auf Konvention und Gewalt gegründet, auch wenn sich ihr Verlauf an der Natur orientiert.“ Besonders beeindruckt hat ihn die Grenze an der Neiße, die Görlitz von Zgorzelec trennt, obwohl es eine Stadt war, die nach dem EU-Beitritt Polens eine „Europastadt“ wurde.
Mich hat die Grenze amüsiert, die Bad Muskau von Muzakov auf der anderen Neiße-Seite trennte und direkt durch den vom Fürsten Pückler angelegten Muskauer Park verläuft. In den Neunzigerjahren hat man beide Parkteile mit einer kleinen Fußgängerbrücke über die Neiße verbunden. Als ich darauf vom polnischen Teil in den deutschen Teil ging, wurde ich in der Mitte von zwei Grenzbeamten angehalten. Sie standen zusammen, redeten und rauchten – und wollten dann meinen Pass kontrollieren. Es war ihnen immerhin peinlich, wir lachten alle drei gequält.
.

.

.

.
Querulanten
1973 gründete sich in Frankfurt/Main der „Informationsdienst zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten“ (ID). Daraus entwickelte Dr. Richard Herding später das „Projekt Alltag“, in dem man sich „pressewirksam“ um „Querulanten“ kümmerte – nicht um Meinungs- sondern um Interessens-Querulanten. Das waren in Bedrängnis geratene Menschen, die sich hilfesuchend u.a. an das Projekt wandten, weil die sonstigen Medien nicht an solchen „Einzelfällen“ interessiert waren. Die von ihnen nur mit spitzen Fingern angefaßten Briefe landeten im Papierkorb. Bei ihnen mußten jede schriftliche Klage mindestens einen Trend anzeigen, weswegen die häufigsten Worte dieses Journalismus „immer mehr“ und „zunehmend“ waren und sind.
Wenn man aber die Briefe dieser Menschen, oft mit Hand geschrieben, gründlich las, enthielten sie doch oft detaillierte Darstellungen z.B. des allgemeinen Elends im Knast, in der Psychiatrie, im Altersheim oder im Falle von Mobbing in einem Dorf oder an der Uni (siehe dazu z.B. das gerade erschienene Buch „Alptraum Wissenschaft“ der Laborbotanikerin Anne Christine Schmidt). Es sind Enthüllungsberichte. Die am System leidenden und sich mit solchen „Kassibern“ an die Öffentlichkeit wendenden Briefschreiber waren erst verfluchte „Muckraker“ und sind nun in der „neuen Unübersichtlichkeit“ (Habermas) von vielen ermunterte „Whistleblower“.
Ich habe immer mal wieder über „Querulanten“ berichtet, wobei ich dieses schon seit dem normannischen Recht abfällig gemeinte Wort beibehielt. Auch die deutschen Behörden und Richter benutzten es, seit Ende der Naziherrschaft allerdings nur noch hinter vorgehaltener Hand. In den USA gab es nicht einmal das Wort Querulant, es wurde erst von deutschen Emigranten dort eingeführt, wohingegen die Schweizer Behörden sogar eine „Querulanten-Kartei“ anlegen wollten.
Hier erwähne ich nun einen polnischen Querulanten, der aus Angst, auf eine schwarze Liste von Spediteuren zu geraten, anonym bleiben möchte. Er kann nur schlecht Deutsch schreiben, ich habe seinen Brief deswegen beim Abschreiben verbessert. Er enthält einen Skandal, aber man müßte ihn nachrecherchieren. Leider ist mein Geigerzähler kaputt, so dass auch die Möglichkeit besteht, dass es sich dabei um einen antiukrainischen Fake handelt. Vor dem Hintergrund des mainstreamigen Solidar-Schwurbels und den begeisterten Polit-Pilgerreisen zu Selensky halte ich es jedoch für möglich, dass der Inhalt des maschinengeschriebenen Briefs durchaus wahr sein kann. Immerhin ist die „Todeszone“ um das Atomkraftwerk Tschernobyl so groß wie Luxemburg und das Saarland zusammen – und besteht aus besten Anbauflächen:
„Sehr geehrte Damen/Herren
Ich habe viele Jahre für eine polnische Spedition als LKW-Fahrer gearbeitet. Seit September 2022 transportiere ich regelmäßig Getreide aus der Ukraine nach Polen, Deutschland und in die Slowakei. Es ist eine harte Arbeit mit tagelangen Wartezeiten an den Grenzen und schlechter Bezahlung. Hinzu kommt, dass ich immer öfter radioaktiven Weizen aus der Region nordwestlich von Kiew transportieren muß. Durch Zufall nur habe ich erfahren, dass das Getreide stark abstrahlt, weil es mit Cäsium und Strontium kontaminiert ist, oft hat es über 100.000 Becquerel und müßte eigentlich als Sondermüll gelten. Mein Schwager hat die Strahlung dieses Weizens immer wieder gemessen, und meint, man dürfte es nicht einmal als Viehfutter verwenden.
Wir haben uns immer wieder bei unseren Chefs beschwert , die aber drohten uns bloß mit Entlassung, wenn wir das bekannt machen würden. Der Weizen war außerdem noch übermäßig mit Pestiziden belastet und stank, dazu war er oft schimmelig, weil er zu lange in Hallen gelagert worden war. Beim Abladen an Mühlen und Mehlfabriken sagten wir nur, der Weizen ist Ostware, es gab anders als bei Weizen aus Deutschland keine Kontrollen. Wir hatten Papiere dabei, die den verseuchten ukrainischen Weizen als polnischen Weizen auswiesen, was an der Grenze keine Probleme machte. Unsere Chefs meinten, die Getreidetransporte würden gut bezahlt werden, es sei ein gutes Geschäft.
Wir belieferten Großmühlen in Berlin, Mannheim, Schweinfurt, Ulm, Ergolding. Von meinen Kollegen erfuhr ich, dass sie nicht mehr nach Polen und in die Slowakei fahren, weil die Lieferungen radioaktiv verseucht und voller Pestizide seien, außerdem würden die Bauern dort mit ihren Traktoren gegen das Billiggetreide aus der Ukraine kämpfen. Deswegen gehen jetzt alle Transporte nach Deutschland. Dort wird nichts kontrolliert, sondern die Ladung nur mit deutschem Weizen vermischt. Angeblich würde man danach im Mehl keine Gifte mehr nachweisen können.
Ich habe trotzdem mit dem Job Schluss gemacht – aus gesundheitlichen Gründen, aber die Leute in Deutschland essen weiterhin dieses Mehl und das damit gebackene Brot.“
Hinzugefügt sei, dass ich in Mitte der Siebzigerjahre während meiner Arbeit in verschiedenen Landwirtschaftlichen Betrieben dabei half, dass mein Chef nicht unwesentliche Mengen an quecksilbergebeiztem Saatgut, das beim Ausbringen auf den Acker übrig geblieben war, auf den Weizenberg in seiner Lagerhalle kippte. Auf meinen Einwand: „Das Zeug ist doch gesundheitsschädlich“, meinte er: „Das vermischt sich – bis zur Unkenntlichkeit“.
.

.

.
Medienschelte
Der Chefreporter vom „Content Network KiVVON“, Frank Überall, hat ein Buch veröffentlicht mit dem Titel „Dead Line für den Journalismus – Wie wir es schaffen, nicht zur Desinformationsgesellschaft zu werden“. Während ich mich freue, dass mit den „Sozialen Medien“ und den Blogs langsam das Ende des professionellen Journalismus eingeläutet wird und stattdessen die Leute selbst das Wort (und Bild) ergreifen, äußern sich meine Freunde zunehmend abschätziger über Facebook, TikTok, Instagram etc.. Denen sie, zumal jetzt mit KI, Fakes und Schlimmeres vorwerfen. Sie vertrauen nach wie vor ihren Mainstreammedien (Tagesspiegel, Tagesschau, FAZ, Spiegel).
Während ich z.B. bei einem Spiegelartikel, der etwas thematisiert, was ich selbst genau kenne, merke, dass der Reporter völligen Unsinn schreibt. Das passiert mir allerdings selten. Und seit Corona, Ukraine und Gaza kann ich diese ganzen staatstragenden Medien sowieso nicht mehr lesen.
Richtig gemein wurde es bereits – in fast allen Printmedien – als sie über den Hungerstreik der Bergarbeiter in Bischofferode berichteten. Nämlich etwa so wie die kenianische Schriftstellerin Nanjala Nyabola in ihrem Text „Why Do Western Media Get Africa Wrong“ es bemerkte: Wenn der erste westliche Journalist vor Ort eintrifft und eine Story schreibt (oft geht es um eine Katastrophe), dann wird er als verläßlichere Stimme angesehen als einheimische Blogger oder Reporter. (Dieses Beispiel habe ich Jeremy Hardings Text über Binyavanga Wainaina im Merkur 2/25 entnommen.)
Es gibt ein weiteres Beispiel, das mir näher liegt, weil ich dort in der Nähe wohne: Die Berichterstattung über den sozialen Brennpunkt „Kottbusser Tor“ in Kreuzberg. Er gilt als „gefährlicher Ort“, „gefährlichster Ort Berlins“ oder sogar als „gefährlichster Ort Deutschlands“. Immer wieder war in der Vergangenheit in den Kapitalmedien davon die Rede – bis die Polizei, die dabei von einem „kriminalitätsbelasteten Ort“ sprach, 2023 am „Kotti“ eine Wache einrichtete, von wo aus sie seitdem jeden Passanten anhalten und durchsuchen darf. Die Medien haben sie buchstäblich dort hingeschrieben, indem sie die Politiker damit quasi zum „Handeln“ zwangen.
Die promovierte Juristin Nora Keller hat darüber 2024 eine Recherche veröffentlicht für die sie etliche Anwohner interviewte (die Polizei weigerte sich, von ihr interviewt zu werden). Ihr Buch hat den Titel: „‘Stärker als das, was uns trennt’ – Kriminalisierungen und Solidarität am ‚gefährlichsten Ort‘ Kottbusser Tor in Berlin Kreuzberg“. Darin zitiert sie einige Schlagzeilen aus den Medien, die so grauenhaft sind, dass man ihren Autoren sofort den „Bockschein“ entziehen müßte. Die BZ-Berlin: „Kriminalität explodiert – Das Kotbusser Tor ist der Platz der Gesetzlosen“ usw..
Zwischen 2016 bis etwa 2019 waren der Ort und seine vermeintliche Gefährlichkeit verstärkt Anlass einer breiten öffentlichen Debatte, schreibt Nora Keller. „Mehrfach war zu lesen, dass sich die Diebstähle am Ort vom Jahr 2014 auf das Jahr 2015 verdoppelt und gegenüber 2013 sogar vervierfacht hätten, Zeitungen berichteten, die Zahl der Raubüberfälle sei innerhalb eines Jahres um 50% und die Drogendelikte um 100% gestiegen.“ Wenn die publizistische Diskriminierung der Anwohner und der sich dort Aufhaltenden nicht hilft, dann tut es die Statistik, aufgrund derer die professionellen Politiker „denken und handeln“, in diesem Fall also die Polizei in Marsch setzen.
Als „besonders bedrohlich wurden in Politik und Medien“ laut Nora Keller die (größtenteil türkisch- und kurdischstämmigen) „Gangs‘ besprochen, die Jugendliche in den 90er Jahren gründeten und die das Kottbusser Tor zu ihrem Zentrum erklärten“. Ein „bedrohliches Phänomen“ – so ähnlich wie die „Clans“ der arabischen Großfamilien in Berlin, die ebenfalls ständig von der Journaille, vornehmlich der Springerstiefelpresse, angeprangert werden. Es gibt außerdem ein reißerisch aufgemachtes „Spiegel-Buch“ über sie.
Am „Kotti“ gab es vor den „Gangs“ Anfang der Achtzigerjahre schon einmal ein „bedrohliches Phänomen“: die Punker, die sich dort trafen. Die Medien und Politiker behaupteten: Weil dieser Haufen dort säuft und rumpöbelt trauen sich keine Kunden in die Geschäfte dort, denen es deswegen schlecht geht. Diese Hetze ließ erst nach, als die New Yorker Stadtplanungskritikerin Toni Sachs-Pfeifer sich dem Platz widmete und zu dem Schluß kam: Alles Quatsch! Die Omas und Opas kommen von weit her, um sich die Punker am Kotti anzusehen.
„Pressefreiheit!“ – dass ich nicht lache, es sind mehrheitlich angemaßte Ordnungshüter. Die Journaille der Kapitalmedien steht unter dem Zwang zu skandalisieren, ist oberflächlich, d.h. muß täglich neue „Problemfelder“ aufreißen, und ist ohne Einfühlungsvermögen für Arme, Minderheiten und Verhaltensauffällige.
.

.
Bert Papenfuß
Der Dichter Bert Papenfuß starb mit 67 am 26.August 2023. „Papenfuß war der Sohn eines NVA-Offiziers und ging zeitweise in Leningrad zur Schule. Er erlernte den Beruf des Elektronikfacharbeiters, Ton- und Beleuchtungstechnikers. Vor dem Armeedienst als Bausoldat arbeitete er als Theaterbeleuchter in Schwerin und ab 1976 in Berlin. Ab 1980 war er freier Schriftsteller. Da seine Publikationsmöglichkeiten in der DDR eingeschränkt wurden, trug er seine Texte in Begleitung verschiedener Rock- und Punkbands vor,“ heißt es auf Wikipedia.
Ich lernte ihn in den Achzigerjahren in Westberlin kennen, wo er sich eine zeitlang aufhielt und auch heiratete: eine Chicagoer Punksängerin, wenn ich das richtig erinnere. Mit ihr hatte er eine Tochter: Leila. Damals bekamen etliche DDR-Punker eine Ausreisegenehmigung nach Westberlin. Sie vermuteten, dass die DDR-Regierung hoffte, sie würden dableiben. Dem war aber nicht so: Es waren keine Republikflüchtlinge sondern Anarchisten.
Als sie nach der Wende im Prenzlauer Berg die Kneipe „Torpedokäfer“ eröffneten, die dann auch meine Stammkneipe wurde, traf ich Papenfuß dort fast jeden Abend. Hinter der Theke arbeitete Lothar, ein Philosoph, der lange Gutachten und Einsprüche brauchte, um nicht vom Arbeitsamt zum Gärtner umgeschult zu werden. Ironischerweise traf ich dort einmal einen Musiker aus Heidelberg, der ebenso lange gebraucht hatte, um vom Arbeitsamt eine Umschulung zum Gärtner finanziert zu bekommen.
Eine der Kellnerinnen im „Torpedokäfer“ war die junge Frau Djamila, die so bezaubernd war, dass alle möglichen Typen ihr Komplimente und Freundschaftsanträge machten – auf Bierdeckel, Büttenpapier und ausgerissenen Kalenderseiten. Sie sammelte diese Geständnisse und stellte sie irgendwann im „Torpedokäfer“ aus – eine ganze Wand voll. Der Name der Kneipe ging auf den ersten Titel der Autobiographie des expressionistischen Dichters und Schiffsentführers Franz Jung zurück, dessen Buch später unter dem Titel „Der Weg nach unten“ erschien, was in gewisser Weise auch auf die Perspektiven der „Torpedokäfer“-Stammgäste zutraf, die sich nach der Westerweiterung der BRD ihrer regelmäßigen Einkünfte beraubt sahen und zudem oft ihre Wohnungen im Prenzlauer Berg wegen Mieterhöhung oder Eigenbedarf verloren.
Bert Papenfuß war mit dem dissidentischen Verlag „Basisdruck“ liiert und forschte nebenbei über Piraten. Ihm verdanke ich einige Ideen für meine Texte, die dort veröffentlicht wurden – übrigens nach dem alten linksradikalen Prinzip „Wer schreibt der zahlt“. In diesem Verlag erschienen nacheinander auch die Zeitschriften „Sklaven“, „Sklaven Aufstand“, „Gegner“ und zuletzt „Abwärts“, dessen 54. Ausgabe Morgen am 26.3. in der Prenzauer-Berg-Anarchospelunke „Baiz“ vorgestellt wird. Papenfuß war bei allen Redakteur und ich gelegentlich Autor.
Außerdem veröffentlichte er ab und zu, ebenso wie ich, ein Buch im Verlag von Peter Engstler, der in der Rhön lebte und dort alle zwei Jahre eine dreitägige Lesung auf der Jungviehweide „Kalte Buche“ veranstaltete. Als Engstler seine Verlagstätigkeit aufgab, wanderten wir mit unseren Büchern zum Verlag „Moloko“ von Ralf Friel in Sachsen-Anhalt, bei dem Papenfuß zunächst als Korrektor meiner Tierbücher fungierte.
Nach dem „Torpedokäfer“ hatte er mit zwei Freunden das „Kaffee Burger“ eröffnet dessen Attraktion die „Russendisko“ von Wladimir Kaminer war. Alle vier wurden damit reich – vorübergehend. Papenfuß stieg nach einer Weile aus diesem Touristenmagnet aus und bekam dafür ein paar Jahre lang eine Rente. Dann eröffnete er zusammen mit Mareile Fellien, die ihn inzwischen geheiratet hatte, die „Kulturspelunke Rumbalotte“ im Prenzlauer Berg – als Ausweichquartier für die „Torpedokäfer“-Freunde.
Das Wort „Rumbalotte“ geht auf einen Witz des Künstlers Thomas Kapielski zurück: Drei Matrosen vergleichen ihre reichlich tätowierten Schwänze, wobei sie über einen lachen, der nur „Rumbalotte“ auf seinem Schwanz stehen hatte. Er brachte sie jedoch zum Staunen als daraus im erigierten Zustand der Satz „Ruhm und Ehre der baltischen Rotbannerflotte“ wurde.
Der Arbeitsamts-Coach empfahl Mareile und Bert immer wieder, sie sollten sich zwecks Umsatzerhöhung für die Touristen fit machen – mit Mixgetränken und ähnlichem Hawaii-Gelumpe, aber sie wollten ja gerade keine Touristen in ihrem Laden haben. Irgendwann traten sie ihn an die Malerin Cindy ab, eine quasi professionelle Gastronomin, und Papenfuß/Fellien mieteten einen Raum in einer stillgelegten Pankower Brauerei an – als Rumbalotte II, für die sie einen Unterstützerverein gründeten. Die Rumbalotte I blieb jedoch, von Cindy umbenannt in „Watt“, Stammkneipe und Veranstaltungsraum der Scene um Papenfuß/Fellien. „Cindy und Bert“ kennt man in der BRD nebenbeibemerkt als gruseliges Gesangsduo. Jetzt soll Cindys „Watt“ gerade wegen einer Mieterhöhung weichen und Kai Pohl, einer der Papenfuß-Dichterfreunde, ruft zu einer Rettungsaktion der Kneipe auf:

Als Papenfuß starb, war ich entsetzt, denn er war der wunderbarste Integrator der Scene gewesen und ein extrem freimütiger Denker: So stellte er z.B. den arbeitslos gewordenen Stasi-Offizier, der die IM für die Prenzlauer-Berg-Anarchos betreut hatte, als Türsteher im „Kaffee Burger“ ein und veröffentlichte dessen Agitprop-Gedichte im „Gegner“. Und mit seinem quasi persönlichem IM Sascha Anderson bestritt Papenfuß nach 2000 gemeinsam Dichterlesungen – z.B. auf der „Kalten Buch“ in der Rhön.
Papenfuß plötzlicher Tod beendete seine Herausgabe der Autobiographie von Norbert „Knofo“ Kröcher, ein (west-)„deutsches Mitglied der terroristischen Vereinigung Bewegung 2. Juni“, wie es auf Wikipedia heißt. Dessen ersten Band hatte Papenfuß im Basisdruck-Verlag veröffentlicht und den zweiten hatte er fast fertig lektoriert. „Knofo“ war zuletzt ehrenamtlicher Feuerwehrhauptmann in Brandenburg gewesen und hatte sich 2016 erschossen. Vielleicht weil er die Schnauze voll hatte.
.

.

.

.

.
Wehrertüchtigung
In den sozialen Medien tauchen plötzlich lauter Soldaten- und Waffenfotos aus dem Zweiten Weltkrieg auf. Daneben Fotos von jungen hübschen ukrainischen und israelischen Soldatinnen. Eine Wirtschaftszeitung titelt „Waffenhersteller fahren Rekordgewinne ein“. Auf „Panorama“ heißt es „Mehrheit für US-Atomwaffen in Deutschland“. „Newsweek“ meldet „Rob Bauer, Vorsitzender des Nato-Militärausschusses, sagte kürzlich, dass das Bündnis „bereit für eine direkte Konfrontation mit Russland sei, während das Land in der Ukraine weiter kämpft.“
In seinem Buch „Himmel über Charkiw” bezeichnet der ukrainische Schriftsteller Serhij Zhadan die Russen laut „Die Zeit“ als “Horde”, “Verbrecher”, “Tiere”, “Unrat”. Der Friedenspreisträger meinte: “Die Russen sind Barbaren, sie sind gekommen, um unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere Bildung zu vernichten. Brennt in der Hölle, ihr Schweine.” Fabio De Masi postete: „Jeden Morgen an dem ich den Bundestag betrat, war ich stolz der Bevölkerung ztu dienen, der eine große Inschrift gewidmet ist. Andere halten es für angemessen, den Reichstag in einen Bazar für die Rüstungsindustrie umzuwidmen.“ „Aufgrund der schweren Völkerrechtsverletzung durch den offenbar geistig gestörten Autokraten Putinlehnen wir ab sofort die Behandlung russischer Patienten ab,“ postete Prof. Dr. Ortrud Steinlein aus München.
„Krieg ist verdichteter Friede!“ meint der Kriegsschriftsteller Roland Linowski in seinem Roman „Stille Erde“. Das Bündnis Sahra Wagenknecht plakatierte: „Angriffe auf Russland über Wiesbanden. Dieser Wahnsinn muß aufhören!“ In Wiesbaden sitzen amerikanische und ukrainische Offiziere und bereiten von dort aus Angriffe mit Raketen und Drohnen auf Russland bzw. russische Truppen vor. Das ukrainische Model Milena erklärt im „Playboy“: „Warum ich mich trotz Krieg nackt zeige“. Die Frau von Wladimir Selensky posierte derweil für „Vogue“ in einem Mantel von Gucci vor einem abgeschossenen russischen Kampfflugzeug. In der britischen Nationalgalerie wurde das Gemälde „Russische Tänzer“ umbenannt in „Ukrainische Tänzer“.
Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff schimpft: „Die Ostermarschierer sind die fünfte Kolonne Wladimir Putins, politisch und militärisch.“ Florence Gaub, stellvertretende Leiterin des EU-Instituts für Sicherheitsstudien urteilte in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“: „Wir dürfen nicht vergessen, dass auch wenn Russen europäisch aussehen, dass es keine Europäer sind, jetzt im kulturellen Sinne, einen anderen Bezug zur Gewalt haben, einen anderen Bezug zum Tod haben.“
Beweis: Wer hat den Treuhandchef Detlev Rohwedder 1991 erschossen? „Ein Russe!“ (hieß es anfänglich sofort)
Wer hat im Kalten Krieg mit U-Booten vor der schwedischen Küste die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt? „Die Sowjetunion!“ 2021 erklärte jedoch ein hoher US-Militär stolz: „Das waren wir, wir haben dafür extra italienische U-Boote geleast“.
Wer manipulierte die US-Wahlen? „Die Russen!“ (Russische Hacker)
Wer beschießt das von russischen Truppen eingenommen ukrainische AKW „Saporischschja“? „Die Russen!“
Wer sprengte die zwei Northstream-Pipelines in die Luft? „Die Russen!“
Ursula von der Leyen kündigte nach den Sprengungen sofort „härteste Konsequenzen“ an. Die CIA hatte zuvor bereits verlauten lassen, dass es dazu kommen werde. US-Präsident Joe Biden sagte in einer Pressekonferenz im Beisein von Olaf Scholz: „Wenn die Russen in die Ukraine einmarschieren, wird es keine Pipelines mehr geben. Wir werden das schaffen, versprochen.“ Victoria Nuland vom US-Senatsausschuss für auswärtige Beziehungen erklärte: Wenn die Russen weiter die Ukraine angreifen, wird das einen „direct impact on the pipelines“ haben. Wir erwarten, dass die Pipelines „suspended“ werden.
Ironischerweise gibt es jetzt amerikanische Interessenten, die die Pipeline kaufen und reparieren wollen.
Auf einem Video sagte der ehemalige US-Senator Richard Black: „Es ist uns egal, wie viele Ukrainer sterben – wir wollen gewinnen. Die Entscheidung über den Kriegsverlauf und auch über das mögliche Ende liegt alleine in den Händen Washingtons.“
Die Zeitschrift der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft berichtet in ihrer Ausgabe 9/24 über die Anstrengungen, die Bundeswehr „in die Mitte der Gesellschaft“ zu holen. Bereits 2022 hatte die FDP-Bildungsministerin Stark-Watzinger die Schulen aufgefordert, mehr Bundeswehr-Offiziere einzuladen. Außerdem sollten die Schulen die Kinder auf einen möglichen Kriegsfall vorbereiten und Zivilschutzübungen einführen. Die Hochschulen sollten sich für Militärforschung öffnen. Vor allen Söder forciert diesen Trend zur neuen Wehrhaftigkeit. Laut Koalitionsvertrag der Ampelkoalition sollen die Ausbildung und Dienst an der Waffe erst ab 18 Jahren möglich sein, aber Deutschland gehört zu einer Minderheit von 46 Staaten, die Minderjährige für das Militär anwerben – 2023 waren es 2000, darunter 315 Mädchen.
.

Der Lehniner Spielplatz für sone:

und solche:













