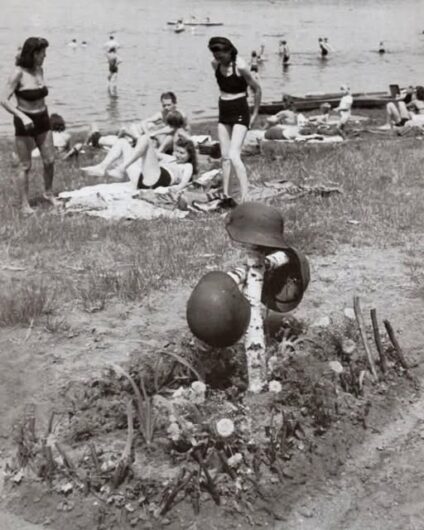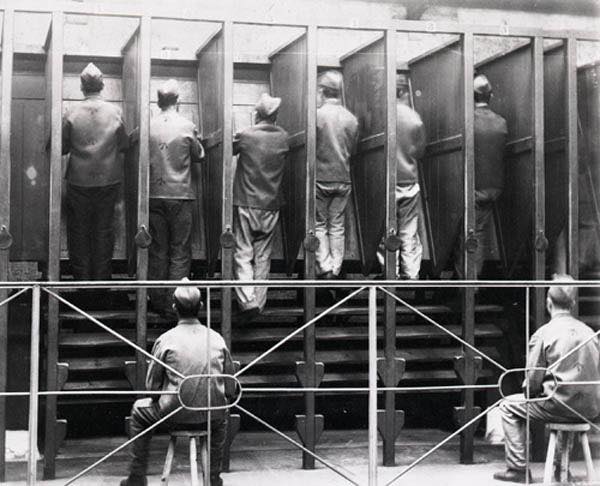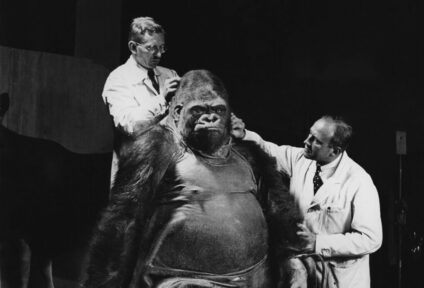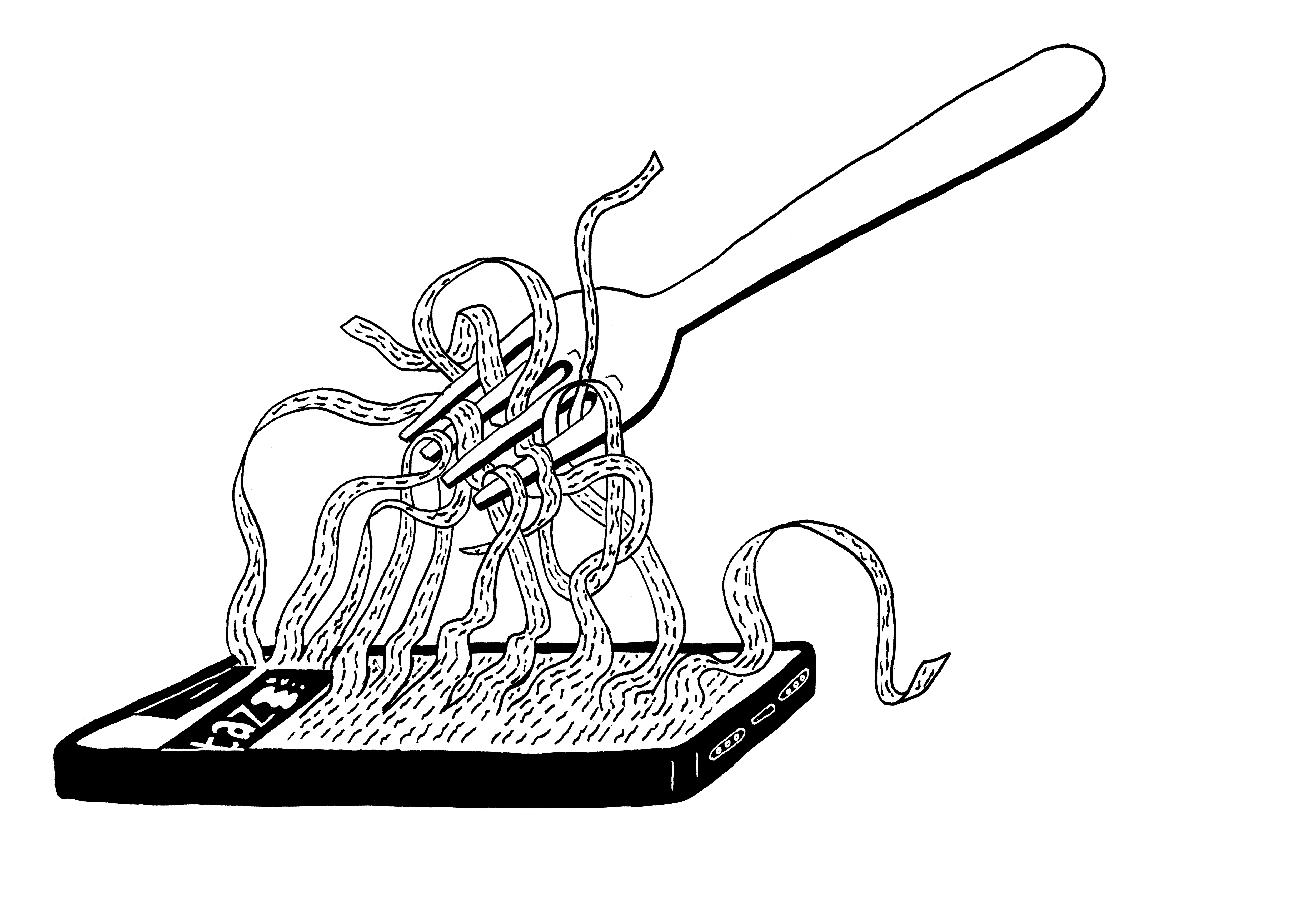Das obige Beitragsbild zeigt englische Häftlinge, die 1895 auf einer Art Autopaternoster Strom für das Gefängnis produzieren.
Löwenmaul
Das Löwenmaul ist eine Modellpflanze zur Erforschung der Blütenentwicklung. Den mit ihr im 20. Jahrhundert experimentierenden Botanikern im Kaiser-Wilhelm-Institut für Kulturpflanzenzüchtung in Müncheberg erschloß das Löwenmaul die Idee der „Rassenhygiene“, der „Eugenik“ und des „Nationalsozialismus“, indem sie als Genetik-Pioniere ihre biologischen Erkenntnisse auf die Gesellschaft übertrugen, die sich nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg daran machte, sich selbst biologisch „neu zu erfinden“. In Müncheberg trieb dies der Gründer des Instituts, Erwin Baur, voran, danach forschte sein Schüler Hans Stubbe am Löwenmaul weiter. Nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg rettete er seine genetische Forschung gegen die sowjetische „proletarische Biologie“ in die DDR rüber, und brachte es schlußendlich mit seinem „Institut für Kulturpflanzenforschung“ in Gatersleben zum obersten DDR-Biologen. Indem Stubbe keimfähige Pollenkörper des Löwenmauls mit Röntgenstrahlen beschoß, wollte er künstlich Mutationen erzeugen, wobei er davon ausging, dass dessen erheblich von den normalen abweichenden „pelorischen Blüten“, die bereits sein Doktorvater Baur beforschte, durch Genmutation entstehen. 1934 berichtete er in der Zeitschrift „Die Naturwissenschaften“ über „Entwicklung und Stand der Mutationsforschung in der Gattung Antirrhinum majus“ – Garten-Löwenmaul.
Eine Kollegin von Stubbe in Müncheberg, die Genetikerin Gerta von Ubisch, kam wenig später als Jüdin im Exil zu der Einsicht: „Leider ist nicht zu leugnen, dass die große Popularisierung der Genetik durch Baur mit zu dem katastrophalen Mißbrauch beigetragen hat, den der Nationalsozialismus mit der Rassenfrage getrieben hat.“
Das Löwenmaul gilt inzwischen ironischerweise als ein Paradebeispiel für Mutationsbildungen, die – ebenso wie der Nationalsozialismus – gerade nicht genetisch entstehen. Schon Linné, der „Ordnung in die Natur“ bringen wollte, kannte eine mit den Löwenmäulern verwandte Pflanze, das Leinkraut, bei der ebenso „scheinbar aus dem Nichts abweichende Blütengestalten auftauchten,“ wie der Biologe Bernhard Kegel in seinem Buch „Epigenetik“ (2009) schreibt. Linné nannte die Abweichler „Peloria“ (Monster auf griechisch), die ihm nicht weniger phantastisch dünkte, „wie wenn eine Kuh ein Kalb mit Wolfskopf zur Welt brächte“.
Der einflußreiche Naturforscher Ernst Mayr war beeindruckt (in: „Die Entwicklung der biologischen Gedankenwelt“ 1984), „dass Linné bereits das Auftreten einer auffälligen Mutation (wie Peloria) kannte, die in den nachfolgenden Generationen unverändert bleibt und doch mit der Eltern-‚Art‚ kreuzbar ist. Botaniker und Gärtner fanden später viele Fälle, die Linnés Peloria ähnelten, indem plötzlich ein stark abweichender Typus auftrat. Linné kam dahin, daß ‚diese neue Pflanze sich mit ihrem eigenen Samen fortpflanzt und daher eine neue Art ist, die es zu Anbeginn der Welt nicht gab‚. Mehr noch: Nach Linnes Klassifikations-Methode war Peloria nicht bloß eine neue Art oder Gattung, sondern eine völlig verschiedene Blumen-Klasse. Dies erschütterte nicht nur seine Auffassung von der Konstanz der Arten, es schien auch seine Axiome der Klassifikation zu widerlegen.“ Das „Monster“ ließ ihn an seinem christlichen Glauben zweifeln.
Darwin, den dann vor allem das qualvolle Töten von Raupen durch Schlupfwespen an Gott verzweifeln ließ, begeisterte dagegen das Peloria-Problem. In „Die Variation von Tieren und Pflanzen unter Domestikation“ (1868) schrieb er: „Pelorische Rassen wie Löwenmaul können über Samen vermehrt werden, und sie unterscheiden sich auf eine wundervolle Weise von der typischen Form in Struktur und Erscheinung.“ Es ging ihm dabei um die „Vermehrungsweise“: „Es sind nicht die reproduktiven Elemente, auch nicht die Knospen, welche neue Organismen erzeugen, sondern die Zellen selbst durch den ganzen Körper. Diese Annahmen bilden die provisorische Hypothese, welche ich Pangenesis genannt habe…Bei Variationen, welche durch die directe Einwirkung veränderter Lebensbedingungen verursacht werden, … werden die Gewebe des Körpers nach der Theorie der Pangenesis direct durch die neuen Bedingungen afficiert und geben demzufolge modificirte Nachkommen aus, welche mit ihren neuerdings erlangten Eigenthümlichkeiten den Nachkommen überliefert werden.“ Dies Zitat zeigt laut Wikipedia, dass Darwin weit lamarckistischer im Sinne einer Vererbung erworbener Eigenschaften gedacht hat, als ihm das heutzutage zugestanden wird. Konkret äußerte er über das Peloria-Phänomen: „Wir müssen davon ausgehen, dass viele Ausdrucksformen, fähig zu evoluieren, in den Organismen verborgen sind. Wir wissen zum Beispiel, dass Pflanzen aus vielen Ordnungen gelegentlich pelorieren.“
Laut Kegel wurde aus Peloria, dem erstaunlichen Einzelfall, mit der Zeit ein ganzer Pelorismus: „Immer mehr Pflanzen wurden entdeckt, mit denen Ähnliches geschah.“ Bei ihrer Erforschung näherte man sich ungewollt der Vermutung, dass sich auch (Umwelt-) Erfahrungen vererben, was in der Mutations-Selektions-Lehre als unmöglich galt. Ironischerweise sind es die Genetiker, die sich nun für diese Vererbungsweise erwärmen (müssen). Bis dahin war sie stets nur von Vertretern der Geistes- und Sozialwissenschaften gegen die darwinistischen Genforscher und Biochemiker ins Feld geführt worden. Um sich nicht ganz von ihrer Sichtweise und ihrem Vokabular zu verabschieden, sprechen die Genetiker nun von „Epigenetik“, was bedeutet, dass sie zwar „das (komplizierte) Leben“ quasi akzeptieren, aber trotzdem weiterhin „lebendige Systeme“ und die „Algorithmen des Lebendigen“ erforschen, bei den Pelorien sprechen sie einstweilen auch noch von „Paramutationen“.
Im Vorwort seines Buches „Epigenetik“ fragt sich Kegel: „Erleben wir tatsächlich die Wiedergeburt der Lamarckschen Idee von der Vererbung erworbener Eigenschaften?“ Er erinnert daran, dass der Begriff des „Gen“ 2009 hundert Jahre alt wurde, und dass man ihn gebührend hätte feiern sollen, „denn ob dieser Begriff seinen nächsten runden Geburtstag noch erleben wird, ist fraglich“: Das „genzentrische Weltbild“ war allzu simpel. „Selbst Craig Venter, vor wenigen Jahren mit seinen Sequenzierrobotern an vorderster Front der biomedizinischen Forschung, muss heute eingestehen: ‚Im Rückblick waren unsere damaligen Annahmen über die Funktionsweise des Genoms dermaßen naiv, dass es fast peinlich ist‘. ‚Wir müssen blind gewesen sein‘, seufzte der Entwicklungsgenetiker Timothy Bestor von der New Yorker Columbia University gegenüber ‚Scientific American‚ angesichts eines ganzen ‚Universums‘ ungeahnter und unerwarteter Phänomene. Über Vererbung und Evolution muss neu und intensiv nachgedacht werden.“
Aber die „Epigenetik“ in den Analysegeräten und Rechnern der etwas ratlosen Genetiker, das ist noch kein „Lamarckismus“ – keine „Milieu-Biologie“: „In diesem Wort ‚Umgebung‘ drängt sich“ laut Heidegger 1946 „alles Rätselhafte des Lebe-Wesens zusammen“. Der sowjetische Dichter Ossip Mandelstam, der sein Schach von der Literatur auf die Biologie setzte, damit das Spiel ehrlicher werde, schrieb 1930 über eine Fahrt nach Armenien: „Ich weiß nicht, wie es andern ergeht, aber für mich vergrößert sich der Zauber einer Frau, wenn sie eine junge Reisende ist, die in wissenschaftlicher Mission fünf Tage lang im Zug nach Taschkent auf einer harten Bank hat liegen können, die sich gut im Latein Linnés zurechtfindet, die im Streit zwischen Lamarckisten und Epigenetikern weiß, wo sie steht, und etwas übrig hat für Löwenmäulchen, Baumwolle oder leichte Melancholie.“
Danach hörte man lange Zeit nichts vom Gartenlöwenmaul. Bis es vor einigen Jahren dem „Wageningen University & Research Center“ in Holland gelang, eine Tomate mit lila Pigmenten auf gentechnischem Wege zu entwickeln. „Der Wageninger Test-Tomate hatte man zwei Gene des Löwenmäulchens eingepflanzt,“ schreibt die holländische Autorin Annemieke Hendriks in ihrem Buch über „Tomaten“ (2017). Mit den Löwenmäulchen-Gene war sie nicht nur lila geworden, sondern – wie mit Mäusen im Experiment bewiesen: Sie sollte auch gut gegen Krebs sein. „Eine Anti-Krebs-Tomate“ gewissermaßen. Am Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaft der Humboldt-Universität meinte man dazu aber nur: „Wäre es doch bloß so einfach.“
.

Schlafsaal eines englischen Obdachlosenasyls. Die etwas bessere Asylvariante für nicht ganz arme Obdachlose nennt sich „4 Penny Coffins“:
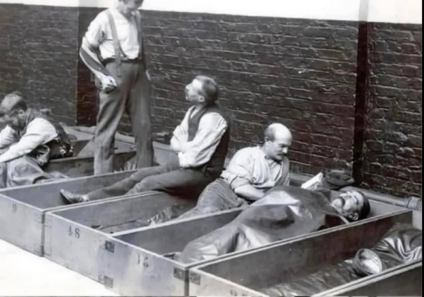
.
Löwenzahn
Der Spandauer Schuldirektor Christian Sprengel kam 1790 der geschlechtlichen Vermehrung der Blumen durch Insekten auf die Spur. Sein Buch „Das entdeckte Geheimnis der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen“ (1793) wurde jedoch lange Zeit als „absurd“ und „obszön“ abgelehnt.
Sein prominentester Gegner war Goethe, der Sprengel vorwarf, die Natur zu vermenschlichen. Ähnliches galt für Hegel, als er 1830 in seiner Vorlesung „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse“ auch „Die vegetabilische Natur“ behandelte. Für ihn war es noch „eine berühmte Streitfrage in der Botanik, ob wirklich bei der Pflanze erstens Sexualunterschied, zweitens Befruchtung wie bei den Tieren vorhanden“ sei. Er entschied sich, von der Geschlechtslosigkeit der Pflanzen auszugehen, selbst bei den Zweigeschlechtlichen, „weil die Geschlechtsteile, außer ihrer Individualität, einen abgeschlossenen, besonderen Kreis bilden.“ Zudem sah er für die „Begattung“, d.h. Bestäubung der Blüten, keine Notwendigkeit, es ist etwas „Überflüssiges: Luxus“, denn die Pflanzen können sich z.B. auch durch Ableger, Sprossen etc. vermehren. „Die Verstäubung ist für sich selbst Zweck der Vegetation, – ein Moment des ganzen vegetativen Lebens, welches durch alle Teile geht.“ Mit anderen Worten: Da die Blüte selbst ein Moment des „Fürsichseins“ ist, kann die Pflanze als Ganzes „nie eigentlich zum Selbst kommen“. Nicht erst die Befruchtung ihrer Blüten, sondern ihr bloßer Wachstumsprozeß ist bereits „Produktion neuer Individuen“.
Erst Charles Darwin verschaffte der von Sprengel entdeckten Symbiose zwischen Blumen und Insekten Geltung: In einem seiner letzten Werke „Über die Einrichtung zur Befruchtung britischer und ausländischer Orchideen durch Insekten“ (1862) urteilte er über Sprengel: „Dieses Schriftstellers eigenthümliches Werk mit seinem eigenthümlichen Titel wird oft geringschätzig beurtheilt. Er war ohne Zweifel ein Enthusiast und hat wohl auch einige seiner Ideen zu einer ausserordentlichen Länge ausgesponnen. Doch habe ich mich mittelst meiner eigenen Beobachtungen überzeugt, dass es einen gewissen Schatz von Wahrheit enthält. Und schon vor Vielen sprach Robert Brown, vor dessen Urtheil sich alle Botaniker neigen, nur mit hoher Achtung davon und bemerkt, dass nur Diejenigen darüber lachen können, welche nicht viel von der Sache verstehen.“
Hegel begriff alle geschlechtliche Vermehrung der Blumen als „Luxus“. Für den Basler Biologen Adolf Portmann war ihre Nektar- bzw. Saftproduktion zum Anlocken der Insekten 1962 nur noch beim Löwenzahn „Luxus“, den er vor allem gegen die Darwinsche Evolutionstheorie ins Feld führte, insofern darin stets auf die Nützlichkeit abgehoben wird. Dem gegenüber gibt es jedoch laut Portmann immer wieder zwecklose, „unadressierte“ Entwicklungsphänomene. „Auch die Schönheit einer Blüte ist nicht hinreichend durch den Zweck der Anlockung von bestäubenden Insekten geklärt, wie innig und sinnvoll solche symbiontischen Beziehungen auch in manchen Fällen sein mögen,“ schreibt der Biologe Joachim Illies in seiner Biographie über Adolf Portmann, der als Beispiel den Löwenzahn erwähnte: „Die ganze goldgelbe Pracht der Blüte, so nützlich sie für die zahllosen Insekten ist, die von ihr angelockt den Pollen und Nektar entnehmen, ist für die Pflanze selbst nutzlos, denn ihre Samenanlagen entwickeln sich grundsätzlich jungfräulich, d.h. ohne Befruchtung allein aus dem Erbgut der Mutterpflanze.“ Wenn die Orchidee ihre Insekten „täuscht“, dann „täuscht“ der Löwenzahn sich quasi selbst.
Portmann schrieb 1955 (in: „Ein Naturforscher erzählt“): „Das ist eine seltsame Geschichte; bereits um 1903 herum haben die Botaniker das alles aufgedeckt. Es entspricht dem ausgerichteten Zweckdenken unserer Zeit, daß der Löwenzahn wohl als ein sinnreiches Beispiel der Bestäubung von Blüten durch Insekten auftritt, daß aber die großartige Unnötigkeit dieses Verfahrens in allen diesen Darstellungen kaum gewürdigt wird.“
„Worin also liegt der Sinn dieses für die Pflanze selbst unnötigen Verfahrens?“ fragt sich sein Biograph Illies. „Allein in der ‚fremddienlichen Zweckmäßigkeit‘ für die Insekten? Solcher Altruismus wäre darwinistisch erst recht unbegreiflich, denn wo sollte sein Selektionsvorteil für die Pflanze liegen?“ Portmann war es dagegen immer wichtig, zu betonen, „daß sich in den Gestalten die Lebensformen selber darstellen, daß Selbstdarstellung wohl gar die oberste Leistung ist, der die anderen dienen müssen.“ In diesem Sinne deutete er auch die Blütengestalten: „Spricht sich bereits in den Blattformen das besondere der Art aus, so ist die Blüte als reichste Gestaltung erst recht ein Ausdruck dieser Selbstdarstellung.“
Die darwinistischen Biologen, die epidemieartig (über Seminararbeiten und Praktikumsaufgaben) neben unzähligen anderen auch den Wikipedia-Eintrag „Gewöhnlicher Löwenzahn“ verantworten, kennen natürlich keine wie auch immer geartete „Selbstdarstellung“ bei Tieren und Pflanzen: keine Kultur in der Natur. Immerhin nahmen sie zur Kenntnis, dass die jungfräuliche Entwicklung des Samens bei den Löwenzahnpflanzen „ungewöhnlich“ ist, insofern sie, „obwohl sie keine Bestäuber benötigen, dennoch Nektar produzieren.“ Aber die Wikipedia-Darwinisten fanden einen Dreh, auch dieses seltsame Phänomen evolutionistisch sich zu erklären, indem sie das scheinbar altruistische, insektenfreundliche Verhalten des Löwenzahns dahingehend deuteten, dass diese Pflanzen „erst vor so kurzer Zeit entstanden sind, so dass ihre Energie verschwendende Nektarproduktion im Laufe der Evolution noch nicht eingestellt werden konnte.“ Aber wenn man gleichzeitig davon ausgeht, dass die Blumen-Insekten-Ko-Evolution die „höchstentwickelte“ Form der Pflanzenvermehrung ist, dann sollte man doch eher davon ausgehen, dass der Löwenzahn dabei ist, seine Selbstbefruchtung langsam aufzugeben. Vielleicht lockt er die Insekten aber auch aus ganz anderen Gründen mit seinem Nektar an.
Der Naturfilmer Jan Haft spricht in seinem Buch „Die Wiese“ (2019) von einem „perfiden Trick“: Indem der Löwenzahn die Wiesen, egal ob Magerwiese oder überdüngte Weide, mit seinem „unwiderstehlichen Nektarangebot überschwemmt, sorgt er dafür, dass alle Insekten leicht satt werden und die anderen Blumen in der Wiese nicht oder zumindest weniger gründlich bestäuben,“ so dass sie weniger Samen bilden und auf diese Weise „nicht so viele Konkurrenten um den begrenzten Platz auf dem Wiesenboden heranwachsen. Der Löwenzahn blüht also nicht, um bestäubt zu werden, sondern um anderen das Wasser abzugraben und sich so Vorteile zu verschaffen.“ Jan Haft erwähnt im Zusammenhang des Löwenzahns ein weiteres „wahres Wunder: von einer nektarführenden Blume zu einer Kugel aus Flugsamen in weniger als einer Woche! Das schaffen nur wenige andere Pflanzen auf der Wiese.“
Es gibt viele Löwenzahnarten, die Taraxacologen (Löwenzahnforscher) haben bereits über 50 entdeckt, einer, der Botaniker Ingo Uhlemann von der Universität Dresden, spricht von einer „schwierigen Gruppe, die bisher nur unzureichend erforscht ist.“ Der Löwenzahn gilt im Allgemeinen als ein „Unkraut“, weil er dazu neigt, ganze Grünflächen mit seinen gelben Blüten und den „Pusteblumen“ zu überziehen. Sein Nektar und seine Pollen sind jedoch für die Insekten (vor allem für Honigbienen und Hummeln) ein Segen. Und aus den jungen Blättern kann man Gänse- und Kaninchenfutter sowie „Löwenzahn-Salat“ zubereiten, aus seiner bis zu einem Meter langen Wurzel angebraten eine ganze Mahlzeit. Im Mittelalter wurde die Pflanze zudem gegen viele Leiden verwendet, seltsamerweise war sie damals laut Jan Haft selten.
Statt in der Volksmedizin findet der Löwenzahn heute in der Industrie Verwendung – und zwar sein Wurzelsaft. Aus der milchigen Flüssigkeit des russischen Löwenzahns „kok-saghyz“ gewannen die sowjetischen Botaniker einen Kautschuk-Ersatz, um das devisenschwache Land von Importen unabhängig zu machen. Bereits 1941 bestand ein Drittel der sowjetischen Gummiproduktion aus Löwenzahnsaft. In Deutschland stellte man, ebenfalls aus „Autarkiebestrebungen“ heraus, den Kautschuk synthetisch her – in den BUNA-Werken: zuerst bei Schkopau und zuletzt auch noch in Auschwitz. Es ging dabei um Reifen für Wehrmachts-Fahrzeuge („Räder müssen rollen für den Sieg!“), aber die produzierten Mengen waren zu klein. Die Endfertigung geschah u.a. im Werks-KZ Stöcken der Reifenfirma „Continental“. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion bemächtigten sich deutsche „Sammelkommandos“ unter der Führung von uniformierten Botanikern der sowjetischen „kok-saghyz“-Forschungsinstitute und -felder und Himmler ernannte sich zum „Sonderbeauftragten für Pflanzenkautschuk“. Im Pflanzenzüchtungsinstitut der SS in Auschwitz wurde damit unter der Leitung des Müncheberger Züchtungsforschers Wilhelm Rudorf weiter experimentiert, um den Kautschukanteil im Milchsaft des Löwenzahns, der einen Milliliter pro Pflanze betrug, zu erhöhen. Aber erst 2014 stellte die Hannoveraner Firma „Continental“ auf der Automesse IAA erstmals einen Reifen aus „Löwenzahn-Kautschuk“ vor, damit wolle der Gummikonzern sich vom schwankenden Weltmarkt für Naturkautschuk unabhängig machen, meldete „finanzen 100“. Wird man den Löwenzahn bald auch hier feldmarschmäßig angebauen?
In dem kleinen Buch über „Botanische Wunder“ (2012) des Potsdamer Biologen Ewald Weber fand ich noch den Hinweis, dass die Früchte mit den Löwenzahn-Samen sich an einer Art Fallschirm so weit wie möglich vom Wind wegtragen lassen und wir tatsächlich daraus das Bauprinzip für Fallschirme entnommen haben. Das Schönste aber ist, dass die Pflanze während des Reifens der Früchte noch einmal ihren Stängel verlängert, so dass die Pusteblume zuletzt die meisten der um sie herum wachsenden Pflanzen überragt – damit der Wind sie voll erfassen kann. Der Löwenzahn ist bisher gut mit seinen selbstbefruchteten Fallschirmsamen gefahren, deswegen bleibt er einstweilen bei diesem „Verfahren“, nehme ich an.
.

52.000 Goldsucher in der Mine Serra Pelada 1986. Aktuell gibt es einen ähnlich Gold-Rush auf einem goldhaltigen afrikanischen Sandstrand:

.

Goldtresor – der Goldpreis hat dank Trump gerade einen vorläufigen Höchststand erreicht: 1 Unze (31,10 Gramm) kostet 3354,97 Dollar. Aber nun droht er wieder zu fallen:
.
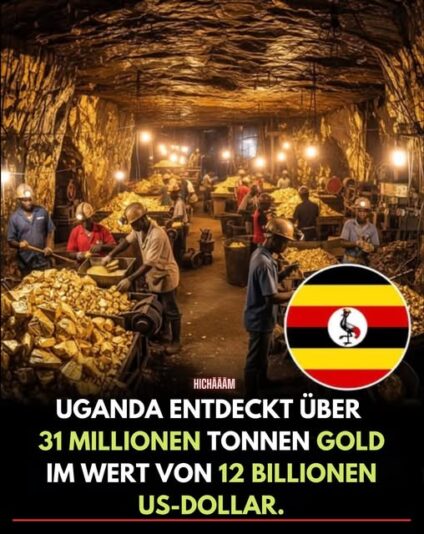
.
Lust
„Werdet selten!“ (Nietzsche) Ein Mückenschwarm kreist über einen Teich; aus dem Off raunt Heinz Sielmann: „Sie haben nur ein Interesse – sich zu vermehren.“ Der holländische Biologe Midas Dekkers sieht das anders: „Im Grunde sind Tiere gar nicht auf Elternschaft aus. Es ist nicht ihr Anliegen, die Art zu erhalten, sondern das von Mutter Natur. Läge es an den Tieren selbst, führten sie ewig ein lustiges Junggesellenleben.“ Zumal die Weibchen vieler niederer Tiere nach dem Eierlegen bzw. Gebären sterben, oder – wie z.B. die australische Krabbenspinne – von ihrer Brut aufgefressen werden? Einige Embryologinnen am Pariser Institut Pasteur sind gar davon überzeugt, dass das Austragen eines Kindes und das Wachsen eines bösartigen Tumors identische Vorgänge sind: Der Fötus ist ein fremdes Stück Fleisch, ein Pfropf, den der Körper der Mutter abzustoßen versucht. Aber dem Fötus wie dem Krebs gelingt es, das Immunsystem seines Wirts erfolgreich zu blockieren. Zwischen ihnen gibt es laut den Embryologinnen nur einen wesentlichen Unterschied: „Aus der befruchteten Eizelle entwickelt sich ein neuer Staat, mit dem Krebs bricht dagegen die Anarchie aus.“
In der Biologie hat man nie einen Unterschied zwischen Verpaarung und Vermehrung gemacht. Am ganzen mehr oder weniger subtilen Spiel der Anbahnung einer Beziehung (und darüberhinaus) interessiert die Naturwissenschaften bloß die materielle Seite: Fakten über die Anzahl der männlichen Spermien, mit denen die Befruchtung erfolgt, Fakten über die Zahl der Jungen, die dabei entstehen, Fakten über die unterschiedlichen Penis- und Hodenformen, Fakten über die Gene, die weitergegeben werden… Die meisten Fach- und Sachbücher über die Sexualität der Tiere gehen so weit, dass sie dem Spatz ebenso wie dem Löwen unterstellen, sie wollen partout, dass die Söhne und Töchter auch ganz sicher ihre eigenen sind. Dabei gibt es sogar unter den Menschen nicht wenige, ganze indigene Völker, die einen Zusammenhang zwischen Geschlechtsakt und Schwangerschaft nicht nur leugnen, sondern geradezu lächerlich finden. Aber die männlichen Tiere sollen es angeblich besser wissen. Deswegen tun sie alles, bis hin zur Ausbildung von Penissen mit denen sie vor dem Akt die eventuell schon vorhandenen Spermien in der Scheide ihrer „Partnerin“ gleichsam raussaugen können. Die US-Biologin Olivia Judson erklärt dazu in ihrem Buch „Die raffinierten Sexpraktiken der Tiere“: „Ein Männchen, das es schafft, seine Partnerin so zu stimulieren, dass sie mehr von seinen Spermien als von denen seiner Nebenbuhler aufnimmt, oder das die Spermien seiner Konkurrenten irgendwie beseitigen kann, gibt eine größere Anzahl seiner Gene weiter als seine weniger kunstfertigen Rivalen. Folglich ist die erste Konsequenz weiblicher Promiskuität, dass Männchen unter einem stärkeren Druck stehen, sich untereinander in allen Aspekten der Liebe auszustechen.“
Aber auch die weiblichen Tiere besitzen genügend Vererbungswissen, indem sie nämlich nur die Männchen mit den besten (gesündesten) Spermien „wählen“. Und das sind immer die Farbenprächtigsten, Lautesten, Stärksten, Schnellsten usw… Dabei geht es stets um ihren Nachwuchs, denn der ist z.B. für den Biologen Josef Reichholf „die eigentliche ‚Währung der Evolution‘.“ Ihre Anzahl ergibt zusammen mit der Zeit „die Leistung“. Die wilde Natur ist wie der Kapitalismus eine Leistungsgesellschaft. Wenn man dem Verhaltensforscher Konrad Lorenz folgt, dann ist es nicht nur im Nazistaat, sondern auch in der Gänsegesellschaft so, dass das „Ehepaaar“ das höchste Ansehen hat, das die meisten Jungen großzog.
Nehmen wir einen Moment an, dass all diese Projektionen nur allzu wahr sind („Gänse sind schließlich auch nur Menschen,“ wie Lorenz einmal sagte), dann gilt aber immer noch, was sich die Tiersexforscherin Olivia Judson eingesteht, dass bei all ihren „Fakten“ etwas Wesentliches fehlt: die Lust! Aber leider „wissen wir so gut wie gar nichts über die Evolution der Lust.“ Dazu gehört zuvörderst eine gewisse Verständigung, jedenfalls in den meisten Fällen. Aber wie soll man das z.B. bei den Elefanten erforschen, die sich über mehrere Kilometer im Infraschallbereich „verständigen“, was jedoch für uns nicht vernehmbar ist. Oder wenn doch – mit Hilfe von Audiotechnik, wie es Professor John Lilly bei den noch weiter reichenden Lautäußerungen von Delphinen tat, dann weiß man immer noch nicht, was sie damit sagen wollen. Stattdessen zu erforschen, wie eine Art sich vermehrt, führt jedoch bloß dazu, dass man „unterhalb der Schafarten nur noch die Schafe zählen kann“, wie der Philosoph Michel Foucault einmal meinte, für den die animalische Liebe ein Fest war, das ihn traurig und glücklich zugleich machte.
Um die „animalische Liebe“ studieren zu können, bedarf die „bisherige Nutzphysiologie“ (des Darwinismus) mithin einer „lustbiologischen Ergänzung“; eine solche veröffentlichte der ungarische Psychoanalytiker Sandor Ferenczi 1923. Darin ist von „Brückenbildungen des Küssens, des Umarmens“ und von der „großen Eintrocknungskatastrophe“ als Ur- und Geburtstrauma die Rede. Weswegen für ihn „nicht das Meer die Mutter symbolisiert, sondern die Mutter das Meer,“ schreibt der Kulturwissenschaftler Peter Berz in „Die Einzeller und die Lust. Bölsche, Freud, Ferenczi“ (2012). Das „Ziel“ (im Feuchten) war einmal die „Verschmelzung“, bei den Vielzellern, auf dem Trockenen zumal, gibt es nur noch eine „Distanzliebe“ – mit der „Haut als Vermittlerin“ (aus der einst auch die Sinnesorgane hervorgingen): Sie (Wir) kennen keinen „Mischakt“ mehr, sondern bloß einen „Berührungs-Akt“. Ferenczi konnte sich auf das 1000seitige Werk „Liebesleben in der Natur. Entwicklungsgeschichte der Liebe“ stützen. Diesen Biologie-Bestseller (den die FU kürzlich neu herausgab) veröffentlichte 1898 der „Naturalist“, Gründer des „Friedrichshagener Dichterkreises“ und der Berliner Volksbühne Wilhelm Bölsche. Er begann darin ganz von vorne: „Wir haben keine Ahnung davon, was eine einzellige Amöbe, was eine Bakterie empfinden, wenn sie sich in zwei Stücke teilen. Es ist ihr Liebesakt. Warum soll sie nicht etwas dabei fühlen? Es ist nach allen Analogien selbstverständlich. Zugleich ist es der Urakt aller Liebe. Die Wollust wäre hier bei ihrem Urphänomen.“ Man ahnt das nur, aber wirklich „gewußt wird die Sache ganz sicher innerhalb unserer Leiber.“
Gerhart Hauptmann, in dessen niederschlesischem Bergdorf Schreiberhau Wilhelm Bölsche zuletzt lebte, urteilte 1931 über die „Lebensleistung“ seines Nachbarn in einer Festrede zu dessen 70. Geburtstag: „Das Interesse für die Natur und für die Wissenschaft von der Natur ist, zumal in Deutschland, zu einem sehr erheblichen Teil allein durch dich geweckt, gefördert und lebendig erhalten worden.“ Wenigstens das Interesse an tierischem „Sex“. Bölsche war ein Propagandist des Darwinismus, die animalische Liebe bestand für ihn in der Verquickung von Lust und Fortpflanzung und damit Arterhaltung. Mindestens bei den Rindern soll das aber ganz anders sein, wie der französische Schriftsteller Mehdi Belhaj Kacem in seiner „Philosophie im Kuhstall“ (2012) nahelegt: „Die Brunst ist ein Genuss für das Weibchen, nicht für das Männchen. Das Weibchen scheint ganze Tage lang einen quasi natürlichen Genuss zu empfinden, beim Koitus selbst empfindet es jedoch keine Lust. Umgekehrt zeigt das Männchen in der Brunstzeit kein Begehren wie das Weibchen… Soweit ein guter Kleinbauer wie ich das beobachten konnte.“
.
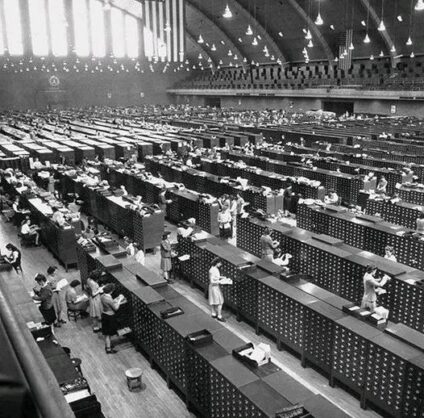
Datenbank des FBI für Fingerabdrücke 1944
.
Lügen
Arthur Schopenhauer fragte sich: „Woran sollte man sich von der endlosen Verstellung, Falschheit und Heimtücke der Menschen erholen, wenn die Hunde nicht wären, in deren ehrliches Gesicht man ohne Misstrauen schauen kann?“ Der Psychoanalytiker und Hundebesitzer Jeffrey Masson schrieb ein ganzes Buch, um zu beweisen: „Hunde lügen nicht“, die Psychologin Susanne Preusker kam dagegen in ihrem Ratgeberbuch „Wenn das Glück mit dem Schwanz wedelt“ zu dem Schluß: „Ein Hund versteht es, Dankbarkeit zu heucheln. In Wirklichkeit hält er alles, was Sie für ihn tun, für selbstverständlich, aber Sie werden sich wesentlich besser fühlen, wenn Sie an seine Dankbarkeit glauben.“ Auch Konrad Lorenz bemerkte bei seinen Hunden „Bully“ und „Stasi“, dass sie „geschickt lügen“ konnten.
Sind Wildtiere ehrlicher? Der Tierpsychologe Heini Hediger meint, sie seien die am wenigsten „beeinflußtesten“ und deswegen „die Norm für alle Beurteilung tierlichen Verhaltens.“ In diesem Sinn behauptet auch der US-Autor Mark Rowlands in seinem autobiographischen Buch „Der Philosoph und der Wolf“ (2009): „Wölfe sind nicht in der Lage zu lügen”. Er ist sich mit dem Primatenforscher Volker Sommer einig: „Erst die Menschenaffen und die Menschen haben die Fähigkeit zu lügen“ – und die Hunde passen sich den letzteren bloß an. In der Reihe der allegorischen Darstellungen steht allerdings die Katze – im Moabiter Gericht z.B. – für die Lüge. Die Erbauer konnten sich dabei auf das „Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens“ berufen.
Der Verhaltensforscher Kurt Kotrschal erwähnt in seiner „sozioökonomischen Bestandsaufnahme ‚Faktor Hund'“ (2004) einen, der mit seinem Herrn gewissermaßen mitlog: „Checker“ – der Hund des US-Präsidenten Nixon: Er half ihm, vor laufender Kamera seine Watergate-Lüge mit treuherzigem Gesichtsausdruck Glaubwürdigkeit zu verleihen. Laut den „Simpsons“ kam „Checker“ dafür in die „Hundehölle“.
Der Haushund steckt in seiner Abhängigkeit vom Menschen in einem Dilemma, das ähnlich auch für Kinder gilt: Einerseits legen die Eltern ihnen ein striktes Lügenverbot auf, andererseits werden sie genötigt, sich artig bei der lieben Tante für das uninteressante Geschenk zu bedanken. „Ob man nun lügt oder nicht – so oder so droht Ärger,“ schreibt die FAZ in ihrer Rezension des Buches „Lügen lesen“ der Kantianerin Bettina Stangneth.
Bei Wildtieren ist das Dilemma eher wie bei erwachsenen Menschen gelagert: Wenn sie nicht lügen, gehen sie unter Umständen leer aus und umgekehrt erreichen sie mitunter nur mit Lügen das von ihnen Begehrte. So wurde z.B. ein junger Pavian dabei von dem schottischen Zoologen Richard Byrne beobachtet, wie er sich einem Weibchen näherte, die gerade eine begehrte Knolle freilegte. Dort fing er jämmerlich an zu schreien, so dass seine Mutter herbeilief und das arglose Weibchen angriff, woraufhin ihr Sohn sich in Ruhe über die Knolle hermachte. Diesen Trick wiederholte er in einer ähnlichen Situation: „Zielgerichtet missbrauchte er den Hilferuf,“ schreibt die SZ, die als ein weiteres Beispiel einen Schimpansen namens Yeroen erwähnt, der im Zoo von Arnhem lebte: „Nach einem verlorenen Kampf gegen das neue Alphamännchen humpelte der abgesetzte, offenbar schwerverletzte Chef davon. Kaum war er allerdings aus dem Blickfeld des Siegers verschwunden, konnte Yeroen wieder völlig normal gehen.“
„Die Welt“ erwähnt den dänischen Verhaltsforscher Anders Møller: „Er hat beobachtet, wie Schwalbenmännchen ihre Bräute von Seitensprüngen abhalten: Finden sie bei der Rückkehr zum Nest ihr Weibchen nicht vor, stoßen sie Warnrufe aus. Das Weibchen wähnt das Nest in Gefahr und eilt herbei. Sobald alle Eier gelegt sind, spart sich der Eifersüchtige den falschen Alarm: Denn während der Brutzeit ist die werdende Vogelmutter nicht mehr in Paarungsstimmung.“
Eine andere Form der Täuschung ist das Sich-Totstellen. Am weitesten geht dabei laut „N24“ die Antillen-Boa: „Bei Gefahr verkrümmt sie sich, verfärbt ihre Augen zu einem leblosen Rosa, sondert ein Sekret ab, das nach Verwesung stinkt, und lässt sogar ein paar Tropfen Blut aus ihren Mundwinkeln rinnen. Sobald sich der Angreifer abwendet, schlängelt sich die Untote davon. Stellt sich hingegen ein Fuchs tot, hat er Hunger. Bereits in Tierbüchern des 12. Jahrhunderts steht, er gebärde sich als sein eigener Leichnam, um aasfressende Krähen anzulocken.“
Viele Tiere täuschen, indem sie sich nicht nur im Verhalten, sondern auch optisch einer anderen Art annähern. Bekannt sind die harmlosen Schwebfliegen, die das Aussehen von Wespen angenommen haben, um gefährlicher auszusehen als sie sind. Mit einer solchen „Mimikry“ versuchen auch harmlose Schmetterlinge und Schlangen ihren Freßfeinden zu entkommen, indem sie das Aussehen von giftigen angenommen haben: Sie mimen es quasi, dazu gehört Rousseaus Beitrag in der Enzyklopadie über das Theater, das er verbieten wollte, denn die Schauspielerei erziehe zur Lüge.
Dazu sind auch Pflanzen in der Lage, Orchideen zählt man z.B. zu den „Täuschblumen“, weil sie für ihre Befruchtung zwar Insekten durch Form, Farbe und Geruch anlocken, aber gar keinen Nektar in ihren Blüten für sie produzieren. Sie setzen allen Ehrgeiz darauf, „ihrem“ Insekt zu gefallen.
Die chilenische Kletterpflanze Boquila ist in der Lage, die Blätter von bis zu drei verschiedenen Bäumen nachzuahmen, um sich vor Fressfeinden – vor allem Schnecken und Käfer – zu schützen. Das „journal ‚pflanzenforschung.de’“ schreibt, dass „die Kletterpflanze die Blätter der Bäume, um die sie sich rankt, in punkto Farbe und Form, Stiellänge und Blattgröße sowie bezüglich der Blattdicke und Ausrichtung imitiert. Mitunter bildet sich sogar ein kleiner Blattstachel an der Blattspitze, wenn dies auch beim Wirt der Fall ist.“
Anders die Pflanzen der südafrikanischen Gattung Lithops: Sie sehen Steinen zum Verwechseln ähnlich (und zwar verschiedenen Steinen, je nachdem, wo sie wachsen), um Pflanzenfresser zu täuschen. Man nennt sie deswegen „lebende Steine“. Wie machen sie das? Die uns immer nur mit den zufällig mutierenden „Genen“ langweilenden Darwinisten müssen sich in solchen Fällen den verhassten Lamarckisten annähern, indem sie diesen Pflanzen laut Wikipedia „einen hohen Grad von phänotypischer Plastizität“ attestieren: „Je stärker der Einfluss von Umweltfaktoren auf den Phänotyp ist, desto höher auch die phänotypische Plastizität.“ Soll heißen, dass die Boquilas und Lithops im Gegensatz zu fast allen anderen Pflanzen, die sich weitgehend gleich bleiben, einem besonders starken Umweltdruck ausgesetzt sind – was eine allzu durchsichtige Erklärung ist – die bloß vortäuscht, etwas zu erklären. Man sagt, dass ein „gezieltes Täuschungsmanöver“ Bewußtsein voraussetzt. Könnte es sein, dass in der Botanik mehr davon vorhanden ist als bei den Botanikern?
In Kurt Mündls TV-Dokumentation „Über Lebenskünstler der Natur – Täuschen und Tarnen“ ist dies „zum Erfolgsprinzip geworden“.
.

Arbeiter einer südafrikanischen Diamantenmine werden täglich nach ihrer Schicht geröntgt, um Diamantendiebstähle durch Verschlucken zu entdecken.
.
Lamarckismus
Der Soziologe Roger Caillois erwähnt es in seinem Buch „Der Krake“ (1986): „Dieses Hirntier, um nicht zu sagen, dieser Intellektuelle, beobachtet immerzu, während er agiert. Diese Besonderheit, die offenbar sein innerstes Wesen zum Ausdruck bringt, läßt sich sogar bei Hokusais wollüstigen Kraken feststellen: Er beugt sich über den Körper der nackten Perlentaucherin, die er in Ekstase versetzt, und läßt sie nicht aus den Augen, als verschaffe es ihm zusätzlichen Genuß, ihre Lust zu beobachten.“ Das Bild gehört zu Hokusais anonym erschienenen erotischen Album und hat den Titel „Perlentaucherin mit zwei Tintenfischen“. In Japan gelten die Kraken nicht wie bei uns als besonders fremdartig und bedrohlich, sondern als geselligkeitsliebend und sinnenfreudig.
.
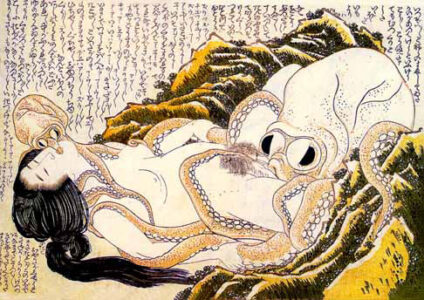
.
Über die japanischen Perlentaucherinnen, Ama genannt, gibt es nicht nur viele Bilder, Fotos und Youtube-Clips, sondern auch jede Menge ernsthafte Berichte. Erwähnt sei hier nur ein längerer Artikel der Wiener Japanologin Ruth Linhart: „Die Ama von Katada“ (http://ruthlinhart.com/japan_23.htm). Dazu schreibt die Autorin:
„Im ersten Teil gebe ich Interviews mit drei Taucherinnen wieder. Sie sollen Lebensläufe von Ama und Arbeitsbedingungen des Ama-Berufes authentisch veranschaulichen. Sodann werden die drei persönlichen Schicksale in einem deskriptiven Teil in den breiteren Rahmen der Dorfstruktur von Katada und der Ama-Gemeinschaft eingebettet. Schließlich folgt die Fragestellung: Entspricht das Bild der Ama, wie es durch Tourismus, bildliche und schriftliche Darstellungen gefiltert wird, der Wirklichkeit?
Ist „die Ama“ jenes Fischermädchen, jene schöne Nixe, die Fosco Maraini (1963) vor 20 Jahren auf der Insel Hekurajima filmte? Ist sie wirklich eine „Amazone“, wie die Taucherinnen von Braw und Gunnarson (1982) genannt werden? Genießen die Taucherinnen von Katada tatsächlich Verfügungsgewalt über die Produktion, wie es lwata Junichi (1971) wohlmeinend behauptet? Paßt die wahre Existenz der Ama mit der Klischeevorstellung von kakâdenka – Frauenherrschaft zusammen, die ihre Erwähnung immer wieder heraufbeschwört?
Nach Wochen Beobachtung aus nächster Nähe – ich wohnte in einer von einer Ama geführten Privatpension an einem der Tauch-Strände von Katada -, nach Gesprächen und Interviews [1978 und 1983], scheint es jedenfalls klar, daß die Ama und ihr Leben sich von romantisierenden Vorstellungen, wie sie bei japanischen Stadtbewohnern und im Westen verankert sind, unterscheiden, daß aber die Stellung der Ama im Dorf und in der Familie nicht in dem Maß von jener der städtischen Japanerin differiert, wie es die allgemeine Vorstellung erwartet. Herrschaft impliziert nämlich Entscheidungsgewalt und Machtausübung. Herrschaft ist ‚institutionalisierte Machtausübung, die zur Differenzierung einer Gesellschaft in Herrschende und Beherrschte führt‘ (König 1962). Die Attribute dieser Macht sind Überlegenheit und Einfluß, Führung und Gehorsam, Überordnung und Unterordnung, Prestige und Autorität. Die im folgenden geschilderten Tatsachen von Katada zeigen, warum die Taucherinnen in diese Definition nicht hineinpassen, Herrschaft scheint in Katada noch immer oder auch wieder Herr-schaft zu sein.“
2002 erschien in Tokyo ein Photoband über die Ama-San von Yoshiyuki Iwase: „Bildnisse von Taucherinnen in Onjuku, Präfektur Chiba 1931-1964“
2011 veröffentlichte die Photographin Ninay Poppe ebenfalls einen Photoband über die „Ama“. Ein Rezensent schrieb: „Ihre Bilder erzählen die Geschichte von japanischen Perlentaucherinnen. Diese Frauen verdienen ihr Geld damit, dass sie nach Seeohren tauchen, schleimige Seeschnecken, in denen sich Perlen bilden. Das Tauchen danach ist eine japanische Tradition und schon über zwei Jahrtausende alt. Auch heute noch tauchen die Ama auf die alte Art und Weise: Ohne Ausrüstung verlassen sie sich nur auf die Kraft ihrer Lungen. Die Japaner halten daran fest, dass die Mehrheit der Ama weiblich sein sollten, weil ihre Körper sich von den männlichen unterscheiden: Das Fett an einem Frauenkörper ist anders verteilt als bei bei einem Mann, was sie im kalten Wasser länger warm hält. Doch mittlerweile ist diese Praxis fast ausgestorben, denn die meisten dieser Frauen sind um die 60 Jahre alt, einige sogar über 80.“ Die Ama tauchen an einem Seil runter – bis zu 60 mal in der Stunde.
Ähnlich die südkoreanischen „Haenyeo“ auf der Insel Jeju-do, die allerdings nicht primär hinter Perlen her sind als vielmehr nach schmackhaften Meeresfrüchten. Man nennt sie auch in Korea „Meerfrauen“. Ihre Ausrüstung besteht seit den Siebzigerjahren aus einer Taucherbrille, Schwimmflossen, einem Neoprenanzug, einem Bleigurt, einer Harke zum Lösen der Meerestiere von Felsen, einem Netz zum Einsammeln des Fangs und einem Seil mit Boje, um ihren Standort zu markieren. Sie tauchen bis zu 20 Meter tief und können bis zu drei Minuten unter Wasser bleiben. Zwischendurch wärmen sie sich an Feuern, die sie in windgeschützten Höhlen am Meer entzünden und essen Muscheln. „Meist hört man die Haenyeo schon, bevor man sie sieht. Denn beim Auftauchen stoßen sie den Sumbisori aus, einen lauten Pfeifton, der durch das Auspusten der Luft verursacht wird,“ heißt es in einer Reportage der „Welt“.
Sie haben laut Wikipedia ein erweitertes Lungenvolumen und wie Wedellrobben nutzen sie die Milz als Sauerstoffreservoir. Beim Tauchen zieht sich das Organ zusammen, wodurch sauerstoffreiche rote Blutkörperchen in den Kreislauf gelangen und so einen längeren Tauchgang ermöglichen.
Die Zeitschrift „Nature“ berichtet in ihrem Newsletter: „Die Tradition des Tauchens auf der südkoreanischen Insel Jeju könnte das Erbgut aller Inselbewohner beeinflusst haben. Die Haenyeo – was so viel wie „Frauen des Meeres“ bedeutet – tauchen seit Jahrhunderten das ganze Jahr über in kaltem Wasser und ohne Atemgerät. Eine genetische Analyse ergab, dass Genvarianten, die mit vermindertem Blutdruck, Kaltwassertoleranz und der Anzahl der roten Blutkörperchen – die mit der Sauerstofftransportkapazität zusammenhängt – in Verbindung stehen, bei Menschen aus Jeju, unabhängig davon, ob sie selbst tauchen, häufiger vorkommen als bei anderen Südkoreanern.“ Wenn das nicht Lamarck Recht gibt, der davon ausging, dass die Umwelt die Körper beeinflusst…
Es gibt heute laut Auskunft der Haenyeo-Genossenschaft noch etwa 5000 Taucherinnen, ihr Altersdurchschnitt liegt bei weit über 50. Auch bei ihnen werden die Fangquoten wie in Japan inzwischen streng kontrolliert. Sie sammeln neben Muscheln, Schnecken, Seegurken und Seeigel auch noch Algen, die sie trocknen und verkaufen. Ihre Insel gilt als matriachalisch organisiert.
Auch über die koreanischen Muscheltaucherinnen – Haenyeos – gibt es eine Vielzahl von wissenschaftlichen und journalistischen Veröffentlichungen – die meisten auf Koreanisch. Auf Youtube findet man aber fast 2000 Clips unter dem Stichwort „Haenyeo“, u.a. eine schöne vierteilige Über- und Unterwasser-Dokumentation von Melissa Struben: „Haenjeo – Koreas Meerjungfrauen“.
.
Warn- und Tarntrachten
Viele Völker in Amazonien und Papua-Neuguinea kennen im Krieg und auf der Jagd Warn- und Tarntrachten, je nachdem. Bei den Bayern dient u.U. ein und die selbe Tracht diesen Zwecken. Sie können jedoch auch darauf verzichten – im Gegensatz zu den Tieren und Pflanzen, die sich ihrer Warn- und Tarntrachten nicht so einfach entledigen können. Weswegen diese auch nicht der Kulturgeschichte, sondern der natürlichen Auslese geschuldet sein sollen, also evolutionär, d.h. mutativ entstanden sind und dann der Selektion im Hinblick auf nützlich oder schädlich unterworfen wurden.
Das hat vor allem in der angloamerikanischen Forschung zu einer Unzahl von genetischen Erklärungsversuchen geführt, während an der französischen Forschung eher die kulturalistischen bzw. spekulativ-philosophischen Ansätze interessieren. Hier steht immer noch Lamarck gegen Darwin. Die einen wie die anderen haben sich dabei meist auf Insekten konzentriert (die z.B. Blätter nachahmen), wobei die französischen Mimikry-Mimese-Forscher gerne vom „Nutzen“ absehen. Der südfranzösische Insektenforscher und Nobelpreisträger Jean-Henri Fabre lehnte gleich alle „Mimikry/Mimese-Theorien ab, er sprach jedoch auch von von einer „Insektenästhetik“, weil er glaubte „zumindest bei der Lehmwespe die Neigung zu erkennen, ihr Werk zu verschönern“- mit glitzernden Steinchen und ausgebleichten Schneckenhäusern.
Was ist aber z.B. mit einer im Kongo lebenden Riesenkröte, die das Aussehen des Kopfes der Östlichen Gabunviper nachahmt? Sicher, sie sieht in ästhetischer Hinsicht auch beeindruckend aus, aber der Verdacht liegt doch nahe, dass sie damit vor allem ihre Freßfeinde warnen (abschrecken) will. Steckt also ein Wille hinter der Anverwandlung eines harmlosen Tieres oder auch einer Pflanze in eine giftige Art? Zuende gedacht würde das auf „Die Abschaffung der Arten“ hinauslaufen, wie der Science-Fiction-Autor Dietmar Dath 2014 sein Buch über die zukünftigen Lebewesen genannt hat, die „aus der Evolution das schlechthin Willentliche gemacht haben“. Dies ähnelt Walter Benjamins Mimese-Definition als „Fähigkeit, Ähnlichkeiten zu produzieren“.
Die Biologen tun sich nach wie vor schwerer, hinter der Mimese/Mimikry von Tieren und Pflanzen einen Willen zu vermuten, denn diese können ihre Tracht ja nicht wie die Bayern einfach wechseln, sehen wir von Chamäleon und Krake ab. Es braucht dazu wohl eine lange generationenübergreifende Entwicklung. Wenn z.B. Passionsblumen-Arten Eier auf ihren Blättern imitieren, um laut Wikipedia „eiablagebereite Schmetterlinge der Gattung Heliconius abzuwehren“.
Oder wenn z.B. bei der Orchideenart Fliegen-Ragwurz die Blüten in Form, Farbe und Geruch derart einer weiblichen Grabwespe ähneln, dass die Männchen sich mit ihnen verpaaren wollen und dabei zwei Pollenpakete auf die Stirn geklebt bekommen, die sie dann bei ihrem nächsten Paarungsversuch an der Narbe der Blüte einer anderen Fliegen-Ragwurzart abstreifen. Laut der Biologin des Berliner Botanischen Gartens, Birgit Nordt, geht die Täuschung teilweise soweit, „dass Bienenmännchen der Gattung Andrena die entsprechenden Ragwurz-Blüten sogar einem Weibchen vorziehen. Verhaltensforscher nennen das eine überoptimale Attrappe.“
Ist hier die Nachahmung vielleicht zu weit gegangen? Die französischen Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari haben desungeachtet ein ganzes postmodernes Beziehungs- und Organisationsmodell daraus gemacht. Statt von Evolution sprechen sie vom Werden und raten uns: „Werdet wie die Orchidee und die Wespe!“ Sie übertrugen dabei die biologische Mimikry auf die soziale, was der französische Kriminologe und Soziologe Gabriel Tarde bereits 1890 in seinem berühmten Werk „Die Gesetze der Nachahmung“ vorwegnahm. Unter den Begriffen Nachahmung und Erfindung verstand Tarde „jede beliebige Neuerung oder Verbesserung in jeglicher Art von sozialen Phänomenen wie Sprache, Religion, Politik, Recht, Industrie oder Kunst“. Wikipedia weist ferner daraufhin, dass sich heute auch Bruno Latour und Peter Sloterdijk auf Tardes Imitationstheorie beziehen. Dass eine Gesellschaft fast auf Nachahmung basieren soll, hat in den USA eine lange, teils wütende Diskussion über Mimikry ausgelöst, bis diese schließlich wieder auf Naturvorgänge eingegrenzt wurde – die nun in der „Bionik“ erforscht werden, um sie technisch nachzuahmen im Sinne einer Erfindung.
Zurück zur Natur: Der Wiener Amphibienforscher Paul Kammerer setzte z.B. Salamander auf Untergründe, vor denen sie grell abstachen. Es gelang diesen Tieren nicht nur, ihre Tarn- und Warntracht gewissermaßen umzufärben, indem sie die Farbe des Sandes, auf dem sie leben mußten, annahmen. Sie vererbten ihre, der neuen Umgebung angepasste Färbung auch ihren Nachkommen. Sein Experiment war insofern lamarckistisch als es ihm um die Vererbung erworbener Eigenschaften ging.
Noch komplizierter ist die Anverwandlung im Falle von Falschen Putzerfischen. Die Echten Putzerfische fressen anderen großen und kleinen Fischen die Parasiten weg – im Maul, zwischen den Kiemen und Schuppen. Wie beim Friseur warten ihre Kunden geduldig, bis diese Putzerfische (Aspidontus taeniatus) sie bedienen. Den Wartenden nähert sich der Falsche Putzerfisch (Labroides dimidiatus), der die Echten in Gestalt, Färbung und Schwimmweise imitiert, um an den ihre Parasitenbeseitigung erwartenden Fischen Flossen- und Hautstücke herauszubeißen. In seinem Buch „Mimikry. Nachahmung und Täuschung in der Natur“ (1971) hat der Zoologe Wolfgang Wickler diesen Falschen Putzerfisch, der als Parasit nur so tut als wäre er ein Parasitenvernichter näher erforscht, wobei er die Begriffe „Signalsender“ und „-Empfänger“ benutzte.
Dieser Parasit ist natürlich, wie andere Parasiten auch, nicht immer erfolgreich, denn ihre Wirte und Zwischenwirte sowie die in diesem Fall Imitierten sind auch nicht auf den Kopf gefallen, wenn man so sagen darf, und lassen sich laufend neue Gegenstrategien einfallen – es ist die reinste Waffenproliferation. „Genug, man muß die These wagen, daß überall, wo Wirkungen anerkannt werden, Wille auf Willen wirkt,“ wie Nietzsche meinte. Viele Gehirnforscher gehen heute vom schieren Gegenteil aus: dass es selbst beim Menschen keine „Willensfreiheit“ (und damit auch keine „Schuldfähigkeit“) gibt, weil wir genetisch, hormonal und enzymatisch sozusagen ferngesteuert sind. Das ist Biologie minus Leben.
Aber man muß den (freien) Willen gar nicht unbedingt rehabiltieren, man kann auch die These wagen: Was wir Menschen an Warn-, Tarn- oder auch Locktrachten an- und ausziehen (Maßanzüge, Camouflage-Jacken, Pelzmäntel, Reizwäsche), über die wir uns vorab Gedanken machen (durchaus im Vollzug einer Nachahmung), können Tiere und Pflanzen körperlich denken. So wie wir z.B. eine Angel mit speziellen Blinkern als Köder für bestimmte Fischarten „erfanden“, haben Anglerfische am Kopf Angeln mit angehängten Leuchtködern „entwickelt“.
.
Orchideen
Manche Blume, so schrieb der Philosoph Theodor Lessing, könnte man „als ein festgebanntes Insekt“ bezeichnen – und andersherum „viele Insekten, zumal die Bienen und Schmetterlinge, als frei bewegliche Blumen“. Die meisten Orchideen, von denen weltweit etwa 25.000 Arten bekannt sind, sehen wirklich wie „festgebannte Insekten“ aus – und wer weiß, vielleicht wird man sie irgendwann auch als solche neu bestimmen. Ganz sicher weiß man jetzt schon, dass diese „Königin der Blumen“ die komplizierteste Existenzform unter den „bedecktsamigen Blütenpflanzen“ entwickelt hat, obwohl oder weil sie angeblich in evolutionärer Hinsicht die jüngste „Familie“ bildet. Fangen wir unten an – im Boden oder (epiphytisch siedelnd) auf Bäumen: Dort braucht sie einen Pilz, damit der Keim überhaupt aufgeht. Man kann die Nährstoffe, die ihm der Symbiosepilz zuführt, künstlich herstellen, das machen die Orchideenzüchter auch, weswegen es bereits über 100.000 Neuzüchtungen (Hybride) gibt, sie werden bei der „Royal Horticultural Society“ registriert und dort gelegentlich auch in ihrem botanischen Namen als besonders ausgezeichnet – „geadelt“. Es gibt aber auch heute noch tropische Orchideen, wild lebend, für die reiche Liebhaber mehr zahlen, „als heute ein Luxusauto kostet“ wie es im Ratgeber „Orchideen“ des Züchters Jörn Pinske heißt. Dabei geht es „nur“ um ihre seltsame Schönheit und manchmal auch um ihren Duft. Einige Arten enthalten daneben noch „psychoaktive Inhaltsstoffe“, aber ansonsten ist sie keine „Nutzpflanze“, abgesehen von der Vanille.
Die Mehrzahl der Orchideen-Liebhaber sind Männer. Der Pflanzenname leitet sich vom griechischen Wort „orchis“ her, was „Hoden“ heißt. Damit waren anfänglich die Knollen verschiedener Erdorchideen gemeint. Wegen dieser Speicherknollen, die bei Wildschweinen begehrt sind, gehört das „Männliche Knabenkraut“ zu einer besonders gefährdeten Art. Orchideen sind zweigeschlechtlich. In der Blüte hat sie (männliche) Staubblätter und eine (weibliche) Narbe, die zu einem „Säulchen“ (Gynosterium) verwachsen sind. Die Pflanze bestäubt sich nicht selbst damit, sondern braucht ein Insekt, dass ihren Pollen zu einer anderen bringt und ihr gleichzeitig fremden Pollen an die Narbe trägt.
„Daß Hummeln, Bienen, Tagfalter, also Insekten, irgendetwas mit den Blumen haben, wußte man schon seit der Antike. Auch daß sie sich irgendwie von ihnen ernähren. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts wußte man auch, daß Blumen ein Geschlecht haben. Linné baute sein ganzes System der Pflanzen darauf auf,“ schreibt der Kulturwissenschaftler Peter Berz. Aber im Sommer 1787 entdeckte der Direktor der Spandauer Realschule Christian Konrad Sprengel auf einer Blumenwiese zwischen dem Wunder ihres Aussehens und den um sie herumschwirrenden Insekten eine völlig neue Beziehung.“
Sprengel findet, daß jedes kleinste Detail jeder Blume es nur auf Das Eine abgesehen hat: Insekten anzulocken, sie hinzuführen, hinzuweisen auf die in ihr verborgenen Schätze – Saft oder Nektar – also den „in der Luft herumschwärmenden Insekten als Saftbehältnisse schon von weitem ins Auge zu fallen“. Und „indem die (so angelockten) Insekten in den Blumen ihrer Nahrung nachgehen“ tun sie etwas ganz anderes: „Zugleich,“ schreibt Sprengel, „ohne es wollen und zu wissen“ befruchten sie die Blumen. Es wird dabei getäuscht und getrickst: viele der spektakulärsten Orchideen haben gar keinen Nektar. Sprengel: „Ich muß gestehen, daß diese Entdeckung mir keineswegs angenehm war.“ Denn: stimmt dann noch die Grundthese?
Die Blüten der Sexualtäusch-Orchidee „Ophrys insectifera“ (Fliegen-Ragwurz) haben nicht nur die Form und Farben einer potentiellen Partnerin für Grabwespen-Männchen angenommen, sondern auch noch den weiblichen Sexuallockstoff. Bei seinen Kopulationsversuchen bekommt das Männchen zwei Pollenpakete auf die Stirn geklebt. „Dolchwespen fallen gerne auf Blüten der mediterranen Orchidee Ophrys speculum (Spiegel-Ragwurz) herein. Teilweise geht die Täuschung so weit, dass Bienenmännchen der Gattung Andrena die entsprechenden Ophrys-Blüten sogar einem Weibchen vorziehen. Verhaltensforscher nennen das eine überoptimale Atrappe,“ schreibt die Biologin des Berliner Botanischen Gartens Birgit Nordt.
Peter Berz fragte sich darob: „Duft als Belohnung. Wie geht das? Nur als Droge, Rausch. Fast zu schön, um wahr zu sein. Die unmittelbare Reaktion der männlichen Bienen auf die Flüssigkeit kann man nur als Rausch bezeichnen. Sie verlieren in erheblichem Maße die Kontrolle über ihre Bewegungen und werden unbeholfen und träge und unaufmerksam. Offenbar genießen sie ihre Empfindungen, denn sie kommen über lange Zeit immer wieder zurück.“
Einige südamerikanische Orchideen, die mit „Prachtbienen“ kooperieren, bieten den Prachtbienenmännchen sogar einen Duft an, der nicht ihnen direkt gilt. Sie nehmen ihn laut dem Biologen Karl Weiß „in ansehnlichen Flakons an den Hinterbeinen“ auf und fliegen damit zu ihren „Balzplätzen“, wo sie „Präsentationsflüge“ unternehmen. „Dabei soll ihr farbenprächtiger Panzer zusammen mit dem betörenden Pflanzenduft die Weibchen anlocken.“
Besonders raffiniert ist die Duftproduktion bei der Germerblättrigen Stenderwurz, die im Jenaer Max-Planck-Institut für chemische Ökologie erforscht wurde: Um Schwebfliegen zur Bestäubung anzulocken, verströmt diese Orchidee einen Botenstoff, mit dem sich Blattläuse alarmieren, er lockt aber auch Schwebfliegenweibchen an, die ihre Eier bei Blattläusen ablegen, weil sich ihre Larven dann von ihnen ernähren. In der Orchideenblüte täuschen darüberhinaus „warzenartige Gebilde“ die Anwesenheit von Blattläusen vor. Es gibt dort aber gar keine, so dass die Larven der Schwebfliegen keine Nahrung finden und sterben. Der Biologe Johannes Stökl erwähnt zwei weitere Orchideenarten, die „stechende Insekten“ durch Vortäuschen von Schmetterlingsraupen in ihren Blüten zu deren Befruchtung verlocken.
Botaniker der Universität Wien erforschten auf Madagaskar Orchideenarten, die einen Geruch von faulem Fleisch verbreiten – um damit Aasfliegen anzulocken. Ihre Samen sind winzig klein und breiten sich wie eine Staubwolke aus, in jedem steckt ein Embryo. Es gibt daneben Orchideenarten, die bis zu zwölf Embryos in ein Samenkorn packen.
Über eine weitere auf Madagaskar vorkommende Art, die einen 30 Zentimeter langen Dorn in ihrer Blüte ausgebildet hat, an dessen Ende sich Nektar befindet, hat Darwin gemeint, man werde dort bestimmt auch einen Schmetterling finden, der einen genauso langen Saugrüssel hat. 1903 entdeckte man ihn tatsächlich.
Die Biogeochemiker der Universität Bayreuth haben bei einer Reihe südafrikanischer Orchideen herausgefunden: Wenn unterschiedliche Arten in enger Nachbarschaft leben und von den selben Insekten (Wespen z.B.) bestäubt werden, „platzieren sie ihre Pollen an unterschiedliche Stellen – z.B. auf verschiedenen Abschnitten ihrer Vorderbeine.“
Die Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari gehen von einer wechselseitigen Beeinflussung aus, die eine Angleichung von Pflanze und Tier hervorgebracht hat. Ein solcher Vorgang – „Werden“ von ihnen genannt – gehört „immer einer anderen Ordnung als der der Abstammung an. Werden kommt durch Bündnisse zustande. Es besteht gewiß nicht darin, etwas nachzuahmen oder sich mit etwas zu identifizieren; es ist auch kein Regredieren-Progredieren mehr; es bedeutet nicht mehr, zu korrespondieren oder korrespondierende Beziehungen herzustellen; und es bedeutet auch nicht mehr, zu produzieren, eine Abstammung zu produzieren oder durch Abstammung zu produzieren…Das Werden ist eine Vermehrung, die durch Ansteckung geschieht.“ Affizieren und Affiziert-werden. „Werdet wie die Orchidee und die Wespe!“ raten sie.
Nach Meinung einiger Orchideenforscher ist bei diesem Angleichungsprozeß die Pflanze die treibende Kraft. Sie wollen festgestellt haben, dass eine Orchidee, die außerhalb des Vorkommens „ihrer“ Insekten „Fuß gefaßt“ hat, sich in Form und Farbe an eine neue Art angleicht. (*)
Im übrigen kennen die Orchideen auch eine vegetative Fortpflanzung (durch Ableger z.B.), weswegen G. W. F. Hegel in seiner Vorlesung „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse“ (1830) die geschlechtliche Fortpflanzung für einen reinen „Luxus“ hielt. Sie wird dafür mit umso mehr Liebe betrieben. Wenn z.B. die mikroskopischen Samen einer asiatischen Orchideenart durch den Wind an eine Baumrinde geweht wurden, entrollen sie „spiralige Ankerfäden“, um sich festzuklammern und in Kontakt mit einem Symbiosepilz zu kommen. Ist keiner da, muß der Keim sterben, schreiben die Mitarbeiter des Berliner Botanischen Museums in ihrem Band über „die skurrile Welt der Orchideensamen“.
Als ich unlängst im Orchideengewächshaus des Kassler „Bergparks Wilhelmhöhe“ war, konnte ich es nicht fassen: Es werden dort fast nur Orchideen gehalten, die der menschlichen Vagina in Form und oft auch in Farbe glichen. Ich erfuhr dort: Die Schamlippe heißt bei den Orchideen ebenfalls „Lippe“ (Labellum), es ist ein zur Lippe geformtes Blütenblatt, das den Insekten eine Landefläche bietet, und die Klitoris ist bei den Orchideen das vorstehende „Säulchen“. Hinzu kommt bei manchen Orchideenarten ein Sexualtäuschduft, der auch auf Menschen, mindestens Männer, wirkt, die Orchidee „Vanille“ kommt dem bereits nahe. Einige Orchideenblüten ähneln der Vagina auch deswegen, weil sie „Haare“ drumherum haben. Kurzum: „Die Sexualorgane der Orchideen sind einzigartig,“ wie die überwiegend männlichen Autoren der „Kosmos-Enzyklopädie Orchideen“ schwärmen. „Wir könnten eine Geistesgeschichte der letzten Jahrhunderte schreiben, indem wir eine Orchideenblüte schildern,“ meinte schon der Basler Biologe Adolf Portmann in seinem Radiovortrag „Insekten und Blumen“ (1942). Gleiches ließe sich auch wohl über die menschliche Vagina (vulgo: Vulva) sagen.
Soll man noch erwähnen, dass ein katholisches Forschungsteam der Botanikerin Marta Kolanowska von der Universität Danzig im Kolumbianischen Urwald eine winzige Orchideenart entdeckte, die statt einer Klitoris ein weinrotes Teufelsgesicht in ihrer Blüte ausgebildet hat? Sie wurde „Telipogon diabolicus“ genannt. Und dann gibt es auch noch die „Orchis italica“, deren Lippe zu einem weißen Männchen mit großem Penis geformt ist. Wer damit wohl angelockt werden soll?
Seit über dem Botanischen Garten nicht mehr das Damoklesschwert der
Schließung hängt, erschließt er sich ständig neue Finanzhebel: Mit (schrecklichen) Exotischen Nächten im Dschungelgewächshaus, mit „Das Dschungelbuch“-Inszenierungen, Hochzeitsfeiern, Halloween, „Christmas Garden“, Kakteentage, eigenem Geschenke-Shop…and more. Aber auch mit der Einbeziehung von immer mehr Hobbygärtnern – z.B. als Anbieter von Stauden, Kakteen und fleischfressenden Pflanzen mit eigenem Verkaufsstand. Schon befürchtet mancher Jahreskartenbesitzer, dass aus dem Garten ein Spektakel wird, ein lauter Verkaufsrummel zwischen den stillen Gewächsen – mit einigen Nebeneinnahmen drumherum.
Kürzlich zeigte man eine „Orchideen-Show“: „Wir lieben Orchideen. Sie auch? Dann sprechen Sie uns an“. Die Züchter und Sprecher der Deutschen sowie auch der Polnischen Orchideen Gesellschaft und der Fachgesellschaft Andere Sukkulanten in der Deutschen Kakteen Gesellschaft ließen sich viel Zeit, um mir das schwierige Geschäft mit diesen komplizierten Pflanzen zu erklären, inzwischen gäbe es ganze „Orchideen-Industrien“, die die Super- und Baumärkte beliefern. Mannimmt ein bestimmtes Teil eines Orchideenstengels und macht daraus Millionen Zellen, aus denen neue Pflanzen gezogen werden.
Hybridsorten züchtet man, indem die Pollen einer Art auf den Stempel einer anderen übertragen werden. Damit gerade das nicht passiert, haben die frei lebenden Orchideen sich so weit auf die Vorlieben eines von ihnen gewählten Bestäubungsinsekts angepaßt, dass dieses, oft auch ohne Nektar dafür zu bekommen, „blütentreu“ bleibt. Anscheinend kann man alle Orchideenarten miteinander kreuzen. Bis heute gibt es etwa 100.000 Hybride. Sie werden immer billiger, aber man hätte keine rechte Freude an ihnen, sagen die Züchter.
Deutsche Orchideen gab es nicht zu sehen, außer Frauenschuh und einige andere nichteinheimische aber winterharte Freilandorchideen. Man machte mich auf winzige Orchideen aus Südamerika aufmerksam, sie hingen an einer Drahtwand und waren auf Korkstücke von der Größe einer Zigarettenschachtel festgebunden. Für die ständig neugezüchteten Hybriden wird offiziell keine wild wachsende Orchidee mehr genommen – „der Natur entnommen“. Das Biosphärenreservat Rhön beschäftigt zu ihrem Schutz sogar einen – sehr kenntnisreichen – Orchideenwart. Über die kleinen Orchideen in der kargen Rhön wurden seit den Zwanzigerjahren schon viele Bücher veröffentlicht.
Auch ein Züchter von fleischfressenden Pflanzen hatte einen Stand im Ausstellungs-Gewächshaus des Botanischen Gartens. Da ich in einem Moor voller Sonnentau groß geworden bin, interessierte mich diese Pflanze besonders. Seine Sonnentaupflanzen sahen jedoch ganz anders aus als „unsere“: Sie stammten aus Südamerika, Südostasien und Australien. Ihr Züchter aus Großbeeren hatte sie von Kollegen gekauft und weitergezüchtet. Die Venusfliegenfallen hatte ich mir größer vorgestellt, vor allem die Kannen der Kannenpflanzen. Füttern tat er sie alle nicht: „Sie müssen nicht unbedingt Fleisch haben“. Im Übrigen sei das mehr eine Liebhaberei als ein Geschäft für ihn. Ich vergaß ihn zu fragen, ob er Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für fleischfressende Pflanzen“ ist.
Über das sehr viel größere Geschäft mit Orchideen fand ich in dem Buch der Biologin Monika Offenberger „Symbiose“ (2014) einige Details: Orchideen-Früchte enthalten bis zu einer Million Samen, die jedoch kein Nährgewebe besitzen und deswegen zum Keimen auf einen Pilz angewiesen sind, „der das Pflanzenembryo ernährt, bis es Blätter und Wurzeln gebildet hat und sich selbst ernähren kann.“ Die Gärtner brauchten lange, bis sie das erkannten und noch länger, bis sie ein geeignetes Nährmedium fanden, „das alle nötigen Substanzen für das Auskeimen der Orchideensamen enthielt“, und zudem eine sterile Umgebung benötigt, damit sich keine Schimmelpilze ansiedeln. „Steriles Arbeiten ist auch heute noch oberstes Gebot beim Kultivieren von Orchideen. Gewandelt haben sich indes die Vermehrungstechniken. Nur ausnahmsweise – etwa beim Frauenschuh – werden noch Samen ausgesät; das Gros der Arten wächst dagegen in Gewebekulturen herans, die man aus speziellen Wachstumsknospen der Mutterpflanze, den sogenannten Augen, gewinnt. Auf diese Weise entstehen beliebig viele Nachkommen. Sie sind, ähnlich wie gewöhnliche Stecklinge oder Ableger, genetisch identisch, sprich: Klone. Aus einem Auge lassen sich Millionen von Jungpflanzen gewinnen. Einer der größten Orchideen-Vermehrungsbetriebe der Welt, das Familienunternehmen Hark aus Lippstadt in Nordrhein-Westfalen, produziert pro Jahr zigmillionen Klone für Abnehmer aus zahlreichen Ländern. Allein „Phalaenopsis“ (Nachtfalterorchidee) deckt mit ihren Varianten fast die gesamte Farbpalette ab. Zudem steht die edle Schöne mit Blühzeiten von mehreren Monaten außer Konkurrenz. Kein Wunder, dass sie auch auf finanziellem Gebiet alle Rekorde bricht: Sie gehört zu den Zimmerpflanzen mit dem weltweit höchsten Umsatz.“
Das Gegenteil gibt es aber auch: In der Rhön nahm ich an einer Orchideen-Exkursion eines Bauern und seines Sohnes teil. Im Auftrag der Verwaltung des Biosphärenreservat schützt er die wilden Orchideen, die auf den Trockenwiesen der Rhön wachsen, vor Überwucherung durch andere Pflanzen und vor dem Abgeflückt-Werden durch Touristen. Er arbeitet dabei mit Traktor und Mähbalken. An unzugänglicheren Flächen übernehmen dies kleine Schafherden, es gibt auch noch eine Ziegenherde für die steilen Hänge. Die Orchideen der Rhön sind zumeist ganz unscheinbar. Man muß schon genauer hinsehen, um sie anhand ihrer kleinen Blüten zu identifizieren.
Der Bauer bewirtschaftet nebenbei noch einige Felder. Er baut darauf Ackerunkräuter an. Die Samen sind für andere Bauern, die sie unter ihr Getreide-Saatgut mischen. Für den dadurch bewirkten geringeren Ernteertrag bekommen die Bauern eine staatliche Entschädigung. Es sind dies alles Experimente, seitdem man meint zu wissen, dass sich eine bestimmte Anzahl von Ackerunkräutern günstig für das Gedeihen der Getreidepflanzen auswirkt.
In der Rhön gedeihen gut 40 Orchideenarten. Der erste, der sie erforschte war Franz Kasper Lieblein, der 1784 eine „Flora Fuldensis“ veröffentlichte. Dann kam Goldschmidt (1863-1916). Die Orchideen wurden 1908 im Band VI seiner Rhönflora bearbeitet.
Derzeit werden die Pilze der Rhön systematisch erforscht – u.a. von dem Botaniker Andreas Bresinsky von der Universität Regensburg. Er schreibt: „Die Rhön hat hinsichtlich ihrer Pilze als schlecht erforscht zu gelten, obgleich die Kenntnis der Großpilze Mitteleuropas ursprünglich von dort aus ganz wesentlich gefördert wurde.“
Auf seiner Internetseite über die Rhön schreibt der aus der hessischen Rhön stammende Autor Marco Klüber: „Auf sonnig-warmen Kalkstandorten sind im Frühling Manns- und Helm-Knabenkraut gebietsweise häufig anzutreffen. Im Sommer dominiert die Mücken-Händelwurz den Aspekt ihrer Standorte. In halbschattigen Bereichen wachsen Bleiches und Rotes Waldvögelein, Braunrote und Müllers Stendelwurz, Großes Zweiblatt und Grünliche Waldhyazinthe. Die sehr seltene Honigorchis hat in den Enzian-Schillergrasrasen der thüringischen Rhön überregional bedeutende Vorkommen, die Grüne Hohlzunge ist eine Besonderheit der Halbtrockenrasen im Bergwinkel. Ragwurze, Pyramiden-Orchidee, Ohnsporn und Bocks-Riemenzunge sind in nacheiszeitlichen Wärmeperioden aus dem Süden eingewandert und bevorzugen die wärmsten Gegenden der Rhön.
Auf extensiven Wiesen können Großes Zweiblatt, Kleines, Manns- und Breitblättriges Knabenkraut ihre Blütenpracht entfalten, stellenweise wachsen hier auch Weiße Waldhyazinthe und Mücken-Händelwurz. Eine der merkwürdigsten und seltensten heimischen Orchideen ist an besonders magere Weiden gebunden: die Herbst-Wendelähre.
Die bunten Bergwiesen an den Hängen der Rhöner Kuppen werden typischerweise zweimal im Jahr gemäht, und ihre Artenzusammensetzung ist von diesem Bewirtschaftungsrhythmus wesentlich beeinflusst. An Orchideen wachsen hier nicht nur Großes Zweiblatt, Mücken-Händelwurz und die beiden Waldhyazinthen, sondern auch Manns-, Kleines, Breitblättriges und sogar das sehr seltene Brand-Knabenkraut.
Manche Orchideenarten erschließen sich auch Lebensräume, in denen man sie nicht unbedingt vermuten würde, nämlich unsere Siedlungs- und Infrastruktur. Sie wachsen in Hausgärten, Wochenendsiedlungen, Stadtparks und auf Friedhöfen; in stillgelegten Steinbrüchen, an Bahndämmen, an Waldwegen, auf Verkehrsinseln und entlang stark befahrener Straßen und Autobahnen. Es lohnt sich, auch an scheinbar unmöglichen Standorten Ausschau zu halten, denn Orchideen sind immer für eine Überraschung gut.“
Anmerkung:
(*) Die Pflanzen, die der Geobotaniker Hansjörg Küster allzu entschieden für „willenlos“ hält, kommen ihnen bei der Futtersuche entgegen. Man nennt das Chiropterophilie – Fledertierblütigkeit und versteht darunter in der Botanik laut Wikipedia ein Merkmalssyndrom bei Pflanzen, die sich auf die Bestäubung durch Fledermäuse oder Flughunde konzentriert haben. Diese Pflanzen blühen oft nachts, ihre Blüten haben einen intensiven Duft. Sie produzieren sehr viel Pollen und Nektar. Die Blüten sind meist derb und weit geöffnet, um den Anflug dieser im Vergleich zu Insekten sehr viel größeren und schwereren Säugetiere auszuhalten. Die „thailändische Hummelfledermaus“ ist allerdings als „kleinstes Säugetier der Welt“ nicht viel schwerer als eine Hummel (1,5 Gramm) und als die kleinste Kolibriart, die kubanische Bienenelfe, die etwa 2 Gramm wiegt.
Bei einigen Pflanzen- und Fledertierarten sprechen Forscher von einer „Symbiose“, andere von einer „Co-Dependence“. Einige chiropterophile Pflanzen bilden ihre Blüten derart aus, dass sie den Schall gut reflektieren, so dass die mit Echoortung sich orientierenden Fledermäuse nicht nur den Standort der Blüte, sondern auch die Qualität und Quantität ihres Nektars abschätzen können. Mit diesem Entgegenkommen versuchen die Pflanzen, ihre Bestäuber zur „Blütentreue“ zu veranlassen. Und das sollen sie angeblich unwillentlich tun?
Ihre Nahrung wird den Fledertieren von den Pflanzen also geradezu angeboten, damit sie deren Samen und Pollen verbreiten (bis zu 70 Prozent der Pollen tragen Flughunde in ihrem Fell unversehrt zur nächsten Blüte). Viele asiatische, afrikanische und australische Bäume sind auf die Fledertiere als Bestäuber angewiesen – sie sind deswegen so nützlich, dass sie auf keinen Fall ausgerottet werden dürfen, wie Naturschützer immer wieder betonen.
.
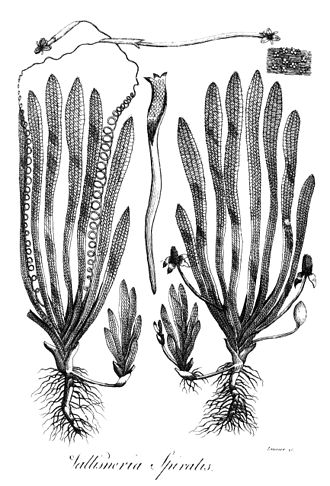
Aalgras gezeichnet von Erasmus Darwin
Aalgras
Man nimmt an, das das Leben im Wasser begann. Irgendwann gingen einige Wesen an Land – die Pflanzen zuerst, danach die Tiere (von denen ein paar Arten seltsamerweise wieder zurück ins Wasser gingen, wo sie dann in gewisser Weise überqualifiziert waren und noch sind). Das Aalgras wird auch „Gewöhnliche Wasserschraube“ (Vallisneria) genannt und ist ein „Froschbissgewächs“, als „echte Wasserpflanze“ blieb es wo es war.
Die Erstveröffentlichung von „Vallisneria spiralis“ erfolgte 1753 durch Carl von Linné. Man sagte, er habe diese Wasserpflanze erfunden, um eine Leerstelle in seinem großartigen „System der Natur“ zu füllen. Erst einige Jahre danach sei sie wirklich aufgetaucht – und zwar überall gleichzeitig. Ihre Herkunft ist jedoch noch immer unklar, jedenfalls nicht aus den schwedischen Gewässern, sie mag gerne wärmeres Wasser. Man vermutet, dass sie sich aus dem Süden immer weiter nach Norden vorgewagt hat – in Süß- aber auch Brackwasser, wobei ihr in jüngster Zeit die Klimaerwärmung hilft. Das gilt auch für andere Vallisneria-Arten. In Berlin steht „Vallisneria spiralis“ allerdings auf der „Roten Liste“ gefährdeter Arten.
Der Botaniker Hansjörg Küster spricht den Pflanzen jeden Willen ab. Wenn man dem belgischen Naturforscher und Dramatiker Maurice Maeterlinck folgt, gilt das nicht für das Aalgras, das etwas Tierisches an sich hat. Aber während Seeanemonen und andere Blumentiere fleischliche Nahrung brauchen, begnügt sich das Aalgras mit der Umwandlung von Licht in Energie; das für ihr Wachstum notwendige CO2 entnimmt sie dem im Wasser gelösten Gehalt.
Maeterlinck schreibt 1907, am Ende seiner Betrachtung über Wasserpflanzen (in: „Die Intelligenz der Blumen“): „Wir können die Wasserpflanzen nicht verlassen, ohne noch kurz das Leben der romantischsten unter ihnen, der Vallisneria, zu berühren, deren Befruchtung die tragischste Episode in der Liebesgeschichte der Pflanzenwelt bildet: Die Vallisneria ist ein ziemlich unansehnliches Gewächs, ohne die seltsame Grazie der Wasserrose oder gewisser Seegräser. Aber man möchte sagen, dass die Natur sie zur Trägerin eines schönen Gedankens erwählt hat. Ihr ganzes Dasein vollzieht sich im Wasser in einer Art Halbschlaf, bis zu der hochzeitlichen Stunde, wo sie zu neuem Leben erwacht. Dann rollt die weibliche Blüte langsam die Spirale ihres Stiels auf, steigt und taucht empor, schwimmt auf der Oberfläche des Teiches umher und entfaltet ihren Kelch. Die männlichen Blüten einer benachbarten Staude, die sie durch das sonnige Wasser erblicken, steigen hoffnungsvoll zu ihr empor. Aber auf halbem Wege sehen sie sich plötzlich festgehalten; ihr Stengel, der Quell ihres Lebens, ist zu kurz.
Man vergegenwärtige sich die Tragödie dieses Verlangens, das Unerreichbare, das doch fast berührt wird. Es wäre unlöslich wie das Drama unseres eigenen Erdenlebens, hätten die männlichen Blüten nicht vielleicht ein Vorgefühl ihrer Enttäuschung. Jedenfalls umschließen sie mit ihrem Kelch eine Luftblase, wie man in seinem Herzen einen Gedanken an verzweifelte Befreiung hegt. Sie zaudern anscheinend einen Augenblick, dann machen sie eine prächtige Kraftanstrengung, die übernatürlichste, die ich in der Geschichte der Insekten und Blumen kenne, um sich zum Glück zu erheben: sie zerreißen freiwillig das Band, das sie ans Dasein kettet. Sie reißen sich von ihrem Stiel los und mit unvergleichlichem Aufschwung, von Perlen des Frohsinns umgeben, durchbrechen ihre Blütenblätter die Wasseroberfläche.
Zu Tode getroffen, aber strahlend und frei, schwimmen sie eine kurze Weile neben ihren sorglosen Bräuten; die Vereinigung vollzieht sich und die Geopferten gehen unter, während die Gattin, die bereits Mutter ist, ihren Kelch, in dem ihr letzter Hauch fortlebt, schließt, ihre Spirale zusammenrollt und wieder in die Tiefen hinabsteigt, um dort die Frucht des heroischen Kusses zu zeitigen…“ Danach wickeln sich die Blütenstandschäfte schraubenartig auf und hoch und sorgen laut Wikipedia, „dafür, dass die reifenden Früchte immer genau unter der Wasseroberfläche gehalten werden“.
Die Pflanze wurde nach dem Naturforscher Antonio Vallisneri benannt, der 1707 bekannt gab, dass er die lange gesuchten Geschlechtsteile bei den Aalen gefunden habe, man wollte deswegen die Genitalien des weiblichen Aals nach ihm benennen, aber dann stellte sich heraus, dass es sich nicht um Eierstöcke, sondern um „eine krankhafte und aufgeblähte Schwimmblase“ handelte. Die Vallisneria wurde bis dahin volkstümlich Aalgras genannt, weil sich zwischen der Pflanze gerne Aale verstecken, aber auch Meerforellen.
In Kanada, an der Westküste von Vancouver Island, gibt es einen Indianerstamm: die Hesquiaht – was übersetzt nicht wie meist „Die Menschen“ heißt, sondern bescheidener: „Die Menschen des Geräusches, das durch das Essen von Heringseiern auf Aalgras entsteht.“ Sie hatten sich einst auf den Fang von Seeottern spezialisiert.
Die Region „Nord-Seeland“ in Dänemark wirbt um deutsche Angler: „Die Beschaffenheit der Küste und des Untergrundes ist äußerst abwechslungsreich: kleine sandige Inseln, kleine Riffs, Blasentang und Aalgras-Felder bilden ein absolut spannendes Meerforellenrevier!“ In dem Forum „leidenschaft-meerforelle.de“ wurde sogleich das Problem der Ausbreitung des „Amerikanischen Borstenwurms in den Aalgras-Feldern an Dänemarks Küsten“ diskutiert. Einer der Teilnehmer meinte: „Aalgras braucht Dünger…und anscheinend kann der Wurm diesen liefern.“
Hierbei handelt es sich um ein im Salzwasser lebendes Aalgras, von dem die Autoren des 2. Bandes „Orthomolekulare Medizin“ annehmen, dass es sich dabei eher um Riedgras (Cladium mariscus) handelt. Der Name Aalgras sei jedoch verständlich, „da diese Pflanze auch viel mit Aalfang zu tun hat“. Sie gehört jedoch nicht wie Vallisneria zur Familie der Froschbissgewächse sondern zu den Sauergrasgewächsen. Diese sind weit verbreitet, die Vallisneria ist eingewandert und gilt als eine invasive Art. Jedoch nicht bei den hiesigen Aquarianern: „Die Schraubenvallisnerie ist eine der meistverkauften Aquarienpflanzen,“ heißt es auf „aquarienpflanzen-shop.de“. Derzeit kartographiert die Universität von Cardiff mithilfe von „Seegras-Spottern“ und einer App alle Aalgras-Felder der Welt, bis jetzt sind es schon 300.000 Quadratkilometer.
.

.
Seegras
Seehasen, auch Lumpfische genannt, sind auf Seegras-Weiden angewiesen. Es sind plumpe Bodenfische, die 10 Kilo wiegen können, bis zu einem halben Meter lang werden und schlechte Schwimmer sind. Sie leben in den kühlen Gewässern des Atlantiks. Meereskaninchen, besser bekannt als Kaninchenfische, leben dagegen im Indopazifik. Nach dem Bau des Suezkanals wanderten sie ins Mittelmeer ein. Auch sie sind auf Seegras-Weiden angewiesen.
Die Ersteren ernähren sich von Weichtieren und Quallen, letztere von Algen und Seegras, eine Blütenpflanze, die auf Schlick- und Sandböden wächst. Die Kaninchenfische suchen Seegraswiesen auf, weil sie sich davon ernähren und die Seehasen, vor allem wenn sie noch jung sind, weil sie u.a. von Robben gejagt werden und sich im Seegras verstecken. Während diese eher zwischen den Pflanzen am Boden leben, halten sich die Kaninchenfische laut Wikipedia „über“ den Seegraswiesen auf.
In Friedrichshafen feiert man „Seehasenfeste“, das hat jedoch nichts mit dem Fisch zu tun, man nannte bloß die Bodensee-Anrainer früher so. Und dann gibt es noch eine Meeresschnecke (Aplysia), die auf Deutsch wegen ihrer hasenartigen Tentakel auf dem Kopf Seehase genannt wird. Sie ernährt sich von Algen und Seegras. Während die Seehasen-Fische sich u.a. von ihr ernähren.
Seegraswiesen kommen in 159 Ländern und auf allen sechs Kontinenten vor. Ihre Wiesen werden jedoch immer kleiner. Auf dem niedersächsischen Wattboden gingen die Seegraswiesen bereits um 77 Prozent zurück. Da sie eine wichtige „Kinderstube“ für viele Fischarten bilden, sind die Meeresforscher besorgt und sinnen auf Rettung.
Die Ursachen ihres Rückgangs sind vielfältig: Die Anker der Yachten, die Wasserverschmutzung, bestimmte Fischfangmethoden und ein Pilzbefall. Es gibt inzwischen mehrere Versuche, u.a. in den USA, diese Wiesen, bestehend aus Zwergseegras und Echtem Seegras, künstlich zu vermehren. Ein solches „Projekt“ gibt es auch in einer Bucht auf Mallorca. Ebenso auf Ibiza im Park Les Salines. Dort zählen die Seegraswiesen seit 1999 zum Weltkulturerbe. Die Journalistin Felicitas Bläsche erwähnt sie in ihrem „TV-direkt“-Bericht „Ibiza – Eine Insel zum Träumen“ (2/25), weil sie meint, dass darin „zahlreiche Vogelarten nisten“: Unter Wasser? Unsinn!
Das Seegras wird vielerorts, z.B. in Südkorea, wie das Wiesengras gemäht, an Land geholt, getrocknet (wie Heu) und dann verkauft. Es dient u.a. als Dämm- und Polstermaterial. Hierzulande verkauft es z.B. die Seegrashandels GmbH. Man kann das Seegras auch essen, besonders begehrt ist es u.a. in Japan und China. Edeka bewirbt es als „Gemüse aus dem Meer“.
Auf der Internetseite des NABU steht unter einem Foto, das einen „juvenilen Seehasen zwischen juvenilen Miesmuscheln“ zeigt: „Auch der neuen Bundesregierung ist das Potential der Unterwasserwiesen bekannt“. Auf „seegraswiesen.de“ heißt es: Diese „fördern Biodiversität und bieten wichtige Ökosystemleistungen wie Kohlenstoffbindung und Sedimentstabilisierung, die für den Klima- und Küstenschutz von großer Bedeutung sind.“ Das Wort „Ökosystemdienstleistungen“ ist ein anthropozentrisches Ekelwort und wird den kleinen Seegräsern in keinster Weise gerecht. Die Internetseite stammt von der „Küsten Union Deutschland e.V.“ in Warnemünde und wirbt für „Seegras-Wiederansiedlungen in der Ostsee“, die „ein neues und aktives Instrument des Unterwassernaturschutzes“ sind. Dazu pflanzt sie jedoch nicht selbst Seegräser, sondern will uns bloß „bei einer fundierten Berichterstattung darüber helfen“.
In einer Seegraswiese leben nicht nur Seehasen und Meereskaninchen, sondern auch jede Menge andere Tiere. Es ist ein Biotop oder besser noch: ein Soziotop. Dies legen jedenfalls zwei Forschungen nahe, die erste kommt aus der Pflanzenforschung, die zweite aus der Soziologie.
1. In ihrem Buch „Die Lichtwandler (2024), in dem es um neuere botanische Forschungsansätze geht, zitiert die Wissenschaftsjournalistin Zoe Schlanger den spanischen Botaniker Rubén Torices: „‚Das Leben der Pflanzen innerhalb ihrer näheren Umgebung ist eine soziale Frage‘, sagt er. ‚Und deshalb sollten wir sie auch aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive betrachten‘.“
2. In der „Zeitschrift für Theoretische Soziologie“ hat die Ausgabe 2/2020 den Schwerpunkt „Symbiose. Theorie für die biosoziale Gegenwart“. In der Biologie hat seit einiger Zeit nicht nur die Erforschung des sozialen Verhaltens in der Tier- und Pflanzenwelt Konjunktur, sondern auch (wieder) der Begriff „Symbiose“. Ende des 19. Jahrhunderts hatten russische Forscher mit dem Begriff verschiedene enge Kooperationen benannt, dann änderte sich der Forscherblick und man entdeckte – mit Darwin – überall den „Kampf ums Dasein“ und ein „Survival of the Fittest“, bis mit einigen amerikanischen Feministinnen, allen voran die Mikrobiologin Lynn Margulis, die Symbiose erneut ins Blickfeld geriet und nun ständig neue Formen des Zusammenlebens entdeckt werden.
Indem die Soziologen diesen Begriff aufgreifen, versuchen sie, ähnlich wie Rubén Torices, eine Brücke zwischen Natur- und Sozialwissenschaft zu schlagen – nur von der anderen Seite her. Dies geschieht natürlich vor dem Hintergrund von Klimaerwärmung, Pandemien und weltweitem Artensterben, das alle Lebewesen betrifft und die menschliche Gesellschaft für den Gegensatz von Ökologie und Ökonomie sensibilisiert hat. Wobei man sich derzeit allerdings meist wieder für letztere und gegen erstere entscheidet.
Die Meereskaninchen nehmen als Pflanzenfresser ihre Nahrung laut Wikipedia „mit mümmelnden Bewegungen der Oberlippe [auf], daher ihr Name“. Sie haben kleine Münder mit winzigen Zähnen und als einzige unter allen Knochenfischfamilien Bauchflossen oben und unten, die von „je einem Hartstrahl gestützt werden“, wobei der von Rücken- und Afterflosse eine Giftdrüse hat. Da die Meereskaninchen in den tropischen Küstenländern ein Speisefisch sind, ist ihr Verzehr nicht ungefährlich: ihr Gift bewirkt eine Fischvergiftung namens Ciguatera.
Bei den Seehasen ist bloß das Fleisch des Männchens „wohlschmeckend“. In Island gilt es getrocknet sogar als Delikatesse. Während die Weibchen nur in Hinsicht auf ihre Eier eine Ökosystemdienstleistung für uns erbringen: Diese Eier, Rogen genannt, von denen ein Weibchen bis zu 700 Gramm in der Laichzeit absetzt, werden schwarzgefärbt und in Salzlake eingelegt als „Deutscher Kaviar“ vermarktet.
Indirekt sind daneben beide Geschlechter menschennützlich, indem sie, in Norwegen z.B., gezüchtet und dann als „Putzerfische“ (siehe taz v. 16.5.2022) auf Lachsfarmen eingesetzt werden. Sie sollen die Lachslaus, einen kleinen Ruderfußkrebs, von den Lachsen abfressen, der sich in Zuchtbecken explosionsartig vermehrt. Die Reduzierung der Lachsläuse soll wiederum den Einsatz von Antibiotika reduzieren, heißt es auf Wikipedia. Und der Seehase reduziert auch die Lachsläuse, denn neben Weichtieren frißt er auch gerne harte Krustentiere.
.
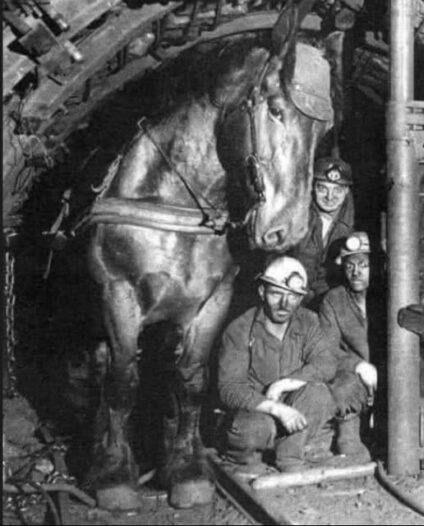
Das letzte deutsche Grubenpferd. Es durfte 1972 wieder ans Tageslicht – mit Pressebegleitung. Auch die Arbeiter im Uranbergwerk Wismut posierten für die Presse Untertage:
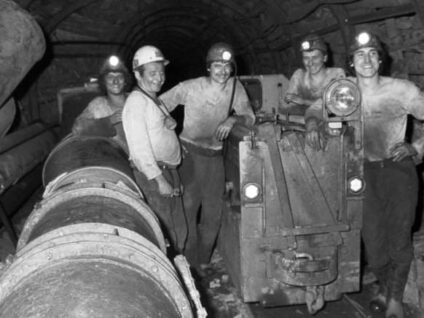
.
Die Arbeit der französischen Messerschleifer war 1902 mindestens ebenso anstrengend wie die Untertage. Sie sollten möglichst ihre Katzen und Hunde mitbringen, damit sie ihnen wenigstens die Beine wärmten:
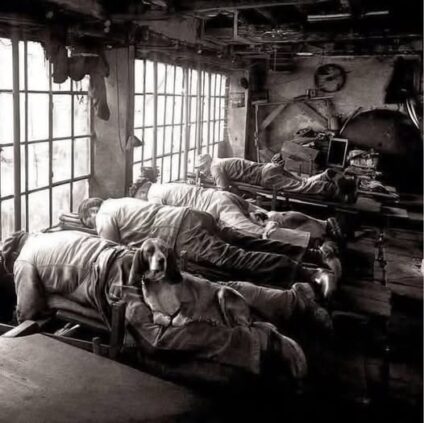
.
Arbeitstiere (ein lichtbildgestützter Vortrag)
1.Video: Meerschweinchen
1890 gelang es, durch gezielte Infektion von Meerschweinchen ein Serum gegen Diphterie herzustellen, an der damals alljährlich tausende von Kinder starben. In der Folgezeit wurden immer mehr Meerschweinchen angeschafft, um das neue Medikament zu testen, bis es die Firma Höchst auf den Markt brachte. Die Meerschweinchen waren dabei vom Versuchstier zu einem lebenden Laborgerät geworden, das Serum herstellte. Sie waren Arbeitstiere geworden. Zur Serumherstellung wurden dann auch Kaninchen, Ratten und Ziegen genommen sowie Pferde, woran eine Tierschutzorganisation kürzlich erinnerte: „Jedes Jahr werden zahlreiche Pferde als Lebendspender von Gegengiften, sogenannten Antitoxinen, missbraucht. Hierzu wird den Pferden zunächst mehrfach das entsprechende Gift injiziert; anschließend werden die Antitoxine aus ihrem Blut isoliert.“ In der DDR waren z.B. die Pferde des Staatsgestüts Liebenberg bei Oranienburg ebenfalls Serumlieferanten, sie lebten nicht lange.
2.Bild: Schimpansen in Labor/Gut Aiderbichl
2012 erteilte das Europäische Patentamt (EPA) der US Firma Altor ein Patent auf einen genveränderten Schimpansen – für Medikamenten-Tests. Nach Ansicht der Tierschützer verstößt die Patentierung eines dem Menschen technisch angeähnelten Affen gegen die ethischen Grenzen des Europäischen Patentrechts. „Es ist für mich eine schockierende Vorstellung, dass eine Firma in einem Menschenaffen nur noch ein technisches Instrument sieht,“ sagte die Schimpansenforscherin Jane Goodall, die Einspruch gegen die Patenterteilung erhob.
„Für Tierversuche kann man keine Sympathie erwarten. Sie finden in einer Parallelsphäre von Labors und Instituten statt, mit der kaum ein Laie je in Berührung kommt. Auch wer sie im Prinzip für nötig hält und darauf vertraut, dass der Gesetzgeber diese unsichtbare Sphäre strengen Regeln unterworfen hat, will es wahrscheinlich selbst gar nicht so genau wissen: wovor das Tierschutzgesetz die Labortiere da schützt. Von den millionenfachen Experimenten profitieren wir lieber stillschweigend, als uns mit einem ethischen Dilemma zu belasten,“ schreibt „Die Zeit“.
3.Foto: Zebrafisch-RoboterBei den meisten Labortieren besteht ihre Arbeitsleistung darin, dass sie innerlich und äußerlich eingeführte künstliche Substanzen (meistens Chemikalien) aushalten müssen. Die kaum 6 Zentimeter groß werdenden Zebrafische aus dem Ganges gelten dabei als die „Laborratten“ unter den Fischen. Es wurden bereits 25.000 wissenschaftliche Studien über sie veröffentlicht, „darunter über 2000 allein im Jahr 2015,“ berichtet der Verhaltensbiologe Jonathan Balcombe in „Was Fische wissen“ (2018). Sein Plädoyer für mehr Empathie mit Fischen müßte jedoch heißen: „Was wir über die Fische wissen wollen“.
Die Aquarianerzeitschrift „Koralle“ schreibt in ihrer April-Ausgabe über die Zebrafischforschung: „Seit es Anfang der 80er-Jahre gelang, einen Zebrafisch zu klonen, wurden verschiedene genetische Stämme rein gezüchtet.“ Und damit kennt nun die Forschung an diesem anspruchslosen und sich schnell vermehrenden kleinen Bärblingen kein Halten mehr. So pflanzten z.B. einige Genetiker in Singapur ihren Zebrafischchen Gene einer Leuchtqualle ein, so dass sie nun ebenfalls im Dunkeln leuchten. Vor allem wurde der Zebrafisch ein „Kleintier-Krankheitsmodell“ – für Störungen des Blutkreislaufs, Leberleiden, Nervendegeneration und Krebs. Der „Koralle“-Autor erwähnt ferner, „dass Stämme mit fehlender Pigmentierung Einblicke in das Innenleben eines Zebrafisches gestatten. Spezielle Computersysteme, ausgerüstet mit Videokameras zeichnen ihre Verhaltensänderungen bei epileptischen Anfällen auf und helfen, diese auszuwerten. Neue Arzneimittel können so geprüft werden, indem man testet, ob sie eine Linderung der Symptome erreichen. Aber auch die negativen, toxischen Auwirkungen dieser Substanzen werden mithilfe der Zebrafische erforscht.“ Es sind Millionen jährlich, die dabei draufgehen. Im Dienste unserer Gesundheit. Es gibt aber auch eine im Dienste ihrer Gesundheit, insofern man vor allem ihr Empfindungsvermögen experimentell erforscht. Auch dabei geht es jedoch meist nur um ihre Leidensfähigkeit. In einer der Studien, die Balcombe erwähnt, wurden dazu z.B. 132 Zebrafischen Essigsäure in den Schwanz gespritzt. „Sie schlugen daraufhin auf eine eigenartige Weise mit dem Schwanz.“ Setzte man sie dagegen dem Alarm-Pheromon eines anderen Zebrafisches aus, reagierten sie „normal und schwammen zum Grund“. Die Forscher schlossen daraus: Die Angst der Fische hat Vorrang vor ihrem Schmerz.
Bei einem anderen Experiment wurde einigen Zebrafischen Essigsäure injiziert, anderen ein etwas harmloseres Salzwasser. Beide Gruppen änderten ihr Verhalten nicht und zogen den Teil des Aquariums vor, wo im Gegensatz zu einem anderen Pflanzen wuchsen. Als man jedoch in den gemiedenen Teil ein Schmerzmittel gab, schwammen die Zebrafische, denen man Säure injiziert hatte, sofort dorthin.
Forscher des Max-Planck-Instituts für Neurobiologie untersuchten genetisch veränderte Zebrafische mit einem Cortisolmangel, dabei diagnostizierten sie Anzeichen einer Depression. Als sie jedoch Medikamente gegen Angstzustände, Valium und Prozac, ins Wasser gaben „normalisierte sich ihr Verhalten“. Schon ein Sichtkontakt mit anderen Zebrafischen, die durch eine Scheibe von ihnen getrennt waren, besserte ihre Stimmung.
Diese und ähnlich ärmliche Experimente haben mit dazu beigetragen, immerhin, dass die Leidensfähigkeit von Fischen in der von Hobbyanglern wimmelnden USA nun quasi amtlich anerkannt ist. Damit sind sie dem Subjektstatus ein Stückchen näher gekommen. Der französische Wissenssoziologe Bruno Latour ist optimistisch: „Irgendwann wird man es genauso seltsam finden, dass die Tiere und Pflanzen kein Stimmrecht haben – wie nach der Französischen Revolution, dass bis dahin die Menschenrechte nicht auch für Frauen und Schwarze galten“.
4. Fehlt
5.Foto: Bundeswehrsoldatin richtet Hunde ab
Bei einigen Tieren ist der Übergang von Haus- zu Nutztieren fließend. Bei den Gebrauchshunden z.B.: Sie sind heute laut der Biologin Donna Haraway vor allem als Zuchttiere und Labortiere sowie als Arbeitshelfer (d.h. als Produktionswerkzeuge) “tätig”. Hunde, die z.B. als Hütehunde ausgewählt und “weiterentwickelt” werden, könnte man deswegen auch bereits als “Biotechnologien in einem System marktförmiger Landwirtschaft” begreifen, schreibt sie. Im US-Fernsehkanal “Animal Planet” werden in der Serie “Dogs with Jobs” regelmäßig weitere Arbeitseinsatzmöglichkeiten für Hunde vorgestellt. Haraway erwähnt u.a. die “Cell Dogs”, die in einem kalifornischen Gefängnis von den Insassen zu Wachhunden ausgebildet werden. Sie leben mit den Inhaftierten für die Dauer dieser “subjekttransformierenden Beziehung” in einer Zelle. Für die einen wie für die anderen gilt: “der Weg zu Freiheit und Arbeit außerhalb der Gefängnismauern” besteht aus dem Lernen von “Disziplin und Gehorsam”. „Einen Hund, der die abschließende Prüfung nicht besteht, erwartet der Tod.”
Anders die Suchhunde, die in Freiheit trainiert werden, so dass sie sich im Einsatzgebiet ihre Fährten selbständig ausarbeiten,“ wie die amerikanische Leichensuchhundebesitzerin Cat Warren in ihrem Buch „Der Geruch des Todes“ schreibt. Ihr Schäferhund Solo soll im Einsatz einen „intelligenten Ungehorsam“ zeigen und das „Suchgebiet wie ein „Vermessungstechniker auf Meth-amphetamin ablaufen“. Die Autorin riecht im Wald bloß die Erde, „Solo riecht die Verstorbenen“. Dann „glitzern seine braunen Augen glücklich und ungeduldig.“
In Mitteleuropa arbeiteten sich einst die Hunde von Aas- und Abfallfressern zu Hüte-, Wach- und Kriegshunden und schließlich zu Jagdhunden hoch, sie wurden quasi adlig, wobei sie sich spezialisierten: in Stöber-, Hühner-, Hetz- und Apportierhunde usw..
6.Foto: Schifftransport mit Rindern
Über die pflanzenfressenden Haustiere schreibt der Kurator der Ausstellung „Arme Schweine“, Thomas Macho, Kulturwissenschaftler in Wien: „Jene Tiere, die seit Jahrtausenden mit den Menschen lebten und arbeiteten – nämlich die Haustiere – wurden aus allen konkreten Lebens- und Arbeitskontexten der Moderne verdrängt. Die Rinder wurden durch Traktoren ersetzt, durch Mähdrescher und andere landwirtschaftliche Maschinen, die Ziegen und Schafe durch die Produktion synthetischer Bekleidung. Die Kavallerie wurde gegen Panzerdivisionen ausgetauscht; und zunehmend wurden die ehemals militärisch idealisierten Pferde zu Zugtieren degradiert, die allenfalls jene Gulaschkanonen schleppen durften, in denen sie bei Bedarf gekocht und an die Soldaten verfüttert werden konnten. Die Kutschen wichen den Eisenbahnen und Automobilen, die Lasttiere den Kränen und Baggern, die Brieftauben den Computern und Telefonen. Wollten wir die Grundtendenz des Modernisierungsprozesses in gebotener Knappheit erfassen, so müßten wir sie als progressive Eliminierung der Haustiere durch Maschinen beschreiben. Diese gesellschaftliche Verdrängung der Haustiere reduzierte die Tiere schlagartig auf eine einzige Funktion, die noch kein Wild- oder Haustier jemals zuvor in vergleichbarer Größenordnung erfüllen mußte: auf die Funktion des Massenschlachtviehs.“
Zu den Pferden sei noch hinzugefügt, dass James Watt, der Entwickler von Dampfmaschinen, die die Pferdekraft ersetzten, zunächst große Schwierigkeiten hatte, den Wirkungsgrad seiner Technik in „Pferdestärken“ (PS) angeben zu können. Inzwischen hat die Maßeinheit „PS“ vergessen lassen, dass sie auf die Zugkraft von Pferden zurückgeht, zumal man seitdem die starken Zugpferd-Rassen, die sog. Kaltblüter, zu nervösen Hobbyreitpferden umgezüchtet hat.
Bei der industriellen Massentierhaltung geht es fast immer um kostengünstiges Aufwachsen lassen – was an sich keine Arbeit ist. Jedenfalls nicht so, wie wir sie meist verstehen: als Ausbeutung, wie das z.B. in extremer Form bei den Milchkühen der Fall ist. Die Schlachtviehhaltung ist dagegen eher eine gewaltsame Reduktion – insofern die Tiere in der industriellen Landwirtschaft auf Fressen, Wachsen und Vermehren reduziert werden. Das gilt auch für die Tiere im Zoo, die die Pfleger gerne beschäftigen würden, aber aus Versicherungs-Gründen meist nicht dürfen.
Auch die Katze erfuhr eine Reduktion – als man sie vom agrarischen Nutztier – als Mäusefänger – zu einer urbanen Haus- und Wohnungskatze machte, die dabei extrem unterfordert wird. Ich habe zusammen mit einer Freundin auch eine Wohnungskatze, Luzie. Das, was wir mit ihr machen ist genaugenommen Tierquälerei, insofern wir sie permanent einer Reizarmut aussetzen.
7.Foto: Katze vor Mauseloch
Eine andere Form von Tierquälerei sind die Millionen Kleintiere in Kinderzimmern, die durchweg ein schreckliches Schicksal haben, das am Ende absurderweise meist in einer aufwändigen Beerdigungszeremonie für das trauernde Kind endet.
Bei den Wildtieren im Zirkus kann man noch am ehesten von Arbeitstieren sprechen.Man sagte lange, dass die im Zirkus auftretenden Tiere, wie Großkatzen, Bären, Seelöwen und Elefanten, es besser als ihre Artgenossen in den Zoos haben, weil sie nicht wie diese hinter Gittern einfach stillgestellt sind, sondern was tun müssen – arbeiten. In den sozialistischen Ländern wurde die Dressur im Sozialismus „wissenschaftlich“ organisiert und die Zirkusse stationär gebaut, bis dahin, dass „Zirkusarchitekten“ einen „kybernetischen Zirkus“ auf den Moskauer Leninbergen planten. Während man im Westen heute die Wildtierdressur verbietet und die Zirkusse überhaupt sich hier quasi überlebt haben, werden in Russland und China weitere gegründet. Artisten und Dompteure sind dort Staatsangestellte.
8.Foto: Zirkusnummer mit Ursula Böttcher
Carl Hagenbeck hatte 1867 in seinem Zirkus die wilde Dressur – „die gewohnheitsmäßige Brand- und Stockdressur“ – durch eine „zahme Dressur“ – eine Mischung aus Schlägen bzw. Peitschenhieben und Belohnungshappen – ersetzt. Es waren die fruchtbarsten Jahre der Naturforschung und des Experiments – wie es im Vorwort der Autobiographie von Carl Hagenbeck: „Von Tieren und Menschen“ heißt. Der Hamburger Tierhändler und Zoodirektor wollte mit der zahmen Dressur „einen Weg zur Psyche des Tieres“ finden, wie er 1928 schrieb: „Je geduldiger und gütiger der Dompteur ist, desto mehr Vertrauen werden die Tiere zu ihm fassen; ist seine Güte aber nicht mit Strenge gepaart, die sich Gehorsam zu erzwingen weiß, dann wird der Vorführung die Sicherheit mangeln.“ Der sowjetische Zirkushistoriker Jewgeni Kusnezow spricht in seinem Buch „Der Zirkus der Welt“ (1970) von einer „humanen Dressur“, aus der Carl Hagenbeck eine ganze „Dressurschule“ entwickelte, sowie auch das Konzept eines „Zoologischen Zirkus“ (ohne Artistik). „Gegen Ende der Neunzigerjahre hatte sich die humane Dressur überall durchgesetzt, ihre Erfolge waren zu offensichtlich,“ schreibt Kusnezow. Dabei wandelten sich jedoch die Begriffe: „Zahm war jetzt eine ruhige, seriöse Nummer“ und „wild“ eine gefährlich wirkende, „bei der man die Tiere reizte“. Kusnezow zufolge begann „mit der Verbreitung der humanen Dressur die große Zeit der Frauen im Raubtierkäfig,“ und sie dressierten meist nicht mit männiglicher Respekterheischung, sondern eher mit jungfräulicher Anmut. Die Dressurnummern mit Raubtieren im Zirkus und im Zoo, wurden immer beliebter.Der Tierpsychologe Otto Koehler äußerte 1942 in Berlin während einer S-Bahnfahrt gegenüber dem späteren Zoodirektor Bernhard Grzimek: „So weit, dass wir mit Elefanten und Tigern Versuchsreihen anstellen, sind wir noch lange nicht. Wir müßten erst mal wenigstens mit ihnen richtig Fühlung haben und das nicht nur den Zoowärtern und Dompteuren überlassen.“ Bernhard Grzimek, der bereits bei sich zu Hause einen Wolf gezähmt hatte, bat daraufhin die Zirkusdirektorin Trude Sarrasani um Erlaubnis, bei ihr als „Tigerdompteur“ aufzutreten. Der Raubtierdompteur Hermann Haupt, der einst bei der berühmten Leipziger Löwenbändigerin Claire Heliot assistiert und später ihre Löwen übernommen hatte, leitete ihn an – indem er Grzimek im Manegenkäfig z.B. zurückzog mit der Bemerkung: „So nahe dürfen Sie an Daisy niemals ran, die packt sie von hinten an.“ Als eine andere Tigerin einen zweiten Sprung verweigerte, übernahm Haupt die weitere Übung und erklärte: „Wenn man so etwas durchgehen läßt, wird sie zeitlebens nur noch einmal springen.“ Vor der „großen Tigerin Gitta“ warnte er ihn: Sie ist „bösartig“ – sie war dann auch die einzige, bei der Grzimek „etwas unbehaglich zumute“ war. Im übrigen empfand er die Raubtiere als „grässliche Pedanten“: Wenn nur eine Kleinigkeit im Ablauf der Nummer anders war (Grzimek schwang z.B. die Peitsche von unten gegen die Beine, während Haupt sie über ihre Köpfe hielt), klappte die Vorführung nicht. Besonders schlimm wäre es gewesen, wenn z.B. „einer der Tiger mit seinem Podest hinfiele, es würde Krach, Aufregung und womöglich einen Aufstand geben.“
Manche ruhmversessenen Dompteure inszenieren so etwas. Der „Tierlehrer“ Otto Sailer-Jackson, der die Laute der Raubkatzen nachahmte, wenn er sie ansprach, mußte einmal im Zirkus Sarrasani für den Dompteur Hermann Haupt einspringen, den seine Löwen schwer verletzt hatten, aber sie waren immer noch zu „aufsässig“, so dass er mit ihnen keine Vorstellung geben konnte. In seinem Buch „Löwen meine besten Freunde“ (1978) beschreibt er, wie seine „handzahm gemachten“ Löwen als „wahre Schauspieler“ einen Aufstand spielten: „In jeder Vorstellung ging Pascha mit furchtbarem Gebrüll gegen mich zum Scheinangriff vor. Die anderen folgten ihm und gaben mit ihrem Brüllen ein schreckenerregendes Konzert, das bange Herzen erzittern ließ. Im Augenblick höchster Erregung des Publikums warf ich meine Peitsche weg und stand mit verschränkten Armen den brüllenden Löwen gegenüber. Als Pascha ganz nahe heran war, sprang ich ihm plötzlich entgegen, umarmte ihn unter dem Gebrüll der anderen und gab ihm einen Kuß. Pascha drehte sich daraufhin um und ging auf seinen Platz zurück. Die anderen folgten ihm. Tosender Beifall.“
Der indische Dompteur Damoo Dhotre trat mit verschiedenen Raubkatzengruppen in amerikanischen, sowjetischen und französischen Zirkussen auf. In Indien veröffentlichte er 1961 eine Autobiographie „Wild Animal Man“. Seine schwierigste Dressur war die eines schwarzen Jaguars, „Negus“, der einen „eigenartigen Humor“ bei seinen Widerstandsaktionen entwickelte. Seinen „Ruhm“, vor allem in Amerika, verdankte Dhotre jedoch der Leopardin „Sonia“, die nur mit einem Lasso dirigiert werden konnte (in Amerika dressierte man mit Schlinge und Stuhl). Sie galt als „bösartig“, weil sie „andere Tiere angriff und den Dompteur behandelte, als wäre er Luft für sie“. Dhotre gegenüber verhielt sich die wild geborene Leopardin jedoch wider Erwarten ganz freundlich: „Sie hätte eine Hauskatze oder ein Schoßhund sein können, nach ihrem Verhalten zu urteilen.“ Für ihn wurde sie eine „Königin, und sie war so lange glücklich, wie man sie als solche behandelte.“ Als sie sich einmal im Freien von der Leine losriß und er „Sonia komm her!“ rief, kam sie sofort zu ihm zurück. „Sie hatte gelernt, alle die manchmal für ein Tier sicher unverständlichen Dinge zu akzeptieren, die ihr von mir beigebracht wurden.“ Für eine Vorstellung im New Yorker Square Garden wollte er zum Abschluß mit ihr zur Musik von „An der schönen blauen Donau“ im Zentralkäfig tanzen: Als alle anderen Tiere draußen waren, breitete er die Arme aus und warf Stock und Peitsche weg, Sonia kam langsam auf ihn zu, erhob sich auf die Hinterbeine und umarmte ihn. So tanzten sie „durch den ganzen Käfig. Dies war die Nacht, von der ich mein Leben lang geträumt hatte.“ Es hätte auch ein „Tanz des Todes“ werden können, fügte er hinzu, dann wäre „das der krönende Höhepunkt einer aufregenden Dompteurlaufbahn gewesen“.
Grzimek erinnerte in seinem Buch „Unsere Brüder mit den Krallen“ (1961) daran, dass in der „Tierseelenforschung“ versucht wurde und werde, den Menschen aus der Versuchsanordnung rauszuhalten, um auch unbewußte Beeinflussungen auszuschalten, wohingegen bei der „Zirkusdressur gerade diese enge Beziehung von Mensch und Tier psychologisch interessant“ sei. Zwei der Tiger des Dompteurs Haupt wurden von einer Hündin aufgezogen: „Für sie bedeutet es gar nichts, dass ein Mensch an sie herantritt und sie streichelt,“ schreibt Grzimek. Mit den anderen, den ängstlichen, die vor ihm zurückweichen, würde er jedoch auf Dauer lieber arbeiten: denn „Ceylon und Daisy sind zwar zahm, sie haben aber auch keinen Respekt mehr.“ Im Gegensatz dazu meinte der Dompteur des Circus Siemoneit-Barum, Gerd Siemoneit, zu dem Zirkusbuch-Autor Werner Philipp (in: „Die dressierte Gesellschaft“ 1982), dass er „Tiger, die im Circus geboren sind, am Liebsten hat: ‚Die latschen mit acht Monaten mit den anderen mit‘.“ Auf der anderen Seite seien es oft die „Peiniger“ unter den Dompteuren, „die ihren Tieren zum Opfer fielen“. Er gestand, „sich manchmal schon ganz schofelig vorzukommen, so schöne Kreaturen hinter Gittern zu halten – aber wer von uns ist schon frei?“ Manche Raubtierdompteure arbeiten mit Drogen, Tierärzte sprechen von „Valium-Tigern“.
Einige Dompteuse gehen mit ihren Arbeitstieren mütterlich um: Als die später mit einer Eisbärengruppe berühmt gewordene DDR-Dompteuse Ursula Böttcher 1955 das erste Mal vor einer Löwengruppe stand und die brav alles taten, was sie sollten, dachte sie: „Hui, die haben ja Respekt vor mir.“ Aber einmal, als sie dem Löwen „Royal“ ein Stück Fleisch zur Belohnung gab, was dieser gewohnheitsmäßig mit einem Prankenhieb quittierte, dem Ursula Böttcher nicht schnell genug auswich, zerriß es ihr die Pulsader. Ihr holländischer „Tierlehrer“ Gaston Bosman sagte, nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen worden war, er würde es ihr nicht übel nehmen, wenn sie nun aufgebe. Aber warum denn, antwortete sie, „Royal hat es doch bestimmt nicht mit Absicht getan. Ich glaube sogar, der ist noch mehr erschrocken als ich.“ Die berühmte Leipziger Dompteuse Claire Heliot äußerte sich ähnlich, nachdem ihr Löwe „Pascha“ sie in den Arm gebissen hatte: „Ganz beschämt wäre er davongeschlurft, in einer Ecke habe er schließlich gelegen, die mächtigen Tatzen vor dem Gesicht.“
9. Foto: Löwendompteurin
Die Behandlung der Zirkustiere wird vom Publikum mitbestimmt. Die amerikanische Tigerdompteuse Mable Stark, deren Lieblingstiger mit ihr im Wohnwagen lebte, wollte irgendwann mit ihren geliebten Großkatzen keine albernen Kunststücke mehr einüben (sie auf einer Kugel balancieren oder durch einen brennenden Reifen springen lassen), stattdessen wollte sie deren Schönheit präsentieren: Die Tiger liefen herum, sprangen von Postament zu Postament – und taten alles wie im Fluß. Sie erwartete großen Applaus, er war aber nur verhalten „respektvoll“. Ganz anders die darauffolgende Löwennummer eines Dompteurs: „Die Tiere fletschten die Zähne, schlugen mit den Tatzen durch die Luft, der Dompteur mußte mehrmals seine Schreckschußpistole einsetzen. Als sie von ihren Postamenten runtersprangen und auf ihn losgingen „konnte er sich nur mit einem Hechtsprung durch die auffliegende Käfigtür retten.“ Das Publikum johlte und klatschte stehend.
Die Löwendompteuse beim Zirkus Busch, Tilly Bébé, über die Paula Busch einen Roman veröffentlichte, schrieb über ihre abendlichen Auftritte: „Diese unverkennbare Grenze zwischen Spiel und Wirklichkeit, zwischen Leben und Tod ist im Grunde die Stelle, die das Publikum interessiert.“
10.Foto: Hitchcocks „Vögel“
Wo jemand zur Arbeit gezwungen wird, gibt es auch Widerstand. Der Harvard-Neurologe Marc Hauser ist sich jedoch sicher, Tiere sind generell nicht in der Lage, sich zu einem Aufstand gegen die Menschen zusammenzurotten. Eine Revolution ist mit Tieren nicht zu machen, schreibt er in seinem Buch „Wild Minds“.
Schon die Ornithologin in dem Hitchcock-Film „Die Vögel“ war davon überzeugt, dass den Vögeln das geistige Potential fehlt, Angriffe mit destruktiven Beweggründen zu führen, wie sie sich ausdrückte.
Hitchcocks Film handelte genau davon. Ein englischer Landarbeiter sieht, dass sich die See- und Landvögel immer aggressiver verhalten. Er vermutet bald, dass hinter ihrer scheinbar zufälligen Schwarmbildung eine Art kollektive Intelligenz steckt – und sieht darin eine zunehmende Gefahr. Er fängt an, seine Hütte zu befestigen. Aus dem Radio erfährt er von ähnlichen Vorgängen im ganzen Land. Nachdem alle Verbindungen zur Außenwelt unterbrochen und die benachbarten Bauern durch Attacken der Vögel umgekommen sind, entwirft der Landarbeiter für sich und seine Familie einen Überlebensplan.
11.Foto: Arbeitselefanten
Ein kleiner Aufstand gelang vor einigen Jahren einer Brigade von Arbeitselefanten in einem indischen Forstbetrieb: Wenn sie nach Feierabend in den nahen Wald entlassen wurden, fielen sie immer wieder in Plantagen ein. Ihre Mahuts banden ihnen schließlich Kuhglocken um, damit die Bauern rechtzeitig gewarnt wurden und die Elefanten vertreiben konnten. Das funktionierte auch – bis zu jenem Tag, als die Elefanten das akustische Warnsignal ausschalteten und ungestört eine Bananenplantage abernteten. Sie hatten alle ihre Glocken mit Schlamm verstopft. Der Philosoph Nietzsche bemerkte, dass „auch im Gehorchen ein Widerstreben liegt; es ist die Eigenmacht durchaus nicht aufgegeben“. In den Human-Animal-Studies spricht man heute von der „Agency“ der Tiere, sie wird von der Biologin Donna Haraway sogar für Labortiere geltend gemacht. Agency ist die Möglichkeit von Individuen, freie Entscheidungen zu treffen. Agency beinhaltet also auch und vor allem Widerstand.
Es gibt Versuchstiere, denen man das im Labor sogar beibringt: Im Jahr 2007 starb Alex, die Intelligenzbestie unter den Papageien. Er hatte in seinen 31 Jahren bei seiner Besitzerin, der Psychologiedozentin Irene Pepperberg, die ihm unentwegt Worte und Zahlen beibrachte, gelernt, auf verschiedene Weise „Nein!“ zu sagen. In Pepperbergs Buch „Alex und ich“, das sie ein Jahr nach seinem Tod veröffentlichte, heißt es: „Während unserer Arbeit lernte Alex, Nein zu sagen. Und Nein hieß dann auch Nein.“ Alex war ein Graupapagei, der für seine Arbeit – Menschensprache lernen – von der Universität bezahlt wurde.
Bis es so weit war, hatte er es erst einmal auf die unter afrikanischen Papageien übliche Weise zu „sagen“ versucht: laut kreischen, beißen oder, „wenn er keine Lust mehr hatte, auf die Fragen eines Trainers zu antworten, die betreffende Person ignorieren“, ihr den Rücken zukehren, sich ausgiebig putzen …
Meist kam er damit durch, seine „Trainer“ verstanden ihn: „Subtil war unser Alex nicht gerade“, meint Irene Pepperberg. Aber dann reichte ihm diese „Sprache“ nicht mehr im Umgang mit seinen Betreuern. Diese sagten häufig „Nein [bzw. No], wenn er etwas falsch identifizierte oder etwas anstellte.“ Irgendwann bemerkten sie, „dass Alex in Situationen, in denen ein ,No‘ angemessen gewesen wäre, ein Laut wie ,Nuu‘ hervorbrachte“. Irene Pepperberg, sagte daraufhin zu ihm: „Gut, dann können wir dir auch gleich beibringen, das richtig schön zu sagen.“ Schon bald verwendete Alex „diese Bezeichnung, um uns zu signalisieren: ,Nein, das mag ich nicht!‘“
12.Foto: Graupapagei Alex und Dr. Irene Pepperberg
In einem Dialog mit seiner Sprachtrainerin Kandia Morton hörte sich das folgendermaßen an: „K: Alex, was ist das? [ein quadratisches Holzstück hochhaltend] – A: Nein! – K: Ja. Was ist das? – A: Vier Ecken Holz [undeutlich, aber richtig] – K: Vier. Sag es schöner! – A: Nein! – K: Ja! – A: Drei … Papier [völlig falsch] – K: Alex. Vier, sag vier. – A: Nein. – K: Komm schon. – A: Nein.“
Laut Irene Pepperberg genoss Alex seine wachsende Publicity immer mehr: Kameras, Mikrofone, staunendes Personal, freudige Trainer und Fans: „Er stand nun mal gerne im Mittelpunkt. Dann trat ein gewisses Glitzern in seine Augen, er plusterte sich auf – im übertragenen Sinne – und nahm die Pose des Stars an.“ Irgendwann war er jedoch das ewige Sprachtraining und auch die wachsende Aufmerksamkeit leid: „In puncto Verweigerung wurde er umso kreativer, je älter er wurde“, schreibt die Autorin, dann freute sie sich aber doch: „Alex versteht die Bedeutung des Begriffs ,Nein‘.“ Sie folgerte daraus sofort positiv – ganz im Sinne ihrer Projektbeschreibung: „Sein Ausdruck eines negativen Konzepts war durchaus schon als fortgeschrittenes Stadium sprachlicher Entwicklung zu betrachten.“
„Wege zum Nein“ – so heißt eine feministische Aufsatzsammlung, herausgegeben von Sina Holst und Johanna Montanari.
13. Foto: Weiße und Schwarze Schwäne auf der Bühne
Im Zirkus sollen die Arbeitstiere zwar verboten werden, aber im Theater und beim Film werden es immer mehr: Auf der Internationalen Tanzmesse in Düsseldorf, dessen innerstädtischer See „Schwanenspiegel“ heißt, gab es 2012 mehrere Versionen vom Schwanensee-Ballett zu sehen. Die „Schwanensee“-Version von Luc Petton hieß kurz und bündig: „Swan“. Und es spielten dabei acht Schwäne mit. Damit es zu den lasziven Berührungen mit den Schwänen kam, arbeiteten die Tänzerinnen mit Futter in ihren Händen, wobei die fünf weißen Schwäne auf der Trockenbühne agierten, was aufgrund ihres watschelnden Gangs nur mäßig elegant wirkte, während die drei schwarzen Schwäne in einem gläsernen Wasserbecken graziös um die Tänzerinnen herumschwammen.
Die Schwäne wurden für ihren „Tanz“ nicht gedrillt. Man ließ sie nach dem Schlüpfen auf Menschen prägen und machte sie schon als Jungschwäne, noch während sie ihr graues „Dunenkleid“ trugen, mit der Bühne vertraut.
Ihrem Auftritt in Düsseldorf war eine öffentlicher Streit zwischen Tierschützern, Theatermanagern und dem Ordnungsamt vorausgegangen. Letztere argumentierten zunächst: „Der Showeinsatz von Schwänen ist im deutschen Recht nicht geregelt“. Erstere konnten dabei auf ein Vorkommnis im Freiburger Theater verweisen: Dort war ein in der Wagner-Oper „Lohengrin“ vom Regisseur Frank Hilbrich eingesetzter Schwan namens Scapetti trotz Dauerpräsenz seiner Tiertrainerin Tatjana Zimek während der Vorstellung von der Bühne geflogen und im Orchestergraben gelandet.
Mit Tieren arbeitet Frank Hilbrich normalerweise nicht, „das ist eine absolute Ausnahme“, der anmutige Schwan sei ein Symbol der Hoffnung, eine märchenhafte Erscheinung; mit einem Stofftier sei diese Wirkung nicht zu erzielen und der lebende Schwan deshalb nicht zu ersetzen.
Die Tiertrainerin Zimek kündigte an, Scapetti – der ein „sehr verschmuster Schwan“ sei – bei der nächsten Vorstellung ein Geschirr anzulegen. „Das ist besser, denn er weiß jetzt, dass er davon fliegen kann.“ Das Geschirr sei aber nicht schlimm für ihn, „sondern wie wenn man einen Hund an die Leine nimmt“. Dennoch entschied die Theaterleitung, ab sofort auf jeden Auftritt von Schwänen auf der Bühne zu verzichten. Nach dem Vorfall mit dem Schwan sei das Risiko zu groß, dass die künstlerische Intention der Szene – die Darstellung von Unkontrollierbarkeit – nicht aufgehe, erklärte die Dramaturgin Jutta Wangemann.
Auch ein Auftritt von 25 lebenden Hühnern, die in einer Szene von Elfriede Jelineks „Winterreise“ auftreten sollten, wurde gestrichen. In Zukunft werde man höchstens noch „dressierte Hunde“ erlauben. Die Freiburger Rathaussprecherin begrüßte den Beschluß: „Der Schwan stand unter Streß.“ Die Tiertrainerin, die mit einer gewerblichen Genehmigung ihre 120 Tiere, die sich auf ihrem Hof in der Nähe von Karlsruhe frei bewegen dürfen, europaweit für Theater- und Filmarbeiten einsetzt, widersprach dem entschieden: „Der Schwan war seelenruhig und hat nicht mal geschnauft“. Nicht Angst habe den Vogel Reißaus nehmen lassen (in der betreffenden Szene geht der Chor singend auf den Schwan zu); schließlich habe sie ihn mehrere Wochen intensiv auf die spezielle Bühnensituation und die Musik vorbereitet. Vielmehr habe das Tier sich bedrängt gefühlt, weil sich ihm der Chor zu schnell genähert habe. Sie bedauerte die Entscheidung der Theaterleitung deswegen. Die Lokalzeitung meldete wenig später noch, dass es sich bei dem Schwan namens Scapetti um eine Gans gehandelt habe, genauer gesagt: um eine argentinische Coscoroba-Gans.
14. Foto: Der Esel Balthazar
In der ersten Ausgabe der Zeitschrift “Tierstudien” machte sich der Dramaturg Maximilian Haas Gedanken darüber, was das Lachen des Publikums über Tiere auf einer Theaterbühne bedeutet. Er hatte 2011 zusammen mit dem belgischen Performancekünstler David Weber-Krebs das Stück “Balthazar” aufgeführt, in dem ein Esel namens Balthazar neben fünf Schauspielern die Hauptrolle spielt. Inspiriert wurde das Projekt von Robert Bressons Film “Au hasard Balthazar” (1966), in dem es um das traurige Leben und den einsamen Tod eines Esels geht. Erst bei der Premiere stellte sich laut Maximilian Haas heraus, dass sie eine Komödie inszeniert hatten – mit dem völlig untheatralischen Esel. In dem Lachen des Publikums über das Tier lag „gleichermaßen eine Quelle der Lust wie ein Gewaltpotential.”
In Düsseldorf fand man dann folgende Lösung: Das zuständige Amt verbot der französischen Choreographin Coraline Lamaison die zwei lebenden Wölfe, mit denen sie auf der Bühne tanzen wollte. Die Tierschutzorganisation Peta hatte zuvor ihrer Behauptung heftig widersprochen, dass die Wölfe auf der Bühne glücklich seien.
Dafür durften aber die acht Schwäne der Compagnie Le Guetteur auftreten – wobei erhebliche Auflagen verfügt wurden: „Die Tiere brauchen für die Dauer ihres Engagements in Düsseldorf einen ausreichenden Auslauf, außerdem müssen sie Nester bauen, gründeln und schwimmen können.“ Die Festivalleitung richtete ihnen daraufhin ein Freigehege mit einer Wiese und einem Teich ein. Luc Petton hat bereits mehrmals Inszenierungen mit lebenden Tieren durchgeführt, u.a. mit Raben und Falken. Mit den Schwänen will er nun eine ‚Tour der Poesie‘ durch Europa unternehmen. „Sicher wird er das Publikum vielerorten in Staunen versetzen mit seiner süßen Utopie vom Frieden zwischen den Geschöpfen. Tierquälerei jedenfalls kann man dieser Inszenierung nicht vorwerfen,“ schrieb die Rheinische Post.
Es gibt immer mehr Agenturen zur Vermittlung von Tiere für Film und Fernsehen. Den Anfang machte die Borsig-Chefsekretärin Rosemarie Fieting 1987 mit einer Künstleragentur für Look-Alikes und Tiere. Im Prinzip kann „die Fieting“ jeden und alles besorgen. Manche Aufträge erfordern Erfindergeist: Einmal wurden zum Beispiel zwei Goldfische verlangt, die miteinander reden sollten. Frau Fieting nahm ihre eigenen und trennte sie mit einer Glasscheibe im Becken. Sofort schwammen sie von beiden Seiten gegen die Scheibe, wobei sie ihre Mäuler auf- und zumachten: „Es sah einer Unterhaltung täuschend ähnlich.“
Bei der steigenden Zahl ihrer Tieraufträge hat Frau Fieting erst einmal mit den „schwierigen“ Besitzern zu tun, die oft besondere Bedingungen stellen. Bei einer Katze, die für 200 Euro im Prenzlauer Berg in einem FU-Lehrfilm mitspielen sollte, waren das zum Beispiel „keine Scheinwerfer, keine Zugluft, keine Straßenszenen“. Alle paar Tage kommt inzwischen jemand mit seinem Tier zu ihr in die Agentur: eine alte Frau mit ihrem Wellensittich, der angeblich „perfekt spricht“, eine Punkerin mit einer weißen Ratte, die „überdurchschnittlich intelligent“ ist oder alleinstehende Männer, deren Hund oder Katze „besonders photogen“ ist bzw. „auch schwierigste Aufgaben meistert“.
15. Foto: Filmtiere
Manche Leute vermarkten ihre „Filmtiere“ selbst. Das in Hoppegarten lebende Ehepaar Ralf und Manuela Grabo z.B.. In ihrer ausgebauten Scheune und mehreren Volieren im Garten halten sie vier Hühner, drei Greifvögel, einen Kolkraben und zwei Pferde. In zwei Terrarien im Haus leben fünf Riesenschlangen und in einem Aquarium etliche Fische. Ralf Grabo war früher Jockey und arbeitete dann im Tierpark (Abt. Raubtierhaus), Manuela Grabo hat, als gelernte Tischlerin, früher nie etwas mit Tieren zu tun gehabt. Sie fand jedoch Schlangen „schon immer schön, mein Liebling aber ist der Uhu“. Dieser sowie die anderen Greifvögel wurden zu DDR-Zeiten aus Nachzuchten erworben, teilweise über befreundete Falkner. Über den Heimtierpark Thale fanden die Grabos 1995 ihren Kolkraben „Kolja“, der schon seinen Namen sowie „Hollo“ sagt, außerdem kann er bellen und gackern. Ihre Nebelkrähe spielte in einem neudeutschen Film, der im Knast Rummelsburg gedreht wurde, mit sowie in einem phantastischen US-Film – auf einem See in der Sächsischen Schweiz, wo sie auf dem Rand eines im Wasser schwimmenden großen Schuhs entlangzugehen hatte: „Die tat das, als hätte sie nie etwas anderes gelernt.“ Auch die Zumutung, mit einem fremden Hund zusammen einen überfahrenen Hasen an der Landstraße zu verspeisen, absolvierte sie mit Bravour: „In die Kamera fliegen mußte sie dann auch noch, und dann hatte die Filmproduktion auch noch nicht mal Geld dafür.“ Die ledige Honorarfrage: „Das sind Aufwandsentschädigungen, die nicht einmal den Unterhalt der Tiere decken.“ Eine der Graboschen Krähen spielte – für ein Trinkgeld – in einem Kinderfilm mit: auf einem schwankenden Oderkahn. „Auch das hat gut geklappt, mit der Zeit werden wir ja sowieso alle, wie soll ich sagen: professioneller.“
16.Foto: Rabenvögel
Mit Greifvögeln darf man laut des nun auch im Osten geltenden Bundestierschutzgesetzes nur beschränkt kommerziell auftreten. Grabos Bussard trat in einem Stück von Johann Kresnik auf: Er saß auf dem ausgestreckten Arm einer schwangeren Schauspielerin. Obwohl der Bussard kaum Probleme mit dieser Rolle hatte, durfte er dann nicht mit auf ein Gastspiel der Volksbühne nach Belgrad: „Die Behörden wollten es nicht genehmigen. Serbien gehöre nicht zur EU und so weiter.“ Wegen solcher oder ähnlicher Restriktionen nehmen die Filmproduktionen meist gleich einen Falkner vor Ort in Anspruch oder hier einen Vogel der Adlerwarte im Teutoburger Wald.
Auch die Schlangen der Grabos kommen nicht aus dem Urwald, sondern aus der DDR. Eine wirkte neulich in einer TV-Dokumentation über verbotenen Tierhandel mit, wo sie auf dem Schwanebecker Zollhof in einer Voliere eine beschlagnahmte Python zu mimen hatte, die sich auf einem Ast zusammenringelt und noch ganz benommen ist von der ganzen. Schmuggeltour: Es klappte auf Anhieb.
17. Foto Python
Eine Schlange besichtigt die Volksbühne/ https://vimeo.com/7655813Die Berliner Volksbühne war bekannt dafür, dass sie in ihren Stücken oft und gerne Tiere einsetzt: Hunde, Pferde und ganze Ziegenherden (in Hauptmanns „Weber“ z.B.). Die meisten Tiere engagierte der Frank Castorf, der Intendant, von Bernd Wilhelm. Der gelernte Tierpfleger arbeitete früher in den Tierversuchslabors der FU. Nach einer Infektion wurde er Frührentner. „Schon immer“ hatte er privat Tiere gehalten – die überdies gerne irgendwelche „Dummheiten“ machten. Mit den Jahren entstand daraus eine ebenso eigenwillige wie freundliche Dressurmethode, die sich heute auszahlt, insofern Herr Wilhelm mit seinen Tieren nicht nur von der Volksbühne, sondern auch von Film- und Fernsehproduktionen „gebucht“ wird: „Die Tiere arbeiten für ihren Lebensunterhalt.“ Daneben tritt er – mit seinen Eseln, Ponys und Ziegen etwa – auch bei Laubenpieperfesten auf und unternimmt Kutscherfahrten mit spastischen Kindern. Außerdem hält er für Problempferde eine „orthopädische Hufbehandlung“ parat. Alles im erlaubten „Rahmen des 400-Euro- Zugewinns“. Die meisten seiner Tiere landeten nach einer „Leidensgeschichte“ bei ihm, und sie müssen nicht auftreten, wenn sie nicht wollen. Die Perserkatze „Missy“ zum Beispiel „wurde schlecht behandelt“: Jetzt liegt sie die meiste Zeit hinterm Ofen in einem Pappkarton. Benno, der kurzbeinige schwarze Hund, gehörte einer Fixerin, die jetzt in einem Haus der Treberhilfe wohnt: „Aus ihm könnte noch mal was werden.“ „Fuchsy“ wurde angefahren am Straßenrand gefunden. Der Kapuzineraffe „Kingkong“ „arbeitet zwar nicht gerne, ist aber dafür nie böse“. Er mag am liebsten Limonade und Gummibärchen und liegt abends neben der für Kunststücke zu alt gewordenen Schäferhündin Sandra. Alle Tiere, auch die Waschbären, der Nasenbär, die Zwergschweine und die Hühner verstehen sich untereinander: „Das müssen sie auch, sonst geht das gar nicht.“ Herr Wilhelm lehnt Aufträge, bei denen sie „schwierige Sachen“ machen sollen, ab. Unlängst buchte die Volksbühne seinen Hengst, damit der auf der Bühne mit herabhängendem Gemächt und von den Schauspielerinnen bewundert, auf und ab gehe. Als das nicht klappte, schlug Wilhelm vor, ihm einen Plastikpenis umzubinden. Das fand der Chefdramaturg jedoch allzu unrealistisch, statt dessen wollte er eine „leichte Narkose“ für das Tier vor (dabei hängt das Gemächt unwillkürlich herunter). Wilhelm fand diese Forderung unannehmbar. Auch der Tierschutzverein protestierte dagegen bei der Volksbühnenleitung. Weniger Probleme gab es mit seinem Esel Max, als der ein wochenlangen Engagement am Gorki-Theater hatte. Wilhelms Ziege tritt regelmäßig bei „Porgy und Bess“ auf, wenn das US-Musical in Berlin gastiert. „Die größte Schwierigkeit sind sowieso die Schauspieler, „die sich erst an die Tiere gewöhnen müssen,“ meint Bernd Wilhelm.
18. Foto: Agility-Course
Auf dem Land, bei Oranienburg, lebt die Hundetrainerin Sabine Berg, allerdings in einem kleinen Reihenhaus mit einem winzigen Garten. Sie hält derzeit neun Hunde. Trotzdem sieht dort innen wie außen alles blitzblank aus, überall stehen Topfpflanzen und Nippes und selbst auf den Plüschsesseln findet sich kein einziges Hundehaar. Sabine Berg kann sich inzwischen eine Putzfrau leisten, außerdem hat sie aber ihre Tiere auch so gut erzogen, dass sie sich vertragen und nichts kaputt oder schmutzig machen: „In so einer Wohngemeinschaft, wie wir sie hier haben, muß jeder Rücksicht auf den anderen nehmen und sich halbwegs anständig betragen!“ Sabine Bergs letzte Neuanschaffung war ein großer grauer Mischlingshund, den sie sich in einem polnischen Tierasyl beschaffte und erst einmal entwurmte und aufpäppelte. Gleich bei seiner ersten kleinen Rolle erwies er sich als ein „wahres Naturtalent“: Er mußte in einem TV-Krimi neben einem Mann über einen Acker gehen, dieser wurd dann erschossen und der Hund mußte die ganze Zeit traurig neben der Leiche ausharren, die er ab und zu beschnüffelte und anstupste, so als könne er es nicht fassen.“Das hat der so gut gemacht, das ich glaube, aus dem wird noch mal was.“
Ein interessantes Filmtier-Problem tut sich gerade in Namibia auf. Dort halten eine Reihe von Leute sich neuerdings Wolfshunde. Weil es sich dabei um Kreuzungen zwischen Hunden und Wölfen handeln soll, wird das als nicht ganz ungefährlich angesehen. Nun gibt es aber in Namibia gar keine wild lebenden Wölfe und deswegen gingen einige Forscher dort der Frage nach: Wo dann die Wolfshunde herkommen? Ihre vorläufige Antwort lautet, dass mehrere ausländische Filmteams Außenaufnahmen in Namibia drehten, wobei sie einige mitgebrachte Wölfe frei ließen, um sie zu filmen. Diese halbwilden Tiere seien nach Drehschluß im Land geblieben und hätten sich dort mit halbzahmen Hunden gepaart.
19/20/21. – 3 Fotos: Glühwürmchen bei Nacht
Auch Glühwürmchen wurden gelegentlich als Arbeitstiere benutzt: Arme chinesische Studenten sammelten sie in ein Glas, um bei ihrem Licht Nachts lesen und schreiben zu können. Im Westen wurden sie zu Millionen als Labortiere vernutzt – nachdem man ihr Glühen chemisch analysiert hatte, es besteht aus Luziferinen und dem Enzym Luciferase, das in Gegenwart des Moleküls Adenisintriphosphat (ATP) aufleuchtet: Schon bald begann u.a. die Sigma Chemical Company mit dem Verkauf von Luciferase für medizinische Zwecke und verbrauchte dazu zigmillionen Glühwürmchen.
In Japan, wo Glühwürmchen-Fangen ein sommerliches Freizeitvergnügen war und an vielen Orten Glühwürmchen-Festivals stattfinden, sind die 50 dort vorkommenden Leuchtkäfer-Arten inzwischen ein Indikator für den Umweltschutz. Sie werden gezüchtet – einerseits zum Verkauf und andererseits, um sie in Schutzzonen wieder anzusiedeln. Solche gibt es für den Tourismus inzwischen auch in Malaysia und China, und ähnlich in den USA. Die Glühwürmchen sind dort im Showbusiness.
22. Foto: Floh-Zirkus
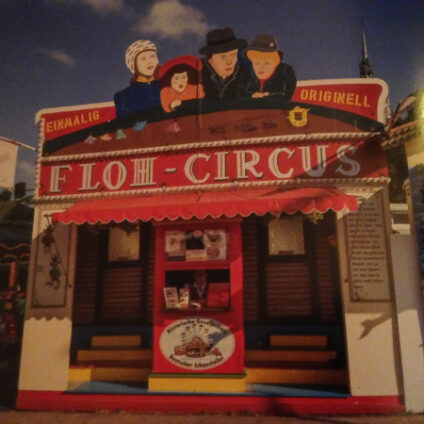
.
Flöhe
„Die Flöhe sind seit langer Zeit Gegenstand der verschiedenartigsten Untersuchungen gewesen: man hat sie vom philologischen und vom satirischen Standpunkte aus beleuchtet, man hat sie wegen ihrer lustigen Sprünge besungen und noch häufiger wegen ihres Blutdurstes verwünscht, man hat sie ‚abgerichtet‚ und so aus ihnen Gewinn zu ziehen gewußt, nur gerade der Zoologe hat ihnen bisher nicht in der gebührenden Weise seine Beachtung geschenkt,“ so schrieb der Parasitologe E. O.Taschenberg 1880. Der derzeitige Wissensstand über die hiesigen Flöhe basiert in erster Linie auf den ökologisch-faunistischen Arbeiten von Peus (zuletzt 1972), heißt es auf der Internetseite der Frankfurter Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, „ergänzende Arbeiten erschienen danach hauptsächlich für einzelne Bundesländer. Die jüngste faunistische Übersicht für das gesamte Deutschland datiert mit Kutzscher & Striese auf das Jahr 2003.“
Der jüngste Flohüberfall geschah im Sommer 2016 in einem Celler Pflegeheim, wo die Bewohner rote Punkte auf der Haut bekamen, die juckten. Die Feuerwehr löste Großalarm aus: Sie riegelte den Ort hermetisch ab – bis die medizinische Hochschule Hannover Entwarnung gab: Flohbisse sind zwar unangenehm aber keine Lebensbedrohung. Das Internetforum „heilpraxis“ erklärte dazu: „Der Speichel des Flohs verhindert, dass das Blut gerinnt. Durch diese Sekrete entzünden sich die Stichstellen und jucken. Wird der Floh gestört, hüpft er ein Stück weiter, so dass die Einstiche sich aneinander reihen“ – meistens sind es wie bei den Wanzenstichen drei. Warum immer drei, weiß kein Mensch! Das Berliner Naturkundemuseum gibt bekannt, seine Flohsammlung umfasse 237 Arten. Im Berliner Tieranatomischen Theater und im Wittstocker Museum des Dreißigjährigen Krieges sah ich Pestflöhe unter dem Mikroskop.
Lebend sind diese flügellosen Insekten, die man paradoxerweise zu den „Fluginsekten“ zählt, äußerst selten geworden. Selbst die Flohzirkusse sind fast ausgestorben – bis auf einen, der alljährlich auf dem Oktoberfest gastiert, wo sich die Kinder unter den Besuchern oft darüber entrüsten, dass diese winzigen Tierchen so große Kutschen ziehen müssen. Gelegentlich bringen Reisende von „Flohmärkten“ im Ausland einige „Siphonaptera“ mit, sie werden hier aber nicht alt. Die Senckenbergischen Naturforscher erwähnen die „sogenannten Sandflöhe“, die in tropischen Ländern die Füße von Warmblütern befallen und dabei die „Tungiasis“ übertragen. Die Berliner Sandflohforscherin Marlene Thielecke setzte sich dieser Gefahr in Madagaskar und Kenia aus, war aber im Gegensatz zu den Einheimischen dank einer Tetanusspritze geschützt: „Als ich den Floh zufällig entdeckte, hatte er sich schon mit seinem ganzen Körper kopfüber in meine Haut gebohrt. Zuerst war er nur ein winziger roter Punkt in der Mitte meiner Fußsohle. Dann ist er Tag für Tag ein bisschen gewachsen, bis er sich als erbsengroße, druckempfindliche Erhebung abzeichnete: der Sandfloh oder in schlau: Tunga penetrans. Er setzt sich wochenlang fest, am liebsten an Ferse und Spann oder unter den Zehennägeln, um dort seine Eier reifen zu lassen. Eigentlich sollte ich ‚sie‚ sagen, denn das machen nur die Flohweibchen.“ Für die Humanmedizinerin ist die Infektion durch den Sandfloh eine „Armutskrankheit: Damit lässt sich kein Geld machen, also investiert auch die Pharmaindustrie nicht in Forschung und Medikamente. Ich wusste: Hier kann man noch vieles herausfinden und bewirken.“
Die US-Ökologen J. F. Masello und P. Quillfeldt fanden in Patagonien unter den Parasiten von Felsensittichen, eine extravagante Flohart, die an den Küken in deren Nasenhöhlen und unter der Zunge parasitiert. Mich haben schon mehrmals Hunde- und Katzen-Flöhe gestochen, aber sie ließen schnell wieder von mir ab. Mein „Lebenssaft“ (Schiller) wirkt bei ihnen empfängnisverhütend, wie die Biologin Lisa Signorile nahelegt, wenn sie schreibt: „Unser Blut stillt ihren Hunger, schmälert aber die Fruchtbarkeit und die Zahl der abgelegten Eier.“ (in: „Mißgeschicke der Evolution“ 2012). Sie fand auf einigen Katzen alle drei Arten: Katzen-, Hunde- und Menschenflöhe. „Unsere“ sind mit den Schweineflöhen identisch. Im Wikipedia-Eintrag heißt es, dass „Flöhe zwar Vorlieben für bestimmte Wirtstiere haben, aber nicht ausschließlich auf diese angewiesen sind. Vielmehr scheinen sie eine größere Bindung zu ihren Nestern zu haben als zu ihren Wirten.“ Und die „Nester“ finden sie außerhalb ihrer Wirte (in Polstermöbeln z.B.), was deren Domestikation und Seßhaft-Werdung geschuldet ist: Ihre Wirte laufen ihnen nicht weg. Als diese noch nomadische Viehzüchter waren, mußten die Flöhe in ihrer Kleidung bzw. im Fell ihrer Tiere mitwandern.
Für alle gilt, dass sie das Blut von jungen Warmblütern besonders bekömmlich finden, denn sie dringen mit ihrem zu einem Stechrüssel umgewandelten Mund leichter durch deren noch dünne Haut. In einer Hamburger Schule für Körperbehinderte bewiesen sie 2005, dass sie auch zählen können: Über 100 Flohweibchen überfielen wie ausgehungert 110 Schüler dort, die dann von der verzweifelten Schulleitung nach Hause geschickt wurden. Ein Sprecher der Bildungsbehörde versicherte: „Ein Befall in diesem Ausmaß ist sehr ungewöhnlich – zumal im November“. Außerdem wurden zwar jede Menge Flohstiche identifiziert, aber kein einziger Floh gefunden. Man forderte daraufhin die Eltern auf, bei sich zu Hause nach den Tieren zu fahnden. Meist ruft man heute bei Flohalarm den US-Weltkonzern „Rentokil“ – danach traut sich lange Zeit kein Floh mehr in das Gebäude. 1998 demonstrierten die ostdeutschen Kammerjäger in Berlin gegen diese ausländische Konkurrenz, die ihren „Lehrberuf“ entwertete, indem sie straflos ungelernte Ungeziefervernichter einstellte.
Einer ihrer „Außendienstmitarbeiter“ erzählte mir, als ich das Gespräch auf Flöhe brachte: „Man kann sie kaum zerdrücken, sie haben einen sehr harten Chitinpanzer, man muß sie mit dem Fingernagel zerknacken. Und erst mal fangen. Sie können in Bruchteilen einer Sekunde losspringen – 30 Zentimeter weit, und das ununterbrochen: tagelang. Ihre Sprünge werden durch die umfunktionierten Flugmuskeln ausgelöst… Aber gegen unsere chemischen Mittel nützt ihnen das alles nichts.“ Auch im Internet erfährt man eher was über das Wie und Womit ihrer Vernichtung, als über das, was sie sonst so treiben. Aber so ist das immer in Deutschland: Wenn man über Parasiten spricht, geht es stets um deren „Bekämpfung“, in Frankreich vermutet man hingegen erst einmal, dass „parasitäre Verhältnisse das System selbst sind,“ wie der Philosoph Michel Serres es ausdrückte. Er scheint ein ähnlich sympathisierendes Verhältnis zu Flöhen zu haben wie ich. Zum einen nannte meine erste Freundin mich „Floh“ und zum anderen besaß ich ein Aquarium und mußte für die Fische laufend Wasserflöhe fangen. Sie hüpften auch unter Wasser und erfreuten mich mit ihrer Munterkeit. Ein Gymnasiast in Ratingen, Lukas Schier, hat unlängst entdeckt, dass sie mit Kaffee noch munterer werden: „Sie hören gar nicht mehr auf, sich zu paaren,“ berichtete er der „Westdeutschen Zeitung“. Die Haustier- und Menschen-Flöhe auch so nicht: „Unter einer halben Stunde ist die Verpaarung nicht fruchtbar,“ meint Lisa Signorile, nicht zuletzt, weil die männlichen Flöhe „die komplexesten Genitalien des gesamten Tierreichs“ haben, und sowieso müssen beide vorher eine anständige „Blutmahlzeit zu sich genommen haben“ – sonst läuft gar nichts.
23. Photo: Grillenkampf
Ähnlich wie mit den Glühwürmchen ist es mit den Grillen in China, Japan und Korea, die dort zu tausenden gefangen und verkauft werden – in kleinen Käfigen. Sie werden als Musiker, aber auch massenhaft zu Kämpfen benutzt.

24. Foto: Ratten, die in Kambodscha Minen suchen
25. Foto: Scheußliche Rattenexperimente

26. Foto: Mit Kormoranen fischen
27. Foto: Mit Geparden jagen
28. Gepard-Safari heute
29. Foto: Mit Falken jagen
Falken
Aus den Falken, diesen Arbeitstieren, wurden inzwischen Haustiere. Sie werden ebensowenig gebraucht wie ihre Beute. Die Falkenjagd ist ein Hobby für Reiche. Ähnliches gilt auch für das Jagdwild (Rehe, Hirsche, Wildschweine, Mufflons, Hasen, Fasane, Rephühner). Sie werden wie die Fische der Angler gezüchtet, um dann frei gelassen und von ihnen getötet zu werden. Die Jäger essen nicht einmal ihre Beute, es geht ihnen nur darum, kapitale Männchen zu erwischen, die ihnen eine Medaille, in Gold, Silber und Bronze, einbringen und eine beeindruckende Trophäe abgeben. Die Jagd ist vom Adel auf die Reichen und Staatsmänner übergegangen, sie ist zugleich immer widerlicher geworden – weitaus widerlicher als das Töten der Nutztiere am Fließband durch rumänische Schlachthofarbeiter, deren Armut sie dazu zwingt.
Im Ostblock haben die führenden Parteimitglieder alle wie verrückt in ihren eigentlich volkseigenen Wäldern gejagt, wobei sie sich in eine glorreiche Vergangenheit als Partisanen zurückphantasierten. Witzigerweise dachten die DDR-Oberen und vor allem die Stasiführung tatsächlich, dass die Feinde aus der BRD sich zuerst in den lächerlichen Wäldern der DDR sammeln und verstecken würden, um von da aus weitere Angriffe durchzuführen. Deswegen wurden die Jagdgebiete ständig und mit einem irren Personalaufwand durchgekämmt. Meist entdeckte man nur ein paar Wilderer – und das waren fast immer sowjetische Offiziere, die nicht belangt werden durften. Ähnlich war es mit den amerikanischen Soldaten im Westen. Es ging mir jedoch hierbei um die mit viel Geld extra zum Abschießen gezüchteten Wildtiere. Inzwischen werden auch die Wildtiere in den afrikanischen Nationalparks derart „bewirtschaftet“. Sie sind nicht nur im Hinblick auf den Safari-Tourismus ein Wirtschaftsfaktor – mit eigenen Schlachthöfen, sehr reiche Leute dürfen in den Nationalparks auch jagen.
30. Foto: Lanzenotter in Terrarium“
Der Ostberliner Tierpark hat eine Schlangenfarm. Es war einmal die größte Giftschlangenfarm Europas, sie stammte aus einer Serumfabrik bei Dresden. Als diese geschlossen wurde, brachte der „legendäre“ Pfleger, „Vater (Fritz) Kraus“ die Tiere in den Tierpark. Sein Nachfolger wurde dann Dr. Petzold und schließlich Klaus Dedekind. Kurator der Farm war zuletzt der Sohn des Tierparkgründers Falk Dathe. Früher geschah das „Abmelken“ des Giftes noch öffentlich. Die „Schlupferfolge“ sind bis heute beachtlich.
Im Englischen bedeutet labour sowohl Arbeit als auch Gebären – in diesem Sinne könnte man auch alle Tiere als Arbeitstiere bezeichnen, die nur gezüchtet werden, um sich zu vermehren, damit wir immer genug Nahrung haben. Die Nazis redeten einst davon, die Eiweißlücke in der Versorgung der Bevölkerung zu schließen. 2014 machte der „Grain Club“ der Landwirtschaftsverbände und -konzerne den Bundestag darauf aufmerksam: „Deutschland kann die Eiweißlücke nicht aus eigener Erzeugung schließen.“ Die Wochenzeitung „Zeit“ konterte: “Würden wir uns gesund ernähren, hätten wir auch keine Eiweißlücke“.
31. Foto: Maulbeerbaumspinner
32. Foto: Götterbaumspinner
Es gibt aber auch ein Textillücke, d.h. es gab sie, die mit dem Züchten von Tieren geschlossen werden sollte, nicht nur von Schafen und Alpakas, sondern z.B. auch von Maulbeerbaumspinnern und Götterbaumspinnern, deren Raupen, wenn sie sich verpuppen, einen Kokon aus Seide spinnen. Mitten in ihrer Metamorphose zum Schmetterling nimmt man sie und wirft sie in heißes Wasser. Anschließend wird die Seide des Kokons getrocknet und aufgespult. Es gibt daneben auch eine Muschel – im Mittelmeer, die seidenähnliche Fäden spinnt, um sich damit am Meeresboden fest zu halten, ihre Fäden waren schon in der Antike bekannt und begehrter als reine Seide.
.

Götterbaumspinner
.
33. Foto: Fischfarm in Berlin
Die Meeresfische sind oder waren zumindest die einzigen, die lange Zeit keine Arbeitstiere waren – insofern die Fischer die einzigen sind, die ernten ohne zu säen. In der DDR hießen die Fischrestaurants deswegen „Gastmahl des Meeres“. Aber seitdem die Fänge zurückgehen und die gefangenen Fische immer kleiner werden (bis 1910 fing man z.B. Plattfische, Heilbutte, die größer als die Fischer waren und über zwei Zentner wogen), geht man mehr und mehr dazu über, die angeblich gefährliche Eiweißlücke mittels Fischfarmen (Aquaponik) zu schließen.
.
Auch Tierleichen ernähren manchmal ihren Mann – hier wird Berlins beliebter Gorilla „Bobby“ für das Museum fit gemacht
Ausgestopfte Tiere
Früher waren die Zoos Wartezimmer für die Museen. Als es noch einen tasmanischen Beutelwolf in einem Zoo gab, meinte ein namhafter Biologe: „Der ist viel zu schade fürs Publikum, der gehört ins Museum.“ Als wir erfuhren, dass im Berliner Naturkundemuseum eine besondere Art der Tierpräparation entwickelt wurde, die „Berliner Schule“, interviewten wir neugierig den Chepräparator Detlef Mazke, er erzählte:
„Die Dermoplastik verlangt eine wissenschaftlich fundierte und ins Künstlerische gesteigerte Art Tierfreundschaft. Da kommt also jetzt aus dem Zoo ein totes Tier ins Museum. Das liegt dann vor einem auf dem Tisch. Das guckt man sich erst einmal an, ob man Zeit hat, damit zu arbeiten. Zeit in dem Sinne, daß noch kein Fäulnisprozeß drinne ist. Erst einmal muß man sich ja mit dem Tier innerlich vertraut machen.
Man fängt also an, dieses Tier zu bewegen: wie weit kann ich das Kniegelenk nach oben nehmen, rutscht mir z.B. die Haut dabei unter dem Gelenk durch, wann gibt es Hautfalten usw. Wie weit kann es den Kopf rumnehmen? Man muß das Tier in seinem Bewegungshorizont erfassen. Das ist das erste, was man macht. Als nächstes nimmt man eine Totenmaske ab. Daran kann man bestimmte Haarrichtungen erkennen und Abstände, vom Augen- bis zum Nasenpunkt z.B., die man hinterher umsetzen muß. Dann wird das Tier noch ein bißchen photographiert, und man macht ein paar Skizzen. Auch Farbskizzen sind wichtig.
Dann wird das ganze Tier abgezogen, also ich zieh die Haut runter wie beim Kaninchen, suche mir aber vorher schon eine Schnittfolge, so daß bei der späteren Präparation die Schnitte nicht zu sehen sind. Jetzt liegt als nächstes der Muskelkörper vor mir auf dem Tisch oder am Boden. Jetzt kann ich wieder das gleiche machen, das Tier erst mal bewegen, Skizzen von den Muskelformen machen usw..Nachdem ich mir dann systematisch bestimmte Muskelgruppen runterpräpariert habe, habe ich da einen Haufen Knochen zu liegen. Davon bau‘ ich mir im Grunde ein grobes Skelett wieder auf und bringe es in die Stellung, in der das Präparat sein soll. Dadurch habe ich immer die Sicherheit, daß ich mich nicht vergaloppiere, weil das Skelett ja stimmen muß.
Und dann fange ich an, mit dem Modellierton auf diesem Skelett Muskel für Muskel aufzutragen. Da gibt’s zwei Möglichkeiten: entweder ich bau das Ding von innen nach außen auf, so richtig schön anatomisch, bis ich zum Schluß das ganze Tier dazustehen habe. Oder es wird gleich in die äußere Form gebracht. Das setzt aber voraus, daß ich meine Studien gemacht habe, dazu muß man in den Zoo gehen und sich selber die Tierchen anschauen. Heutzutage kann man dazu auch sehr schön mit der Videokamera arbeiten und Bewegungsabläufe aufnehmen. Wenn Sie im Zoo sitzen und gucken sich das Tier an – da kann ich fünf Stunden davor sitzen! –, aber wenn ich nach Hause komme, weiß ich immer noch nicht: Wie setzt der Löwe eigentlich den Fuß exakt auf? Man hat zwar den Gesamteindruck, aber die Details fehlen.
Manchmal denke ich: Der Bildhauer hat es einfacher als wir, der richtet sich nach dem äußeren Umriß, während die Präparatoren die innere Form des Tieres rekonstruieren müssen. Nehmen Sie einen Braunbären, der sieht puschelig aus, der hat einen dicken Hals und einen schönen Bauch. Wenn man sich aber von dieser äußeren Form leiten läßt, dann kriegen Sie anschließend niemals das Fell rüber, das wird dann ein völlig unförmiges Gebilde. Wenn man dann das Tier fertig modelliert hat, dann kommt eine Klebeschicht rauf, die Haut wird regelrecht aufgeklebt. Das ist ein Prozeß, der relativ lange dauert. Die Haut liegt da wie ein großer Teppich und ich muß es ja um die runde Form anbringen, da gibt es erst einmal tausend Falten. Eine Woche oder vierzehn Tage während dieses Trockenprozesses muß man täglich mehrere Stunden an diesem Ding arbeiten, um immer wieder Korrekturen anzubringen.“
Dem Museumspräparator geht es im Endeffekt nicht um das Tier und seine individuelle Geschichte, wo dann sogar die (Glas-)Augenfarbe bis aufs I-Tüpfelchen stimmen müßte: Wie es bei einem Hund z.B. der Fall zu sein hätte, dessen Leiche sein sentimentales Herrchen bei einem privaten Präparator in Auftrag gibt.
„Daß man im Westen eine größere Vorliebe für Action-Präparationen hat als im Osten, liegt vielleicht an der Reizüberflutung. In Amerika hat man in Museen z.B. ganze galoppierende Herden – von Säbelantilopen etwa. Das ist, als wenn ich ein Fernsehbild anhalte. Eine eingefrorene Bewegungsphase. Wenn ich da eine Sekunde hinschaue, ist es phantastisch, und präparationstechnisch absolut genial gemacht, Hut ab auch vor der statischen Seite. Das sind ganz komplizierte Geschichten, so ein galoppierendes Tier zu zeigen. Aber es ist eine eingefrorene Phase, die eigentlich das Ding nicht bringt. Unser Auffassung, die der ‘Berliner Schule’ kann man sagen, ist so: Wenn ich z.B. ein Reh habe und will da eine Spannung reinbringen – das Tier ist gelaufen, hat also eine Schrittfolge gehabt, dann am Boden geäst und plötzlich hat es ein Geräusch gehört, nimmt den Kopf hoch, macht sich relativ lang und hat also dieses Äugen in die Gegend, und ist dabei schon so weit gespannt, daß es im nächsten Augenblick abspringen könnte. Also man ahnt, daß jetzt gleich etwas passieren könnte, aber das Reh kann genauso gut auch im nächsten Moment feststellen: Es ist nichts – und weiter äsen. Es muß da eine Zeitebene drin sein und es muß auch eine Geschichte erzählt werden – an diesem Tier. Man möchte doch den Besucher überraschen: Was könnte aus der Sache werden. Man muß sich mit dem Tier auch identifizieren können.”
Als die Chinesen 1980 dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt eine Pandabärin namens Tjen Tjen schenkten, der sie an den Westberliner Zoo gab, protestierte Moskau, weil Westberlin nicht Teil der BRD war. Tjen Tjen starb 1984 an einer Virusinfektion. Im Tieranatomischen Theater auf dem Biologie-Campus der Humboldt-Universität stellte der chinesische Künstler An-Chi Cheng 2016 im Rahmen einer Ausstellung über “Mensch-Tier-Beziehungen” Tjen Tjen aus: Sie zeigte vom ersten bis zum letzten verschenkten Pandabär, was die chinesische Regierung in den Jahren ihrer “Panda-Diplomatie”, die 1982 aufgrund weltweiter Proteste von Tierschützern beendet wurde, damit alles erreicht hatte, vornehmlich im “Ostblock”: an Verträgen, Handelsbeziehungen usw.. Chefpräparator Matzke hat dann auch die im Westberliner Zoo 2007 und 2012 gestorbenen Pandabären Yan Yan und Bao Bao ausgestopft. „Die Luftfeuchtigkeit darf nicht schwanken und die Vitrinen müssen so dicht sein, dass an keiner Stelle ein Schädling eindringen kann“, erklärte er der „Welt”, „dann können sie locker mehrere hundert Jahre alt werden“.
Zu den berühmten Tieren im Naturkundemuseum zählt auch der im Zoo einst beliebte Gorilla „Bobby“, er befindet sich ebenfalls in einer Glasvitrine. Bei Bobby erstmalig die aus der Anatomie entlehnte Paraffin-Methode an, die den Affenstar von damals zu einem bis heute beeindruckenden Meisterwerk der Dermoplastik werden ließ. Das Verfahren, so erklärt uns Chefpräparator Matzke, sei konservationsgeschichtlich sehr bedeutsam gewesen, eine Art Revolution in der Kunst, tote Tiere mit ihren individuellen Gesichtszügen für die Nachwelt zu erhalten. „So eine Affenhaut ist ja sehr nackt. Bei Tieren mit langen Haaren oder dicken Federn sieht man die Haut im Original nicht, die kann ich verstecken, wenn sie etwas geschrumpft, verknittert oder pergamentartig geworden ist. Bei einem Menschenaffengesicht geht das nicht, die Schrumpfungsrisse können nicht kaschiert werden. Da hat der damalige Präparator Kästner diese Methode entwickelt, mit der das Wasser über eine Alkoholstufenreihe aus dem Gewebe gezogen und dann Paraffin anstelle von Wasser in die Haut gebracht wurde.“ Das Resultat kann sich heute noch, neben den lebendigen Gorillas im Zoo, sehen lassen.
Es gibt dort ferner einen präparierten Schwarm Fische. An ihrer Vitrine wird dazu erklärt: „Bei einem Fischschwarm fertigt man nur einen Abguß an, der mehrmals abgeformt wird, woraus dann Silikonpositive gemacht werden, die man sich hinbiegen kann.“ Die meisten Fische kann man auch lebend kaum voneinander unterscheiden. Mimiklos verkörpern sie zunächst ähnlich den Silikon-Exponaten „Typen“. Der Chefpräparator des Naturkundemuseums Detlev Matzke erklärte uns zu den Fischpräparaten: „Wir haben einen eigenen Präparator, der sich mit Fischabgüssen beschäftigt. Das hier sind alles Abgüsse. Man kann einen Fisch auch mit Haut und Schuppen präparieren. In beiden Fällen ist es so, daß sich die Farbe, die der Fisch hat, nicht erhalten läßt, die geht in jedem Fall verloren, er muß also hinterher bemalt werden. Da streiten sich die Geister: der eine möchte unbedingt das Original haben, dem ist es ganz wichtig, daß es der Originalfisch ist, der andere möchte lieber einen Abguß vom Fisch haben, weil die Struktur beim Vertrocknen nicht wegfällt. Beim originalen Fisch liegt ja ohnehin eine Schleimschicht drüber, die sich sowieso verliert. Wenn ich also den Originalfisch nehme und dessen Schuppen bemale, dann sehe ich hinterher auch bloß die Farbe und nicht mehr die Schuppen. Wir haben uns hier im Museum entschieden, mit Abgüssen zu arbeiten. Der Museumsbesucher kann das kaum unterscheiden – da kommt immer als erstes die Frage “Ist das Ding echt?” und wenn dann gesagt wird “Nein, das ist ein Abguß”, dann ist es nicht mehr interessant. Das Original hat bei vielen eine ganz andere Bedeutung noch.
Es gibt eine Technologie, die sich noch nicht so ganz durchgesetzt hat und die auch sehr kompliziert ist, die nennt sich Dermoplastik ohne Haut. Bei borstigen, sehr kurzhaarigen Tieren geht das sehr gut, bei einem Stachelschwein z.B. Da wird das fertig präparierte Tier mit einer Paraffinschicht umhüllt, dann trenn ich das Tier durch, und dann habe ich die Haut mit den Haarwurzeln in der Paraffinschicht drinne. Diese Schicht kann ich dann wegätzen. Dann bleiben nur noch die Haarwurzeln in dieser Kappe gehalten. Da rein läßt sich jetzt ein Kunststoff eingießen und dann füg ich das Ding wieder zusammen. Anschließend steht es als Kunststofftier da mit den Originalhaaren. Den Kunststoff kann ich einfärben. Ich habe also überhaupt kein Problem mehr, daß das Tier später mal reißt, es kann auch nicht mehr schrumpfen. Es ist ein Stück Plastik mit Originalhaaren.
Bei den Fischen ist das ähnlich. Es geht dabei ja nicht darum, zu zeigen, daß ist jetzt der Karpfen Kuno aus dem und dem Teich, sondern darum, eine bestimmte Form zu zeigen, die typisch sein muß für den Karpfen. Wir wollen ja in der Museumspädagogik ganz andere Sachen mit rüberbringen: Wir wollen darauf aufmerksam machen, welche Körperform hat er, wird er schnell schwimmen oder langsam, ist es ein Friedfisch oder hat er kräftige Zähne…Das kann man über ein naturgetreues Modell viel besser machen als mit einer Originalpräparation eines Fisches, wo ich immer aufpasssen muß, daß die Luftfeuchtigkeit nicht zu sehr abfällt im Winter und ich hinterher Risse habe und das Ding auseinanderfällt.“
Neben den Trockenpräparaten gibt es im Naturkundemuseum auch noch eine „nasse“ Fischsammlung, deren Grundstock einst Dr. Marcus Elieser Bloch im 18.Jahrhundert zusammentrug, „Millionen Fische, Reptilien, Krebs- und Spinnentiere, seit Humboldts Zeiten in aller Welt gesammelt, konserviert in 80 Tonnen reinem Ethanol, verteilt auf knapp 260.000 Gläser,“ schrieb die Berliner Morgenpost.
2014 bekamen die etwa 50000 Fische einen eigenen Saal: Gut ausgeleuchtet stehen da nun alle ihre Gläser auf hohen Metallregalen und mittendrin befindet sich der aus Brandschutzgründen bloß fiktive Arbeitsplatz eines Fischforschers. Als Besucher kann man nur außen herum gehen und beeindruckt sein über die vielen Fische – in so einer modernen Museums-Inszenierung. In der Aufsatzsammlung „Wissenschaft im Museum“ (2014) der Wissenschaftshistorikerinnen Margarete Vöhringer und Anke te Heesen kritisiert letztere diesen neuen „Raum voller Gläser“, in dem „nicht das einzelne Objekt hervorgehoben und mit einer Erklärung versehen“ wird, sondern „ihr Erscheinen als Menge im Vordergrund“ steht. In den Naturkundemuseen wird die „Natur mithilfe toter Gegenstände dargestellt, ihre Präsentationen aber sollen das Leben selbst symbolisieren.“ Aus der Warte des naturkundlichen Objekts stellt der Raum mit den Fischgläsern ein „Unterforderung“ dar. Von der Warte allein des Atmosphärischen her stellt er jedoch eine Überforderung dar, „denn was sollen wir auswählen, was besonders intensiv betrachten, woran uns orientieren?“ fragt Anke te Heesen. Hier wurde mit großer Geste leichtfertig der Museumsauftrag Vermittlung von Wissen zugunsten einer künstlerischen Rauminstallation fallen gelassen, das Feuilleton lobte dann auch prompt den Verzicht auf „die sonst übliche Museumspädagogik“.
.
Papageien-Kollektion des amerikanischen Natural History Museums
.
Algen
Blaualgen sind weder Pflanzen noch Tiere, sondern Bakterien. Wenn sie kugelige Kolonien bilden, nennt man sie „Teichpflaumen“, wenn es bei ihnen zur „Algenblüte“ kommt, werden sie giftig (was jetzt in der Oder geschah). Einige dieser heute „Cyanobakterien“ genannten Algen betreiben einen im Tag-Nacht-Rhythmus wechselnden Stoffwechsel: tagsüber Photosynthese und nachts Stickstofffixierung. Dies ist laut Wikipedia „nach heutigem Wissensstand einmalig“.
Kieselalgen sind einzellige Algen, auch Diatomeen genannt, die sich mit einer Zellhülle aus Siliziumdioxid umgeben, deswegen heißen sie Kieselalgen. Die Art „Thalassiosira pseudonana“ war der erste marine Mikroorganismus, dessen gesamtes Genom sequenziert wurde. „Geo“ nennt diese Art eine „Chimäre“, weil sie wie wir Harnstoff produziert, aber über einen pflanzlichen Fettstoffwechsel verfügt. Die chemische Verbindung des Harnstoff nutzt die Kieselalge als Energiequelle. Zum Fettabbau verfügt sie über zwei unterschiedliche Methoden: In ihren Mitochondrien, den Zell-„Kraftwerken“, findet sich ein Abbauprozess, wie er auch bei Tieren abläuft. In anderen Organellen zerlegt die Alge Fettsäuren wie eine Pflanze. „Hier scheint die Grenze zwischen Tier- und Pflanzenreich zu verschwimmen.“ Einst hatte die Kieselalge andere Einzeller „in sich aufgenommen“: Ein internationales Forscherteam fand sie als Organellen, die wohl aus einer Symbiose mit Rotalgen stammen.
Auch bei der einzelligen Grünalge Chlamydomonas reinhardtii wußte man lange nicht, ob sie eine Pflanze oder ein Tier ist: Einerseits verfügt sie, um Photosynthese zu betreiben, über Chloroplasten, die einen roten „Augenfleck“ haben, andererseits hat sie zwei Geißeln, mit denen sie sich lichtgesteuert fortbewegen kann. Zwei US-Biologen haben laut FAZ in einer Analyse der Proteine von C. reinhardtii festgestellt, dass sie „mehr Pflanze als Tier“ ist. Was sie von Pflanzen unterscheidet, sind „Gene für die Ausbildung des Bewegungsapparates“. Von den Menschen unterscheidet sie sich durch „1879 Proteinfamilien“, die nur Pflanzen besitzen. Diese einzellige Alge kann sich in kurzer Zeit in einen vielzelligen Organismus verwandeln.
Der italienische Bioingenieur Julian Melchiorri hat mit der Grünalge gebastelt. Heraus kam dabei ein „Lebendiger Algen-Kronleuchter“, der das Zimmer erhellt und angeblich so viel Sauerstoff wie 100 Hektar Wald produziert.
Eine Grünalge, die auf Spitzbergen vorkommt, wurde auf ihre Widerstandsfähigkeit getestet, indem man sie für 530 Tage an der Außenseite der internationalen Raumstation ISS anbrachte – sie überlebte.
Die holländische „Unterwasser-Autorin“ Mieke Zwamborn beschäftigt sich mit der Ästhetik von Algen. Dazu hat sie Herbarien von Algologen und die Algen-Poesie von Dichtern und Musikern studiert. In ihrem „Portrait ‘Algen’“ (2019) erwähnt sie Andreas Greiner, der in einem abgedunkelten Raum ein Salzwasseraquarium auf die Saiten seines Klaviers stellte, in dem „Meeresleuchttierchen, einzellige Algen, schwammen, die bei Vibrationen aufblitzen“. Ein anderer Musiker entlockte einer Wasserpflanze mit einem Unterwassermikrophon Töne: Sie werden hervorgerufen durch „Tausende kleine Sauerstoffbläschen,“ die von der Pflanze beim Wachstum abgegeben werden.
An der französischen Küste gab es bis Anfang des 20. Jahrhunderts Tangsammler, -mäher und -fischer. Sie trockneten die Algen und verbrannten sie. Die Asche brauchte man zur Herstellung von Schießpulver, das Kaliumcarbonat darin verwendete die Seifen- und Glasindustrie. Die Algen – Seegras bzw. Tang – wurden auch als Heilmittel für verschiedene Leiden sowie als Nahrungsmittel gesammelt. In Nordeuropa trieben die Bauern ihre Viehherden im Winter an den Strand, wo sie sich vom angeschwemmten Tang ernährten.
Die Japaner haben besonders viele Algen-Gedichte und -Gerichte: In ihrem Darm leben Bakterien, „die dasselbe stärkespaltende Enzym wie ein Meeresbakterium produzieren. Offenbar haben ihre Bakterien das Gen im Laufe der Zeit übernommen,“ schreibt der Spiegel. In Europa ißt man nun auch gerne Sushi, aber unsere Darmflora braucht noch eine Weile, bis wir die Algen darin ebenfalls verdauen können.
Carl von Linné zählte die Algen in seiner Systematik zu den „Verborgenblütern“, weil sie „auf eine für uns unsichtbare Weise blühen“. Um 1940 entdeckte eine britische Algologin jedoch den „komplexen Fortpflanzungszyklus der Rotalge“. In ihrer Heimat interessierte sich niemand dafür, wohl aber die Algenzüchter in Japan, denen damit schon bald nach dem Krieg eine lukrative Algen-Produktion gelang. 2017 trafen sich 120 Algenspezialisten zu einem Kongreß, „um die aufstrebende europäische Algenzucht und die Möglichkeit, Kraftstoff aus Algen zu gewinnen, voranzutreiben.“
In der Sowjetunion faßte man bereits ab 1933 Nutzungsmöglichkeiten für die Algen ins Auge – und zwar im ersten GULag auf den Solowezki-Inseln im Weissen Meer. Forschungsleiter war dort das Universalgenie Pawel Florenski. Als Ikonenverehrer begriff er die Zentralperspektive als eine „Maschine zur Vernichtung der Wirklichkeit“. Weil er in seinem Werk „Imaginäre Größen in der Geometrie“ Dantes „Göttliche Komödie“ mit der Relativitätstheorie interpretiert hatte, war er auf der Gefängnisinsel inhaftiert worden, wo er bei der Gewinnung von Jod und Agar-Agar aus Algen helfen sollte. Es gelang ihm, zehn Patente dafür anzumelden. Daneben hielt er dort fast täglich wissenschaftliche Vorträge über Algen und schrieb Briefe an seine Familie (2001 im Anthroposophenverlag Pforte unter dem Titel „Eis und Algen“ veröffentlicht). Im ersten Brief an seine Frau schrieb er: Eigentlich sei er mit seiner Isolierung auf Solowetzki am Ziel seiner Wünsche angelangt. Als Jüngling habe er immer davon geträumt, ins Kloster zu gehen, jetzt lebe er im Kloster, nur dass es eben ein Lager sei. Als Kind sei es sein sehnlichster Wunsch gewesen, auf einer Insel zu wohnen, Ebbe und Flut zu erleben und sich mit Algen zu befassen. „Nun bin ich auf einer Insel, hier herrscht Ebbe und Flut, und ich habe mit Algen zu tun“.
Pawel Florenski
Pawel Florenski studierte ab 1900 in Moskau Mathematik bei Nikolai Bugajew, Philosophie bei Sergej Trubezkoi und Psychologie bei Lew Lopatin, 1904 kam er in Kontakt mit der literarischen Gruppe der Symbolisten, Andrej Bely legte ihm eine Beschäftigung mit der Anthroposophie nahe, daneben las Florenski Goethe, schließlich wandte er sich einem geistlichen Führer, dem Starez Isidor, zu. 1910 heiratete er die Bauerntochter Anna Michailowna Giazintowa, aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor. 1911 wurde er zum Priester geweiht, er lebte jedoch von Veröffentlichungen, Vorträgen und Lehrtätigkeiten. 1920 übernahm er die Leitung der Forschungen zur Anwendung von Kunstharz in der Elektrotechnik in der Moskauer Fabrik „Karbolit“. In seinen Schriften kritisierte er die Zentralperspektive, die er zugunsten der Ikonenmalerei verwarf, weil jene „eine Maschine zur Vernichtung der Wirklichkeit“ sei, während jene ein „synarchisches Feld“ zu denken erlaube. 1922 erschien sein Buch „Imaginäre Größen in der Geometrie“, an dem er 20 Jahre gearbeitet hatte und das u.a. von Ossip Mandelstam, Wsewolod Iwanow, Maxim Gorki, Jewgeni Samjatin und Michail Bulgakow gelobt wurde, die offizielle Kritik monierte dagegen insbesondere das Schlußkapitel, in dem er das Weltbild in Dantes „Göttlicher Komödie“ mit Hilfe der Relativitätstheorie interpretierte. Dies wird später einer der Anklagepunkte sein, die zu seiner Verhaftung und Inhaftierung führen, obwohl die Zensur etliche Passagen darin vor Drucklegung gestrichen hatte, worüber er sich in einem Brief „An die Politabteilung“ beschwerte.
Von 1925 bis 1933 ist Florenski Leiter der Abteilung für Materialkunde am Staatlichen Forschungsinstitut für Elektrotechnik. 1928 wird er jedoch vorübergehend verhaftet: Man wirft ihm vor, unter dem Deckmantel wissenschaftlicher Arbeit religiöse Propaganda betrieben zu haben, er wird nach Nishni Nowgorod verbannt, wo er im Radiolaboratorium arbeitet. Gorkis erste Frau, Jekaterina Peschkowa, bemüht sich als Leiterin des Politischen Roten Kreuzes um seine Rückkehr nach Moskau“. Sie hat schließlich Erfolg. 1930 holt man Florenski als stellvertretenden Direktor für Wissenschaft ans Allunionsinstitut für Elektrotechnik in Moskau. Am 25. Februar 1933 wird er jedoch erneut von der GPU verhaftet und schon einige Monate später wegen „Konterrevolutionäre Agitation und organisierte konterrevolutionäre Tätigkeit“ zu zehn Jahren Zwangsarbeit an der Baikal-Amur-Magistrale in Ostsibirien verurteilt, wo man ihn dann der Abteilung für wissenschaftliche Forschung zuteilt. 1934 überführt man ihn ins Amurgebiet, auf eine Versuchsstation zur Erforschung von Dauerfrostböden. In Moskau versucht derweil die Familie, seine Freilassung zu erwirken. Der tschechoslowakische Botschafter in Moskau bietet an, den Verurteilten in seinem Land aufzunehmen, Florenski lehnt jedoch unter Berufung auf den Apostel Paulus (Phil. 4,11) ab: „…ich habe gelernt, worin ich bin, mir genügen zu lassen“.
Im Herbst 1934 überführt die GPU ihn auf die Solowki-Inseln im Weißen Meer, dem ersten bolschewistischen Straflager. Er soll sich dort mit Meeresalgen befassen und beim Aufbau einer Fabrik zur Gewinnung von Jod und Agar-Agar aus Algen helfen. In den darauffolgenden dreieinhalb Jahren gelingt es ihm, dafür zehn Patente anzumelden. Daneben hält er dort fast täglich wissenschaftliche Vorträge und schreibt Briefe (vier im Monat sind ihm erlaubt) vor allem an seine Kinder, seine Frau und seine Mutter – über 150 insgesamt. Sie wurden auf Deutsch 2001 im Dornacher Anthroposophenverlag Pforte veröffentlicht unter dem Titel „Eis und Algen“, herausgegeben von Fritz und Sieglinde Mierau, die daneben auch für eine zehnbändige Ausgabe seiner Werke im Berliner Kontext-Verlag verantwortlich sind.
In ihrem Vorwort zu dem Band mit „Briefen aus dem Lager“ heißt es an einer Stelle: „Kein Wunder, schreibt Florenski einmal seiner Frau, wenn bei so vielen ein- und ausgehenden Briefen die Zensoren an nervlicher Zerrüttung litten. Und: Eigentlich sei er mit seiner Isolierung auf den Solowki-Inseln am Ziel seiner Wünsche angelangt. Als Jüngling habe er immer davon geträumt, ins Kloster zu gehen, jetzt lebe er im Kloster, nur dass es eben zum Lager gehört. Als Kind sei es sein sehnlichster Wunsch gewesen, auf einer Insel zu wohnen, Ebbe und Flut zu erleben und sich mit Algen zu befassen. ‚Nun bin ich auf einer Insel, hier herrscht Ebbe und Flut, und ich werde bald mit Algen zu tun bekommen‘.“
Nachdem jedoch die Algenerforschung sowie die Jod- und Agar-Agar-Testproduktion auf den Solowki-Inseln erfolgreich verlaufen ist, wird das Projekt aufs Festland verlagert – und Pawel Florenski erschossen: am 8. Dezember 1937. Er wurde 55 Jahre alt. 1959 wird er offiziell rehabilitiert, 1989 wird seiner Familie eine Sterbeurkunde ausgestellt. Inzwischen hat die orthodoxe Kirche ihn heilig gesprochen.
Brief v. 26.11. 1934 (an seinen Sohn Michail)
Lieber Mik…
Es gibt hier viele Algen und wohl auch Muscheln. Die Stürme werfen die Algen (oder „Meerespflanzen“, wie man sie auch nennt) auf den Strand, so daß sich Wälle von mehreren Kilometern Länge, 1 1/2 Metern Höhe und mehreren Metern Breite bilden. Diese Meerespflanzen sind eßbar (giftige gibt es gar nicht), aber ihre Zubereitung ist ziemlich kompliziert. In manchen Ländern werden sie leicht angekocht, dann getrocknet und so gegessen, aber das schmeckt nicht besonders. In Amerika, Japan, China, Indochina, England, Schottland u.a. Ländern werden Algen sehr viel gegessen, man macht die verschiedensten Dinge daraus. Konfekt, Konfitüre, Blancmanger [Mandelpudding], Kissél [Fruchtpudding], Speiseeis, Salate, Soßen, Sauermilchpudding, ich glaube sogar Gebäck. Bei uns sind wir noch nicht soweit, die Algen auf diese Weise zu verwenden, wir stellen aus ihnen nur Jod her. Man kann aus Algen viele verschiedene technisch wichtige Stoffe gewinnen: einen besonderen Klebstoff, das Algin, dann Zellulose, Mannit, verschiedene Lösungsmittel für die Lackindustrie, Kalisalze usw. Vorerst wird aus den Algen aber nur Jod gewonnen; die Algen werden zu Asche verbrannt, dann wird die Asche in Lauge gewaschen und in diesem Wasser das Jod aus dem Kaliumjodid freigesetzt. Die Asche enthält auch noch Chlorkalium, schwefelsaures Kalium, Soda, Bromkalium und andere nützliche Stoffe. Ich küsse Dich innig, lieber Mik. Folge Mamma, sei lieb zu ihr und vergiß Deinen Papa nicht.
Brief v. 3.12. (an seine Frau Anna)
Liebe Annulja…
Die Werkstatt, in der ich arbeite, befindet sich am Ufer ddes Blagopolutschied-Hafens. Es ist eine armselige kleine Werkstatt, an deren Tür das stolze Wort ‚LABORATORIUM‘ prangt. Das steht zwar nur auf dem Schild, aber es ist doch befriedigend, es beim Eintritt zu lesen. Manchmal bin ich aber auch in einem richtigen Laboratorium, es ist klein, aber für die Verhältnisse von Solowki recht anständig. Es liegt zwei Kilometer vom Kreml entfernt im Wald am Ufer eines Sees.
Brief v. 14.12. (an seinen Sohn Kirill)
Lieber Kirill…
– Ich teile Dir eine Beobachtung mit, die ich gemacht habe, ich glaube, sie kommt in der Literatur nicht vor. Sie ist von Bedeutung für die Mineralogie, etwas Analoges zum Alexandrit. Es handelt sich um folgendes: Bei der Jodgewinnung nach dem sog. Bichromatverfahren wird der Extrakt aus Algenasche mit Bichromat und Schwefelsäure behandelt. Diese Lösung zeigt sowohl vor als auch nach der Entfernung des Jods je nach Art der Beleuchtung eine Zweifarbigkeit. Bei abendlicher (künstlicher) Beleuchtung, zum Beispiel bei elektrischem Licht, ist die Lösung von violett-purpurner Farbe, bei Tageslicht dagegen ist sie smaragdgrün. Der Unterschied in der Farbe ist so verblüffend, daß man nicht glaubt, es handle sich um ein und dieselbe Flüssigkeit. Da das Jod hier keine Rolle spielt, zeigt sich vermutlich der Unterschied auch bei einer sehr schwachen Lösung von Bichromat und Schwefelsäure. Man kann aber auch versuchen, Kalium-Jodid hinzuzufügen, das das Bichromat auflöst und zu anderen Chromverbindungen führt. Dieser Versuch ist so schön, daß es sich lohnt, ihn nachzumachen, um das mit eigenen Augen sehen zu können. Vermutlich kann man durch eine Veränderung des Mediums erreichen, daß das Purpurviolett ind Rot übergeht. – Küß Mama und die Kinder und sag ihnen, daß ich ihnen in Kürze einzeln schreiben werde.
Brief v. 14.12. (an seinen Wohn Wassili)
Lieber Wasjetschka…
Im Augenblick denke ich (privat, das gehört nicht zu meinen dienstlichen Aufgaben) über den Aufbau einer komplexen Produktion hier nach, eines ganzen Kombinats zur Gewinnung von Brom aus Meerwasser unter Ausnutzung der Wind- und Gezeitenenergie, über einen wohlabgestimmten Zyklus verschiedener Prozesse und Produkte. Ein schöner Plan, aber ehe ein Projekt daraus wird, ist noch viel Arbeit nötig, leider braucht man auch Bücher, die hier nicht vorhanden sind. Dennoch werde ich mit einigen Spezialisten über die Sache nachdenken. Dann prüfe ich nach und nach verschiedene Varianten der Gewinnung von Jod und anderen Produkten aus Meeresalgen. Die Beschäftigung mit den Algen und dem Brom verspricht interessante Ergebnisse, die in engem Zusammenhang mit meinen Arbeiten über die Elektromaterialien stehen.
Brief v. 21/22 6. 1935 (an seinen Sohn Wassili)
Lieber Wasjutschka…
Im Augenblick studiere ich die Alginate, speziell das Natrium- und Kaliumalganit, die ich aus Algen gewinne. Diese Stoffe können das importierte Tragant und Gummiarabikum sehr gut ersetzen, u.a. in der Textilindustrie beim Stoffdruck u..ä. Ihre Bindekraft ist erstaunlich: Eine 8%ige Alginatlösung hat eine bedeutend höhere Bindekraft als eine 32%ige Gummiarabikumlösung, ist also mehr als 4mal so ergiebig, ganz zu schweigen vom Preisunterschied. Andererseits ist ihre Kapillaritätskonstante nur etwa halb so groß wie die des Gummiarabikums, daher werden selbst schwache Lösungen in bedeutend geringerem Maße aufgesogen, was wiederum von großem Vorteil ist sowohl in bezug auf den Materialverbrauch als auch auf die Druckqualität. Die Messungen der physikalisch-chemischen Konstanten müssen mit improvisierten Geräten vorgenommen werden. Bei meiner mathematischen Bearbeitung der Meßergebnisse habe ich einiges gefunden, was von der Kolloidchemie bisher nicht geleistet worden ist….Ich küsse Dich, mein Lieber
Brief v. 5./6.9. (an seine Frau Anna)
Liebe Annulja…
Im Augenblick arbeite ich in dem neugeschaffenen Konstruktionsbüro; ich bin hauptsächlich damit beschäftigt, eine Reihe unserer Erfindungen auf dem Gebiet der Algenverarbeitung und der Nutzung von Algin und Alginat zum Patent anzumelden. Außerdem sind ein paar Artikel zu schreiben. Und bald werde ich mich mit dem Projektieren von Chemischen Fabriken zu befassen haben…
Brief v. 24./25. 9. (an seinen Sohn Michail)
Lieber Mik…
Ich lebe hier wie auf Jules Vernes ‚Geheimnisvoller Insel‘ – alles muß selber ausgedacht und aus fast nichts hergestellt werden, nichtsdestoweniger ist dabei etwas herausgekommen. Habt ihr die Natriumalginatblättchen erhalten? Das ist ein Algenprodukt, esläßt sich auf die erstaunlichste Weise verwenden, davon werde ich Dir in den nächsten Briefen erzählen…
Brief v. 15.11. (an seine Mutter)
Liebe Mamotschka…
In letzter Zeit haben mich die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten eines Algenprodukts, nämlich des Algins, beschäftigt. Es sind unzählig viele, ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche, die da in Frage kommen. Vielleicht sind einige der von mir aufgespürten längst bekannt, und da ich keinen Zugang zur Literatur habe, entdecke ich sie noch einmal. Ich stelle Pauspapier her, verschiedene Arten Zeichen- und Malpapier, Packpapier, Papier für Ölmalerei u.ä., dann Farben, Fixative, Leim, Substanzen zum Beschichten verschiedener Oberflächen usw. Insbesondere reparieren wir alte Gummischuhe und gießen Stiefelnähte aus, damit sie wasserdicht sind. Ich habe 4 Artikel für die Zeitschrift des BBK geschrieben, weiß aber nicht, ob sie sie dort drucken können, denn sie sind ziemlich lang. Ich schreibe unzählige Notizen für Wandzeitungen zu verschiedenen technischen Fragen, vor allem im Zusammenhang mit Algen.
Brief v. 16-23.12. (an seine Frau Anna)
Liebe Annulja…
Ich bin gesund, leide an nichts Not, arbeite im Laboratorium mit Algen und Sphagnum und lebe unter erträglichen Bedingungen, halte Vorlesungen über Mathematik, schreibe allerhand technische Notizen, bin den ganzen Tag von morgens bis spät in die Nacht beschäftigt – das ist Pflicht und ist zugleich nützlich für mich, es erstickt die Sehnsucht.
Brief v. 7-11.1. 1936 (an seine Frau)
Liebe Annulja…
Meine Arbeit geht in der gewohnten Richtung weiter, ist aber durch die Ausdehnung der Experimente etwas komplizierter geworden. Wir sind schon halbwegs am Produzieren und rechnen täglich mit 2-3 kg Algin und 2 kg Agar. Schon für diese Menge müssen bedeutende Massen Rohstoff verarbeitet werden und damit große Wasserbottiche vorhanden sein. Der Rohstoff wird in Wasser aufgekocht, dann filtriert, gefroren, wieder aufgetaut, eingedampft und getrocknet, das erfordert Aufmerksamkeit, eine entsprechende Apparatur, die allerdings sehr einfach ist, eine riesige Menge verschiedener Gefäße usw. Da es sich bei diesen Vorgängen um Versuche handelt, muß ständig gewogen, gemessen, protokolliert, gerechnet und analysiert werden. Jede einzelne Operation ist nicht weiter kompliziert, aber im ganzen, wenn man bedenkt, wieviel Vorgänge aufeinander abzustimmen und welch große Mengen Rohstoff zu bewegen sind, ist es schon ein beachtliches Unternehmen. Neben den Versuchen halte ich Vorlesungen – 3mal zwei Stunden die Woche, und einmal muß ich zur Sitzung des BRIS (des Büros für Erfindungen).
Brief v. 7.-13.2. (an seine Frau Anna)
Liebe Annulja…
In diesen Tagen erblickten wir die Früchte unserer Mühen: Ein Konditor hier hat Marmelade auf der Grundlage von Agar aus unserer Produktion hergestellt und war mit dem Ergebnis höchst zufrieden. Auf die Marmeladenmasse kam 1 1/2% Agar, aber das war schon etwas zu viel, es genügen 1,2%, d.h. es entspricht gutem Auslandsagar. In letzter Zeit war es klar und kalt, genau das Richtige für unsere Versuche….Tag und Nacht wird ununterbrochen gearbeitet, und meine Gehilfen dürfen nicht ohne Aufsicht bleiben, sonst kommt es zu Versäumnissen.
Brief v. 24-25.3. (an seine Tochter Maria-Tinatin)
Liebe Tika…
Heute brachte man mir ganz frische Algen, die man mit einer besonderen Vorrichtung vom Grunde des Meeres unter dem Eis hervorgeholt hat (das Eis ist dieses Jahr nicht dick, 80 cm). Es sind fleischige, elastische große algen aus der Klasse der Braunalgen, der Ordnung der Laminarien. Sie heiße Laminaria digitata, d.h. Fingerlamelle, weil das ‚Blatt‘ der Alge einer riesigen Hand mit gespreizten Fingern ähnelt. Außerdem gibt es Laminaria saccharina, d.h. Zuckerlamelle, sie ist ziemlich süßt. Ich habe sie gekostet, sie ist recht fest, aber äußerst schmackhaft, leicht salzig, erinnert an Sauerkraut, nur daß sie nicht sauer schmeckt. Die Algen saugen sich (mit ihren Rhizoiden, so etwas wie Wurzeln) an Steinen fest, um sich im Wasser Halt zu verschaffen, ernähren sich aber eigentlich nicht durch die Wurzeln, sondern sie nehmen ihre Nahrung über die ganze Oberfläche direkt aus dem Wasser auf. Von Mitte Juli bis Ende August vermehren sich die Laminarien mittels Sporen. Bei der Saccharina entwickeln sich die Sporen in der Mitte des ‚Blatts‘, bei der Digitata an den Blattenden. Die Sporen zeigen sich als einzelne rote Punkte, etwa wie beim Farn. Ich küsse mein liebes Töchterchen innig und erwarte die Ankunft der Möwen, um von ihnen etwas über mein Töchterchen zu erfahren.
Brief v. 8.-10.4. (an seine Frau Anna)
Liebe Annulja…
Du fragst nach den Algen. Deine Fragen lassen sich nicht mit einem Satz beantworten. Es gibt 13 Klassen von Algen; im Weißen Meer wurden von den 4 bedeutenderen Klassen 121 Arten und 129 Formen gefunden,…
.

Die Polizei prüft 1922 die Kleiderlänge von zwei Frauen, die zu viel Bein zeigen. Beim Zigarettenverkauft und -konsum war man damals weniger pingelig:

.
Chinesische Sternzeichentiere
Als Buddha die Erde verlassen wollte, rief er alle Tiere zu sich. Nacheinander kamen sie zu ihm, um sich zu verabschieden – in folgender Reihenfolge:
Ratte: Ich hatte mal einen zahme Ratte, die ich zusammen mit einem Meerschweinchen und einem Kaninchen auf einer Insel im Moor hielt, wo wir wohnten. Sie konnte aber schwimmen und tat das auch gerne, wenn sie nicht gerade die Insel untertunnelte oder schlief. Ursprünglich sollte sie im Aquarium des Bremer Überseemuseums an Schlangen verfüttert werden. Sie war weiß und tauchte gerne, wenn sie hochkam, war ihr Kopf voller brauner Pflanzenteile. Wir hatten den Eindruck, dass sie besonders gerne schwamm und tauchte, wenn wir Besuch aus der Stadt hatten, der davon sehr beeindruckt war. Für die Chinesen ist die Ratte im Tierkreiszeichen charmant, gesellig, einfallsreich.
Ochse: Gemeint ist ein Wasserbüffel. Der Autor Aravind Adiga erinnert sich: „An der Tür steht das wichtigste Familienmitglied: die Wasserbüffelkuh. Sie war bei weitem die Fetteste in unserem Haus, und so war es auch bei allen anderen Familien des Dorfes. Den ganzen Tag fütterten die Frauen sie mit frischem Gras; das Füttern war ihre Hauptbeschäftigung im Leben. Alle Hoffnungen dieser Frauen richteten sich auf den Leibesumfang der Büffelkuh. Gab sie genug Milch, konnten die Frauen etwas davon verkaufen, und am Ende des Tages war vielleicht ein bisschen Geld übrig. Sie war wohlgenährt, ihr Fell glänzte, über ihrem haarigen Maul stand eine Ader hervor, und von ihren Lefzen hingen lange, dicke, perlmuttfarbene Speichelfäden. Den ganzen Tag lag sie in ihrem dicken Scheißhaufen. Sie war die Haustyrannin!“ So gaben die Frauen z.B. Aravind Adigas Vater erst nach der Büffelkuh zu essen. Früh am Morgen band der Vater sie von ihrem Pfahl los und zusammen mit seinem Sohn brachte er das dicke Tier an einen Wassergraben, damit es sein Morgenbad nahmen konnte. „Die Büffelkuh watet hinein und kaut an den Seerosenblättern. Währenddessen geht über ihr, dem Vater, und mir und meiner Welt die Sonne auf. Es ist kaum zu glauben, aber manchmal vermisse ich diesen Ort.“ Die Männer arbeiten im Reisfeld mit Wasserbüffelbullen, die kastriert sind: Ochsen. Sie verkörpern die Eigenschaften stur, geduldig, beharrlich.
Tiger: Die amerikanische Dompteurin Mabel Stark arbeitete zeitweilig mit 20 Tigern. Sie meinte: „Tiger mögen nur Menschen, die einen stärkeren Willen als sie haben“. Mit dem von ihr großgezogenen Tiger „Rajah“ lebte sie in ihrem Wohnwagen zusammen, er schlief auch in ihrem Bett, ebenso wie ihr dritter Ehemann. In der Manege bestand ihre berühmteste Nummer darin, dass sie denTigern den Rücken zukehrte und Rajah sie plötzlich von hinten ansprang, zu Boden warf und mit ihr rang. Mit der Zeit entwickelte sich daraus bei dem Tiger ein Paarungsakt. Weil sein Samen auf ihrem schwarzen Lederkostüm unschön aussah, wechselte sie in ein weißes Kostüm, das sie bis zum Ende ihrer Karriere 1968 trug. Tiger werden in China als durchsetzungsfähig, abenteuerlustig und unabhängig charakterisiert.
Hase (2023): Hasen gibt es auf allen Kontinenten, sie leben im freien Feld und flachen Mulden. Neugeborene Hasen sind Nestflüchter, haben bereits Fell und können sehen. Häsinnen boxen laut WWF gerne mal einen Verehrer um. Und sie können zweimal gleichzeitig schwanger werden, bis zu 80 km/h schnell werden, drei Meter weit und zwei Meter hoch springen und sehr gut schwimmen. Sie sind quasi Wiederkäuer, d.h. sie kauen ihre ausgeschiedenen Kotkugeln noch einmal durch. Hasen lassen sich nicht zähmen. Auf der Flucht schlagen sie ihre typischen Haken, ändern also mehrfach abrupt die Richtung. In den budhistischen Ländern wird der Hase verehrt und wenn man einen sieht wird einem „ganz kühl ums Herz“. Sie werden dort als distanziert, klug, diskret charakterisiert.
Drache: Man sagt in China: ein Chinese ist ein Drache, zwei Chinesen sind ein Wurm, und bei den Japanern ist es umgekehrt. Unter den Tieren gibt es heute nur noch den kleinen bis zu 20 Zentimeter langen Flugdrachen, der in Südostasien lebt. Er ist ein Insekten fressender Baumbewohner. Die von den ausgebreiteten verlängerten Rippen getragene Flankenhaut wird als Flughaut benutzt, mit der er von Baum zu Baum gleiten kann. Ihn charakterisieren die Chinesen als aktiv, launisch und vielseitig.
Schlange: In der Volksbühne machten einmal fünf Pythonschlangen Theater. Die Pythons wirkten bühnenerprobt. Sie balancierten auf einer Bambusstange und bewegten sich langsam auf den Schultern ihres Besitzers Rainer Kwasi. Die größte, eine etwa fünf Meter lange gelbe Python, spielte die Hauptrolle in einem Film. Man sah, wie sie züngelnd die ganze Volksbühne erkundete – bevor sie sich im Roten Salon dem zahlreich erschienenen Publikum zeigte. Derweil erklärte man uns das multifunktionale Sinnesorgan ‚gespaltene Schlangenzunge‘, zudem habe die Python noch eine Art drittes Auge auf der Stirn, mit der sie etwa Infrarotstrahlen wahrnehmen kann. Im übrigen sei ihr gesamtes Sensorium so ausgeprägt, dass sie sehr feine Informationen über den Menschen wahrnehmen könne – „vielleicht mehr als wir über sie“ – die von den Chinesen als sensibel, unabhängig und ab und an als faul charakterisiert wird.
Pferd: Früher gehörte dem die Welt, der ein gutes Pferd und eine Stunde Vorsprung hatte. Heute sind Pferde aus Chrom und Stahl gemacht und kleine dicke Männer reiten sie. Nach wie vor gilt jedoch laut Adorno, dass „der Gestus Münchhausens, wie er sich und sein Pferd am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht, zum Schema einer jeden Erkenntnis wird, die mehr sein will als bloßer Entwurf.” Im Internet findet man dagegen mehrere Fotos, auf denen eine Reiterin verzweifelt versucht, ihr Freizeit-Pferd aus einem Sumpf zu ziehen, in dem es stecken geblieben ist. Pferde sind im Gegensatz zu Eseln Fluchttiere und drehen mitunter durch. Sie werden als aufmerksam, kontaktfreudig und eloquent charakterisiert.
Ziege: Von den Ziegen ist ein beträchtlicher Teil verwildert (frei). „Schafe zu bewachen ist ein Kinderspiel verglichen mit dem Ziegenhüten,“ meint der Ökologe Josef Reichholf. Er sieht einen Unterschied zwischen den zwei Tierarten vor allem in ihrem Grad an Eigensinnigkeit. Die schwäbische Schäferin Ruth Häckh bewundert Ziegen, aber „aus Sicht des Schäfers sind sie eigentlich unmöglich. Wie Schafe hüten lassen sie sich jedenfalls nicht, dafür sind sie zu ausgeprägte Individualisten.“ Schafe fressen Gras, Ziegen lieber Blätter, die sie sich suchen. Dazu springen sie über Zäune und plündern Gärten. Für Ruth Häckh gibt es „keinen wirtschaftlichen Grund, Ziegen zu halten. Sie tun aber der Seele gut, sie steuern sozusagen ein abenteuerliches Element bei“. Das trifft sich mit ihrer chinesischen Charakterisierung: kreativ, künstlerisch, großzügig.
Affe: Der französische Kardinal Melchior de Polignac soll zu dem im Jardin du Roi gezeigten Menschenaffen gesagt haben: „Sprich – und ich taufe Dich!“ Die indigene Dayakbevölkerung auf Borneo behauptet, dass diese von ihnen „Waldmenschen“ genannten Orang-Utan nicht sprechen, weil sie sonst arbeiten müssten. Die einheimischen Angolaner unterstellen den Schimpansen ebenfalls mutwilliges Schweigen. Der amerikanische Primatenforscher Robert Yerkes ging davon aus, dass sie unfähig sind, Gedanken durch Laute wiederzugeben, dennoch haben sie viel zu erzählen. „Vielleicht können sie sich eine einfache nichtlautliche ‚Zeichensprache‚ aneignen.“ Das taten sie auch: Schon bald gab es Menschenaffen, die über 100 Wörter in der Gebärdensprache beherrschten. Eine Primatenforscherin brachte einem Bonobo statt Handzeichen eine Reihe von Symbolen („willkürliche geometrische Formen“) auf einer elektronischen Tastatur bei, mit deren Hilfe sowie mit Gesten und Lauten er mit den Menschen kommunizieren sollte. „Eine Methode, die eine normale, gesellige Unterhaltung nicht gerade fördert,“ kritisierte der Gebärdensprachlehrer Roger Fouts, der eine „computerfeste Schimpansin“ namens „Lana“ erwähnt, die traurige Sätze wie „Bitte, Maschine, kitzel Lana“ tippte. Affen werden als einfallsreich, lustig und gesellig charakerisiert.
Hahn: Der Pater Athanasius Kircher hypnotisierte 1646 einen Hahn, danach auch noch andere Vögel, aber mit Hühnern war es am Leichtesten, so leicht, dass auch Leute wie Helmut Kohl, Al Gore und Werner Herzog es Kircher nachgemacht haben. . Einmal hypnotisiert, bleibt die Hühner solange liegen bis der Hypnotiseur sie ein paar Mal mit dem Finger anstupst. „Sie scheinen so etwas wie die Stars der Tierhypnose zu sein,“ schrieb die Nordwest-Zeitung, die gleich eine ganze Reihe von Hühner-Hypnotiseuren erwähnte. Aber wozu macht man so etwas Unsinniges? Wir hatten sechs Hühner und einen Hahn, der sehr umsichtig war. Er rief die Hennen, wenn er etwas zu fressen fand und verteidigte sie mutig gegen Feinde, aber nicht gegen uns: Dass wir den Hennen täglich die Eier aus dem Nest klauten und seine Schar sich deswegen nicht vergrößerte, nahm er schicksalsergeben hin. Als ordentlich, gewissenhaft und ehrenhaft wird er nicht nur in China charakterisiert.
Hund: Er kann zwar nicht so gut sehen wie wir, aber dafür viel besser riechen, was ein ganz anderes Weltbild ergibt als eines, das auf optische Eindrücke beruht. Nietzsche hatte wahrscheinlich recht, als er sagte: „Ich erst habe die Wahrheit erkannt – indem ich sie roch. Mein Genie liegt in meinen Nüstern.“ Was einige Engländer für die einzig angemessene Wahrnehmungsweise für einen Philosophen hielten. Inzwischen ist es jedoch mit unserem Geruchssinn nicht mehr weit her, deswegen nimmt man dafür gerne Hunde. Mit ihrer feinen Nase müssen sie immer mehr erschnüffeln: Trüffel, Drogen, Bomben, Vermisste, Leichen … Eigentlich kann man ihre Nase auf alles trainieren. Eine Gruppe in Deutschland phänomenologisch ausgebildeter US-Chefreporter um Robert Ezra Park gründete 1920 die Chicago School of Sociology, in ihr gehört das „Nosing Around“ bis heute zum Unterrichtsprinzip. Hunde werden in China als ehrlich, zuverlässig und fürsorglich charakterisiert – aber auch gegessen.
Schwein: „Als aufs Land geschickter jugendlicher Intellektueller hatte ich Schweine gezüchtet,“ schreibt Wang Xiaobo in seiner Geschichte eines Schweines, „das so geschickt wie ein Steinbock war, es prang mit einem Satz über den Zaun des Schweinestalls hinweg. Deshalb trieb es sich überall herum und blieb nie im Stall.“ Es war sein Lieblingsschwein, „weil es sich nichts vorschreiben ließ und solch ein freies und unbändiges Leben führte. Unsere Leiter veranstalteten speziell deswegen eine Sondersitzung und erklärten den Schweinbruder zum bösen Element, das die Frühlingsarbeit sabotiere. Sie beschlossen, Mittel der proletarischen Diktatur gegen ihn einzusetzen.“ Aber das Schwein konnte entkommen und mied fortan die Menschen. Xiaobo meint: „Nun habe ich vierzig Jahre gelebt. Außer diesem Schwein habe ich in meinem Leben noch kein anderes Wesen getroffen, das es wie dieses Tier gewagt hätte, dem vorgesehenen Leben die Stirn zu bieten. Ganz im Gegenteil, ich habe viele Menschen getroffen, die das Leben anderer mit Inhalten zu versehen versuchen und Menschen, die ein von anderen vorgegebenes Leben führen und damit glücklich sind. Aus diesem Grund kann ich dieses Schwein, das seine eigenen Wege ging, nicht vergessen.“ Schweine werden im chinesischen Horoskop als hilfsbereit, gefühlvoll und treu charakterisiert.
.
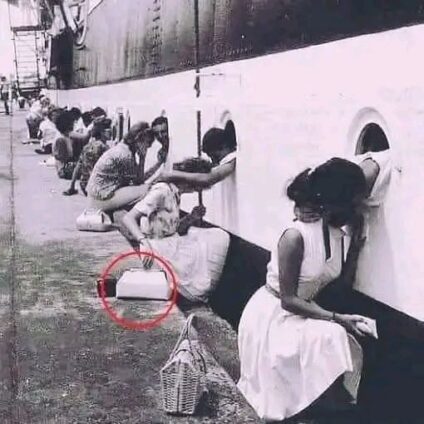
WKZwo: Bräute verabschieden ihre Männer, die in den Krieg ziehen. Was die rot eingekreiste Damentasche soll, weiß ich nicht. Nach dem Krieg geht das Leben irgendwie weiter: Badende an der Havel in den Fünfzigerjahren: