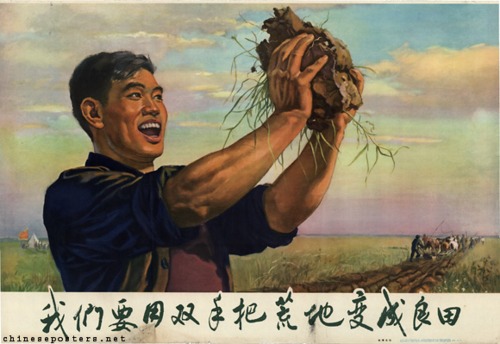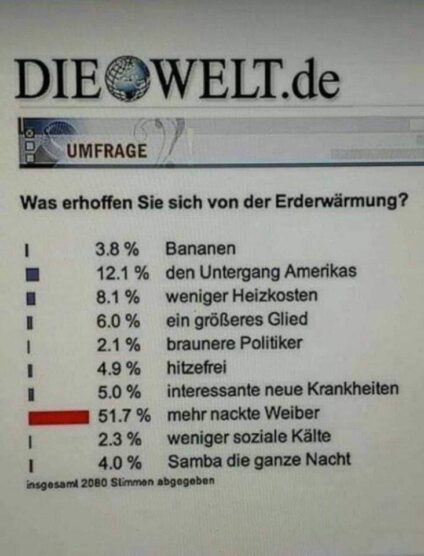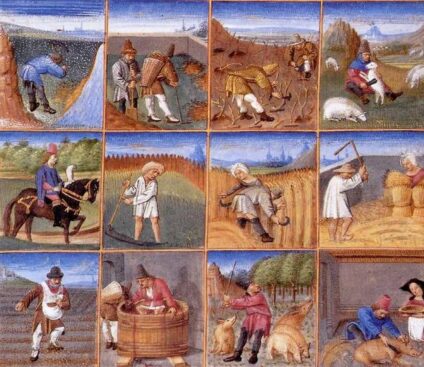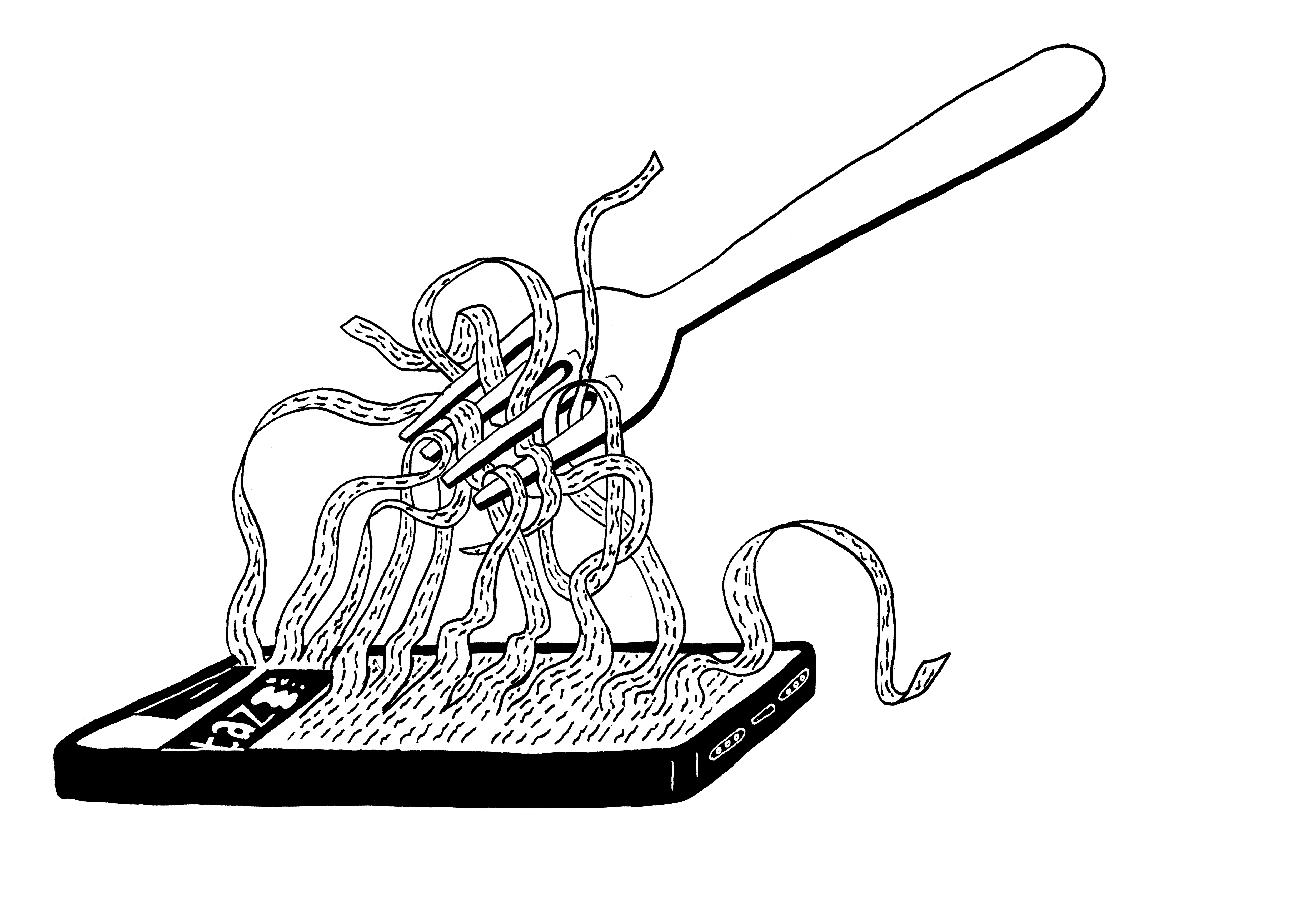Die Drei Mits
„Der größte Fehler“ der chinesischen kommunistischen Partei habe darin bestanden, so Ho Tschin Minh, dass sie nichts zur Vertiefung der chinesischen „Agrarrevolution“ getan, sondern im Gegenteil die „Bauernbewegung“ noch gebremst hätte. Die Partei hatte sich, gestützt auf ihre deutschen und russischen Berater aus der Komintern vor allem auf die Organisierung von Arbeiteraufständen in den großen Städten konzentriert. Diese waren blutig niedergeschlagen worden. Damals waren gerade mal 0,5% der chinesischen Bevölkerung Arbeiter. Noch heute ist China ein Agrarland. Der Bauer, das ist „das wirkliche China“, wie der Agrarutopist Peng Pai meinte. Nach der Niederschlagung der Arbeiteraufstände in den chinesischen Städten, die Inseln gleich in einem Bauernmeer lagen, reorganisierte der Bauernsohn Mao Tse-tung die kommunistische Partei auf dem Land neu – und orientierte dabei die Politik um – auf die Bauern und ihren Partisanenkampf.
Während der so genannten Großen proletarischen Kulturrevolution wurden später Millionen Intellektuelle und Kader, aber auch und vor allem die „gebildete Jugend“ aufs Land geschickt – unter der Losung der „3 Mits“: Mit den Bauern essen, mit den Bauern arbeiten, mit den Bauern diskutieren! Um die „3 Trennungen“ – von der Praxis, vom Volk und von der körperlichen Arbeit – zu überwinden. Die Kulturrevolution hatte eine große Ausstrahlung: im Westen wurde der Maoismus fast zu einer Mode. Einer, der ihn bis zu seinem Tod 2013 immer wieder – selbstkritisch, zerknirscht – ins Spiel brachte, war der taz-Redakteur Christian Semler, ehemals Vorsitzender der KPD. Dabei äußerte er stets sein Bedauern über die vielen chinesischen Gebildeten und Spezialisten, die damals über Jahre zu verblödender Landarbeit gezwungen wurden. Dies traf vor allem auf die als „Reaktionäre, Rechte Elemente und Revisionisten“ klassifizierten Intellektuellen zu, die teilweise über 22 Jahre aufs Land verbannt blieben, nämlich seit der „Anti-Rechts-Kampagne“ 1958, die auf die „Hundert-Blumen-Bewegung“ gefolgt war. Erst 1976 begann ihre Rehabilitierung, außerdem schaffte man die Pflicht zur Landarbeit vor dem Studium ab.
Wenig später – nach der Verhaftung und Verurteilung der „Viererbande“ – wurden auch schon die ersten literarischen Aufarbeitungen der Kulturrevolution – der zehn chaotischen Jahre, wie man sie nun nannte – veröffentlicht. Die Bücher darüber werden inzwischen als „Narben-Literatur“ bezeichnet. Sie wurden – aus naheliegenden Gründen: um Maos Irrweg aufzuzeigen – auch in Ost- und Westdeutschland gerne übersetzt und publiziert, insgesamt etwa 200. Man kann sagen, dass fast jeder Autor (die meisten waren Frauen) seine Landverschickung im Nachhinein anders empfand und beurteilte: Sie waren gerührt, wie freundlich die Bauern sie empfingen und alles mit ihnen teilten; sie waren angeekelt von deren Primitivität und losen Sitten; sie waren erstaunt, wie sehr die Bauern sie – als verzärtelte Stadtjugendliche – schonten; sie waren überheblich, weil sie gebildeter waren; sie fühlten sich von der Partei verraten und verheizt; sie schwangen sich zu Kulturarbeitern auf dem Land auf; sie wurden journalistische Ideologen für regionale Medien; sie wollten „diese wichtigen Jahre des Aufbaus“ nicht missen; sie empfanden ihre Landverschickung als verlorene Jahre; sie bissen die Zähne zusammen und hielten durch, weil sie nur dann anschließend studieren durften; sie fanden die Zeit ideal – für Hooligans; sie schämten sich, schmutzige Arbeit verrichten zu müssen (obwohl Mao lehrte, „dass Schmutz am Körper Sauberkeit im Kopf“ bedeute) usw..
.
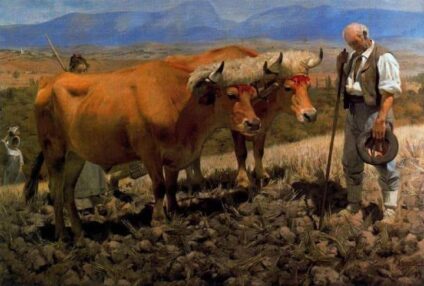
.
Scheiße
„Kuhmist ist wichtiger als Dogmen!“ (Mao tse Tung)
Mao war der Sohn eines wohlhabenden Bauern aus Hunan, u.a. wollte er erreichen, dass man in China der Rinderzucht mehr Bedeutung beimaß. In der chinesischen Landwirtschaft gab es nie genug Vieh, um mit deren Exkrementen die Felder zu düngen. Pferde für die Armee wurden aus der Mongolei eingeführt; bäuerliche Familien hielten ein bis zwei Schweine zur Selbstversorgung; wer keine Ochsen zur Feldbestellung besaß, spannte sich selbst vor den Pflug. Der Ausweg bestand aus menschlichen Exkrementen, die als Dünger aufbereitet wurden.
Während der Revolution 1927 bis 1949 schickten verschiedene Länder Kühe nach China zur Versorgung der hungernden Bevölkerung. Es gibt darüber einen Film von Guan Hu: „Cow“. Die Hauptrollen spielten Huang Bo – als Kleinbauer Niu Er – und seine friesische Milchkuh Duo Niu: Sie ist eine Spende aus Holland zur Verbesserung der Versorgung der Roten Armee. Es ist das Jahr 1940 im Dorf Yizhen. Alle Bewohner wurden in Krieg und Bürgerkrieg getötet, nur Niu Er und Duo Niu haben überlebt. Mal rettete der Bauer die Kuh, mal rettete sie ihn.
Vor der Revolution mussten Landarbeiter sich verpflichten, die Toilette des Gutsbesitzers zu benutzen. An den Landstraßen standen Töpfe. Sie wurden regelmäßig geleert. Fäkalien waren ein Handelsgut, man konnte sie portionsweise auf dem Markt kaufen. Unternehmer zahlten viel Geld, um die Exkremente ganzer Städte einzusammeln und an die Bauern zu verkaufen. Man wußte dort, weil jede Pflanze Humus verbraucht, muss er vor allem in der Landwirtschaft immer wieder ersetzt werden.
In den USA wußte man das vielleicht auch, aber es war einfacher, immer wieder neues Land unter den Pflug zu nehmen, d.h die Prärien nach und nach landwirtschaftlich zu nutzen. Bis es in den Dreißigerjahren zu verheerenden Dürren und Staubstürmen kam, wodurch die Böden Millionen Tonnen Humus verloren, die zuvor von den Wurzeln des Präriegrases vor Erosion bewahrt worden waren. Teile der fruchtbaren Great Plains in Kanada und den USA wurden zu einem „Dust Bowl“, einer Staubschüssel. Tausende von Farmer waren gezwungen, ihr Land aufzugeben. John Steinbeck hat diese Situation 1939 in seinem Roman „Früchte des Zorns“ geschildert.
Die amerikanischen Agrarexperten hatten jedoch schon Ende des 19. Jahrhunderts angefangen, sich über den Humusschwund Gedanken zu machen. 1909 bereiste der Leiter der Abteilung für Bodenbearbeitung im US-Landwirtschaftsministerium, Franklin H. King, mit einer Gruppe von Mitarbeitern China, Korea und Japan, um zu studieren, wie man in diesen Ländern damit umging. Sein begeisterter Bericht „4000 Jahre Landbau“ erschien 1911 (auf Deutsch zuletzt 1984).
Der Autor kommt darin zu der Überzeugung, dass die amerikanische Landwirtschaft unbedingt von der in China, Korea und Japan lernen muss. „In Amerika verbrennen wir ungeheure Mengen Stroh und Maisstrünke: weg damit! Kein Gedanke daran, dass damit wertvolle Pflanzennährstoffe in alle Winde zerstreut werden. Leichtsinnige Verschwendung bei uns, dagegen Fleiß und Bedächtigkeit, ja fast Ehrfurcht dort beim Sparen und Bewahren.“
Noch mehr galt das für den Umgang mit Fäkalien. Er wird nicht als Abfall begriffen und mühsam entsorgt, sondern auf Schiffen zusammen mit Schlamm auf Kanälen transportiert, an Land gelagert, dann in Gruben an den Äckern geschüttet, wobei man dazwischen Lagen mit geschnittenem Klee packt und „das Ganze immer wieder mit Kanalwasser ansättigt. Dies lässt man nun 20 oder 30 Tage fermentieren, dann wird das mit Schlamm vergorene Material über den Acker verteilt.“
Die US-Agrarwissenschaftler hielten die „landbaulichen Verfahren“ der Chinesen, Koreaner und Japaner, mit denen diese „jahrhundertelang, praktisch lückenlos alle Abfälle gesammelt und in bewundernswerter Art zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und Erzeugung von Nahrungsmitteln verwertet haben, für die bedeutendste Leistung der drei Kulturvölker.“
Wenn man sie studieren will, „muss man auf das achten, was uns die Hauptsache zu sein scheint, dass nämlich unter den Bauern, die die dortigen dichten Bevölkerungen jetzt ernähren und früher ernährt haben, richtiges, klares und hartes Denken Brauch ist.“
Zur Zeit des „Großen Sprungs nach vorne“ (1959-1961) gab es den Plan, auf einem Mu Land (667 Quadratmeter) 500 Kilo Getreide zu ernten, man brauchte daher eine Menge Dünger. Es gab dafür in der damaligen Zeit fast nur menschliche Exkremente. 2024 erntete man in China mit viel Kunstdünger auf einem Mu maximal 375,2 Kilo Sommergetreide, wie der Direktor der ländlichen Abteilung des Nationalen Statistikamtes Wang Guirong im Herbst des Jahres mitteilte.
Weil frische Exkremente kein Dünger sind, sondern Gift, das die Ernte zunichtemacht, beschloß man während der „Großen Sprungs“ auf den Sportplätzen tiefe, an Brunnenschächte erinnernde Gruben auszuheben und mit Exkrementen zu füllen, damit sie durch das Methan in der Erde fermentierten. Der 1952 in Peking geborene Schriftsteller Wang Xiaobo erinnert sich in seinem Bericht über „Das Goldene Zeitalter“ (2024): „Als wir klein waren, robbten wir vor bis zum Grubenrand und warfen brennende Streichhölzer hinein, fasziniert von der schwachen blauen Flamme, die dann an der Oberfläche züngelte. Nachts kniete ich andächtig am Grubenrand, um gebannt in die mysteriöse Flamme zu starren, vollkommen vergessend, dass sie das Produkt von Scheiße war.“
Der später als Soziologe tätige Xiaobo schreibt weiter: „Bedauerlicherweise brachte die sorgfältige Jauchegrubenanlage aber nichts, weil nach gelungener Fermentation niemand wußte, wie man das Zeug aus der Grube herausheben sollte, es war zu wässrig zum Schaufeln und zu zäh zum Schöpfen…Vor allem waren die Gruben verdammt tief. Wehe man rutschte ab und plumpste hinein; die Überlebenschancen tendierten gegen Null. Aus diesem Grund wurden die Gruben mitsamt dem wertvollen Dünger aufgegeben. Irgendwann wucherten sie zu und waren nicht mehr von der Umgebung zu unterscheiden, was sie zu gefährlichen Fallen machte.“ Einer von Xiaobos damaligen Mitschülern fiel tatsächlich aus Versehen hinein und erstickte.
Eine Kollegin von Xiaobo an der Peking-Universität, die er zitiert, erinnerte sich, dass in der Kaderschule noch ganze andere Scheißgeschichten aus der Zeit des „Großen Sprungs“ kursierten. Damals befanden einige der lokalen Kader, dass es zu lange dauerte, in den Grüben Dünger herzustellen: „Damit das mit der Fermentierung schneller ging, ließen sie in jeden Haushalt vor dem Essen erstmal einen Wok Scheiße aufkochen.“ Nachzulesen ist das in einer Abhandlung des Soziologen Prof. Shen Guanbao. Xiaobo fügte hinzu: „Die Geschichte von der gekochten Scheiße ist unabdingbar für die sorgfältige Aufarbeitung unserer verflossenen Jahre, denn sie bildet sozusagen den roten Faden dieser Jahre.“ Seine Übersetzerin Karin Betz erwähnt als eine ihrer Schwierigkeiten mit seinem Buch: In der chinesischen Alltagssprache gibt es mehr als 35 Worte für Scheiße.
Seit Deng Xiaopings Privatisierungsparole „Bereichert Euch!“ (1983) hat sich in China viel geändert, gerade auf dem Agrarsektor. Amerika lernte dabei nicht mehr von China, sondern umgekehrt. Erwähnt sei eine Nachricht auf „pflanzenforschung.de“ von 2010: „Aufgrund des übermäßigen Einsatzes von Stickstoffdünger werden Chinas landwirtschaftliche Flächen immer saurer und bringen immer weniger Ertrag. Laut Experten könnte das in Zukunft die Lebensmittelproduktion Chinas gefährden.“
Die Naturschutzorganisation Greenpeace ergänzte: „China hat seine Landwirtschaft mit großem Aufwand industrialisiert und mittlerweile einen Anteil von 34 Prozent am weltweiten Bedarf an Phosphor-Düngemittel. Die meisten werden im Land selber produziert.“ Und z.T. sogar exportiert.
Daneben wurde die Versorgung der Bevölkerung mit Fleisch, Schweinefleisch vor allem, durch Landkäufe im Ausland, u.a. in der Ukraine, verbessert: So erwarb China 100.000 Hektar Ackerland in der Schwarzerderegion, das auf drei Millionen Hektar vergrößert werden soll. Neben dem Futtermittelanbau sollen darauf vor allem Schweine für den chinesischen Markt gezüchtet werden. Die chinesische Agroholding China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO) ist einer der größten Arbeitgeber in der ukrainischen Landwirtschaft und einer der größten Investoren in deren landwirtschaftliche Infrastruktur (über 200 Milliarden Dollar seit 2008).
Die chinesische Landwirtschaft verbraucht heute rund 40 Millionen Tonnen Kunstdünger jährlich. In einer Wirtschaftsmeldung hieß es 2013: „Schlechte Nachrichten für die Kali+Salz AG. China steigt beim russischen Düngemittelriesen Uralkali ein und schürt damit neue Spekulationen über die Machtverteilung in der Branche. Da die Volksrepublik zu den größten Konsumenten von Kali-Düngern gehört, wird es aus Sicht von Experten wahrscheinlicher, dass Uralkali die Preise wie angekündigt drückt und dies durch größere Verkaufsmengen wettmacht – unter anderem in China.“
Damit dürfte die Scheiße von 1,42 Milliarden Chinesen wohl endgültig nur noch ein kostspielig zu entsorgender Abfall geworden sein – und ihr Land bald mit ähnlichen Humusverlusten wie in den USA vor hundert Jahren zu kämpfen haben. 2024 meldete u.a. „n-tv.de“: „In vielen Regionen Chinas senken sich die Böden – jedes Jahr um mehrere Millimeter.“ Der Deutschlandfunk berichtete bereits 2013, dass die Vergiftung der Böden in China zunehme: „Pestizide, Überdüngung, Industrieabwässer. Ein Großteil der Flächen, auf denen Nutzpflanzen angebaut werden, ist verseucht.“
.
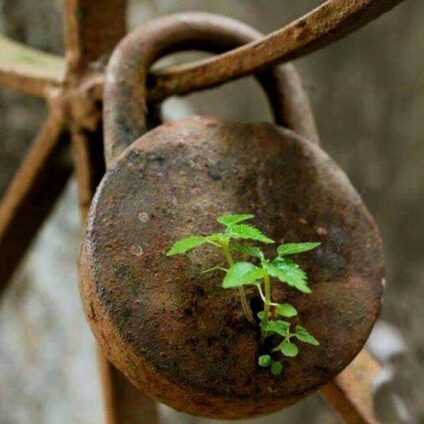
.
Bakterien
Die Mikrobiologin Lynn Margulis kritisierte an ihren Kollegen: „Sie haben keine Ahnung von der Vielfalt des Lebens. Sie glauben, weil etwas in Escherichia coli ist, wissen sie etwas darüber.“ Wie z.B. der Biologiephilosoph Jacques Monod: „Was für E.coli wahr ist, muß auch für den Elefanten wahr sein“.
Die Bakterien entstanden vor etwa 3,5 Milliarden Jahre und sind mit Abstand die häufigsten Lebewesen, gefolgt von Einzellern (mit einem Zellkern), Pilzen, Pflanzen und Tieren. E.coli Bakterien siedeln gerne in unserem Darm. Man sagt, sie haben einst nur deswegen Vielzeller wie uns entwickelt, damit sie immer ein gutes Nährmedium haben. Und noch ich-kränkender: Sie sind es auch, die uns drängen, auf dieses oder jenes plötzlich einen wahren Heißhunger zu haben.
Kolibakterien können aber auch ohne uns leben – überall: in der Luft, im Wasser, in der Erde. Wir können dagegen nicht ohne sie leben. Sie sind für uns die wichtigsten Symbionten.
Escherichia coli wurde 1919 nach dem Wiener Bakteriologieprofessor Theodor Escherich benannt, der sich 1886 als Kinderarzt mit einer Forschungsarbeit über „Die Darmbakterien des Säuglings“ habilitierte. E.coli läßt sich im Labor leicht vermehren, was unter günstigen Bedingungen alle 20 Minuten durch Teilung geschieht. An der Universität Wisconsin gelang es vor einiger Zeit, das „Nummer-Eins-Labor-Arbeitspferd E.coli“ zu sequentieren. Nun weiß man: Sein „Chromosom“ ist 4,6 Mio Basenpaare lang und enthält 4288 „Gene“, aber davon sind 40% „komplette Rätsel“.
Berühmt wurde E.coli vor allem durch die Arbeiten des Genetikers Jacques Monod, der mit amerikanischem Geld in Paris ein ganzes Institut um E.coli gründete. Zusammen mit seinen Kollegen André Lwoff und Francois Jacob bekam er für seine Forschung 1965 den Nobelpreis. In den Siebzigerjahren kam es zwischen Jacob und Monod zum Streit: Ersterer wollte zukünftig weiße Mäuse erforschen, für ihn hatte E.coli nicht mehr genug Individualität, um sich weiter ernsthaft mit ihm zu beschäftigen.
In seinem Buch „Die Maus, die Fliege und der Mensch“ (1998) schrieb er: „Ich wollte eine Veränderung. Seit 15 Jahren ließ ich nun schon ausgesuchte Bakterienpaare im Takt kopulieren. Ich hatte nichts dagegen, eine Art Guru der Sexualität zu werden, aber nicht der Bakteriensexualität. Auch wollte ich etwas Sichtbares, mit Hormonen, Leidenschaften, mit einer Seele. Ich wollte Tiere, denen man ins Auge blicken, die man individuell erkennen, ja benennen konnte. Und die fähig waren, einem auch selbst in die Augen zu blicken.“
Ein Bakterium „träumt“ bloß davon, da war sich Francois Jacob sicher, „zwei zu werden“. Wobei seine Sexualität, anders als bei uns, mit der Vermehrung nichts zu tun hat, sie vermehren sich ungeschlechtlich. Ihre Sexualität besteht aus Berührungen, bei der Gen-Geschenke übergeben werden. Dies geschieht durch direkten Körperkontakt oder mittels Proteinfäden, so genannten Sexual-Pili, die aus der Distanz von einem Bakterium zum anderen hinüberwachsen. Die Fortpflanzung geschieht dagegen durch Teilung, wobei sich die Chromosomen sowie auch die im Zellplasma integrierten Organellen ebenfalls teilen. Auf diese Weise ist E.coli quasi unsterblich. Und weil alle Bakterien miteinander Gene austauschen können, gibt es nicht etwa eine Million Arten oder mehr, sondern eigentlich nur eine.
Jacobs Kollege am Collège de France Michel Foucault fragte sich: „So lange man es zu tun hat mit einem, relativ gesehen, so einfachen Organismus wie einem Bakterium, kann man dann wirklich von einem Individuum sprechen?“ Präziser gefragt: „Kann man sagen, dass es einen Anfang hat, da es schließlich nur die Hälfte einer früheren Zelle ist, die ihrerseits die Hälfte einer anderen Zelle war und so weiter bis in die fernste Vergangenheit des ältesten Bakteriums der Welt?“ Oder – in die andere Zeitrichtung gefragt: „Kann man sagen, dass es stirbt, wenn es sich teilt, zwei Bakterien Platz macht, die unabhängig bestrebt sind, sich alsbald ihrerseits zu teilen?“
Das Sterben, der Bruch im Gedächtnis, tritt erst mit der Verbindung von Sexualität und Fortpflanzung ein. Ich erinnere nur an den Seufzer des Dichters Peter Rühmkorf: „Ach könnte man doch angelesene Eigenschaften vererben!“
Einer von Foucaults Lieblingsbegriffen war der „Würfelwurf“, er fand ihn in Francois Jacobs „biologischer Geschichtsschreibung“, die „uns zeigt, wie und warum man das Leben, die Zeit, das Individuum, den Zufall ganz anders denken muß“ – und zwar von „hier aus: in unseren Zellen“.
Man schätzt, dass in und auf uns zehn Mal mal so viele Bakterien leben wie wir Körperzellen haben, sie wiegen insgesamt 2 Kilo. Aber diese Schätzungen haben etwas Absurdes, denn mit einem einzigen Gramm unserer Scheiße scheiden wir bereits 100 Milliarden Individuen aus. Wobei E.coli es mit seiner extremen Säureresistenz nahezu problemlos schafft, durch Mund und Magen wieder zurück in unseren Dickdarm zu gelangen.
Andere Säugetiere, vor allem Wiederkäuer wie die Kuh, sind in ihrem Pansen bakteriell noch viel üppiger ausgestattet als wir, weswegen die Mikrobiologin Lynn Margulis sagen kann: „Der Pansen – das ist die Kuh“. Noch reichhaltiger und komplizierter sind die Bakteriensymbiosen im Verdauungsapparat von Termiten, die von extrem nährstoffarmem Holz leben. Ähnliches gilt für Koalabären und Biber: Sie sterben, wenn sie zu wenige Darmbakterien der Mutter mit ihrem Kot aufgenommen haben. Wenn Menschenkinder durch einen Kaiserschnitt auf die Welt kommen, fehlen ihnen ebenfalls lebenswichtige Bakterien, die ihnen ihre Mutter sonst im Geburtskanal mitgegeben hätte. In einer New Yorker Klinik wickelt man deswegen nun per Kaiserschnitt geborene Säuglinge in Tücher, die mit der Scheidenflüssigkeit ihrer Mutter getränkt werden.
Kürzlich entdeckten US-Forscher unerwarteterweise mehrere Raupenarten, die gar keine Bakterien in ihren Verdauungsorganen haben. Umgekehrt erforscht die Meeresbiologin Nicole Dubilier, Leiterin der Abteilung Symbiose im Bremer Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie, einen Meereswurm ohne Verdauungsorgane, der sich mit Hilfe von fünf Bakterienarten ernährt. Der Wurm führt ihnen mit dem Meereswasser nur Schwefelwasserstoff zu, das sie durch Sulfidoxidation in Energie umwandeln. Für den Biologen Bernhard Kegel sind die Bakterien „Die Herrscher der Welt“, wie er 2015 sein Buch über sie nannte. Da sie in und an fast allen Lebewesen sind, gibt es für ihn „kein Einzelwesen“. Die Idee einer essenziellen Identität sei rein fiktiv.
.

.
Bärtierchen
Bisher sind 1300 Arten bekannt. Im Amsterdamer „Micropia Museum“ steht gleich im Eingang ein Bärtierchen, so groß wie ein Braunbär und auch so braun. Die 2014 eröffnete Einrichtung ist das erste und einzige Mikroorganismen gewidmete Museum – mit 25 Mitarbeitern in weißen Kitteln, die sich mit den Tierpflegern im Zoo nebenan vergleichen. Ihre Tiere kann man allerdings nur unter dem Mikroskop sehen.
Das Museum befindet sich nicht zufällig in Amsterdam: Dort lebte der Glasschleifer Antoni van Leeuwenhoek (1632 –1723), der nicht nur das Mikroskop erfand, sondern auch derart fasziniert war von dem, was ihm dieses zu sehen ermöglichte: „Animalcules“ (kleine Tierchen), u.a. Bakterien und menschliche Spermatozoen, dass er eine Reihe von Entdeckungen damit machte. Ihm ist der erste Saal im Museum gewidmet.
Die Bärtierchen nennt man auch Wasserbären. Sie sind weniger als einen Millimeter groß und haben acht Beine mit einziehbaren Klauen am Ende, die sich bei einigen Arten zu Haftscheiben umwandelten. Andere Arten können ihre Stummelbeine teleskopartig ineinanderschieben, ebenso ihre „Mundkegel“. Zum Fressen pressen sie diesen laut Wikipedia gegen die betroffene Pflanzenzelle oder die Haut ihrer Beute. Durch Vorschieben der nadelscharfen Stilette werden diese dann angestochen und der Zell- oder Körperinhalt ausgesaugt. Am Liebsten fressen sie Algen, einige Arten aber auch andere Mikroorganismen, u.a. andere Bärtierchenarten.„baertierchen.de“ erwähnt eine Art, die parasitär auf den Mundtentakeln von Seegurken lebt.
Es gibt Bärtierchen in vielen Farben, ihr Blut ist farblos. Etliche Bärtierchen verfügen über punktförmige, rot oder schwarz gefärbte Augen. Sie leben überall auf der Welt, auch in der Antarktis, auf Gletschern, im Süßwasser, im Meer und an Land. Dort am Häufigsten im Moos, wo etwa 200 Individuen auf einen Quadratzentimeter vorkommen können. „Oft finden sich unterschiedliche Arten in den verschiedenen Zonen des Mooses,“ heißt es auf Wikipedia.
Bei Trockenheit fallen Bärtierchen in einen todesnahen Zustand („Tönnchen“ genannt), in dem sich keine Stoffwechselaktivität mehr nachweisen lässt. Wenn es nass wird, wachen sie wieder auf. „Besonders in Süßwasser lebende Arten, aber auch solche, die Moose oder Laubstreu besiedeln“, sind Wikipedia zufolge „in der Lage, als Zysten bezeichnete Resistenzstadien zu bilden. Dazu ziehen sich die Tiere auf 20 bis 50 Prozent ihrer ehemaligen Körpergröße zusammen, reduzieren ihren Stoffwechsel und bauen teilweise auch ihre inneren Organe ab. Dieser Vorgang wird von bis zu drei unvollständigen, unmittelbar aufeinanderfolgenden Häutungen begleitet, an deren Ende das Tier von einer mehrwandigen Umhüllung aus nicht-zelligen Hautschichten umgeben ist.“ Auf diese Weise können die Tiere über ein Jahr überleben. Sobald sich die Umweltbedingungen geändert haben, befreien sie sich innerhalb von 6 bis 48 Stunden wieder aus ihrer Umhüllung. Diese Zysten sind jedoch weniger widerstandsfähig als die Tönnchen.
Bärtierchen vermehren sich sexuell, die Weibchen können aber auch ohne Befruchtung Eier entwickeln und es gibt Zwitter unter ihnen. Ihre Populationen verbreiten sich vor allem durch Wind, Wasser oder Tiere. „Zur aktiven Fortbewegung benötigen alle Arten einen dünnen umgebenden Wasserfilm. Sie nutzen dann die Beine der ersten drei Rumpfsegmente, die im Gegensatz zu den verwandten Stummelfüßern nicht nur paarweise, sondern auch einzeln bewegt werden können, um etwa über Sandkörner zu krabbeln oder in Mooskissen herumzuklettern.“
Jungtierchen reagieren auf Lichteinstrahlung mit schnelleren Bewegungen und spontanen Richtungsänderungen. Die Wikipediaautoren vermuten: „Da Lichteinstrahlung oft mit Wärmestrahlung und nachfolgender Wasserverdunstung verbunden ist, hängt dieses Verhalten vielleicht mit der für Jungtiere bedrohlicheren Austrocknungsgefahr zusammen.“ Der Psychoanalytiker Sandor Ferenczi meinte, dass wir uns vielleicht ins mütterliche Fruchtwasser zurückwünschen, aber eine noch viel ältere Austrocknungs-Katastrophen befürchten, weswegen nicht das Meer die Mutter symbolisiert, sondern umgekehrt die Mutter das Meer.
Die Zahl der Gewebezellen der Bärtierchen ist genetisch festgelegt. Ihr Größenwachstum kann daher, folgt man Wikipedia „nicht durch eine Vermehrung der Zellenanzahl, sondern nur durch ein Wachstum der individuellen Zellen selbst stattfinden. Wird (durch experimentellen Eingriff) nach der ersten Zellteilung eine der beiden Tochterzellen abgetötet, entwickelt sich dennoch ein anatomisch vollständiges und lebensfähiges Tier, das dann nur halb so viele Zellen enthält wie normal.“ Einige Körperteile, wie Hinterdarmauskleidung, Beinklauen und Mundwerkzeuge („Stilette“) werden „regelmäßig gehäutet“. Die Stilette können vorgestreckt oder eingezogen werden.
Bärtierchen haben keine Atmungsorgane, der Gasaustausch findet durch Diffusion über die Haut statt, die dazu nass sein muss. Im Mitteldarm findet sich eine reiche Bakterienflora, also eine Natur in der Natur. Unverdauliche Reste und Schadstoffe werden von der oberen Hautschicht in das darüberliegende Außenskelett eingebaut „und bei der nächsten Häutung zusammen mit dieser abgestoßen.“
2020 schrieb „Die Welt“: „Extreme Kälte, radioaktive Strahlung, Sauerstoffmangel und sogar das Vakuum des Weltalls – all das kann Bärtierchen nichts anhaben. Doch Forscher entdeckten eine Schwäche bei den Winzlingen, die ihnen sogar das Leben kosten kann“: Zwar halten sie kurzzeitig eine Temperatur von 151 Grad Celsius aus, aber nicht auf Dauer. So stellte eine Studie fest, dass die Bärtierchen der Art Acutuncus antarcticus durch den Klimawandel sogar vom Aussterben bedroht werden könnten.
Der „Tagesspiegel“ berichtete 2025, dass eine im Nationalpark Schwarzwald auf Flechten entdeckte Bärtierchenart nach dem Ministerpräsidenten des Bundeslandes benamt wurde. Sie heißt jetzt Ramazzottius kretschmanni.
Auf „baertierchen.de“ heißt es, dass vom Quedlinburger Pastor Ephraim Goeze 1773 „die erste publizierte Abbildung stammt“. Der Schriftsteller Jan Wilm schreibt in seinem Buch „Bärtierchen“ (2025), dass der Danziger Pastor Conrad Eichhorn den kleinen Wasserbären taufte. „Das Bärtierchen beobachtete er durch sein ‚Vergrösserungs-Glaß‘ und fertigte eine der ersten Illustrationen eines kleinen Wasserbären an.“ Seine Forschung publizierte er 1775 in dem Buch „Beyträge zur Naturgeschichte der kleinsten Wasserthiere, die mit blossem Auge nicht können gesehen werden und die sich in den Gewässern in und um Danzig befinden.“
.
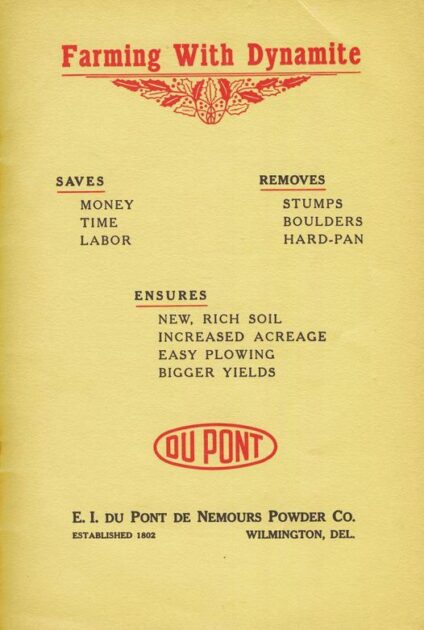
.
Kleine Tierchen
Kürzlich besuchten wir das „Micropia Museum“ in Amsterdam. Es ist das einzige auf der Welt, das sich den Mikroben widmet. Man kann sie nur unter dem Mikroskop sehen. Da die amerikanische Mikrobiologin Lynn Margulis zu meinen Biologenvorbildern zählt, hat mich die „Unsichtbarkeit“ dieser Tierchen nicht abgeschreckt. Eher schon die Umwelt dieses Museums – Amsterdam, wo man nicht mal mehr ohne Smartphone auf eine öffentliche Toilette gehen oder mit der Straßenbahn fahren kann. Ich hoffe, dass sich dieser Elektronikwahn in einigen Jahren wieder legt. Schon dass die Menschen dort (wie auch hier) ständig mit einem Smartphone in der Hand oder vor der Nase rumlaufen, ist eine Beleidigung für jedes soziale Wesen.
Das „Micropia Museum“ ist nicht zufällig in Amsterdam situiert worden, denn dort lebte der Glasschleifer Antoni van Leeuwenhoek (1632 – 1723), der nicht nur das Mikroskop erfand, sondern auch fasziniert war von dem, was ihm seine Erfindung sichtbar machte: „Animalcules“ (kleine Tierchen). Das Deutsche Museum schreibt: „In seinem Zahnbelag fand Leeuwenhoek als erster Bakterien; er entdeckte den peripheren Blutkreislauf in den feinen Kapillaren und konnte damit die Verbindung des arteriellen mit dem venösen Blutkreislauf erklären; seine spektakulärste wissenschaftliche Tat aber war die Entdeckung der menschlichen Spermatozoen und der geschlechtlichen Fortpflanzung aller Lebewesen; akribisch beobachtete er, neben dem vieler anderer Tiere, das sexuelle Verhalten der Flöhe und die Entwicklungsschritte vom befruchteten Ei bis zum fertig entwickelten Floh. Dabei scheute er sich nicht, diese Forschungsobjekte in seiner Hosentasche mit sich herum zu tragen und mit dem eigenen Blut zu ernähren.“
Es verwundert deswegen nicht, dass gleich die erste Abteilung im Micropia Museum ihm gewidmet ist. Vor einiger Zeit fand in Schwerin eine große Ausstellung mit Bildern holländischer Maler aus dem 17. Jahrhundert, dem „Goldenen Zeitalter“ der Niederlande, statt. Ein Schwerpunkt bildeten dabei „Waldstilleben“ (auch Waldbodenstücke genannt), dessen Hauptvertreter Otto Marseus van Schrieck (1619 – 1678) war. Er malte Einblicke in Biotope mit wildwachsenden Pflanzen und kleinen Tieren wie Eidechsen, Fröschen und Insekten. Oft handelt es sich dabei laut Wikipedia um die Vegetation (und Fauna) eines Waldbodens oder eines Sumpfes. Die Tiere, die er malte und liebte, hielt er lebend in seinem Haus und Garten. In der Schweriner Ausstellung kam auch der Mikroskoperfinder Anti van Leeuwenhoek vor, der sich für noch kleinere Tierchen interessierte. Zudem wurde dort auch noch an die zuletzt in Westfriesland lebende Maria Sybilla Merian (1647 – 1717) erinnert.
Sie war eine Naturforscherin, Künstlerin und Geschäftsfrau, die mit ihrer Tochter in der holländischen Kolonie Surinam forschte und malte. Sie machte, wieder laut Wikipedia, zu den verschiedenen Entwicklungsstadien der Schmetterlinge und Falter detaillierte Aufzeichnungen und entwickelte einen neuen Bildtyp, das „Metamorphosenbild“, das diese auf ästhetische Weise illustrierte. Wegen ihrer genauen Beobachtungen und Darstellungen gilt sie als wichtige Wegbereiterin der modernen Insektenkunde. Ich meine zu wissen, dass sie sogar die Metamorphose der Schmetterlinge vom Ei über die Raupe und ihre Verpuppung bis zum fertigen Schmetterling entdeckt hat. Ab 1675 veröffentlichte sie zwei Bände mit dem Titel „Der Raupen wunderbare Verwandelung und sonderbare Blumennahrung“. Auch eine Entdeckung von ihr, dass Schmetterlinge und andere Insekten vom Nektar und Pollen der Blumenpflanzen leben.
Dass auch umgekehrt die Blumen von oder durch Insekten leben, also dass diese bei der Nahrungssuche die Blumen befruchten, fand dann der Spandauer Schulleiter Christian Konrad Sprengel (1750 – 1816) heraus. Er war weniger glücklich als die drei holländischen Forscher bzw. Maler: Sein Buch „Das entdeckte Geheimnis der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen“ wurde zum Einen von vielen Naturforschern abgelehnt – u.a. von Goethe, der ihm vorwarf, der Natur einen menschlichen Verstand zu unterlegen (erst Darwin rehabilitierte ihn und seine Entdeckung). Und zum Anderen kniete er sich buchstäblich derart in seine Blumen-Insekten-Beobachtung auf einer Wiese, dass er aus seiner Schulleiterstelle „wegen Pflichtvergessenheit entlassen“ wurde.
Das „Micropia Museum“ klärt begeistert darüber auf, dass Mikroben nicht nur Krankheitserreger sind, sondern für uns lebensnotwendig (wir haben 39 Billionen Bakterien, Viren und Pilze an und in unserem Körper und bloß 30 Billionen Körperzellen). Daneben hat uns auch die Pflanzenliebe der Amsterdamer begeistert: Überall an und vor den Häusern blühte es und es ging dort alles viel gemütlicher zu als in Berlin, was auch sehr schön war.
.
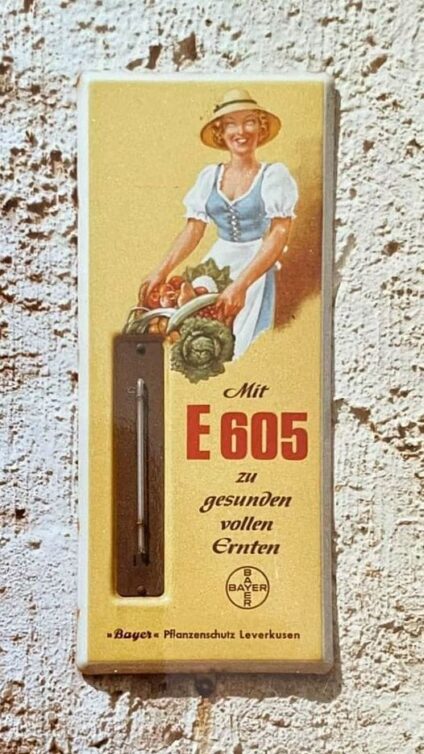
.
Regenwürmer
Seit langem wird – fast weltweit – der „Humusschwund“ beklagt, zum großen Teil dadurch hervorgerufen, dass mehr und mehr auf chemische Dünger statt auf biologische gesetzt wird, d.h. auf Exkremente und anderes organische Material. Um die Humusschicht zu erneuern, braucht es Mikroorganismen und Regenwürmer. Erstere galten lange Zeit vor allem als Krankheitserreger und letztere als Pflanzenschädlinge.
Ihre Umwertung verdankten sie u.a. dem Humusforscher Raoul Heinrich Francé und seinen „Untersuchungen zur Oekologie der bodenbewohnenden Mikroorganismen“ (1913) sowie zum „Leben im Ackerboden“ (1922), beide Bücher wurden 1981 neu herausgegeben. Als er 1943 in Budapest starb, führte seine Frau, die Biologin Annie Francé-Harrar, seine Forschung weiter. Neben einem „Handbuch des Bodenlebens“ veröffentlichte sie 1950 „Die letzte Chance – für eine Zukunft ohne Not“, beide Bücher wurden 2011 von der „Gesellschaft für Boden, Technik, Qualität“ (BTQ) neu herausgegeben. Das zweite kann man sich als „pdf“ im Internet herunterladen.
„Die letzte Chance“, damit meint die Autorin: Wenn wir nicht schleunigst den Wald retten und die Humusschicht auf unseren Böden verbessern, dann ist es um das Leben auf der Erde geschehen: „Wir, unsere ganze Generation, stehen vor einem Abgrund, denn Humus war und ist nicht nur der Urernährer der ganzen Welt, sondern auch der alles Irdische umfassende Lebensraum, auf den alles Lebende angewiesen ist.“ Um den Humus zu erhalten, müssen wir die Mikroorganismen im Boden, die ihn schaffen und von denen die Pflanzen abhängen, von denen wiederum wir abhängen, studieren und kennen, um sie bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen und nicht – wie jetzt noch – permanent zu behindern: „Seit Jahrhunderten haben wir unsere Böden kaputt gemacht.“
2025 erschien von Ottawa, Meckes, Straaß und Lieckfeld ein üppiger Bild-Text-Band mit dem Titel „Drecksarbeit – Der Mikrokosmos unter unseren Füßen“. Es führt das „Leben im Ackerboden“ von Raoul und Annie Francé anhand einzelner Arten vor: Springschwänze, Hornmilben, Bärtierchen, Asseln usw.. „Weltweit leben 1 000 000 000 mal mehr
Bakterien im Boden, als es Sterne im Weltall gibt,“ heißt es da. Mit ihnen „summiert sich das Gewicht der Lebewesen, die einen Hektar durchwurzelbaren Bodens bewohnen, auf 15 Tonnen.“
Mit den Regenwürmern hat sich bereits Charles Darwin beschäftigt, auch experimentell. Sein Buch „Die Bildung der Ackererde durch die Tätigkeit der Würmer“ wurde 2020 erneut veröffentlicht. Vor Darwin hatte sich bereits der französische Historiker Jules Michelet mit der Bedeutung der Kleinstlebewesen im Boden befasst und sie als „die unbemerkbaren Erbauer des Erdballs“ bezeichnet. Sein gleichnamiger Text erschien 1985 in der Zeitschrift „Tumult“.
Neuerdings hat der französische Philosoph Gaspard Koenig in seinem Roman „Humus“ die Geschichte zweier Agrarwissenschaftler erzählt, die sich als ausgebildete Regenwurmexperten je ein Start-Up ausgedacht haben: Der eine will einen vergifteten Acker, den er geerbt hat, mit Regenwürmern wieder fruchtbar machen, der andere Regenwürmer in Massen industriell in riesigen „Wurmkompostern“ züchten und verkaufen. Beide scheitern: Ersterer reduzierte daraufhin seine Ausgaben und lebte bescheiden vom Gemüseanbau in seinem Garten. Letzterer endete in einem betrügerischen „Greenwashing Projekt“. Beide geraten dann in bewaffnete Kämpfe der Organisation „Extinction Rebellion“, die ebenfalls scheitern.
In der Zeitschrift „Tierstudien“ zum Thema „Erdlinge“ (2025, Heft 27) findet sich ein „Plädoyer für das Leben mit Würmern“ von Filippo Bertoni, der darüber 2016 auch seine Dissertation an der Amsterdamer Universität schrieb: „Living with worms.pdf“. Dazu hat er sich auch mit der „Wurmkompostierung“ befasst. In seinem „Plädoyer“ schlägt er eine „Art von Zusammensein“ vor. Zudem erwähnt er eine Regenwurmforscherin, Ingrid M. Lubbers, mit der er zusammenarbeitete, die „in ihrer Arbeit zeigte, wie Regenwürmer zu Emissionen beitragen, indem sie die Zersetzung organischer Stoffe unterstützen, ein Phänomen, das sie als ‚Global Worming‘ bezeichnete.
Statt von „Zusammensein“ geht es in einer Buchreihe um „Verbunden sein“. Herausgegeben wird die Reihe vom amerikanischen Non-Profit-Verlag W_Orten & Meer – Verlag für verbindendes diskriminierungskritisches Handeln“. Der erste Band besteht aus einer Aufsatzsammlung zum Thema „erd verbunden sein“ (2024). Einer der Autorinnen ist Robin Wall Kimmerer, Gründerin des „Center for Native Peoples and the Environment“. Den 16 Autorinnen geht es um das große Ganze, bis zum Kosmos, aber ein Beitrag, von Marcia Bjornerud hat immerhin den Titel „Erdlinge werden“. Sie erzählt darin, wie sie als Geologie-Professorin in Wisconsin ihren Studenten auf Exkursionen, dahin, wo es keinen Handyempfang gibt, die Erde unter ihren Sneakers nahe bringt.
In Berlin tourte die Schauspielerin Barbara Geiger von der „Stiftung Fräulein Brehms Tierleben“ lange Zeit mit einem charmanten Regenwurm-Vortrag durch die Lande. Einmal auch auf einer taz-Konferenz.
Die Tierschützerin und Schimpansenforscherin Jane Goodall erzählte dem Neurologen Oliver Sacks, dass sie als kleines Kind die Regenwürmer mit ins Bett nahm. In Olivers Sacks posthum veröffentlichten Buch „Briefe“ (2025) heißt es: „Ich werde (wieder) Töpfe voller Erde, in der es von Regenwürmern wimmelt, in meine Küche bringen (ich tat es 2009, als ich über sie schreiben wollte). Darwin stellte fest, dass ihr ‚Lieblingsgemüse‘ Zwiebeln, Radieschen und Kohl war. Das ist auch das meine, was uns einmal mehr die Kontinuität des Lebens vor Augen führt!“
Auf „lokalkompass.de“ heißt es über den Regenwurm: „Er hat weder Beine noch Augen oder Ohren, dafür die Kraft von zehn Herzen und eine Muskelleistung, die ihn das 60-Fache seines Körpergewichts stemmen lässt. Die Rede ist vom Regenwurm. Damit zählt der Regenwurm zu den stärksten Tieren der Welt, wenn man seine Kraft in Relation zur Größe setzt
Allein in Deutschland kommen 46 verschiedene Regenwurmarten vor, weltweit sind es über 3000. Einer der bekanntesten Vertreter in unseren Gärten ist der Tauwurm alias Regenwurm, Lumbricus terrestris. Er wird bis zu 30 Zentimeter lang und kann einen Durchmesser von 15 Millimetern erreichen.“
Die Regenwürmer ernähren sich von verrotendem organischem Material und scheiden Humus aus. Jeder Kleingärtner richtet deswegen für sie einen Komposthaufen ein, denn was geerntet wurde, muß auch wieder dem Boden zugeführt werden – eben Humus. „In gesunden, humusreichen Böden können mehr als 600 Tiere pro Quadratmeter vorkommen. Sie bilden jährlich bis zu 80 Tonnen pro Hektar Krümel und Humus, die unverzichtbaren Ton-Humus-Komplexe. Die meisten Regenwürmer ziehen dazu meist nachts organisches Material in ihre Röhren, etwa Blätter oder Pflanzenreste. Die fressen sie und zersetzen sie so,“ heißt es auf „agrarheute.com“. Und ferner: „Seit 2005 ist der Regenwurm verstärkt in den Blickpunkt gerückt.“
Auch in den des Wissenschaftshistorikers Bruno Latour: In seinem „Kompositionistischen Manifest“ (2010) schreibt er: Spätestens seit „‚Kopenhagen‘, Klimaerwärmung, Genmais und Virenepidemien“ ist allen klar geworden: Die Experimente der „Naturalisten” sind längst den Laboratorien entwachsen und betreffen alle – jeden von uns, wir sind ‚Mitforscher‘, ob wir wollen oder nicht. Latours „politische Ökologie“ will das Gegenteil von einer „Öko-Politik“ sein. Dazu gehört für ihn die Einsicht: „Kritik, Natur, Fortschritt, das sind drei der Zutaten des Modernismus, die kompostiert werden müssen.” Der Biologe Jakob von Uexküll hat bereits 1909 versucht, das Weltbild der Regenwürmer zu umreißen (wie zuvor auch schon das von Zecken).
Die Darstellung ihres Geschlechtsverkehrs fällt sehr unterschiedlich aus. Auf „welt.de“ liest man: „Forscher fanden heraus, dass die Regenwürmer beim Sex nicht nur viel Zeit verbringen, sondern auch ihr Leben riskieren. Spät in der Nacht beginnen die Paarungen. Dabei pressen zwei Würmer den Körperabschnitt mit den Geschlechtsöffnungen gegenläufig aneinander. Spitze Borsten und zäher Schleim sorgen für eine feste Bindung, während das Sperma ausgetauscht wird. Zwischen 2,5 und 5,5 Stunden halten die Würmer engen körperlichen Kontakt. Oft genug dauert die Paarung bis in die Morgenstunden, was allerhand Gefahren mit sich bringt. Wenn sich etwa eine hungrige Amsel nähert, benötigen verpaarte Würmer für den Rückzug viel länger als einzelne. Auch verletzen sich die Würmer an den Borsten des Partners. Schließlich wird oft einer von beiden ganz aus seinem Loch gezogen und riskiert, auszutrocknen oder gefressen zu werden.“
Auf Wikipedia schreiben die Autoren, wahrscheinlich Biologiestudenten: „Regenwürmer besitzen als Zwitter sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsorgane und diese zudem jeweils beidseitig. Sie beginnen mit zwei Paar Hoden jeweils vorn im Coelom der Segmente 10 und 11, angeheftet an deren vordere Scheidewände. Die Hoden sind bei einigen Gattungen in eine Samenkapsel eingeschlossen, bei anderen frei. Die reifen Spermien werden in einem Vorratsbehälter gesammelt, der sich als Ausstülpung des hinteren Dissepiments in das folgende Segment erstreckt. Die Spermien werden von paarigen Spermienleitern, jeweils mit einem Wimperntrichter (einer Öffnung mit einem Saum von Zilien, die in Richtung des Inneren schlagen) aufgefangen, diese vereinigen sich beiderseits und münden meist in zwei erkennbaren Öffnungen (männliche Poren) nach außen. Die männlichen Genitalporen liegen meist im 13. oder 15. Segment. Im Segment 13 liegen entsprechend die weiblichen Organe (Eierstöcke). Die Eier werden von Eileitern, ebenfalls mit trichterförmiger Öffnung ins Coelom des Segments zu porenförmigen Öffnungen im folgenden 14. Segment geleitet. Bei der Paarung werden die Spermien des jeweiligen Partners zunächst in Samentaschen aufgenommen, deren Anzahl gattungsspezifisch verschieden ist. Die Befruchtung erfolgt im durch das Clitellum gebildeten Kokon.“
.
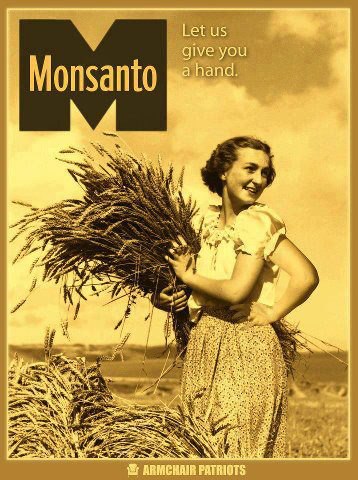
.
Regenwürmer (2)
Der „gemeine Regenwurm“ (Lumbricus terrestris) galt lange Zeit als Schädling: Man nahm an, dass er die Wurzeln der Pflanzen fraß. Heute weiß man, dass er im Gegenteil die fruchtbare, oberste Erdschicht produziert, indem er verrottende Pflanzenteile verdaut und als „Humus“ ausscheidet. „Es sind große, kraftvolle Würmer, die für ihre Aufgabe, die Bearbeitung des Bodens, gut gerüstet sind,“ schreibt die US-Autorin Amy Stewart in „Der Regenwurm ist immer der Gärtner“ (2015). Sie haben ein bis fünf paar Herzen und schlafen nie, kennen höchstens „inaktive Phasen,“ wie der US-Regenwurmforscher Sam James herausfand, der ihr Paarungsverhalten studierte: „Der Wurm wählt einen Sexualpartner vor allem nach dem Gesichtspunkt der Länge aus. Würmer sind Hermaphroditen, sie müssen ihre Körper so aneinanderlegen, dass die männlichen Organe des einen, es sind nicht mehr als winzige Poren um das 12. Segment herum, sich an den weiblichen des anderen orientieren.“ Um miteinander verhaftet zu bleiben, sondern sie eine klebrige Flüssigkeit ab. „Ihre sexuelle Leidenschaft ist stark genug, um für eine gewisse Zeit die Furcht vor dem Licht zu überwinden,“ schrieb Charles Darwin, der das für ein Zeichen ihrer Intelligenz hielt – in seinem letzten Werk „Die Bildung der Ackererde durch die Thätigkeit der Würmer“ (1881). In einem anderen englischen Lehrbuch über Regenwürmer behauptet der Autor, dass sie sich gerne streicheln lassen. Ei und Sperma der Würmer werden in einer „drüsigen Hautverdickung“ abgelegt, die hernach vom Wurm verlassen und zu einem Kokon wird. Erst wenn die Umweltbedingungen für sie günstig sind, befruchten Ei und Sperma sich. Zu den „Lieblingsexperimenten der Wurmforscher“ gehört laut Amy Stewart das Halbieren, wobei sich nur aus einem Ende, meist das mit dem Kopf, ein neuer Wurm entwickelt. Die US-Autorin hat ausgerechnet, dass in ihrem Garten „pro Acre“ (4050 Quadratmeter) 5,2 Millionen Regenwürmer leben. Jeder produziert etwa 30 Gramm Kot (Humus) im Jahr, zusammen 150 Tonnen.
Es gibt etwa 3500 Regenwurmarten, die vielversprechensten werden gezüchtet, exportiert und z.B. an Angler, Kläranlagenbetreiber, Reptilien- und Amphibienhalter verkauft. In Minnesota haben Angler anscheinend mit „europäischen Regenwürmern“ gefischt, von denen sie anschließend ein paar Exemplare wegwarfen. Diese vermehrten sich – und das so sehr, dass sie die Laubwälder von Minnesota veränderten. Dort gab es bis dahin keine Regenwürmer, so dass sich große Schichten von Laub auf der Erde bildeten, davon lebte eine Vielzahl kleiner Bodenorganismen, aber auch Pflanzensamen und Baumschösslinge gediehen darin. Die europäischen Regenwürmer fraßen alles Laub weg – mit der Folge, dass dort bis zu 80% der Blumen und Pflanzen sowie auch einige Bodenbrüter und Spitzmäuse verschwanden. Die Forstwissenschaftler können nichts dagegen tun, eine meinte: „Die Würmer sind buchstäblich die Ingenieure des Ökosystems.“
Etwa 50 Regenwurmarten wurden nach dem schwedischen Erstbeschreiber Gustaf Eisen benannt, zudem bekam die Gattung „Lumbricus“, zu der unser „europäischer Regenwurm“ gehört, den Namen „Eisenia“. Der schwedische Schwebfliegenforscher und Schriftsteller Fredrik Sjöberg hat ihm ein Buch gewidmet: „Der Rosinenkönig“ (2011). Obwohl Sjöberg oft zum Angeln ging und gärtnerte (wobei er der „modernen Kompostierung“ mit Kompostwürmern als „Weltanschauung“ ablehnend gegenüberstand), ist seine „Beziehung zur Biologie der Regenwürmer eher reserviert“. Gustaf Eisen war jedoch nicht nur ein Regenwurmtaxonom, sondern auch Rosinenveredler, Feigenzüchter und Glasperlenforscher. Vor allem gelang es ihm, die größten Bäume der Welt vor dem Gefälltwerden zu retten, indem er die Gründung des Sequoia National Parks in der kalifornischen Sierra Nevada betrieb. Am Fuße des dortigen „Mount Eisen“ wurde er auch begraben – von der Botanikerin Alice Eastwood, mit der Eisen ein Verhältnis hatte, wie Sjöberg vermutet, weil er 1904 einen Regenwurm nach ihr benannte: „Mesenchytraeus eastwoodi“.
Bereits als Zoologiestudent in Uppsala hatte Eisen sich auf Regenwürmer (sein Freund auf Tausendfüßer) spezialisiert. Nachts ging er mit einer Laterne über Friedhöfe und sammelte Würmer. 1871 veröffentlichte er seine erste größere Arbeit über sie: „Beiträge zur Oligoccetfauna Skandinaviens“. Die Schrift schickte er u.a. Charles Darwin, der sich bedankte und nebenbei bemerkte, auch er beschäftige sich „ein wenig mit Regenwürmern“. Das war untertrieben oder erst die Lektüre der Schrift von Eisen regte ihn dann derart an, dass er jede Menge Regenwurm-Experimente im Garten seines Hauses in „Down“ anstellte: wie sie beispielsweise verschiedene Blätter und Papier in ihr Loch ziehen. Um ihr Gehör zu testen, mußte seine Familie mit ihren jeweiligen Musikinstrumenten den Regenwürmern etwas vorspielen. Im Ergebnis kam heraus: „Die Würmer haben kein Gehör“. In dem Kapitel „Die Intelligenz der Regenwürmer“ übermüdet Darwins Beweiseifer den Leser etwas, zumal sein Stil umständlich ist, der russische Dichter Ossip Mandelstam meinte: „Es ist unmöglich, der Darwinschen Gutmütigkeit zu widerstehen…Doch ist denn die Gutmütigkeit eine Methode schöpferischer Erkenntnis und ein würdiges Verfahren der Wahrnehmung des Lebens?“.
Darwins Gründlichkeit war u.a. gegen einen „Mister Fish“ gerichtet, der zwei Jahre zuvor seiner Behauptung über den „Anteil, den die Regenwürmer an der Bildung jener Schicht an Ackererde gehabt haben, welche die ganze Oberfläche der Erde in jedem mäßig feuchten Lande bedeckt“, widersprochen hatte – „und zwar bloß wegen ihrer vermeintlichen Unfähigkeit eine derartig große Arbeit zu verrichten. Wir haben hier wieder ein Beispiel an jener Unfähigkeit, die Wirkung einer beständig wiederkehrenden Ursache zu summieren,“ heißt es gleich in der Einleitung zu seinem Regenwurm-Buch. Bei dem schon mit seiner 1859 veröffentlichten Evolutionstheorie berühmt gewordenen Biologen wunderten sich damals seine englischen Kollegen, warum er sich auf seine letzten Tage ausgerechnet mit Regenwürmern beschäftigte. Es ging ihm darum, „endlich wieder Feldbiologe“ zu sein, vermutet der Feldbiologe Sjöberg: Es passe zu dem greisen Forscher, dass „er wie ein alter Guru auf den Kieswegen spaziert und über Unerhebliches nachgrübelt.“
Währenddessen machte sich der damals 25jährige Gustaf Eisen auf nach Amerika, wo der Gründer des „Harvard Museum of Comparative Zoology“, Louis Agassiz, ihm eine Expedition an die kalifornische Küste finanzierte: Er sollte dort Seegurken sammeln, nebenbei betrieb er seine Regenwurmforschung weiter. Irgendwann wechselte er jedoch den Gegenstand seines Interesses – und kam nicht wieder auf die Würmer zurück.
.
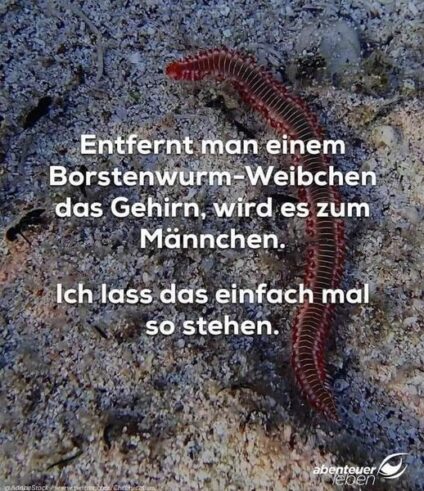
.
Regenwürmer, die an Dein Fenster klopfen, die sagen Dir…
Bayrische Biologen meinen, der Regenwurm sei gut gegen Hochwasser, weil er die Deiche wasserdurchlässiger macht; während US-Klimaforscher behaupten, dass seine Wühltätigkeit Treibhausgase im Boden freisetzt. Wiener Pedologen gehen davon aus, dass Regenwürmer den Pflanzen helfen, sich gegen die sich ausbreitenden Spanischen Wegschnecken zu schützen; und chinesische Forstangestellte entdeckten in der Provinz Yunnan Regenwürmer, die einen halben Meter lang werden. Umgekehrt fand man im Nationalpark Great Smoky Mountain zwei eingewanderte chinesische Regenwurmarten: Amynthas agrestis und Amynthas cortisis. Diese sind nun dabei, die Bodenbeschaffenheit und in der Folge die Zusammensetzung der Vegetation nachhaltig zu verändern, was von einigen Wurmpezialisten derzeit genauer erforscht wird.
Mit der Öko-Bewegung wird daneben auch das Geschäft mit Regenwürmern immer lohnender: Die Süddeutsche Zeitung porträtierte gerade die Firma „Superwurm“ des Ehepaars Langhoff in Düren, das Lebendwürmer – 10 Tonnen im Jahr – über das Internet verkauft – an Angler und Gartenbesitzer.
In diversen Internetforen wird währenddessen immer noch der alten „Jugend-forscht“-Frage nachgegangen, ob aus einem halbierten Regenwurm zwei ganze werden können.
FAZ 2005: Am Angelhaken aufgespießte Würmer empfinden nach einer norwegischen Studie ebensowenig Schmerz wie Hummer oder Krebse, die in kochendes Wasser geworfen werden. „Der gewöhnliche Wurm hat ein sehr simples Nervensystem. Man kann ihn in zwei Hälften schneiden, und er macht trotzdem so weiter wie vorher“, sagte Professorin Wenche Farstad, welche die Untersuchung für die norwegische Regierung leitete.
Vermutlich krümmten sich Würmer am Haken nur aus Instinkt. „Sie fühlen vielleicht etwas, aber es ist kein Schmerz und beeinträchtigt ihr Wohlbefinden nicht.“ Die norwegische Regierung hatte die Studie kurz vor der Neugestaltung des norwegischen Tierschutzrechts in Auftrag gegeben. Hätte sie ein Schmerzempfinden von Würmern ergeben, wäre der Einsatz von Lebendködern vermutlich verboten worden.
Die meisten wirbellosen Tiere nähmen anders als Säugetiere keinen Schmerz wahr, sagte Professorin Farstad. Ihr Hirn sei schlicht nicht groß genug, die Signale zu interpretieren. Dies gelte auch für Hummer oder Krebse, die zur Zubereitung in kochend heißes Wasser geworfen werden. Die großhirnfixierte Farstad hat Unrecht: Tierschutz-Organisationen bezeichnen das Zubereiten von Krebsen – z.B. auf dem „weltgrößten Hummerfest“ in Maine – als barbarisch: die Tiere werden lebend in riesige Töpfe mit kochendem Wasser geworfen. Das rohe Massenvergnügen in der „Hummerhauptstadt“ wurde vom Schriftsteller David Foster Wallace kritisiert – und das ausgerechnet in einer amerikanischen Gourmet-Zeitschrift. Auf Deutsch erschien sein Essay 2009 mit dem Titel „Am Beispiel des Hummers“. Argumentationshilfe lieferten ihm u.a. US-Krebsforscher, die feststellten, dass Hummer „Nozizeptoren“ besitzen und demzufolge auch Schmerzen empfinden. Die deutschen Tierschützer fordern eine Gesetzesänderung: „Die derzeit gültige Verordnung über das Töten von Hummern stammt aus dem Jahr 1936, als über die Leidensfähigkeit der Krustentiere noch wenig bekannt war.“
.
.
Leo Tolstoi schrieb 1897 in sein Tagebuch: „Die Krebse haben es gern, dass man sie lebend kocht. Das ist beileibe kein Scherz. Wie oft hört man das. Der Mensch hat die Eigenheit, Leiden, die er nicht sehen will, nicht zu sehen.“ Das gilt auch für die Leiden der Regenwürmer.
.

.
Mistkäfer
Der englische Biologe J.B.S. Haldane wurde einmal in einer Gesellschaft von Theologen gefragt, was er bei seiner Erforschung der Schöpfung über den Schöpfer erfahren habe: „Er hatte offenbar eine außerordentliche Zuneigung zu Käfern,“ meinte er. Denn es gibt nur eine Art „homo sapiens“ aber 400.000 Käferarten auf der Erde. Davon sind rund 150 Mistkäfer, 59 leben in Europa, d.h. in Wäldern, Feldern und Steppen, sie sind tag- und nachtaktiv und können fliegen, sind dabei allerdings „eher schwerfällig unterwegs,“ wie „tierchenwelt.de“ über diese schwarzblauen „Dickerchen“ urteilt. Schwerfällig heißt auch, dass sie schlecht steuern können und deswegen oft irgendwo gegenfliegen. Ist es ein Stacheldraht, spießen sie sich daran im Sommer reihenweise auf, bei anderen Gegenständen fallen sie bloß zur Erde, berappeln sich nach einiger Zeit und fliegen erneut los.
„Das Besondere an diesem Käfer ist die Kraft, mit der er das Ziel anfliegt, vorwärtsgetrieben wird, wie ein Torpedo. Der Antrieb dieser Kraft ist am Körper selbst nicht zu finden, im koordinierenden System der Nerven vielleicht, in der Ausscheidung von Wärmetropfen in den Gelenken. Der Käfer hebt sich vom Boden, scheint‘s – schwerfällig und ungeschickt und beinahe, würde man sagen, mit einigem Widerwillen. Und dann setzt die Triebkraft ein. Der Käfer kommt in Fahrt.“ Aber früher oder später: „Stoß gegen den Widerstand – und dann der Sturz. Einmal am Boden, ist alle Kraft gewichen. Ich habe oft den Käfer dann in der Hand gehalten. Er bewegte sich in einem engen Kreis und war noch nicht fähig, ein Ziel anzunehmen. Er war stark angeschlagen. Dazu kam die Panik, dass alles noch einmal begonnen werden muß und daß es weitergeht.“ Dies schrieb der revolutionäre Schriftsteller Franz Jung in seiner Autobiographie „Der Torpedokäfer“ (1972) hieß, denn: „Ich habe den Flug unzählige Male in mir selbst erlebt, bei Tag und bei Nacht. Das Ende ist immer das gleiche gewesen: Anprall, Sturz, Kriechen am Boden.“ – Und dann ein neuer Anlauf. Das hat Franz Jung also mit dem Mistkäfer gemeinsam, aber auch mit Donald Duck: „Wahrer Donaldismus ist Scheitern, es wieder versuchen, nochmal versuchen, wieder scheitern, scheitern, scheitern und nochmal scheitern, doch niemals aufgeben.“
Der gemeine Mistkäfer sucht den Kot von Pflanzenfressern. Er fliegt meist abends in Kreisen um diese Tiere herum und wartet darauf, dass etwas für ihn abfällt, denn er und seine Brut leben davon. Auf einen Kuhfladden landen schon bald zig. Einige, um zu fressen, viele, um sich Vorräte zu sichern.
Die Wissenschaft nennt ihn Geotrupes stercorarius. Geotrupes heißt übersetzt „Erdbohrer“ und Stercorarius: „der, der ausmistet“. Das gilt für Männchen und Weibchen, die ein Leben lang, d.h. ein bis drei Jahre, zusammen bleiben und sich auch – für Insekten untypisch – gemeinsam um den Nachwuchs kümmern. Dazu legen sie in der Erde einen aus vielen Kammern bestehenden Bau an, in den sie Kotkugeln zur Versorgung der Larven mit Nahrung packen. Diese bleiben bis zur Verpuppung ein Jahr in dem mit Lehm verschlossenen Bau, der jedoch ein mit Stroh verstopftes und damit luftdurchlässiges „Fenster“ hat. „Die unterirdische Versorgung des Nachwuchses mit Dung hat einen äußerst positiven Nebeneffekt, denn die Erde wird mit Nährstoffen versorgt und dadurch wesentlich fruchtbarer,“ heißt es auf „biologie-schule.de“.
Wegen der Kotkugeln nennt man ihn und vor allem seinen ägyptischen Verwandten, den scarabaeus sacer, auch „Pillendreher“. Dieser war den Ägyptern heilig, seine Mistkugeln, mitunter so groß wie Äpfel, wurden als ein Abbild der Weltkugel angesehen, er selbst als Verkörperung der Gottheit Chepre mit Skulpturen geehrt und als Amulett getragen. Eine meiner Tanten brachte einmal von einer Ägyptenreise einen solchen Skarabäus mit, den sie an einer Kette am Hals trug. Ihm hatte man einen Edelstein auf den Rückenpanzer geklebt. Er lebte, sie fütterte ihn und setzte sie ihn Nachts in ein Terrarium.
Die Mistkäfer orientieren sich im Dunkeln auf ihren Wegen von der Brutkammer zur Nahrungsquelle nach dem Sternenlicht. Eine Studie über dieses Orientierungsverfahren wurde 2013 mit dem ironischen Anti-Nobelpreis“ ausgezeichnet. 2016 legte eine Veröffentlichung nahe, dass sich Mistkäfer einen Schnappschuss des Nachthimmels merken. Dies passiert laut Wikipedia während sie sich um die Hochachse drehend auf der Dungkugel tanzen. – Hört sich wie ausgedacht an! Der gemeine Mistkäfer ist auch ohne seinen berühmten ägyptischen Verwandten ein interessantes und lustiges Tier. Obwohl er im Mist wühlt, freut man sich im Frühjahr auf ihn, ähnlich wie auf den schon fast ausgestorbenen Maikäfer – und zertritt ihn nicht angeekelt. Dennoch ist die Mistkäferforschung nicht gerade üppig, meist wird in den großen Insekten-Überblicken bloß auf die Beiträge des südfranzösischen Insektenbeobachters Jean-Henri Fabre (1823 – 1915) verwiesen. Im ersten Band seiner zehnbändigen „Erinnerungen eines Insektenforschers“ (2010) heißt es: „Sucht man in der Literatur Einzelheiten über das Verhalten des Scarabaeus im Allgemeinen und des Pillendrehers im Besonderen, stellt man fest, daß die Wissenschaft nicht über die Erkenntnisse der Pharaonenzeit hinausgelangt ist.“
Fabre hat verschiedenen Mistkäferarten dann jedoch viel Zeit gewidmet. Über die kleinsten Pillendreher „Sisyphus schaefferi L.“ schreibt er: Nachdem das Paar sich ein gutes Stück aus dem Kuhfladen rausgesäbelt und es rund geknetet hat, spannt sich die „an ihrem größeren Wuchs erkennbare Mutter“ vorne ein und zieht die Kugel im Rückwärtsgehen, „während der Vater von hinten schiebt“. Weil sie die Kugel stur geradeaus rollen, stürzen sie oft mit ihr auf Hügeln oder Steinen ab, geben aber nicht auf. Alle Mistkäfer könnten Sisyphus heißen! Während die Mutter mit dem Graben der Kammern anfängt, jongliert er so lange mit der Kugel, „indem er sie zwischen seinen in die Luft gestreckten Hinterbeinen sehr schnell rotieren läßt.“ Damit bewacht er sie auch, denn immer wieder klauen sich die Mistkäfer gegenseitig ihre Dungkugeln, die sie nicht nur als Nahrung für ihren Nachwuchs, sondern auch für sich selbst brauchen. Aber den Mistkäfer „wirft ein Dungdiebstahl nicht um, er fliegt zum nächsten Haufen und beginnt von vorn,“ schreibt Fabre (in Band 6). Bei zwei Mistkäferarten aus Argentinien, die er geschickt bekam, wird die Dungkugel gegen das Austrocknen mit einer lehmigen Schicht umkleidet und birnenförmig geformt – mit einer Art Warze am dünnen Ende, in der das Ei untergebracht wird, am Ende der Warze bringen sie einen „Verschluss mit luftdurchlässigem Filzpfropfen“ an. Die einzelnen Arten haben als „Grabegeräte“ ganz unterschiedlich geformte Hörner auf der Stirn, und „alle benutzen einen Rechen: mit ihren gezähnten Vorderbeinen sammeln sie das Material.“ Fabre bewundert und beneidet ihre „Charakterfestigkeit“, die „beinahe an das Reich der Moral rührt“.
.

.
Tausendfüßer
Die Tausendfüßer gehören zum Stamm der Gliederfüßer (Arthropoda), und dort zum Unterstamm Tracheentiere. Sie sind meist wurmförmig, zwischen 2 und 28 Zentimeter lang und wegen ihrer vielen Beine manchmal ziemlich schnell. Die Tiere leben fast durchweg an Land – unter feuchten Steinen, Blättern, Baumrinden, in Kellern usw.. Sie besitzen stets ein Paar Fühler und zum Atmen verzweigte Luftröhren (Tracheen).
So weit ist ihre Beschreibung und Einordnung in die Systematik gesamtdeutsch, aber ihre Klassenzugehörigkeit wird im Westen und Osten unterschiedlich gefaßt: In „Grzimeks Tierleben“ (Band 1 – Niedere Tiere) gehören sie zu den „Myriapoda“, im „Urania Tierreich“ (Wirbellose Tiere – Band 2) zu den „Diplopoda“.
Im hervorragenden US-„Leitfaden“ der Zellbiologinnen Lynn Margulis und Karlene V. Schwartz: „Die fünf Reiche der Organismen“ – gehören die Tausendfüßer als Arthropoda (Gliederfüßer) zur Überklasse der Uniramia, auch Tracheata genannt, in der sie als „Diplopodia“ eine von fünf Klassen darstellen. Die anderen vier Tracheata-Klassen – das sind „die Hundertfüßer, die Wenigfüßer, die nur neun oder zehn Beinpaare und verzweigte Antennen aufweisen, die Zwergfüßer, mit zehn bis zwölf Beinpaaren, und – als bei weitem artenreichste Gruppe – die Insekten.“ Die (westdeutschen) „Myriapoden“ gibt es bei Margulis/Schwartz ebensowenig wie in der DDR. Den BRD-Übersetzern ihres „Leitfadens“ gelang es jedoch, das Wort noch schnell im Index unter zu bringen, wo es nun Verwirrung stiftet.
Die DDR-Philologen und -Systematiker waren im Zweifelsfalle genauer als die der BRD – und das ist auch hier der Fall, denn die etwa 11- bis 12.000 Diplopoda-Arten haben alle mindestens 13 Beinpaare, im Höchstfall jedoch nur 340 (u.a. die in den Tropen lebende Art „Siphonophorella progressor“). Unter den europäischen Formen erreichen Weibchen der in den Alpen lebenden Art „Ophioiulus nigrofuscus“ mit 121 Beinpaaren die höchste Extremitätenzahl. Der Klassenbegriff „Myriapoda“ (unzählige Füße) ist also übertrieben, während „Diplopoda“ (Paarbeinige) es besser trifft: Der Körper der so genannten Tausendfüßer besteht nämlich aus paarweise verschmolzenen Körperringen, an denen sich jeweils zwei Beinpaare befinden, bis auf das vordere Segment, das extremitätenlos ist. Manchmal schwankt die Zahl der Beinpaare auch innerhalb einer Art: bei den geschlechtsreifen Männchen der heimischen „Leptophyllum nanum“ z.B. zwischen 67 und 111. Generell gilt, dass die Zahl der „Doppelringe“ sich von Häutung zu Häutung vermehrt – und damit auch die Doppelbeinpaare. Die „Schwankungsbreite“ zwischen den Arten könnte laut „Grzimeks Tierleben“ darauf hindeuten, „dass die Tausendfüßer keine stammesgeschichtliche Einheit darstellen.,“
Die Keimdrüsen der Tausendfüßer befinden sich im Bereich der Hüften des zweiten Beinpaares. Das Männchen nimmt den Samen mit zu diesem Zweck umgestalteten „Begattungsfüßen“ auf – und übergibt ihn dem Weibchen. Einige Arten leben nur ein Jahr, bei vielen stirbt das Männchen nach der Begattung. Bei den „Schnurfüssern“ häutet sich das Männchen danach jedoch und hat dann erst einmal nur noch rückgebildete, lediglich durch Knospen angedeutete Fortpflanzungsorgane. Es gleicht damit wieder einem vor der ersten Reifehäutung stehendem Tier. Durch eine zweite Häutung ist es dann wieder begattungsfähig. Diese Tausendfüßer-Art kann sich also durch Sexualität mehrmals verjüngen – und wird damit älter als die meisten anderen Arten (viele alte reiche Amis und Saudis setzen auf diesen Trick!). Bei den in Mitteleuropa vorkommendenden „Pinselfüßern“, die sich mittels Jungfernzeugung vermehren, hat sich daneben auf der Prominenteninsel Sylt eine von ihnen fortentwickelte zweigeschlechtliche Form herausgebildet (auch das ist typisch für diese Insel und ihre anspruchsvollen Nutzer).
Die meisten Tausendfüßer ernähren sich von abgestorbenen Pflanzenteilen, die sie mit ihren Beißorganen (Mandibeln) zerkleinern. Einige sind sehr wehrhaft, ihr Biß kann beträchtliche Schmerzen verursachen. Zum Lichtsehen haben die Tiere am Kopf Anhäufungen von Einzelaugen (Ocellen), die ihnen jedoch kein Bild liefern, dafür können sie mit den Sinneszapfen und Sinneskegeln an den Fühlern chemisch wahrnehmen. Eine Unterordnung, die „Bandfüßer“, ist sogar stets blind, sie hat dafür in der hinteren Körperhälfte einen flügelartigen Fortsatz, auf dem Wehrdrüsen-Poren liegen. Damit scheiden sie Blausäure aus. Eine Zoologin, die diese Tiere einmal in Afrika in einem Plastiksack sammelte, machte die Erfahrung, dass sie sich damit im luftdichten Sack alle selbst vergiftet hatten. Die „Schnurfüßer“ produzieren sogar ein noch stärkeres Gift: eine Verbindung zweier Chinone, die stark schleimhautreizend wirkt. Bei den „Saftkuglern“ ist dies ein Alkaloid – das so bitter ist, dass eine Maus, die einmal ein solches Tier in den Mund genommen hat, es wohl nie wieder tun wird. Während die zu den „Schnurfüßern“ zählende Art „Schizophyllum sablosum“ sich mit einer auffallend gelben „Warnfärbung“ begnügt. Die „Nemaphotora“ besitzen Spinndrüsen, mit denen sie seidenartige Gespinste herstellen, die ihnen Schutz bieten, ebenso ihrem Eigelege. Bei den „Wehrhaften“ handelt es sich meist um Unterklassen und deren Ordnungen bzw. Überordnungen. Die meisten Tausendfüßer-Arten rollen sich bei Gefahr bloß spiralförmig ein und sind deswegen harmlos.
Seit einigen Jahren werden die großen tropischen Arten zunehmend als Terrarientiere gehalten, in Gefangenschaft können einige bis zu acht Jahre alt werden. Sie lernen, ihren Besitzer von anderen Menschen zu unterscheiden, wahrscheinlich über den Geruch. Im Internet gibt es eine informative Homepage: „diplopoda.de“, dort erfährt man alles über Haltung, Pflege, Fütterung und Nachzucht der „Wörmi“ bzw. „Tausi“, wie die Besitzer ihre Tiere liebevoll nennen. Die Webseite wird von zwei westdeutschen Terrarianern betreut, von denen der eine Biologie studiert. Im Osten gibt es seit 1992 das „Magazin für Wirbellose im Terrarium – Arthropoda“. Es wird von der „Zentralen Arbeitsgemeinschaft Wirbellose im Terrarium“ (ZAG) in Wernigerode herausgegeben. Die ZAG war früher einmal dem Kulturbund der DDR angegliedert, heute kooperiert sie gelegentlich mit den westdeutschen Zentralorganen der Terraristik „Reptilia“ „Draco“ und „Terraria“, in denen ebenfalls gelegentlich über Tausendfüßer berichtet wird. Ihr Weddinger Chefredakteur Heiko Werning meint: „Die DDR-Terraristik war sehr gut. Weil die Tiere Mangelware waren, d.h. dass man sie nicht einfach im Laden neu kaufen konnte, wenn sie einem starben, deswegen hat man sich dort wohl mehr Mühe bei der Haltung, Pflege und Aufzucht gegeben als im Westen.“
2014 führten Wissenschaftler des Senckenberg Forschungsinstituts in Görlitz eine Inventur der in deutschen Gewächshäusern lebenden Tausendfüßer durch. Dabei fanden sie 18 zugewanderte Arten, die bisher noch nicht in Deutschland entdeckt worden waren. Zwei der Tausendfüßer wurden das erste Mal in Südeuropa nachgewiesen.
.
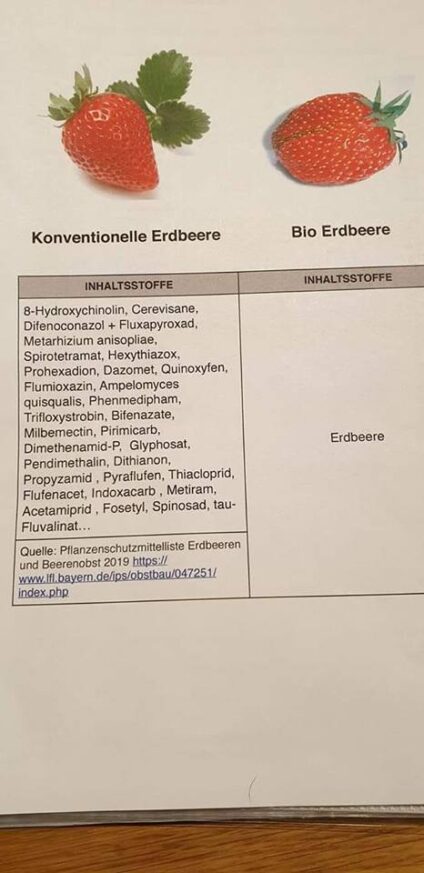
.
Asseln
Im U-Bahn-Fernseher las ich die Schlagzeile „Riesenassel im Meer entdeckt“. Als ich den taz-Computer anstellte und in der Suchmaschine „Riesenassel“ eingab, zeigte sie bereits 96.000 Eintragungen dazu an. Riesenmeeresasseln sind schon lange bekannt und eine Delikatesse in China. Sie sollen besser als Hummer schmecken. Die neue, bisher noch unbekannte Riesenassel fanden die Forscher auf einem Fischmarkt, wo diese Tiere lebend verkauft werden. Sie gaben ihr den Artnamen „Bathynomus vaderi“ – Bathyals ist der lichtarme Bereich des Meeres zwischen 200 und 4000 Meter Tiefe und mit „vaderi“ ist Darth Vader gemeint, weil ihr Kopf sie an den Sith-Lord aus Star Wars erinnerte. Die Riesenassel ist fast 30 Zentimeter lang, hat 14 Beine und wiegt mehr als ein Kilogramm. Damit ist sie etwa 20 Mal so groß wie eine Kellerassel, um die es mir eigentlich in diesem Text geht.
Aber man kann locker von der einen zur anderen Assel kommen: Beides sind Krebse und die Kellerassel eroberte vor etwa 160 Millionen Jahren das Land, wo es sie heute weltweit gibt, in 3500 Arten. Asseln bilden „die ökologisch vielfältigste Gruppe der Krebse,“ schreibt der Krebsforscher Heinz-Dieter Franke (in: „Kleine rote Fische, die rückwärts gehen“ 2024). Die Weibchen der Landasseln produzieren nicht wie die meisten Krebse viele kleine Eier aus denen dann Schwimmlarven werden, die „frühzeitig auf sich allein gestellt sind“, sondern nur wenige große Eier, die sie im Brutraum auf der Bauchseite ablegen. Dort sind die Embryonen vor Austrocknung und Infektionen geschützt, zudem versorgt das Muttertier sie mit Sauerstoff und Salzen.
Laut Franke haben die Landasseln zwar „lungenähnliche Organe“ entwickelt („Hohlräume in den vorderen Beinpaaren,“ nennt sie „biologie-schule.de“). Daneben haben sie aber auch die ursprüngliche Atmung über Kiemen beibehalten, deren Oberfläche nass gehalten werden muß. Dazu entwickelten sie ein „einzigartiges Wasserleitsystem in der Körperoberfläche“, mit dem sie winzigste Massermengen aus der Umgebung aufnehmen und an die Kiemen weiterleiten können.
Die Landasseln siedeln in feuchten „Kleinstlebensräumen“ und ernähren sich von verrottenden pflanzlichen Substanzen. „Sie fressen sogar ihren eigenen Kot und dünsten ihren Urin in Form von Ammoniak-Gas aus,“ schreibt „Die Zeit“.
Als „Primärzersetzer“ bringen sie die Humusbildung in Gang – und machen sich damit nützlich. Zudem kommen sie gut mit „Umweltgiften aller Art“ zurecht, selbst verstrahlte Gebiete nach Reaktorunfällen lassen sie kalt und sie sind „in besonderem Maße immun gegenüber Infektionen“.
Asseln haben ein ähnlich aussehendes Exoskelett wie die Panzer von Gürteltieren, mit dem einige Arten sich wie diese bei Gefahr zu einer Kugel zusammenkrümmen können. Man nennt sie deswegen „Kugelasseln“ (Armadillidiidae), meine Eltern nannten sie „Kellerasseln“ (Porcellionidae): In unserer Wohnung besaßen wir ein großes Beet mit Zierpflanzen, das mit Ziegelsteinen eingefaßt war. Die Steine hatten kleine eckige Löcher und in denen lebten Kellerasseln – tausende (Sie sind sehr gesellig). Dort war es warm und feucht. Man sah diese harmlosen kleinen Tiere aber nie, die als Kugel so groß wie „Liebesperlen“ sind, wenn auch nicht so schmackhaft. Für Kröten, Maulwürfe etc. allerdings schon.
In Frankes Krebsbuch heißt es: Sie können dort, „wo der Mensch ihnen dazu Gelegenheit bietet, auch lebende Gewebe [von Pflanzen] schädigen“. In Gewächshäusern oder Vorratslagern „kann es zu einer Massenvermehrung der Tiere kommen, die Bekämpfungsmaßnahmen notwendig macht.“ Unsere Asselmassen haben nie eine Pflanze geschädigt, aber ungefähr einmal im Jahr wurde es ihnen in den Ziegelsteinlöchern zu eng und ihre Jungen zogen aus, um neuen Lebensraum zu finden. Sie hätten in der zentralheizungstrockenen Luft zwar nicht lange überlebt, wir bekämpften diese Asselinvasionen aber trotzdem, indem wir die ausschwärmenden Tiere jedesmal leicht hysterisch tot traten, dann zusammenfegten und im Klo entsorgten.
Franke schreibt, dass sie auch unsere Wasserleitungssysteme besiedeln, was kaum zu vermeiden sei: Sie klammern sich an „die geringsten Unebenheiten der Rohrwände“…„Bei einem massenhaften Auftreten der Tiere besteht der aus dem Wasserhahn kommende (oft euphemistisch als ‚Rostablagerung‘ angesprochene) Mulm hauptsächlich aus dem Kot von Asseln.“ Vor allem das Trinkwasser aus Talsperren oder Flüssen enthalte organische Schwebstoffe. „Diese bilden die Nahrungsgrundlage von Bakterien und Pilzen, die an den Rohrwänden einen sogenannten Biofilm bilden,“ von dem die Asseln leben.
Daneben erwähnt Franke noch die im Meer lebenden Bohrasseln, die von Holz leben. Anders als Termiten können sie das Holz ohne symbiontische Mikroorganismen in ihrem Magendarmtrakt verdauen. Mit ihrer Bohrtätigkeit gefährden sie Holzschiffe und hölzerne Hafenanlagen.
Der Krebsforscher zählt überdies noch einige Asseln im Kulturbetrieb auf: „Dicke geschäftige Kellerasseln von Krämern“ – wie der Kulturphilosoph Egon Friedell den Menschentypus des Börsenzeitalters abfällig nannte. Dann die „Kellerasselkunst“ (cloportism), als die der Schriftsteller Joris-Karl Huysmans „die angeblich-engstirnige literarische Schule des Naturalismus“ bezeichnete (zu der auch er zählte). Außerdem die „Geschichte zweier Kellerasseln“ – wie Gustave Flaubert seinen letzten Roman betiteln wollte, der dann unter den Namen seiner zwei Protagonisten „Bouvard et Pécuchet“ erschien. Diese beiden Kleinbürger waren wildentschlossen, sich „fast jeder der damaligen Wissenschaften zu widmen“. Der irische Satiriker Jonathan Swift nannte gleich alle Engländer Kellerasseln (woodlice)
Eine weitere Kellerassel erkennt Franke in Franz Kafkas Erzählung „Die Verwandlung“. Darin geht es um einen Mann, Gregor Samsa, der eines Morgens aufwacht und sich über Nacht in ein ungeheures Ungeziefer verwandelt hat. In diesem Tier fand Franke eine Reihe von Merkmalen, die ihn vermuten lassen, dass es sich dabei um eine Riesenlandassel handelt, u.a. weil Gregor Samsa von Kafka als vielbeinig beschrieben wird und weil es ihn „nach typischer Art der Asseln in die Dunkelheit und zu faulender Nahrung“ zieht, was von seinen Mitbewohnern als „eklig“ empfunden wird.
Dabei lassen sich die Landasseln laut Franke in puncto „Sauberkeit“ kaum übertreffen – obwohl sie in Mulm und Abfällen leben: „Mit einer selbstreinigenden Oberfläche, auf der nichts zu haften scheint, treten uns die Tiere stets untadelig gepflegt gegenüber.“
.

.
Maulwurf
„Wenn ihr also den Maulwurf recht fleißig verfolgt, und mit Stumpf und Stiel vertilgen wollt, so thut ihr euch selbst den grösten Schaden und den Engerlingen den grösten Gefallen,“ schrieb der alemannische Pädagoge Johann Peter Hebel. Nun hat sich aber die Situation völlig umgedreht: Es gibt so gut wie keine Engerlinge mehr (die Larven des nahezu ausgerotteten Maikäfers), so dass sich die Maulwürfe an den äußerst nützlichen Regenwürmern schadlos halten, was die Gärtner noch mehr erbost als die Maulwurfshügel auf ihrem Rasen, aber es nützt ihnen nichts, denn in Deutschland sind laut Bundesartenschutzverordnung fast alle heimischen Säugetierarten besonders geschützt. Dazu zählt natürlich auch der „europäische Maulwurf“. Das Weibchen bringt im Juni drei bis vier nackte, anfangs blinde Jungen zur Welt, die sie vier bis sechs Wochen säugt.
Maulwürfe werden selten in Zoos gehalten. Wikipedia berichtet, dass man im Osnabrücker Zoo „Unter der Erde“ welche hielt, aber nachdem mehrere Tiere gestorben waren, wurde die Haltung von Maulwürfen beendet. Ich hielt auch einmal einen Maulwurf, den unsere Katze gefangen hatte, in einem Terrarium mit Erde und Regenwürmern, aber auch er starb nach kurzer Zeit. Zum Trost bekam ich ein Stofftier: „Der kleine Maulwurf“, der durch eine tschechoslowakische Zeichentrinkserie berühmt geworden war. Sie lief später auch im deutschen Fernsehen, für das dann auch das überaus beliebte Kinderbuch „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ filmisch animiert wurde: Auf der Suche nach dem Übeltäter fragt der Maulwurf sich bei allen möglichen Tieren durch: Doch Taube, Kaninchen, Kuh und Schwein beweisen ihm, dass ihre Kothaufen ganz anders aussehen. Den richtigen Tipp bekommt er schließlich von zwei Fliegen, die sich mit der Materie bestens auskennen: Es war der Hund des Metzgers mit Namen „Hans-Heinerich“, der dann auch die Rache des kleinen Maulwurfs zu spüren bekommt.
Dann gibt es ferner eine Maulwurfgeschichte von einem Soldaten im Ersten Weltkrieg, dem ein Maulwurf im Schützengraben das Leben rettete. Franz Kafka machte daraus eine Erzählung mit dem Titel „Der Riesenmaulwurf“. Dieser bleibt jedoch unsichtbar, obwohl ein Dorfschullehrer versichert, ihn gesehen zu haben. Von Primo Levi stammt ein Loblied auf den Maulwurf in Form eines Gedichts. Und von dem ebenfalls aus Turin stammenden Leiter der dortigen Buchmesse Ernesto Ferrero eine Erzählung über das Leben eines Maulwurfs und den aussichtslosen Kampf des Menschen gegen das unterirdisch lebende Tier.
Von Kant verspottet, erfährt der Maulwurf bei Hegel eine erste politische Würdigung: „Bisweilen erscheint der Geist nicht offenbar, sondern treibt sich, wie der Franzose sagt ‚sous terre‘ herum. Hamlet sagt vom Geiste, der ihn bald hier- und bald dorthin ruft: ‚Du bist ein wackerer Maulwurf‘, denn der Geist gräbt unter der Erde fort und vollendet sein Werk.“ So heißt es in Hegels „Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte“. Marx vergleicht dann die Revolution mit einem alten Maulwurf, „der umsichtig unter der Erde das Terrain vorbereitet, um eines Tages ans Licht zu kommen und den Sieg zu erringen“. Auf „deutschlandfunkkultur“ heißt es über diese unterirdische Wühlarbeit des Maulwurfs der Revolution weitaus pessimistischer: „Beharrlich gräbt er seine Wege durch die Finsternis. Vergeblich, aber mit Zuversicht.“ Angesichts der sich erneut weltweit durchsetzenden völkischen Reaktion hat das Berliner Theater „Hau“ jüngst ein trotziges Festival „Der Maulwurf macht weiter“ organisiert. Zuvor hatte man einer historischen Aufarbeitung des bundesdeutschen Buchhandels den Untertitel „Von Marx zum Maulwurf“ gegeben, was sich so anhörte als seien die linken Buchläden und Verlage, bedrängt von Internet und Amazon, für die „Revolution“ bereits so weit, wieder in den Untergrund zu gehen, um „Raubdrucke“ unters Volk zu bringen. Aber was diesmal raubdrucken? „Brehms Thierleben“?
Anders als die meisten Revolutionäre ist der Maulwurf für die Wühlarbeit sehr gut ausgestattet. Das Tierlexikon zählt acht Merkmale auf: „Der Schwanz dient als Tastorgan zur Orientierung in dunklen Gängen. Durch die zylinderförmige Körperform kommt er gut durch die Gänge. Beim Graben schiebt er die Erde mit der Stirn an die Seite. Die rüsselartig verlängerte Nase wird wegen der starken Beanspruchung bei der Wühlarbeit durch einen länglichen Nasenknorpel geschützt. Mit den Ohren kann er jede Erschüterung im Boden und an der Oberfläche hören. Die starken Vordergliedmaßen sind ein hilfreiches Werkzeug für die Wühlarbeit. Das Fell besteht aus überaus dicht stehenden Haaren, die herabfallende Erde wird vom Körper fern gehalten. Die Augen braucht er im Dunkeln seines Lebensraums nicht.“ Wir sagen deswegen auch, jemand sei „blind wie ein Maulwurf“, dabei „ahnen“ wir laut Tagesspiegel nicht einmal, dass Maulwürfe „die Welt farbig sehen und sogar ultraviolettes Licht wahrnehmen, wozu kein Mensch imstande ist.“
Früher hat man sie massenhaft erschlagen, vergiftet, in Fallen gefangen und ihnen das seidenweiche schwarze Fell abgezogen. Jacken, Krägen und Schlafröcke aus Maulwurfsfellen waren lange Zeit schick. Auch und gerade bei den Revolutionären. Heute untersuchen z.B. Leo Peichl und seine Kollegen vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt die Netzhäute von Maulwürfen und anderen unterirdisch lebenden Säugetieren. Diese sterben dabei vermutlich auch, aber heraus kommt am Ende: „Es ist nicht so, dass sich ihre Augen als Anpassung an das unterirdische Leben völlig zurückgebildet haben“, sagt Peichl. „Ihre Netzhaut enthält Stäbchen und zwei verschiedene Zapfentypen wie bei anderen Säugetieren auch.“
Auf „Youtube“ findet man zig Clips, die zeigen, wie Maulwürfe durchs Gras laufen, sich eingraben, dabei Regenwürmer entdecken und fressen; wie sie in einem künstlichen Substrat Gänge graben; wie die Maulwurfsgrillen es ihnen im Kleinen nachtun, mit ebenfalls sehr großen Grabklauen ausgerüstet; wie sie aus einer kaputten Hausecke herauskommen, in allen Löchern am Haus Insekten findet und anschließend nicht mehr in ihre Höhle reinpassen, woraufhin sie immer nervöser und hektischer werden und versuchen, im Garten ein neues Loch zu graben. Ein Clip hat den Titel: „Maulwurf findet ein neues Zuhause“, ein anderer: „Die besten Mittel um Maulwürfe endgültig zu vertreiben“ – eine Anleitung zu ihrer Ausrottung also, die 35.000 Mal aufgerufen wurde. Dagegen steht mit 128.000 Aufrufen ein Clip mit der pazifistischen Frohbotschaft „Maulwürfe gehören nun mal zur Naturlandschaft. Anstatt sie zu bekämpfen, sollte man sich freuen, dass sie die Böden lockern.“
Egal für welches Tier man sich interessiert, man kommt im Internet immer auf dieses Meinungs-Spektrum: Ökonomie versus Ökologie. Alfred Brehm erinnerte bereits daran, „daß die Naturforscher einen großen Theil ihres Wissens alten, erprobten Maulwurfsfängern verdanken.“
.
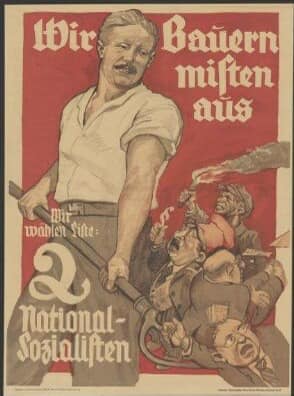
.
Maulwurfsfänger
2019 gab es noch 300 offiziell registrierte Maulwurfsfänger in England. Bei der Gartenliebe der Engländer gibt es daneben natürlich noch Millionen Gärtner und Bauern, die quasi inoffiziell Maulwürfe vernichten. Sie töten mit Gift, Gas, Feuer, Benzin, mit der Hacke oder mit einem Spaten. Man darf sich wundern, dass es überhaupt noch Maulwürfe in England gibt.
„Denn die Hacke der Gärtner ist ein Opfermesser mit dem alles kurz und klein geschlagen wird, die ganze chaotische Vielfalt, um hernach auf dem sauber geeggten Geviert die Homogenität zu zelebrieren, zu züchten,“ wie Michel Serres schreibt. „Wenn die Wut des Messers sich gelegt hat, ist alles bearbeitet: zu feinem Staub geeggt. Auf die Elemente zurückgeführt. Analyse oder: Nichts ändert sich, wenn man von der Praxis zur Theorie übergeht. Agrikultur und Kultur haben denselben Ursprung oder dieselbe Grundfläche, ein leeres Feld, das einen Bruch des Gleichgewichts herbeiführt, eine saubere, durch Vertreibung, Vernichtung geschaffene Fläche. Eine Fläche der Reinheit, eine Fläche der Zugehörigkeit…Der Gärtner, der Priester, der Philosoph. Drei Ursprünge in drei Personen in einer einzigen Verrichtung im selben Augenblick. Es ging nicht darum, die Erde durch Bearbeitung fruchtbar zu machen, es ging um Ausmerzen, Unterdrücken, Vertreiben, es ging um Zerstören, die Hacke des Gärtners ist ein Opfermesser.“
Der englische Maulwurfsjäger Marc Hamer hat ein Buch über seine Arbeit geschrieben: „Wie man einen Maulwurf fängt“ (2019). Der Vegetarier war eine zeitlang arbeits- und obdachlos, arbeitete dann bei der Bahn, studierte Kunst und gab eine Zeitschrift heraus. Dann wurde er Gärtner und mußte sich mit Maulwürfen „auseinandersetzen“. Er wollte sie so human wie möglich töten, aber er tötete sie eben. „Um sie wirklich los zu werden, muß man sie töten. Maulwurffänger können eine Population nur eindämmen.“ Es ist mit dem Maulwurfsjäger ein bißchen so wie mit der autistischen US-Nutztierexpertin Temple Grandin, die laufend Verbesserungen auf Schlachthöfen entwickelt und durchsetzt – zum Wohle der Rinder und Schweine, deren Leben dort allerdings endet.
Marc Hamers Buch beginnt mit dem Satz „Ich habe viele Jahre lang in Gärten und auf Bauernhöfen Maulwürfe gefangen. Maulwurfsfang ist eine alte Kunst, die mir ein gutes Leben beschwert hat, doch nun bin ich alt und das Jagen, Fallenstellen und Töten leid.“ Er ist verheiratet, hat Kinder, wohnt in einem Haus mit Garten, wo er sich vom Saulus zum Paulus wandelte: „Wir freuen uns für die Maulwürfe, die dort leben.“
Vielleicht war es der Einfluß seiner Frau. Ich erinnere an den Gartenbesitzer Helmut Salzinger, der in seinem Buch „Der Gärtner im Dschungel“ (1992) schrieb: „Wenn meine Frau sah, dass fünf Erdkröten groß geworden waren, dann war das eine gute Gartensaison gewesen.“
Sei es, wie es ist, der Maulwurfexperte Marc Hamer gesteht gleich zu Anfang: „Die gesamte Lebensgeschichte eines Maulwurfs zu erzählen, ist unmöglich,“ weil er ja die meiste Zeit unter der Erde im Dunkeln lebt. Deswegen erzählt der Autor vor allem von seiner Jagd auf die Tiere – im Auftrag von Gartenbesitzern. „Maulwurfsfänger erstellen Werbeflyer und Webseiten.“ Am Anfang experimentierte er noch: Seine „Methode sollte effizient, schnell, von Emotionen losgelöst und technisch sein.“ Zwar fing er die poussierlichen Tierchen, weil er damit sein Geld verdiente, „aber natürlich gibt es auch persönliche Gründe, weshalb man einen solchen Beruf wählt,“ schreibt er – und erzählt dann sein Leben (woraus seine „persönlichen Gründe“ allerdings nicht unbedingt hervorgehen).
Das Gärtnern ist für ihn auch eine Kunst, nur dass er dabei nicht mit Pinsel und Bleistift arbeitet, seine Hände sind eher „dafür gemacht, ein Gewehr, eine Axt oder einen Spaten zu halten.“ Seine liebste Freizeitbeschäftigung ist dann auch Holzhacken und Wandern. Als Maulwurfsjäger ist man sowieso viel unterwegs. „Als Gärtner arbeite ich in gepflegten Gärten, die für Menschen gedacht sind, nicht für Tiere und Pflanzen, und die beeindrucken sollen. Aber dort bin ich nie mit dem Herzen dabei. Mein Herz ist in den Wäldern und auf den Wiesen.“
In einem Kapitel erklärt er, was es alles an Maulwurfsarten auf der Welt gibt, sogar weiße (selten), er aber jagt nur den „Europäischen Maulwurf“. Die englischen Archäologen sind an dessen Maulwurfshügeln interessiert: Oft findet man darin Ton- und Glasscherben, die der Maulwurf von unter der Erde heraufgebracht hat. „Sie nennen das Maulwurfologie“. Obwohl Marc Hamer nicht in die unterirdischen Gänge gucken kann, ist er sich sicher: „Maulwürfe haben weder Freunde noch Familie, sie statten einander keine Besuche ab, sie hassen Gesellschaft.“ Sie legen Vorräte mit Regenwürmern an, die sie so verletzen, dass sie zwar weiterleben, aber nicht wegkriechen können. Die Psychiater haben das modifiziert übernommen, indem sie ihre Patienten haufenweise hospitalisieren und unter Drogen setzen, ruhig stellen.
Gegen Ende des Jahres, wenn das Wetter ungemütlich wird, beginnt die Maulwurfsfänger-Saison, denn „sobald es kälter wird und die Würmer sich tiefer in die Erde eingraben, Futter also schwerer zu finden ist, erweitern die Maulwürfe ihr Reich und plötzlich tauchen Hügel auf, wo vorher keine waren. Dann werde ich gerufen.“
Der Maulwurfsjäger trägt keinen weißen Kittel, sondern robuste Kleidung und einen Wachsbaumwollhut mit breiter Krempe. „Auf alten Fotos tragen Maulwurfsjäger immer solche ramponierten, breitkrampigen Hüte.“ Jetzt steht er auf seinem Einsatzfeld: „Ich stelle meinen Blick auf unscharf, versuche jegliche voreilige Schlüsse zu vermeiden und scanne das Feld auf Muster und die Entfernungen zwischen den einzelnen Hügeln ab.“ Dort können etwa 12 Maulwürfe leben, schätzt er. Seine erste Jägerlist: „Ich wasche mir die Hände mit Erde aus einem Maulwurfshügel, um meinen Geruch zu überdecken.“
Ein Maulwurf kann pro Tag etwa 20 Meter „Tunnelsystem“ graben. „Dabei verbaut er kontinuierlich Erde in die Decke und die Wände. Einen Teil schiebt er vor sich her, bis es irgendwann zu viel ist. Dann hält er kurz an und schiebt die Erde hinaus an die Oberfläche. Manchmal sehe ich ganz kurz einen, wie er gerade die riesigen rosa Hände aus dem Maulwurfshügel streckt…Seine Berechenbarkeit, sein Bedürfnis nach einem festen Revier und seine Abneigung gegenüber Veränderungen sind die Schwächen, dank derer man ihn fangen kann. Ich beginne die Jagd, indem ich die frischesten Hügel suche, die erst wenige Stunden alt sind.“
Junge Maulwürfe, die das mütterliche Tunnelsystem verlassen müssen, kommen an die Oberfläche. „Sie taumeln blind über die Wiese und suchen nach Futter. Die meisten werden dabei von Vögeln gefressen. Die Obdachlosen einer jeden Spezies sind stets die leichtesten Opfer.“ Deswegen versuchen die jungen Maulwürfe so schnell wie möglich einen eigenen Tunnel zu graben oder in einen leerstehenden einzuziehen, „dessen früherer Besitzer letztes Jahr einer Falle zum Opfer gefallen ist. Sie beginnen ihr eigenes Leben, und dann werde ich gerufen und soll sie fangen.“
Maulwürfe werden durchschnittlich vier Jahre alt. Sie können quieken und Fiepen, „aber das hört man als Mensch selten.“ Ihr Geschlecht ist schwierig zu bestimmen, „da die äußeren Geschlechtsmerkmale beim Männchen und beim Weibchen fast identisch sind. Die Klitoris des Weibchens ist genauso groß wie der Penis des Männchens.“ Bei den Hyänen ist die Klitoris ebenfalls derart verlängert. „Das Hämoglobin im Blut eines Maulwurfs kann viel mehr Sauerstoff binden als das anderer Tiere, und außerdem haben Maulwürfe die besondere Gabe, ihren Atem noch einmal einzuatmen und somit so viel Leben wie möglich daraus zu ziehen. Der Nachteil dabei ist, dass ihr Blut schlecht gerinnt und sie schnell verbluten.“
Vor etwa 60 Jahren wurden Maulwurfsjäger von Maulwurfstötern bedroht, schreibt Marc Hamer. Sie töteten mit Würmern, die voller Strychnin waren, diese legten sie in die Tunnel und zerstörten damit den Maulwurfsjägern das Geschäft. „Sie konnten nicht nachweisen, ob sie die Maulwürfe wirklich erwischt hatten und ihre Methode barg außerdem das Risiko, eine gesamte Maulwurfspopulation umzubringen.“ 2006 wurde der Einsatz dieses Gifts jedoch trotz Proteste der britischen Regierung von der EU aufgrund seiner Gefahr für die Umwelt verboten. „Seitdem haben die Maulwurfsjäger wieder Arbeit bei den Bauern und Gartenbesitzern und das Mächtegleichgewicht ist wiederhergestellt,“ meint Marc Hamer. Die Maulwurfsfänger wurden immer gut bezahlt, früher erhielten sie sogar jährlich ein festes Gehalt. Er hat gehört, „die Maulwurfspopulation in Großbritannien liege aktuell zwischen 30 und 40 Millionen Tiere und steige stetig weiter, weil die Bauern sie nicht mehr wegfangen lassen müssen.“ Demnach scheint es früher Pflicht gewesen zu sein, wenn man Maulwurfshügel sah, einen Maulwurfsfänger kommen zu lassen.
Marc Hamer versenkt mitunter über 100 Fallen (aus rostfreiem Edelstahl) in das Tunnelsystem eines Maulwurfs, die er täglich kontrollieren muß: Er umzingelt ihn mit Fallen. „Früher habe ich mehrere Maulwürfe gehäutet und das Fell gegerbt, ich wollte einfach wissen, ob ich das könnte.“
Obwohl Marc Hamer sich quasi schon zur Ruhe gesetzt hat und sowieso keine Maulwürfe mehr töten will, rufen immer noch alte Kunden von ihm gelegentlich an, er rät ihnen, „selbst zu lernen, wie man Maulwürfe los wird, oder eine Wildblumenwiese anzulegen, wobei ich ihnen gerne helfe. Gegen Bezahlung, versteht sich. Man muß Maulwürfe ja nicht töten. In Deutschland und Österreich steht der Europäische Maulwurf unter Naturschutz, dort leben die Gartenbesitzer einfach mit ihm.“ Schön wärs!
.
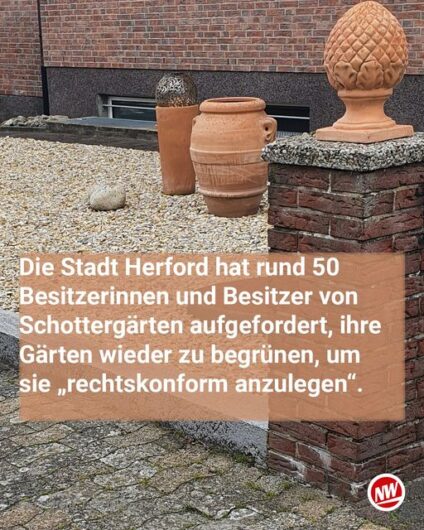
.
Russischer Maulwurf (Desman)
Der Russische , dort auch Wychochol genannt, ist ein im Wasser lebender Maulwurf mit einer langen dünnen Schnauze, die er als Schnorchel benutzen kann. Das auch als „Wassermaulwurf“ bezeichnete Tier ist sehr selten geworden, für das Magazin Focus ist es schon „fast ein Fabelwesen“, aber für Kreuzworträtsellöser ist diese Maulwurfsart mit sechs Buchstaben ziemlich real.
Das deutsche Fernsehen finanzierte im Frühjahr ein Naturfilmteam, um einen lebenden im Wolgagebiet aufzuspüren und zu filmen. Als Sprecher wollten sie den Schriftsteller Wladimir Kaminer verpflichten. Der fragte den Redakteur verwundert: „Haben Sie etwa so wenig gute Sprecher, dass sie einen Laien mit starkem russischen Akzent anheuern müssen?“ Er nahm dann aber den Job doch gerne an.
Anschließend erzählte er: „Die Landschaft ist wunderschön, die Aufnahmen sind spektakulär, doch exotische Tiere kann die mittelrussische Ebene nicht bieten. Die Fauna an der Wolga ist den Deutschen gut vertraut, Wildschweine und Elche, Biber und Schildkröten, Adler, Mäuse und jede Menge Mücken. Das einzige Tier, das es nur an der Wolga und sonst nirgends auf der Welt gibt, heißt Wychochol.“
Es gibt dieses Tier allerdings auch noch – etwas kleiner und mit längerem Rüssel – in den Pyrenäen, wo es ebenfalls immer seltener wird. Die BBC drehte einmal einen Film über diesen „Galemys pyrenaicus“, der sich gern an schnell fließenden Gebirgsbächen aufhält, während der russische „Desmana moschata“ eher an Seen und Teichen zu finden ist. Beide haben Schwimmhäute zwischen den Zehen, können mit ihren Krallen aber auch gut klettern. Ihre Augen sind winzig, wirken jedoch durch eine weiße Umrandung sehr viel größer.
Kaminer bekam vom Sender weitere Informationen über dieses selten gewordene Tier, das einst über ganz Europa verbreitet war: „Es soll ein Millionen Jahre altes Relikt sein, ein Überlebenskünstler, es hat die Mammuts überlebt und Waldbrände und Weltkriege, es hat die Eiszeit und den Kommunismus überlebt und den Niedergang der Sowjetunion ebenfalls, der in meiner Heimat nach wie vor als GGKJ, ‚größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts‘ bezeichnet wird. Die besondere Wehrhaftigkeit des Wychochol, das Geheimnis seines langen Lebens, ist im Schwanz des Tierchens versteckt. Es sind Drüsen, die einen dermaßen stark riechenden Duft produzieren, dass die Kühe das Wasser nicht mehr aus dem Fluss trinken, wenn dort zuvor ein Wychochol vorbeigeschwommen ist.“
Wegen ihres Fells und des Drüsensekrets, das man für die Parfümherstellung verwendete, hat man die intensiv verfolgt, sodass sie an den Rand der Ausrottung gerieten, 1957 wurde die Jagd auf sie deswegen verboten, zuvor gab es bereits einige regionale Schutzzonen für die Tiere, deren Fell an der Oberseite rotbraun und an der Unterseite aschgrau gefärbt ist.
1933 hieß es in einer Zusammenfassung über den Stand der russischen Wychochol-Forschung: „In den letzten Jahren wurde eine Reihe sehr interessanter Arbeiten über die Lebensweise des , dieses kostbaren Pelztieres, veröffentlicht. Während der nun fast zehnjährigen Schutzperiode wuchs der Bestand der Art merklich, sodass wir sie nicht mehr als aussterbendes Tier, sondern nur als leicht ausrottbares bezeichnen können.“
Es gab wiederholt Versuche, die Wassermaulwürfe in Gefangenschaft zu halten und zu züchten – aber ohne großen Erfolg, weil es sich als zu schwierig erwies, sie richtig zu ernähren. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte den neben der Jagd mehr und mehr die Gewässerverschmutzung zu. Laut Wikipedia richteten die sowjetischen Naturschutzbehörden daraufhin mehrere Schutzgebiete ein und initiierten Umsiedlungsprogramme, neben dem Wolgagebiet auch am Ob und am Dnepr, wo die früher nicht heimisch waren.
Gelegentlich werden heute noch Umsiedlungsprogramme durchgeführt: 1983 wurde eine Städtepartnerschaft zwischen Erlangen und Wladimir, einer Stadt am Fluss Kljasma, vereinbart. Im Internetblog „erlangenwladimir“ wird berichtet, dass 2019 die Arbeiten an der neuen Bahnstrecke für Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Moskau und Kasan begonnen haben. Es ist ein chinesisch-russisches Gemeinschaftsprojekt. Die Züge sollen in Wladimir halten – die Hauptstadt des gleichnamigen Oblast liegt an der Kljasma, einem Nebenfluss der Oka, die in die Wolga mündet. Bei den Planungsarbeiten ging es darum, einen Ausgleich zwischen Verkehr und Umwelt zu finden: „So will man etwa 20 Wassermaulwürfe – der Blog berichtete schon öfter über diese fast ausgestorbenen Kleinsäuger – aus einer Zone im Becken der Kljasma umsiedeln, weil man befürchtet, die in der Nähe verlaufende Trasse könnte den Russischen stören.“
An der Wolga musste das Filmteam das kleine, etwa rattengroße Tier lange suchen: „Es folgte seinem Geruch am Fluss, verlief sich beinahe im Wald und wurde dann aber doch fündig: 20 Sekunden lang tauchte der Wychochol aus dem Wasser auf, winkte mit dem Rüssel dem deutschen Zuschauer und verschwand wieder. Schon schön, sagte die Redaktion bei der Abnahme des Films, aber etwas zu wenig Exotik. Deswegen wurde ich als Sprecher mit russischem Akzent angeheuert“, so Kaminer.
Dem Film ist nicht zu entnehmen, dass die im Gegensatz zu den Maulwürfen sozial leben, das heißt, dass sie sich oft zu mehreren einen Bau am Ufer teilen, dessen Eingänge unter der Wasseroberfläche liegen und den sie mit Pflanzenmaterial auspolstern. Gelegentlich legen sie ihre Baue auch in Biberburgen an.
Biber ebenso wie Bisamratten sind Nagetiere und fressen Pflanzen, sind also keine Nahrungskonkurrenten für die Wassermaulwürfe, die man gelegentlich auch als Bisamrüssler bezeichnet. Sie zählen zur Ordnung der Insektenfresser, jagen nachts und haben es dabei auf kleine Fische ebenso wie auf Krebstiere und Amphibien abgesehen, auch Insekten verschmähen sie nicht, das gilt noch mehr für den Pyrenäen-Wassermaulwurf, der sich hauptsächlich von Wasserinsekten und deren Larven sowie von Blutegeln, Ringelwürmern und Schnecken ernährt.
„Er lebt in monogamer Einehe“, behaupten jedenfalls die Autoren von „tierdoku.de“, die an anderer Stelle jedoch schreiben: „Über das Fortpflanzungsverhalten der Pyrenäen-Wassermaulwürfe ist nur sehr wenig bekannt“, gleiches gilt für die Lebenserwartung in ihren natürlichen Lebensräumen. Sie graben keine Baue, sondern nutzen Felsspalten und -höhlen.
Über den Russischen , von dem es noch etwa 30.000 Exemplare geben soll, schrieb Alfred Brehm: „Oft steckt er seinen Rüssel in das Maul und läßt dann schnatternde Töne hören, welche denen einer Ente ähneln. Reizt man ihn oder greift man ihn an, so pfeift und quiekt er wie eine Spitzmaus.“
.
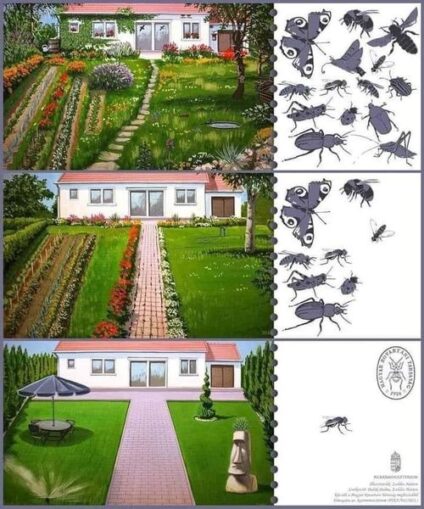
.
Wühlmäuse
Eine Wühlmaus kommt selten allein. Sie sind tag- und nachtaktiv, haben kurze Schwänze, einen gedrungenen Körperbau, ihre Ohren sind klein, ihr Fell ist dunkelbraun und sie sehen nett aus. Neulich fand eine taz-Redakteurin zwei Wühlmäuse auf ihrem Balkon im 5. Stock in einem Blumenkübel. Das wurde angezweifelt, weil die Wühlmäuse, von denen es 150 Arten gibt, eigentlich auf der Erde leben, wo sie Gänge graben, in denen sie sich nicht nur aufhalten, gebären und in Sicherheit bringen, sondern wo sie auch die unterirdischen Teile von Pflanzen fressen.
Beliebt sind bei ihnen die Gartenpflanzen. „Wühlmäuse können schwere Schäden an Wurzelgemüsen, Stauden, Kartoffeln, Obstbäumen und anderen Nutzpflanzen verursachen,“ heißt es auf Wikipedia. Wenn die Gartenbesitzer in den Beeten deren länglich flache Erdhaufen sehen, sind sie entsetzt und sehen die Früchte ihrer Arbeit in Gefahr, weswegen sie sogleich nach Mittel und Wegen forschen (googeln – 33.900 Einträge), wie man diese „Schädlinge“ nachhaltig vernichtet.
Das gilt vor allem für Veganer, die sich schon auf das Ernten ihres gesunden Gemüses im Herbst freuen und sogar planen, zum Erntedankfest alle Freunde mit Gerichten aus Selbstangebautem zu erfreuen. Ein Freund von mir, der Fleischesser ist, sagt sich dagegen: „Lass sie. Diese Wühler wollen auch leben und sie ersparen mir das Ernten und vor allem die noch mühsamere Verarbeitung des Gemüses.“ Er ist sich außerdem unsicher, ob die aufgeworfenen Erdhügel nicht von einem Maulwurf stammen, der zwar auch Gänge gräbt, aber Regenwürmer, Käfer und Wühlmausbabys frisst. Weil Regenwürmer überaus nützlich sind, könnte man ihn ebenfalls als „Schädling“ bezeichnen, aber Vorsicht: Der Maulwurf steht unter Naturschutz! Seine Erdhaufen sind zudem laut Wikipedia „rundlicher und größer, was bei den Wühlmäusen nicht der Fall ist. Auf dem Erdhaufen der Wühlmäuse liegt hingegen meist ein Stein, den sie beiseite geräumt haben.“
Die Nachbarn meiner Eltern haben Wühlmäuse mit einem Wasserschlauch in ihren Gängen zu vertreiben und zu ertränken versucht. Die Autoren des Wikipedia-Eintrags empfehlen „Begasungsmittel, Giftköder oder Mausefallen“. Da sie jedoch gleichzeitig keine Ökoignoranten sein wollen, meinen sie, dass sich „die Förderung der natürlichen Feinde der Wühlmaus – z. B. Hermelin, Mauswiesel und Rotfuchs als hilfreich erweist“. Aber wie „fördert“ man die? In Niedersachsen, wo besonders viele Jäger ihr Unwesen treiben, passiert genau das Gegenteil: Dort hat man so viele Füchse erschossen – etwa 60.000 jährlich (u.a. mit den dort seit 2022 erlaubten Nachtsicht- und Nachtzieltechniken), dass die Bauern nun über eine „Wühlmausplage“ klagen, die für einige sogar schon existenzbedrohend sein soll.
Wem die Unterstützung der Kleinraubtiere nicht gelingen will, dem empfiehlt Wikipedia florale Mittel: „das Anpflanzen von Holunder, Lavendel und auch Wacholder am Gartenzaun“ der für die „auf Duftstoffe empfindlich reagierenden Nager eine natürliche Barriere entstehen läßt. Das Vergießen von vergorener Buttermilch ist ebenfalls eine Möglichkeit, die Schädlinge zu vertreiben.“ Letzteres kommt jedoch für Veganer nicht infrage, da sie tierische Produkte ablehnen. Sonst könnten sie ja auch, wie einige indigene Völker in Nordamerika, gleich die Wühlmäuse essen. Das Internet ist in dieser Hinsicht indigenenunwissend: Gibt man „Mäuse essen“ ein, bekommt man nur Einträge über eine „tiergerechte Ernährung von Mäusen“: Getreide und Sämereien, kein Käse, denn auch die Wühlmäuse sind quasi Veganer.
Garten-Unkräuter wie Giersch, Löwenzahn, Quecke und Sauerampfer werden von ihnen jedoch eher verschmäht. Menschliche Pflanzenfresser können dagegen aus den „Unkräutern“ feine Suppen und Salate zubereiten: Katarina Körner z.B.. Sie hat daraus sogar ein Geschäft entwickelt: mit mehreren „Soup-Kultur“-Läden in Berlin. Ihr Partner Benny Härlin setzt in seinem Projekt „2000-Quadratmeter Weltacker“ aber eher auf Nutzpflanzen als auf Unkräuter. Im Gegensatz zu einem Landwirt in der Rhön, der Unkräuter anbaut, die er an Ackerbauern verkauft. Sie bekommen für das Einsäen eine staatliche Förderung. Das Getreide soll mit diesen, ihren uralten Feld-Partnern, laut neuesten Erkenntnissen besser gedeihen. Was den Wühlmäusen natürlich nur recht sein kann.
Die Literatur über diese Nager ist mager. Da gibt es „Earhart: Der abenteuerliche Flug einer Wühlmaus um die Welt“ von Torben Kuhlmann; „Nur die Wühlmaus war Zeuge – Ein Schrebergarten-Krimi von Martina Pahr; „Wühlmaus, Giersch und Laubenpieper“ von Hartmut Brinkmann; und „Als die winzige Wühlmaus Wanda…“ von Pauls/Bohm/Röckener.
Ich fragte den Schriftsteller Wladimir Kaminer per mail, ob er Wühlmäuse im Garten habe. „Oh ja“, schrieb er mir, „viele“. „Meine Frau Olga fuhr neulich zum Obi-Markt nach Lindow . Sie wollte ein bisschen Gift kaufen, um die schädlichen Mäuse zu beseitigen. Im OBI Markt zeigten sich die Gartenfreunde entsetzt über ihre Mordabsichten. Sie empfahlen Olga unangenehm riechende Tabletten, 20 Euro pro Packung, die man in die Mauselöcher reindrücken sollte. Die Wühlmäuse würden diesen Geruch nicht mögen, meinten sie. Das stimmte auch, die Wühlmäuse mochten die Tabletten wirklich nicht, sie gruben sie aus, brachten sie zu uns und legten sie vor die Tür. Aber wir mochten den Geruch auch nicht. Daraufhin hat Olga den Künstler Alexander animiert, etwas gegen die Wühlmäuse zu unternehmen. Alexander malte ein Schild: „Ihr seid hier nicht willkommen!“ und stellte es im Garten auf. Olga hat ihn darauf hingewiesen, dass Wühlmäuse nicht lesen können, weil sie unter der Erde leben. Daraufhin hat Alexander das Schild mit der Aufschrift nach unten in die Erde gesteckt. Die ganze Nacht hörten wir die Wühlmäuse, wie sie sich unter der Erde darüber amüsierten.“
Es gibt seit 1960 ein Kabarett in Westberlin: „Die Wühlmäuse“ und in Ostberlin seit 1962 die Stasiakte „Wühlmäuse“. Das waren zunächst einige Maoisten aus dem SDS, die Tunnel unter die Mauer gruben – für Republikflüchtlinge, und dann aus der Jungen Union Leute wie Eberhard Diepgen, Rüdiger Landowski und der spätere Astronaut Reinhard Furrer, der einmal bei einer entdeckten Flucht einen Grenzschützer, der sie verfolgte, anschoss. Angeblich gruben sie die Fluchtunnel nicht einmal selbst, sondern ließen dies (gegen Bezahlung?) von Studenten machen. Nichtsdestotrotz bekamen sie für ihre Schlepperdienste einen Orden. Heute, da die Flüchtlinge nicht mehr aus dem Osten sondern aus dem Süden kommen, sind solche Wühlmausdienste nicht mehr sonderlich ehrenvoll.
.

.
Igel
Manche Tiere haben plötzlich Konjunktur, seit einiger Zeit sind es Igel, die 2024 zum „Tier des Jahres“ erklärt wurden . Erst fielen mir auf Facebook Fotos auf, die eine Igelmutter zeigten, die in einem Karton ein halbes Dutzend Junge säugte, dann gleich mehrmals ein Foto von einer Katze, die sieben kleine Igel adoptiert hatte und sie säugte (deren Mutter war von einem Rasenmäher getötet worden). Und immer wieder ein „süßes Igelbaby“ in der offenen Hand eines Menschen liegend.
Im deutschen Internet gibt es mittlerweile mehr als eine Million Einträge über Igel. Ihren Winterschlaf halten sie von November bis März. Manchmal unterbrechen sie ihn aber auch und gehen „einige Tage umher“. Im angloamerikanischen Internet werden unter „Hedgehog“ fast 100 Millionen Einträge gelistet. Dort bekommen die Igelmütter nur halb so viele Junge wie die in Deutschland. Dafür wird interessanterweise erwähnt, dass die Igel „gelegentlich ein Ritual durchführen.“ Die Forscher nennen es „Salbung, wenn das Tier auf einen neuen Duft stößt, leckt und beißt es die Quelle ab, bildet dann einen duftenden Schaum in seinem Maul und klebt ihn mit seiner Zunge auf seine Stacheln. Der Zweck dieser Angewohnheit ist unbekannt, aber einige Experten glauben, dass das Salben den Igel mit dem neuen Duft der Gegend tarnt und Raubtieren, die von seinen Stacheln gestochen werden, ein mögliches Gift oder eine Infektionsquelle bietet.“
Mein Vater hat jedes Jahr einige Igel in einer Holzkiste überwintern lassen, wenn sie munter wurden, gab er ihnen Milch zu trinken (von ihrer Laktoseintoleranz wußte er nichts), danach kratzten sie sich, aber wegen ihres „Stachelkleides“ können sie sich ihrer Flöhe, Zecken und Milben schlecht erwehren. Die Igelstation Göpner empfiehlt, damit sie ruhiger schlafen können, einen Spray namens „Frontline“. Auf „wildtierrettung.de“ heißt es jedoch: Bloß nicht! „1. Ihre Schlafnester sind ebenfalls voll mit Flöhen und sie werden sich genauso viele Flöhe wieder einfangen, aber ihr Immunsystem wird durch das Nervengift auf ihrem kleinen Körper geschwächt.“ Und 2. „‘Dein‘ Igel treibt sich auch im Garten Deiner Nachbarn herum, Dein Nachbar denkt genauso wie Du und besprüht ihn auch mit einem handelsüblichen Flohmittel. ‚Dein‘ Igel hat damit die doppelte Dosis mit dem angeschlagenen Immunsystem und er stirbt.“
Der größte Feind des Igels ist in England der Dachs. Den Namen „Heckenschwein“ hat das Tier wegen seiner lauten Geräusche, die es macht. Dazu schreibt die „deutschewildtierstiftung.de“: „Man hört sie durchs Unterholz rascheln, wo sie auf Nahrungssuche sind. Wenn Sie etwas zu fressen gefunden haben, schmatzen sie laut und knacken bisweilen Schneckenhäuser und Insektenpanzer. Am lautesten sind Igel jedoch, wenn die einzelgängerisch lebenden Tiere auf Artgenossen treffen und in Streit oder auch Paarungslaune geraten. Dann geben sie ein Keckern von sich und können sogar fauchen und kreischen.“ Igel haben kein Territorium, deswegen kann es durchaus sein, dass der fast zahme Igel in einem Garten, den der gerührte Besitzer regelmäßig fotografiert, jedesmal ein anderer Igel ist.
Besonders anrührend ist „die Geschichte des kleinen Igels mit dem großen Herzen: ‚Eine Handvoll Glück‘“ („25 Grammi di Felicita“ so der Originaltitel) über das anfänglich „winzige Igelweibchen Ninna“ des italienischen Tierarztes Massimo Vaccetta. Das Buch veröffentlichte er zusammen mit der Schriftstellerin Antonella Tomaselli. Auf Amazon heißt es dazu: „Massimo kümmert sich aufopfernd um seinen neuen Schützling und schon bald ist Ninna nicht mehr aus seinem Leben wegzudenken. Gemeinsam unternehmen die beiden Nachtspaziergänge, fahren ans Meer und flüchten vor einem gefährlichen Dachsangriff.“
So schlecht ist das Buch aber gar nicht, wie fast jedes Buch über ein oder mehrere Tiere als „companion species“ ist es mit Herzblut geschrieben, so to speak. Wenn man sich auf sie intensiv und lange eingelassen hat, dann bekommt man quasi automatisch mehr heraus (über ein Igelweibchen) als die halbe Igel-Artenforschung, Das Buch ist dennoch das Ergebnis einer Igelforschung, denn, mit den Worten des Ökologen Josef Reichholf, „der Artenschutz steht nicht über dem Tierschutz“. Es war hilfreich, die nichtmenschlichen Lebewesen als Arten zu erforschen, aber nun gehe es um Individuen: „Zu lange wurden sie lediglich als Vertreter ihrer Art betrachtet, das machte sie austauschbar und normierte sie zum ‚arttypischen Verhalten‘, aus dem die ‚artgerechte Haltung‘ abgeleitet wurde. Das ist falsch,“ sagt Reichholf an anderer Stelle.
Über das Igelweibchen Ninna heißt es auf „literallysabrina.de“, der Internetseite einer „Tierliebhaberin“: „Allein das Cover mit dem niedlichen Igel hat mich neugierig gemacht“. Aber auch die Artenschützer sind als Igelretter nicht bar aller Leidenschaften für diese Insektenfresser mit den Knopfaugen.„Urlaub, Wochenende, Feierabend – das sind Begriffe, die im Vokabular der meisten Menschen nicht vorkommen, die sich aktiv und ambitioniert in die Igelhilfe und den Igelschutz einbringen. Oft kreist ihr gesamtes Leben um die liebenswerten Stachler. Im Alltag geben medizinische Behandlung und zeitraubende Routinearbeiten bei Pflege und Betreuung den Takt vor, wenn man sich um hilfsbedürftige Igel kümmert …,“ heißt es in dem Buch „Stachelige Passion“ von Maja Langsdorff. Es werden darin die Geschichten von zwölf Frauen und einem Mann erzählt, „die ihr Leben, ihre Energie und ihre Zeit ganz den Igeln und dem Igelschutz widmen bzw. gewidmet haben.“ Die Porträtierten haben der Autorin von ihrer Igel-Leidenschaft berichtet. Erschienen sind ihre Interviews in Band 9 der Pro Igel-Reihe „Igelwissen kompakt“.
In England wurde unlängst der Guitarist der Rockband „Queen“, Sir Brian May, als „Retter von tausenden verwaisten oder verletzten kleinen Igeln“ bekannt. Er hat mit der Vorsitzenden des „Save Me Trust“ Anne Brummer und seinem Geld das „Amazing Grace Rescue Center“ gegründet. „Es ist wunderbar, den Igeln zu helfen, ich habe dabei so viele Freuden erlebt, an die ich vorher nicht einmal im Traum gedacht habe,“ erzählte er in der Channel 5 Show „Saving Britain‘s Hedgehogs“, über das Aufziehen und Auswildern der Igel in seinem „Rescue Center“, wo sie, um sich an die Freiheit zu gewöhnen, zunächst in einen großen Garten kommen, der „ein Paradies für Igel“ sei. Im Land der Gartenfreunde spielt der Igel eine viel wichtigere Rolle als in Deutschland, das in puncto Igelschutz noch durchaus zulegen könnte. Das meint auch die Wildtier-Stiftung, die mit ihrer Werbekampagne auf den langsamen Rückgang der Igel-Bestände aufmerksam machen will.
.

.
Amsel
Zwei nach Geschlechtern getrennte Forschungsgruppen einer Berliner Privatuniversität befragten im Neubau-Viertel Karow-Nord Ehepaare, ob der Mann oder die Frau bei der Wahl ihres Einfamilienhauses bestimmend war. Sie kamen dabei zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Ähnlich ist es bei den Amselforschern: „Die Rolle des Männchens bei der Nistplatzwahl ist umstritten,“ heißt es auf Wikipedia. „Manche Autoren gehen von einer alleinigen Entscheidung des Weibchens aus, andere nehmen an, dass das Männchen dem Weibchen die in Frage kommenden Nistplätze zeigt oder auf andere Weise mehr oder weniger Einfluss nimmt.“
Bei einer anderen Amselforschung – im Rahmen eines „Jugend forscht“-Wettbewerbs – war die „Sonderpreisgewinnerin“ von der Frage ausgegangen, ob die Londoner und Berliner Amseln unterschiedlich singen: „Ja, es lassen sich Unterschiede (Dialekte) nachweisen.“ Dem Amselgesang widmen sich etliche Vogelforscher, denn die Amsel gilt als „besonders kreativ in der Erfindung, Kombination und Variation von Motiven. Die melodiösen Strophen klingen für menschliche Ohren eingängig und gefällig, ganz im Gegensatz zu dem bei Erregung zu hörenden Zetern oder ‚Tixen‘ . einer Aneinanderreihung hoher ‚tix‘-Laute,“ wie es auf Wikipedia heißt. Nicht zuletzt wegen des Gesangs, von Männchen wie Weibchen, wurden sie in Neuseeland und Australien eingebürgert. Vielen Farmern dort gelten sie nun als Schädlinge und werden verfolgt, weil sie ihre Obstplantagen und Weinberge plündern. In Nordamerika und Südafrika waren die Einbürgerungsversuche erfolglos.
Die Amsel war einmal ein scheuer Waldvogel, aber nach und nach wanderte sie in die Städte ein, wo sie sich stark vermehrte und inzwischen zu den beliebtesten und am wenigsten scheuen Wildvögeln gehört. Der Hobbyornithologe Dr. Salm-Schwader geht davon aus, dass die Ursache für diese Standortverlagerung mit der Erfindung des Rasenmähers und den damit möglich gewordenen großen Kurzrasenflächen in den städtischen Parkanlagen und Gärten zusammenhängt. Den Amseln erleichtern sie das akustische Auffinden von Regenwürmern, die in ihren Gängen ein scharrendes Geräusch verursachen, wenn sie sich bewegen. Die Regenwürmer zählen neben Insekten zur Hauptnahrung der Amseln. Der Hobbybiologe Dr. Salm-Schwader vertritt die These, dass das Kurzhalten der Rasenflächen sich positiv auf die Intelligenzentwicklung sowohl der Amseln als auch der Regenwürmer ausgewirkt habe, denn Je kürzer das Gras, desto schneller müssen beide reagieren.
Seit 2002 gibt es ein Forschungsprojekt namens „ICARUS“, in dem 200 in Gefangenschaft geborene Amseln mit GPS-Sendern ausgerüstet und freigelassen wurden; weitere 1800, die ebenfalls noch besendert werden sollen, will man „aus der Natur“ nehmen, wie der MDR das nannte. Man will dann die Flugrouten der 2000 Amseln verfolgen: Die Sensoren schicken Bewegungsdaten der besenderten Amseln mit präziser Positionsbestimmung an eine Antenne, die an der Außenwand der internationalen Raumstation ISS befestigt ist. An Bord dieses derzeit größten Satelliten im Erdorbit werden die Daten dann bearbeitet. Das System funktionierte auch nach einigen Pannen: Das ICARUS-Team hatte damit „den nächsten großen Meilenstein, mit Tieren rund um den Globus zu kommunizieren, erreicht.“ Als Russland 2022 die Ukraine angriff, wurde die Kooperation jedoch beendet.
„Aber was weiß man, wenn man weiß, ob und wo sich die Singvögel herumtreiben?“ Fragte sich der MDR. „Ihre Migrationsbewegungen von Nord nach Süd und umgekehrt sind bekannt. Auch, dass sich manche inzwischen nicht mehr jährlich auf die Reise machen.“ Man weiß, je weiter nördlich die Amseln leben, in Schweden, Finnland und Russland, desto mehr fliegen im Herbst nach Süden, während von den in Mitteleuropa heimischen sich ein immer geringerer Teil in etwas wärmere Regionen absetzt. Der Ornithologe Jochen Hölzinger weiß sogar, wo sich die Amseln aus Baden-Württemberg hinbegeben – und das ganz ohne ihre Besenderung: Ihr bevorzugtes Winterquartier ist das untere Rhonetal („Die Vögel Baden-Württembergs“ Band 3/1).
Außerdem weiß man, dass die in Städten lebenden Amseln seltener nach Süden fliegen als die in Wäldern lebenden. Und dass die Amselmännchen, häufiger in ihren Revieren bleiben als die Weibchen, höchstens weichen sie kurzfristig der Kälte aus. In den Städten brüten pro Hektar vier und mehr Paare, in den Wäldern kommt höchstens ein Brutpaar auf einen Hektar. Wobei die Beobachtungen der „Bird-Watcher“ ergaben, dass die Weibchen ihre Nester alleine bauen (in Büschen, auf Bäumen oder auf dem Boden) und dass sie ihre vier bis fünf Eier auch alleine ausbrüten. Das Männchen füttert sie währenddessen und beteiligt sich dann auch an der Aufzucht der Jungen.
In der Stadt suchen sich die Amseln höhergelegene Niststandorte als im Wald und scheuen auch nicht vor ausgefallenem Nistmaterial (wie Papier-, Plastik- und Stoff-Fetzen) zurück sowie vor ausgefallenen Nistplätzen – hinter Leuchtreklame, in Briefkästen, auf Balkone, in Motorräumen von Schrottautos… Ein Amselpaar baute einmal sein Nest in einem Berglift, als der in Betrieb genommen wurde, mußte das Männchen stets mit hoch- und wieder runterfliegen, um sein Weibchen zu versorgen und später mit ihm zusammen ihre Jungen.
Im Wikipedia-Eintrag heißt es, dass „im Siedlungsgebiet zwar mehr Bruten pro Jahr erfolgen können, der Bruterfolg aber durch Störungen von Menschen sowie auch von Hauskatzen beeinträchtigt wird und in ländlichen Gebieten oft größer ist. In Gebieten, in denen Rabenvögel, insbesondere Elstern, zahlreich sind, kann es zu einer Häufung von Gelegeverlusten kommen.“
Der Biologe Cord Riechelmann schrieb: Es sei zwar wahr, dass Elstern „in manchen Gegenden einen Großteil der Erstbruten von Amseln fressen. Dennoch lasse sich „kein nachweisbarer Einfluss dieser Tatsache auf den Bestand der Amseln finden. Amseln bringen es in Städten mitunter auf bis zu drei Bruten in einem Jahr und offensichtlich können sie sich den Verlust des ersten Geleges ‚leisten‘.“
Was sie jedoch kaum überleben, ist das seit 2018 durch Stechmücken übertragen Usutu-Virus: „Komplette Straßenzüge in Hamburg liegen voll mit toten Amseln,“ berichtete Renke Lühken vom Institut für Tropenmedizin dem NDR. Der NABU schrieb damals auf seiner Internetseite: „Das Amselsterben nimmt offensichtlich immer größere Ausmaße an. Gab es bis vor einer Woche erst 1.500 Verdachtsfälle, sind es heute bereits 5.000 Meldungen über kranke oder verendete Vögel.“
Wo Amseln in Gärten brüten und gefüttert werden, kann es vorkommen, dass sie die Gartenbesitzer um Hilfe bitten, wenn sich eine Elster ihrem Gelege bzw. ihren Jungen nähert. Die englische Bratschistin Len Howard verließ 1938 ihr Orchester und erwarb ein Haus mit einem großen Garten in Sussex. Dort beobachtete sie über 30 Jahre lang „Alle Vögel meines Gartens“, wie ihr 1952 veröffentlichtes Buch heißt (das 2025 auf Deutsch erschien). 1956 folgte „Living with Birds“. Die holländische Philosophin Eva Meijer schrieb über Len Howards begeisternde Vogelbeobachtungen einen Roman: „Das Vogelhaus“ (2018). Fast alle Vögel, vor allem Meisen, Amseln und Rotkehlchen, aber auch Spatzen und viele andere, die in ihrem Garten oder in der Nähe lebten, benutzten ihr Haus. Sie wurden von Len Howard gefüttert und hatten ein derartiges Vertrauen zu ihr, dass sie sie bei Gefahr um Hilfe riefen. „Was sonst, wenn nicht Denken und Vernunft, hätte sie so handeln lassen sollen? Es ist alles andere als Instinkt, einen Menschen aufzusuchen, im Gegenteil“, schreibt Len Howard.
Sie stellte bei den einzelnen Vögeln, es waren im Laufe der Zeit hunderte, „große Unterschiede in der Persönlichkeit und Intelligenz“ fest, sowohl innerhalb einer Spezies als auch zwischen den Arten. Dennoch fand sie, dass sich ihr „Geist oder Bewußtsein“ nicht „grundlegend von dem unseren unterscheiden“, auch wenn die Ornithologen ihrer Zeit das Gegenteil behaupteten und wohl immer noch behaupten. All ihre „Schlußfolgerungen beruhen auf der Beobachtung einzelner, in Freiheit lebender Vögel aus nächster Nähe. Mit Geduld ist es so möglich, viel aus dem Ausdruck in ihren Augen, aus ihren Bewegungen und aus ihrem Tonfall zu erfahren, die alle zusammen die Sprache der Vögel bilden.“
Umgekehrt sprach sie mit den Vögeln „in meiner ganz normalen Sprechstimme, denn sie lernten in relativ kurzer Zeit, anhand des Tons einige der Wörter zu verstehen…Und durch diesen engen Kontakt gelangte ich allmählich zu einem besseren Verständnis ihrer Denkweise.“ So schloß sie z.B. bei einem Vogel anhand seines „Gesichtsausdrucks, seiner Unruhe und angespannten Haltung“, dass er „zweifelsfrei wirklich besorgt“ war. „Meine Vögel geben mir durch ihre Rufe und Handlungen oder Nunancen in den Bewegungen zu verstehen, was ihnen durch den Kopf geht. Begreife ich nicht sofort, was sie mir klarmachen wollen, finden sie schon bald einen anderen Weg der Kommunikation, meist einen pantomimischen, den sie auch untereinander benutzen.
Der Hallenser Verhaltensforscher Karsten Brensing meinte einmal: Um Tiere zu verstehen, muß man sie gerade vermenschlichen. Als er das in einem Interview äußerte, erschrak er, denn für die objektivistische und reduktionistische Biologie, wie sie u.a. vom Zentralorgan der Genetiker unter den Biologen, der angloamerikanischen „Nature“, vorgegeben wird, ist so etwas tabu.
Ein Drittel von Len Howards erstem Buch mit Beobachtungsprotokollen ist der Vogelsprache im engeren Sinne, dem Gesang, gewidmet – mit Noten. „Noch nie war ein Gesang mir der Sprache so verwandt erschienen,“ schreibt Vinciane Despret (in: „Wie der Vogel wohnt“ 2022), nachdem sie einer Amsel zugehört hatte.
.
.
Wasseramsel
Als Kind hatte ich die Zeitschrift „Der kleine Tierfreund“ abonniert. Einmal konnte man darin eine Reise in die Serengeti gewinnen. Dazu mußte man die Namen von 20 verrätselten Tieren herausfinden, einen Aufsatz über sie schreiben und ein Bild von ihnen malen. Am Schwierigsten war es für mich, auf die verrätselte Wasseramsel zu kommen, von der keiner in meiner Umgebung jemals gehört hatte. Sie läuft auf dem Grund von Bächen, um dort nach Nahrung zu suchen. So ähnlich wie die Amseln auf dem Rasen. Beide suchen Insekten und Würmer, die Wasseramsel dazu noch kleine Fische. „Als Standvogel stürzt sie sich auch in eiskalte Fluten,“ schreibt der BUND. Einen „Unterwasserjäger“ nennt sie „Geo“. Seit ich die Wasseramsel enträtselte, und auch ohne eine Serengeti-Safari zu gewinnen, bin ich ein Bewunderer dieses Vogels, den ich bis heute noch nirgendwo gesehen habe, obwohl er in etlichen Fließgewässern vorkommen soll. Das geht vielen so. In „Jasper und sein Knecht“ (2016) schreibt der holländische Autor Gerbrand Bakker, der in der Eifel wohnt: „Aus dem Augenwinkel entdecke ich im Bach den Vogel, nach dem ich schon zweieinhalb Jahre Ausschau halte. Die Wasseramsel.“
Sie ist die einzige Vertreterin der Familie der Wasseramseln. Das klingt zwar tautologisch, weist aber darauf hin, dass die Wasseramsel eine quasi singuläre Erscheinung ist, auch wenn sie zu den nicht gefährdeten Arten zählt. „Sie ist einzigartig unter den Singvögeln, da sie fliegen, schwimmen, tauchen und sogar unter Wasser laufen kann,“ heißt es auf dem Eifelportal „life-baeche“. Der NABU in Mosbach schreibt: „Sie sind die besten an ein Wasserleben angepaßten Singvögel.“
Man hört und liest nur Gutes über die Wasseramsel. Höchstens, dass die Angler gelegentlich maulen: „Die frißt uns die ganzen Jungfische weg!“ Aber beweisen können sie das nicht, denn sie haben auch noch nie eine Wasseramsel gesehen. Kommt noch hinzu, dass die meisten Menschen heute nur noch aus reinem Vergnügen angeln, während die Wasseramseln davon leben, also moralisch im Recht sind. In dem von der Vogelwarte Sempach herausgegebenen Handbuch „Die Vögel der Schweiz“ erklären die Biologen, was dem vermeintlichen „Fischereischädling“ die Unterwasserjagd erleichtert: „Schwere, markgefüllte Knochen, kurze, rundliche Flügel und ein pelzdunenreiches Gefieder. Das Auge wird unter Wasser durch eine halbtransparente Nickhaut geschützt und das Ohr durch eine Hautfalte verdeckt.“
Die Wasseramsel lebt an schnell fließenden, klaren Gewässern, an deren Ufern sie auch brütet. Das jeweilige Gewässer ist und bleibt ihr Revier, nur wenn es zufriert, treibt es sie ein Stück weiter nach Südwesten. Bei den wegen des Frostes aus dem Osten bis zu uns ausweichenden Wasserameln handelt es sich „merkwürdigerweise“, dem „natur-lexikon“ zufolge „vor allem um weibliche Vögel.“ Dies lasse den Schluß zu, dass die Männchen so lange sie können ihr Revier behüten, d.h. die Weibchen kehren nicht in ihr Revier, sondern in das der Männchen zurück. Die „relative Partnertreue“ ergibt sich durch Festhalten am angestammten Revier.
Dazu fand ich jedoch keinen Hinweis, obwohl alle deutschen Mittelgebirgsregionen und viele Städte im Internet „Wissenswertes“ über „ihre“ Wasseramseln mitteilen. Fast schämt man sich, noch keine gesehen zu haben, zumal die Wasseramsel „Vogel des Jahres 2017“ war. Der Regionalverband Harz schreibt auf seiner Internetseite: „Das Männchen versucht das Weibchen mit eindrucksvollen Imponierflügen, -tauchgängen, Tänzen und Gesang zu betören. Stimmt das Weibchen in den Hochzeitsgesang ein und akzeptiert die dargebotenen Speisen, steht der Familiengründung nichts mehr im Wege. Allerdings sind Möglichkeiten zum Nestbau in Felsnischen und an Steilufern rar geworden.“ Bei Flußbegradigungsmaßnahmen hat man ihnen stellenweise künstliche Bruthöhlen angeboten.
Dem Innsbrucker Alpenzoo gelang 1983 die weltweit erste Handaufzucht von Wasseramseln. Die Vögel verfügen über ein reichhaltiges Stimmrepertoire, ihre Rufe und Gesänge werden jedoch oft von dem lauten Geräusch ihres Lebensraumes übertönt. „Während der Mauser ist die Wasseramsel zwar flugfähig, ihre Manövrierfähigkeit ist jedoch eingeschränkt, deswegen hält sie sich sehr verborgen und verbleibt meist in einem kleinen, besonders beutereichen Abschnitt ihres Reviers,“ heißt es auf Wikipedia, wo auch noch erwähnt wird, dass ein Paar 0,4 Hektar untiefes Wasser beansprucht. Gute Wasseramselgebiete weisen etwa ein Brutpaar auf einen Kilometer Gewässer auf. Am Bach des englischen Farmers und Historikers John Lewis-Stempel ernähren bereits 200 Flussmeter ein Pärchen, ihre Nahrungsbeschaffung ist anglerähnlich, schreibt er in seinem Buch „Ein Stück Land“ (2017): Sie packen den gefangenen Fisch am Schwanz und zerschlagen seinen Kopf auf einem Stein.
Im Osten, bis hin nach Kamtschatka und Taiwan, überlappt sich ihr Verbreitungsgebiet weiträumig mit dem der Flußwasseramsel, die auch Pallasamsel genannt wird – zu Ehren des russischen Naturforschers Peter Simon Pallas, der auf seine alten Tage ein Haus in Berlin bezog, wo jetzt die taz auf ihre alten Tage ihr neues Redaktionsgebäude errichtete. Die Flußwasseramsel ist zwar größer, verträgt sich aber mit der Wasseramsel, die bis an die Zuflüsse des Baikalsees siedelt. Hierzulande überlappen sich ihre Reviere mit der Gebirgsstelze, die jedoch in flachem Wasser Insekten jagt und von Wald gesäumte Bäche bevorzugt, die von der Wasseramsel eher gemieden werden. Ihre bevorzugten Lebensräume sind Bäche und Flüsse der „Forellenregion“, nur selten dringt sie in die „Äschen- und Barbenregion“ vor.
1963 wurde die Wasseramsel durch eine Volksabstimmung zu Norwegens „Nationalvogel“ ernannt. Finnische Ornithologen weisen jedoch darauf hin, dass zwar nur etwa 350 Wasseramsel-Paare in Finnland leben, aber zum Überwintern kommen bis zu 10.000 dieser Vögel aus Nordnorwegen ins Land. Wenn man weiß, wie lang die Winter in Skandinavien sind, könnte man also auch sagen, dass dieser etwa starengroße, dreifarbige Vogel eher in Finnland beheimatet ist. Aber man geht immer vom Brutplatz aus.
Der Herrmann-Hesse-Stipendiat Wulf Kirsten veröffentlichte ein „Gespräch“ mit der Wasseramsel, darin heißt es: „Kaum hatte ich die Stadt Calw betreten und den Fluß im Blickfeld, meinte ich eine Schwalbe in den Wassermassen absaufen zu sehen. Aber der Vogel hatte mich genarrt, denn er tauchte wieder auf – nach geraumer Zeit. Da wußte ich, die heimliche Wasseramsel probt ihre Urbanisierung. Fortan sah ich flußauf, flußab Wasseramseln schwirren, im Mühltunnel verschwinden, Tauchkünste vollführen, Junge füttern. Eines Tages sah ich die Brut aufschwirren, dicht über den Spiegel hin schießen, schwalbenähnlich, aufgestoben, stadtaus an stillere Flußstrecken. Einmal, eines Morgens, und dann nicht wieder. Ich stand an der Brückenbrüstung neben der Kapelle, sah auf die Flußinsel, von der aus Hesse ins Wasser gesprungen war.“
.
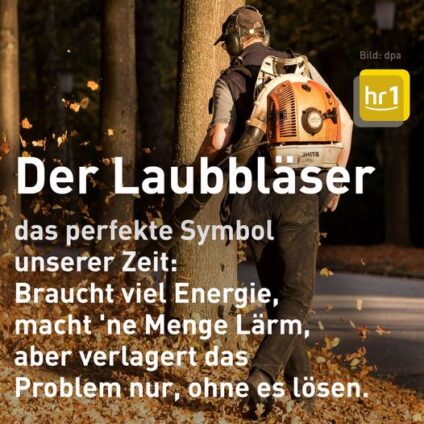
.
Mistkäfer
Der englische Biologe J.B.S. Haldane wurde einmal in einer Gesellschaft von Theologen gefragt, was er bei seiner Erforschung der Schöpfung über den Schöpfer erfahren habe: „Er hatte offenbar eine außerordentliche Zuneigung zu Käfern,“ meinte er. Denn es gibt nur eine Art „homo sapiens“ aber 400.000 Käferarten auf der Erde. Davon sind rund 150 Mistkäfer, 59 leben in Europa, d.h. in Wäldern, Feldern und Steppen, sie sind tag- und nachtaktiv und können fliegen, sind dabei allerdings „eher schwerfällig unterwegs,“ wie „tierchenwelt.de“ über diese schwarzblauen „Dickerchen“ urteilt. Schwerfällig heißt auch, dass sie schlecht steuern können und deswegen oft irgendwo gegenfliegen. Ist es ein Stacheldraht, spießen sie sich daran im Sommer reihenweise auf, bei anderen Gegenständen fallen sie bloß zur Erde, berappeln sich nach einiger Zeit und fliegen erneut los.
„Das Besondere an diesem Käfer ist die Kraft, mit der er das Ziel anfliegt, vorwärtsgetrieben wird, wie ein Torpedo. Der Antrieb dieser Kraft ist am Körper selbst nicht zu finden, im koordinierenden System der Nerven vielleicht, in der Ausscheidung von Wärmetropfen in den Gelenken. Der Käfer hebt sich vom Boden, scheint‘s – schwerfällig und ungeschickt und beinahe, würde man sagen, mit einigem Widerwillen. Und dann setzt die Triebkraft ein. Der Käfer kommt in Fahrt.“ Aber früher oder später: „Stoß gegen den Widerstand – und dann der Sturz. Einmal am Boden, ist alle Kraft gewichen. Ich habe oft den Käfer dann in der Hand gehalten. Er bewegte sich in einem engen Kreis und war noch nicht fähig, ein Ziel anzunehmen. Er war stark angeschlagen. Dazu kam die Panik, dass alles noch einmal begonnen werden muß und daß es weitergeht.“ Dies schrieb der revolutionäre Schriftsteller Franz Jung in seiner Autobiographie „Der Torpedokäfer“ (1972) hieß, denn: „Ich habe den Flug unzählige Male in mir selbst erlebt, bei Tag und bei Nacht. Das Ende ist immer das gleiche gewesen: Anprall, Sturz, Kriechen am Boden.“ – Und dann ein neuer Anlauf. Das hat Franz Jung also mit dem Mistkäfer gemeinsam, aber auch mit Donald Duck: „Wahrer Donaldismus ist Scheitern, es wieder versuchen, nochmal versuchen, wieder scheitern, scheitern, scheitern und nochmal scheitern, doch niemals aufgeben.“
Der gemeine Mistkäfer sucht den Kot von Pflanzenfressern. Er fliegt meist abends in Kreisen um diese Tiere herum und wartet darauf, dass etwas für ihn abfällt, denn er und seine Brut leben davon. Auf einen Kuhfladden landen schon bald zig. Einige, um zu fressen, viele, um sich Vorräte zu sichern.
Die Wissenschaft nennt ihn Geotrupes stercorarius. Geotrupes heißt übersetzt „Erdbohrer“ und Stercorarius: „der, der ausmistet“. Das gilt für Männchen und Weibchen, die ein Leben lang, d.h. ein bis drei Jahre, zusammen bleiben und sich auch – für Insekten untypisch – gemeinsam um den Nachwuchs kümmern. Dazu legen sie in der Erde einen aus vielen Kammern bestehenden Bau an, in den sie Kotkugeln zur Versorgung der Larven mit Nahrung packen. Diese bleiben bis zur Verpuppung ein Jahr in dem mit Lehm verschlossenen Bau, der jedoch ein mit Stroh verstopftes und damit luftdurchlässiges „Fenster“ hat. „Die unterirdische Versorgung des Nachwuchses mit Dung hat einen äußerst positiven Nebeneffekt, denn die Erde wird mit Nährstoffen versorgt und dadurch wesentlich fruchtbarer,“ heißt es auf „biologie-schule.de“.
Wegen der Kotkugeln nennt man ihn und vor allem seinen ägyptischen Verwandten, den scarabaeus sacer, auch „Pillendreher“. Dieser war den Ägyptern heilig, seine Mistkugeln, mitunter so groß wie Äpfel, wurden als ein Abbild der Weltkugel angesehen, er selbst als Verkörperung der Gottheit Chepre mit Skulpturen geehrt und als Amulett getragen. Eine meiner Tanten brachte einmal von einer Ägyptenreise einen solchen Skarabäus mit, den sie an einer Kette am Hals trug. Ihm hatte man einen Edelstein auf den Rückenpanzer geklebt. Er lebte, sie fütterte ihn und setzte sie ihn Nachts in ein Terrarium.
Die Mistkäfer orientieren sich im Dunkeln auf ihren Wegen von der Brutkammer zur Nahrungsquelle nach dem Sternenlicht. Eine Studie über dieses Orientierungsverfahren wurde 2013 mit dem ironischen Anti-Nobelpreis“ ausgezeichnet. 2016 legte eine Veröffentlichung nahe, dass sich Mistkäfer einen Schnappschuss des Nachthimmels merken. Dies passiert laut Wikipedia während sie sich um die Hochachse drehend auf der Dungkugel tanzen. – Hört sich wie ausgedacht an! Der gemeine Mistkäfer ist auch ohne seinen berühmten ägyptischen Verwandten ein interessantes und lustiges Tier. Obwohl er im Mist wühlt, freut man sich im Frühjahr auf ihn, ähnlich wie auf den schon fast ausgestorbenen Maikäfer – und zertritt ihn nicht angeekelt. Dennoch ist die Mistkäferforschung nicht gerade üppig, meist wird in den großen Insekten-Überblicken bloß auf die Beiträge des südfranzösischen Insektenbeobachters Jean-Henri Fabre (1823 – 1915) verwiesen. Im ersten Band seiner zehnbändigen „Erinnerungen eines Insektenforschers“ (2010) heißt es: „Sucht man in der Literatur Einzelheiten über das Verhalten des Scarabaeus im Allgemeinen und des Pillendrehers im Besonderen, stellt man fest, daß die Wissenschaft nicht über die Erkenntnisse der Pharaonenzeit hinausgelangt ist.“
Fabre hat verschiedenen Mistkäferarten dann jedoch viel Zeit gewidmet. Über die kleinsten Pillendreher „Sisyphus schaefferi L.“ schreibt er: Nachdem das Paar sich ein gutes Stück aus dem Kuhfladen rausgesäbelt und es rund geknetet hat, spannt sich die „an ihrem größeren Wuchs erkennbare Mutter“ vorne ein und zieht die Kugel im Rückwärtsgehen, „während der Vater von hinten schiebt“. Weil sie die Kugel stur geradeaus rollen, stürzen sie oft mit ihr auf Hügeln oder Steinen ab, geben aber nicht auf. Alle Mistkäfer könnten Sisyphus heißen! Während die Mutter mit dem Graben der Kammern anfängt, jongliert er so lange mit der Kugel, „indem er sie zwischen seinen in die Luft gestreckten Hinterbeinen sehr schnell rotieren läßt.“ Damit bewacht er sie auch, denn immer wieder klauen sich die Mistkäfer gegenseitig ihre Dungkugeln, die sie nicht nur als Nahrung für ihren Nachwuchs, sondern auch für sich selbst brauchen. Aber den Mistkäfer „wirft ein Dungdiebstahl nicht um, er fliegt zum nächsten Haufen und beginnt von vorn,“ schreibt Fabre (in Band 6). Bei zwei Mistkäferarten aus Argentinien, die er geschickt bekam, wird die Dungkugel gegen das Austrocknen mit einer lehmigen Schicht umkleidet und birnenförmig geformt – mit einer Art Warze am dünnen Ende, in der das Ei untergebracht wird, am Ende der Warze bringen sie einen „Verschluss mit luftdurchlässigem Filzpfropfen“ an. Die einzelnen Arten haben als „Grabegeräte“ ganz unterschiedlich geformte Hörner auf der Stirn, und „alle benutzen einen Rechen: mit ihren gezähnten Vorderbeinen sammeln sie das Material.“ Fabre bewundert und beneidet ihre „Charakterfestigkeit“, die „beinahe an das Reich der Moral rührt“.
.
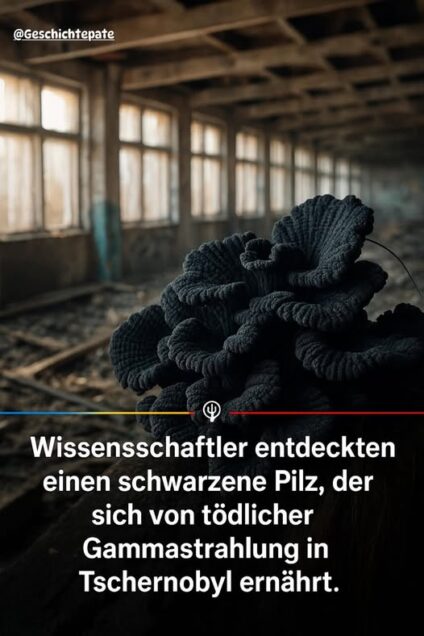
.
Gärten
„Gott steckt in jeder Tomate“ (Spinoza)
Mitten in der Coronazeit begann die Gartensaison. Das „Homeoffice“ einiger taz-Redakteure ist jetzt ein „Datschen-Büro“. Ein Verlag schickte mir ein kleines Buch mit dem Titel „Im Garten“ – von einer Journalistin mit Garten: Susanne Wiborg. Die etwa 30 alphabetisch geordneten, also nicht geordneten Kapitel haben Überschriften wie „Holunder“, „Quitte“, „Nelke“ usw.. Der Witz oder die Idee daran ist, dass sie in der Literatur gesucht hat, wo jemand sich über diesen oder jenen Gegenstand ihres Buches/Gartens geäußert hat. So beruft sie sich z.B. beim „Holunder“ auf ein Holunder-Gedicht von Peter Huchel, um fortzufahren: „Das Christentum bemühte sich nach Kräften, dieses stolze heidnische Gehölz zurechtzustutzen.“
Ich fühlte mich fast beschämt von ihrer Literaturkenntnis. Per mail schrieb ich ihr, dass ich mit dem Buch etwas anfangen könne, aber derzeit sei wegen Corona alles durcheinander geraten, und deswegen…Was auch stimmte. Zudem hatte ich den zu Hause bleibenden tazlern leichthinnig versprochen, mich im verwaisten taz-Gebäude um ihre privaten Topfpflanzen zu kümmern, nicht wissend, dass es über 50 waren. Hinzu kamen noch die sozusagen tazeigenen Pflanzen im Großraum, sowie auf den zwei Dachterrassen und auf dem Hof. Und weil es so warm und trocken war, gierten alle nach Wasser, nach mir. Die Autorin/Gärtnerin hatte Verständnis. Diese Entschuldigung für etwas „Liegengebliebenes“ hört man jetzt im Übrigen von allen Seiten. Als ich zur taz-Gartenbau-Redakteurin ging, um ihr eine Rezension über Wiborgs Buch anzubieten, war ihr Schreibtisch verwaist – natürlich. Es lag darauf die neue Ausgabe der Zeitschrift „Sinn und Form“. Im Inhaltsverzeichnis stieß ich auf zwei Texte des Sprachtheoretikers Francis Ponge – über „Die Nelke“ und „Die Mimose“, die ich mir kopierte. Im ersten schreibt er: „Meine Nelke muß nichts Besonderes sein: Man muß sie nur zwischen zwei Fingern halten können.“
Dann regnete es doch noch ein bißchen – und die Schrebergartenbesitzer waren wieder guter Laune. Ich bekam von der auf Gartenthemen spezialisierten Journalistin Sigrid Tinz gleich drei Gartenbücher geschickt: ein „Lob der Unordnung im Garten“, ein Plädoyer für einen „Frieden mit den Maulwürfen“ und eine Konzeption für eine auf die Pflanzen vertrauende „Gartengestaltung“. Hörte sich alles gut an, obwohl das letzte eher praktisch ausgerichtet war und ich ja eigentlich kein Gärtner bin sondern eher ein Gießer und derzeit mehr ein Notgießer. Zu dem Unordnungsbuch schrieb ich der Autorin, dass ein taz-Mitarbeiter unlängst das Buch „Der Gärtner im Dschungel“ eines Garten-Unordnungs-Theoretikers, Helmut Salzinger, wiederveröffentlicht hat. Zu ihrem Maulwurfsbuch: dass ich schon mehrmals in der taz Artikel über Maulwürfe (deutsche und russische) veröffentlichte hätte und ein weiterer in meiner Schublade läge – über englische Maulwürfe aus der Sicht eines Maulwurfjägers, der tausende von Maulwürfe landauf landab getötet hat, aber sie nun, altersmilde geworden, sogar in seinem Garten leben läßt. Er schreibt: Sein Gesinnungswandel könnte aber auch auf den moralischen Einfluß seiner Frau zurückzuführen sein. Über ihr „Einfach gärtnern“-Buch schwieg ich. Sigrid Tinz schrieb mir zurück, sie freue sich über die schnelle Antwort – auch noch von einem „Maulwurf-Liebhaber“. Das stimmte, die Maulwürfe gefallen mir. Mit dem eher praktischen Gartenbuch von Sigrid Tinz – „Selbst ist die Pflanze“ – konnten vielleicht die „Urban Gardening“-Leute neben dem taz-Gebäude etwas anfangen, überlegte ich.
In einer anthroposophischen Buchhandlung fand ich dann im Schaufenster ein dünnes Büchlein, das mir schon vom Titel her so gefiel, dass ich es kaufte: „Über das Geistige in der Möhre“. Da haben nämlich die wenigsten Pflanzenkundler und -grübler etwas drüber veröffentlicht. Außer Rudolf Steiner natürlich – zu dem ich in landwirtschaftlicher Hinsicht sowieso viel Vertrauen habe, seitdem ich weiß, dass er bereits 1921 den Rinderwahnsinn und das Bienensterben vorausgesagt hat – und zwar mit den richtigen Begründungen. Das ist doch irre oder? Das Möhren–Büchlein enttäuschte mich jedoch: Es handelte sich dabei um eine Wiederveröffentlichung von Steiners „Kurs für Landwirte“, den er 1924 auf einem schlesischen Gutshof vor geladenem Publikum durchführte und woraus dann die „biologisch-dynamische Landwirtschafts“-Bewegung hervorging. Aber ich suchte das Geistige in der Möhre, und die Möhre kam in dem Büchlein nicht ein einziger Mal vor, zudem war das „Geistige“ von Steiner derart ins Gestirn gedacht worden, dass es mir nicht gelang, es zurück auf die Erde zu beziehen, bzw. unter die Erde, wo die Möhren ja bekanntlich stecken.
.

.
Tausendfüßer
Die Tausendfüßer gehören zum Stamm der Gliederfüßer (Arthropoda), und dort zum Unterstamm Tracheentiere. Sie sind meist wurmförmig, zwischen 2 und 28 Zentimeter lang und wegen ihrer vielen Beine manchmal ziemlich schnell. Die Tiere leben fast durchweg an Land – unter feuchten Steinen, Blättern, Baumrinden, in Kellern usw.. Sie besitzen stets ein Paar Fühler und zum Atmen verzweigte Luftröhren (Tracheen).
So weit ist ihre Beschreibung und Einordnung in die Systematik gesamtdeutsch, aber ihre Klassenzugehörigkeit wird im Westen und Osten unterschiedlich gefaßt: In „Grzimeks Tierleben“ (Band 1 – Niedere Tiere) gehören sie zu den „Myriapoda“, im „Urania Tierreich“ (Wirbellose Tiere – Band 2) zu den „Diplopoda“.
Im hervorragenden US-„Leitfaden“ der Zellbiologinnen Lynn Margulis und Karlene V. Schwartz: „Die fünf Reiche der Organismen“ – gehören die Tausendfüßer als Arthropoda (Gliederfüßer) zur Überklasse der Uniramia, auch Tracheata genannt, in der sie als „Diplopodia“ eine von fünf Klassen darstellen. Die anderen vier Tracheata-Klassen – das sind „die Hundertfüßer, die Wenigfüßer, die nur neun oder zehn Beinpaare und verzweigte Antennen aufweisen, die Zwergfüßer, mit zehn bis zwölf Beinpaaren, und – als bei weitem artenreichste Gruppe – die Insekten.“ Die (westdeutschen) „Myriapoden“ gibt es bei Margulis/Schwartz ebensowenig wie in der DDR. Den BRD-Übersetzern ihres „Leitfadens“ gelang es jedoch, das Wort noch schnell im Index unter zu bringen, wo es nun Verwirrung stiftet.
Die DDR-Philologen und -Systematiker waren im Zweifelsfalle genauer als die der BRD – und das ist auch hier der Fall, denn die etwa 11- bis 12.000 Diplopoda-Arten haben alle mindestens 13 Beinpaare, im Höchstfall jedoch nur 340 (u.a. die in den Tropen lebende Art „Siphonophorella progressor“). Unter den europäischen Formen erreichen Weibchen der in den Alpen lebenden Art „Ophioiulus nigrofuscus“ mit 121 Beinpaaren die höchste Extremitätenzahl. Der Klassenbegriff „Myriapoda“ (unzählige Füße) ist also übertrieben, während „Diplopoda“ (Paarbeinige) es besser trifft: Der Körper der so genannten Tausendfüßer besteht nämlich aus paarweise verschmolzenen Körperringen, an denen sich jeweils zwei Beinpaare befinden, bis auf das vordere Segment, das extremitätenlos ist. Manchmal schwankt die Zahl der Beinpaare auch innerhalb einer Art: bei den geschlechtsreifen Männchen der heimischen „Leptophyllum nanum“ z.B. zwischen 67 und 111. Generell gilt, dass die Zahl der „Doppelringe“ sich von Häutung zu Häutung vermehrt – und damit auch die Doppelbeinpaare. Die „Schwankungsbreite“ zwischen den Arten könnte laut „Grzimeks Tierleben“ darauf hindeuten, „dass die Tausendfüßer keine stammesgeschichtliche Einheit darstellen.,“
Die Keimdrüsen der Tausendfüßer befinden sich im Bereich der Hüften des zweiten Beinpaares. Das Männchen nimmt den Samen mit zu diesem Zweck umgestalteten „Begattungsfüßen“ auf – und übergibt ihn dem Weibchen. Einige Arten leben nur ein Jahr, bei vielen stirbt das Männchen nach der Begattung. Bei den „Schnurfüssern“ häutet sich das Männchen danach jedoch und hat dann erst einmal nur noch rückgebildete, lediglich durch Knospen angedeutete Fortpflanzungsorgane. Es gleicht damit wieder einem vor der ersten Reifehäutung stehendem Tier. Durch eine zweite Häutung ist es dann wieder begattungsfähig. Diese Tausendfüßer-Art kann sich also durch Sexualität mehrmals verjüngen – und wird damit älter als die meisten anderen Arten (viele alte reiche Amis und Saudis setzen auf diesen Trick!). Bei den in Mitteleuropa vorkommendenden „Pinselfüßern“, die sich mittels Jungfernzeugung vermehren, hat sich daneben auf der Prominenteninsel Sylt eine von ihnen fortentwickelte zweigeschlechtliche Form herausgebildet (auch das ist typisch für diese Insel und ihre anspruchsvollen Nutzer).
Die meisten Tausendfüßer ernähren sich von abgestorbenen Pflanzenteilen, die sie mit ihren Beißorganen (Mandibeln) zerkleinern. Einige sind sehr wehrhaft, ihr Biß kann beträchtliche Schmerzen verursachen. Zum Lichtsehen haben die Tiere am Kopf Anhäufungen von Einzelaugen (Ocellen), die ihnen jedoch kein Bild liefern, dafür können sie mit den Sinneszapfen und Sinneskegeln an den Fühlern chemisch wahrnehmen. Eine Unterordnung, die „Bandfüßer“, ist sogar stets blind, sie hat dafür in der hinteren Körperhälfte einen flügelartigen Fortsatz, auf dem Wehrdrüsen-Poren liegen. Damit scheiden sie Blausäure aus. Eine Zoologin, die diese Tiere einmal in Afrika in einem Plastiksack sammelte, machte die Erfahrung, dass sie sich damit im luftdichten Sack alle selbst vergiftet hatten. Die „Schnurfüßer“ produzieren sogar ein noch stärkeres Gift: eine Verbindung zweier Chinone, die stark schleimhautreizend wirkt. Bei den „Saftkuglern“ ist dies ein Alkaloid – das so bitter ist, dass eine Maus, die einmal ein solches Tier in den Mund genommen hat, es wohl nie wieder tun wird. Während die zu den „Schnurfüßern“ zählende Art „Schizophyllum sablosum“ sich mit einer auffallend gelben „Warnfärbung“ begnügt. Die „Nemaphotora“ besitzen Spinndrüsen, mit denen sie seidenartige Gespinste herstellen, die ihnen Schutz bieten, ebenso ihrem Eigelege. Bei den „Wehrhaften“ handelt es sich meist um Unterklassen und deren Ordnungen bzw. Überordnungen. Die meisten Tausendfüßer-Arten rollen sich bei Gefahr bloß spiralförmig ein und sind deswegen harmlos.
Seit einigen Jahren werden die großen tropischen Arten zunehmend als Terrarientiere gehalten, in Gefangenschaft können einige bis zu acht Jahre alt werden. Sie lernen, ihren Besitzer von anderen Menschen zu unterscheiden, wahrscheinlich über den Geruch. Im Internet gibt es eine informative Homepage: „diplopoda.de“, dort erfährt man alles über Haltung, Pflege, Fütterung und Nachzucht der „Wörmi“ bzw. „Tausi“, wie die Besitzer ihre Tiere liebevoll nennen. Die Webseite wird von zwei westdeutschen Terrarianern betreut, von denen der eine Biologie studiert. Im Osten gibt es seit 1992 das „Magazin für Wirbellose im Terrarium – Arthropoda“. Es wird von der „Zentralen Arbeitsgemeinschaft Wirbellose im Terrarium“ (ZAG) in Wernigerode herausgegeben. Die ZAG war früher einmal dem Kulturbund der DDR angegliedert, heute kooperiert sie gelegentlich mit den westdeutschen Zentralorganen der Terraristik „Reptilia“ „Draco“ und „Terraria“, in denen ebenfalls gelegentlich über Tausendfüßer berichtet wird. Ihr Weddinger Chefredakteur Heiko Werning meint: „Die DDR-Terraristik war sehr gut. Weil die Tiere Mangelware waren, d.h. dass man sie nicht einfach im Laden neu kaufen konnte, wenn sie einem starben, deswegen hat man sich dort wohl mehr Mühe bei der Haltung, Pflege und Aufzucht gegeben als im Westen.“
2014 führten Wissenschaftler des Senckenberg Forschungsinstituts in Görlitz eine Inventur der in deutschen Gewächshäusern lebenden Tausendfüßer durch. Dabei fanden sie 18 zugewanderte Arten, die bisher noch nicht in Deutschland entdeckt worden waren. Zwei der Tausendfüßer wurden das erste Mal in Südeuropa nachgewiesen.
.

.
Entfremdung
1. In der sozialistischen Frühphase der Bremer Universität, in den Siebzigerjahren, haben wir uns mit den Frühschriften von Marx und dem Begriff der „Entfremdung“ wahre „Paper“-Schlachten geliefert. Und dann verschwand er – der Begriff. Nun verzeichnet Google bereits wieder 852.000 Eintragungen und die Philosophin Rahel Jaeggi veröffentlichte gerade ein Buch „zur Aktualität“ des Entfremdungs-Begriffs. „Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ‚Nach Marx‘ und ‚Der neue Chef‘.“
Die „Entfremdung“ ist ein sinnliches Wort – man denkt dabei an die „Fremde“, romantisch bis elendiglich, an Entwicklungen, die einen „befremden“, ans „Fremdgehen“ und „fremdeln“, ans „Verfremden“ und an „Realitätsfremdes“. Laut Wikipedia ist die Entfremdung ein „Zustand, in dem eine ursprünglich natürliche Beziehung (zwischen Menschen, Menschen und Arbeit, Menschen und dem Produkt ihrer Arbeit sowie von Menschen zu sich selbst) aufgehoben, verkehrt, ge- oder zerstört wird.“ Wir erleiden diese Entfremdung jedoch nicht nur, sondern erschaffen sie uns auch. Bei Hegel heißt es: „Was der Geist will, ist, seinen eigenen Begriff erreichen (den Ort an dem er theoretisch und praktisch in Harmonie mit dem Ganzen steht); aber er selbst verdeckt sich denselben, ist stolz und voll Genuß in dieser Entfremdung seiner selbst.“
In diesem Satz hat sich der Geraer Öko-Landwirt Michael Beleites mit seinem neuen Buch „Land-Wende. Raus aus der Wettbewerbsfalle“ verfangen. Die „Harmonie“ (mit der Natur) sowie „eine Rücknahme überdehnter Naturentfremdung“ ist sein Anliegen – d.h. der „Versuch einer Wiedervereinigung der Realität“. In theoretischer Hinsicht beruft der Autor sich dabei auf sein bereits von mir in der Broschüre „Fische“ (2016) erwähntes Buch „Umweltresonanz: Grundzüge einer organismischen Biologie“. In der „Land-Wende“ geht es ihm nun darum, seine „biologischen Erkenntnisse an einem praktischen Beispiel konkret“ zu machen, und zwar „aus der Perspektive einer fundamentalen Kritik am Selektionsdenken und an der Wettwerbslogik“ (in der heutigen Landwirtschaft). Was für ihn bis hin zu der allgemeinen Forderung nach „mehr Aufenthalt im Freien“ und „mehr körperliche Arbeit in ‚freier Natur'“ geht. Für das Ganze, die Gesellschaft, bedeutet das, „ein integratives Verhältnis zur Natur“ zu finden. Bereits mit der Seßhaftigkeit und der damit zusammenhängenden „Domestikation“ von Tieren und Pflanzen sowie der „Selbstdomestikation“ der Menschen sei es zu einer „Degeneration“ gekommen.
Ebenfalls 2016 hatte Beleites bereits eine Schrift mit dem Titel „Dicke Luft: Zwischen Ruß und Revolte: Die unabhängige Umweltbewegung in der DDR“ veröffentlicht. Mit seinem Buch „Land-Wende“ begibt er sich nun in dünne Luft.
1940 hatte der Verhaltensforscher Konrad Lorenz einen Aufsatz „Durch Domestikation verursachte Störungen arteigenen Verhaltens“ veröffentlicht, der ihm 1973, bei Entgegennahme des Nobelpreis, heftig vorgehalten wurde: „Die Tierzucht“ gerate ihm darin „zum Modell für die Menschenzucht“. Bei Vergleichen zwischen Wild- und Hausgänsen hatte Lorenz fatale „Verfallserscheinungen“ bei den domestizierten Rassen festgestellt – und daraus u.a. geschlußfolgert: Beim Menschen sei es ebenfalls durch Domestikation „zur Vernichtung oder mindestens Gefährdung von instinktmäßig programmierten Verhaltensweisen wie Mutterliebe oder selbstlosem Einsatz für Familie und Sozietät gekommen“, woraus letztlich „Sozial-Parasitismus“ entstehe.
Auch Beleites spricht von „Parasitentum“, dem er eine „organismische Integration“ entgegenstellt. Ob diese aber auch die von Lorenz diagnostizierte „Verluderung der Instinkte“ (die Beleites „eine Art Präzisionsverlust erblicher Verhaltensmuster“ nennt) bei Mensch und Tier verhindert – und ob wir das wirklich wollen, läßt er in seinem durchgängigen „Biologismus“ offen. Erst recht Nietzsches Gegenfrage: „Seid natürlich! aber wie, wenn man eben ‚unnatürlich‘ ist…“
Beleites zitiert dafür den Wissenschaftsjournalisten Jörg Blech: „Die Umwelt in den Industriestaaten passt nicht zur Natur des Menschen.“ – Immer mehr werden krank. Die Bolschewiki waren noch davon überzeugt, sie und ihn passend zu machen. So meinte z.B. der Sowjetdiplomat Adolf Joffe in seinem Abschiedsbrief an Trotzki 1927: „Wer wie ich an den Forschritt glaubt, kann sich sehr gut vorstellen, dass die Menschheit, wenn unser Planet erschöpft ist, längst Mittel und Wege gefunden haben wird, um sich auf anderen, jüngeren Planeten anzusiedeln.“ Selbst die so DDR-verbundene Autorin Christa Wolf notierte sich noch 1959 auf dem Weg zum III. Schriftstellerkongreß in Moskau ein Gespräch, dass sie unterwegs mit Erwin Strittmatter geführt hatte: „Wir reden über die Möglichkeit von ‚Marsmenschen‘, die in letzter Zeit durch die Forschungen sowjetischer Wissenschaftler wieder in größere Nähe gerückt sind. Behaupte noch einer, die beiden Marsmonde (von dem Durchmesser!) seien künstliche Monde, vor Zeiten von vernunftbegabten Wesen hochgeschossen. Die darunterliegende Kultur ist längst vergangen – eine Vorstellung, die mich etwas deprimiert. Auch der große Komet, der 1908 in Sibirien niederging, soll ein Venusschiff gewesen sein.“
Nachdem Juri Gagarin 1961 den ersten Schritt in diese „richtige Richtung“ getan hatte – als Kosmonaut von „Wostok 1“ („Ab gehts!“ so seine berühmten Worte, heute Trinkspruch russischer Männer), jubelte der Philosoph des Judentums Emanuel Lévinas: Damit werde nun endgültig und weltweit das „Privileg der Verwurzelung und des Exils“ beseitigt. Seit Gagarins Weltraumflug gibt es keine „Heimat“ mehr. Fortan würden wir alle in der „Diaspora“ leben – und damit keiner mehr. Womit ein gutes Stück Entfremdung aufgehoben wäre.
Das Gegenteil ist jedoch inzwischen der Fall: Die aus der Lenkwaffenforschung nach dem Krieg entstandene Kybernetik und dann die computerbasierte Gentechnik haben die „Entfremdung“ zum Programm erhoben. Der Fortschrittsphilosoph Vilèm Flusser meinte, dass wir uns noch im Zeitalter der Vorkunst bewegen, die „wahre Kunst“ beginne mit der Gentechnik: „Erst mit ihr sind selbstreproduktive Werke möglich.“ Weniger optimistisch ausgedrückt: Sie läuft darauf hinaus, alle Lebewesen – von der Amöbe über die Birke und den Champignon bis zum Menschen – künstlich herzustellen, und zwar besser als sie sich bis jetzt auf quasi natürliche Weise entwickelt haben. Es ist noch ein weiter Weg bis dahin, aber schon jetzt ließe sich sagen: Es war ein schrecklicher Fehler, die organismische Natur den Naturwissenschaften zu überlassen, die nur Subjekt-Objekt-Beziehungen gelten lassen, verdinglichendes Denken, dabei geht es hierbei um Subjekt-Subjekt-Beziehungen, d.h. um die Welt, wie das Subjekt sie erfährt. Dagegen ließe sich nun wieder einwenden – mit den Worten eines Allgäuer Gräzisten: „Ja … die Sach mim Subjekt … Es is halt ein so junges Kindlein des Westens. ‚Der Pabest ist ze junk!'“ (Walther von der Vogelweide)
2. In seiner Habilitationsschrift Mitte der Achtzigerjahre sprach der französische Philosoph Jean Baudrillard von der „Kunst des Verschwindens“ – verstanden als ein „Tarnverfahren zum Überleben“ – d.h. als eine Subjektstrategie, die auf Verführung basiert. Kurz vor seinem Tod, 2007, hat er diese „Kunst“ noch einmal thematisiert: Diesmal als Objektstrategie eines umfassenden „digital processing“, das den Menschen qua Technologie zum Verschwinden bringt – damit aber auch das Böse sowie alle Radikalität: „Wenn sie sich vom mit sich selbst versöhnten und dank des Digitalen homogenisierten Individuum trennt, wenn alles kritische Denken verschwunden ist, dann geht die Radikalität in die Dinge über. Und das Bauchreden des Bösen wechselt zur Technik selbst hinüber…Wenn die subjektive Ironie verschwindet – und sie verschwindet im Spiel des Digitalen – dann wird die Ironie objektiv. Oder sie verstummt.“ Ja, dank des „Klonens, der Digitalisierung und der Netze“, so Baudrillard, sind wir eigentlich schon so gut wie verschwunden.
Die Ironie als Objektstrategie besteht z.B. darin, dass nach der Wende alle alten und neuen wilden Künstler anfingen, Baustellen zu malen – um ihre Kunst an den Bauherren zu bringen. Anders als früher gab es auf ihren Werken jedoch durchweg keine Bauarbeiter mehr. Deren hilflose Wut zeigte angesichts des Lohndumpings ausgerechnet im Hauptstadt-Bauboom bereits das langsame Verschwinden der alten Arbeiterklasse an – „in Wirklichkeit“ und nicht nur in der Kunst. Dafür wurden „Kranballets“ inszeniert und einmal erschlug ein umstürzender Baukran eine „Nachwuchskünstlerin“ (BILD). Solche ironischen Objektstrategien haben zum Hintergrund die enorme Warenanhäufung. Selbst die Liebe ist nur noch konsumistisch realisierbar: mittels Kinobesuch, Candlelight-Diner, romantischem Urlaub oder anderen Freizeitvergnügungen. Sogar der gelungene Geschlechtsakt hat mehr und mehr Waren bzw. käufliche Dienstleistungen – wie Fitness- und Solariums-Center-Besuche, Pornofilm-Kennerschaft, Reizwäsche, Viagra, Parfums, Öle, etc. – zur Bedingung. Und selbst die gemütliche Kneipenrunde hat sich schon objektmäßig gegen uns gewendet. Das Bier, das wir bestellen, ist nicht mehr Mittel zum Zweck (das Gespräch), sondern umgekehrt: Man hat sich nichts mehr zu sagen, stattdessen rückt die Frage, ob man noch eine Runde und noch eine und noch eine bestellt, in den Mittelpunkt. Dazu gibt es immer mehr Biersorten.
Und sowieso dürfen wir inzwischen nicht einfach mehr miteinander reden sondern müssen kommunizieren: Wie oft sieht man Leute zusammen sitzen und sich fast nur noch mit ihren Handys beschäftigen. Die „kommunikative Vernetzung“ ist zum Wert an sich geworden und nicht mehr „Mittel zum Zweck der Verständigung,“ schreibt Miriam Meckel in ihrem Buch „Wege aus der Kommunikationsfalle“, in dem sie vom „Tanz ums Telefon“ spricht. Allein das Marktvolumen für Klingeltöne beläuft sich inzwischen auf 5 Milliarden Dollar. Und täglich werden 171 Milliarden E-Mails verschickt. Eine Glasgower Studie ergab, dass Bürobeschäftigte bis zu 40 mal in der Stunde ihr E-Mail-Programm aufrufen. Beim Mikrochiphersteller Intel wurde festgestellt, dass selbst Ingenieure, die im selben Büro sitzen, sich lieber E-Mails schicken als miteinander zu reden. Einige große US-Unternehmen haben ihre Mitarbeiter bereits zu „No E-Mail Fridays“ verdonnert. Aber auch nach Feierabend oder gerade dort „organisieren bereits Millionen ihre Freundeskreise über Online-Netzwerke,“ schreibt der Spiegel in seiner Jahresend-Ausgabe – und zitiert eine „Userin“ namens Carolin Thiele (25): „Hundertmal am Tag gehe ich da rein, ganz schlimm.“ In dem neuen Suhrkamp-Reader „Schicht! Arbeitsreportagen für die Endzeit“ hat Feridun Zaimoglu einen Anbieter von Internet-Sex interviewt: Die Männer zahlen über 100 Euro dafür, der Unternehmer meint jedoch, dass viele diesen Bildschirm-Wichs erotischer finden als reale Sexualkontakte. Die BZ veröffentlichte neulich schon Tipps für Leute, die nicht mehr vögeln können, wenn keine Kamera dabei ist, die sie währenddessen aufnimmt. Den Anfang dazu machte die Sängerin Amanda Lear, als sie alle Spiegel in ihrem Haus entfernte und durch Videokamers und Bildschirme ersetzte.
3. In seinem letzten Werk beklagte der englische Dichter Percy Bysshe Shelley 1821 die zunehmende Verarmung von immer mehr Menschen. Für die Ungleichheit und Unordnung machte er vor allem den „ungehemmten Gebrauch des Berechnenkönnens“ verantwortlich.
In Dostojewskis „Aufzeichnungen aus dem Kellerloch“ (1864) sieht ein heruntergekommener ehemaliger Beamter in großer Klarheit, dass eine freie moralische Entscheidung in einer Welt, die zunehmend von instrumenteller Vernunft beherrscht wird, unmöglich ist. Er besteht darauf, dass es nicht für alle gültig sein darf, dass zwei mal zwei vier ergibt, und kritisiert die Fortschrittsgläubigkeit, die aus den modernen Errungenschaften der Technik und Naturwissenschaften (u.a. der Evolutionstheorie) resultiert und auf soziale Vorgänge übertragen wird.
Der spätere indische Premierminister Jawaharlal Nehru schrieb 1943 im englischen Gefängnis über die Auswirkungen des englischen Kolonialismus in seinem Land: „Die unverkennbarste und weitestgehende Veränderung war die Zerschlagung des Agrarsysystems und die Einführung der Begriffe des Privateigentums und des Großgrundbesitzes. Die Geldwirtschaft hatte sich langsam durchgesetzt, das Land wurde eine marktfähige Ware. Woran früher auf Grund bestehender Bräuche streng festgehalten worden war, das wurde jetzt durch das Geld aufgelöst.“
Ähnlich dachte auch der Mathematiker Theodore Kaczynski. Er gehörte zu den kalifornischen Computer-Pionieren. Als er sah, was für mächtige „Global Player“ aus ihren anfänglichen Gedankenspielen (u.a. auf den berühmt gewordenen „Macy-Konferenzen“) erwuchsen, zog er sich in eine Waldhütte zurück, von wo aus er ab 1978 Briefbomben an seine ehemaligen Kollegen schickte, die damit Karriere machten. Kaczynski, den man daraufhin „UNA-Bomber“ (von UN-iversities und A-irlines) nannte, wurde 1996 verhaftet und zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Leipziger Filmemacher Lutz Dammbeck veröffentlichte 2005 das „Manifest“ des UNA-Bombers auf Deutsch. Zuvor hatte er seinen Film „Das Netz“ vorgeführt: Interviews mit Beteiligten an der Entwicklung von Internet-Technologien und den entsprechenden Sozialtheorien. Deren Voraussetzung war die inzwischen nahezu weltweit durchgesetzte und empirisch fruchtbar gewordene Überzeugung, dass die Gesetze komplexer Systeme unabhängig von dem Stoff, aus dem sie gemacht sind – also auf Tiere, Computer und Volkswirtschaften – gleichermaßen zutreffen. Dass der UNA-Bomber einigen dieser Denker und Macher Briefbomben geschickt hatte, wurde als „Maschinenstürmerei“ bezeichnet.
Diesen Begriff (in bezug auf einen Zentralcomputer allerdings noch) hatte 1953 der Schriftsteller Kurt Vonnegut mit seinem Buch „Das höllische System“ reloaded. In dem Aufstands-Szenario, das er darin entwarf, indem er die Militärforschung des „Fathers of Cyborg“ Norbert Wiener und des Mathematikers John von Neumann weiter dachte – geht es um die Folgen der „Maschinisierung von Hand- und Kopfarbeit“, d.h. um die aus dem Produktionsprozeß entlassenen Menschen, die überflüssig geworden sind und nur noch die Wahl haben zwischen 1-Dollarjobs in Kommunen und Militärdienst im Ausland, wobei sich beides nicht groß unterscheidet. Dagegen revoltieren sie, ihr Aufstand wird jedoch niedergeschlagen.
Norbert Wiener beschwerte sich brieflich beim Autor über seine reaktionäre Rolle dabei. Vonnegut antwortete ihm: „Das Buch stellt eine Anklage gegen die Wissenschaft dar, so wie sie heute betrieben wird.“ Es endet damit, dass die Rädelsführer hingerichtet werden, darunter der Seitenwechsler John von Neumann, er verspricht: „Dies ist nicht das Ende, wissen Sie.“
Noch während der Attentatsserie von Theodore Kaczynski – 1984 – beantwortete der Schriftsteller Thomas Pynchon in der „New York Times Book Review“, die alte Frage „Is it o.k. to be a Luddit“? Er spielte damit auf die englischen Maschinenstürmer um 1800 an, die man „Ludditen“- nach ihrem( fiktiven) Anführer Ned Ludd – nannte, wobei Pynchon jedoch an eine mögliche Zerstörung der heutigen elektronischen Rechner dachte. Sein Text endet mit dem Satz: „Wenn die Kurven der Erforschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz, Robotern und der Molekularbiologie konvergieren… Jungejunge! Es wird unglaublich und nicht vorherzusagen sein, und selbst die höchsten Tiere wird es, so wollen wir demütig hoffen, die Beine wegschlagen. Es ist bestimmt etwas, worauf sich alle guten Ludditen freuen dürfen, wenn Gott will, dass wir so lange leben sollten“.
Pynchon sieht demnach ähnlich wie der französische Philosoph Jean Baudrillard das Heil in „Objekt-Strategien“: Erst mit der Vervollkommnung der Logarithmen kehren die Götter wieder, um es mit dem Berliner Kulturwissenschaftler und Pynchonforscher Friedrich Kittler zu sagen. Aber können und wollen wir so lange warten?
.
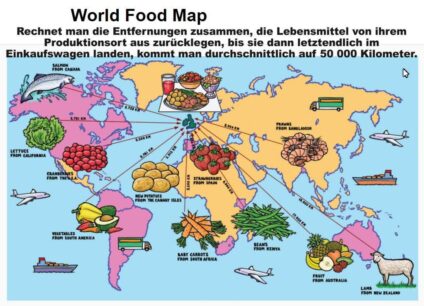
.
Ernte/Dank/Fest
Auf „berliner-woche.de“ findet man alle Erntedank-Events. Vor diesen Feiern für die ganze Familie am 6. Oktober kam aber erst mal die Ernte: Wir hatten mal einen Acker an eine Wohngemeinschaft im Nachbardorf verpachtet, die darauf Zucchinis anbauten. Uns ermahnten sie, nicht zu viel davon zu essen, denn sie wollten die ganze Ernte verkaufen. Aber plötzlich waren tausende von Zucchinis reif und sie hatten sich um nichts gekümmert. Flehentlich baten sie, die Zucchinis an unsere Tiere zu verfüttern, aber die mochte nach drei Tagen keine mehr. Schließlich landete die ganze Ernte auf dem Misthaufen, der daraufhin umkippte und nur noch eine stinkende Lache war.
Wir hatten u.a. sechs Schafe, als wir die das erste Mal geschoren hatten, besaßen wir bereits genug Wolle zum selber Verarbeiten bis an unser Lebensende. Umgekehrt gab es vor einigen Jahren eine Invasion von Nacktschnecken, die den Gartenbesitzern die Ernte erheblich schmälerten. Die Trockenheit in diesem Jahr wirkte sich unterschiedlich aus: Die einen ernteten dank fleißigen Gießens Badewannen voll mit Rucola, bei anderen gab es so gut wie kein Beerenobst, bei einer Freundin so viele Pflaumen, dass ein dicker Ast abbrach, bevor sie ihn abstützen konnte.
Bauern, die nennenswerte Mengen an Weizen anbauten und genug Platz in ihrer Scheune hatten, brachten ihre Ernte nicht gleich zur Mühle, wie die meisten, sondern lagerten sie einige Wochen zwischen – bis der Weizenpreis sich „wieder erholt“ hatte. Das war vor dem Internetzeitalter. Heute ist das Geschäft globalisiert: Schon Monate vor der Ernte müssen die Anbauer Kontrakte auf der Getreidebörse „aushandeln“. Aber dennoch müssen sie noch immer entscheiden, wann der beste Zeitpunkt für den Verkauf ihrer Ernte ist. „Wir beobachten die Getreidebörse genau,“ meinte eine Bäuerin, „doch wenn der Preis nach unserem Verkauf noch steigt, darf man sich nicht darüber ärgern. Dann ist das eben so.“ Ein bißchen so wie mit dem Wetter?
In Italien habe ich erlebt, wie sich alle auf die ersten Tomaten freuten, aber dann wurden es immer mehr – und sie mußten auf verschiedene Weise haltbar gemacht werden. Schließlich konnte keiner mehr Tomaten sehen, geschweige denn essen. Ähnlich war es danach mit den Eßkastanien. Das ist eine richtige Kultur, mit besonderen Lagerplätzen in den Scheunen. Es gibt zig Zubereitungsarten, aber irgendwann ekelt man sich schon vor dem Geruch von Eßkastanien. Zwar werden immer noch mehr als genug geerntet, aber die letzten großen Bäume, die von den einstigen Eßkastanienhainen übrig geblieben sind, werden heute als Naturdenkmäler geschützt.
Das Haltbarmachen der Früchte nach der Ernte ist aufwendig: Tagelang wird entkernt, gewaschen eingekocht, aus Pflaumen im Backofen Mus gemacht und vor allem getauscht: Äpfel gegen Birnen, Salat gegen Beeren usw.. Danach, wenn alle alles im Überfluß haben, wird es im Verwandtenkreis verschenkt und schließlich selbst wildfremden Leuten geradezu aufgedrängt – mit Bemerkungen wie „Das verfault ja sonst. Wär doch schade drum“. Kürbisse sehen im Garten schön aus, aber einer reicht für die ganze Familie. Die Pachtobstbäume an den Alleen trugen heuer wegen der Trockenheit nur wenig, aber keiner wollte selbst die wenigen Äpfel oder Birnen haben. Aus „mundraub.org“ findet man Karten, wo überall in Mitteleuropa welches „herrenlose Obst“ geerntet werden kann. Bis jetzt sind dort 55.730 „Fundorte“ verzeichnet. Bei der Ernte soll man möglichst die Bäume gleich pflegen.
Der Erntedank gilt also erst einmal den Anbauern selbst: Gottseidank sind sie mal wieder alles losgeworden – und haben auch genug Vorräte für sich angelegt. Als nächstes dürfen sie dem Allmächtigen oder wenigstens dem Wettergott und hilfreichen Nachbarn danken. Wenn alle Bücklinge getan sind, darf man getrost ein Fest feiern – und ein bißchen fachsimpeln oder etwas angeben.
.

.
Kleine Erdbewegungen
An der deutsch-holländischen Grenze hielt ein älterer Holländer mit Fahrrad an, auf seinem Gepäckträger hatte er eine Kiste mit Erde. Die Zöllner fragten ihn, ob er etwas zu verzollen habe, was der Mann verneinte. Nachdem er jedoch mehrmals die Grenze überquert hatte durchsuchten sie die Kiste mit Erde und schauten sich auch sein Fahrrad genau an, fanden aber nichts. Das ging so eine ganze Weile, schließlich hielt es ein junger Zöllner nicht mehr aus und sagte zu dem Mann: „Wir wissen, dass Sie etwas schmuggeln. Bitte verraten Sie mir doch: was, ich werde es für mich behalten. „Fahrräder!“ sagte der Holländer.
In Berlin gründeten einige Kenianer ein „On Bidong“, eine Art Bank: Jeder gab allmonatlich 20 Euro in eine Kasse und wenn jemand ein Geschäft gründen wollte, konnte er das Geld beanspruchen. Eine gute Idee, aber dann passierte es, dass einer ihrer Freunde starb und in der Heimat „in roter Erde“ beerdigt werden wollte. Die Überführung seiner Leiche in einem Holzsarg, der noch einmal in einem Zinksarg steckte, kostete mehr als die „On Bidong“-Leute in der Kasse hatten. Sie zahlten dennoch alle Kosten der Überführung und fingen wieder von vorne an zu sparen.
Etwas anderes dachten sich die Freunde von Jakov Blau in Odessa aus: Er war in den Achzigerjahren ausgewandert und hatte sich in Lyon niedergelassen. Als er alt wurde, wünschte er sich, ebenfalls in der Heimat beerdigt zu werden. Eine Überführung seiner Leiche nach Odessa war jedoch zu teuer, auch wußte er nicht, ob man ihm das überhaupt genehmigen würde. Aber dann hielt Putin 2022 eine „Peter-der-Große-Rede“, in der es ihm um „russische Erde einsammeln“ ging. Jakov Blaus Odessaer Freunde brachte das auf die Idee, ihm regelmäßig Pakete mit billigen Odessaer Souvenirs zu schicken, die sie statt in Papier in Erde packten. Ihre Idee funktionierte und Jakov Blau war auch einverstanden damit (viele russische Exilierte haben sich eine Handvoll russische Erde auf ihr Grab in der Fremde werfen lassen). Fortan kamen regelmäßig Pakete mit Erde bei Jakov Blau an, die er in seiner Wohnung stapelte.
Noch lebt Jakov Blau, aber die Geschichte geht noch weiter: Ich besuchte den umtriebigen Unternehmer Juri Sergienko in Perm, den ich kurz nach der Wende bereits als russischen Partner der DDR-Pipelinebaufirma GABEG kennengelernt hatte. Die Firma war für drei Abschnitte der Gaspipeline (die von Sibirien über die CSSR bis in die DDR reichte) verantwortlich: in der Ukraine, bei Moskau und im Oblast Perm. Der neureiche Sergienko hatte mit einigen Unternehmerfreunden ein nicht-öffentliches Restaurant in Perm gegründet, wohin er mich einlud. Nach einigen alkoholhaltigen Erfrischungsgetränken erzählte ich ihm Jakov Blaus Erdgeschichte, wobei ich erwähnte, dass er und seine Odessaer Freunde damit den KGB bzw. den Nachfolger FSB ausgetrickst hätten. Zu meiner Überraschung verwahrte sich Sergienko entschieden gegen jeden Witz über den KGB, vor allem aus deutschem Mund. Er stand auf, zahlte unser beider Zeche und ging.
Zurück in Berlin erfuhr ich von einem russophilen Freund eine weitere Erdbewegungsgeschichte. Sie spielte sich auf der Insel Walaam im Ladogasee bei Petersburg ab. Der See ist der größte Europas und die Insel Walaam (Teil eines Archipels) war ein großer nackter Felsen auf der einst ein orthodoxes Kloster gebaut wurde und drum herum etliche Kirchen und Kapellen. Die Gläubigen, die dort über Jahrhunderte hinpilgerten, brachten alle einen Sack Erde mit, worauf die Mönche Blumen und Gemüse pflanzten. Nach der Revolution wurde aus der Insel ein Straflager und nach dem Zweiten Weltkrieg eine Siedlung für Kriegsversehrte. Ab 1990 übernahm die orthodoxe Kirche wieder die Insel und belebte auch das Kloster neu, zu dem nun auch der ehemalige KGB-Offizier Putin gerne hinpilgert.
In dem Buch „Nachruf aufs Paradies“ von Lutz Dursthoff über „Meine Frau, unsere russische Datscha und ich“ (2024) las ich später, dass der Kölner mit seiner aus Russland stammenden Frau ein Haus in einem Dorf nahe der weissrussischen Grenze besitzt (oder bis zum Ukrainekrieg besaß) und dass die beiden einmal mit dem Schiff von Petersburg aus die Klosterinsel besucht hatten. Dort sahen sie, dass man inzwischen noch mehr Erde auf die Insel getragen hat: „ausreichend für einen dichten Fichtenwald“.
Der Berliner Künstler Alexander „Xandi“ Krohn erzählte mir, dass ihn einmal ein Freund gebeten hatte, ihm für seine Tochter „gelben Wüstensand“ aus Australien mitzubringen. Für die zwölf Kilo musste Xandi Übergepäck bezahlen, aber das war ihm das Geschenk wert. Als dann jedoch ein anderer Freund von ihm starb, ein Australier, der als Musiker im Prenzlauer Berg gelebt hatte, erbat Xandi sich das Säckchen mit Sand zurück, um es dem Toten mit ins Grab zu geben. Und so geschah es dann auch.
.
.
Kartoffeln
Wenn man in Rom eine Kartoffel mit der rechten Hand über die linke Schulter in den Trevi-Brunnen wirft, dann sollen angeblich alle Wünsche wahr werden. Dieser Aberglaube wird von der Stadtverwaltung quasi wissenschaftlich, genauer gesagt: volkswirtschaftlich aufgefangen, indem man die 200.000 Kilogramm, die Bedienstete jährlich aus dem Brunnen fischen, verkauft. Siehe dazu auch „Macht und Magie in Italien“ von Thomas Hauschild – eine ethnologische Studie, die sich bemüht, die Aufklärung nicht gegen den Aberglauben ins Feld zu führen. So wie es z.B. noch Friedrich Engels tat, als er sich 1878 kurz der „Geisterwelt“ zuwandte. Er war noch äußerst optimistisch, dass die aufklärerisch-wissenschaftliche Arbeit diesem Spuk früher oder später ein Ende bereiten würde: „Hat es aber schon die Arbeit von Jahrtausenden erfordert, bis wir einigermaßen lernten, die entferntern natürlichen Wirkungen unsrer auf die Produktion gerichteten Handlungen zu berechnen, so war dies noch weit schwieriger in bezug auf die entfernteren gesellschaftlichen Wirkungen dieser Handlungen.“ Dazu erwähnt Engels den Anbau der Kartoffel in Europa „und in ihrem Gefolge die Ausbreitung der Skrofeln.“ Dabei handelte es sich um leichte Vergiftungen, hervorgerufen durch den Verzehr der grünen Teile von Kartoffelpflanzen: Die Forschung hat dieses anfangs aus Unkenntnis entstandene Problem schnell beseitigt. (1)
Danach stand dem massenhaften Anbau und Verzehr von Kartoffeln in Europa erst einmal nichts mehr im Weg. Um auf den unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad von „natürlicher“ und „politischer Ökonomie“ zu sprechen zu kommen, fragte Engels weiter: „Was aber sind die Skrofeln, gegen die Wirkungen, die die Reduktion der Arbeiter auf Kartoffelnahrung auf die Lebenslage der Volksmassen ganzer Länder hatte, gegen die Hungersnot, die 1847 im Gefolge der Kartoffelkrankheit Irland betraf, eine Million fast nur kartoffelessender Irländer unter die Erde und zwei Millionen über das Meer warf?“ (2)
Dagegen helfe nur die Organisierung der Massen und mit Hilfe des wissenschaftlichen Sozialismus der Klassenkampf. Aber erst einmal wurde dann der Kartoffelkäfer zum Problem. Während die Kartoffel aus Südamerika stammt, kommt der Käfer aus Nordamerika, genauer gesagt: aus Colorado, weswegen man ihn in den USA auch „Colorado Beetle“ nennt. Seine ursprüngliche Nahrungspflanze war die Büffelklette (Solanum rostratum), die auch zur Familie der Nachtschattengewächse gehört. Den Übergang auf die Kartoffel ermöglichte ihm das Vordringen der weißen Siedler, die Kartoffeln aus Europa mitbrachten und anbauten, „so wurde dem Käfer seine neue Nahrungspflanze praktisch entgegengebracht“, heißt es bei Wikipedia. In Europa hatte der Kartoffelkäfer keine natürlichen Fressfeinde, seine Warnfarben schützten ihn. Erst in den letzten Jahrzehnten begannen einheimische Vogelarten, u.a. Fasane, den Kartoffelkäfer als Beute anzunehmen. Vor allem versucht man, der Käferplage durch Chemikalien und eine gezielte Infizierung der Käfer mit dem Bacillus thurengiensis Herr zu werden. Auf kleineren Feldern wird er auch heute noch meist per Hand aufgelesen und vernichtet.
In der Weimarer Republik behauptete die deutsche Propaganda in einem Merkblatt, dass die Kartoffelkäferplage vom Erzfeind Frankreich verursacht worden sei. Im Zweiten Weltkrieg behauptete die Nazi-Propaganda, dass die Amerikaner Kartoffelkäfer als biologische Waffe einsetzen würden, indem sie sie über deutsche Felder abwürfen. Als um 1950 herum fast die Hälfte aller Kartoffelfelder in der DDR vom Kartoffelkäfer befallen wurde, machte die staatliche Propaganda erneut die Amerikaner dafür verantwortlich. Gleichzeitig mobilisierte die Regierung alle Schüler und Studenten, um den „Amikäfer“ und seine Larven auf den Feldern abzusammeln. Unterdes forderte die amerikanische Regierung von der Bundesrepublik Deutschland, propagandistische Gegenmaßnahmen zu unternehmen. Diese beschloss daraufhin einen Postversand an sämtliche Gemeinderäte der DDR und den Ballonabwurf von Kartoffelkäferattrappen aus Pappe mit einem aufgedrucktem „F“ für „Freiheit“. Die etwas unglückliche Aktion bestärkte die DDR noch in ihrer Annahme, es mit einer großangelegten US- bzw. Nato-Sabotageaktion zu tun zu haben, die darauf abzielte, eine Hungersnot in den sozialistischen Ländern herbeizuführen. Auch Polen wurde 1950 von einer Kartoffelkäferplage heimgesucht: „Unerhörtes Verbrechen der amerikanischen Imperialisten“, titelte im Mai des selben Jahres die „Trybuna Ludu“. Bis dahin war man dort davon ausgegangen, dass die deutsche Wehrmacht 1939 den Kartoffelkäfer in Polen eingeschleppt hatte. Die Deutschen hatten dort zuvor, im 18 Jahrhundert, schon die Kartoffel eingeführt, weswegen man sie in Polen auch „Berliner“ nannte. 1950 wurde nun ebenfalls das halbe polnische Volk mobilisiert, um der Kartoffelkäferplage Herr zu werden. Bereits 1946 war dazu eine Kampfschrift: „Der Kartoffelkäfer – ein bunter Saboteur“ von Irena Ruszkowska veröffentlicht worden. (3)
2001 stand die Kartoffel in Polen erneut im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit: Die Danziger Künstlerin Julita Wojcik hatte eine Performance in einer Warschauer Galerie angekündigt, die darin bestand, dass sie 50 Kilogramm Kartoffeln schälen wollte. Das sei keine Kunst, wurde ihr daraufhin vorgeworfen, ihr gehe es nur um den Skandal, denn „nach der Performance würden die Kartoffeln nicht verzehrt, es handle sich also um Verschwendung und Rowdytum,“ schreibt Sebastian Cichocki in „Alphabet der polnischen Wunder“. 2006 wurde der polnische Präsident Lech Kaczynski von der Berliner tageszeitung mit einer Kartoffel verglichen, woraufhin dieser eine offizielle Entschuldigung von Deutschland, mindestens von der tageszeitung verlangte. Das tat der taz-Journalist, Peter Köhler, auch – allerdings nicht beim Präsidenten, sondern bei der Kartoffel.
2007 wurde in Deutschland die Sorte „Linda“ zur Kartoffel des Jahres erklärt. Es gibt sie seit 1974, kreiert hat sie das Pflanzenzuchtunternehmen „Europlant“, das 2004 den Sortenschutz, der bis 2009 gültig war, an das Bundessortenamt zurückgab, weil die Firma inzwischen eine neue Sorte gezüchtet hatte, die ihr noch profitabler als „Linda“ dünkte. Die Kartoffelanbauer, aber auch viele Konsumenten, die sich inzwischen an Linda gewöhnt hatten, protestierten dagegen. Im Kartoffelanbaugebiet Lunestedt, zwischen Bremen und Hamburg gelegen, sowie in Barum bei Lüneburg gründete sich zur Rettung der alten Sorte erst ein regionaler „Linda-Freundeskreis“, der sich bemüht, sie wieder – für viel Geld – zugelassen zu bekommen, nicht nur in Deutschland, und sodann eine bundesweite „Ackerfront“, in der u.a. die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) und der Verband „Bioland“ sowie der Verein „Slow Food Deutschland“ vertreten sind. Die „Ackerfront“ hat nun zusammen mit dem Künstler Torsten Haake-Brandt eine „Hommage an die beste Kartoffel der Welt“ in Form eines Buches veröffentlicht – im Berliner „Karin Kramer Verlag“. Die Autoren stammen zumeist aus Lunestedt und Umgebung: „Kartoffelbauern wie die Familie Wrede, Erntehelfer, Freunde und Liebhaber der Kartoffel. Sie alle leben mit Linda in enger Verbundenheit,“ schreibt Torsten Haake-Brandt im Vorwort. Einer, Jürgen Bahlmann, bezeichnet darin die Züchter von Europlant als „Agrarhampelmänner“ und meint, dass sich ihre Linda-Ersatzsorte „Belana“ wie eine Slipeinlage anhöre. Bis der Streit mit der Firma, die laufend gegen die Linda-Rettungsaktivitäten klagt, ausgestanden ist, hat er für seine Kartoffeln eine „provisorische Insellösung“ – im Blumentopf – gefunden, wie er schreibt und mit Photo beweist. Andere Beiträge beschäftigen sich z.B. mit Kartoffelroder, Kartoffelschälen, Kartoffelschnaps und dem eingangs bereits erwähnten Kartoffelwerfen am römischen Wunschbrunnen.
Bei der „Ackerfront“ und ihren Buchautoren handelt es sich um eine westdeutsche Initiative. Das eigentliche Kartoffelanbaugebiet war jedoch Ostdeutschland: Einmal wegen der sandigen Böden in weiten Teilen des ostelbischen Junkerlandes und zum anderen wegen der großflächigen Anbaumöglichkeiten. Hier galt z.B. der mehrmalige Gutsverwalter und spätere Schriftsteller Hans Fallada als „Kartoffelexperte“ – angeblich konnte er 1000 Sorten auseinanderhalten. Nun macht dort in Brandenburg seit einigen Jahren eine Initiative für „nicht-kommerzielle Landwirtschaft“ (NKL) von sich reden. Sie begann unter der Parole „Kartoffeln für alle!“, wozu u.a. auch solche von der Sorte Linda gehören. Dazu verschickten die Diplomlandwirte von der „Lokomotive Karlshof“ 2006 einen „Aufruf zur Selbstorganisierung“ an rund 200 Wohn- und Landprojekte, um deren Bedarf an Kartoffeln zu erfassen. Sie kamen schließlich auf 4150 Kilogramm, woraufhin sie auf 0,7 Hektar Kartoffeln pflanzten. Mit 50 Helfern ernteten sie dann 4,5 Tonnen. 2007 erweiterten sie wegen des gestiegenen Bedarfs die Anbaufläche auf über einen Hektar, bekamen jedoch Probleme mit dem Kartoffelkäfer. 2008 ernteten sie bereits 15 Tonnen, die Erntehelfer wurden immer weniger, dafür schafften sie sich immer mehr Maschinen an. Ein Teil der Ernte wird in Berlin über sogenannte „Kartoffelcafés“ abgesetzt.
In ihrer Broschüre „NKL – ein Erfahrungsbericht“ heißt es, dass sie über das „Kartoffel-Experiment“ hinausgehen wollen – und müssen: „Schritt für Schritt wollen wir auch diese Herausforderungen angehen und im NKL-Rahmen finanzieren. So läuft gerade eine Finanzkampagne an, um Geld für einen größeren Traktor und weitere Bodenbearbeitungsmaschinen zu organisieren, die wir für die Grundbodenbearbeitung benötigen. Wir glauben, dass das ‚Netz‘ aus vielen es schafft, auch für die nächsten Jahre die Finanzierung in Angriff zu nehmen, und das gibt uns Mut.“ Die Finanzkampagne der NKL besteht im wesentlichen aus Spendenaufrufen
Dazu merkt einer ihrer Erntehelfer aus der Nachbarschaft, dem es ziemlich viel Spaß gemacht hat, mit ca. 20 anderen Kartoffeln aufzusammeln, ausgehend von einem Marx-Zitat, an: „‚An die Stelle des ökonomischen Werts der Dinge als indirekte und feteschistische Vermittlung trete die menschlich-soziale Kommunikation als direkte Vermittlung, die den kapitalistischen Irrationalismus ausschließe‘. Wenn ich das richtig verstanden habe, heißt das, dass sich die Kartoffeln vom Lebensmittel zum Kulturgut verwandeln. Und so hab ich es auch erfahren, die Arbeit verwandelt sich in ein Ferienlager. Das hat was von vorweggenommener Utopie.
Aber ein wenig absurd find ich es doch, wenn den Lebensmitteln, die ich mit produziert habe, auf der einen Seite ihr Geld-Wert entzogen wird, und auf der anderen Stelle, begründet mit der praktischen Kapitalismuskritik, wiederum Geld-Mittel eingeworben werden müssen, um NKL möglich zu machen.“
Ich möchte abschließend dazu bloß noch anmerken, dass die Kartoffel schon bei den Inkas ein „Kulturgut“ war und es erst recht jetzt in Form und Substanz der Sorte „Linda“ ist. Kultur beschränkt sich nicht nur auf die Assoziation von Subjekten, sondern schließt auch die Objekte mit ein, um so mehr, wenn sie – wie in diesem Fall die Kartoffeln – gewissermaßen im Lebensmittelpunkt stehen. Es ist aber noch ein weiter Weg, bis wir wirklich von der Naturgeschichte der Art „Kartoffel“ (Solanum tuberosum) und der Zuchtsorte „Linda“ zur Kulturgeschichte der Kartoffelpflanze Linda als Individuum kommen. Dazu oder dabei müßte erst einmal die Dichotomie von Natur und Kultur (Gesellschaft) und die von Objekt und Subjekt überwunden werden.
Anmerkungen:
(1) Im Internet findet sich dazu die Eintragung: Alle grünen Teile der Pflanze, die Beeren und die am Licht ergrünten Teile der Kartoffel, enthalten das für die Gattung Solanum typische Glyko-Alkaloid Solanin, das eine unangenehme Hautreizung hervorruft, leicht zu verwechseln mit den Skrofeln. Und das neue Gewächs roch in den Blättern anders als die bisher gekannten Pflanzen. Wenn Lager- oder Winterkartoffeln ungeschützt im Freien liegen, so werden sie grün. Nach ein bis zwei Tagen werden sie giftig und können weder gegessen noch verfüttert werden.
„Ein hübscher Knabe namens Brosi besaß einen Raben,/ der hatte aber im Herbst zu viele junge Kartoffeln ins Futter bekommen und war gestorben und … begraben“, schrieb Hermann Hesse. Die Blätter und Knollen sind dann stark blausäurehaltig. Insofern ist verständlich, wenn behauptet wurde, der Genuß der Kartoffeln rufe Aussatz, eine der gefürchteten Krankheiten jener Zeit, hervor. Sicherlich hat eine Rolle gespielt, die Knollen zwar zu kochen, aber nicht zu schälen oder zu pellen. Kartoffeln wurden auch in Preußen-Brandenburg verantwortlich gemacht für Gicht, Bleichsucht, Hautausschläge und Rheumatismus sowie für andere Krankheiten.
Karl Marx diskutierte das Kartoffelproblem etwas anders: „die Kartoffel, die Baumwolle und der Branntwein sind Gegenstände des allgemeinsten Gebrauches. Die Kartoffeln haben die Skrofeln erzeugt; die Baumwolle hat zum großen Teil die Schafwolle und das Leinen verdrängt, obwohl Leinen und Schafwolle in vielen Fällen von viel größerem Nutzen sind, sei es auch nur in hygienischer Beziehung. Endlich hat der Branntwein über Bier und Wein gesiegt, obwohl der Branntwein als Genußmittel allgemein als Gift anerkannt ist. Während eines ganzen Jahrhunderts kämpften die Regierungen vergeblich gegen das europäische Opium; die Ökonomie gab den Ausschlag, sie diktierte dem Konsum ihre Befehle. Warum aber sind Baumwolle, Kartoffeln und Branntwein die Angelpunkte der bürgerlichen Gesellschaft? Weil zu ihrer Herstellung am wenigsten Arbeit erforderlich ist und sie infolgedessen am niedrigsten im Preise stehen. Warum entscheidet das Minimum des Preises in bezug auf das Maximum der Konsumtion? Vielleicht etwa wegen der absoluten Nützlichkeit dieser Gegenstände, wegen der ihnen innewohnenden Nützlichkeit, wegen ihrer Nützlichkeit, insofern sie auf die nützlichste Art den Bedürfnissen des Arbeiters als Mensch und nicht des Menschen als Arbeiter entsprechen? Nein – sondern weil in einer auf das Elend begründeten Gesellschaft die elendesten Produkte das naturnotwendige Vorrecht haben, dem Gebrauch der großen Masse zu dienen. (aus: „Das Elend der Philosophie“)
(2) Die Kartoffelkrankheit „Braunfäule“ ist ein mit der Kartoffel aus Südamerika eingeschleppter Schmarotzerpilz, der zwischen 1845 und 1850 nahezu alle in Europa angebauten Kartoffeln erfaßte. „Als wirksamstes Mittel gegen den Pilz hat sich das zwei- bis dreimalige Bespritzen der Pflanzen mit einer fein zerstäubten Kupfervitriolkalklösung (Bordelaiser Brühe) bewährt,“ schreibt Meyers Lexikon. 2002 gelang Forschern des Max-Planck-Instituts für Züchtungsforschung in Köln die Isolierung eines Gen, das Kartoffeln vor dieser sog. „Kraut- und Knollenfäule“ schützt: Das zum Resistenz-Gen R1 gehörende Protein alarmiere die Kartoffelzellen, wenn eine Pilzspore eindringe. Weltweit richtet der Erreger der Ernteschäden von rund zwei bis drei Milliarden Euro jährlich an. Unter Leitung von Christiane Gebhardt sei es dem Kölner Forscherteam gelungen, das Gen R1 auf dem fünften von zwölf Chromosomensträngen der Kartoffel aufzuspüren und zu isolieren, teilte die Max-Planck-Gesellschaft mit. Das Gen codiere ein Protein von etwa 1300 Aminosäuren, die im Fall von Eindringlingen eine hypersensitive Reaktion in der Pflanzenzelle auslösten. Die Zellwände würden dicker, so dass sich die Pilzsporen nicht ablagern könnten. Außerdem stoße die Zelle Stoffe aus, die für den Erreger (Phytophthora infestans) giftig sind. Mit dem isolierten Gen hätten die Wissenschaftler nun „eine Art Prototyp“ in der Hand, erklärte der MPI-Mitarbeiter Agim Ballvora. Im Erbgut der Kartoffel lägen mehrere andere Resistenzgene in unmittelbarer Nähe, darunter Gene zur Abwehr des Fadenwurms (Globodera). „Wir hoffen, dass die verschiedenen Resistenzgene eines Tages so weit erforscht sind, dass wir den gesamten Abwehrmechanismus der Kartoffel verstehen und für die Entwicklung neuer Sorten nutzen können“, sagte Ballvora.
(3) An einer Stelle geht es darin um einen Lehrer, der die Kinder und Erwachsenen über die mit der US-Sabotageaktion verbundenen Gefahren aufklärt, um sie zum Kampf gegen die Kartoffelkäfer zu motivieren: „Wenn der Feind die Oberhand gewinnt, wird die Kartoffel vielleicht eines Tages zu einer Delikatesse, die nicht für jedermann erschwinglich ist, so wie Orangen oder Bananen.“ In der DDR veröffentlichte die DEWAG Werbung 1950 eine Broschüre „Arbeiter und Bauern, seid wachsam. Kartoffelkäfer entlang der Bahn und Strassen“. Das bezog sich vor allem auf den sächsischen Landkreis Bautzen. Dazu waren auf einer Karte alle Befallstellen von Kartoffelkäfern in diesem Kreis mit roten Punkten verzeichnet worden.
.
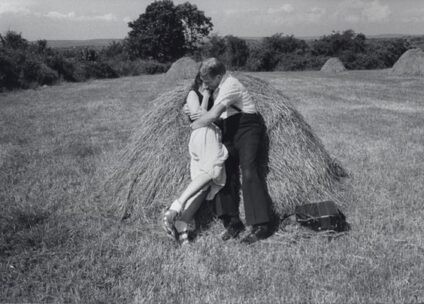
.
Florale Gefühle
1926 kam nach vierjähriger Produktionszeit der Film „Das Blumenwunder“ in die Kinos – und begeisterte die Künstler und Philosophen. Man sprach von einem „Biologischen Kino“. Gedreht wurde der mit einem Orchester musikalisch untermalte Stummfilm auf dem Versuchsgelände „Limburger Hof“ der BASF. Der Vorsitzende des Chemiekonzerns, Carl Bosch, war Hobbybotaniker und seine Firma hatte gerade einen Volldünger – „Nitrophoska“ – auf den Markt gebracht. Der Film war als Werbemaßnahme gedacht, denn der neue Kunstdünger mußte bei den Bauern erst noch durchgesetzt werden.
Inzwischen ist dies fast flächendeckend geschehen, die Biermösl Blosn singen: „Gott mit dir, du Land der Baywa [ein bayr. Agrargroßhändler], deutscher Dünger aus Phosphat / Über deinen weiten Fluren liegt Chemie von fruah bis spaat / Und so wachsen deine Rüben, so ernährest du die Sau / Herrgott, bleib dahoam im Himmi, mir hom Nitrophoska blau.“
In der Programmzeitschrift für das „Das Blumenwunder“ hieß es: „Stickstoff hin Stickstoff her, Werbezweck hin, Werbezweck her, hier war Höheres zu sehen.“ Und das sahen dann auch nach kurzer Zeit über 70.000 Kinobesucher so. Am Anfang werden einige im Garten spielende Mädchen von einer Frau, „Flora“ persönlich, darüber belehrt, dass man aus Gedankenlosigkeit und Gewalttätigkeit keine Pflanzen ausreißen darf.
Der philosophische Anthropologe Max Scheler schrieb seiner Frau, er hätte im Kino fast geweint: „man sieht die Pflanzen atmen, wachsen und sterben. Der natürliche Eindruck, die Pflanze sei unbeseelt, verschwindet vollständig. Man schaut die ganze Dramatik des Lebens – die unerhörten Anstrengungen.“
Der andere philosophische Anthropologe Helmuth Plessner war da gegenteiliger Ansicht: „Natürlich macht es Eindruck, wenn man im Film die Bewegungen etwa einer Ranke oder Winde“ sieht. Aber dabei eine Empfindungsfähigkeit zu unterstellen, sei grundsätzlich ein „Verrat am Wesen der Pflanze“. (Der Geobotaniker Hansjörg Küster hält noch heute die Pflanzen für gänzlich „willenlos“.)
Ähnlich sah das auch der Lebensphilosoph Ludwig Klages. Er sprach von einer „Sachverhaltsfälschung“, „wenn im zeitverdichtenden Laufbild die Tabakspflanze hastig in die Höhe schießt und Wurzeln schlangenartig auseinandergleiten…“ Wie wir ja wüßten, liegt der Zeitballung wie Zeitzerdehnung eine „Loslösung der metrischen Zeit von der Wirklichkeitszeit zugrunde.“ Klages konstatiert daher eine „Wesensverfehlung“ in den zeitgerafften Pflanzenbewegungen.“
Für Walter Benjamin waren diese Photos und Filme von Pflanzen dagegen eine willkommene „Erweiterung des Blicks“, mit dem die gezeigten „Formen den Schleier, den unsere Trägheit über sie geworfen hat, von sich abtun.“ Er schrieb: „Ob wir das Wachsen einer Pflanze mit dem Zeitraffer beschleunigen oder ihre Gestalt in vierzigfacher Vergrößerung zeigen – in beiden Fällen zischt an Stellen des Daseins, von denen wir es am wenigsten dachten, ein Geysir neuer Bilderwelten auf.“
Aus einem ganz anderen Grund davon begeistert war der Biosoph Ernst Fuhrmann, der nicht nur ausführlich „Das Blumenwunder“ würdigte, sondern auch selbst – gestützt auf die gleichermaßen botanischen wie künstlerischen Aufnahmen zweier Fotografen – eine illustrierte Reihe mit Monographien einzelner Pflanzengruppen, „Die Welt der Pflanze“ betitelt, herausgab, daneben den Bildband „Die Pflanze als Lebewesen“. Sie sollten helfen, „sich auf das Wesen der Pflanze zu konzentrieren.“
Für den Schriftsteller Franz Jung bedeuteten seine Arbeiten eine „Bloßlegung der geheimen Fäden, die Mensch, Tier und Pflanze verbinden.“ Alfred Döblin rezensierte Fuhrmanns Fotobuch in der „Frankfurter Zeitung“, wobei er erwähnte, auch selbst vom „Blumenwunder“-Film beindruckt worden zu sein. Danach habe er sich gefragt: „Was soll man jetzt machen? Tiere kann man nicht essen, nun sind auch noch die Pflanzen lebendig, jetzt fürchte ich mich, in ein Kohlblatt zu beißen.“
Tatsächlich zeigte das Haus der Kulturen der Welt in Berlin 2012 im Rahmen seiner Ausstellung „Animismus – Revisionen der Moderne“ einen sowjetischen Film, in dem ein Weißkohl zerschreddert wurde, während ein anderer Kohlkopf neben ihm, an eine Art Lügendetektor angeschlossen, die heftigsten Reaktionen zeigte. Sie ließen sich als Todesangst deuten. Ironischerweise fand dort im Haus zur selben Zeit ein Kongreß statt, auf dem die Tierrechtsaktivistin Hilal Sezgin bei der Frage „Was soll man jetzt machen?“ auf ihre vegetarische Lebensweise zu sprechen kam, die sie damit begründete, dass Pflanzen „keine Gefühle“ hätten. Im Gegensatz zu Tieren. Sie stieß mit dieser Meinung bei den Zuhörern auf heftigsten Widerstand.
.

.
Lachende Wiesen
Auf einer wunderschönen Wiese in der Rhön fanden manchmal Lesungen statt. Ich las dort zuletzt einen Text über „Lachende Wiesen“: Wir können uns keine „lachende Wiese“ mehr vorstellen. Sie ist über Homer und dann das latinisierte Griechisch, schließlich das christianisierte Latein zu uns gelangt – als Paradebeispiel für eine Metapher. Den Poetiken und Rhetoriken des Mittelalters galt ihr Lachen als „uneigentliche Rede“, dahinter verbarg sich die „eigentliche“: eine blühende Wiese. Der Philosoph Friedrich Kittler erklärte dazu in einer seiner Vorlesungen über Griechenland:
„Daß Odysseus und seine Gefährten auf dem Schiff guten Grund hatten, jedem Schluck Süßwasser als einer göttlichen Nymphe oder Muse zu danken, fiel faulen dicken Mönchen, diesen Gefangenen in Kloster- und Universitätszellen, nicht mehr ein. Hinter der Harmlosigkeit lachender Wiesen verbargen sich also die schönen, für Christen jedoch bedrohlichen zwei Möglichkeiten, daß entweder die Götter auf Wiesen anwesend oder aber die heidnischen Dichter Wiesen zu Göttinnen verzaubern können.“
Und so wurden aus den Nymphen, den jungen Mädchen – als Personifikationen von Naturkräften, bloße Metaphern. Ähnliches geschah mit der griechisch-heidnischen „Mimesis“ – Nachahmung, das die Scholastiker mit „imitatio“ bzw. „repraesentatio“ übersetzten – was bei Thomas von Aquin z.B. heißt, daß jemand (ein Dichter) etwas (z.B. eine Metapher) für jemand (einen Hörer oder Leser) darstellt. Was bedeutete nun aber „Mimesis“ ursprünglich? Dazu wieder Kittler:
„Denken Sie von den Göttern nicht zu abstrakt…Ohne Götter, die miteinander schlafen, gäb es keine Sterblichen, ohne Eltern, die miteinander Liebe machten, keines von uns Kindern. So bleiben einzig Dank und Wiederholung. Nichts anderes heisst bei den Griechen, solang sie dichten, Mimesis, Tanz als Nachvollzug der Götter“ bzw. „göttlicher Liebestaten“.
Denn auch beim Geschlechtsverkehr ahmen wir laut Kittler die Götter nach. Er erwähnt dazu einen Song von Jimmy Hendrix: „And the Gods made love“. Die Popstars haben uns seiner Meinung nach die Götter wieder nahegebracht. Bei einem Popkonzert in Kopenhagen z.B. brachte ein Junge seine Freundin anschließend Backstage zum Sänger: „Der hat die Nacht mit ihr verbracht und am nächsten Tag ging die Liebe zwischen dem Mädchen und ihrem Freund weiter.“ Ähnliches passierte 1986 laut dem Musikkritiker Mießner auch der Punkband „Freygang“ nach einem Konzert in Bitterfeld. Für Kittler sind das Beispiele „einer uneifersüchtigen Variante des Amphytrion-Stoffes, so wie auch Amphytrion nicht ernsthaft zu Alkmene sagen kann: ‘Ich verbiete dir, mit Zeus zu schlafen!’“
Als die Wiesen noch lachten – zu Beginn unserer Zivilisation – war noch alles voller Götter und Göttinnen, Musen, Nymphen, Halbgötter und Heroen. Umgekehrt konnten alle Götter sich in Tiere, Menschen, Pflanzen, Wolken, Stürme und Nebel verwandeln – wenn es z.B. galt, ein Jungfrau zu verführen: aus Lust und um neue Helden zu zeugen. Bei dem „musenverlassensten Volk Europas“, den Römern, wurden die Götter erst entsexualisiert und schließlich im Christentum auf Einen reduziert.
Bei den Griechen waren Mensch und Tier noch ungetrennt: „zoon“. Der Begründer der modernen Zoologie – Jean-Baptiste de Lamarck – postulierte 1809 in seiner „Philosophie zoologique“: An der Komplexität heutiger Lebewesen könne man abschätzen, wann sich deren Urzeugung vollzogen hat. Was bedeutet, dass der Mensch als das Lebewesen mit der höchsten Komplexität, das älteste Lebewesen auf der Erde wäre.
In der Bibel ist dagegen das Wiesengras sehr viel älter als der Mensch, denn dieser wurde erst an Gottes letztem Werktag geschaffen – indem er ihn sich, wie überhaupt die ganze Welt, einfach vorstellte und wollte – nämlich: „Laßt uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.“
Nun gibt es schon lange keine Griechen mehr, wohl aber noch Reste von anderen heidnischen Völkern, die manchmal nur noch ein Dutzend Menschen umfassen. Was sie jedoch eint, ist ein anderes Weltbild – und damit gegebenenfalls auch ein anderes Verständnis von lachenden Wiesen.
Der brasilianische Ethnologe Eduardo Viveiros de Castro erklärt uns das so: Im Westen ist ein „Subjekt“ – der herrschenden „naturalistischen Auffassung“ gemäß – „ein ungenügend analysiertes Objekt.“ In der animistischen Kosmologie der amerikanischen Ureinwohner ist laut de Castro das Gegenteil der Fall: „Ein Objekt ist ein unvollständig interpretiertes Subjekt.“
Dass was wir als einen angenehmen Heugeruch wahrnehmen sind die Schmerzensschreie der Wiesengräser.
.
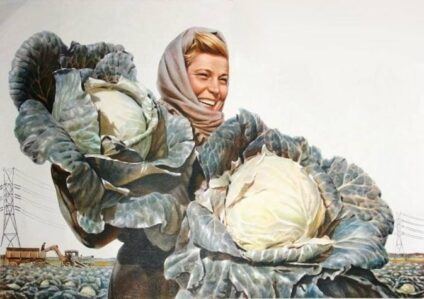
.
Urban Gardening
Schon wieder so ein Angloamerikanismus – warum sagt man nicht Stadtgärtnern? Fragte ich mich, aber dann verstand ich, dass es wie so vieles aus Amerika kommt, wo die Armen in den deindustrialisierten Städten Detroit, Chicago und New York Brachflächen besetzt und mit Gemüse bepflanzt haben. Gleichzeitig bildete sich dort eine „Garden Guerilla“, die sie bei Auseinandersetzungen mit kommunalen und privaten Landbesitzern verteidigte.
Das Urban Gardening geht ideengeschichtlich auf die kalifornische Hippiebewegung zurück, die Anfang der Siebzigerjahre erst Landkommunen gründete und dann auch Gärten in der Stadt anlegte. Ihr „Zentralorgan“ war der 1968 gegründete „Whole Earth Catalogue“. In England entstand die Idee des Guerilla-Gardening: das heimliche Ausbringen von Pflanzensamen und Pilzsporen im öffentlichen Raum. In Berlin meinte kürzlich ein Teilnehmer an einem „Stadtforum von unten“ – zu dem daneben tagenden, quasi offiziellen „Stadtforum von oben“: „Die Planer machen immer top-down-Gärten, wir müssen bottom-up-Gärten machen, d.h. aus grau – Beton – grün.“ Die Initiatoren des größten Berliner Urban Gardening Projekts, des „Prinzessinnengartens“ kamen im Übrigen in Havanna auf die Idee.
Das erste Urban Gardening Projekt entstand in Westberlin genaugenommen auf einem DDR-Grundstück – auf einer kleinen Verkehrsinsel, die beim Mauerbau außen vor gelassen worden war. Mit Erlaubnis der Grenzsoldaten konnten zwei türkische Arbeiter dort 1983 Gemüsegärten anlegen und sich aus Abfallholz sogar zweigeschossige Lauben bauen. Ihre beiden Gärten existieren noch heute. In Ostberlin war es der „Hirschgarten“ in der Oderberger Strasse, auch nicht ganz legal.
Die häufigsten Urban Gardening Projekte in der Stadt – das sind die massenhaft von den Anwohnern begrünten Baumscheiben. Zwar wird manch liebevolle Bepflanzung irgendwann wieder aufgegeben oder zerstört, aber es kommen immer wieder neue dazu. Ihre kleinen Einzäunungen werden verbessert und Sitzbänke drumherum gebaut. Anfangs versuchten die Bezirksverwaltungen diese seltsame Bürgerbewegung noch mit Verfügungen zu stoppen. Aus Treptow hieß es 2010 z.B.: „Diese Begrünungsmaßnahmen mitsamt Umzäunung greifen ins öffentliche Stadtbild ein und stellen Gefahren dar.“ Das könne unter keinen Umständen erlaubt werden. In Neukölln ließ man 2015 rund 60 Baumscheibenbänke entfernen – wegen Lärmbelästigung. Und in Pankow wurde unlängst noch eine ganze Baumscheiben-Bepflanzung von Amts wegen entfernt.
Wenn man wie ich auf der Suche nach allem möglichen Grün in der Stadt ist, werden die Spaziergänge immer länger, gleichzeitig verfeinert sich der Blick. Die hiesige Stadt-Werbung verspricht: „Berlin ist die grünste Stadt Deutschlands.“ Das ist zwar übertrieben, aber tatsächlich stößt man hier ständig auf Büsche, Bäume, Blumen, Rasenflächen und kleine Blumenbeete, auf wunderbare Gärten in Hinterhöfen, auf wahre Dschungel zwischen Gewerbehöfen. Vor den Häusern und Geschäften stehen immer mehr Kübel und Töpfe mit Pflanzen, die Fassaden werden berankt, Balkone bepflanzt, Dächer begrünt. An jedem der hunderttausend Straßenbegrenzungspfähle, Poller genannt, sammelt sich mit der Zeit Erde und Staub und es sprießen irgendwelche Gräser daraus hervor. Manchmal welche mit üppigen Blüten. In feuchten Sommern wachsen sogar in den Ritzen zwischen den Naturpflastersteinen auf den Gehwegen allerlei Gräser. Der Verleger Alexander Krohn gab 2025 in seiner „Distillery Press“ ein Fotobüchlein mit dem Titel „Pflanzen in Ritzen“ heraus. Egal in welche Richtung man geht, irgendwann stößt man immer auf einen kleinen oder großen Park und auf eine Schrebergarten-Kolonie. Letztere weichen allerdings immer öfter Neubauvorhaben.
Wir nähern uns dem moralischen Dilemma allen Gärtnerns: Man möchte eine harmonische Beziehung mit der Natur erreichen – und muß dabei ständig über Leichen gehen. Für den französischen Philosophen Michel Serres sind Pflug und Spaten „Opfermesser“, mit dem alles kurz und klein geschlagen wird, die ganze chaotische Vielfalt, um hernach auf dem sauber geeggten bzw. geharkten Geviert die Homogenität zu zelebrieren, zu züchten: „Wenn die Wut des Messers sich gelegt hat, ist alles bearbeitet: zu feinem Staub geeggt. Auf die Elemente zurückgeführt. Analyse oder: Nichts ändert sich, wenn man von der Praxis zur Theorie übergeht. Agrikultur und Kultur haben denselben Ursprung oder dieselbe Grundfläche, ein leeres Feld, das einen Bruch des Gleichgewichts herbeiführt, eine saubere, durch Vertreibung, Vernichtung geschaffene Fläche. Eine Fläche der Reinheit…Der Bauer und Gärtner, der Priester, der Philosoph. Drei Ursprünge in drei Personen in einer einzigen Verrichtung im selben Augenblick.“ Für Serres ging es nicht darum, die Erde durch Bearbeitung fruchtbar zu machen: „es ging um Ausmerzen, Unterdrücken, Vertreiben, es ging um Zerstören, das Pflugmesser, die Hacke ist ein Opfermesser“. Auch beim Urban Gardening.
.

.
Zäune
Laut Rousseau beginnt das Eigentum mit dem ersten Menschen, der sagt, das ist meins – und die anderen es akzeptieren, dass er einen Zaun zieht oder Grenzpfähle setzt. Der Journalist Christian Semler begleitete einmal eine deutsche Delegation nach Moldawien. Es ging dabei um organisatorisch-materielle Hilfe bei der Sicherung der Grenze gegen Flüchtlinge, die in die EU wollten. Im Gegensatz zu der wachsenden Zahl staatlicher Grenzsperren und Zäune werden auf der anderen Seite, im Privaten, die Einzäunungen jedoch eher weniger. Das fing mit dem Verschwinden von Weidezäunen an, weil die Kühe fortan in großen Laufställen gehalten wurden. Der ehemalige Waldarbeiter Peter Engstler erinnert sich, dass sie früher oft Zaunpfähle hergestellt hatten: „aber ungerne, denn die bringen nichts, weil sie so dünn sind und man so lange braucht, bis man einen Raummeter zusammen hatte, nach dem wir bezahlt wurden. Bei den wenigen Viechern, die heute noch nach draußen auf die Weide kommen, nimmt man meistens zum Einzäunen Pfähle aus Plastik oder Metall.“
Wenn ganze Wohnquartiere eingezäunt werden, spricht man von „Gated Communities“. Auf ihren Zaunpfählen sind mitunter Überwachungskameras montiert. Nicht wenige Sozialforscher gehen davon aus, dass dieses Elend bereits mit der Seßhaftigkeit begann: Während die Nomaden den Raum beherrschten, nahmen die Seßhaften ihn in Besitz, sie zerstückelten und markierten ihn, um ihn aufzuteilen. Anny Milovanoff schreibt in „Die zweite Haut des Nomaden“ (2076): „Der Nomade hält sich an die Vorstellung seines Weges und nicht an eine Darstellung des Raumes, den er durchquert. Er überläßt den Raum dem Raum.“
Berühmt wurden die Kämpfe gegen Einzäunungen in England, als dort das Gemeindeland (die Allmende) privatisiert wurde. „Diggers“ und „Levellers“ nannten sich die Widerständler, die die Zäune und Hecken „ausgruben“ und „einebneten“, daher ihre Namen. Nach dem Ende des DDR-„Volkseigentums“ brachen auch in und um Berlin „Zaunkriege“ aus. Der Staat hatte ganze Seen privatisiert und die neuen Besitzer sie eingezäunt, so dass die in der Nähe Wohnenden nicht mehr im See baden und angeln gehen konnten. Damit wurde ein Gewohnheitsrecht gebrochen. Nachts wurden Zäune entfernt oder Löcher in die Zäune gemacht. Am Liebenberger See, hielten die neuen Besitzer des „Seeschlosses“, die Deutsche Kreditbank (DKB), die Zudringlinge durch „Security-Kräfte“ von der Seenutzung ab. In und um Potsdam, wo um den Zugang zu den privatisierten Seegrundstücken am Heftigsten gestritten wurde, führte ein „Zaunkrieg“ zur Gründung einer Bürgerinitiative gegen die Seeeinzäunung. Nachdem sie drei Mal protestiert hatten, ließ die Stadt mit Baggern Hecken und Zäune auf zwei Grundstücken entfernen.
In der DDR gab es die größte Vielfalt an Grundstückszäunen. Hintergrund dafür war einst die Gründung von Maschinen-Traktoren-Stationen (MTS), dort wurden die landwirtschaftlichen Geräte der LPGen repariert. Im Winter gab es auf den Stationen nur wenig zu tun, deswegen schweißten die Mitarbeiter den Dörflern gerne aus MTS-Beständen an Band- und Muniereisen ihre Privatzäune zusammen, wobei sie deren gestalterische Sonderwünsche – Sonnen, Vögel, Sterne – berücksichtigten. Mit der Zeit wurden die ostdeutschen Zäune in den Dörfern immer künstlerischer, während zuvor mit der Kollektivierung der Landwirtschaft erst einmal tausende von Kilometer Zäune und Hecken niedergerissen worden waren. Noch heute werden diese Zäune alljährlich neu gestrichen, d.h. in Ehren gehalten.
In einigen Regionen Westdeutschlands gibt es staatliche Zuschüsse, wenn die Bürger sich dort beim Einzäunen regionaltypischer Zäune bedienen – in Norddeutschland z.B. für den „Friesenzaun“ und in der bayrischen Rhön für den „fränkischen Gartenzaun“.
Auf Sardinien gab es bis vor kurzem Weideland in Gemeindeeigentum – ohne Zäune. 1975 wurde jedoch ein „Reformgesetz zur Strukturentwicklung“ verabschiedet, das von den Schafzüchtern (Hirten) die Seßhaftwerdung sowie privaten Grundbesitz (mindestens 30 Hektar) verlangte. Die Fördergelder und Kredite mußten sie dann u.a. dazu verwenden, ihre Weiden zu „umzäunen und innen mit Zäunen und Gattern zu unterteilen“ – was einen scharfen Traditionsbruch bedeutete und gleichzeitig vielen armen Hirten die Existenzgrundlage raubte. Dies ließ das Banditentum auf Sardinien erneut aufleben.
Anders auf Korsika: Dort laufen die Schweine und Rinder halbwild herum. Viele Bauern wissen nicht einmal, wie viele sie besitzen. Die Kuhhaltung wird vom französischen Staat subventioniert, deswegen besitzt jeder mindestens ein paar – und sei es nur auf dem Papier. Es sind inzwischen so viele, dass sie alles platt machen – auf der Suche nach Futter. Deswegen fangen immer mehr Leute an, wenigstens ihre Gärten einzuzäunen. Aber die hungrigen Rinder springen selbst über hohe Zäune oder trampeln sie runter.
.

.
Betonplaner
„Es kommt drauf an, was man draus macht!“ diesen alten Werbespruch der Zementindustrie scheint sich die Stadtplanung in Berlin zu eigen gemacht zu haben. Obwohl sie auf Plakaten für ein „Grünes Berlin“ wirbt, gehört sie damit ganz sicher nicht zur „ökologischen Klasse“, wie der Wissenssoziologe Bruno Latour und der Soziologe Nikolaj Schultz die neuen Klimaaktivisten und Umweltschützer in ihrem „Memorandum ‚Zur Entstehung einer ökologischen Klasse‘“ nennen. In Schweden gibt es schon lange „Brukarplanering“: Planung mit und für die Nutzer. Seit Berlin Hauptstadt ist, geschieht hier das Gegenteil: Die Behörden engagieren renommierte Architekten aus dem Ausland.
Vor 1989 wurde bei einem Verkehrsberuhigungsprojekt am Lausitzer Platz in Berlin-Kreuzberg vom Planungsbüro noch eine Anwohnerbefragung durchgeführt. Selbstverständlich kam dabei heraus, dass fast alle Geschäftsinhaber am Platz dagegen waren, weil sie sich vom Autoverkehr mehr Kunden erhofften. Der Platz wurde trotzdem „beruhigt“, denn die Planer von den Grünen meinte, dass ihre Gegner bloß von der CDU aufgewiegelt worden seien.
Nach der Wende konnte man am Invalidenpark in Mitte sehen, wie das plötzlich großdeutsch gewordene Gemüt seine Planungshoheit missbrauchte. Einst diente die Freifläche den Insassen des Invalidenhauses als Nutzgarten. Nun wurde für viel Geld der Zürcher Professor Girot und das Pariser Landschaftsarchitekturbüro atelier Phusis beauftragt, etwas ganz „Schickes“ dort zu planen. Heraus kam eine riesige Raketenabschussrampe aus Beton.
Ähnliches geschah mit dem Besselpark an der Friedrichstraße, benannt nach dem Astronomen F.W. Bessel. Der Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. ließ dort von K.F. Schinkel eine Sternwarte bauen. Schon 1841 war man hier dem Größenwahn verfallen, denn am Gebäude wurde der „preußische Normalhöhenpunkt“ markiert, von wo aus „Berlin Mean Time“ angenommen wurde. Bekanntlich konnte man sich aber nicht durchsetzen gegenüber dem »historischen Nullmeridian« der Seemacht England an der Sternwarte in Greenwich. Das Observatorium wurde nach Babelsberg verlegt, das Gebäude abgerissen.
Erst 1995 legte man dort einen Park an: Rasenflächen mit einem Heckenriegel für Spatzen und fast 100 Kastanienbäumen. Während der Coronajahre wurde er vom Landschaftsarchitekturbüro Rehwaldt „aufwändig revitalisiert“, d. h. in ein „lebendiges und attraktives Parkareal umgestaltet“ – mit vielen „Sichtachsen“ aus Beton. Eine blühende Brachfläche nebenan wurde gleich ganz zubetoniert. Die Hecke entfernte man zugunsten eines halbmeterhohen Betonriegels (mit eingravierten Wörtern wie „Glück“, „Erfolg“ etc.), weil die Anwohner angeblich Angst gehabt hätten, im Dunkeln an der Hecke vorbei zu gehen. Die Planer „gestalteten“ auch den daran anschließenden zugepflasterten Platz vor der Akademie des Jüdischen Museums.
Das alles ist Teil einer Gentrifizierung dieses türkisch-proletarischen Gebiets mittels Eigentumswohnungen, Fahrradläden und Medienunternehmen. Alles vom Feinsten. Im Zentrum befindet sich der „soziale Brennpunkt“ Mehringplatz vor dem U-Bahnhof Hallesches Tor. Zur „Quartiersaufwertung“ wurde 2006 das Ende der Friedrichstraße bis zum Mehringplatz als illuminierter „Pfad der Visionäre“ mit Vorbildfunktion verlängert. 2014 gewannen die Büros Arge Lavaland GmbH und TH Treibhaus das Wettbewerbsverfahren für die Neugestaltung des Mehringplatzes, wofür man dann neun Jahre brauchte – bis 2023. So lange war der Platz eingezäunt. Wieder wurde vor allem mit Beton „revitalisiert“, wobei sie den geraden Fußweg vom „Pfad der Visionäre“ bis zum U-Bahnhof mit einer kleinen Betonmauer versperrten und den Weg 30 Meter weiter nach rechts verlegten. Schon kurz nach der Eröffnungsfeier wurde das von den Nutzern korrigiert: Sie stiegen über das Mäuerchen und gingen über den Rasen. Jetzt ist dort ein Matschweg.
Weil von oben derart dumpf-autoritär geplant wird, findet man solche eigenmächtigen „Nutzungsspuren“ überall: an der Humboldt-Bibliothek am Tegeler Hafen, im Volkspark Wilmersdorf, am Antonplatz in Weißensee usw.. Es handelt sich dabei um abkürzende Trampelpfade über Rasenflächen, weil die angelegten Beton- oder Steinplatten zu umwegig sind. Mit »Brukarplanering« hätte es intelligentere Lösungen geben können, aber das hätte Sozialforschung statt Beton erfordert.
P.S.: Es gibt ein hervorragendes Buch zum Thema „Beton“ – von Anselm Jappe, der sowieso interessante Bücher schreibt.
.
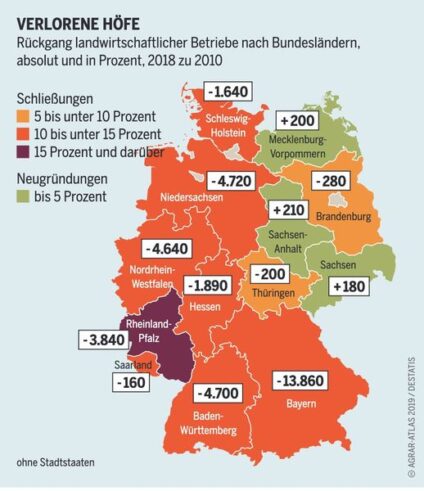
.
Berliner Forschung
Gelegentlich fahren Busse durch die Stadt, auf denen Tierschützer für ein Verbot von Tierversuchen werben. Ein andern mal wirbt ein Pharma- oder Kosmetikkonzern für ein neues Produkt. Der BVG ist es egal, ob für oder gegen Tierversuche geworben wird, beide zahlen das Selbe. Früher protestierten die Tierschützer noch leibhaftig am Steglitzer „Mäusebunker“ der FU, in dem bis 2020 Versuchstiere gehalten wurden. „Die Zeit schrieb: „Für Tierversuche kann man keine Sympathie erwarten. Sie finden in einer Parallelsphäre von Labors und Instituten statt, mit der kaum ein Laie je in Berührung kommt. Auch wer sie im Prinzip für nötig hält, will es wahrscheinlich gar nicht so genau wissen. Von den millionenfachen Experimenten profitieren wir lieber stillschweigend, als uns mit einem ethischen Dilemma zu belasten“.
Inzwischen gibt es eine Kampagne „Rettet den Mäusebunker“, initiiert von Architekten, die dieses „Schlüsselwerk des Brutalismus“ erhalten wollen – nun für „Kreative“ statt für Versuchstiere. Für letztere gibt es mehrere neue „Mäusebunker“ in Berlin-Buch. Dort werden allein im Max-Delbrück-Centrum durchschnittlich 105.403 Tiere pro Jahr vernutzt. Daneben gibt es auch noch den Charité-Campus Buch, wo man die Wirt-Virus-Beziehung bei Vampirfledermäusen erforscht, die mit einem neuartigen Morbillivirus infiziert wurden.
In der Krebsforschung sind Onkomäuse beliebt. Es sind gentechnisch modifizierte Mäuse, die infolge einer künstlich herbeigeführten Mutation Krebs haben. „Die Onkomaus ist ein Meilenstein,“ schreibt die Philosophin Lara Huber in ihrem Buch „Relevanz“ (2020). Da diese Mäuse in Harvard patentiert wurden, darf man sie bei Strafe nicht nachzüchten, man muß ständig neue kaufen.
In Berlin wird daneben auch gerne mit Zebrafischen experimentiert. Es wurden bereits 25.000 wissenschaftliche Studien über sie veröffentlicht. An genetisch veränderten – durchsichtigen – Zebrafischen erforscht man „Störungen des Blutkreislaufs, Leberleiden, Nervendegenerationen und Krebs“. Forscher des Max-Planck-Instituts für Neurobiologie untersuchten genetisch veränderte Zebrafische mit einem Cortisolmangel, dabei diagnostizierten sie Anzeichen einer Depression. Als sie Medikamente gegen Angstzustände, Valium und Prozac, ins Wasser gaben „normalisierte sich ihr Verhalten“ jedoch. Schon ein Sichtkontakt mit anderen Zebrafischen besserte ihre Stimmung. In Berlin züchtet ein Forschungsinstitut am Müggelsee Zebrafische, u.a. die „gläsernen“, was sie damit anstellen, weiß ich nicht.
Auch Meerschweinchen, die „Prügelknaben der Physiologen“, wie der Entomologe Fabre sie nannte, werden immer noch massenhaft in Forschungslaboren (diesen Tier-Folterkammern für verrohte Karrieristen) vernutzt. Wenn im 19. Jahrhundert irgendwo auf der Welt eine Seuche ausbrach, packten Robert Koch in Berlin und Louis Pasteur in Paris je 100 Meerschweinchen ein und eilten damit ins Zentrum der Seuche. Es war ein Wettrennen um den Nobelpreis. Ihre mit den Erregern infizierten Meerschweinchen blieben auf der Strecke. 1890 gelang es, mit den armen Tieren ein Serum gegen Diphterie herzustellen. Der preußische Staat hatte zunächst kein Interesse, die Diphterie (an der jährlich über 1000 Kinder allein in Berlin sterben) zu bekämpfen, er finanzierte stattdessen die Forschung an Tetanus, da dies eine große Gefahr für wertvolle Pferde darstellte. Es dauerte lange, bis die Firma Hoechst das neue Medikament auf den Markt brachte. Die Meerschweinchen waren dabei vom Versuchstier zu einem lebenden Laborgerät geworden, das Serum herstellte.
2012 wurden 3.721 Meerschweinchen für Hautsensibilisierungstests verwendet,“ heißt es auf „meerschwein-sein.de. „Auch werden Meerschweinchen zur Aus-, Fort-, und Weiterbildung benutzt sowie zur Qualitätskontrolle und Erforschung von Produkten und Geräten. 2007 wurde auch der stark umstrittene Schwimmtest, bei dem die Tiere bis zur Erschöpfung schwimmen müssen, an Meerschweinchen durchgeführt. Der Test mit dem Schweregrad ‚schwer‘ wurde mit 349 Meerschweinchen gemacht. Der Schwimmtest wird in der Depressionsforschung eingesetzt und dient zum Testen von Antidepressiva.“
.
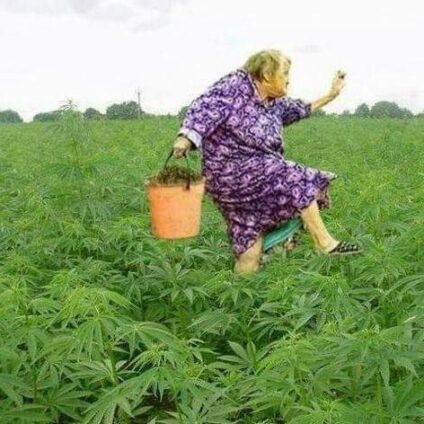
.
Volkseigentum
Der Historiker Marcus Böick bezeichnete die Treuhand als „Bad Bank“ der deutschen Erinnerungskultur, als eine Einrichtung, in die soziokulturelle beziehungsweise sozioökonomische Abstiegs-, Entfremdungs- und Zurücksetzungserfahrungen „ausgelagert“ wurden. Die Leipziger Kultursoziologin Yana Milev hat 2020 die Erinnerung an diese Kolonialisierungszentrale noch einmal hervorgeholt mit ihrem Buch „Das Treuhand-Trauma. Die Spätfolgen der Übernahme“.
Für die Autorin ist diese Anstalt, gegründet von westdeutschen Antikommunisten, in der sich Gauner und Betrüger die Klinke in die Hand gaben, ein „Modellfall der neoliberalen Annexion“.
Ich habe mir einmal im Kartellamt eine Liste aller privatisierten Betriebe im Elektrobereich besorgt, sie hörte jedoch bei „L“ auf. Als ich mir auch noch die andere Hälfte im Amt erbat, bekam ich keine Antwort mehr. Bei Durchsicht der ersten Hälfte wurde aber bereits deutlich, dass der Siemens-Konzern die übergroße Mehrheit der ganzen VEB in diesem Wirtschaftsbereich „übernommen“ hatte, die er dann wahrscheinlich peu-à-peu stillgelegt hat, wozu ihm wahrscheinlich noch einige Milliarden DM vom Weststaat zugeschoben wurden – als eine Art Verlustausgleich. So wie der BASF(Kali & Salz) für die Übernahme und Schließung des Bergwerks in Bischofferode.
Die „neoliberale Annexion“ hat aber laut Yana Milev nicht nur alle volkseigenen Betriebe liquidiert, es verschwanden auch „90 Verlage, 1700 Zeitungen und Zeitschriften, 217 Theater, 10 staatliche Puppentheater, 87 Orchester, 955 Museen, 190 Musikschulen, 99 Musikkabinette, 16900 Bibliotheken, 1500 Kultur- und Clubhäuser, 805 Kinos, 450 Galerien, 200 Heimat- und Volkskunst-Museen, 10.000 Jugendklubs, 1000 Kulturhäuser der VEB, 3 Staatszirkusse (Aeros, Berolina, Busch), 300 öffentliche Spielplätze, 161 spezifische Trainingszentren, 1820 DDR-Trainingszentren, der Rundfunk der DDR mit je 2 Rundfunkchören, Sinfonie- und Unterhaltungsorchestern sowie 3 Tanzorchestern und 2 Rundfunk-Kinderchören, ferner das Fernsehen der DDR und das DEFA-Filmkombinat.“
Der Schriftsteller Lothar Baier urteilte: „Die Bundesdeutschen entdeckten in der ihnen plötzlich zugänglich gewordenen DDR ein Terrain, auf dem sich ein Stück versäumter Kolonialgeschichte nachholen läßt.“ Diese Kolonialisierung war jedoch mit der Auflösung der Treuhandanstalt nicht beendet, sondern hält noch immer an – wenn auch vor allem in Form von Demütigungen und Unverschämtheiten. Etwa so wie ein THA-Bereichsleiter auf einer Treuhand-Konferenz im Kongreßzentrum am Alexanderplatz zu einem Kollegen meinte: „Ich muß unbedingt mal wieder Ostweiber beschlafen.“
Oder der Jurist Jörg Stein, der als „Parteienverräter“ im Osten reich wurde: Er arbeitete gleichzeitig für die Treuhand (70.000 DM monatlich), für die IG-Metall (5000 DM) und für die Belegschaften (allein für die Sozialplanbegleitung des Betriebsrats der Mikrotechnolgischen Gesellschaft Frankfurt/Oder 500.000 DM). In seinen unverschämten Briefen an die Betriebsräte zitierte er Marx und Brecht.
Der erste Treuhandchef Detlef Rohwedder, der die Mehrzahl Betriebe „sanieren“ und nicht nur „abwickeln“ wollte (und deswegen wahrscheinlich erschossen wurde – von einem „unbekannten Russen“, wie die Westmedien sofort mutmaßten) sah es kommen: „Die benehmen sich schlimmer als Kolonialoffiziere,“ meinte er über das Wirken eines Teils seiner THA-Truppe und der im Osten zu hunderten eingefallenen „Manager (Übernahmeinteressenten).
Im Sommer saß ich in einem Pankower Restaurant auf der Raucher-Terrasse, am Nebentisch unterhielten sich zwei Männer, sie sahen aus wie gut genährte Geschäftsleute. Der eine sagte, etwas lauter werdend: „Du hast mein Feuerzeug eingesteckt.“ Der andere griff in seine Jackettasche und holte ein durchsichtiges Einwegfeuerzeug heraus: „Meinst Du das?“ „Ja,genau!“ „Das ist nicht Deins!“ „Wie bitte?!“ „Weißt Du das nicht, seit der Wende sind Einwegfeuerzeuge und Kugelschreiber Volkseigentum.“ „Ok, dann gib Du mir Unser aller Einwegfeuerzeug.“
.
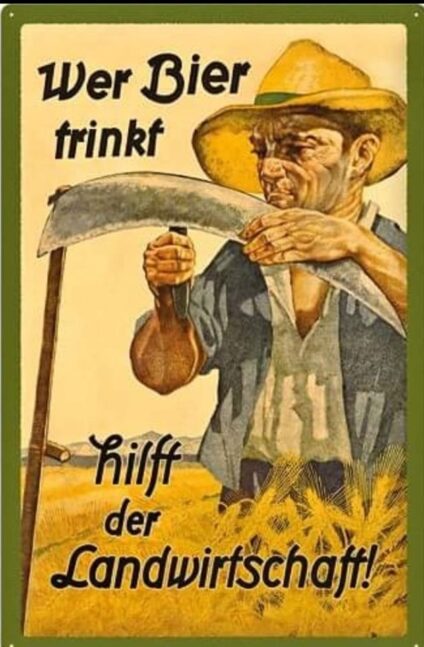
.
Gentechnisches Weltwissen
Die Schriftstellerin Doris Lessing besaß viele Katzen in ihrem Leben und veröffentlichte mehrere Bücher über sie. Sie meinte zuletzt, dass sie inzwischen mehr über eine gestorbene Katze trauere als über einen gestorbenen Bekannten oder Verwandten.
Ja, sagt da das Magazin der Max-Planck-Gesellschaft „Forschung“ in seiner Ausgabe vom Mai 2018, das liegt daran, dass es ihr vom Einzeller „Toxoplasma gondii“ aufgedrängt wurde, denn der „tut alles dafür, dass der Mensch und die Katze zusammenfinden. Den Mensch braucht er als Zwischenwirt. Nur im Darm von Raub- und Hauskatzen kann der Parasit neue Eier legen…Das würde erklären, warum sich infizierte Menschen von Katzen besonders angezogen fühlen.“
So weit so idiotisch. Ich habe dieses „Forschungsergebnis“ im Nachwort des Buches „Die lustige Tierwelt und ihre ernste Erforschung“ als „Abbremser“ verwendet – nachdem ich den Philosophen Hans Blumenberg gegen die Genpool-Erhalter zitiert hatte: „Auch ohne naturschützerische Gebärde muß gesagt werden, dass eine Welt ohne Löwen trostlos wäre.“ Und mich dann entsetzt: „Bald ist es schon so weit. Die Raubtierforscher prognostizieren, dass höchstens die (urbanen) Hauskatzen überleben werden. Aber so sehr wir uns auch z.B. um unsere kleine Katze Luzie bekümmern, ihre häusliche Haltung ist die reinste Tierquälerei, eine extreme Reizunterflutung. Da es jedoch keinen Ausweg gibt, wir weiterhin ihre Lebensverlegenheiten ernsthaft erforschen – und uns an ihrem Witz erfreuen, gehört sie auch zur lustigen Tierwelt. Für unser Interesse an ihr scheint es aber noch einen tieferen Grund zu geben…“ Nämlich den Parasiten „Toxoplasma gondii“.
Damit wollte ich mich ironisch von unserer närrischen Katzenliebe freisprechen: Wir können nichts für unsere Depolitisierung – ein übler Parasit steuert uns.
Aber nun kommt auch noch das Magazin für Naturwissenschaft „spektrum.de“ an und erweitert die Wirkung des neurologischen Manipulators „Toxoplasma gondii“ über die Ökologie ins Ökonomische – schon in der Überschrift: „Macht Katzenparasit Berufsanfänger mutiger?“
Es geht um eine neue Studie, veröffentlicht in den altehrwürdigen „Proceedings of the Royal Society B“: „Wohl mehr „als 2 Milliarden Menschen sind weltweit mit ‚Toxoplasma gondii‘ infiziert“ und schon „seit Langem berichten Forscher über Indizien für mögliche psychische Veränderungen bei Infizierten“. Die neue Studie zeige nun, „dass toxoplasmainfizierte Menschen weltweit häufiger beruflich selbständig sind – und somit Risiken vielleicht anders bewerten als andere.“
Die Autoren der ersten im MPI-Magazin referierten Studie wollten mit ihrem Toxoplasma darauf hinaus, dass einst, als die Raubkatzen noch viele waren und gefährlicher, die Menschen aber weniger und hilfloser als heute, dieser üble Parasit sie geradewegs in ihre tödlichen Fänge trieb. Er manipulierte sie also derart, dass sie das Risiko, sich einer oder mehreren Raubkatzen zu nähern, anders bewerteten als andere, die hübsch auf Distanz blieben. Mangels Löwenrudel werden die Infizierten nun von Baulöwen magisch angezogen
Die Autoren der zweiten in „spektrum.de“ referierten Studie testeten ihre steile These erst mal an Mäusen, indem sie sie mit dem Parasiten infizierten. Und siehe da: Er „macht die Nager zum Teil selbstmörderisch mutig“. Dann untersuchten sie 1495 Studenten: Die mit dem Erreger infizierten „wählen knapp eineinhalb mal so häufig wie Gesunde Wirtschaftswissenschaften im Hauptfach.“ Und schließlich stellten sie noch „bei Teilnehmern an Berufsbörsen, die auf eine selbständige Tätigkeit vorbereiten sollen,“ fest, dass sie „1,8mal häufiger infiziert sind als der Durchschnitt der Bevölkerung“. Zuletzt durchforsteten sie demografische Statistiken aus 42 Ländern – und dann stand für sie fest: „Offenbar korreliert die Durchseuchungsrate mit ‚Toxoplasma‘ in einem Land und der Prozentsatz der Selbständigen.“
Damit sich aber nun nicht alle Leute Katzen anschaffen, um sich mit dem Urtierchen Toxoplasma gondii mental fit zu machen, fügen die Autoren hinzu: Da viele Selbständige scheitern, könne man nicht sagen, „dass der Einfluß des Parasiten Menschen grundsätzlich erfolgreicher“ mache. Er bleibt jedoch auch im Anthropozän quasi raubtierorientiert. Das hat bereits die Heidelberger Genetikerin Christiane Nüsslein-Volhard anläßlich der Verleihung des Nobelpreises an sie gesagt – “dass die Natur in gewisser Weise kapitalistisch funktioniert“ – und die kapitalistische Gesellschaft quasi naturgegeben ist. Da beißt sich die Katze in den Schwanz und wir sind so klug als wie zuvor. Nein dümmer, weil wir diese völlig verbretterte Ami-Lebensforschung möglicherweise für bare Münze nehmen.
.

.
Das Geoingenieurprojekt „Joseph Beuys“
1979 schlug Joseph Beuys der damals gerade täglich erscheinenden taz vor, anläßlich der Eröffnung seiner Ausstellung im New Yorker Guggenheimmuseum mit AndyWarhol zusammen eine Aktion zu machen. Es wäre die Verbindung von Kunst, politischer Aktion und Reklame für eine gute Sache – die taz – geworden. In der Redaktion war man von solcher Öffentlichkeitsarbeit jedoch wenig begeistert und lehnte ab – mit der Begründung: der Flug nach New York wäre zu teuer.
Bei der linken italienischen Tageszeitung „Lotta Continua“ waren es umgekehrt die Redakteure, die Beuys um unterstützende Zusammenarbeit baten: Er kam nach Rom und half. „Wir kauften ein: fünf Kilo Butter, drei mal drei Meter Industriefilz, Leim, Eimer und Pinsel, eine Schaufel, eine Schere, saubere Lumpen, einen kleinen Kassettenrekorder, ein Dutzend große Schultafeln, Kreide und eine alte glorreiche Linotype aus Heidelberg.“ Im Palazzo Braschi legte Beuys damit los. „Vor hunderten und aberhunderten Zuschauern arbeitete, sprach und antwortete er pausenlos. Eine informelle Versteigerung erlaubte es dann, das Endprodukt zu einem Höchstpreis zu verkaufen. Die Zeitung wurde dadurch nicht gerettet. Beuys ermöglichte uns einen würdigen Tod, nicht die Verlängerung unseres Lebens,“ erinnerte sich in der taz Gianpiero De Vitis, der später im taz-Haus in der Rudi-Dutschke-Strasse das Restaurant „Sale e Tabacchi“ eröffnete.
Als Beuys 1986 starb, war die taz seinen Ideen gegenüber schon aufgeschlossener. In aller Eile wurden Freunde und Weggefährten als Nachrufer mobilisiert. Sein Freund, der Graphiker Klaus Staeck, der mit Beuys und Heinrich Böll die „Freie Hochschule für Kreativität und Interdisziplinäre Wissenschaften“ gegründet hatte, schrieb: „Wohl keiner hat die Einheit von Kunst und Leben so überzeugend gelebt wie er. Er hat die Tore des Kunstghettos ganz weit aufgemacht. In seinem erweiterten Kunstbegriff hatte alles Platz, was zu seinem universalen Weltbild gehörte.“
Ab 1996 veranstalteten die Gründer der Ost-taz André Meier und Jürgen Kuttner allmonatlich in der Volksbühne einen Videoschnipselabend: „Von Mainz bis an die Memel“ – mit kurzen Ausschnitten aus BRD- und DDR-Fernsehsendungen, die Kuttner witzig-medienwissenschaftlich kommentierte. Ihre bis heute über 200 Vorstellungen, die zwischendurch im Deutschen Theater, stattfinden, enden stets mit der Aufzeichnung eines Fernseh-Wahlspots der Grünen „Sonne statt Reagan“, in dem Beuys als Sänger auftritt („Jeder kann singen“).
1982 hatte Beuys anläßlich der 7. Kassler „documenta“ 7000 Eichen und 7000 Basaltstelen gepflanzt. Man sah darin eine lokale Begrünungsaktion, denn Beuys sprach von „Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“. Sie zielte aber aufs große Ganze. Der Anthroposoph Beuys war ein Weltretter bzw. –verbesserer. Diese aufwändige Aktion war jedoch teuer. Staeck schrieb in der taz: „Ich wurde dreimal Zeuge, wie Beuys bei den verschiedensten Veranstaltungen in immer neuen Anläufen ein Vorstandsmitglied der Deutschen Bank, das vorgab, sehr an der Kunst von Beuys interessiert zu sein, bewegen wollte, für seine 7000-Eichen-Aktion in Kassel ein paar Bäume zu spenden. Schließlich erfolglos.“ Die Pflanzaktion wurde aber trotzdem durchgeführt.
Zu seinem 100. Geburtsstag fanden an vielen Orten Beuys-Feiern statt – in Nordrhein-Westfalen ein ganzes Veranstaltungspaket: „Ausstellungen, Aktionen und Performances, Theater, Musik und Vorträge“. Ähnlich in Kassel, wo die für den Erhalt der Bäume und Basaltstelen gegründete „Stiftung 7000 Eichen“ ein „beuyslaborkassel2021“ initiierte, das jede Menge Beuys-Events anbot. All diese Aktivitäten waren jedoch nicht viel mehr als Ahnenpflege.
Die wahren Erben der Beuysschen Eichen-Basaltstelen-“Pflanzaktion“ in weltrettender Absicht sitzen in angloamerikanischen Laboren. Sie nennen sich „Geoengineers“, es geht ihnen darum, das Klima erwärmende CO2 zu reduzieren. Zum Einen drängen sie darauf, anderthalb Milliarden „Eichen“ zu pflanzen, die CO2 aufnehmen. Und zum Anderen zur Nutzung von Basalt-Bergwerken, die abgesaugten Stickstoff aufnehmen und durch Versteinerung binden. Schon gibt es auf Island und in der Schweiz solche Anlagen, die zum Teil mit dem gesammelten Stickstoff Gemüsegewächshäuser betreiben. In Deutschland machte das die Stickstoff produzierende Chemiefabrik SKW vor. Anlässlich des 500. Jahrestags des Anschlags der 95 Thesen durch Martin Luther an die Tür der Schloßkirche in Wittenberg wurde die Elbestadt von den evangelischen Kirchenoberen Deutschlands mit einer „Leistungsschau“ überzogen. Das im Wittenberger Ortsteil Piesteritz ansässige Stickstoffwerk beteiligte sich daran mit der Präsentation einer „Luther-Tomate“, die es in den Werksgewächshäusern mit Stickstoff aufzieht. Hier deutete sich die Erweiterung der von Beuys in Kassel „gepflanzten 7000 Eichen und 7000 Basaltstelen“ ins Globale an.
Die für den „New Yorker“ arbeitende Journalistin Elizabeth Kolbert hat all diese Geoengineers für ihr auf Deutsch erschienenes Buch „Wir Klimawandler. Wie der Mensch die Natur der Zukunft erschafft“ besucht – und auch gleich die „Schwachstellen“ ihrer Weltrettungsprojekte benannt. In ihrem Buch geht es „um Menschen, die Probleme zu lösen versuchen, die Menschen beim Versuch, Probleme zu lösen, geschaffen haben.“
Der „Gruppe von Negativ-Emissions-Technologen“, die vorschlägt, anderthalb Milliarden „Eichen“ zu pflanzen, „was 200 Milliarden Tonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre binden könnte“, wird entgegen gehalten: „Bäume sind dunkler. Wenn wir z.B. die Tundra aufforsten würden, würde es die von der Erde absorbierte Energiemenge erhöhen“ – also sogar eher zur „Erderwärmung“ beitragen. „Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, wäre, mit der CRISPR-Technologie genmodifizierte hellere Bäume zu schaffen.“ Also sie künstlich zu albinisieren. „Soweit ich weiß, hat das bisher niemand vorgeschlagen, doch es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein,“ meint Elizabeth Kolbert.
Eine weitere Gruppe von Geoengineers will zwecks Verlangsamung der Erderwärmung Kalzit-, Sulfat- oder Diamant-Partikel in der Stratosphäre versprühen, die das Sonnenlicht zurückstrahlen. Dafür hat sie schon mal ein Flugzeug, den Stratospheric Aerosol Injection Lofter, kurz SAIL genannt, konstruiert. Mit dem will man im ersten Jahr 100.000 Tonnen Schwefel versprühen. Leider würde dies „das Erscheinungsbild des Himmels verändern. Er wäre nicht mehr blau, sondern weiß.“
Wenn man jetzt auch noch das Anthropozän-Phänomen der zunehmenden Zahl von quasi-natürlichen Albinogeburten bei Wildtieren und -pflanzen quer durch alle Arten – von der Mücke bis zum Elefanten und vom Hanf bis zum Ahorn – dazu zählt, kann man sich in etwa ein Bild machen: Kein Schnee im Winter mehr, aber ganzjährig weisse Mischwälder mit weissen Tieren unter weißem Himmel.
Der „documenta“-Erklärer Bazon Brock hat es vielleicht schon geahnt, als er in einer von der taz 1986 abgedruckten Diskussion mit Beuys über das Konzept „Gesamtkunstwerk“ diesem vorwarf: „Ihr könnt so viele Konzepte vertreten wie ihr wollt, sobald ihr uns aber zwingt, diese Konzepte eins zu eins in der Wirklichkeit zu realisieren, wird es totalitär.“ Das wird es ganz sicher, wenn die Geoingenieure ihre „Projekte“ verwirklichen dürfen, denn alle Länder der Erde wären davon betroffen – ungefragt.
.

.

.
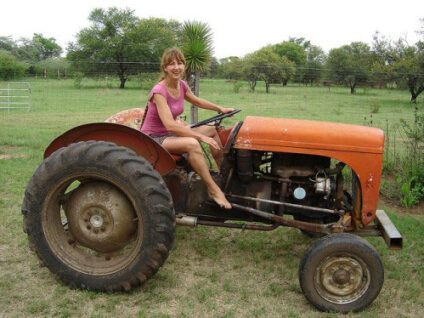
.

.

.

.
Anthropozentrismus
Unlängst machte ich in der Komischen Oper die überraschende Erfahrung, dass dort jetzt auch schon gegen den westlichen Anthropozentrismus laut gedacht wird. Und ich dachte, das wäre eine Macke von mir, dass ich mich bei aller Empathie für Tiere und Pflanzen ständig über den Anthropozentrismen aufrege. In der Oper ging es um „Menschen und Tiere“. Und der eingeladene katholische Seelsorger und Verhaltensbiologe Ulrich Lüke, der an der Universität in Münster mit zwei Poitou-Eseln „auf Augenhöhe“ therapeutisch arbeitet, forderte, den „despotischen Anthropozentrismus“ zu überwinden. Für den Theologen „hat die anthropozentrische Theologie keine Bedeutung mehr.“ Dabei kann er sich sogar auf den derzeitigen Papst Franziskus berufen, der gemeint hatte: „Macht Euch die Erde untertan“ – das sei die falsche Aufforderung zum Handeln. Sie stammt von sogenannten guten Hirten. Das durch die Bibel fundierte Christentum ist eine Schafreligion. Und was sollen Schäfer schon groß beim Untertan machen anrichten? Mag man anfangs – im Jahr Null und später – gedacht haben. Nun ist die Situation jedoch eine ganz andere, auch wenn sich im Schaf-Hirte-Verhältnis nicht groß was verändert hat. Der Papst meint, es müsse nun heißen: „Macht Euch der Erde untertan!“
In der taz-Kantine stellte der „Zeit“-Korrespondent Thomas Fischermann sein Buch „Der letzte Herr des Waldes“ vor. Es war ein wunderbares Porträt des jungen Amazonasindianers Madarejuwa Tenharim, weitgehend dem weißen Europäer ins Aufnahmegerät diktiert. Aus seiner Welt- und Waldsicht ging hervor, dass er und sein Stamm, die Tenharim, sich gerade nicht als „Herren“ des Waldes sehen, sondern umgekehrt, dass sie dessen „Gesetze“ genau befolgen, damit sich der Wald nicht rächt.
Näheres erfuhr ich im Haus der Kulturen der Welt: dass nämlich die Indigenen der beiden Amerikas dem Anthropozentrismus mit einem totalen Anthropomorphismus entkommen. Laut dem brasilianischen Ethnologen Eduardo Viveiros de Castro ist bei ihnen die Idee weit verbreitet, das jede Lebensform sich selbst als menschlich (an)sieht. Ich verstand das erst nicht, aber der Ethnologe führte das dann in seinem Buch „In welcher Welt leben?: Ein Versuch über die Angst vor dem Ende“ aus, das er mit der Pariser Philosophin Deborah Danowski veröffentlichte, die an der Päpstlichen Universität von Rio de Janeiro lehrt. Danach gehen die Indigenen davon aus, dass das, was alle von sich selbst sehen, „ihre ‚Seele‘ ausmacht. Demzufolge sieht ein Jaguar, wenn er einen anderen Jaguar anschaut, einen Menschen; aber wenn er einen Menschen anschaut, sieht er ein Schwein oder einen Affen, da dies das von den amazonischen Indios das am meisten geschätzte Wild ist.“ Die beiden Autoren definieren deren „Animismus“ als „ein ‚anthropomorphes Prinzip‘, das fähig ist, sich jenem ‚anthropozentrischen Prinzip‘ entgegenzustellen, das uns als eine der tiefsten Wurzeln der westlichen Welt erscheint.“
Aktuelles Beispiel: Mehrere wissenschaftliche Studien und sogar die Regierungsrichtlinien des Berliner Senats legen nahe, dass die Natur in der Stadt zum menschlichen Wohlbefinden beiträgt und das sie zu wenig ist, weswegen „die grüne Infrastruktur entwickelt“ werden soll. Nicht um ihretwegen, sondern für uns Menschen also soll mehr „Natur“ geschaffen werden, das ist Anthropozentrismus (für Doofe). Abgesehen davon, dass in Wirklichkeit genau das Gegenteil geschieht. So wurden z.B. die für Insekten und vor allem Spatzen so wichtigen sieben Hecken im Besselpark neben der taz und am Neuköllner Weigandufer sogar alle Büsche und Sträucher entfernt. Eine Mitarbeiterin des BUND fügte hinzu: „Gerade in Wohngebieten werden sie rücksichtslos runtergesägt, Wildblumenwiesen totgemäht und Gehölze verschnitten“ – der Gentrifizierung zuliebe.
.
.
Angst einjagen
In Berlin darf jetzt wieder gejagt werden – auf junge Rehe, junge Reh-Mütter und ältere Mütter. Ganzjährig werden Wildschweine, Waschbären, Füchse und Kaninchen gejagt. In der letzten Saison erwischten die Berliner Jäger 338 Rehe, 2339 Wildschweine, 18 Waschbären, 81 Füchse und 862 Kaninchen. Deutschlandweit wurden 2017 rund 134.000 Waschbären und 435.000 Füchse getötet.
Rechtzeitig zur Jagdsaison erschien das Buch des Ethnopsychoanalytikers Paul Parin: „Die Jagd – Licence for Sex and Crime“ – mit Nachworten von einer Zoologin, einer Historikerin, einem Bibliothekar und einem Ethnologen. Das Buch war bereits 2003 mit einem Nachwort von Christa Wolf erschienen, aber völlig verstümmelt worden, „in einer eigenartigen Mischung aus Respektlosigkeit, Prüderie und sachlicher Unkenntnis“ – so dass eine Neuherausgabe notwendig wurde. Der Autor war Jude und Sozialist: Beide jagen nicht, aber Parin war eine „Ausnahme“. Zudem gehörte er zu den Tiermördern, die bei einem gelungenen Schuß einen Orgasmus bekamen, auch beim Reiten gelegentlich, ebenso beim Ausgepeitscht werden und beim Auspeitschen. „Das Jagdfieber gewährleistet hemmungslosen sexuellen Genuss und die Lust am Verbrechen,“ schreibt er, denn natürlich ist das alles extrem unmoralisch, außerdem jagt man heute nicht mehr, um sich zu ernähren, sondern um mit Lust zu morden. „Jagd ohne Mord wäre ein Oxymoron.“ Schon für seinen Vater, ein Gutsbesitzer in Slowenien, galt: Seine „Jagdleidenschaft hatte die Grenze verwischt, die Anstand und Moral von Vergehen und Verbrechen scheidet.“ Nach dem ersten erlegten Rehbock bekam die jugendliche „Gier“ seines Sohnes „ein Ziel: der Mord an eine Kreatur“.
Die heutigen Jäger benutzen eine verharmlosende „Waidmannssprache“, um dies zu kaschieren, einige entblöden sich nicht, sich als „Ökologen“ und „Naturschützer“ zu bezeichnen. Parin meint, dass „solche unbeholfenen Versuche, die Jagd vom Geruch der Sucht und Grausamkeit freizusprechen, gar nicht mehr nötig sind,“ denn „es könnte sein, dass die brutale Umgestaltung der Welt nicht mehr rückgängig zu machen ist.“ Zwar wird gelegentlich behauptet, dass Jäger aggressiver und sadistischer als nicht jagende Menschen sind, aber, wie es in einem der Nachworte heißt, „neuropsychologische Forschungen legen nahe, dass vor allem Männer Gewalt um der Gewalt willen ausüben und daran Spaß haben.“
Die Jagd hat natürlich mit Macht (über die Tiere) zu tun, mit der Herrschaft des Menschen über die Natur, aber mit der Forderung nach mehr Frauen in den Führungsetagen legen nun auch immer mehr Frauen die Jagdprüfung ab – und auf jagdbares Wild an. Die Schriftstellerin Dörte Hansen erwähnt in ihrem norddeutschen Dorfroman „Mittagsstunde“ (2018) einen Jagdverein, in dem die Frauen bereits die Mehrheit stellen, mit der Folge, dass das Wild von ihnen nicht mehr gejagt, sondern gehegt und gepflegt (gekuschelt) wird. Dies mag ein bloßer Autorenwitz sein, für den Münchner Ökologen Josef Reichholf steht es jedoch fest, dass die Angst der Tiere vor den Menschen eine Folge der Jagd ist und dass sich bei einem umfassenden Jagdverbot wieder eine Art „Urvertrauen“ bei ihnen einstellt, wie es die Tiere in vielen Gegenden der Welt an den Tag legten – bevor die Weißen kamen und alle zutraulichen töteten.
Parin hat solche „Tierparadiese“ noch erlebt – in der Sahelzone, dort hielten sich Gazellen und Trappen zwischen den Rinderherden der Einheimischen auf, die keine Gewehre besaßen. Reichholf erlebte im Golf von Kalifornien, wo Wale nicht mehr gejagt werden dürfen, dass ein Walweibchen an sein „Whale-Watcher-Boot“ kam und sich von ihm die lästigen Seepocken abpflücken ließ. Die Erfahrung, dass mit dem Jagdverbot die Fluchtdistanz von Wildtieren geringer wird, macht man in fast allen Nationalparks. In Berlin darf man bei Strafe keine Wildtiere füttern – und sollte das auch nicht, dann sobald sie etwas weniger scheu werden, erschießt man sie. Aber ist das nicht ihre einzige Überlebensmöglichkeit – dass wir halbwegs friedlich mit ihnen zusammenleben? Die in die Städte eingewanderten Tiere bemühen sich doch bereits darum.
.
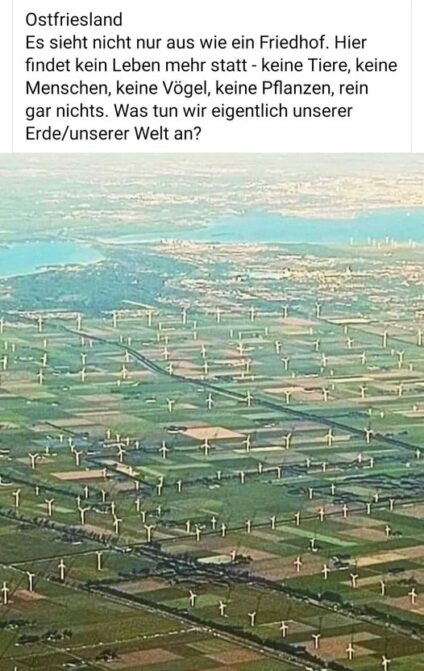
.
Zu den Sternen aufblicken
Meine Bekannte Jekaterina nahm einmal an einer „Sternfahrt“ mit PKWs zu Deutschlands erstem Sternenpark teil. Als einen solchen bestimmt und benannt hatte ihn eine „International Dark Sky Association“ in Arizona, die sich dem Kampf gegen „Lichtverschmutzung“ widmet. Das „Dark Sky Reserve“ ist ein über 1000 Quadratkilometer großes „Nachtschutzgebiet“ bei Gülpe im Havelland, in dem es zehn Beobachtungsplätze gibt, von denen aus man des Nachts in die Sterne guckt, wobei der Norden des Reservats besonders dunkel, also für Himmelsbetrachtungen sehr geeignet ist, weil es dort kaum (noch) menschliche Ansiedlungen gibt.
Die „Sternfahrt“ bestand aus 9 mit 4 PKWs von verschiedenen Orten angereisten Russen, darunter einige astronomisch und ornithologisch interessierte. Sie hatten sich Karten mit den fünf „Highlights“ des Sternenparks ausgedruckt: den WestHavelländer Astrotreff (WHAT), den Sternenblick Parey (SBP), das Optikmuseum (OPM), den Optikpark (OPP) und das Naturparkzentrum (NPZ), wo sie ein Buch über den Park: „Zurück zur Nacht“ erwarben.
Das Westhavelland ist ein bedeutender Rastplatz für Zugvögel, vor allem für Kraniche und Wildgänse. Dazu hätten die Sternfahrer jedoch schon tagsüber dort sein müssen, dann kreisen diese Vögel in Massen am Himmel. Den Hobbyornithologen verdroß es jedoch nicht, dass sie zu spät losgefahren waren, denn dafür ziehen dort nach Sonnenuntergang unzählige Sterne, Kometen und die internationale Weltraumstation ISS ihre Bahnen, wie es in einem Interneteintrag über die vier deutschen Sternenparks heißt.
Einer der Teilnehmer erzählte, dass allein die Milchstrasse aus etwa 200 Milliarden Sternen bestehe, von denen man nur einen winzigen Bruchteil sehe, denn die Milchstrasse habe einen Durchmesser von rund 100.000 Lichtjahren. Selbst mit den besten Teleskopen ließen sich nur 50 Milliarden Galaxien beobachten. Eine Galaxie ist eine durch Gravitation zusammengehaltene Ansammlung von Sternen, Planetensystemen, Gasnebeln, Staubwolken und Dunkler Materie.
Jekterina, die bis dahin mit mäßigem Erfolg Nachtwanderungen durch Mitte für Berlintouristen angeboten hatte, interessierte sich vor allem für die Beobachtung einiger Sterne wie Orion und Sirius und das Sternbild des Großen Bären, mit denen es eine besondere Bewandtnis hat. Es sind an den Himmel versetzte Ermordete: Artemis, die große olympische Göttin der Jagd, des Waldes, der Geburt und des Mondes, Hüterin der Frauen und Kinder, hatte den Himmelsjäger Orion quasi aus Versehen, weil ihr Bruder Apollo sie vorsätzlich irregeführt hatte, mit Pfeil und Bogen getötet. Daraufhin blieb ihr nichts anderes übrig als ihn, den sie eigentlich heiraten wollte, zusammen mit seinem Hund Sirius zu verstirnen.
Dieser griechische Mythos hat sein Pendant bei den kanadischen Schwarzfußindianern: Eine ihrer Urmütter heiratete einen Grizzlybären und wurde dadurch selbst zu einem Grizzly. Ihre Familie wollte die zur Bärin gewordene Tochter daraufhin töten, aber sie kam ihnen zuvor und tötete ihre Familie mit Pfeil und Bogen, starb dabei jedoch selbst. Alle zusammen bilden sie seitdem das Sternbild des Großen Bären.
Da die Erforscher der Vorgeschichte davon ausgehen, dass die Indianer während des Mittelpaläolithikums nach Amerika kamen, geht Claude Lévi-Strauss davon aus, dass die Mythologie Orions u.a. auf eine ebenso alte Zeit zurückgeht und mit ihnen dort angelangt ist.
Von einem der Amateurastronomen ließ Jekaterina sich diese Himmelskörper zeigen, fand sie aber enttäuschend. Die gelernte Starkstromingenieurin bekam wenig später eine Stelle im Weddinger Kulturamt. Dort mußte sie jedoch die Toiletten putzen, was sie so deprimierte, dass sie kündigte – und wieder zurück nach Moskau zog. 2018 fuhr sie zu einer entfernten Verwandten auf die inzwischen von Russland annektierte Krim, wo sie erst einmal blieb. Mir mailte sie im Jahr darauf, dass der nächtliche Himmel über der Krim noch viel weniger lichtverschmutzt sei als der über das Westhavelland und man deswegen noch viel mehr Sterne und Sputniks sähe. Die gemeinen Amis hätten die russische Halbinsel oder Teile davon jedoch nicht als „Dark Sky Reserve“ anerkennen wollen.
.

.
Die Dunkelheit erhellen
„Es ist paradox: Gerade die Dunkelheit, die mit dem Einbruch der Nacht einsetzt, öffnet den Blick in die Ferne, in die Unendlichkeit des Weltalls,“ schreibt der Kulturwissenschaftler Bernd Brunner in seinem „Buch der Nacht“ (2021). In 36 Kapiteln lotet er darin die Finsternis aus. Dazu ist das Buch gespickt mit z.T. langen Zitaten von Dichtern, Schriftstellern und Philosophen über die Nacht. Seit Kafka weiß man, dass diese Menschen arbeiten, wenn alle Bürger schlafen. Für Brunner ist Marcel Proust der „berühmteste Schlaflose“.
Lange Zeit war die Nacht jedoch vor allem mit Schrecken und Angst verbunden – vor wilden Tieren, Räubern, Mooren und Gespenstern. Für die katholische Kirche war sie gar die Zeit der Umtriebe des Teufels und der Hexen. Erst die Aufklärung brachte Licht ins Dunkel. Während diese von den Romantikern eher verehrt wurde – u.a. von Novalis: „Trägt nicht alles, was uns begeistert, die Farbe der Nacht?“ Laut Brunner kommen einem dann die besten Ideen und brauchbarsten Einfälle, einigen Wissenschaftlern sogar noch im Schlaf.
Gehört dazu vielleicht auch die Erfindung der Glühbirne? Ernst Bloch hielt in finsteren Zeiten (1935) dafür, dass sie „die Anfechtungen des Nachtgrauens weit gründlicher geheilt hat als etwa Voltaire; denn sie hat das Grauen aus den Schlupfwinkeln der äußeren Dunkelheit selbst vertrieben und nicht nur aus der des Kopfes“. Heute, am Ende des technischen Fortschritts, beklagen wir jedoch die „Lichtverschmutzung“, die uns den „bestirnten Himmel“ über uns raubte, der Kants Gemüt noch mit „Bewunderung und Ehrfurcht“ erfüllte, ebenso wie das „moralische Gesetz“ in uns, mit dem es auch nicht mehr weit her ist, da die Verbrecher inzwischen selbst am hellichten Tag zuschlagen.
Jenseits der verschwindenden Sterne und der Moral bleibt uns jedoch die Lust erhalten, die schon Goethe für die Nacht reklamierte. Auch für Nietzsche erwachten in dieser Zeit „alle Lieder der Liebenden“, die für die „Nachtschwärmer“ heute in Technoclubs laut werden, sehr laut. Wo es in der Sonne zu heiß ist, machen die Menschen gerne die Nacht zum Tag, von dort kommen die „Geschichten aus tausendundeiner Nacht“, die von Scheherazade erzählt wurden, um den Tod (durch den persischen König) hinaus zu zögern. Aus einem ähnliche Grund zerstörten die europäischen Revolutionäre gerne Straßenlaternen: um im Dunkeln zu entkommen.
Brunner vergisst aber auch nicht die Tiere, Rehe, Füchse, Malaienbären, die ebenfalls, um den Tod (durch die Menschen) zu vermeiden, „nachtaktiv“ wurden. Bei den Nachtfaltern sind es die tagaktiven Vögel, vor denen sie ins Dunkle wichen. Auch einige Pflanzen, wie die Nachtkerze und die Mondblume, erwähnt er. Die Nachtschattengewächse haben jedoch laut Brunner nichts mit der Tageszeit zu tun, sondern sind eher Nachtschadensgewächse, weil einige giftige Substanzen enthalten, „die zu einer Art ‚Umnachtung‘ führen können“. Auch die sechs Monate dauernde Polarnacht im Hohen Norden kann für die Menschen aus südlicheren Ländern diesen Effekt haben.
.

.
Nicht-menschliche Nachbarn
Die auf der Nordhalbkugel lebenden Tiere und Pflanzen wandern wegen der Klimaerwärmung in Richtung Arktis und die auf der Südhalbkugel lebenden in Richtung Antarktis, so der Befund des Politologen Benjamin von Brackel in seinem Buch „Natur auf der Flucht“ (2021). Eine weitere Wanderbewegung von Tieren und Pflanzen ist die vom Land in die Stadt. In Berlin leben inzwischen viel mehr Arten als im weiten Umland. Hier müssen sie sich nach neuen Lebens- und Wirtschaftsweisen umsehen – und sich möglichst an die Menschennähe gewöhnen. Der Ökologe Josef Reichholf meint, dass die Dörfer sich der Natur verschließen und die Städte sich ihr öffnen.
Am Wannsee z.B. kommen Badende und Wildschweine bereits ziemlich gut miteinander aus. Vor einiger Zeit besuchten wir ein Café am Schildhorn. Als wir auf den Parkplatz zurückgingen und ich das Auto aufschloß, drängt mich eine Wildsau zur Seite und sprang auf den Fahrersitz, wo sie in der Mittelkonsole was Eßbares suchte, aber nichts fand. Grummelnd zog sie sich zurück und drängte mich dabei erneut zur Seite. Dabei sah ich etwa sechs Frischlinge hinter mir, die auf ihre Mutter warteten. Am Rupenhorn wohnt die Veterinärin Dr. Malone, die täglich zwei Wildsauen mit Wasser versorgt, weil diese wegen eines Zauns nicht mehr an den Wannsee gelangen können. Sie sind schon fast handzahm geworden, was den Obrigkeitsdenkern allerdings nicht gefällt: Die Wildtiere sollen den Menschen meiden.
Kürzlich stand ich Nachts an der Ampel am Görlitzer Bahnhof und wartete auf grünes Licht als ich einige Meter neben mir einen Fuchs sah, der ebenfalls die Skalitzer Strasse überqueren wollte. Er wartete auch und als die Ampel grün wurde, gingen wir beide los. Anscheinend glaubte er zu Recht, dass er sicherer über die Straße gelangte, wenn er sich nach mir richtete. Im Prinzenbad, im Wannsee-Schulungsheimgarten von Verdi, auf einem Kreuzberger Schulhof und im Hinterhof vom Haus der Kulturen Welt stellte sich regelmäßig ein Fuchs ein, wenn die Leute dort ihr Essen bzw. Pausenbrot auspackten oder den Grill anschmissen. In höflicher Entfernung warteten sie darauf, etwas abzubekommen. Auf einem Neuköllner Spielplatz sollten die Ratten vernichtet werden; statt Gift auszulegen hoffte man hier aber auf die Hilfe von einem Fuchs, der dann dort auch tatsächlich auf Rattenjagd ging. Auch auf dem Prager Platz in Wilmersdorf holt sich ein Fuchs immer mal wieder eine Ratte. Manchmal allerdings auch ein Kaninchen. Sie werden auf den offenen Hinterhöfen in der Prinzregentenstrasse von den Anwohnern mit Gemüseresten gefüttert. Im Palast der Republik lebte zuletzt ein Fuchs, als der Palast abgerissen wurde, verschaffte man ihm ein neues Domizil in der Tiefgarage am Alexanderplatz, das er auch annahm.
Ähnlich klug und urban verhalten sich die Krähen z.B. auf dem Hackeschen Markt und an den zwei Imbißständen am Mehringdamm: Sie hoffen dort auf Brot- und Fleischreste. Anderswo haben die Krähen von den Flaschensammlern gelernt und durchsuchen die orangenen Abfallkörbe an den Straßenrändern.
Dreister als Füchse sind die Waschbären, bislang trauten sie sich jedoch nur bis in die Außenbezirke Spandau, Reinickendorf, Marzahn und Treptow.
Im Engelbecken brütet eine Schwänin gleich neben den Cafétischen und ist so durch die Nähe der Gäste vor Eierdieben und sonstigen Feinden geschützt.
Ein Eichhörnchen springt regelmäßig von einem Baum auf den Balkon des taz-Autors Kuhlbrodt, wo er Futter für das Tier hinlegt. Im Prenzlauer Berg kam im letzten kalten Winter ein Eichhörnchen durch die offene Tür einer Küche im Erdgeschoß, wo wir zu fünft saßen. Sofort wurden ihm einige Nüsse hingelegt, es wollte aber nicht fressen, sondern sich nur aufwärmen.
In der Alten Schönhauser Strasse in Pankow hängen an den Balkonen einige Nistkästen für Meisen. Bei einer Mieterin fliegen sie in das Zimmer, wenn die Balkontür offen ist und schauen ihr bei der Arbeit zu. Weil dort auch ein Elsternpaar sein Revier hat, fallen ihm oft die flügge gewordenen Jungmeisen zum Opfer. Bisher haben die Meiseneltern die Mieterin vergeblich gebeten, ihre Jungen vor den Elstern zu schützen.
Tauben und Spatzen muß man hier nicht erwähnen: Sie leben schon seit ewigen Zeiten in Berlin und kennen viele Überlebensmöglichkeiten. Derzeit nähern sich Goldschakale der Stadt.
Die Spatzen muß man aber doch erwähnen, füge ich Ende September 2025 hinzu, denn an mindestens sechs markanten Plätzen und in Gebüschen Berlins, wo sich stets kleine Schwärme von bis zu 50 Spatzen aufhielten, sind sie plötzlich verschwunden. Das verlangt, gründlicher als bisher von mir recherchiert zu werden. In Hamburg sind sie tatsächlich verschwunden, weil alles dort so schön wärmeisoliert und renoviert wurde, ebenso in London, weil man dort die Vorgärten mitsamt ihren Hecken aufgrund des Parkdrucks in „Car Ports“ umgewandelt hat. In Berlin sind auch die Amseln plötzlich seltener geworden, eigentlich alles Vögel bis auf die Tauben und Krähen und ein paar Möwen.
.

.
Schwachstellen
Im Zweizwerge-Verlag Berlin erschien vor einiger Zeit die Autobiographie eines Polizisten: Er las auf der Wache täglich die taz – um seine BZ und Bild lesenden Kollegen zu provozieren, dann wurde er Kontaktbereichsbeamter (KOB) im Wedding, wobei er hoffte, aus der Bevölkerung heiße Tips für irgendwelche schweren Delikte zu bekommen, er wurde aber geradezu überhäuft von Denunziationen, was er zunächst schätzte, aber schnell merkte er, dass an all diesen Anschwärzungen nichts dran war. Enttäuscht gab er seinen KOB-Job auf – und wurde Personenschützer bei Willy Brandt, den er sehr schätzte und vor allem davor schützte, dass der regierende Bürgermeister ständig besoffen gemacht wurde. Jedesmal, wenn man „Cognac-Willy“ auf einer Versammlung abfüllte, ging er nach einiger Zeit in den Saal zu ihm und sagte laut: „Herr Brandt, der Wagen ist vorgefahren.“ Obwohl der die ganze Zeit vor der Tür stand. Aber Willy Brandt verstand, sagte „Letzte Runde“ und verschwand mit ihm.
Die US-Wissenschaftlerin Shoshana Zuboff nennt das, was auf uns zukommt „Überwachungskapitalismus – wobei sie zuvörderst an die elektronische Überwachungstechnik denkt, die ständig vervollkommnet wird. So besitzen die Ehemänner in Saudi-Arabien z.B. ein Smartphone, dass Alarm gibt, wenn eine ihrer Ehefrauen sich mit ihrem Smartphone dem Flughafen nähert.
Letzten Endes braucht aber auch die totale Überwachung Staatsdiener, die handgreiflich werden, also Polizisten, die den Überwachten oder Verdächtigen festnehmen.
Und das ist die Schwachstelle aller Systeme. Der jüdische Schriftsteller Valentin Senger überlebte mit seiner Familie, weil ein Polizist in der Meldestelle den Eintrag „mosaischer Glaube“ einfach löschte. Wer das heute angibt, der muß nur noch „Kultussteuern“ zahlen.
Am Souveränsten war unser Dorfpolizist: Wenn er einen Bauernsohn zur Musterung für die Bundeswehr melden mußte, ging er erst zu dessen Vater. Wenn der sagte, er bräuchte seinen Sohn unbedingt auf dem Hof, dann meldete er ihn nicht. Wenn der Abgabetermin für das Dieselrückzahlungsformular nahte, ging er zu den Bauern und füllte sie mit ihnen aus. Er besuchte regelmäßig meinen Vater, der für ihn einen Schnaps bereithielt, irgendwann zückte er sein Notizbuch und sagte: „Schorse, kann ich Dir mal mein neues Gedicht vorlesen?! Einmal druckste er herum: „Was Unangenehmes diesmal, jemand hat dich angezeigt, weil Du Dein Haus schwarz gebaut hast.“ Mit Hilfe des Dorfpolizisten kam mein Vater aber gimpflich davon.
Mein bayrischer Halbbruder lud mich einmal auf ein Dorffest ein, wo ausschließlich „Maß Bier“ ausgeschenkt wurde (in 1, 069 Litergläsern). Ich sagte, dass ich noch fahren müsse, er meinte daraufhin: „Bis zu drei Maß darfst Du hier trinken, da sagen die Polizisten nichts.“
Auch im bayrischen Bischofsheim wurde mir in einer Kneipe gesagt: „Keine Gefahr, die Polizei hält Dich nicht an, nur wenn oben im Walddorf die ‚Bösen Onkelz‘ spielen, werden ausnahmslos alle kontrolliert.“
Am Seltsamsten war ein Grenzpolizist am Grenzübergang Wannsee/Dreilinden. Gewöhnlich fragten die Grepos, ob man Waffen oder Funkgeräte dabei hatte, er fragte jedoch den Fahrer: „Was ist denn das, es riecht so komisch?“ Wir antworteten: „Haschisch“. Und wie wirkt das? Wollte er wissen. Es entspann sich daraufhin ein längeres Informationsgespräch. Als alles gesagt war, schenkten wir ihm ein Stück Haschisch. Als wir wieder mal nach Westdeutschland fuhren, hatte „unser“ Grepo erneut Dienst. Er grüßte uns wie alte Bekannte – und wir gaben ihm erneut ein Stück. Dann fragte er, was da auf dem Aschenbecher läge. Eine Purpfeife für Haschisch antworteten wir und reichten sie ihm. Er besah sie sich so genau, dass wir sie ihm schließlich schenkten. Als ich das einer DDR-Dissidentin erzählte, war sie entsetzt, wie unmoralisch wir uns gegenüber der DDR-Staatsgewalt verhalten hatten. Dabei waren wir hocherfreut gewesen, dass einer von den „Organen“ sich so menschlich uns gegenüber verhalten hatte.
Das mögen alles Kleinigkeiten gewesen sein, aber sie sind wichtig, um den immer unmenschlicheren Systemen zu entkommen.
.
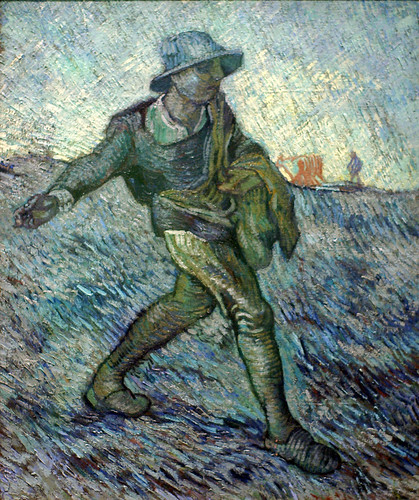
.
Startup-Fieber
Die Innovationsberater-Firma „Startup Genome“ fand heraus, Berlin ist die Startup-Metropole Deutschlands. 2020 schaffte diese nachgesellschaftliche Projektwelt hier bereits 19.000 Billigjobs. Fast im Monatstakt werben inzwischen neue Bringdienste in den U-Bahnhöfen. Ich vermute, dass dahinter jedesmal Millenials stehen, die ständig an ihren Smartphones rummfummelten, sich nächtens Fastfood und Softdrinks kommen ließen und dann die tolle Idee eines Bringdienst hatten. Dazu stellten sie einen Schwarm armer Schweine als Ausfahrer ein.
„Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald,“ hieß ab 1955 der Werbespruch der ersten Schnellrestaurantkette – mit Broiler To Go im Angebot. Ähnlich lautet nun der Spruch der Lieferfirma „Wolt“: „Berlin erreicht Herd-Immunität“. In den LPG der DDR gab es auch schon einen Lieferdienst, d.h. die Fahrer brachten den Mitarbeitern täglich Essen aufs Feld.
Es gibt wahre Startup-Moden: Nach den Fastfood-Lieferdiensten warben neue Bankgründungen in den U-Bahnhöfen, sie nannten sich Smartphone-Banken: Alle Geldgeschäfte wurden bei ihnen angeblich „easy“ erledigt – mittels „financial technology“. Deswegen hießen sie auch „Fintech-Banken“. Eine Wirtschaftszeitung unkte: „‘Es reicht nicht, Fantasien zu verkaufen‘ – ruppiges Börsenklima für Fintechs“.
Nach den Finanz-Startups kamen die Finanzamt-Startups. Eins nennt sich „taxfix“: Es will die jährliche Steuererklärung für uns erledigen. Als wenn es nicht schon genug Steuerberater gäbe. Das Problem dabei ist, bevor sie eine Steuerrückzahlung für uns erreichen, wollen sie erst mal selbst Geld von uns haben. Die taxfixer werben dafür mit dem kessen Spruch: „Schluss mit Steuer-blablablabla-erklärung“.
Noch abstoßender sind die Startups der Drogendealer. Kurando z.B., das uns „Medikamente in 30 Minuten“ liefern will: „Free delivery…“ Oder „Mayd“, das ebenfalls verspricht, uns blitzschnell z.B. Schmerztabletten zu liefern. Ihre Renner sind angeblich nicht-rezeptpflichtige Potenzmittel. Mayd kooperiert mit Apotheken. Diese nehmen die Bestellungen auf und stellen die Ware zur Abholung bereit. Mayd hat bloß die Fahrer, die sie ausliefern. Wir haben es also auch hier mit einem oder mehreren Cleverles (in Sneakers und Kapuzenpullis?) zu tun. Sie sitzen in ihrer Computer-Zentrale und stellen einen, mehrere oder ganz viele Arbeitslose bzw. besessene Sportler ein, die bei Wind und Wetter durch die Stadt jagen – und dabei ständig ihr Startup-Smartphone am Ohr haben.
Auf „businessinsider.de“ heißt es: „Mayd ist nicht das einzige deutsche Startup mit dieser Idee. Nach der aktuellen Seedrunde ist es allerdings das am besten finanzierte.“ Eine „Seedrunde“, das sind Samenspender, namentlich die Startups „468 Capital“, „Earlybird“ und „Target Global“. Laut eines Linkedln-Posts des Mayd-Gründers haben daneben auch bekannte „Business Angels“ wie die Gründer der Startups „Amorelie“, „Auto1, „Aitme“ und „Flixbus“ in seine Lieferfirma investiert – insgesamt 13 Millionen Euro.
Mayd war so erfolgreich als Drogendealer, dass seine Vertragsapotheken nicht nachkamen mit den Bestellungen. Einige Start-Upper haben bereits Lieferdienst und Apotheke verbunden: die Versandapotheke „DocMorris“ z.B., die 2000 von einem holländischen Apotheker und einem deutschen Ingenieur gegründet wurde und jetzt dem Schweizer Konzern „Zur Rose Group AG“ gehört.
Für den Apothekerverband ist die Strategie von DocMorris nur Augenwischerei. „Es gibt jetzt schon viele Einkaufsgemeinschaften von Apotheken. Diese kaufen bei Großhändlern billiger ein und unterbieten oft die Preise von DocMorris,“ sagte die Sprecherin der „Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände“ dem Leiter des „News-to-be-smart-Rooms“ bei „BurdaForward“, was der „Bunte“-Besitzer Hubert Burda als „digitales Medienhaus der Zukunft“ bezeichnet. Sein „Forward“ läuft wahrscheinlich auf eine „Bunte für die Startupper-Class“ raus.
.
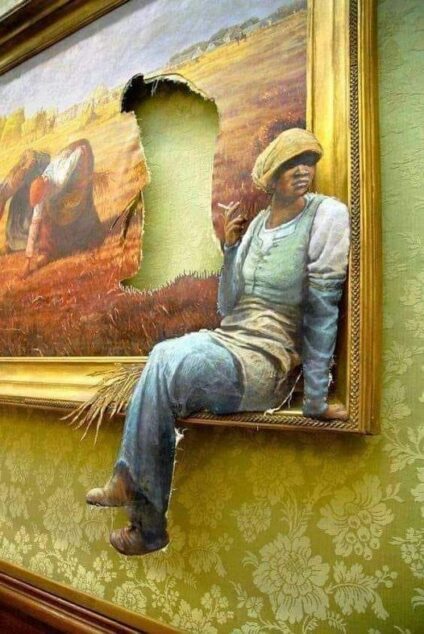
.
Staat-Ups
Grob gesagt kann man bei den Existenzgründern zwischen sich verwirklichen und verwirken unterscheiden. Erstere werden zumeist vom Arbeitsamt gefördert und mit einem Coach versehen, man spricht deswegen auch von „Staat-Ups“. Letztere suchen sich Investoren, die ihnen einen Projektmanager vor die Nase setzen, der sie auf marktwirtschaftlichem Kurs hält (so machen es z.B. die Zalando-Brüder). Von allen „Start-Ups“ gelangt höchstens einer von zehn in die Gewinnzone.
Unsere Kneipe in Neukölln war ein Staat-Up, das Wirtsehepaar Uschi und Ansgar war arbeitslos gewesen und hatte beim Jobcenter einen Projektantrag gestellt, der genehmigt worden war. Normalerweise muss sich jeder irgendwann entscheiden, ob er vor oder hinter der Theke stehen will, für unseren „Fuchsbau“ hinterm Comenius-Garten traf das nicht zu, d.h. Gäste und Wirte waren nicht unterscheidbar. Weswegen die Einnahmen nicht mit den Ausgaben für Getränke und Knabberzeug Schritt hielten: Es wurde großzügig eingeschenkt und die Deckelführung lax gehandhabt, während den „Aushilfen“ anständige Stundenlöhne gezahlt wurden.
Irgendwann führte der vom Jobcenter auf das „Projekt“ angesetzte „Coach“ ein ernstes Gespräch mit Uschi und Ansgar: Der Umsatz könnte besser sein, sagte er, der selbst eine Art „Staat-Up“ war: ein Unternehmensberater. Einst hatte er in der Hochschule für Ökonomie sozialistisches Wirtschaften gelernt, dann hatte er als Selbständiger Firmen beraten. Diese hatten seine Wirtschaftskonzepte jedoch meist abgelehnt und waren „deswegen wieder vom Markt verschwunden“. So war es dann auch beim „Projekt“ von Uschi und Ansgar, denen er vorschlug, mehr Touristen anzulocken und z.B. Cocktails und „Happy Hours“ einzuführen, sowie mit „Flyern“ draußen für ihre Veranstaltungen zu werben. Aber dazu fand sich niemand und das ganze „Hawaii-Gelumpe“ mit den Happy-Hours lehnten alle ab, zumal sie befürchteten, dass dann plötzlich Englisch im „Fuchsbau“ gesprochen wurde. Nicht dass sie generell was gegen Fremde hatten, Polen und Russen waren z.B. willkommen, es standen acht Wodka-Sorten im Kühlfach.
Als der Coach sich mit der Anökonomie das „Fuchsbaus“ vertraut gemacht hatte, schlug er vor, mit den Stammgästen einen Kulturverein zu gründen, das würde die Verluste auf viele Schultern verteilen, wenn nicht gar dazu führen, endlich Gewinn zu machen, denn hinter einem solchen altruistischen Verein stünden viele Egoisten, die nicht draufzahlen wollen auf Dauer. Der Coach argumentierte gerne biologisch, in diesem Fall bemühte er eine Drosselart, bei der die ledigen Vögel den Brutpaaren bei der Aufzucht helfen, wodurch sie an Ansehen gewinnen. Desungeachtet wurde sein Rat angenommen und schon bald waren alle Mitglieder im Verein der Freunde des klassenlosen Fuchsbaus. Da die Höhe des Mitgliedsbeitrags jedoch von jedem selbst bestimmt wurde und man auch nichts zu zahlen brauchte, änderte der Verein wenig an der finanziellen Misere. Den „e.V.“ gibt es noch heute, aber Uschi und Ansgar übergaben die Kneipe einem anderen Wirtsehepaar. Dennoch blieb alles so wie es war, nur dass die neue Thekencombo etwas strenger wirtschaftete und die Gläser nicht mehr so voll schenkte.
Zu den Vereinsmitgliedern gehörte Malgorzata, eine Fotokünstlerin. Da sie selten ein Foto verkaufte, war sie arbeitslos gemeldet. Irgendwann legte das Jobcenter ihr nahe, sich selbständig zu machen mit einer Förderung und einem Coach. Bei diesem handelte es sich um einen Westberliner, der eine Künstleragentur hatte, aber es sei ihm damit nach der Wende so ergangen wie Woody Allen in „Broadway Danny Rose“. Malgorzata photographierte vor allem Leute in U- und S-Bahnen. Danny Rose riet ihr, sich auf Hochzeiten, Betriebsfeiern und Firmenjubiläen zu werfen und dazu z.B. bei Kapitänen von Ausflugsschiffen und Betreibern von Hochzeitssälen vorzustellen – mit Visitenkarten. Seine Vorschläge machten Malgorzata regelrecht krank. Oft hatte sie sich vorgestellt, wenn sie mal wieder einen hupenden türkischen Hochzeits-Konvoy auf der Straße sah, hinzurennen und die Braut aus dem Auto zu zerren, um sie zu retten. Das war also alles nichts für sie, ihr Coach machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl und ihr Sachbearbeiter beim Jobcenter drohte: „Wir können auch anders!“.
.

.
Tätowierungen
Da die kapitalistische Produktion von Anfang an eine Überproduktion ist, steigen ständig ihre faux frais, die keinerlei Mehrwert schaffen. Dazu zählt u.a. die Werbung, die laufend neue Ideen produzieren muß. Längst hat sie die Bekleidung unserer Körper erfaßt, indem die Textilproduzenten ihre Label außen sichtbar auf ihre Waren anbringen und Fußballer sowie Rennfahrer mit ihren Label geradezu pflastern. Seitdem die Unternehmen die sozialen Medien entdeckt haben, wimmelt es auch dort von Produkt-Reklame. Selbst die Zeitungen aus Holz spicken ihre Internet-Auftritte damit, man kann wählen: entweder Abo oder umsonst mit Werbung.
Hat die Wirtschaftswerbung es den Graffitikünstlern nachgemacht und alle freien Flächen mit Label – „tags“ und „pics“ – überzogen oder war es umgekehrt? Dann wären die Graffitijunkies die Rache von unten auf den Reklamedruck des Kapitals – von oben.
Parallel zu diesem Klassenkampf mittels Verunstaltungen traten immer mehr Leute auf, die eine Art von Eigenwerbung auf ihren T-Shirts und Stofftaschen trugen – „Kung Fu Fighter“ oder „Alles Fotzen außer Mutti“. Auf dem großen Busen einer Frau stand „Too Big To Fail“, eine Amerikanerin schrieb auf ihr T-Shirt: „Wish They Were Brains“.
Was lag da näher als unter die Haut zu gehen? Sich seine Eigenwerbung eintätowieren zu lassen. Unter „tattoo-sprüche“ finden sich Fotos dazu: Ein Frauenhals mit „Keep me wild“, ein Unterarm mit „Be happy“. Das Magazin „Men‘s Health“ schrieb 2016: „Ihr Tattoo soll ein Spruch sein? Dann liegen Sie voll im Trend!“ Eine Hamburger Tätowiererin erklärte der Redaktion: „Dass die Familie für Männer eine sehr wichtige Rolle spielt, erkennt man auch an der aktuellen Beliebtheit von Tattoo-Sprüchen zum Thema Familie. Bei Männer beliebt sind große Buchstaben auf den Fingern“, behauptet die Tätowiererin, „Auch die Brust wird mittlerweile oft mit großen Lettern verziert und die persönliche Botschaft stolz in die Welt getragen.“
Auf Frauenkörper liest man eher Buddhas Ratschläge für ein Leben im Hier und Jetzt. Der Schweizer Historiker Valentin Groebner studierte Tattoos im Freibad. Ihm flüsterte (in: Merkur 2019/10) jede entblößte Botschaft ein „Bitte schau mich an“ zu. Die „gezackten dunklen Bänder an den Oberarmen“ waren inzwischen so häufig geworden, dass sie ihm kaum noch auffielen. Die ersten tattoos in den Siebzigerjahren waren noch „gefährlich-verrückt“. Groebner meint, Tattoos seien keine Label, so wie auf Kleidern oder Sonnenbrillen, sondern sollen „Selbstbestimmung signalisieren – oder soll man ‚Werte‘ sagen?“.
Gerade auf diese will man bei den Beamten in Zukunft besonders achtgeben: Die angehenden Lehrer z.B. sollten einen „Fragebogen“, der ihre „Tätowierungen abfragt“ ausfüllen, ihre Gewerkschaft sorgte jedoch für Rücknahme der Bögen, er beinhaltete, genaue Angaben zu jedem Tattoo zu machen – inklusive einem Satz, was die Tätowierung einem persönlich bedeute und einem Foto, das beizulegen war.
Ein 2021 verabschiedetes Bundesgesetz zur „Regelung des Erscheinungsbilds von Beamtinnen und Beamten“ hatte bereits festgelegt, dass Tattoos „im sichtbaren Bereich verboten“ sind – wenn sie „die Funktionsfähigkeit der Verwaltung gefährden“ oder an der Verfassungskonformität des Staatsbediensteten Zweifel aufkommen lassen. Extremistische oder Gewalt verherrlichende Darstellungen seien verboten.
Bei der Polizei wurde ein Bewerber abgelehnt, weil der Polizeiarzt sein tattoo als „sexistisch“ eingeschätzt hatte. Das bezog sich auf die Brüste einer eintätowierten Göttin Diana. Das Angebot des Bewerbers, die Brüste überarbeiten zu lassen, wurde abgelehnt.
Ähnliches passierte einer Bewerberin für den gehobenen Polizeivollzugsdienst: Sie wurde abgelehnt, weil sie auf einem Unterarm das auf Französisch eintätowierte Zitat „Bitte bezwinge mich“ trug. Das Verwaltungsgericht entschied, eine Polizistin dürfe „keine Ansätze für Provokationen bieten“.
.

.
Briefmarken und Chinchillas
Ein Bremer hatte eine gute Geschäftsidee. Sowas gibt’s. Der in Berlin lebende Schriftsteller Peter Kohle (Nomen est Omen?) annoncierte in einer Philatelisten-Zeitschrift, dass er eine komplette Sammlung Briefmarken von afrikanischen Staaten besäße und sie umständhalber abgeben müsse. Ihm wurden daraufhin z.T. erhebliche Summen angeboten. Das könnte also funktionieren, dachte er sich. Seine Freundin und er kauften sich einen VW-Bus, bauten ihn aus und fuhren nach Afrika. Sie besuchten alle 54 Staaten und kauften deren Briefmarken, mehrere von jeder Marke.
Als die beiden Afrikareisenden wieder in Berlin angelangt waren, setzte Kohle erneut eine Anzeige in eine Philatelisten-Zeitschrift: Habe einen kompletten Satz Marken von allen afrikanischen Staaten zu verkaufen. Und weil er mehrere von allen besaß – wurde er damit zum Millionär. Gleichzeitig schrieb er einen Bericht über ihre Afrikatour, die er unter dem Titel „Afrika -Patt Problem“ veröffentlichte. Im Vorwort schrieb er: „…Die Besonderheit der folgenden Berichterstattung liegt in der Alltäglichkeit, in dem Irrsinn der Normalität, in dem täglichen Drama…“
Weniger Glück als Geschäftsmann hatte ein Altonaer namens Jörg Böttcher, der mit Frau und Kind in Teltow auf einem Resthof lebt und bei einem Besuch des Kirschblütenfests zwei Dithmarscher kennenlernte, die eine „tolle Geschäftsidee“ hatten: In seinem leeren Schweinestall könnte er wunderbar Chinchillas züchten, meinten sie. Chinchillafelle gelten neben dem Zobel als einer der wertvollsten Pelze im Rauchwarenhandel. Damit könne er reich werden: zwischen 100 und 150 Euro bekäme man für ein Fell. Und das Futter – Gräser, Blüten, Kräuter – koste so gut wie nichts. Die Dithmarscher boten sich sogleich an, ihm neun Paare zu verkaufen – pro Tier verlangten sie 250 Euro. Nähme er alle, bekäme er einen Mengenrabatt und müsse nur 4000 Euro insgesamt zahlen.
Jörd Böttcher wollte erst einmal Näheres über Haltung und Pflege von Chinchillas wissen: Es sind südamerikanische Nagetiere. Diese auch Wollmäuse genannten Tiere werden bis zu 35 Zentimeter lang. Die Weibchen können bis zu drei Mal im Jahr zwei bis vier Junge bekommen, die schon mit etwa acht Monaten geschlechtsreif sind.
Seine Frau, Marina Klose, war skeptisch, sie wollte erst einmal ein Tier sehen. Kein Problem: Die beiden Dithmarscher hatten in ihrem Auto ein Pärchen in einer Box dabei. Als sie den beiden die Tiere zeigten, waren sie begeistert – und machten den Deal sogleich perfekt.
Als die wertvollen Pelztiere angeliefert wurden, wuchs die Begeisterung noch, denn es waren zwei schwangere Weibchen dabei – und alle 18 lebten sich gut im Schweinestall ein. Im „Chinchilla-Lexikon“ las das Ehepaar: „Manche halten Chinchillas einfach nur aus Profitgier, andere aber haben sich das Ziel gesteckt, Qualität statt Quantität zu züchten. Grundsätzlich kann man aber sagen das nicht das teuerste Tier das beste Chinchilla ist. Jedoch ist auch gleichzeitig zu sagen, dass das günstigste Tier nicht immer das günstigste Tier ist. So müsse man für ein Persian Royal Angora Chinchilla momentan weit über 2000 € bezahlen. Und das wäre noch günstig!“
Im Geiste rechnete das Ehepaar sich schon die ungeheuren Gewinne aus. Und dann vermehrten sich die Tiere auch wirklich sehr gut. Als sie die ersten zum Verkauf anboten, machte man ihnen jedoch wenig Hoffnung, dass sie mehr als 25 Euro pro Tier bzw. Fell bekämen. Ein große Enttäuschung, doch loswerden mußten sie die Tiere, denn sie hatten schon bald zu viele. Mehrere Händler, die sich ihre Chinchillas persönlich ansahen, winkten ab: Das Fell war ihnen nicht gut genug. Zuletzt bot das Ehepaar die Tiere „fürn Appel undn Ei“ Zoologischen Handlungen an.
Unterm Strich war ihre Chinchillazucht ein Minusgeschäft. Immerhin konnten sie aber nun bei Gesprächen über Geschäftsideen am Start-Upper-Stammtisch in Teltow mitreden. Ihre Chinchilla-Pleite interessierte alle.
.

.

.
Auf das Verschlechterungsverbot pochen
Die Kleinstadt Nauen nahe Berlin hat einen Gemeindewald. Auf „nauen.de“ befindet sich eine Liste mit „einige Leistungen, die ihr Stadtforst erbringt: „Industrieholz für Zellstoff und Faserplatten/ Brennholz für den Hausbedarf/ Praktikantenausbildung/ Erholungs- und Schutzleistungen/ Realisierung von Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen/ Totholz sowie Horst- und Höhlenbäume für die Tierwelt/ Bestattungsmöglichkeit in der Natur.“
Das ist viel Leistung für so einen kleinen Stadtforst (1100 Hektar), bei dem auch noch ein Drittel unter Naturschutz steht: das FFH-Gebiet Leitsakgraben. Und dort gilt ein „Verschlechterungsverbot“: Im „Lebensraumtyp 9160“, d.h. in einem Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald darf die Forstverwaltung nicht einfach eine Kiefernplantage anlegen. In der FFH-Richtlinie heißt es dazu in Art.6 Abs. 2, dass „Störungen von Arten, für die die Gebiete ausgewiesen sind, zu vermeiden sind.“
Zwischen einigen Bürgern und dem Stadtförster kam es deswegen in Nauen zu einem Konflikt. Der von dort stammende Student der Umweltwissenschaften Tobias Mainda hatte den starken Eindruck, dass das FFH-Gebiet „zum reinen Holzlieferanten der Stadt Nauen verkommen ist“ und bat die Europäische Kommission, Generaldirektion Umwelt, um Rechtsauskunft. „Umsetzung und Vollzug europäischen Rechts sind grundsätzlich Angelegenheit der Mitgliedstaaten,“ wurde ihm geantwortet. Konkret war das in diesem Fall das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie das Bundesamt für Naturschutz. Aber beide verwiesen ihn an die Behörde vor Ort. Also stellte er dort – d.h. bei der Staatsanwaltschaft Potsdam – Strafanzeige gegen den Förster Thomas Meyer wegen „Vergehen nach dem Bundesnaturschutzgesetz“. Der zuständige Staatsanwalt Kukuk sah jedoch von der Einleitung eines Ermittlungsverfahren ab, mit der Begründung, dass „die Rodungen als Grundlage für die Wiederaufforstung durchgeführt worden sind und somit der Wiederherstellung des FFH-Gebietes dienten“.
Tobias Mainda schaute sich zusammen mit dem Biologen Jens Esser von der „Entomologischen Gesellschaft Orion-Berlin“ das FFH-Gebiet Leitsakgraben noch einmal genauer an. Es hat die EU-Nummer DE 3343-301, zum Erhalt seiner Lebensraumtypen, insbesondere Eichen-Hainbuchenwälder und Erlen-Eschen-Wälder, dient ein Managementplan. Desungeachtet wurden dort Eichen in Furnierqualität gefällt, „quasi ein Kahlschlag“, und Stieleichen sowie Hainbuchen langsam „durch gepflanzte Lärchen und aktuell durch Kiefern verdrängt“. Die außerdem gepflanzten Douglasien, die angeblich der Klimaerwärmung und Trockenheit trotzen, „schwächeln und sind nicht schädlingsfrei“. Der Insektenforscher Esser entdeckte dort Borkenkäfer, u.a. den Kupferstecher auf ihnen.
In einem Leserbrief an die Lokalzeitung kritisierte Esser Nauens Stadtförster Meyer, der gemeint hatte, der Eichbockkäfer würde die Eichen töten: „Es gibt nicht nur einen, sondern zwei Eichbockkäfer-Arten“ – einen „Großen“ und einen „Kleinen“, beide sind bundesweit besonders geschützt, der Große zusätzlich noch EU-weit. Die Entfernung von besiedelten Bäumen stellt somit schon mal „einen Verstoß gegen deutsches Artenschutzrecht dar“. Wahrscheinlich lebte auf den gefällten Eichen der Kleine Eichbock, der auf abgestorbenen Stämmen oder Starkästen siedelt. „Durch die Fraßtätigkeit der Larven verliert das Holz an Verkaufswert, gewinnt aber ökologisch ungemein. Zumindest ersteres dürfte Herrn Meyer nicht gefallen. Den großen Eichbock findet man in Brandenburg nur noch sehr vereinzelt – „ein Werk vieler Generationen von Förstern.“
Was konnte man noch tun, um das kleine Nauener FFH-Gebiet zu erhalten? Vom NABU (Naturschutzbund) kam eine gute Nachricht: Im „Fauna-Flora-Habitat Leipziger Auwald“ ließ das Forstamt Bäume fällen ohne zuvor eine „Verträglichkeitsprüfung“ durchgeführt zu haben. Und die „Grüne Liga Leipzig“ brachte das bis vor das Oberverwaltungsgericht Bautzen zur Geltung, das dann im Juni 2020 auch alle Fällungen im Auwald erst einmal untersagte. Die Anwältin der Naturschützer, Franziska Heß, freute sich: „Die Bedeutung der Entscheidung ist kaum zu unterschätzen“ – auch für das FFH-Gebiet im Nauener Stadtwald?
.
.
Wir Achtsamen
Zur Achtsamkeit, die demnächst in skandinavischen Schulen gelehrt werden soll, gehört die Umsichtigkeit – nicht nur im Hinblick auf „Schnäppchen“, sondern auch z.B. beim Gebrauch des Wortes „Wir“. „Wir müssen die Vermüllung der Meere stoppen!“ „Wir müssen den Waffenexport nach Saudi-Arabien unterbinden!“, „Wir wissen zu wenig über die Klitoris“, „…Wer, wenn nicht wir“ usw. Besonders absurd ist das in den „sozialen Netzwerken“, auf Facebook z.B., wenn dort das „Wir“ („…müssen was gegen den Elfenbeinhandel tun“) mit der Aufforderung zur Unterstützung verbunden wird – die darin besteht, dass man sie anklickt. Und gut is!
Ich verstehe: Es gibt viele „Wirs“ – ein Fußballvereins-Wir, ein „Partei- und Gewerkschafts-Wir „Wir Opelaner“, Schlesiertreffen, „Wir Motorradfahrer“, „Wir Friesen“ – Apropos: Als dieses „Wir“ Theodor Storm gepackt hatte, zieh ihn Theodor Fontane der „Husumerei“. Trotzdem sollte man nicht den Husumer Nationalökonomen Ferdinand Tönnies und seine Unterscheidung von Gemeinschaft und Gesellschaft dabei vergessen. „Gemeinschaften“ gibt es viele, sie können sich an den unmöglichsten Orten, auch geistigen, entwickeln: So gibt es z.B. in Ost- und in Westdeutschland je einen Kreis von Leuten, die Tausendfüßer züchten („Tausi“ von ihnen genannt) und die sogar je eine eigene Zeitschrift herausgeben. Eine Gesellschaft gibt es aber schon lange nicht mehr, höchstens Nationen, Staaten. Also zielt das politische oder sozial engagierte „Wir“ auf die Weltbevölkerung, mindestens auf die in den industrialisierten Ländern. Der Autor Thomas Steinfeld schreibt in der SZ, dass viele Themen heute „oft ins Große zielen“ – und damit letztlich „Ohnmacht“ anzeigen. Ebenso oft aber würden die Argumente auch ins Kleine,“ auf den Einzelnen, „den verantwortungsvollen Bürger“ zielen. Er denkt dabei an die „Flugscham“, die nicht bis zu den „Kampfliegern“ denkt. Stattdessen wird es immer kleinteiliger – bis hin zu einer „Ideologie privater Verantwortung“. Diese debattiert dann z.B., inwieweit die Segelschiffstour mit Eskorte von Greta Thunberg noch „klimaneutral“ ist. Alles Private ist politisch – das hatte einmal eine andere Bedeutung: von sozial determiniert, es war also analytisch gemeint. Jetzt ist das Wir Teil einer Konsumentendemokratie, in der das Gesetz der großen Zahl gilt, das auch der vereinzelte Konsument für sich nutzen kann, indem er z.B., dem Vorbild Ralph Naders folgend, eine bestimmte Ware nicht kauft, um den Hersteller, wenn das viele machen, zu etwas zu zwingen.
Das war u.a. bei der „Anti-Shell-Kampagne“ Mitte der Neunzigerjahre der Fall, die von „Greenpeace“ mitgetragen wurde. Dieser Global NGO-Player spricht im übrigen auch gerne von „Wir“. Im Falle des „Glühbirnenverbots“ umfaßte dies sogar den Osram- und den Philips-Konzern, mit denen zusammen „Greenpeace“ am EU-Parlament vorbei die Ersetzung der Glühbirne durch quecksilberhaltige „Energiesparlampen“ durchsetzte. Derzeit ist die Organisation bei der „Anti-Nestlé-Kampagne“ aktiv: Ein Boykott wegen der auf Privatisierung drängenden „Wasserpolitik“ des weltgrößten Nahrungsmittelkonzerns und seiner Palmölimporte, für die in Indonesien der Urwald seinen Palmölplantagen weichen muß.
Und „Wir“ sollen deswegen keine Nestlé-Produkte mehr kaufen! Schon heißt es in den sozialen Medien, dass dadurch der Konzern bereits starke Umsatzeinbußen hinnehmen mußte. Die ersten Supermärkte hätten sich schon dem Boykott angeschlossen. So eine konsumistische Boykottaktion ist eine Art Heerschau: Man sieht, wie groß das „Wir“ ist – wenigstens in diesem einen Punkt im weltumspannenden Netz des Kapitals: Nestlé. Man geht bereits ins Detail: Die einen konzentrieren sich auf das in Flaschen verkaufte Raubwasser des Konzerns, andere haben sein Katzenfutter „Kitkat“ im Visier. Es kommt zu Überschneidungen – zwischen dem „Wir“ der Nestlé-Gegner und dem „Wir“ der Katzenliebhaber.
.
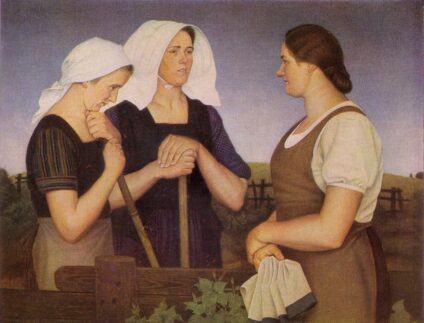
.
Drei Bio-Bildungstage
Seitdem das Damoklesschwert der Schließung nicht mehr direkt über dem Botanischen Garten hängt, erschließt er sich ständig neue Finanzhebel: Mit (schrecklichen) Exotischen Nächten im Dschungelgewächshaus, mit „Das Dschungelbuch“-Inszenierungen, Hochzeitsfeiern, Halloween, „Christmas Garden“, Kakteentage, eigenem Geschenke-Shop…and more. Aber auch mit der Einbeziehung von immer mehr Hobbygärtnern – z.B. als Anbieter von Stauden, Kakteen, und fleischfressenden Pflanzen mit eigenem Verkaufsstand. Schon befürchtet mancher Jahreskartenbesitzer, dass aus dem Garten ein Spektakel wird, ein lauter Verkaufsrummel zwischen den stillen Gewächse – mit etlichen Nebeneinnahmen drumherum.
Kürzlich zeigte man eine „Orchideen-Show“: „Wir lieben Orchideen. Sie auch? Dann sprechen Sie uns an“. Die Züchter und Sprecher der Deutschen sowie auch der Polnischen Orchideen Gesellschaft und der Fachgesellschaft Andere Sukkulanten in der Deutschen Kakteen Gesellschaft ließen sich viel Zeit, um mir das schwierige Geschäft mit diesen komplizierten Pflanzen zu erklären, inzwischen gäbe es ganze „Orchideen-Industrien“, die die Super- und Baumärkte beliefern. Man nimmt ein bestimmtes Teil eines Orchideenstengels und macht daraus tausende von Zellen, aus denen neue Pflanzen gezogen werden. Hybridsorten züchtet man, indem die Pollen einer Art auf den Stempel einer anderen übertragen werden.
Damit gerade das nicht passiert, haben die frei lebenden Orchideen sich so weit auf die Vorlieben eines von ihnen gewählten Bestäubungsinsekts angepaßt, dass dieses, auch ohne Nektar dafür zu bekommen, „blütentreu“ bleibt. Anscheinend kann man alle rund 300 Orchideenarten miteinander kreuzen. Bis heute gibt es etwa 30.000 Hybridarten. Sie werden immer billiger, aber man hätte keine rechte Freude an ihnen.
Deutsche Orchideen gab es nicht zu sehen, außer Frauenschuh und einige andere nichteinheimische aber winterharte Freilandorchideen. Man machte mich auf winzige Orchideen aus Südamerika aufmerksam, sie hingen an einer Drahtwand und waren auf Korkstücke von der Größe einer Zigarettenschachtel festgebunden. Für die ständig neugezüchteten Hybriden wird offiziell keine wild wachsende Orchidee mehr genommen – „der Natur entnommen“. Das Biosphärenreservat Rhön beschäftigt zu ihrem Schutz sogar einen – sehr kenntnisreichen – Orchideenwart. Über die kleinen Orchideen in der kargen Rhön werden viele Bücher veröffentlicht.
Auch ein Züchter von fleischfressenden Pflanzen hatte einen Stand. Da ich in einem Moor voller Sonnentau groß geworden bin, interessierte mich vor allem diese Pflanze. Seine Sonnentaupflanzen sahen jedoch ganz anders aus: Sie stammten aus Südamerika, Südostasien und Australien. Ihr Züchter aus Großbeeren hatte sie von Kollegen gekauft und weitergezüchtet. Die Venusfliegenfallen hatte ich mir größer vorgestellt, vor allem die Kannen der Kannenpflanzen. Füttern tat er sie alle nicht: „Sie müssen nicht unbedingt Fleisch haben“. Im Übrigen sei das mehr eine Liebhaberei als ein Geschäft. Ich vergaß ihn zu fragen, ob er Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für fleischfressende Pflanzen“ ist.
Am darauffolgenden Tag besuchte ich die Naturschutzstation Marienfelde, wo man den Mitgliedern des Entomologen-Vereins „Orion“ das seit einem Jahr bestehende Schmetterlingshaus zeigte, aus dem bereits einige tausend Tagfalter in die Freiheit des 100-Hektar-Geländes entlassen werden konnten: „Vom Kleinen Fuchs allein 1500“. Bis dahin hatte der für das Schmetterlingshaus Verantwortliche sich um das Futter für ihre Raupen gesorgt und tat es auch noch, denn hunderte von Raupen des Tagpfauenauges fraßen auch bei kaltem Wetter noch in lockeren Gruppen Brennnesselpflanzen, die er für sie hingestellt hatte. Ein Schmetterlingsfreund hatte ihm einen Buchsbaum mit einigen Raupen des Buchsbaum-Zünslers geschenkt, der gerade in den Alpenländern die Buchsbäume niedermacht – seine Existenzbasis. Im Schmetterlingshaus sind die Parasiten der Feind – winzige Schlupfwespen u.a., die ihre Eier in die Raupe injizieren – heraus kommen dann statt eines Schmetterlings ein Dutzend weitere Schlupfwespen.
Der Vereinsvorsitzende des „Orion“ und der Verantwortliche der Naturschutzstation besprachen kurz das Was und Wie einer entomologischen Zusammenarbeit. Dabei kamen sie zwecks schonender Artbestimmung auf den Einsatz von UV-Lichtfallen („aus England, die sind die Besten“) zu sprechen. Im Vortragshaus erzählte uns dann der Gärtner Jürgen Gienskey, Orion-Mitglied seit 1960, etwas über „Meligethes und ihre Brutpflanzen“ – dazu zeigte er Photos von diesen Pflanzen, die er in seinem Garten gepflanzt hatte. Bei Meligethes handelt es sich um die sehr artenreiche Gattung der Glanzkäfer, konkret war dabei u.a. vom Rapsglanzkäfer die Rede, der für die Rapsanbauer zu einem Problem werden kann. Das Weibchen legt ihre Eier in die Blüte, die Larven gehen in die Fruchtstände. Der nur wenige Millimeter große Käfer geht zwar auch auf andere Blüten – sie müssen aber gelb sein. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht er u.a. auf die „Gemeine Ochsenzunge“. Der Orion-Vorsitzende erklärte dazu: Diese Pflanze gibt es in Berlin nur noch an einem Standort: am Brandenburger Tor komischerweise. Früher hat man sie als Färbepflanze für Gelb benutzt, ihre Blüten sind jedoch blau-lila.
Zwar besitzt die Naturschutzstation Marienfelde neben Bienen auch einen wilden Eber und ein paar Schafe, deren kämpferischer Bock schon manchen Graffitisprayer auf frischer Tat weggestoßen hat, aber die Säugetiere behielt ich mir für den nächsten Tag vor, da stand ein Besuch des Zoos in Eberswalde an.
Schon von draußen sah man, dass das Weißkopfseeadler-Pärchen zwei Junge groß gezogen hatte, die Mutter stieß seltsame hohe Töne aus, gefolgt von einem leisen Grollen – anscheinend hatte sie irgendetwas erregt. Leider hat der Zoo zu viele Laubbäume stehen gelassen, so dass einige Tiere entschieden zu wenig Sonne ab bekamen, bei Klammeraffen und Leoparden hatte man sich allerdings damit geholfen, dass zwei entfernte Gehege bzw. Inseln über Gebäude hinweg miteinander durch einen Gang aus Draht für die Tiere verbunden wurde. Das Zoogelände ist hügelig. In einigen größeren Gehegen hält man afrikanische Vögel und Säugetiere, die sich in Freiheit ein Habitat teilen, zusammen. In einem anderen leben Bär und Wolf zusammen. So etwas wird in immer mehr Zoos versucht. Im Berliner Zoo hat man aus drei Volieren für die Greifvögel jeweils eine gemacht, in zwei weiteren können die Besucher sogar in die „Flugvoliere“ gehen. In Eberswalde haben nur die Webervögel im tropischen Reptilienhaus viel Flugraum. Sie machten denn auch einen aufgeräumten Eindruck. Auch ein geschecktes Elselfohlen freute sich augenscheinlich seines Lebens. Während das wohl läufige Fischotter-Weibchen von seinem sie unentwegt beschattenden Gatten eher genervt schien.
Das waren die drei Bio-Bildungstage hintereinander. Die nächsten Kulturtage werden in Berlin bestimmt nicht lange auf sich warten lassen.
.
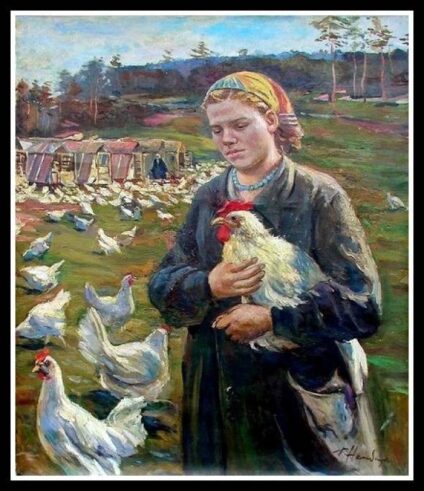
.
Öko-Abenteuer
Kürzlich fand das „1. Berliner Bergfilm-Festival“ statt – mit Reinhold Messner. Das Bergsteigen war ab den Siebzigerjahren Bestandteil von Manager-Fortbildungskursen: Am Seil in einer Steilwand hängend sollten sie das Aufeinanderangewiesensein sinnlich nachvollziehen. Die norwegische Reiseschriftstellerin Erika Fatland meint in ihrem Buch über den Himalaya, „Hoch oben“ (2021), dass dieser fromme Wunsch in Rekorde umgemünzt wird. Die Autorin brachte es selbst am Mount Everest bis zum Basislager 5364 Meter über N.N., dann blieb ihr die Luft weg.
1975 schaffte es die erste Frau auf den Gipfel (8848 Meter), 2013 die erste amputierte Frau, 2005 die erste Eheschließung, 2013 die ersten Zwillinge und der älteste Mann (80), 2014 das jüngste Mädchen (15), 2017 der erste Krebskranke, 2006 der erste Diabetiker (Typ 1), 2010 der erste mit künstlichem Darmausgang, 2001 der erste Blinde, 2006 der erste mit einer Doppelamputation. Er mußte jedoch die Erlaubnis, den Berg zu bezwingen, erst vor dem Obersten Gerichtshof Nepals erstreiten. Dieser kam zu dem Schluß: Keinem dürfe der Zugang zum Mount Everest verwehrt werden. Das war vor allen Dingen ein Recht der Sherpas gewesen – sich unverantwortlichen Führungen zu verweigern. Nicht wenige waren in der Vergangenheit „im Berg“ geblieben.
In der Sowjetunion war das Bergsteigen, aber auch das Hochklettern an Bäumen, Straßenlampen und Hausfassaden fast ein Volkssport. Ab 1939 wurde der noch populärer durch eine Reihe von deutschen Filmen von und mit dem Bergsteiger Harry Piel. Die Partei versuchte gegenzusteuern, eine Schlagzeile der Prawda lautete: „Wider den Harrypielismus“. Zu viele hatten ihre Kletterfähigkeit überschätzt.
In Berlin gibt es nur zum Klettern ungeeignete Trümmerberge, dafür jedoch rund ein Dutzend „Kletterparks“ und „Kletterhallen“.
Es geht beim Bergsteigen u.a. darum, an die Grenze der Fähigkeiten, an das „Limit“, zu gelangen. Alle horizontalen und vertikalen Wüsten durchwandern: Dem Südtiroler Bergsteiger Reinhold Messner geriet das zum Lebensinhalt. Er bestieg nacheinander alle 14 Achttausender, durchquerte Grönland und die Antarktis zu Fuß sowie mit 60 die Wüste Gobi – allerdings halb per Anhalter. Sein Buch darüber, „Gobi. Die Wüste in mir“ (2018), ist eine Art Tiroler Existentialismus. Es geht ihm, ein Schloßherr inzwischen, „immer wieder um extreme Herausforderungen“, um eine umweltschonende „Revolutionierung des Abenteuerbegriffs“. Man könnte ihn als einen Ernst Jünger für Ökos bezeichnen.
Er hat 96 Bücher geschrieben, ein Bergmuseum gegründet und viele Filme produziert. In seinem Gobi-Bericht schreibt er in gewohnt dramatischem Ton: „Ich darf jetzt keine Zeit verlieren, wenn ich mein Leben nicht verspielen will. Die Wüste ist ungeheuer groß und doch Schritt für Schritt zu durchqueren, wenn ich mir die Hoffnung nicht nehmen lasse und meinem innersten Wesen bis zuletzt treu bleibe.“ Unterwegs hört er Stimmen. „Im Gehen spüre ich, sogar in der Wüste, die Mitte in mir.“ Solch Gespür verhindert leider, die Außenwelt gründlich wahrzunehmen. Es ist ein Egoextrem-Trip.
Anders die Biologin Carmen Rohrbach, die ebenfalls eine Liebhaberin von „Extremdestinationen“ ist und dazu eine Menge Bücher veröffentlichte: Sie hat die Wüste Gobi „erkundet“. In ihrem Buch „Mongolei“ (2008) schreibt sie: „Man war schnell daheim in der Wüste, weil alle schwierigen Dinge fehlten.“ Dazu verhalfen ihr auch freundliche Viehzüchter. Mittendrin fragt sich die 60jährige „beliebteste Reiseschriftstellerin Deutschlands“: Was kommt nach der Mongolei – dem „Zufluchtsort“ für ihre „Seele“ zu DDR-Zeiten? „Wüßte ich den Tag meines Todes könnte ich meine Kräfte bündeln…Gefährliches wagen, auf das ich aus vernünftigen Gründen verzichtet habe.“
An Gefährliches wagen sich auch immer mehr Tierfilmer (der Sensationsgier der Medien folgend). Als man den jungen Tierfilmer Andreas Kieling fragte, warum er so an der arktischen Fauna interessiert sei, antwortete er: „Ganz einfach – ich mußte mir sehr genau überlegen, wo es eine Marktlücke gab.“
Der vielgereiste Fernsehproduzent Roger Willemsen berichtet in seinem posthum erschienenen Buch „Unterwegs“ (2020) von einem Gespräch mit einer Stewardess: „Sie gesteht mir in 11.000 Meter Höhe verschwörerisch, auf Langstreckenflügen höre sie Stimmen in den Wolken. ‚Es sind die Toten, die da reden,‘ sagt sie, sie tun es nur über Meeren, Bergen und Wüsten‘. Ich lächele. ‚Das Universum lacht nicht,‘ raunt sie.“
.

.
Amerikanismen
Selbst die kleinste Kunstgalerie betitelt ihre Ausstellungen inzwischen auf Englisch – „In the heart of the West“ oder „Diversity United“ zum Beispiel. Die Hiesigen sprechen bis auf wenige alle Englisch und von den Ausländern, Touristen, die meisten – wird gesagt, und darauf hingewiesen, dass die Sprache in den sozialen Medien sich sowieso angloamerikanisiert.
Kürzlich fand am Brandenburger Tor eine „Demo“ statt, bei der nur noch englische Wörter auf den Transparenten standen – mit den Forderungen der Teilnehmer. Bei ihren Fotos auf Facebook konnte ich es nicht unterlassen, mich über diesen um sich greifenden PC-Trend zu mokieren. Woraufhin mich jemand streng anging, was ich denn für ein Typ sei: in der taz publiziere, RT gucke und eine arische Sprache verlange.
Ich verstand, das Deutsche war für ihn Nazisprache. Das konnte ich noch nachvollziehen: Als ich in Nordafrika war, begrüßte man mich, wenn man hörte, dass ich Deutsch sprach, mit „Hitler gutt!“. Und ein mir bekannter polnischer Bauer, der Zwangsarbeiter bei den Deutschen war, verläßt jedesmal den Raum, wenn jemand Deutsch spricht. Auch dass die Nazis sich als „Arier“ begriffen und SS-Expeditionen ausrüsteten, um im Himalaja und in Afghanistan nach Ur-Ariern zu suchen, wußte ich, aber nicht, was eine „Arische Sprache“ sein sollte. Auf Wikipedia gibt es sie sogar im Plural: Die indoiranischen Sprachen, früher als „arische Sprachen“ bezeichnet, bilden einen Primärzweig des Indogermanischen. Die indoiranische Sprachfamilie besteht aus den Hauptzweigen Iranisch, Nuristani, Indoarisch, die von insgesamt über eine Milliarde Menschen gesprochen werden.
Die arischen Sprachen entwickelten sich vor den germanischen. Meine Forderung nach Protest-Parolen auf Deutsch war aber nicht Altdeutsch-Nationalistisch gemeint noch bedeutete sie „Deutsche helfen Deutschen“. Diese bierernste AfD-Parole hatten wir übrigens 1990 als ironisches Logo der Treuhandanstalt in der taz veröffentlicht: Es bestand aus den zwei sich umfassenden Händen des SED-Emblems und um den Rand herum stand „Deutsche helfen Deutschen Treuhand“.
Mein Wunsch nach Vermeidung von Anglizismen war höchstens altmodisch erzieherisch: Die Passanten sollen aufgeklärt werden über die Notwendigkeit dieser oder jener Forderung: „Mieten runter!“, „Kein Impfzwang!“ oder „Keine Rinderzucht auf Regenwaldböden!“ zum Beispiel. Auch „Höhere Gehälter für Pflegepersonal“ vermittelte sich doch den Vorübergehenden und den Polizisten viel eindeutiger als „Higher salaries for Caregivers!“. Beim Wort „Pflegepersonal“ hat man hier sofort konkrete Bilder vor Augen. Ärgerlich benamt sind selbst die Boxen an Parkanlagen, denen man Plastiktüten zum Aufsammeln von Hundescheiße entnimmt: „Dogstations“.
Vor einiger Zeit hatte ich schon zu bedenken gegeben, dass diese Anglifizierung der deutschen Sprache doch im Zuge des amerikanischen Imperialismus geschieht. Ein Kollege antwortete mir kurz: US-Imperialismus – „darauf habe ich nur gewartet“. Das hörte sich an wie: Der Imperialismus ist doch längst aus der Mode.
Ein anderer Kritiker verortete mich nicht bei den Ariern oder bei den „Antiimps“, sondern bei den Gender-Gegnern wie etwa den Berliner Linguisten Peter Eisenberg, der davon ausgeht: „Die Genderfraktion verachtet die deutsche Sprache“ – aber nicht zwangsläufig auf amerikanischem Englisch. Im Gegenteil: Zwar kommt der Genderism aus den USA, aber hierzulande ist es wesentlich ein Deutsch-Schreib- und –Titelproblem. Er, Eisenberg, sei zwar kein „Hardliner“, doch er müsse die Sprache, die er liebt, verteidigen. Etwa gegen den Genderstern, sagte er. Die deutsche Sprache „lieben“, davon kann bei mir keine Rede sein.
Ich verstehe, dass durch den täglich ins Deutsche hinzukommende Anglizismus, „unsere“ Sprache peu à peu mit neuen Bedeutungen aufgeladen wird: z.B. von „Dauerlauf“ (Schweiß, stinkig, unschön aber sportlich) zu „Jogging“ (technisch und modisch ausgerüstet, entstressend, schön) oder von „Heimarbeit“ zu „Homeoffice“. In umgekehrter Richtung geschieht das auf den Philipinen, die lange eine US-Kolonie waren und es etliche englischsprachige Zeitungen gibt: Fast täglich ersetzen diese ein englisches Wort durch ein Tagalog-Wort.
Wenn man aber guten Willens ist, kann man die hiesige Angloamerikanisierung (bei der aus Entschuldigung „Sorry“ und aus Genau! „Exactly“ wurden), auch als „Deep Antifa“ verstehen. Die gegen Neonazis vorgehende Antifa wäre demnach eine eher oberflächliche Variante dieses „Kampfes“, während die zunehmende Ersetzung der deutschen Wörter durch Anglizismen in die Tiefe ginge, in das Denken mit Wörtern – deswegen: „Deep Antifa“. Ich halte eine solche PC-Arbeit an der Sprache jedoch für überschätzt.
An der mit egalitärem Geist gegründeten Bremer Universität duzten sich alle, aber schon den ersten jungen Dozenten Ende der Siebzigerjahre gelang es, ihr Duzen distanzierter klingen zu lassen als ein Siezen und dazu jede Menge Anglizismen „von drüben“ einzuflechten. Fast so wie die Modemacherin Jil Sander, die der FAZ mitteilte: „Mein Leben ist eine giving-story. Ich habe verstanden, daß man contemporary sein muß, das future-Denken haben muß…Und für den Erfolg war mein coordinated concept entscheidend, die Idee, daß man viele Teile einer collection miteinander combinen kann. Aber die audience hat das alles von Anfang an auch supported. Der problembewusste Mensch von heute kann diese Sachen, diese refined Qualitäten mit spirit eben auch appreciaten. Allerdings geht unser voice auf bestimmte Zielgruppen.“
Immer seltener trifft man auf Leute, die noch einen ganz anderen spirit appreciaten – wie z.B. ein Kneipenbesitzer bei Husum, der seinen Cocktail nicht „Sex on the beach“, sondern „Geschlechtsverkehr am Wattenmeer“ nennt.
.

.
Elefanten
Über Botswana erfährt man meistens nur etwas, wenn es um die dortigen Elefanten geht. In Botswana leben mehr als 130.000 Dickhäuter – rund ein Drittel aller Elefanten Afrikas, Der WWF meldete: „2020 starben 350 Elefanten in Botswana. Sie wurden nicht von Wilderern getötet, denn ihnen fehlten keine Stoßzähne.“ 2021 berichtete „netzfrauen.org“: „In Botswana dürfen in den kommenden Monaten 287 Elefanten legal getötet werden. Die Trophäenjäger kommen aus der ganzen Welt. Obwohl der KAZA-Nationalpark, die weltweit größte Zone für Naturschutz und Ökotourismus vor etwa 10 Jahren mit 50 Millionen Euro deutscher Finanzierung ausreichend Platz für Elefanten bieten müsste, werden Hunderte Elefanten entweder verkauft oder wie in Botswana von Trophäenjäger erschossen.“
2023 beabsichtigte die Bundesregierung, die Einfuhr von Jagdtrophäen geschützter Arten einzuschränken und in einigen Fällen sogar gänzlich zu verbieten. 2024 kam heraus, dass das Sterben der 350 Elefanten in Botswana auf Blutvergiftung zurückzuführen sei, verursacht durch Bakterien. Die Forscher vermuten, dass Stress aufgrund von Hitze und Trockenheit zu diesem Ausbruch beigetragen hat. Ebenfalls 2024 berichtete der Spiegel: „Wegen der anhaltenden Dürre ergreift die Regierung in Simbabwe eine umstrittene Notfallmaßnahme. Sie will Elefanten jagen, um den Hunger der Bevölkerung zu mildern.“
2025 wurden 410 Elefanten zum Abschuss durch Trophäenjäger freigegeben. Dabei handelt es sich um Bullen mit möglichst großen Stoßzähnen, deren Abschuß gravierende Folgen für die Elefantenherden hat. Weil die deutsche Beschränkung der Einfuhr von Trophäen aus Botswana zur Folge hat, dass weniger Trophäenjäger ins Land kommen, um dort Elefanten zu schießen (einer kostet etwa 70.000 Euro), ist der Präsident des Landes erbost, denn Botswana braucht dringend beides: weniger Elefanten und mehr Geld. Er verkündete deswegen, 20.000 Elefanten nach Deutschland zu schicken. Und er akzeptiere kein Nein.
Das „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ fragte sich: „Könnten 20.000 Elefanten in Deutschland überleben – und wäre dann noch Platz für uns?“ Zunächst stellte die Autorin Miriam Keilbach fest: „Die Elefantenpopulation in Deutschland liegt bisher bei rund 130 Exemplaren, wobei es etwas mehr Asiatische als Afrikanische Elefanten und deutlich mehr Kühe als Bullen gibt. Die meisten Elefanten finden sich in Zoos, insgesamt halten noch 24 Zoos, Tierparks und Safariparks Elefanten. Hinzu kommt eine Art Altersheim für Zirkustiere, in denen ebenfalls Elefanten unterkommen, beispielsweise im Elefantenhof Platschow und im Erlebnispark Starkenberg.“
In Mitteleuropa lebten einst zwar Elefanten, die hiesige Bevölkerung ist inzwischen aber nicht mehr, ähnlich wie bei den Wölfen, an sie gewöhnt. „Grundsätzlich darf jede und jeder in Deutschland Elefanten als Haustier halten – insofern man eine artgerechte Haltung bieten kann,“ aber wer kann das schon – außer vielleicht Gloria von Thurn und Taxis. Aber ihr Landbesitz reicht nicht: „Wir bräuchten ungefähr die Fläche des gesamten Saarlands und des Stadtstaats Bremens, um die Tiere zu beheimaten, wenn sie so viel Platz wie im dicht besiedelten Chobe-Nationalpark von Botswana haben sollten. In deutschen Wäldern wäre ebenfalls Platz: Die Fläche des gesamten Waldes in Bayern ist mehr als doppelt so groß wie der Chobe-Nationalpark.“
Die 20.000 Elefanten würden gemeinsam 3000 bis 3500 Tonnen Grünzeug fressen – am Tag! Das Grasland müssten sie sich hier mit den anderen Weidetieren teilen, denen rund 4,73 Millionen Hektar zur Verfügung stehen (etwa 18-mal das Saarland). „Neu überdenken müsste man womöglich auch das Wassermanagement. Ein Elefant trinkt bis zu 150 Liter Wasser am Tag“ und da er bis zu 175 Kilogramm am Tag frisst, muss er natürlich auch viel kacken: „Bis zu 20-mal am Tag scheidet er etwa 100 Kilogramm Dung aus – das wären bei 20.000 Elefanten also jeden Tag 2000 Tonnen. Aber die gute Nachricht: Elefantenkacke eignet sich perfekt als Dünger, würde unserer Natur also gar nicht so schlecht tun.“
Nur, was machen die Elefanten, wenn es hierzulande kalt wird? „Sie bekommen schnell Erfrierungen an Rüssel und Ohren. Deshalb verbringen sie in Gefangenschaft in Deutschland die Winter häufig in beheizten Ställen.“ Zwar sind sie durchweg friedlich, können gelegentlich aber auch gefährlich werden: „vor allem wenn die Bullen in der sogenannten Musth sind oder es Konflikte um Futter gibt. Da Elefanten 40 Stundenkilometer schnell rennen können, hilft es wenig, bei einer Begegnung wegzulaufen. Rund 400 Menschen sterben jährlich durch Elefanten.“
Wenn die 20.000 Elefanten aus Botswana unter uns lebten, bestünde also ein sofortiger Handlungsbedarf. Die flämische Schriftstellerin Gaea Schoeters hat sich in ihrem Roman „Das Geschenk“ (2025) realistische Gedanken darüber gemacht, was der Regierung in Berlin alles dazu einfallen würde – an Schadensbegrenzung. Wenig! Zumal die Rechten im Bundestag dem Kanzler ständig vorhielten, dass seine Regierung Sozialleistungen kürzt, aber für die Elefanten Unsummen ausgibt und mit dieser Polemik Punkte bei den Wählern sammelt. Im Jahr zuvor hatte die Autorin bereits einen Roman mit dem Titel „Trophäe“ veröffentlicht, da ging es um Nashörner.
Für die Elefanten, von denen sich viele ausgerechnet in der Hauptstadt herumtreiben, wo sie in der Spree baden, wurde auf die während der Corona-Pandemie erprobten Maßnahmen zurückgegriffen, wobei der Virologe Drosten diesmal eine Elefantologin ist. Um den Autoverkehr, der wegen der Elefanten immer wieder ins Stocken gerät, zu entlasten, wird das Arbeiten im Home-Office propagiert. Außerdem werden „Sperrstunden“ eingeführt, und wie beim Flüchtlingsansturm wird nun auch beim Elefantenansturm auf „Wir schaffen das!“ gesetzt, indem die Länder und Kommunen Kontingente übernehmen müssen. Bayern weigert sich wie üblich.
Anders als beim überteuerten Kauf von Masken und Impfstoffen setzt man aber diesmal auf den lukrativen Verkauf von Elefantendung, auch ins Ausland. Das soll Geld in die Staatskasse „spülen“. Es gibt dafür einen „Kackeplan“, der sich zwar gut anläßt, aber dann scheitert, weil die Düngerportionen aus Unachtsamkeit Samen der schnell wachsenden Hülsenfrucht Kudzu enthalten, die alles überwuchert. Die Bauern sind sauer und protestieren vor dem Kanzleramt, auch die Abnehmer im Ausland sind erbost und stornieren.
Die Rechten fordern „Weg mit den Viechern. Zurück nach Afrika.“ Der Kanzler verweigert sich, unterschreibt dann aber doch schweren Herzens einen „Drittstaaten-Vertrag“ mit Ruanda, das gegen eine gehörige Summe die Elefanten übernimmt. Dafür wird seine Partei wiedergewählt und er bleibt im Amt. Getrübt wird sein Sieg nur durch die Presse, die meldet: „Ruanda erteilt erste Jagdlizenzen für Elefanten.“
.

.
Berlin indisieren
Die Dörfer verschließen sich der Natur, die Städte öffnen sich ihr, stellte der Ökologe Josef Reichholf fest. In Berlin gehören dazu u.a. Wildschweine und Füchse. Was hier der Fuchs ist in indischen Städten der Leopard. In Europa gilt der Leopard als besonders gefährlich und unter den Zirkusdompteuren als das schwierigste Raubtier. Aber im hinduistisch-buddhistischen Indien geht man anders mit Tieren um und diese anders mit den Menschen. Auf dem Forum „downtoearth.org.in“ wurde unter der Überschrift „Die Leoparden in meinem Hinterhof“ daran erinnert, dass die Leoparden in Indien quasi schon immer an den Rändern menschlicher Siedlungen gelebt hätten. Heute gebe es in vielen Teilen des Landes keinen Wald mehr, sondern nur noch ein Mosaik von Äckern, was den Leoparden um so mehr den Siedlungen nahe bringe. Im übrigen habe man deswegen auch einigen Grund zum Stolz, denn Indien sei „das einzige Land weltweit, in dem die Menschen und ihr Vieh in nächster Nähe von Raubtieren leben.“
Allein auf dem Gemeindeland des Dorfes Akole bei Mumbai lebt rund ein Dutzend Leoparden. Und die Dorfbewohner wollen, dass das auch so bleibt. Manchmal reißt ein Leopard eine Katze oder einen Hund. Wenn eine Ziege gerissen wird, bekommt der Besitzer eine Kompensation. Im Ort gibt es einen Tempel für eine Göttin, die sich u.a. in einen Leopard verwandeln kann. Ihr werden gelegentlich Opfer gebracht. Drei Mal kam es zu einem Unfall: Einmal schlug ein Leopard ein Liebespaar vom Moped, ein andern Mal verletzte einer ein Kind. Umgekehrt wurde ein Leopard durch einen Stromschlag getötet. Seitdem dieses Zusammenleben diskutiert wird, entdeckt man überall Leoparden. Ein US-Internetmagazin titelte: „Viele Leoparden, keine Unfälle. Ein indisches Dorf erprobt, wie das geht!“ Das Magazin „National Geographic“ machte unter der Überschrift „Mit Leoparden leben“ aus den Raubkatzen gleich ein Vorbild für uns alle: „Wenn die Menschen den überkommenen Lebensraum der Leoparden umgestalten, passen diese sich dem neuen an. Können wir das auch?“ Diese Frage, hierzulande u.a. vom Fuchs und vom Wolf aus gestellt, ist keine akademische sondern eine lebenspraktische, weil es für viele Tiere (und Pflanzen) schon bald keine anderen Habitate als die wachsenden Städte geben wird. Dabei stellen sich z.B. Probleme ihrer Ernährung. So erfuhr ich von Rolf Schneider, Biologe an der Humboldt-Universität, über die letzte Dohlenkolonie in Köpenick: „Dohlen sind zwar überall geschützt, sie bekommen hier aber weniger Nachwuchs als auf dem Land. Das Futterangebot ist problematisch: Zwar gibt es genug Kohlehydrate (Brot z.B.), aber sie brauchen für die Aufzucht Eiweiß (Insekten, Würmer etc.). Die Sterberate der in der Stadt geborenen Jungen beläuft sich auf 70 bis 100 Prozent, auf dem Land betrifft es nur 25 Prozent.“ Um allein die Dohlen hier einigermaßen zufrieden zu stellen, bräuchten wir intelligente Gartenbauämter in den Bezirken, die nicht nur mit Rattengift, Mähmaschinen, Motorsägen und Laubbläser arbeiten und etwas mehr „Indien“ als auf Speisekarten: Nach der Studentenbewegung gab es im Urbankrankenhaus eine ganze Therapieeinrichtung für „Indienfahrer“, also für Berliner, die nach Indien gefahren und hierher zurückgekehrt prompt durchgeknallt waren. Wo sind die alle geblieben?
.
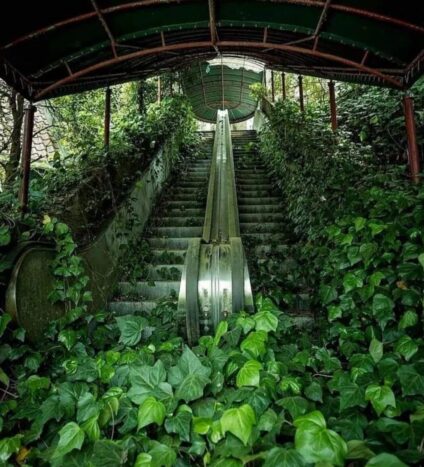
.
Fake-Orte
Der Reichstagverhüller Christo hat das Verhüllen von der Pike auf gelernt: Als Kunststudent in Sofia gehörte er zu einer Brigade, die kaputte Scheunen längs einer Bahnstrecke nach Rumänien verhüllen sollte. Ein Semesterferienjob, der den bulgarischen Künstler offensichtlich geprägt hat.
Als Erfinder von Fake-Orten gilt indes Potemkin – mit seinen berühmten „Dörfern“, um Katharina die Große zu täuschen, die ihre Fahrt auf die Krim als Inspektionsreise nutzte. Die Dörfer ihres Gouverneurs Potemkin waren jedoch alles andere als vorgetäuscht. Der Historiker Gerhard Prause sagte es so: „Fürst Potemkins Dörfer waren nicht von Pappe“.
Die taz berichtete in den 1997 mehrmals über „mohammedanische Fake-Dörfer“ auf süddeutschen Übungsplätzen, wo Nato-Offiziere lernen, „deeskalierend“ auf eine sie hassende Bevölkerung einzuwirken. Die Statisten, die z.B. einen aufgebrachten Beerdigungszug spielen müssen, kamen meist uns Russland. Einer taz-Autorin, die Arabistik studierte, gelang es, von der deutsch-amerikanischen Verwaltung als Mitspielerin zugelassen zu werden. Wladimir Kaminer, veröffentlichte eine Geschichte über seine Moskauer Freunde, die aus Geldmangel ebenfalls unwillige Mohammedaner spielten.
1998 erklärte uns ein vortragender Major des Verteidigungsministeriums die neue NATO-Verteidigungsdoktrin: „Sie ist nicht mehr nach Rußland hin angelegt, die russischen Soldaten haben inzwischen die selbe Einstellung zum Krieg wir wir auch – sie wollen nicht sterben! Außerdem ist die Stationierung von Raketen in Ungarn und Polen z.B. so gut wie gesichert, es geht nur noch darum, wie viel wir dafür zahlen müssen. Ganz anders sieht es jedoch bei den Arabern aus, mit dem Islam. Deswegen verläuft die neue Verteidigungslinie jetzt auch” – Ratsch zog er hinter sich eine neue Landkarte auf – „etwa hier: zwischen Marokko und Afghanistan”.
In Lichterfelde besaßen die „US-Spearheads“, um den Häuserkampf zu üben, eine „Geisterstadt“. Ähnliche militärische Objekte auf Truppenübungsplätzen kannte auch schon die Reichswehr, die Wehrmacht, die Bundeswehr und die NVA. Manchmal sieht man noch Reste davon, wenn man an einem Manövergelände vorbeifährt, z.B. am Truppenübungsplatz „Wildflecken“ (Rhön). Dort bereitete die Wehrmacht sich auf den Russlandfeldzug vor. Zuletzt machte die US-Armee aus Wildflecken ein sündiges Dorf, heute wohnen Russlanddeutsche in ihren Häusern. In Afrika hatte Rommel zuletzt einen Panzerangriff dergestalt gefakt, dass er alle seine Volkswagen, die er noch hatte, in der Wüste im Kreis fahren ließ, um eine weithin sichtbare Staubwolke zu produzieren. Die Engländer ließen sich davon täuschen und zogen sich zurück, aber nur einmal.
Zu Hause entschieden sie sich für die Errichtung von „Scheinfabriken“ – in der Hoffnung, die Deutschen würden bloß diese „Starfishs“ bombardieren. Aus den Schornsteinen der Fake-Fabriken quoll dicker Rauch, jede verbrannte 160 Tonnen Treibstoff täglich. Das Dorf Arne am Ärmelkanal mußte einer solchen Fabrik weichen. 1966 übernahm die „Royal Society for the Protection of Birds“ die ausgelöschte Gemeinde.
Auch Fake-Städte wurden errichtet: 200 bis 1943. „Das Starfish-Projekt war ein großer Erfolg: Bis 1944 waren diese Orte 730 Mal angegriffen worden, schreibt der Sozialgeograph Alastair Bornett in: „Die seltsamsten Orte der Welt“ (2015). In seiner Region Dorset gibt es heute „250 verlassene Dörfer“, z.T. sind sie nur noch für Heimatforscher zu erkennen.
Ein ähnlich hohes Dorfsterben hat es auch in Niedersachsen, um Göttingen herum vor allem, gegeben. Hier interessierten die „Geisterdörfer“ eine Kulturwissenschaftlerin. Kürzlich warnten „Experten“ vor einem neuen „Dorfsterben“.
Im „Qualitätsjournalismus“ werden gerne die „Geisterstädte“ in Ostdeutschland thematisiert. Damit sind nicht die deindustrialisierten Städte Wittenberge oder Weißenfels z.B. gemeint, sondern die Kasernen der Roten Armee, die nach ihrem Abzug weder verkauft noch verschenkt werden konnten, so dass sie verfielen. Den Hobbyarchäologen sind sie willkommen. Einer entdeckte auf dem Gelände der zerbröselnden „Kaserne Vogelsang“ bei Berlin, wo bis 1994 15.000 Soldaten mit ihren Familienangehörigen lebten, eine „geheime russische Geisterstadt im Wald“, was sofort von einem Reiseveranstalter in die Abenteuer-Liste „Lost Places“ für Berlintouristen aufgenommen wurde. Auch der topophile Sozialgeograph Bornett findet „Geheime Städte, Verlorene Räume, Wilde Plätze“ interessant – und hat 47 von ihnen erkundet: Orte, die ihm zur „Wiederverzauberung der Welt“ dienen.
.
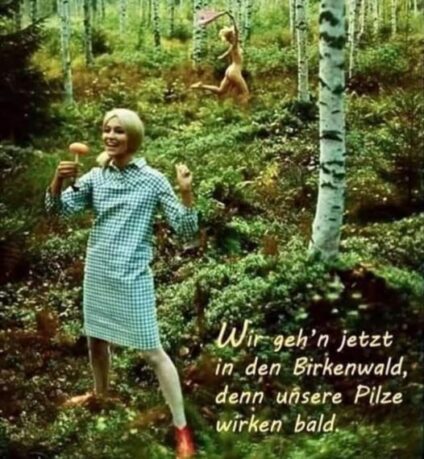
.
Lockere Naturgesetze
Neulich wurde mir in einem Kneipengespräch gesagt, die Naturgesetze seien unumstößlich. „Gravitation und Lichtgeschwindigkeit sind sogenannte Fundamentalkonstanten.“ Nur in Berlin? Oder auch z.B. in London? Fragte ich. Blöde Frage, bekam ich zur Antwort. Aber das war sie nicht.
Im Londoner Patentamt fand der Botaniker Rupert Sheldrake heraus,
dass die Lichtgeschwindigkeit zwischen 1928 und 1945 um etwa 20
Kilometer pro Sekunde sank – überall auf der Welt. Aber ab
1948 stieg sie wieder an. Sheldrake suchte daraufhin den Leiter der
Metrologie am National Physical Laboratory auf und fragte
ihn: „Was sagen Sie zu diesem Rückgang der Lichtgeschwindigkeit
zwischen 1928 und 1945?“
„Oh je,“ sagte er, „Sie haben da die peinlichste Episode in der
Geschichte unserer Wissenschaft aufgedeckt.“
„Kann es sein, dass die Lichtgeschwindigkeit tatsächlich
gesunken ist? Und wenn ja, hätte das doch erstaunliche Auswirkungen.“
„Nein, nein, natürlich kann sie nicht wirklich gesunken sein.
Sie ist eine Konstante!“
„Aber wie erklären Sie dann die Tatsache, dass jeder festgestellt
hat, dass sie in dieser Zeit viel langsamer geworden ist? Liegt es
daran, dass sie ihre Ergebnisse gefälscht haben, um das
herauszubekommen, wovon sie dachten, dass es andere Kollegen
herausbekommen würden, und die ganze Sache nur in den Köpfen der
Physiker entstanden ist? “
„Wir benutzen das Wort verfälschen nicht gerne.“
„Was bevorzugen Sie dann?“
„Nun, wir nennen es lieber ‚intellektuelles Phase-Locking‘.“
„Wenn das damals so war, wie können Sie dann so sicher sein, dass es
heute nicht mehr so ist? Und dass die heutigen Werte nicht durch
intellektuelles Phase-Locking erzeugt werden?“
„Wir wissen, dass das nicht der Fall ist.“
„Wie können Sie das wissen?“
„Wir haben das Problem gelöst.“
„Und wie?“
„Wir haben 1972 die Lichtgeschwindigkeit per Definition festgelegt.“
„Aber sie könnte sich immer noch ändern.“
„Ja, das würden wir jedoch nie erfahren, weil wir das Messgerät in Bezug auf die Lichtgeschwindigkeit definiert haben, also würden sich die Einheiten mit ihr ändern!“
Er sah sehr erfreut darüber aus, dass sie dieses Problem gelöst hatten.
Sheldrake bohrte weiter: „Und was ist dann mit der Gravitationskonstante, das „große G“, Newtons universelle Gravitationskonstante. Sie hat sich in den letzten Jahren um mehr als 1,3 Prozent verändert. Und sie scheint von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit zu variieren.“
„Na ja, das sind eben Fehler. Leider gibt es ziemlich gravierende Fehler beim großen G.“
„Und wenn es sich wirklich ändert? Ich meine, vielleicht verändert es
sich wirklich.“
Sheldrake hat sich daraufhin angesehen, wie sie es machen: Sie messen es
in verschiedenen Laboren, erhalten an verschiedenen Tagen
unterschiedliche Werte und bilden dann den Durchschnitt. Andere Labore
auf der ganzen Welt machen das Gleiche und kommen in der Regel zu einem etwas anderen Durchschnittswert. Und dann trifft sich das internationale Komitee für Metrologie alle zehn Jahre oder so und bildet den Durchschnitt aus den Werten der Labore in der ganzen Welt, um den Wert von groß G zu ermitteln.
Aber was wäre, wenn G tatsächlich Schwankungen unterliegen würde? Was, wenn es sich ständig ändern würde? Es gibt bereits Beweise dafür, dass es sich im Laufe des Tages und des Jahres ändert. Was wäre, wenn die Erde auf ihrem Weg durch den galaktischen Raum dunkler Materie oder
anderen Umweltfaktoren ausgesetzt wäre, die den Wert verändern könnten? Vielleicht verändern sie sich alle zusammen. Was wäre, wenn diese Fehler gemeinsam ansteigen und abnehmen?
Seit mehr als zehn Jahren versucht Sheldrake, Messtechniker davon zu
überzeugen, sich die Rohdaten anzusehen. Außerdem bemüht er sich, sie
davon zu überzeugen, die Daten und die tatsächlichen Messungen ins
Internet zu stellen, um zu sehen, ob sie aufeinander abgestimmt sind. Um
zu sehen, ob sie zu einem bestimmten Zeitpunkt steigen und zu einem
anderen sinken. Wenn ja, könnten sie gemeinsam eine Schwankung
aufweisen. „Das würde uns etwas sehr Interessantes sagen. Aber niemand hat das getan, weil G eben eine Konstante ist. Und somit hat es also keinen Sinn, nach Veränderungen zu suchen. Dies ist ein Beispiel
dafür, dass eine dogmatische Annahme die Forschung tatsächlich behindert.“
Zusammengefaßt: In London wie in Berlin besteht man auf feste, ewig gültige Naturgesetze, aber damit lügt man sich nur in die Tasche: Sie sind es nicht! Nichts ist konstant. Das dient nur zur Beruhigung unserer kurzen Lebenszeit. In London beträgt sie im Durchschnitt höchstens 82 Jahre, in Berlin 80,5, Tendenz steigend, weil aufgrund der Gentrifizierung die Armen ausgedrängt und die Reichen reingebeten werden, die unsterblich werden wollen, dem sie sich mit normativem Verhalten, Nichtrauchen, Fitnesscenterbesuchen, Meeresurlaube, Biogemüse, Hafermilch, Gesundheitschecks, Wandern, ungiftigen Klamotten, regelmäßigem Geschlechtsverkehr usw. annähern.
.

.
Immas Dingpolitik
Es begann mit Bruno Latour, der die Dinge als handelnde Akteure/Aktanten begriff, inzwischen habe ich schon ein ganzes Regal voller Bücher über die Dingwelt. Laut Latour wird die Moral mehr und mehr an Dinge delegiert – z.B. an die Hotelschlüssel, die man nicht abgibt, weil der nächste Gast sie braucht, sondern weil sie mit so einem dicken Gewicht verbunden wurden, dass man sie schnell wieder los werden will. Man ahnt, dass es mit den zunehmenden, alle Moral aufsaugenden Dingen nicht gut ausgehen kann. Die vielen Dinge machen nicht nur arm, wie der Schriftsteller Peter Mosler meinte, sondern auch asozial!
Die Massai besitzen im Durchschnitt 30 Dinge, die Deutschen 10.000. Der Bischof von Kamtschatka, Venjaminoff, lehnte es 1860 ab, die dingarmen Aleuten zu taufen, „da die Bekehrten dann mit ihrer eingeborenen Moral brechen, die unter ihnen sehr hoch entwickelt ist“ – höher als die der zivilisierten Christen. Die Yanomami-Indianerin, Yarima, heiratete den Ethnologen Kenneth Good und zog mit ihm nach New Jersey, wo sie als Hausfrau mit drei Kindern in einem Reihenhaus lebte. Ihr Ehemann verschaffte sich durch die Heirat mit ihr einen einzigartigen Zugang zur Gesellschaft der Yanomami. Seine Frau verließ ihn und ihre Kinder jedoch nach einigen Jahren – und ging zurück an den Orinoko. Sie hielt es in den USA nicht aus: „Das einzige, was sie lieben, sind Fernsehen und Einkaufszentren. Das ist doch kein Leben“, erklärte sie dem Autor Patrick Tierney (in: „Verrat am Paradies: Journalisten und Wissenschaftler zerstören das Leben am Amazonas“ 2002).
Die taz-Mitgründerin Imma Harms nahm sich 2017 vor, „von jetzt an jeden Tag“ ein Ding weniger zu besitzen. Sie vertritt eine so hohe Moralpolitik, dass die taz der irgendwann nicht mehr entsprach und sie sich auf einen taz-blog zurückzog (für 60 Euro im Monat). Sie trennt sich jedoch nicht von ihrem Besitz, um wieder mehr Moral zu gewinnen, sondern weil sie sich auf ihr „allmähliches Verschwinden vorbereiten muss und will“, wie sie schreibt. Die 71jährige hat zwar nicht vor, demnächst zu sterben, aber sie lebt auf dem Land und ihre wesentliche Tätigkeit besteht im Basteln und Reparieren (auf ebenso hohem Niveau wie ihre Moralpolitik – vor ihrem taz-Engagement war die Informatikerin Mitgründerin der technikkritischen Zeitschrift „Wechselwirkung“). Nun geht sie vorsorglich davon aus, dass sie in zehn bis fünfzehn Jahren zu solchen Arbeiten nicht mehr in der Lage sein wird. Gerahmt wird diese Ding-Reduzierung bei ihr von einem allgemeinen Zug zur Bescheidenheit, d.h. von ihrem Anspruch, immer weniger zum Leben zu brauchen. Fast hört sich das an wie ein geplantes „Fading-Away“, so dass am Ende vielleicht nur noch einige wenige Dinge (Filme und Bücher) von ihrer Anwesenheit hienieden zeugen – als eine Art Existenz-Essenz.
Ist das nicht geradezu eine Anti-Wirtschaftsweise? Wo doch die Lebensgeilheit der meisten Wohlhabenden sich gerade darin zeigt, dass sie immer mehr Dinge anschaffen (bis hin zu Schlössern, Schiffen und ganzen Inseln) – und ihnen zuletzt nichts anderes mehr übrig bleibt, als – zum Glück vergeblich – um ihre Unsterblichkeit zu „kämpfen“.
Über diese Anökonomie, die Imma allerdings nicht so nennt und schon gar nicht moralisiert, hat sie nun im „Aufland-Verlag“ (Oderbruch) „Reflexionen über das Mensch-Ding-Verhältnis“ veröffentlicht: „Dichtung und Heimwerk“ betitelt (wobei sie einiges ihrem taz-blog entnahm). Man erinnert sich vielleicht noch an das Buch von Arundhati Roy „Der Gott der kleinen Dinge“. Es heißt, „er ist der Gott dessen, was verloren geht, der persönlichen und alltäglichen Dinge, nicht der Gott der Geschichte, die die ‚kleinen Dinge‘ grausam in ihren Lauf zwingt.“ Der hiesige Gott steckt dagegen bereits laut Spinoza in allen Dingen (Tiere und Pflanzen sind auch „Sachen“). Zudem stellen sie und andere Sachen als Ware die „gesellschaftlichen Verhältnisse“ her, wie Marx schrieb, während wir als Personen/Produzenten „sachliche Verhältnisse“ eingehen.
Imma Harms bezieht sich in ihren Reflexionen kaum auf solche und andere (Ding-)„Diskurse“, schreibt ihr Verleger Kenneth Anders im Vorwort. Ihre „beinahe pingeligen Analysen“ könnten entmutigen, es gibt darin „Trauer und Komik“, aber noch öfter ist da beim Basteln und Reparieren auch „das Gelingen“. Letzteres könnte sich sogar zu einem „gelungenen Leben“ aufsummieren. Man wird sehen.
.

.
Schwarzes Loch
Der inzwischen verstorbene Religionswissenschaftler Klaus Heinrich hielt 1993 einen Vortrag in der Psychiatrischen Klinik des Universitätskrankenhauses Rudolf Virchow über „Sucht und Sog“. Es gäbe eine „Zielstrebigkeit des Süchtigen“, sagte er, sie sei an die Stelle „zielstrebigen Fortschreitens“ getreten. Heute verdanke die Sucht ihre gesellschaftliche Karriere im „Zerfall des Fortschrittsglaubens“ der „gleichsam leerlaufenden Begehrensstruktur“. Wobei man bei der Sucht auch immer das Wort „Suche“ mithöre. Sich Sehnen als Sucht. Wichtig sei dabei der Sog: Die Sucht ist eine saugende Strömung, die sich mit mit dem Metaphernbereich des Meeres verbindet, aber auch mit der oralen Erfahrung des Saugens, das im „Gesogenwerden“ einerseits „eine von der Anstrengung des Saugens entlastende halluzinativ infantile Umdeutung erfährt und andererseits dem weiblichen Part der genitalen Kopulation eine durchaus männlich fixierte, d.h. mit männlichen Lustvorstellungen und Ängsten besetzte ursprungsmythische Überhöhung, richtiger: Vertiefung, bietet.“
Das Bild des Meeres und seiner Gefahren habe als Metapher des Unbewußten weibliche Qualität, auch und vor allem die der vielversprechenden gefährlichen Verlockung. Die psychische Disposition des „Sogs“ sei also nicht nur „die halluzinierte Erfüllung eines Triebwunschs“, sondern berühre auch „die uns aus Mythologie, Liebesspiel und Analyse wohlbekannte Vertauschung von Mund und weiblichem Genital, die Zusammengehörigkeit also von Gefahr beschwörender und bannender Oralität. Bis hin in die entwickelsten Formen der Sprache, mit dem die Gefahr zugleich verkörpernden – um den Preis des Mitausgelöschtwerdens – sie auslöschenden weiblichen Schoß. ‚Sog‘ als Schoßmetapher, der uns in Totalregression in sich hineinzuziehen verspricht.“
Der „Vereinigungswunsch ist hier auch Todeswunsch“. Die Einheit von Eros und Thanatos, „Liebes- und Todessehnsucht, kennt das ganze 19. Jahrhundert als ein zentrales Thema der Literatur und der Künste. Der Liebestod in Verdis „Aida“ als Finale – „O Grab, O Brautgemach“.
In der „Realität des Süchtigen“ gehe es um die „Abstoßung von allen, was ihn am Erreichen der Sogbewegung hindert.“ Ein erstrebter Subjekt-Verlust – eine Katastrophen-Sehnsucht. „Katastrophennähe verwandelt in Katastrophenpräsenz macht aufmerksam auf eine Form der Sucht, die mir heute die herrschende zu sein scheint,“ meint Heinrich. Die wesentliche Verlockung in den Medien sei: „Ereignissucht. Ereignissucht aber, insofern sie eine allgegenwärtige Katastrophenfaszination verrät, hat den Namen ‚Katastrophensucht‘ verdient. ‚Süchtig nach Katastrophe‘ ist heute die aktuelle Form der Formel ‚süchtig nach Sog‘.“
Die ungerührte Hinnahme der realen Katastrophen scheint zu bekunden: „sie sind immer noch nicht katastrophisch genug, jede Möglichkeit der visuellen Steigerung wird ausgeschlachtet. Das süchtige Hinarbeiten auf die Katastrophe scheint im großen das zu sein, was unser ‚normales‘ alltägliches Suchtverhalten im kleinen ist.“ Das süchtige Subjekt will erfaßt werden vom Sog. Wobei wir jedoch regelmäßig enttäuscht werden – „süchtig nach Enttäuschung, sind“, die allein uns „weiterbringt auf dem Vertilgungsweg“. Die „Schoßmetapher für Vereinigung durch Ausgelöschtwerden“ ist für Heinrich ein sehr realistisches Bild „historischer Ambivalenz und Schuldgefühle, und zwar auf dem Hintergrund der Geschlechterspannung“.
„Die überspitzte Formulierung: ‚die Welt selbst aus der Welt zu schaffen, und ihr nach!‘ erscheint nur so lange als abstrakte Konstruktion, wie wir sie bildlos lassen…Wir bewegen uns in katastrophisch eingefärbten Untergangs- und Auferstehungsvisionen, damit immer noch in einem großen, kosmisch geweiteten Initiationsraum. Wirklich populär geworden ist das Bild – die große Phantasie vom ‚Schwarzen Loch‘. Dies ist die erstaunlichste Schoßmetapher, die wir zur Zeit haben: spur- und zeichenlos saugt es ein und läßt verschwinden.“
„Der sexuelle Phantasiehorizont“ des Schwarzen Lochs, „in dem die Forschung metaphorisch eingebunden bleibt, wird aufdringlich deutlich im sogenannten ‚Keine-Haare-Theorem‘: ‚Ein Schwarzes Loch hat keine Haare‘ (das bezeichnet den Umstand, dass die Beschaffenheit des Körpers, aus dessen Zusammensturz es resultiert, keinen Einfluß hat auf die Größe und die Gestalt des Lochs). Doch so stark ist die Macht der mit Geschlechterspannung verfahrenden Phantasie, dass dieses letzte katastrophische Suchtprodukt – so möchte ich es angesichts seiner Popularität einmal nennen – doch wieder als Schoß und Schlund erscheint, freilich einer, der nur noch in der einen, der zerstörerischen Richtung tätig ist.“
Dazu hieß es in der Bild-Zeitung: „Weltallmonster bedroht Erde. Vor zwei Stunden Schwarzes Loch in Erdnähe entdeckt! Verschlingt alles erbarmungslos!“ Und aktuell am 30. November 2020 im Wissenschaftsforum „spektrum.de“: Wenn „die Masse des Universums in seinem Hubble-Radius so groß ist wie die Masse eines Schwarzen Lochs im gleichen Radius“, dann läßt sich unser ganzes „Universum als das Innere eines Schwarzen Lochs annehmen“, was bedeute, „wir leben in einem Schwarzen Loch“, sind also drin: in Gustave Courbets „Ursprung der Welt“ und Else Lasker-Schülers „Weltende“ zugleich.
.
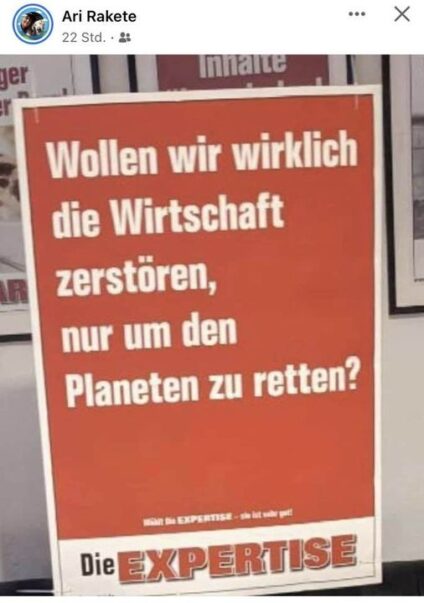
.
Sag zum Abschied leise Service!
Man geht davon aus, dass die Computerisierung noch weitere Massenarbeitslosigkeitswellen hervorruft. Den entlassenen Arbeitern und Angestellten wird wie stets geraten, sich zu „qualifizieren“, umzuschulen und selbständig zu machen. Einer der Betroffenen erwiderte: „Reparaturwerkstätten, klar! Ich wollte eine aufmachen, als ich arbeitslos geworden bin. Jan, Sam und Alf auch. Wir haben alle geschickte Hände, also laßt uns alle eine Reparaturwerkstatt aufmachen. Für jedes defekte Gerät in Ilium ein eigener Mechaniker. Gleichzeitig sahnen unsere Frauen als Schneiderinnen ab – für jede Einwohnerin eine eigene Schneiderin.“ Dies ist ein Zitat aus dem 1953 veröffentlichten Buch des US-Schriftsteller Kurt Vonnegut: „Das höllische System“ – 1953!
Damals ging es um die Massenarbeitslosigkeit produzierenden Folgen der Einführung des „Zentralcomputers“. Heute ist es das Internet und die „Coaches“ der Jobcenter raten ihren „Kunden“ nun, „Spätis“ und Friseurläden zu eröffnen – in jeder Straße 10. Da das aber nicht funktioniert, geht es darum, „Zwischenhändler“ zu werden – möglichst im zukunftsoptimistischen Internet: Sei es mit immer neuen Apps und Papps, sei es mit „Datendiebstahl“ und -verkauf, oder mit erschlichenen Dienstleistungen: „Sag zum Abschied leise Service,“ wie dazu der Netzkolumnist Peter Glaser sagte. Es vergeht kein einziger Tag, an dem man mir nicht per mail versichert, ich hätte irgendwo 50.000 Euro oder 5 Millionen gewonnen, geerbt oder sonstwie verdient, ich müßte nur Soundsoviel vorschießen, überweisen. Am Schlimmsten ist das vollkommen mafiöse Firmengeflecht des Dr. Klenk aus dem Westerwald.
Seit drei Jahren bekomme ich von einem seiner vielen Callcenter mindestens zwei Mal in der Woche eine unsittliche Aufforderung: Ich soll ihnen das Jahresabogeld für „Die Zeit“ überweisen, dann soll ich endlich die Jahresgebühr für ihren Flugsicherheitsdienst FAS zahlen und neuerdings soll ich das Jahresabo für „Lotto24“ verlängern. Dazu mahnen mich auch noch ständig die Deutsche Bank, die Commerzbank und die ‚Sparkasse an, dass da was mit meinem Konto nicht stimmt. Ich habe aber überhaupt kein Konto! Klenk und seine Comrads in Crime“ sind nicht zimperlich: Einen abtrünnigen Geschäftspartner hat Klenk schon mal die Ohren abschneiden lassen (er bekam dafür 2001 eine sechsjährige Haftstrafe). Und einen jungen Abowerber, der es in der Drückerkolonne für das Pressevertriebszentrum“ (PVZ – das so ziemlich alle Kapitalmedien mit Abos versorgt) nicht mehr aushielt und sich absetzen wollte, hielten sein Kolonnenführer bei voller Fahrt auf der Autobahn aus dem Fenster, um ihn wieder zu motivieren. Bei den Juristen der Uni Erfurt hatte man 2015 zusammen mit dem LKA angefangen, ein Organogramm vom Klenk-Geflecht anzufertigen, dann erstellten sie dort ein zweites Organogramm von einigen der darin verflochtenen Firmen und schließlich ein Liste der vielen Branchen, in denen Klenk wirkt, mit den jeweiligen Jahresumsätzen. Das reichte bis zu Videoclubs, Pornoproduktionen, Drückenkolonnenfirmen, Hotels, Restaurants usw.
Mit der Liste der Geschäftsführer, Miteigentümer und Teilhaber dieser ganzen vernetzten Firmen sind sie noch immer beschäftigt, was nicht verwundert, denn diese neue „Servicebranche“ (mit ihren ganzen mehr oder weniger schwachsinnigen, aus Amerika kopierten „Start-Ups“) verändert sich ständig. Es ist ein Geflecht, in dem laufend Löcher entstehen (nicht zuletzt durch Gerichtsurteile), das sich gleichzeitig aber auch permanent nach außen erweitert, durch Verschmelzungen (Rationalisierungen) verdichtet, und im Inneren Teile liquidiert, weil bei diesen immer schneller überholten Technologien und Märkten ganze Branchen plötzlich hinfällig werden: zuletzt die Videoclubs… Ach, es wird böse enden.
.

.
Von wegen Landei
Hühner gelten allgemein als nicht besonders klug. Deswegen setzten sich die Journalisten auch sofort in Marsch, als sie die Geschichte über die rotbraune Henne Inge erfuhren: Im Dezember 2017 hatte der Hühnerhalter Gerald Wernicke aus Wutzow (Potsdam-Mittelmark) das Tier an den Hühner-Bräter Heiko Weinberg im fünf Kilometer entfernten Ort Görzke verkauft. Der wollte sie zwar nicht grillen, wohl aber ihren Nachwuchs, den sie jedoch erst einmal legen und aufziehen sollte. Inge scheint dieses für sie und ihre noch ungeborenen Küken unvorteilhafte Geschäft geahnt, wenn nicht sogar gerochen zu haben, denn sie fand ein Schlupfloch im neuen Stall und flüchtete. „Tatsächlich hat Inge geahnt, dass es kein guter Ort für sie beim Broiler-Bräter ist,“ schreibt die Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ).
Zwei Monate war die Henne unterwegs, dann meldete sie sich wieder zurück in Wutzow bei ihrem vormaligen Besitzer Gerald Wernicke: „Mir standen die Haare zu Berge, als ich Inge wieder unter meinen Hühnern fand“, sagte der 60-Jährige der MAZ. „Ich habe Inge hochgehoben und sie hat sich so gefreut,“ d.h. laut gegackert. Mehr war jedoch aus ihr nicht rauszubekommen. Wernicke versprach ihr dennoch, dass er sie nicht zum Hühner-Bräter zurückbringen oder sie anderweitig verkaufen werde: Inge darf jetzt uralt bei ihm werden! Die MAZ schreibt: „Nun muss Gerald Wernicke Interviews am laufenden Band über sein superschlaues Huhn geben. Gerade steht das zweite Fernseh-Team vor seiner Tür – diesmal von NTV.“ Sein Nachbar Richard Baum meint: „Inge ist inzwischen die bekannteste Persönlichkeit in Wutzow.“ Er bezweifelt jedoch, dass ein Huhn eine solche Entfernung zu seinem Heimatstall überwinden kann. Gerald Wernicke ist sich aber sicher: „Die Ringkennung ist eindeutig. Außerdem hatte er von Inges Rasse New Hampshire nur noch vier weitere Tiere, jetzt sind es mit Inge wieder fünf. Insgesamt hält er, der als Arbeiter bei Voestalpine in Kirchmöser beschäftigt ist, 30 Hühner, vor allem für den Eigenbedarf.“ Dem Hühner-Bräter Weinberg hat er als Ersatz für Inge zwei Hennen gegeben. „Der hat das verstanden, dass ich Inge behalten werde.“ Sie auf der nächsten Geflügelschau präsentieren, will er jedoch nicht: „Sie ist nicht schön genug, ihr fehlt das gewisse Etwas.“ Der Hühnerzüchter hofft jedoch laut WAZ, „dass nun Inges Küken Schönheit und Intelligenz vereinen. Auf den Nachwuchs des Superhuhns ist er gespannt und wird ihn aufziehen.“ Gut eine Woche später war es schon so weit: Da schlüpfte bereits das erste Küken von Inge, sein Vater war der Hahn Horst, während seine Mutter weitere Eier legte. Wieder erschien die Lokalzeitung vor Ort und berichtete: „Wernicke hat viele Nachfragen nach Küken seiner superschlauen Henne. Zunächst aber will er Inges Nachwuchs selbst aufziehen,“ außerdem T-Shirts mit Inges Konterfei herstellen und vermarkten.
Den MDR inspirierte diese Geschichte zu einer Sendung über Hühner-Intelligenz: „Der Volksmund spricht vom ‚dummen Huhn‘ – völlig zu Unrecht, wie die US-Biologin Lori Marino in der Zeitschrift „Animal Cognition“ zeigt. Marino hat eine Reihe aktueller Studien zur Psychologie, den Gefühlen und dem Verhalten der Tiere ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass die Vögel weit intelligenter sind, als landläufig angenommen. Demnach können Hühner bestimmte logische Schlüsse ziehen, zu denen Menschenkinder erst im Alter von sieben Jahren fähig sind und sie haben individuelle Charakterzüge. Überraschend komplex ist zudem die Verständigung zwischen den Tieren. Die Forscher haben über 24 verschiedene Rufe identifiziert, die Hühner nutzen, um miteinander zu kommunizieren.“ Die Leiterin des wissenschaftlichen Geflügelhofs des Bundes deutscher Rassegeflügelzüchter, Inga Tiemann, ergänzte (auf „wissenschaft.de“): „Ein Huhn kann sich außerdem bis zu 100 Gesichter merken und wird aus Erfahrungen klüger.“
.
Einige Fotos von Eigentlich-Kopfarbeitern:

Vaclav Havel
.
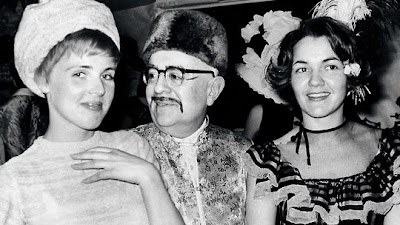
Theodor W. Adorno mit unbekannten Faschingspartnerinnen
.
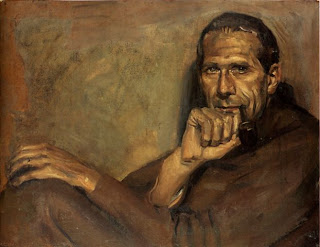
Alfred-Sohn-Rethel
.
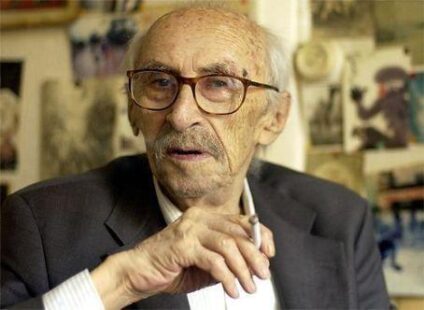
Paul Parin
.
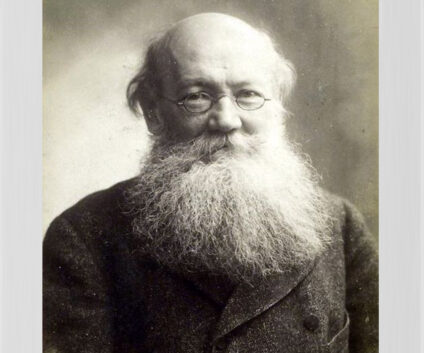
Peter Kropotkin
.

Bert Papenfuß
.
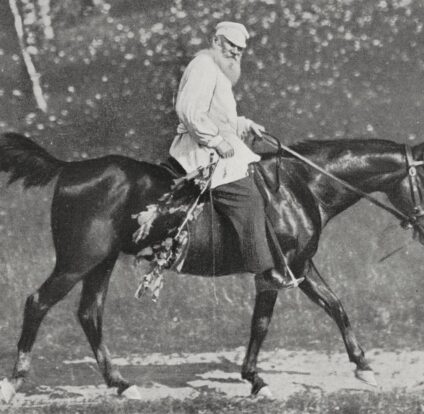
Leo Tolstoi auf einem Ritt zurück nach Hause
.

Martin Otting am Meer
.

Alce P. Liddell mit Farn
.
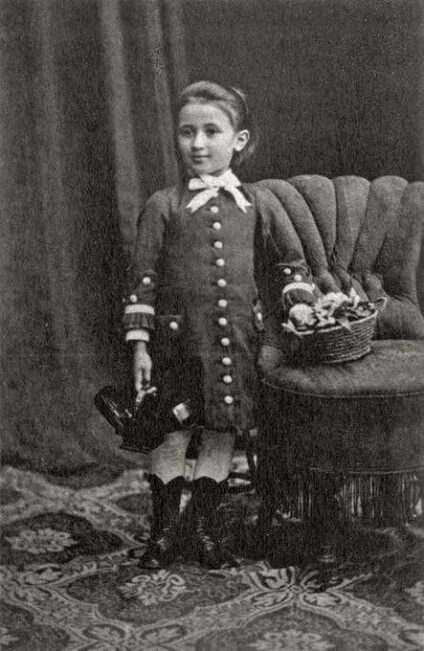
Rosa Luxemburg mit Geschenkkorb
.
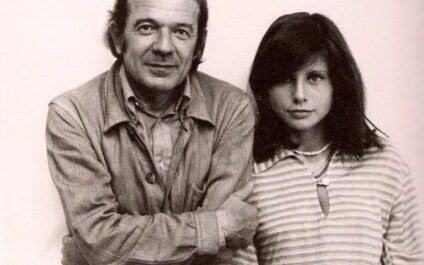
Gilles Deleuze mit Claire Parnet
.
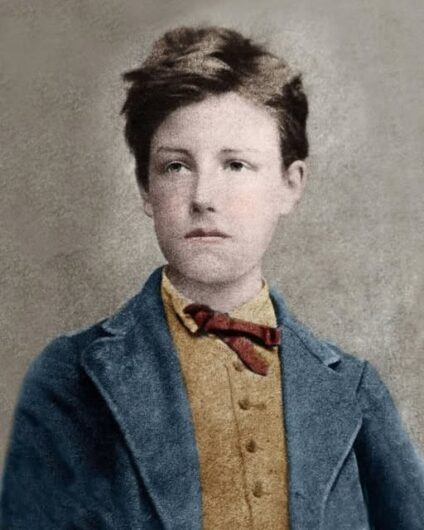
Arthur Rimbaud
.

Dr. Salm-Schwader (Dr. B.Scherer)
.

Ich mit selbstgebautem Spielzeug
.

Ich auf polnischem Spielpanzer