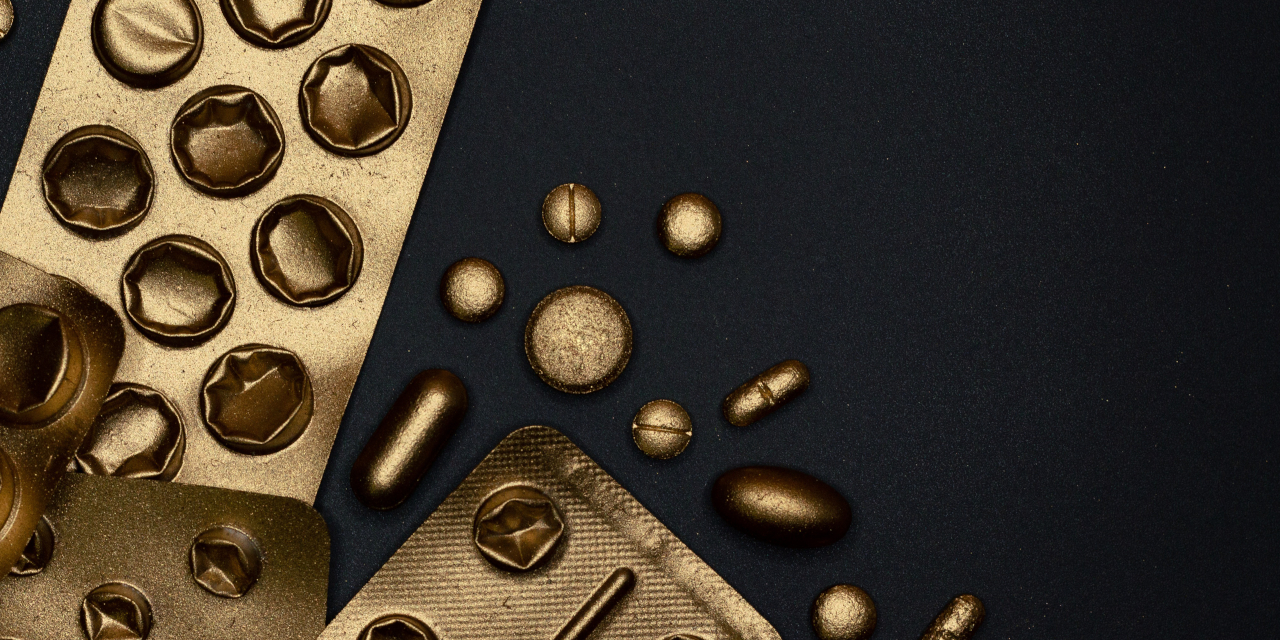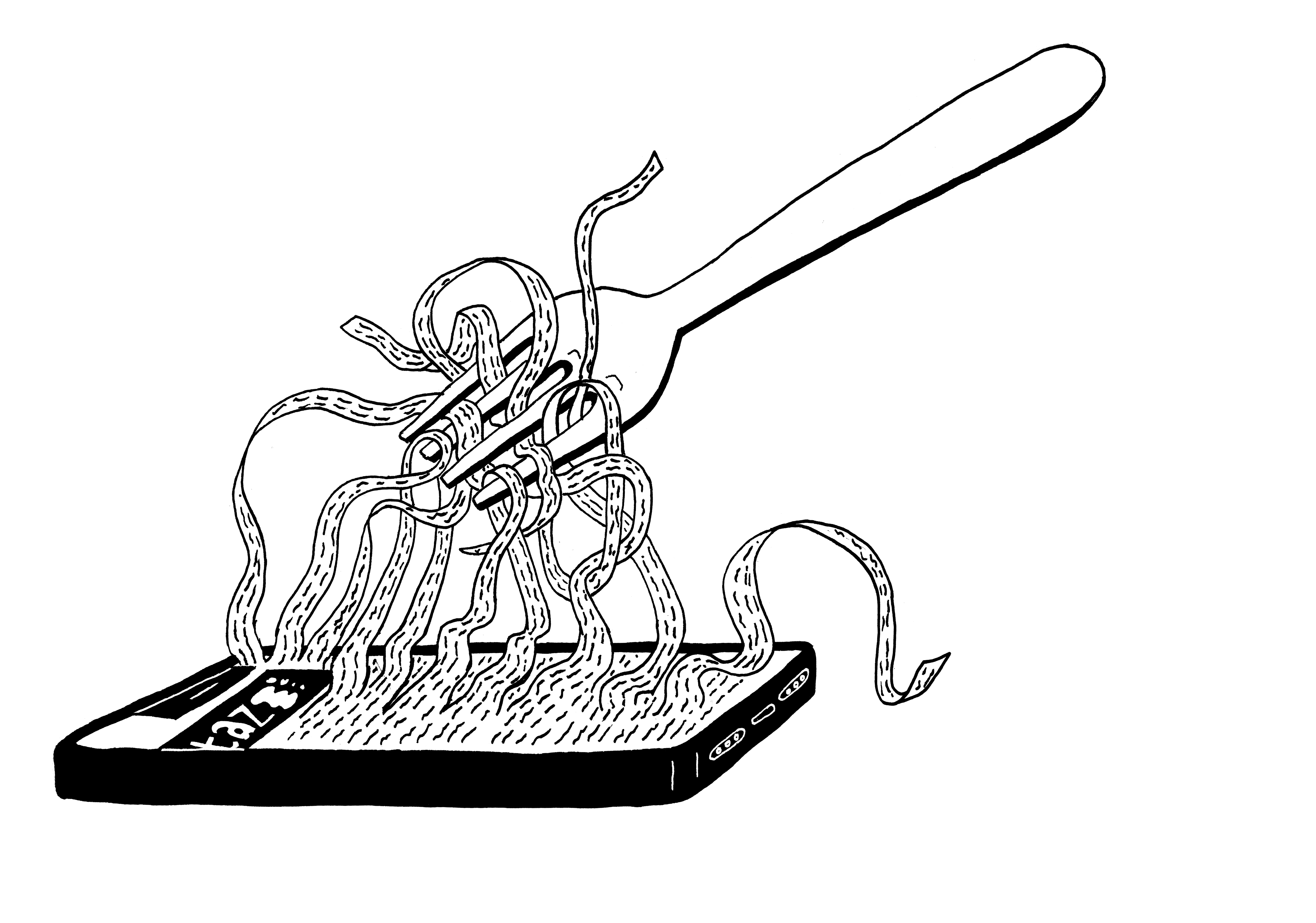Berlin ist schwanger von so einigen Welten. Auch wegen diesem einladenden Pluralismus strömten bis vor der Corona-Pandemie noch ungebremst viele Menschen in die Hauptstadt, explodierten die Mieten, waren Studenten gezwungen in den Fluren zu sitzen. Eine davon, die Berlin besonders gerne zum Markenzeichen angeschneidert wird, spannt sich alphabetisch von Anomalie Club bis Zyankali Bar und ließ sich ohne Weiteres von Donnerstag bis Dienstag durchexerzieren. Kaum ein paar Monate vergingen eine Zeit lang ohne eine neue Reportage der größten Tageszeitungen, in der mutige Journalisten eine Nacht in den Dark-Rooms der Hauptstadt schilderten, ganz am Puls einer Tiefsee-Expedition im Wasser der technobetriebenen Subkultur. Während die Zukunft dieser schon wegen ihrer Einzigartigkeit bewahrenswerten Kultur heute ungewiss ist, haben sich manche ihrer individuellen Spätfolgen nicht verändert.
Eine andere Welt, für manche schließt sie unmittelbar an die Genannte an, reicht von Anonyme Alkoholiker bis Tannenhof Berlin-Brandenburg. Hier geht es für die Einzelne und den Einzelnen um ungleich mehr. Weil sie, wie ich, zu viel wollten. Der Kosmos der Berliner Suchthilfe geht weit in die Hunderte an Gruppen, Institutionen und Veranstaltungen. Sucht ist Geld: Das kann für Smartphoneapps, Drogenhandel und Reha-Kliniken gleichermaßen gelten. Die Einen aber halten die Hand auf, während die anderen sie zur Hilfe reichen, wenn sonst nichts mehr hilft. Gehört man zu denen, die nacheinander tief in beide dieser Gesellschaften eintauchen durften, konnten, mussten – lernt man Vieles über sich Selbst. Aber vor allem Eines: Die Mär vom Menschen, der sich nie ändert, hat hier keine Gültigkeit.
Die Überlebensmöglichkeiten stecken im Dialog
Als ich vor fünf Jahren nach Berlin kam, mitte zwanzig, frisch studiert und mit etwas Geld von meiner letzten Arbeitsstelle auf einem italienischen Kreuzfahrtschiff, gab es schon bewusst diese Sätze in meinem Kopf: „Du kannst mittlerweile nicht mehr ohne Drogen aus dem Haus gehen, was ist das für ein Leben?“ oder „irgendwann musst du damit aufhören.“ – bis das aber Gehör fand, bis zur Therapie, war es noch ein weiter Weg.
Mein Studienfach mochte ich gern, und ich konnte mit Worten wie Aneurisma, Dysplasie oder Zölliakie etwas anfangen. Aber mein Herzvokabular ging eher: Keta – Strecke – Flakes – aufkochen – Sechserkurs – Dopamin. Die Kombination von reichlich freier Zeit und dem Hang zum Uferlosen beförderte mich noch während Studiums in die Flughöhe von mehreren psychischen und körperlichen Abhängigkeiten gleichzeitig. Speed zum Aufstehen und Arbeiten, GBL gegen die Angst, Benzodiazepine und Bier zum Runterkommen, LSD als Kinobesuch.
In diesem Modus kam ich in die Berliner Szene und redete viel mit vielen Menschen. Bis dahin hatte ich mich schon durch einige Hauptstädte Europas gefeiert, und nicht nur ich stellte fest: Berlin mag auf einem absteigenden Ast sein, aber so wie dort ist es doch nirgends. Am Sonntagnachmittag im Garten des Sisyphos oder Montagmittags zum Closing im Berghain hörte man die Feiernden so philosophieren: Wir genießen es, solange es noch geht. Solange die Stadt noch nicht so touristisch ausgelatscht ist wie London oder Paris. Ich erquasselte mir einen Job als Türsteher in dem Club, der die zügelloseste mir bekannte Partyreihe verantwortete. Meine Suchterkrankung musste nicht weiter darüber nachdenken, ob das sinnvoll ist. Also gab ich dann jedes Wochenende mit versteinertem Gesicht und manchmal entzügig zitternden Händen in den Jackentaschen den Türsteher.
Meine private Vorstellung von zynischer Coolness kannte kein besseres Futter als Gästen das besonders ungeschickt versteckte Kokain bei der Taschenkontrolle abzunehmen, um es in der nächstbesten Toilettenpause selbst einzunehmen. Wenn ich mir dabei in der nächsten Woche, nach dem Marathonschlaf, wieder im Spiegel in die Augen sehen konnte, dann nur durch das Glück, schon wieder Stoff gefrühstückt zu haben. Am besten hat man sich vom Wochenende vage gemerkt, wer wo was verkauft und wem man Geld schuldet. Wer mit wem eine Affäre hat. So überlebt man auch in der Szene.
Bei weitem nicht alle in dieser losen Gemeinschaft befinden sich im Suizid-Auf-Raten-Geschäft. Viele sind in der Szene eine Weile zuhause und driften dann langsam aus dem einen oder anderen Grund wieder raus – Studium beendet, Kind kommt, ein guter Job in Aussicht. Aber manche sind „there to stay“, die Wenigsten davon leben gesünder als ich es tat, die Wenigsten suchen sich Hilfe. Weil man es mit einer Krankheit zu tun hat, die man nicht glaubt, zu haben. Höchstens noch eine Berufskrankheit. Von Außen wird dem Betroffenen zugeredet: „Was ist das für ein Leben, sag mal?“ – „irgendwann musst du aufhören.“ Aber die Straße des Konsums fahren viele so lange ungebremst weiter, bis sich die Reifen hochkant in die Böschung drehen. Zu anstrengend und angstmachend ist es, nüchtern zu sein.
Für die Entgiftung entschied ich mich nicht wirklich, ich hatte irgendwann einfach keine Wahl mehr, weil das Leiden zu viel wurde und weil mein Körper versagte.
Dann braucht man plötzlich ganz andere Wörter. Suchtdruck – Reha – ausschleichen – Einzelgespräch – Ergo – Selbsthilfegruppe. Im Berghain wurde mir die Smartphonekamera überklebt, die Schilder mahnten „no photos allowed“. Im Therapieraum hängt an der Wand: „Was du hier siehst, was du hier hörst – bitte lass es hier!“ Das kannte ich also schon. Alles andere war neu und hatte sowieso erstmal überhaupt nichts mit mir zu tun. Die Spur der Läuterung war schnell verflogen und erst ein paar Entgiftungen später fange ich an, diese Wörter wirklich zu benutzen. Ich finde, wie viele andere, zu einem Träger von Einrichtungen zur Suchttherapie und schließlich in Charlottenburger Selbsthilfegruppen trockener Alkoholiker. Dass illegale Drogen für mich ein größeres Problem sind als Alkohol, spielte für die Menschen dort keine Rolle. Es gilt: Vor der Sucht sind alle Süchtigen gleich.
Man mag vorher vieles gewesen sein; Mutter, Karrierist, der cleverste Dealer der Stadt oder Strafvollzugsbeamtin – erste Instanz, so berichten die meisten, war am Ende die Flasche, die Pille, das Pulver und so fort. Das nun um hundertachtzig Grad zu drehen, die Abstinenz zur ersten Instanz werden zu lassen, ist eine Sache, für die man sich scheinbar ganz aufgeben muss. Entsprechend wenige erleben das. Zwei Prozent, heißt es manchmal. Auch Therapeuten geizen da nicht immer mit desillusionierenden Berichten. Um hier nun „dazuzugehören“, muss man mit Chancenlosigkeit gesegnet sein und dann vor allem Eines tun: In den Dialog gehen.
Vom Patienten zum Rehabilitanden
Qualifizierte Entgiftungen werden von vielen Berliner Krankenhäusern durchgeführt. Sie dauern zwei bis drei Wochen und fühlen sich für den Patienten situationsgemäß wie eine lange, quälende Zeit an. Auch wenn drei warme Mahlzeiten am Tag und eine umsichtige Betreuung warten, geht es den Meisten erstmal schlechter als zuvor. Zuletzt vorallem Alkoholkranke erholen sich manchmal vergleichsweise schnell, Drogenkonsumenten brauchen je nach Substanz auch Wochen, um wieder gangbar für den Krankenhausalltag zu sein. Patienten wackeln in letzter Minute mit plattgeschlafenen Haaren zum Mittagessen, rauchen an gekippten Fenstern, schwänzen Gruppengespräche. An die ersten Tage erinnere ich mich nicht. Aber ich weiß, dass ich schon am ersten Tag, an dem ich mich besser fühlte, wieder daran dachte, zu trinken und Drogen zu nehmen. Suchtdruck.
Nach Entlassung wird meist zu einer Langzeittherapie geraten. Nicht alle folgen dieser Empfehlung. Der Rest findet sich zu mehreren Monaten Therapie ein. Format: Stationär, Tagesklinik mit Übernachtung zuhause oder gleich nur ambulant zwei Mal die Woche. Leider siebt selbst die Fahrt vom Krankenhaus in die Therapieeinrichtung nochmal einen Teil der Patienten aus. Weil manche nie dort ankommen, weil der Spätkauf auf dem Weg glücksverheißender ist als Monate der Arbeit, bieten manche Einrichtungen sogar Shuttleservices an. Angekommen, wird man nicht mehr Patient genannt, sondern Rehabilitand.
Die verschiedenen Häuser arbeiten an denselben Zielen: Abstinenz, Wiedereingliederung, Arbeitsfähigkeit, psychischer Stabilität. Die Instrumente dazu variieren. Kommen in einer Einrichtung viele Menschen mit gerichtlichem „Therapie statt Knast“-Hintergrund zusammen, ist aus naheliegenden Gründen mit mehr Widerstand gegen das Therapieangebot zu rechnen. Dann fliegt schon eher mal ein Stuhl durch den Flur oder der Zaun, doch ein Stück niederer als im Gefängnis, wird nachts überklettert. Dort spielen Arbeitstherapie, ein klares und enges Regelwerk und ein gewisser Drill eine Rolle. Aber auch der suchtkranke Rechtsanwalt ohne Strafregister wird schon mal ruppig, wenn ihm erst das Kiffen verboten wird und ihm dann Fremde vorschreiben, er solle sich neue Freunde suchen, die nüchtern leben. Und außerdem anfangen, regelmäßig zu frühstücken.
Für mich war auch diese Zeit zunächst ein reiner Beißholzakt. Nicht vor, nicht zurück, und noch mit genug Überlebensinstinkt bestückt, um nicht ab durch die Mitte zu gehen. Aber ich habe mich mit der Zeit in anderen Teilnehmern wiederentdeckt. Am ersten Tag bekam ich einen Paten aus der Klientenschaft und lernte meine Bezugstherapeutin kennen. Sich an eine neue Arbeitsstelle mit Kollegen, Chef, Kantine und den Intima zwischen den Zeilen zu gewöhnen, ist nun schon eine herausfordernde Situation. An einem Ort, an dem sich viele verschiedene psychische Leiden bündeln und es Tagein, Tagaus um Gefühle geht, ist das ein nicht weniger einnehmendes Erlebnis.
Mit der Zeit aber wurde mein Kopf klarer und die innere Kritik war wieder aktiviert. Gehört die Person neben mir überhaupt hier her? Ist die Frau gegenüber besoffen? „Bleiben Sie bei sich“ ist die vielleicht beliebteste Losung gegen diese Wehrhaftigkeit. Es dauerte eine Zeit, bis ich bemerkte, dass die anderen Teilnehmer genauso paralysiert waren wie ich, und dass es nur natürlich war, dass sich unsere innere Zerrissenheit in viel überbordendem Verhalten äußerte.
In den Gruppen wurde gezetert und gestritten, geweint und ausgelacht, geschwindelt und gefleht. Ruhig wurde es höchstens noch in der Ergotherapie oder während einer Ohrakupunktur. Stunden, in denen langsam Momente der Besinnung und des Meditativen eintreten, die für mich etwas völlig Neues waren. Entspannung so herzustellen kam nie in Frage, solange ich dafür nur eine Pille unter der Zunge zergehen lassen musste. Wenn dann in der morgendlichen Großgruppe wieder jemand steif und fest behauptete, seine 0,4 Promille am Vortag kämen garantiert von den Pralinen, die er versehentlich gegessen habe, wurde die neu gewonnene Ruhe wieder getestet.
Revolution in Permanenz
Irgendwann durchbrach ich dann eine persönliche Schallmauer. Ohne Knall, ohne Initiationsritus. Und auf die einzige Art, wie diese Schallmauer überschreitbar ist: Still und einzeln für mich. Die ewigen Dialoge waren eingesickert, der Widerstand verlor seinen Sinn und meine Wurzeln lösten sich langsam vom Boden. Kapitulation, und ab dem Zeitpunkt gab es nur noch den Weg nach vorne. Ich fing an, jeden Abend nach der Therapiezeit in Selbsthilfegruppen zu gehen, beantragte betreutes Wohnen für Suchtmittelabhängige und ließ die Jahre zwischen Uni, Clubs, durchfeierten Wochen und sonstigen Abenteuern ziehen ohne mit dem Taschentuch zu winken. Hätte ich mich nochmal nach ihnen umgedreht, ich wäre sowieso geblieben.
Und als das nächste Mal eine Rückfallaufarbeitung in der Großgruppe anstand, mein Mitrehabilitand von der durchzechten Nacht erzählte, in die ihn seine Depressionen gezogen hatten, und von dem Versuch, mit dem Urin seiner Freundin die Stichprobenkontrolle zu betrügen – da war ich plötzlich nicht mehr neidisch und auch nicht sauer. Ich war bei mir. Und dachte nur: Gottseidank ist mir das nicht passiert.
Auch für Therapeuten in der Suchthilfe reichen sich Don Quixote und Sisyphus die Hand. Rückfälle, Betrugsversuche und Non-Compliance sind auf der buchstäblichen Tagesordnung. Ich konnte aber bemerken, dass auch nach vielen Jahren der Arbeit im Suchtbereich noch Herzblut im Spiel ist, wenn es um Einzelschicksale geht. Auch wenn man sagen könnte, dass die Chancen auf Erfolg sehr schlecht sind.
Unheilbar geheilt
Was man leicht an den Veteranen des abstinenten Lebens, den Menschen, die schon Jahre an den Tischen der Selbsthilfegruppen sitzen, ablesen kann, ist die erstmal traurige Wahrheit: Sucht ist eine unheilbare Krankheit. Manche sitzen dort seit über zwanzig Jahren, nüchtern. Und der blinde Fleck Suchtverhalten, für den die Selbsthilfe Rückspiegel ist, wird immer blind bleiben. Das muss natürlich erstmal im Großhirn ankommen: Lebenslange Therapie? Und das auch noch jede Woche? Nur damit die weiter dafür sorgen, dass ich das Leben nüchtern aushalten muss? Es sieht ganz danach aus.
Aber als ich diese übergroße „bittere Pille“ erstmal verdaut hatte, bemerkte ich auch etwas Zweites: Sie sehen dabei gar nicht unglücklich aus. Im Gegenteil, eine sanfte Euphorie des Angekommenseins kommt in ihre Gesichter, wenn sie den Raum pünktlich zur Gruppenzeit betreten. Mit der Zeit und etwas Beobachtung wurde mir das Offensichtliche klarer: Wer über Jahre hinweg Ehrlichkeit, Reflektion und Gemeinschaft mit Gleichleidenden übt, führt schlicht und ergreifend ein glücklicheres Leben. Glücklich trotz Krank-Sein. Glücklich auf Grund von Krank-Sein. Geheilt trotz Unheilbarkeit?
Heute steht das Ende meines ersten ganz drogen- und alkoholfreien Jahres vor der Tür. Ich stehe also noch mitten im Prozess dieser neuen Vokabeln von Abstinenz bis Zwölf-Schritte-Programm. Es ist anstrengend, Ehrlichkeit, Reflektion und Gemeinschaft mit Gleichleidenden zu üben. Aber nach allem was ich weiß hat es mir das Leben gerettet.
Der Autor dieses Beitrags möchte anonym bleiben.