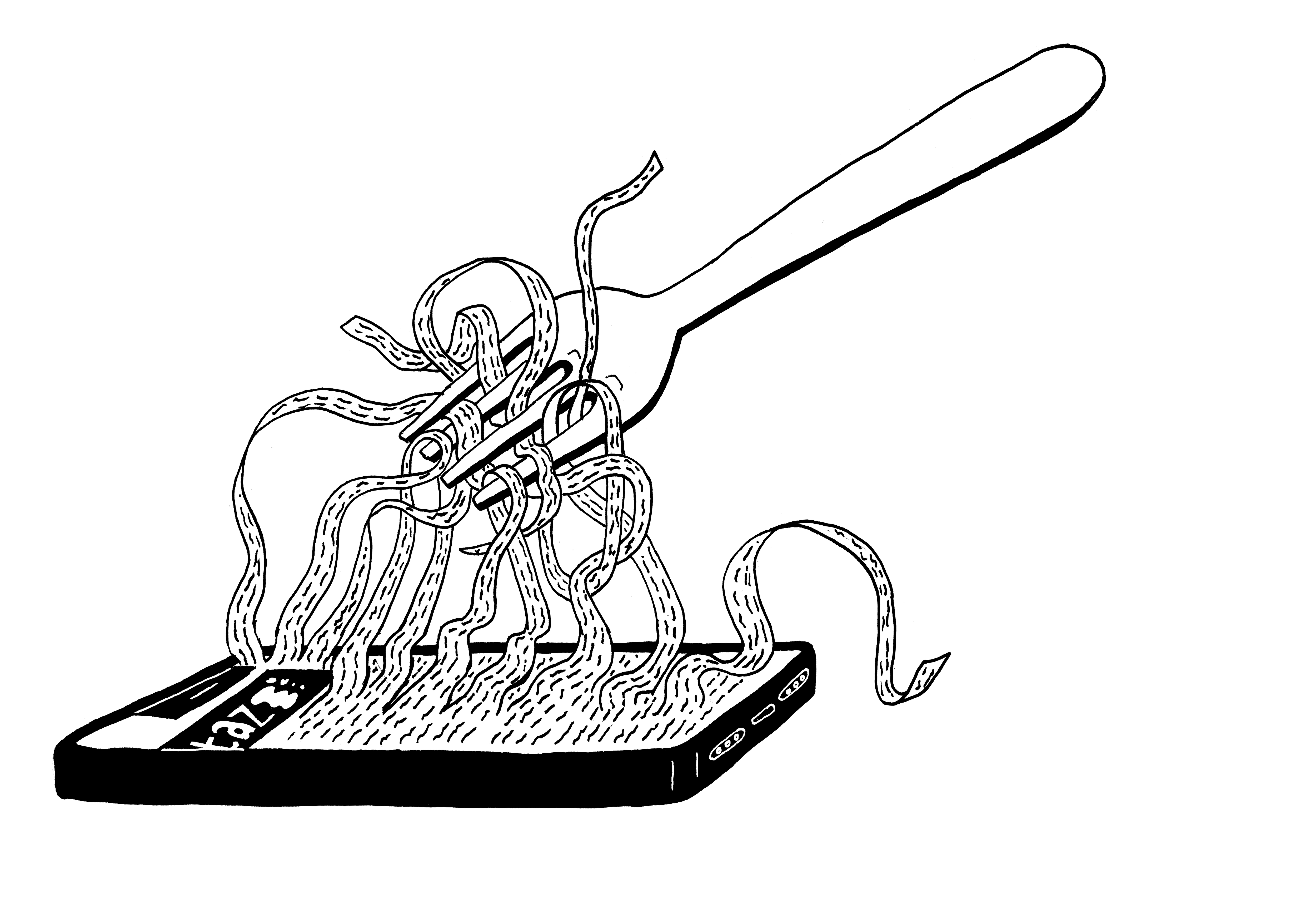Was ist Rassismus? Die Amadeo-Antonio-Stiftung sagt sinngemäß: Wenn Menschen aufgrund ihrer körperlichen Merkmale einer bestimmten ethnischen Zugehörigkeit oder Herkunft zurechnet und aufgrund dessen beurteilt und abgewertet werden. Abgewertet – oder auch aufgewertet?
„Mal wieder eine rein weiße Veranstaltung; keine persons of colour dabei!“ hört man gelegentlich als antirassistische Kritik. Das Problem: Der Antirassismus trägt den Rassismus – oder sagen wir: den rassistischen Blick – immer in sich. Er fixiert das, was er abschaffen möchte, auf antithetische Weise. Aber ich will von mir sprechen.
Uruguay, Monte Video, Stadtteil Tres Cruzes, 5. Dezember 2019. Wir sitzen in der Pizzeria Amalfa, einem weitläufigen Lokal, das mehr Ähnlichkeit mit einer McDonalds-Filiale als mit einem italienischen Restaurant hat. Auf beiden Seiten des Raums laufen, von niemand beachtet, auf großen Flachbildschirmen unterschiedliche Fernsehprogramme. Wir haben nichts anderes gefunden an dem Abend und kauen an den unhandlichen Chivitos herum: zwischen zwei Brötchenhälften ist ein Steak, Schinken, Käse, ein Spiegelei und Gemüse aufgeschichtet. Wenn man reinbeißt, läuft einem die dicke Remouladensoße über die Hand. Ich warte, dass Thomas seine Pommes Frittes aufgegessen und sein Bier ausgetrunken hat. Wir haben noch was vor.
Am Nachbartisch sitzt ein Gast, der anscheinend nichts mehr vorhat. Ein alter Mann, vielleicht Mitte 80 oder auch 90. Er sitzt gebeugt und nach vorn gerutscht auf seinem Stuhl, hat die Beine übereinander geschlagen. Die weite Hose ist nach der Art alter Männer bis weit über den Bauchnabel nach oben gezogen. Seine knotigen Finger halten den Henkel einer Kaffeetasse fest. Die andere Hand liegt leicht zitternd auf dem Tisch. Neben der Kaffeetasse steht ein Teller mit einem kleinen Kuchenstück, das aber bisher nicht angerührt wurde. Ich blicke immer mal wieder verstohlen zu ihm herüber und wundere mich, warum er weder aus der Tasse trinkt noch von dem Kuchenstück isst.
Thomas hat Interesse an einem zweiten Bier. Ich habe nichts dagegen; unser Abendprogramm kann noch etwas warten. Thomas erzählt irgendetwas, aber ich bin unaufmerksam und einsilbig; ich will den Moment nicht verpassen, wenn der Mann von seinem Kaffee trinkt oder sich sonst wie regt. Verbringt er seinen Abend hier in dieser kargen Form von Gesellschaft? Ich schwanke zwischen Neugier und Anteilnahme. Seine linke Hand tastet über den Tisch, fasst nach der Zeitung, die aufgeschlagen vor ihm liegt, als wolle er eine Seite umblättern. Das tut er aber nicht. Seine Augen gleiten über die aufgeschlagene Seite, sein Kopf hebt sich. Die Zeitung liegt unter seiner Hand, er streicht ohne hinzuschauen ganz sacht darüber, als wolle er sich ihrer Anwesenheit versichern. Die rechte Hand lässt den Henkel der Kaffeetasse los und greift nach einem kleinen Glas Wasser, das dahintersteht. Das Glas zittert in der Hand des Mannes, und als er es zum Mund führt, spiegelt das Wasser Lichtreflexe, die aus irgendeiner Talkshow durch den Raum flimmern.
Der Mann schaut weder auf einen der Bildschirme, noch scheint ihn irgendetwas in dieser tristen, fast leeren Gaststube zu interessieren; sein Blick geht durch die großen Fensterscheiben ins Dunkle der beginnenden Nacht. Vielleicht ist es auch gar kein aktives Schauen, sondern in seinen offen stehenden Augen ziehen Bilder aus anderen Zeiten vorbei.
Ich sehe das Profil des Mannes. Wirres, auf dem Kopf gelichtetes, weißes Haar. Eine nach hinten geneigte Stirn, die unterhalb einer kleinen Einkerbung in eine im weiten Bogen gewölbte Nase übergeht. Eine jüdische Nase, denke ich. Und während ich das denke, weiß ich, dass ich nicht das Recht habe, die Nase von jemand als jüdisch anzusehen. Begleitet von schlechtem Gewissen, formt sich in mir eine Geschichte zu dem Mann am Nebentisch.
Ein jüdischer Immigrant, als Jugendlicher mit seinen Eltern hierher geflüchtet, oder vielleicht auch als Kind gerettet, während seine Familie dem rassistischen Terror in Europa nicht entkommen konnte. Er wird von Verwandten aufgenommen, begeistert sich für Astronomie. Aber das Studium muss abgebrochen und ein Beruf erlernt werden. Später hat er ein Auskommen als Uhrmacher oder vielleicht auch als Buchhändler. Ein Leben, eine Familie, das Heute legt sich über die schmerzende Erinnerung. Die Verbindung zur jüdischen Gemeinde in Montevideo lockert sich, verliert nach und nach ihre Bedeutung. Hier ist er nicht Jude sondern Uruguayer.
Jahrzehnte später. Die Familie ist zerstreut, die Kinder sind nach Europa gegangen, gegen das sie nichts haben, die Enkel sind Deutsche, Franzosen, jedenfalls weit weg. Er bleibt allein zurück. Uruguay ist teuer geworden, seine Kinder helfen ihm, die kleine Zweizimmerwohnung zu bezahlen. Für seinen Alltag bleibt nicht viel. Den Tag verbringt er im Park. Danach trinkt er einen Kaffee in der Pizzeria Amalfa. Dort lässt man ihn in Ruhe vor seinem Kaffee sitzen, auch wenn es Stunden dauert. Er kann die Zeitung lesen, die ihn aber immer weniger interessiert, weil ihm alles entweder bekannt oder unbegreiflich vorkommt.
Meine Fantasie ist zugleich schuldig und unschuldig. Als Kind einer Generation von Nazis klebt die Schuld als ein unauslöschbarer Makel an mir. Vielleicht waren es Vorfahren von mir, die Stadtviertel auf Menschen mit jüdischen Nasen „durchkämmt“ haben, auch wenn es den Begriff des „racial profiling“ noch nicht gab. Unschuldig sind meine Gedanken, weil sie keine Abneigung oder gar Abscheu enthalten, sondern voller Empathie sind. Ich interessiere mich für den Mann, ich würde ihn gern kennenlernen, ich möchte nachvollziehen, was er erlebt hat. Trotzdem – meine freundlichen Gedanken sind von einem Stigma ausgelöst, das ich ihm anhänge. Auch der Philosemitismus enthält und erhält den Rassismus.
Der Mann, der alte Uruguayer, der vielleicht mal ein Immigrant war, greift nach dem bisher nicht angerührten Kuchenstückchen. Er benutzt dazu eine dünne Papierserviette, die seine Finger vor der süßen Klebrigkeit schützen soll. Er beißt ab, legt das Kuchenstück zurück auf den Teller, behält aber die Serviette in der Hand. Daumen und Zeigefinger reiben sich an dem Papier, als seien die klebrigen Krümel doch an ihnen hängen geblieben. Und auch ich versuche, meine Gedanken abzustreifen.
Er ist einfach nur ein alter Mann, der in einem Lokal in Montevideo sitzt und Kaffee trinkt. Mehr gibt es nicht zu sehen und mehr gibt es nicht zu spekulieren. Wir brechen auf und lassen den Ort hinter uns.