Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Vielleicht muss ich einen kleinen Umweg nehmen. Vor 15 Jahren habe ich mich an dieser Stelle über die Inschrift über einer Tür im Schweizer Bergell gewundert, die die BewohnerInnen zum Schweigen und Ohren-zuklappen verdonnert, bzw. da es ja den PassantInnen den Spruch mit auf den Weg gibt, auch allen anderen diese Haltung empfiehlt.
Später habe ich erfahren, dass die Inschrift kein Unikat ist, sondern es noch andere Häuser in der italienisch-sprachigen Schweiz gibt, die das Prinzip – Tür zu, Mund zu, Ohren zu – den Eintretenden und Vorübergehenden empfehlen.
Das Erstaunliche ist ja weniger, dass irgend ein verknötterter Hausherr sich diese Marotte mal einfallen ließ, sondern dass andere das kopieren und dass der Spruch bei den späteren Restaurationen der Fassade immer wieder gepflegt und akribisch ausgebessert wurde. Und da setzt tatsächlich meine Frage an: Was ist Traditionspflege? Werden die Spuren der ehemals hier Wohnenden aus Respekt vor ihrer damaligen, wenn auch heute unverständlichen Lebenseinstellung bewahrt? Oder wird diese Einstellung dadurch, dass ihrer Verwitterung aktiv entgegengewirkt wird, nicht auch tendenziell übernommen? Indem sie lesbar gehalten wird, wird auch ermöglicht, dass die Inschrift ihre Botschaft weiter verbreiten kann. Die Behandlung als Zitat entmachtet die Botschaft nicht. Oder?
Die Diskussion über das „N−“ Wort (ich wiederhole es hier nicht) und die deprimierende Debatte über das Relief an der Wittenberger Kirche, das eine „J−“ darstellt (auch das wiederhole ich hier nicht; soviel Distanzierung, wie da nötig wäre, traue ich den Gänsefüßchen nicht zu) zeigt, dass das historische Erbe weiter toxisch ist und ausgeschlagen werden sollte. Bloß nicht noch ausbessern, erklären und relativieren! Verwittern, verfallen lassen und vergessen!
Müncheberg ist eine kleine Provinzstadt östlich von Berlin. Von Mönchen im 13. Jahrhundert gegründet, war sie lange Zeit ein florierender Handelsplatz, der seinen Reichtum zu schätzen und zu schützen wusste. Davon zeugen noch die zwei stehen gebliebenen wehrhaften Türme des östlichen und westlichen Stadttors. Den Rest hat der Zahn der Zeit zernagt. Was nach Hussitensturm, Dreißigjährigem Krieg, der Pest und diversen Feuersbrünsten noch stand, wurde im Endkampf gegen den deutschen Faschismus zermalmt. 85% der Stadt waren danach zerstört. Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet die Verteidigungsanlagen, also die Stadtmauer und die beiden Türme alles überstanden haben.
Am sogenannten Storchenturm des Küstriner Tors entdecke ich eine Inschrift, die mich in ähnlicher Weise verwirrt und verwundert wie die Botschaft aus dem Bergell. Ich lese:
„Wer giebt seinen Kindern Brod / und leidet selber Noth,
den soll man schlagen / mit dieser Keule todt.“
Über der steinernen Inschrift hängt auch tatsächlich die besagte Keule, ein uralter Eichenast, ein knorriger Knüppel, der nicht so aussieht, als brächte man ihn zum Zuschlagen überhaupt über den Kopf.
Auf dem Heimweg kommen mir eine Reihe sich gegenseitig aufwerfender Fragen.
Ein martialischer Knüppel an einem Stadttor würde als solcher nicht erstaunen, eine Art gedrohte Faust gegen die vordringenden Feinde. Aber die Inschrift gibt der Drohung eine andere Richtung. Bloß wer ist denn eigentlich gemeint? Derjenige, der in der Not zunächst mal seine Kinder durchbringen will? Den soll man auch noch totschlagen? Was ist mit dem Generationenvertrag? Eltern sind doch angeblich dazu da, eine neue Generation auf den Weg zu bringen, so wie sie selbst auf den Weg gebracht wurden! Die Selbstlosigkeit von Eltern gilt geradezu als biologische Konstante. Es gibt unzählige anrührende Geschichten, wie sich Eltern für ihre Kinder opfern.
Hier werden sie offen dazu aufgefordert, erstmal an sich zu denken. Insofern ist es auch eine Drohung in Richtung der Kinder. Wenn ihr euren Eltern das Brot wegfuttert, habt ihr später keine Eltern mehr! Und zwar nicht, weil sie Hungers sterben, sondern weil wir sie wegen ihrer Blödheit totschlagen!
Was mich weiter verwirrt, ist die Tatsache, dass sowohl Keule als auch Spruch dort unkommentiert, also widerspruchsfrei hängen, und das offenbar nach sehr langer Zeit. Außerdem gibt es eine merkwürdige Diskrepanz zwischen Form und Inhalt der Schrifttafel. Die drohenden Worte sind in dekorativer Frakturschrift auf den Untergrund graviert und sorgfältig ausgemalt, dabei mit einer Art Bilderrahmen umgeben. Diese Anordnung stammt auf keinen Fall aus dem Mittelalter, eher wohl aus dem 19. Jahrhundert. Und sie wurde, deutlich erkennbar, ausgebessert, nachgezogen, farblich frisch gerahmt.
Dieses kommentarlose Auffrischen der Schrift kann doch nur als eine Bejahung oder zumindest eine Gleichgültigkeit dem Inhalt gegenüber gelesen werden! Denken die MünchebergerInnen tatsächlich so? Bei einem Straßenfest befrage ich C., eine geborene Münchebergerin.
„Ja, die Keule, das hatten wir mal in der Schule“, erinnert sie sich dunkel.
Aber gab es da keine kritische Auseinandersetzung mit dem Spruch?
„Nee, wieso?“ fragt sie arglos zurück.
Na ja, also die Kinder verhungern lassen, um selbst zu überleben?
„Sieh’s doch mal so: Wenn die Eltern in der Zeit verhungert sind, konnten die Kinder doch auch nicht überleben!“, meint C., die praktisch denkende Mutter von drei Kindern.
G. mischt sich ins Gespräch ein; er kann sich noch an Details der Keulen-Legende erinnern und erzählt, was er weiß. „Das stammt noch aus dem Mittelalter. Da gab es in Müncheberg einen reichen Kaufmann. Der hat alles, was er hatte, seinen Kindern schon zu Lebzeiten überlassen. Als er dann alt war und deren Hilfe brauchte, haben die ihn im Regen stehen lassen. Als er gestorben ist, hat er eine Kiste für die Erben zurückgelassen. In der war diese Keule und der Spruch“.
Ich bin skeptisch. Das ist doch verdreht! Den Erben die Keule hinterlassen? Sollen sie andere totschlagen, die so handeln wie ihr Vater, der sie ja schließlich reich gemacht hat? Das kann doch nicht sein, dass es in der Stadt keine Fragen zu diesem Überbleibsel gibt? Es gibt aber einen Heimatverein. Ein Vereinsmitglied lerne ich auf einem regionalen Treffen kennen. Ralf D. findet in seinen Unterlagen einen Text des 2017 verstorbenen Heimatforschers Klaus Stieger. Darin heißt es: „Die Sage um Keule und Spruch am Storchenturm soll auf einen Tuchmachermeister aus dem Jahr 1394 zurückgehen, der seinen Kindern zu Lebzeiten alles gab und im Alter von ihnen vernachlässigt worden ist.“
Neue Informationen produzieren neue Fragen. Woher stammt diese genaue Jahreszahl 1394? Da war der Marktflecken mal gerade eben gegründet. Die Stadtmauer und die beiden Tortürme wurden laut Wikipedia im 14. Jahrhundert gebaut. Auf den Seiten der Müncheberger Stadtverwaltung heißt es sogar, dass der Turm erst im 15. Jahrhundert gebaut wurde. Wie kommt also 100 Jahr später die Keule an den Turm und warum? Wo war sie in der Zwischenzeit? Wer hat das verfügt? Mit welcher Absicht? Und die Inschrift? Sie ist deutlich viel jünger. Die Botschaft wird also durch Erneuerung gepflegt.
Während ich mir meine Gedanken mache, sucht Ralf D. weiter. Er findet im Archiv des Heimatgeschichtsvereins die maschinelle Abschrift eines Gedichts, das die Keulengeschichte in Form einer Ballade besingt. Ralf D. datiert die Ballade aufgrund der Orthografie auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Abschrift aufgrund des Nadeldrucker-Schriftbildes auf Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts.
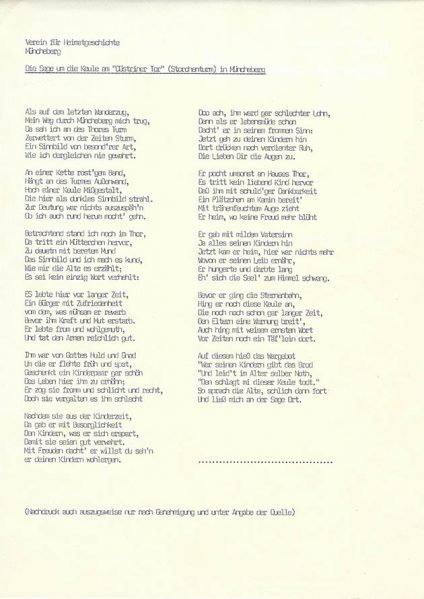 Also ein „Mütterchen“, was immer das sein soll, setzt der wackere Heimatdichter ein, um sich einen Reim auf die Keule zu machen. Die Tafel findet er in dieser Variante nicht vor, sondern legt ihre Botschaft der Frau in den Mund.
Also ein „Mütterchen“, was immer das sein soll, setzt der wackere Heimatdichter ein, um sich einen Reim auf die Keule zu machen. Die Tafel findet er in dieser Variante nicht vor, sondern legt ihre Botschaft der Frau in den Mund.
Ralf D. transkribiert den gefundenen Text in eine ansprechende Form mit Kopf und Signet des Heimatvereins. Dabei korrigiert er ein paar der offensichtlichen Tippfehler. So heißt es jetzt in der letzten Strophe: „Auf diesem hieß das Wahrgebot: / „Wer seinen Kindern giebt das Brod / „Und leid’t im Alter selber Noth, / „Den schlagt mid dieser Keule todt.“ (…)“ (Hervorhebung durch mich)
Als Verfasser hat er erstaunlicherweise angegeben: „Ein Tuchmachermeister im Jahre 1394“, der die Legende über sich selbst ja nun ganz gewiss nicht verfasst haben kann.
Ralf D. meldet sich ein paar Tage später noch einmal; er hat noch was gefunden. In einer Festschrift, die 2007 anlässlich der 775-Jahr-Feier Münchebergs herausgegeben wurde, wird als Verfasser des Heimatgedichtes ein Hermann Ahrends angegeben, der es im Februar 1847 im Müncheberger Wochenblatt veröffentlicht haben soll. Aha, die Spätromantik, die sich ihre dunkle, mittelalterliche Vorgeschichte teils als einen Gruselort, teils als einen Sehnsuchtsort umgedeutet hat!
In eben dieser Erläuterung von 2007 zu Keule und Inschrift heißt es weiter: „Die Sage soll sich auf eine Begebenheit aus dem Jahre 1394 beziehen. Die Holztafel, die an diese Begebenheit erinnerte, war so verwittert, dass sie in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts herunterfiel. Der Neffe des verstorbenen Staatskanzlers Graf Hardenberg bemerkte dies bei einer seiner zahlreichen Durchfahrten durch die Stadt und ließ auf seine Kosten eine Steintafel dort anbringen, die vor fast 150 Jahren, am 12. Mai 1857, feierlich enthüllt wurde, und die uns zusammen mit der wesentlich älteren Keule noch heute das Warngebot vermittelt.“
Eine Ungereimtheit könnte damit geklärt werden: Die Keule hing zum Zeitpunkt der Entstehung der Ballade wohl noch da, die Schrifttafel war schon heruntergefallen. Vielleicht hat der Neffe Hardenberg die Zeilen im Müncheberger Wochenblatt gelesen und sich vorgenommen, hier großherzig zu sein? Vielleicht gab es auch gar keine verwitterte Holztafel und die ganze Geschichte stammt von Hermann Ahrends? Vierzig Jahre vorher hatte Clemens Brentano die Sage von der Loreley auf dem Rheinfelsen erfunden, die wiederum 15 Jahre später von Heinrich Heine als „Märchen aus alten Zeiten“ bezeichnet wird. Was Heine recht war, könnte Ahrends billig gewesen sein.
Dem Hardenberg-Neffen gefiel die Idee von der mittelalterlichen Botschaft, weil sie so gut in die Zeit – seine Zeit – passte: die überall um sich greifende Industrialisierung musste mit alten Traditionen brechen und eine neue Denkweise einführen, den hemmungslosen Egoismus, und ihn historisch verankern, so, als wenn es schon immer so gewesen wäre. Mit anderen Worten: Ich habe große Zweifel an der Datierung der Geschichte und halte sie für eine genealogische Nachgestaltung aus dem Blickwinkel des 19. Jahrhunderts.
Egal, ob historisch authentisch oder genealogisch verzerrt, die Geschichte wird fortgeschrieben. Mit der aufgefundenen Quelle zur Quelle konnte Ralf D. nun feststellen, dass er falsch korrigiert hat: Das „Wargebot“ in der Abschrift aus dem 90er-Jahren ist kein „Wahrgebot“, wie er vermutet hatte, sondern ein „Warngebot“, so reimte jedenfalls Hermann Ahrends. Ralf D. korrigiert seine Abschrift der Abschrift der Abschrift dementsprechend.
Aber was ist ein „Warngebot“?



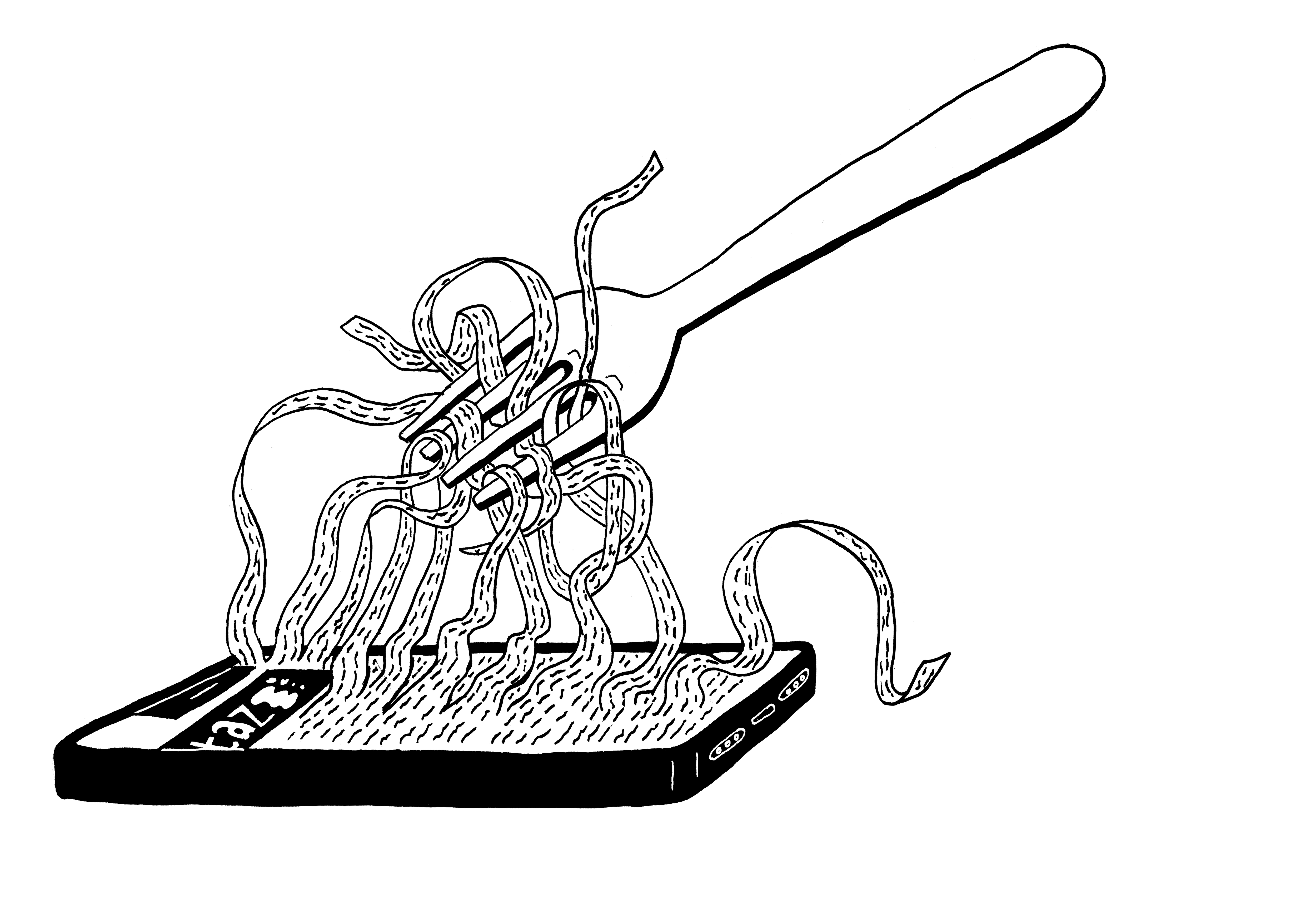
Das Ofriginalgedicht stammt von Rüdiger von Hinkhoven aus dem 13. Jhd.:
https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Der_Schlegel_(R%C3%BCdiger_von_Hinkhoven,_13._Jh.)