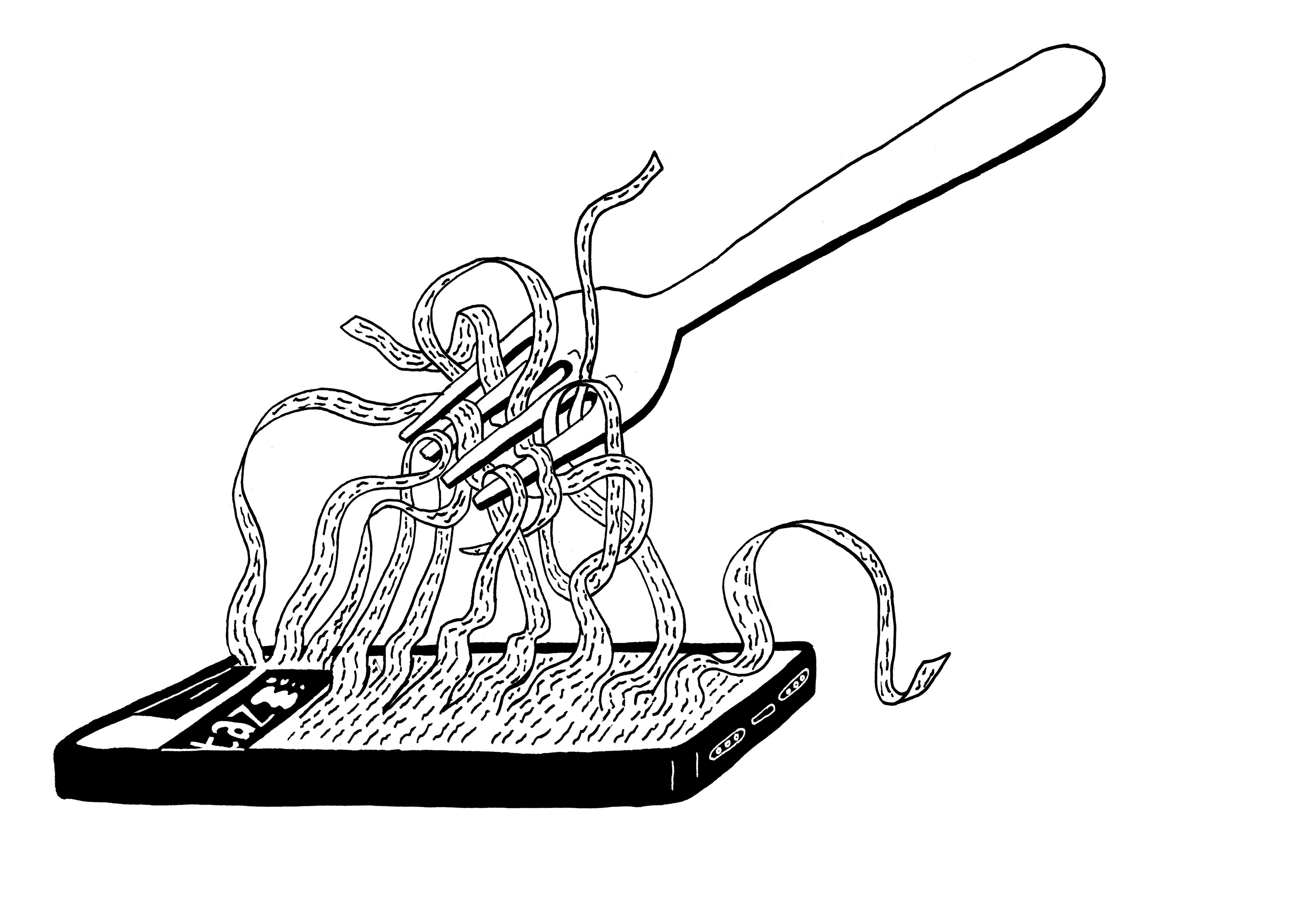Manchmal bekomme ich auf einen alten Beitrag noch eine Zuschrift, nach Wochen oder gar Monaten. Und das ist recht angenehm, weil ich dadurch wieder beginne, über Dinge nachzudenken, die ich länger unbedacht habe liegen lassen. Vor ein paar Tagen kommentierte eine Leserin meinen Blog-Beitrag zu den Personalpronomen dey und demm, den ich im Oktober 2024 hier veröffentlicht hatte, und meinte, das Problem der direkten Anrede einer non-binären Person, lasse sich doch hervorragend mit Sternchen und Sprechpause lösen. Statt wie von mir vorgeschlagen „liebey Kim“ solle ich „liebe*r Kim“ schreiben und sagen. Ist das so einfach?
Beim Sternchen in einem Wort wie Sprecher*innen haben dieselben keine Probleme, das Zeichen in eine Sprechpause zu übersetzen. Phonetisch ist diese Pause ein Konsonant, der im Deutschen nicht geschrieben, aber ständig benutzt wird, zum Beispiel immer dann, wenn ein Wort mit einem Vokal beginnt. Innerhalb von Wörtern kommt er ebenfalls vor, ein geschriebenes Wort, das sich auch „Musoim“ aussprechen ließe, wird mit seiner Hilfe zum Museum. „Sprecher*innen“ auszusprechen macht deshalb nicht mehr Schwierigkeiten als auszusprechen, dass manche Sprecher sinnen oder spinnen. Aber, zum Beispiel, „keine*r“?
Ich beschäftige mich mit Lyrik, genauer mit metrisch gebundener und gereimter Lyrik. Es spielt für meine Arbeit eine große Rolle, wie viele Silben Wörter haben und welche von denen betont oder unbetont sind. Die Wörter „keine“ und „keiner“ haben zwei Silben, deren erste betont ist, auf „keine“ reimt sich das Allgemeine, auf „keiner“ jeder Designer. Die Sprechpause * trennt „keiner“ aber nicht zwischen zwei Silben (kein*er = kein er), sondern innerhalb einer Silbe; ich spreche zuerst kurzes, lautlich zum kurzen I tendierendes E, pausiere und beende das Wort mit einem länger ausgehaltenen Rrrrr. Aus den ursprünglich zwei Silben werden auf diese Weise drei: kei – ne – rrrrr. Ob die letzte, etwas knurrige Silbe – du bist wie Keine*r! – auch als zärtlich empfunden werden kann, dürfte situationsabhängig sein. Klanglich ist sie im Deutschen eher ungewöhnlich, normalerweise wird ein „er“ zum A hin verschlissen, wie die Balina und Brandenburja am besten wissen, die es am deutlichsten tun. Wird „keine*r“ also eher „kei – ne – a“ ausgesprochen?
Wie auch immer, es ist ein dreisilbiges Wort. In den von mir bevorzugt benutzten Versarten, wechseln betonte Silben mit unbetonten ab, weshalb dreisilbige Wörter entweder, wie bei „Gefühle“, eine betonte Silbe zwischen zwei unbetonten oder, wie bei „irgendwie“, eine unbetonte Silbe zwischen zwei betonten haben; „keine*r“, „liebe*r“, „gute*r“ usf. gehören zu den letzteren:
Beim Abendbrot, mein Süße*r
zerdepperte das Essgeschirr.
Bei aller Süße, die dey hat,
ich machte danach einen Cut.
Oder:
Beim Abendbrot, mein Süße*r
erklärte mir die Algebra.
Dey löste alles auf nach X.
Ach, mit der Liebe wird es nix!
Ich gebe zu, das ist machbar, auch wenn sich die Aussprache von „Süße*r“ hier erst durch den Reim in der folgenden Zeile erschließt. Aber immerhin. Bei der Lösung „mein Süßey“ reimt sich, wie bei den vermutlich allermeisten anderen kurzen Adjektiven mit der Endung „-ey“, schlicht gar nichts; mein Vorschlag bringt erst einmal nur den Vorteil der Zweisilbigkeit:
Mein Süßey bringt beim Abendbrot
durch seine Schönheit mich in Not.
Verzehrend mich, verschlingend ey –
ich schwanke zwischen straight und gay.
Aber ich habe noch einen anderen Vorteil, das Wort „Süßey“ erklärt sich selbst. Denn ey ist keine Süße, kein Süßer, kein Süßes, ey ist ein Süßey, dey jedoch im Satz und Vers genau die gleiche Stelle einzunehmen vermag wie der Süße, die Süße und das Süße auch. Ich muss mich für ey nicht verrenken, ich kann ey nehmen, wie ey ist, mit emm bleibe ich im Fluss. Und darum geht es mir. Nicht darum, die Umständlichkeit von Formen wie „Süße*r“ vorzuführen; Umständliches erledigt sich von allein. Wichtig ist mir die Feststellung, dass non-binäre Personen ein Recht haben sollten, sich in aller Schönheit, Selbstverständlichkeit und Bequemlichkeit durch die geschriebene und gesprochene Sprache zu bewegen und sich in ihr zu behaupten.
***
Die Süße bringt beim Abendbrot
durch ihre Schönheit mich in Not.
Verzehrend mich, verschlingend sie –
mich überfällt Melancholie.
Mein Süßer bringt beim Abendbrot
durch seine Schönheit mich in Not.
Verzehrend mich, verschlingend ihn –
ich sitz bloß da. Und sollte knien.
Mein Süßes bringt beim Abendbrot
durch seine Schönheit mich in Not.
Verzehrend mich, verschlingend es –
ich leide unter Zuckerstress.