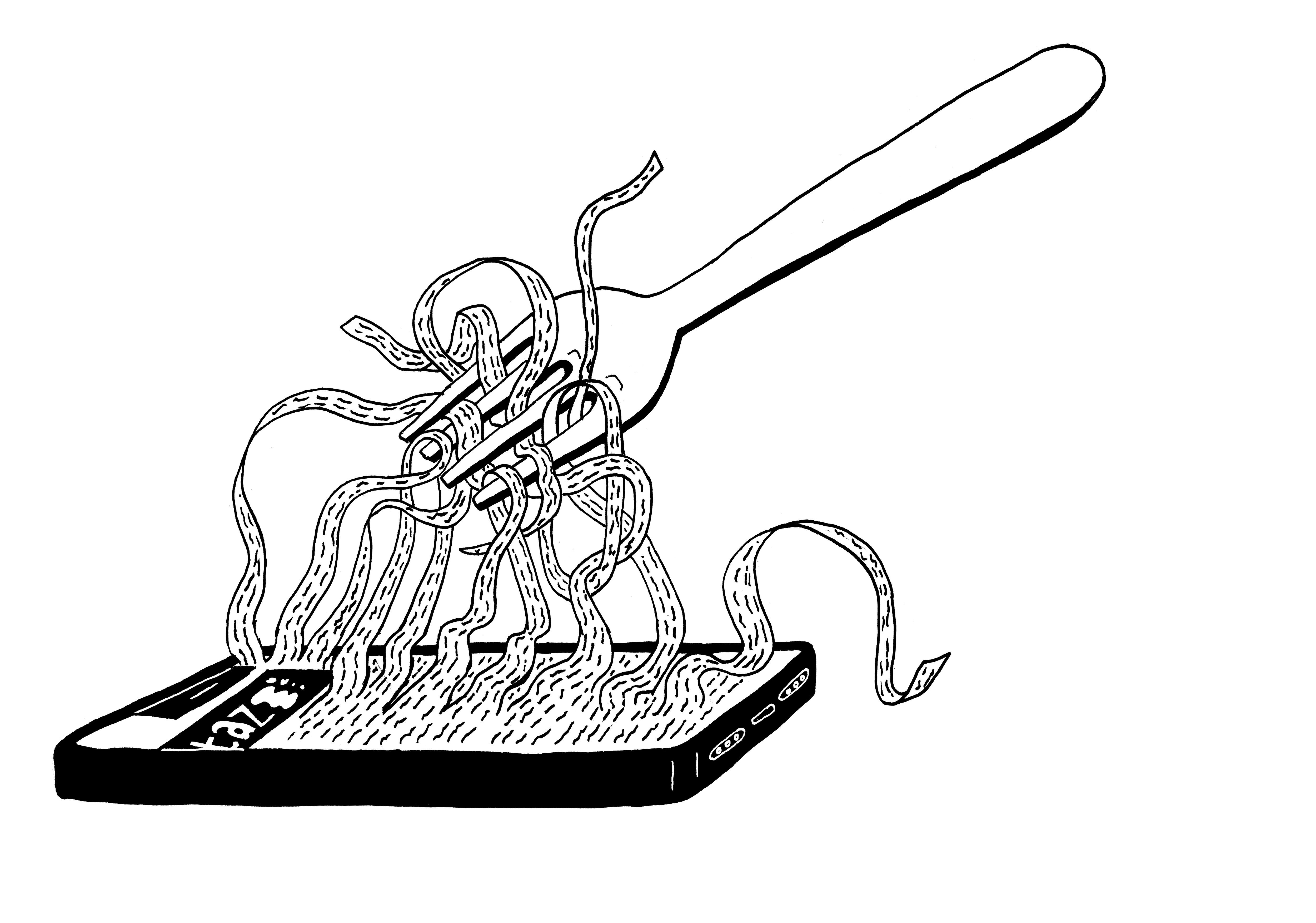Das technokratische Verwalten der Covid-Krise hat die verallgemeinerte Isoliertheit sichtbar gemacht, in der wir längst vordem schon gefangen waren. Insofern ist es Repräsentation, wenn nicht Präsentation des Neoliberalismus, der heute weniger seine Hegemonie einbüßt als sie zu verabsolutieren: Präsentation seiner Abstraktion, seiner Egomanie, seiner Soziophobie. Als Subjekten bleibt uns darin – ganz TINA gemäß – nur die Wahl der Qual zwischen zwei Arten des Asozialen: entweder hat mensch hedonistisch-ignorant seine Freiheit zu spreaden, oder verängstigt-interiorisiert zur Monade zu erstarren. In solchem Szenario lässt sich die eigene Subjektivierung nur künstlich fixieren in einem dieser beiden unmenschlichen Extreme – oder eben oszillieren von Seite zu Seite derselben Medaille. Dabei fallen sich beide Seiten letztlich gegenseitig in den Rücken, denn bei geteilter Täterschaft ist Beschuldigung reziprok.
Der Hintergrund: je weniger es eine ernstzunehmende politische Strukturdebatte gibt, desto mehr plustert sich die moralische Schulddebatte auf. Existenziell zwischen den Stühlen sitzen die Vereinzelten schließlich nur, weil sie kollektiv betroffen sind von dieser Krise, jedoch einzig atomistisch in Bezug auf sie handeln dürfen und können. Auch aktivistische Unvermitteltheit ist desto weniger zuhanden, je mehr Politik privatisiert wurde. In die Psychen verbannt leben wir folglich zwischen Dilemma und Konjunktiv – dem Korrelat der Zwangsprivatisierung einer Krise, die nicht weniger strukturell selbstverschuldet ist als die ihr vorhergehenden.
Solange sich diese Krise – ähnlich ihren Vorgängern – als Ausnahmefall gebärdete, ließ sich Asozialität light ‚links‘ vom Neoliberalen qua heroischer Verantwortung und inwendiger Solidarität begründen. Inzwischen aber, wo das Ende der Krise – Stichwort Mutationen – auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben ist, müssen die langfristigen psychosozialen Schäden, die drohende Anomie des sozialen Körpers und die objektive Depression seiner Psychosomatik in die Beurteilung der medizinischen Gefahrenlage mit einbezogen werden, um sie nicht von vornherein zu verzerren.
In der Tat schreit auch diese Krise damit lauthals nach Politisierung. Die bürgerliche Öffentlichkeit aber versagt gerade als Sprachrohr dieses Aufrufs zum Politischen. Stattdessen gibt es als höchstes der Gefühle Grabenkämpfe zwischen Vitalismus und Askese. Nun ist es in der Tat paradox, fürs Überleben das Leben zu opfern, oder die Gesundheit zu retten mittels schleichender Pathologisierung der Lebenswelt. Die Alternative dazu kann aber nicht eine wie auch immer geartete Debatte um Euthanasie sein – wie sie sich manches ‚alternative‘ Medium heute leistet. Im Gegenteil würden alle einmal wirklich zu Ende gestellten Fragen ums Überleben, Leben und Lebendige sofort in eine antikapitalistische Antwort umschlagen – vermittelt: von der Ökologie als Lebenszeit der Gattung bis zur Arbeit als Lebenszeit des Individuums. Das ist die tiefste Schicht Möglichkeit dieser Krise wie aller, die ihr vorhergingen: die Rückkehr des Politischen als einziger Weg, das Problem wirklich anzugehen, statt seinen Ursachen auszuweichen.
Um die Realisierung dieser Möglichkeit zu verhindern, ist die Dialektik des Neoliberalismus als Alternativlosigkeit zwar rhetorisch hilfreich. Wer den Kompromiss mit dem Bestehenden aber zu weit treibt, läuft Gefahr, dieses selbst mitsamt seiner hoffnungsreicheren Bestände zu verspielen.