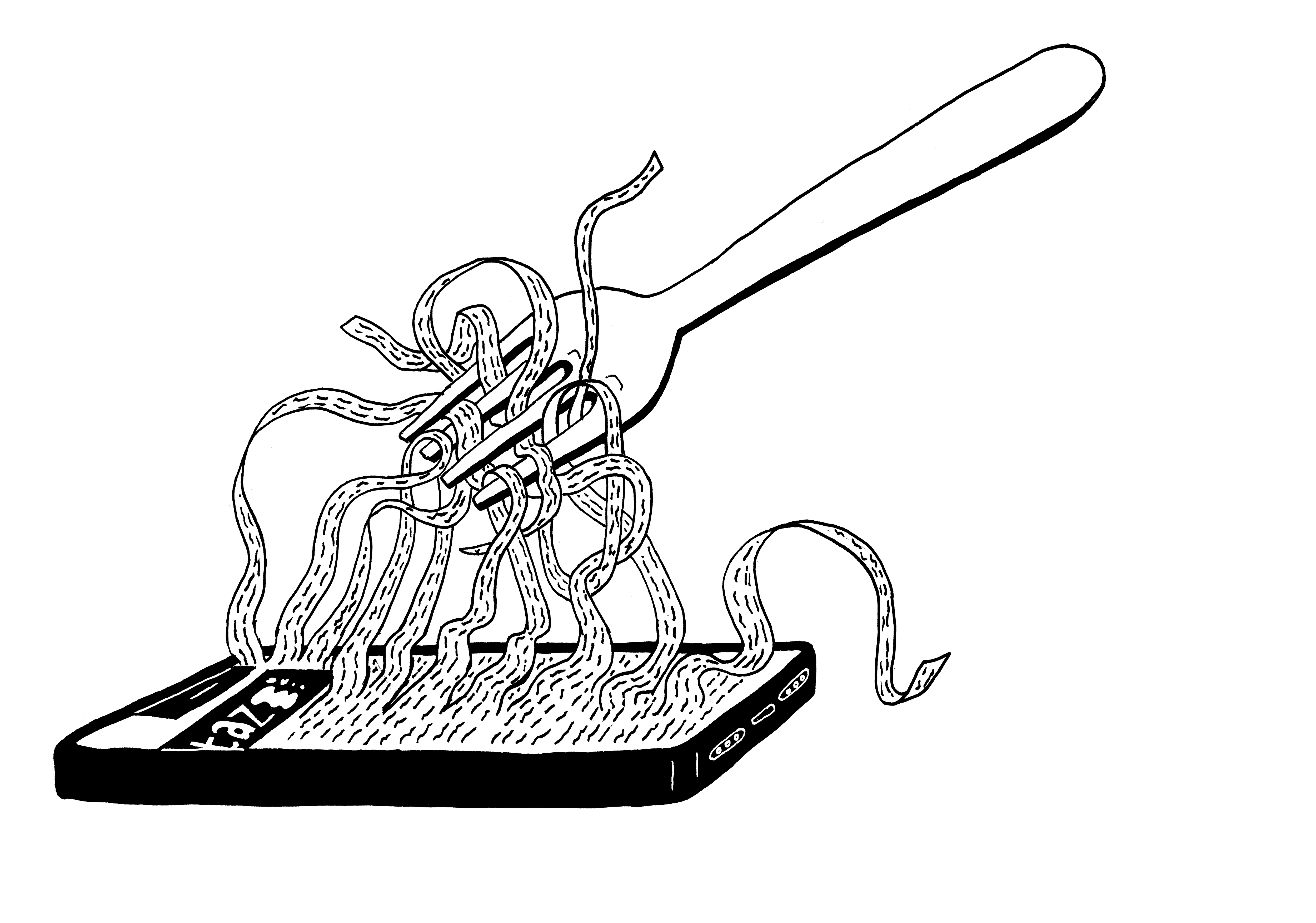Im zweiten Jahresdrittel 2025 hat ein Team des “Zentrums für Volksstudien” (CEESP) Stimmen von indigenen Autoritäten und Sprecher*innen von Basisorganisationen aus verschiedenen Regionen Boliviens zusammengetragen, die sich kritisch gegenüber dem bolivianischen Staat und den Formen der Machtausübung in den letzten Jahren äußern. Insofern sind sie nicht repräsentativ für diejenigen, die jüngst Rodrigo Paz Pereira zum neuen Präsidenten Boliviens gewählt haben. Suzanne Kruyt, José Octavio Orsag, Mónica Rocha, Huáscar Salazar und Daniela Toledo vom CEESP denken, dass die Polarisierung wenig hilfreich war, um die politische Entwicklung zu verstehen. Ihr Text will dazu beitragen, die verfügbaren Energien auf die Lösung der wirklichen Probleme in den Territorien der indigenen Gemeinden auszurichten.
von
Suzanne Kruyt, José Octavio Orsag, Mónica Rocha, Huáscar Salazar und Daniela Toledo (CEESP)
Die indigenen Organisationen sind heute von Spaltung und Konflikten um die Vertretungsbefugnis geprägt. Dabei steht die Legimität durch die Basis in einem Spannungsverhältnis mit staatlich anerkannten Vertretungsmechanismen. Das weitgehend von den Indigenen erkämpfte Plurinationale Bolivien erlebt offensichtliche Widersprüche zwischen den historischen Versprechen und der tatsächlichen Praxis der Staatsorgane.

Auf diesem Hintergrund gibt es Versuche der Wiederherstellung des sozialen Gefüges: Gemeinden konzentrieren ihre Mittel darauf, sich vor den Folgen der Klimakatastrophe zu schützen; Frauen kämpfen für ihre Beteiligung an Entscheidungen in patriarchal geprägten Organisationen; Jugendliche suchen Alternativen zu dem Dilemma, sich zwischen prekären Lebensbedingungen in ihren Gemeinden oder Abwanderung entscheiden zu sollen.
Spaltung und Desorientierung
„In der Gemeinde gibt es zwei Autoritäten”, beschreibt Marcela Quisbert Pilco von der Organisation Tupak Katari die Situation in Zongo (am Osthang der Andenkordillere im Departamento La Paz) eine Situation, die sich in vielen Dörfern anderswo in Bolivien wiederholt. “Früher gab es nur eine Vertretung. Heute unterstützt eine die Regierung, die andere vertritt das Volk. Das führt zu Uneinigkeit.“
René Vargas Llaveca ist Sprecher der indigenen Yampara-Nation im Departament Chuquisaca. Für ihn war das Jahr 2012 der Wendepunkt: „Damals hat die Regierung der Bewegung zum Sozialismus (MAS) damit begonnen, die indigenen Völker zu spalten. Eine Fraktion, die Evo Morales MAS nahe stand, und die andere, die von der Basis her ihre Rechte verteidigt hat.“ Aber nicht nur der Staat hat zur Spaltung beigetragen, erklärt Eva Colque, eine Aymara, die für die Stiftung Nuna in der bolivianischen Hochebene arbeitet. Der doppelte Wohnsitz, die Tatsache, dass viele Dorfbewohner*innen mit einem Fuss auch in der Stadt leben, schwäche ebenso die dörfliche Organisation und begünstige die Einbindung in städtische Parteistrukturen.
Nelly Romero, eine Weise, frühere Guaraní-Autorität und Vizepräsidentin des Dachverbandes der indigenen Tieflandvölker CIDOB, unterscheidet zwischen legaler und legitimer Vertretung: „Zahlreicher Sprecher*innen treten auf und behaupten, sie seien die gesetzliche Vertretung. Dabei sollten sie auch Legitimität haben. Die kommt, wenn sie vom Volk gewählt sind. Die gesetzliche Vertretung rührt dagegen daher, dass jemand von außen sagt, dass du die Leitung hast.”

Dabei ist der Klientelismus ein Schlüsselmechanismus, wie Saúl Carayuri erklärt. Er ist eine Autorität der Guaraní, die in den Randvierteln der Departaments-Hauptstadt Santa Cruz leben. „Die Sprecher*innen bekommen irgendeine bezahlte Stelle und geben sich damit zufrieden, statt sich darum zu kümmern, dass das Schulwesen besser wird.“ Aus Basisvertreter*innen werden so Vermittler*innen staatlicher Ressourcen. “Sie folgen den Vorgaben der politischen Parteien”, wenn sie nicht ohnehin nur als Aushängeschild missbraucht werden.
Wie schwierig es dann ist, auf lokaler Ebene eigene Vorstellungen zu entwickeln, berichtet Nelvi Aguilar aus dem vorwiegend von Quechua bewohnten Hochtal von Cochabamba. „Die Leute wollen gar nicht mehr zu den Versammlungen kommen, weil dort nur über Politik geredet wird und man sich bekämpft und beschimpft.” Der Parteienstreit durchdringt die Organisationen und lässt wenig Platz für die konkreten Probleme der Gemeinden.

Umkämpfte Territorien: Zwischen der versprochenen Autonomie und der drohenden Zerstörung durch Rohstoffgewinnung
Eines dieser Probleme ist die Versorgung mit Trinkwasser, so wie in den Dorfgemeinden von Escoma in der Provinz Camacho von La Paz. Eva Colque von der Stiftng Nuna: „Vor 30 Jahren wurden Trinkwassersysteme in dieser Region gebaut. Heute sind die meisten Quellen jedoch in einem besorgniserregenden Umfang durch Fäkalien und Mineralien kontaminiert. Dabei gibt es auf dem Gemeindeland keinen Bergbau. Doch die Abfälle kommen von einem Betrieb an der Grenze zu Peru, der den Suche-Fluss und damit auch den Titikaka-See vergiftet.”
Samuel Flores Cruz erlebt Ähnliches im Bergland nördlich von Potosí: „Es nützt uns nichts, dass unser Land als indigenes Territorium der Nation Qhara Qhara anerkannt ist. Der Bergbau nimmt es uns mit Verschmutzung und Landbesetzungen weg.” Die Landtitel bieten keinen Schutz. Transnationale Unternehmen arbeiten im rechtsfreien Raum, Bergwerkskooperativen breiten sich aus. Selbst Urteile des Verfassungsgerichts werden nicht respektiert.

Stattdessen dient die Kriminalisierung der ansässigen Bevölkerung der Kontrolle ihres Territoriums. Samuel Flores: „Der bolivianische Staat hat uns mit allen Mitteln attackiert. Gegen 24 indigene Autoritäten hat die Landreformbehörde Klage eingereicht, weil sie ihr Territorium verteidigt haben.“ Solche Gerichtsverfahren verschlingen Ressourcen und Energie der Organisationen.
Eva Colque berichtet aus dem für die Kallawaya-Medizin bekannten Landkreis Curva aus La Paz auch von internen Widersprüchen: „Obwohl es dort einen immensen Reichtum an Wasser und Land in allen Höhenlagen gibt, werden nicht einmal mehr Lebensmittel für den Eigenbedarf angebaut. Früher arbeiteten nur zwei von 12 Ayllus (indigene Gemeindeverbände) im Bergbau, heute sind es acht.“ Sie zerstören ihre eigenen Lebensgrundlagen.
Die Falle der Polarisierung
Laut dem Yampara René Vargas Llaveca ist es noch komplizerter. „Die Nation der Yampara steht keiner politischen Partei nahe. Sie kämpft nur mit Gesetzen für ihre Rechte. Sie folgt weder der Linken noch der Rechten. Wie gut wäre eine Regierung mit indigenem Gesicht gewesen, die die Rechte der indigenen Völker durchgesetzt hätte. Dann hätten wir uns vielleicht gefragt, was droht, wenn die Rechte an die Regierung kommt. Aber da die Linke mit einem indigenen Präsidenten regiert hat, ohne die Rechte der indigenen Völker und Nationen zu erfüllen, läuft es auf das Gleiche hinaus.”

Die programmatischen Unterschiede zwischen der MAS und der traditionellen Opposition sind durchaus bekannt. Sie verschwinden aber, wenn es darum geht, den indigenen Organisationen tatsächlich Entscheidungsgewalt zuzugestehen. Samuel Flores: „Wir haben Abgeordnete, die angeblich indigen sind, aber nicht einmal bereit waren, Verfassungsbeschwerden zu unterzeichnen, um unsere Rechte zu verteidigen.” Der Druck von beiden Seiten des politischen Spektrums neutralisiert sogar individuelle Versuche, den Zaun zu durchbrechen. Der Guaraní Saúl Carayuri erklärt, warum die indigenen Völker so unbequem für das politische System sind: „Uns gefällt die Freiheit. Als Volk wollen wir kein Drehbuch vorgesetzt bekommen, so wie es die politischen Parteien tun, damit wir nach ihrem Rhythmus tanzen”. Eine wirkliche Selbstbestimmung hat in der Parteienlogik keinen Platz (siehe auch das Porträt von Indolencio Zabrana).

Samuel enttäuscht diese systematische Ausgrenzung: „Was nützt es uns, von einer Partei vertreten zu werden, die unsere Rechte nicht respektiert? Und wenn die Verfassung die Rechte nicht garantiert, muss sich das Volk erheben“. Die Polarisierung zwischen Linken und Rechten ist dabei ein Mechanismus, der jenseits der programmatischen Unterschiede beiderseitig zur Verhinderung von Selbstbestimmung der indigenen Organisationen führt. Das Etikett “rechts”, mit dem indigene Völker belegt werden, die sich für ihre verfassungsmäßigen Reche einsetzen, entlarvt die Perversion des politischen Diskurses. Indem die indigenen Völker sich der politischen Vereinnahmung verweigern, öffnen sie den Blick für einen tieferen Widerspruch: Zwischem dem kolonial geprägten Staat und den Lebensweisen und Organisationsformen, die in den indigenen Territorien überlebt haben. René Vargas meint: „Egal welche Regierung sich dazu durchringt, unsere Rechte durchzusetzen, sie wird von uns respektiert werden.”
Alltägliches Widerstehen: Zurück zur eigenen Kraft
„Die Krise ist nicht nur schlecht”, sagt Nelvi Aguilar aus dem Hochtal vor Cochabamba. Und sie gibt damit den Gedanken über die wirtschaftlichen Probleme eine neue Richtung: „Denn wir erkennen, dass wir unsere Dinge auch selbst erledigen können. Wenn wir uns keine Medikamente leisten können, werden wir auf unsere Pflanzen zurückgreifen. Es ist kein Geld für Insektizide und Kunstdünger da? Dann nutzen wir eben natürlichen Dünger und biologische Mittel”. Die Krise rüttelt die Menschen dazu auf, sich an Fähigkeiten und Wissen zu erinnern, die während dem Rohstoffboom in Vergessenheit geraten waren. „Auch bei der Ernährung”, fährt Nelvi fort, “essen wir wieder viel von dem, was wir früher hatten so wie Meerschweinchen oder Schafsfleisch. Und das ist sehr gut.” Es geht nicht darum, die Armut zu romantisieren, sondern angesichts der prekären Verhältnisse pragmatisch wieder die eigenen Ressourcen zu entdecken.

Die Frauen gehen bei dieser Suche voran, betont die Guaraní Nelly Romero: „Unsere Brüder haben ihre Vertretungsmöglichkeiten verloren, weil sie Landbesetzungen, Bodenspekulation und die Verhandlungen mit den Erdgaskonzernen zugelassen haben. Nun eignen wir Frauen uns diese Instrumente an, um uns zu verteidigen. Wir verteidigen unser Land, weil wir nicht verschenken können, was unser Leben gekostet hat.” Die Frauen versuchen daher nicht einfach die Ämter zu besetzen, die die Männer verlassen haben. Sie versuchen den Führungsstil und die Vertretungsformen selbst zu verändern.
Eva Colque berichtet, wie mi Altiplano versucht wird, Autonomie zurückzugewinnen: „Es gibt indigene Gemeindeverbände (Ayllus), die Autonomie wollen. Nur ein Ayllu kann das derzeit schaffen. Es sind Basisprozesse. Sie haben begonnen, ganz ohne institutionelle Unterstützung von außen ihr Territorium zu ordnen.“ Die praktische Autonomie wächst, wo die juristische Autonomie im bürokratischen Labyrinth stecken geblieben ist. Das Wasser ist eine Priorität, das die Gemeinde eint. “Sie kaufen Setzlinge von Obstbäumen”, berichtet Eva, “denn sie merken, dass Nahrungsmittel fehlen werden.” So analysieren sie die Klimakatastrophe von ihrem Land aus.
Auch wenn Samuel Flores keine gute Meinung vom Staat hat, hält er an seinem Kampf fest: „Wir werden unsere Rechte nicht in Verhandlungen zur Disposition stellen, sondern ihre Erfüllung einfordern. Ich weiß, wie schwer das ist und dass Widerstände zu überwinden sind. Die müssen wir bereinigen. Und falls irgendein Verfassungsartikel nicht funktioniert, muss er verändert werden.“ Auch René Vargas will nicht aufgeben: “Die Yampara werden weiter kämpfen, egal wer der nächste Präsident ist. Man verzichtet nicht auf die eigenen Rechte.”
Für den Guaraní Saúl Carayuri hat Autonomie konkrete wirtschaftliche Aspekte: „Wann werden wir ohne Herren sein? Wann werden wir über unsere eigenen Gelder verfügen? Wir haben unser Territorium, das anerkannt ist. Wir können unsere eigenen Landnutzungspläne entwerfen und eine wirtschaftliche Entwicklung nach unseren kulturellen Prinzipien in Gang setzen.” Es geht ihm nicht um eine Rückkehr zu einer idealisierten Vergangenheit, sondern um die Zukunft: „Wir müssten ein anderer Staat werden. Und das wird dem heutigen Staat nicht gefallen.”

Im Hochtal von Cochabamba vereinbaren die Frauen klare Regeln, um ihre Treffen zu schützen. Wer Parteipolitik einbringt, um die Gruppe zu spalten, muss eine Strafe zahlen. Nelvi Aguilar: „Bei unseren Treffen sagen wir, dass wir nicht von Parteipolitik reden, sondern nur von unseren eigenen Projekten. Wenn es um Bewässerung geht, geht es um Bewässerung.” Was auf den ersten Blick als Entpolitisierung erscheint, ist tatsächlich eine tiefergreifende Re-Politisierung: Man findet zurück zur Erneuerung des Lebens, zu dem, was die Menschen vor Ort vereint, und nicht was sie trennt. Es handelt sich um ein tägliches Beharren, Suchen und Rückgewinnen. Das zusammen legt nicht nur die Krise und die Fragwürdigkeit staatlicher Versprechen offen, sondern eröffnet auch die Möglichkeit, zu den Quellen der eigenen Kraft zurückzukehren. Oder wie Nelvi es zusammenfasst: „Nicht alles ist schlecht in der Krise“.
Jenseits des Wahlkarrusells
Die Wahlergebnisse haben die Verhältnisse nicht wesentlich verändert, die in den zitierten Interviews ihren Ausdruck gefunden haben. Das Wasser wird auch weiter verschmutzt nach Escoma kommen. Und die jungen Guaraní werden sich zwischen prekären Arbeitsbedingungen und der Gewalt des Drogenhandels bewegen müssen. Die Bergwerksunternehmen werden weiter auf indigenes Territorium vordringen, dessen Autonomie der Staat zwar auf dem Papier anerkennt, aber in der Praxis ignoriert. Bolivien erlebt einen politischen Wandel, der über die Wahlprozesse hinausreicht. Die Interviews zeigen aber auch, dass jenseits des Medienlärms der Parteipolitik noch tiefere Prozesse fortbestehen: Gespaltene Organisationen, die versuchen wieder zusammen zu finden; Umkämpfte Territorien zwischen verbrieften Rechten und Interessen der Rohstoffausbeutung; Jugendliche ohne klare Lebensperspektiven, aber mit dem Willen, diese zu suchen.
Die Probleme Boliviens werden nicht mit Wahlen gelöst. Die Krise geht über den Streit um die Kontrolle des Staates hinaus. Denn es ist auch eine Krise der Organisation des Staates und der Formen der Repräsentation. Wer verstehen will, was an der Basis geschieht, kann sich nicht nur auf vereinfachende Erklärungsmuster von Widerstand versus Kooptation, Siegende versus Besiegte beschränken. Die Interviews legen komplexe Anpassungs-, Verhandlungs- und Suchprozesse offen. Bei denen treffen staatliche Kontrollversuche auf interne Organisationsprozesse. Wünsche nach mehr Autonomie werden durch Notwendigkeiten des täglichen Überlebens eingeschränkt. Demographischer Wandel trifft auf ökonomische Zwänge. Die Turbulenzen des diesjährigen Wahlkampfs werden vorüber gehen, so wie in früheren Jahren. Aber die Realität eines Landes wird bleiben, in dem die Territorien umkämpft sind und die Gemeinden ihre Rechte vertreten oder sich anpassen.

Die gesammelten Interviews eröffnen keine endgültigen Lösungen oder alternative Programme. Aber sie zeigen, dass an den Bruchstellen der herrschenden politischen Ordnung andere Politikformen entstehen oder fortbestehen. Die stellen das Leben in den Mittelpunkt, suchen nach wirklicher Selbstbestimmung und versuchen trotz der Kräfte, die sie spalten, die sozialen Netze und Gemeinschaften zu rekonstruieren. Das benötigt Zeit und Geduld und folgt nicht dem Rhythmus der Wahlzyklen. Die Rückgewinnung von Legimität wird auch nicht mit Gesetzesänderungen zu lösen sein. Die Verteidigung des Territoriums benötigt mehr als Landtitel. Der erste Schritt ist vielleicht das, was Nelvi Aguilar vorschlägt: „Zum Konkreten zurück zu finden, zu dem, was die Menschen vor Ort eint, statt dem, was sie trennt“.

Wir vom CEESP sind davon überzeugt, dass alternative Zukunftsentwürfe davon abhängen, die wirklich wichtigen Themen in den Mittelpunkt zu stellen: Nicht, wer die Kandidaten bei den Wahlen sind und welche Allianzen sie schmieden. Sondern wie wir der Wasserkrise begegnen, wie der Landraub gestoppt werden kann, wie selbstbestimmte Netzwerke geknüpft werden, und wie eine Wirtschaft gestaltet werden kann, die nicht auf Rohstoffausbeutung beruht. Solche Prozesse müssen sichtbar gemacht und gestärkt und Brücken zwischen ihnen gebaut werden (siehe auch diesen Beitrag zu den Perspektiven nach den Wahlen von Mario Rodriguez). Auf diese Weise kritisches Bewusstsein zu schaffen, dass die fruchtlose politische Polarisierung überwindet, ist eine dringende Aufgabe für alle, die nachhaltigen Wandel anstreben.
Dabei gilt es, diese Prozesse anzuerkennen, ohne sie zu idealisieren, aber auch ohne sie klein zu reden. Die wichtigsten Veränderungsprozesse werden nicht von Oben kommen, sondern von dort, wo trotz allem das Leben verteidigt und neu erfunden wird.

Der Text wurde von Peter Strack für Latinorama stark gekürzt und ins Deutsche übersetzt und ist vollständig in der im September 2025 erschienenen Ausgabe 2 der Zeitschrift EN CLAVE SALVAJE nachzulesen, die finanziell von der Rosa Luxemburg Stiftung unterstützt wurde. Wir bedanken uns beim CEESP für die Abdruckgenehmigung.