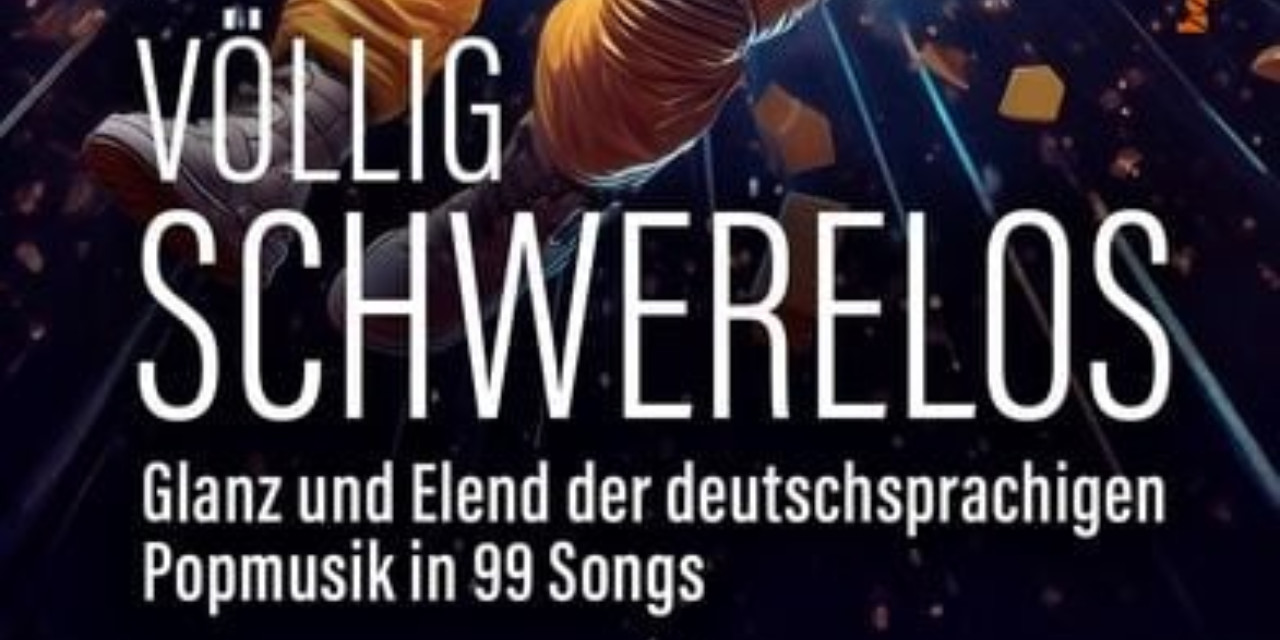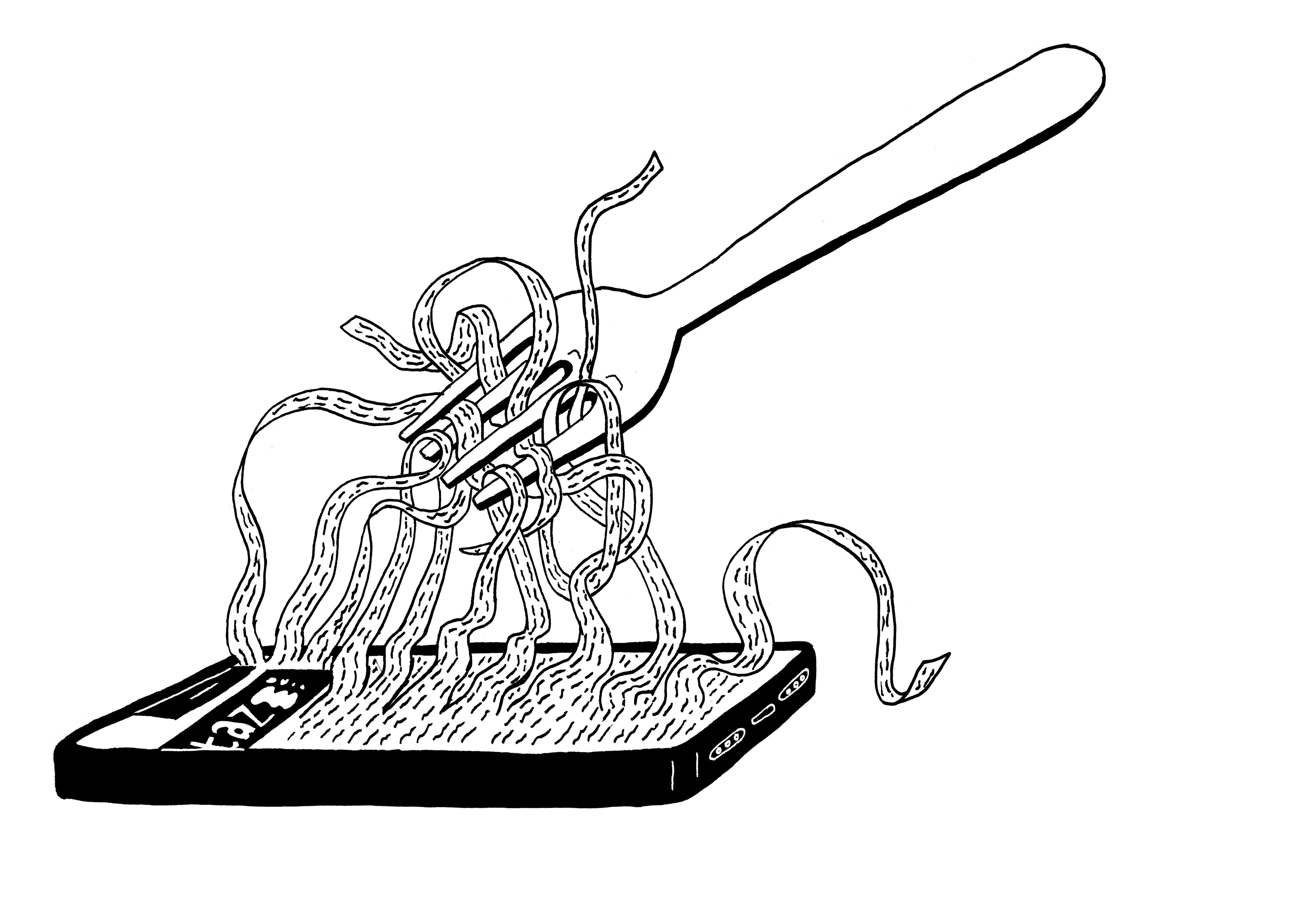Der österreichische Journalist Wolfgang Zechner hat sich die Aufgabe gestellt, in 99 Songs durch die deutschsprachige Popgeschichte zu fliegen. Ergebnis ist das sehr empfehlenswerte Buch „Völlig schwerelos – Glanz und Elend der deutschsprachigen Popmusik in 99 Songs“, das dank Zechners Hang zu starker Meinung ein durch und durch abwechslungsreiches, durchaus auch überraschendes Buch ist. Zwar sind – vielleicht biographisch bedingt, aber fraglos auch pophistorisch begründbar – die späten 70er und frühen 80er im Fokus des Buches, aber brillieren gerade auch die Geschichten über Lieder aus der Frühzeit der deutschsprachigen Popmusik. Wer beispielsweise Freddy Quinns Schlager des Reaktionären „Wir“ einmal mit völlig anderen Ohren hören will, sollte zu „Völlig Schwerelos“ greifen.
Einen anderen Exkurs können wir heute als Auszug abdrucken: wie deutsche Plattenfirmen versuchten, Punk zu verstehen und dabei gnadenlos scheiterten (Peter Hein & Co werden an anderer Stelle im Buch ausführlich besprochen, allein dafür schon große Liebe meinerseits!).
ANARCHY IN GERMANY?
38. Strassenjungs – „Ich brauch meinen Suff“
(BRD, 1977)
Die Revolution brach an einem Freitag los. Am 23. April 1976 erschien auf Sire Records das Debütalbum einer obskuren Band aus dem New Yorker Stadtteil Queens. Die vier Jungs sangen lakonisch-lustige und extrem eingängige Songs über den Horrorfilm Texas Chainsaw Massacre, über den Mad-Comic „Spion gegen Spion“ und darüber, dass sie Klebstoff schnüffeln wollen.
Obwohl oder gerade weil die Hälfte der Bandmitglieder jüdische Wurzeln hatte, nannten sie ihre frühe Hymne „Blitzkrieg Bop“. Sie trugen Lederjacken und abgerissene Jeans sowie einen Einheitshaarschnitt.
Sie spielten eine genauso schnelle wie reduzierte Variante des US-amerikanischen Garagenrocks, in dem auch The Velvet Underground sowie der 1960er-Bubblegum-Pop von den Ronettes, den Shangri-Las und von – Achtung, überraschende Querverbindung zum bisher Gelesenen! – Connie Francis kräftig nachhallten.
Die vier Jungs hatten alles, was man haben konnte: Energie, Geschwindigkeit, Melodien, Stil, Provokation, Ironie und Humor. Sie waren perfekt. Mehr noch: Sie waren derart meta, dass sogar die Hipster aus der Kunstszene begeistert waren. Die Band hieß Ramones. Ihre Musik nannte man bald Punk.
In der angloamerikanischen Musikszene regierte vor 1976 der sogenannte Progressive Rock – eine Form des gediegenen musikalischen Kunsthandwerks, das für technische Materialschlachten und gepflegte Langeweile stand. Punk war die Antithese zum zeitgenössischen Prog-Rock, den der österreichische Punk-Pionier Xaõ Seffcheque im Gespräch mit mir einst so trefflich als Umstandsmeier-Rock bezeichnet hat. Punk hatte eine Botschaft: Hier sind drei Akkorde – jetzt gründe eine Band! Punk war zu Beginn kein Stil, sondern eine Idee. Ein Neubeginn. Jeder Mensch konnte sich im Punk neu erfinden. Wichtig war, dass man etwas Eigenes machte. Was das genau war, war eigentlich egal. Zumindest anfänglich.
Weil nichts ansteckender ist als eine gute Idee, fasste Punk auch schnell jenseits des großen Teiches Fuß. In Großbritannien traf Punk auf fruchtbaren Boden und verschränkte sich mit der dortigen Working-Class-Kultur. Noch im selben Jahr, am 22. Oktober, erschien mit „New Rose“ von The Damned die erste britische Punk-Single. Kurz darauf folgten die ersten Veröffentlichungen der Sex Pistols und von The Clash.
Auch in Westdeutschland, in der Schweiz und in Österreich entstanden Szenen, und in den Probekellern der Metropolen gründeten Jugendliche erste Bands. Diese Gruppen wurden von der Industrie ignoriert. Wie schon beim Rock’n’Roll 20 Jahre zuvor, witterte der musikalisch-industrielle Komplex trotzdem den großen Zahltag. Punk? Klingt gut. Machen wir selbst. Die Industrie hatte aber ein Problem: Sie verstand das Phänomen nicht. Beim Rock’n’Roll war es anders gewesen. Der war als Massenphänomen in den USA von der Entertainment-Industrie lanciert worden. Im Unterschied dazu war Punk eine Kultur von unten. Die ersten Versuche der westdeutschen Plattenfirmen, das neue Phänomen zu monetisieren, mussten daher scheitern. Und sie scheiterten spektakulär.
Noch 1977 engagierte das Produzententeam Alex Klopprogge und Eckehard Ziedrich für Columbia Records eilig ein paar angestaubte Altrocker, die teilweise schon in den 1960er-Jahren aktiv gewesen waren, und nannte das so entstandene Punk-Projekt Strassenjungs.
Das Debutalbum bekam den zweifelhaften Namen Dauerlutscher verpasst. Auf dem Cover sind vier verwitterte Gestalten mit langen Haaren abgebildet. Einer trägt einen Vollbart, ein anderer hat die Mähne zum Faschings-Iro hochgekleistert. Die Musik passte sich dem optischen Elend an: Serviert wurde räudiger Blues-Rock mit Texten, die zwischen völlig verunglückter Gesellschaftskritik und permanenter Notgeilheit oszillieren. „Ich brauch meinen Suff wie der Spießer den Puff“, röchelt der Sänger in „Ich brauch meinen Suff“. Je länger das Lied dauert, desto unangenehmer wird es. „Besoffen auf dem Damenklo ist jede wie Brigit Bardot“, heißt es schlussendlich. Igitt. In dieser abgefuckten Parallelwelt ist Punk ein volltrunkener Herrenabend im örtlichen Pornokino.
Das war aber nicht einmal der bescheuertste Aspekt des Strassenjungs-Debakels. Am schlimmsten waren die Namen. Namen spielen im Punk eine entscheidende Rolle. Mit ihrer Hilfe streift man die alte Identität ab und erfindet sich neu. Der schüchterne Nerd Jeffry Ross Hyman verwandelte sich in Joey Ramone und das Londoner Arbeiterkind John Lydon mutierte zum Sex-Pistols-Frontman Johny Rotten. Niemand wird mir lauben, mit welchen Namen die Strassenjungs ins Rennen geschickt wurden. Ich nenne sie trotzdem, kommentiere sie aber nicht. Denn was soll man dazu noch sagen? Sie lauteten: Alexander Adrett, Willi Anstand, Mario Nett und – ich schwöre auf das Gesamtwerk von Alexandra! – Karl Kraftlos.
Hätten die Ramones geahnt, was sie in Westdeutschland mit ihrer Punk-Revolution anrichten werden, hätten sie sich wahrscheinlich auf der Stelle aufgelöst. Trotzdem gehört Dauerlutscher in jede gut sortierte Plattensammlung. In jede schlecht sortierte sowieso. Die Platte ist der Goldstandard in Sachen deutsches Pop-Missverständnis und ein ewig gültiges Mahnmal einer allumfassenden Inkompetenz.
Es erinnert uns daran, was im Pop wie im Leben schiefgehen kann, wenn die falschen Leute versuchen, das Richtige zu machen. Dass diese Themenverfehlung auch noch ein kolossaler kommerzieller Flop war, muss ich nicht extra erwähnen. Das hielt die Industrie nicht davon ab, weitere Punk-Projekte aus dem Boden zu stampfen. Eines davon schaffte es 1978 sogar, bis in die geheiligten Hallen des popkulturellen Status quo vorzudringen – in die ZDF-Hitparade. Davon erzählt die Geschichte des nächsten Songs.
Das Buch „Völlig schwerelos – Glanz und Elend der deutschsprachigen Popmusik in 99 Songs“ von Wolfgang Zechner ist bereits erschienen