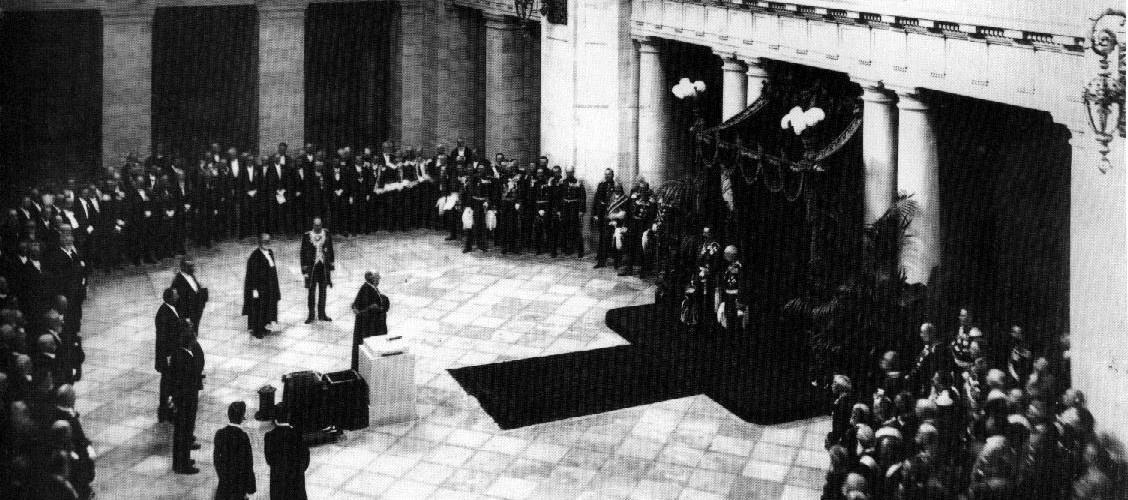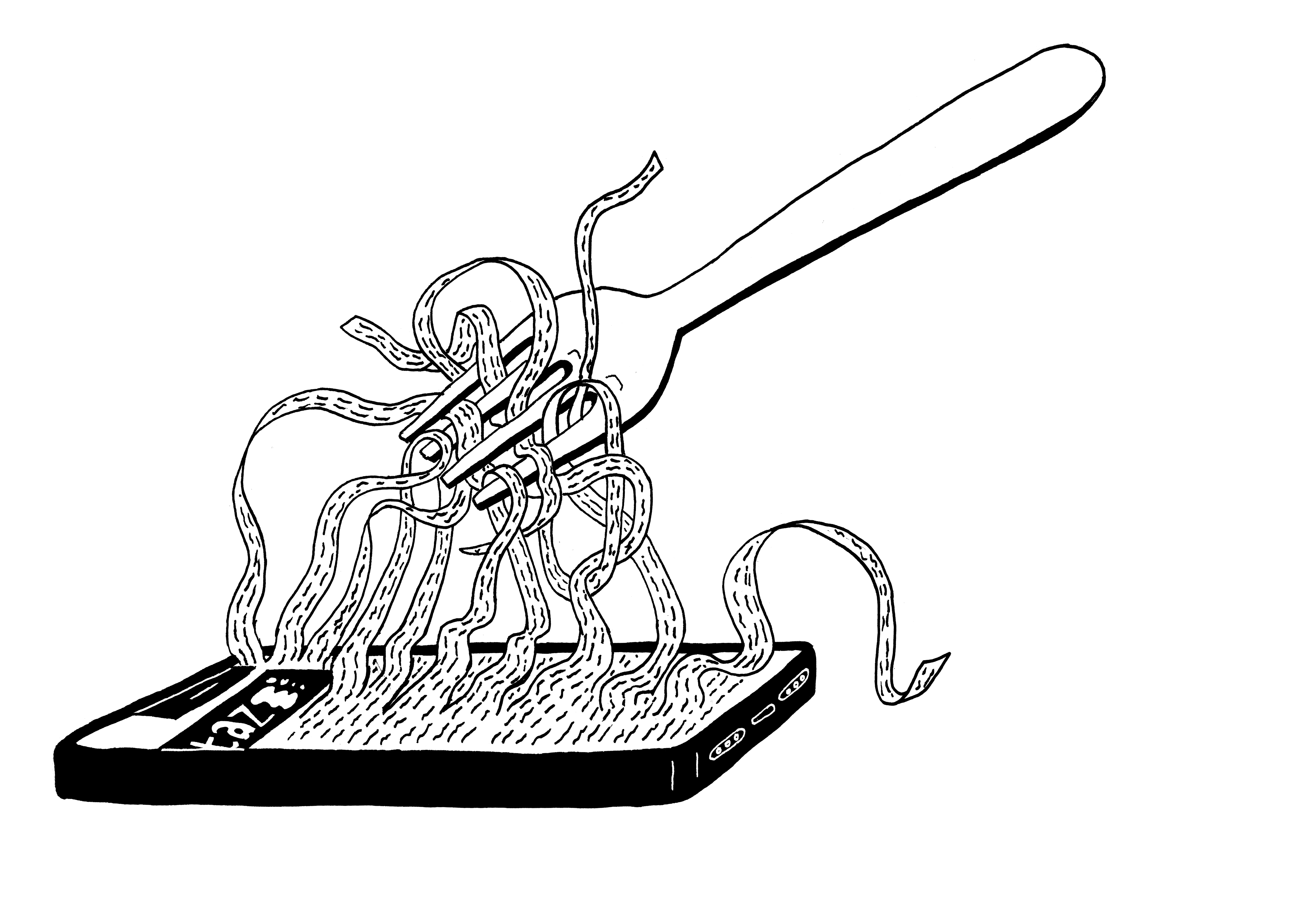Die aktuelle Diskussion zum Thema Rassismus im Grundgesetz (GG) hat sich bisher um die Vorteile und Nachteile der Verwendung des Begriffs „Rasse“ in Art. 3 GG gedreht. Dabei verdient auch Art. 116 GG Aufmerksamkeit. Er regelt wer deutsch ist und wer einen verfassungsrechtlichen Anspruch darauf hat, es zu sein. Dabei trägt er sowohl der systematischen Vertreibung deutscher Minderheiten aus ihren Heimatländern, als auch den rassistisch, politisch oder religiös motivierten Ausbürgerungen des NS Regimes Rechnung. Von diesen Ausbürgerungen waren vor allem deutsche Juden, aber auch deutsche Sinti und Roma betroffen.
Art. 116 GG betrachtet alle geflüchteten und vertriebenen Angehörigen deutscher Minderheiten als deutsche Volksangehörige und legt fest, dass sie vor dem Gesetz deutsch sind. Auch unrechtmäßig vom NS Regime ausgebürgerte Personen, sogenannte ehemalige deutsche Staatsangehörige, haben nach Art. 116 GG einen Anspruch darauf wieder eingebürgert zu werden, wenn sie dies beantragen. Bei ihnen ist die Wiedereinbürgerung aber nicht automatisch und der Anspruch darauf leitet sich auch nicht aus ihrer deutschen Volkszugehörigkeit ab, sondern aus ihrer zu Unrecht aberkannten Staatsangehörigkeit.
Die Differenzierung zwischen deutschen Volksangehörigen und ehemaligen deutschen Staatsangehhörigen hat durchschlagende Konsequenzen. Nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) und dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG) gelten auch für die Nachfahren beider Personengruppen unterschiedliche Regeln beim (Wieder-)erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit. Darüber hinaus wurden die Regelungen für deutsche Volksangehörige auf alle deutschen Minderheiten in Osteuropa ausgeweitet, während der Personenkreis der einen Anspruch auf die deutsche Staatsbürgerschaft hat, der sich aus ehemaliger deutscher Staatsangehörigkeit ableitet zum Teil eher beschränkt wurde (z.B. BVerwG, 6. 12. 1983 — 1 C 122.80, dem entgegen steht aber u.a. BVerfG, 20.05.2020 – 2 BvR 2628/18).
Er wurde auch nicht, wie wiederholt gefordert, auf alle Personen ausgeweitet die vor dem NS Regime flüchten mussten, sondern nach wie vor nur, wenn die Nazis ihnen nachweislich die deutsche Staatsbürgerschaft weggenommen haben. Im Vergleich zum Verfahren für deutsche Volksangehörige ist der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit für die Nachfahren von NS Ausgebürgerten an eine Reihe von zusätzlichen Bedingungen geknüpft und die erfolgreiche Einbürgerung ist, anders als bei deutschen Volksangehörigen, auch nicht mit einem Anspruch auf Integrationsleistungen verbunden.
Als das Grundgesetz 1949 in Kraft trat, wurde die Differenzierung beim (Wieder-)erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft für beide Personengruppen mit ihren unterschiedlichen Interessen begründet. Man ging davon aus, dass eine automatische Wiederherstellung ihrer Staatsbürgerschaft nicht von allen NS Ausgebürgerten gewünscht werde, und, dass ein solches Vorgehen sich nachteilig auf ihre etwaigen Einbürgerungen im Ausland auswirken könnte. Dahingegen wisse man von geflüchteten oder vertriebenen Angehörigen deutscher Minderheiten, dass sie in einer akuten Notlage seien die man am schnellsten und effektivsten durch sofortige Einbürgerungen in Deutschland beenden könne.
Das ist schlüssig und nachvollziehbar. Nicht selbsterklärend dahingegen ist, warum diese Personengruppen ausgerechnet an ihrer Volks- bzw. Staatszugehörigkeit unterschieden wurden. Ebenfalls nicht selbsterklärend ist, warum sich die Ansprüche für Volksangehörige und die Nachfahren von NS Verfolgten nach wie vor grundlegend unterscheiden, jetzt wo die Umstände die eine solche Unterscheidung rechtfertigten schon lange weggefallen sind und das erklärte Ziel in beiden Fällen die Wiedergutmachung der Verbrechen des Dritten Reichs ist (s. etwa hier und hier).
Tatsächlich lässt sich die rechtliche Unterscheidung zwischen Volksangehörigen und Staatsangehörigen auf das Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935 zurückführen, welches Staatsangehhörige von Reichsbürgern trennt. Demnach konnten nur Staatsangehörige „deutscher Rasse“ Reichsbürger sein und waren damit, anders als Staatsangehörige „anderer Rassen“, vollwertige Bürger. Damit wurde gerechtfertigt, dass Staatsangehörige deutlich weniger Rechte und mehr Pflichten hatten als Reichsbürger und auch viel leichter ausgebürgert werden konnten.
Es ist bedauerlich, dass sich im Grundgesetz auch heute noch das rassistische Erbe des Reichsbürgergesetz wiederfindet, denn auch damals schon wäre eine andere Lösung denkbar gewesen. Noch bedauerlicher ist es, dass höchstrichterliche Entscheidungen, Gesetzes- und Verwaltungsakte seither den unterschiedlichen Umgang mit Einbürgerungsgesuchen nach Volks- bzw. Staatszugehörigkeit nie in Frage gestellt, und damit weiter legitimiert und zementiert haben (Überblick dazu z.B. hier).
Die aktuelle Debatte zum Thema Rassismus im Grundgesetz ist auch eine Gelegenheit darüber nachzudenken, ob im deutschen Recht weiterhin Platz für das Erbe des Reichsbürgergesetzes sein sollte. Zum Schutz und zur Stärkung deutscher Minderheiten im Ausland gibt es bessere Wege. Das Ziel der Wiedergutmachung für die Verbrechen der NS Zeit wird so geradezu ad absurdum und das Bild eines völkischen deutschen Volks, abseits und unabhängig von seinen Bürgerinnen und Bürgern ist fernab der Realität eines zunehmend bunteren Deutschlands.