Der Bär flattert in nördlicher Richtung.
Ende 1968 stand die Gründung des März Verlags vor der Tür, das Komische war, ich selbst ahnte noch nichts davon. Auch sonst hatte, was damals ablief, die schrillen Züge einer Farce. Vielleicht lag es am Sujet, dieser Mischung aus Pop, Politik und Porno, oder weil ich als Tollhausoberboß eine Horde von Tollhäuslern anführte. Nein, das wäre ungerecht gegen mich selbst und meine Kombattanten. Die allerdings unterließen nichts, um über die Zeitläufte vergessen zu machen, wie grotesk sie damals herumhampelten auf den Straßen, auf dem Papier und in den befreiten Betten. In all dem wob keine konzeptuelle Dramaturgie, und glaub bloß nicht, daß ich die Komik der Possen immer erkannt hätte, in denen ich mitspielte! Einige waren so dumpf, daß ich 1972 als ›Siegfried‹-Erzähler manchmal der langweiligeren Lüge den Vorzug gab – die Wahrheit ist eben kaum zu glauben. Aber inzwischen haben wir ja gelernt, die Realität zu dekonstruieren, deshalb wird mir auch jeder die folgende Geschichte abnehmen, die zunächst ganz seriös anfing.
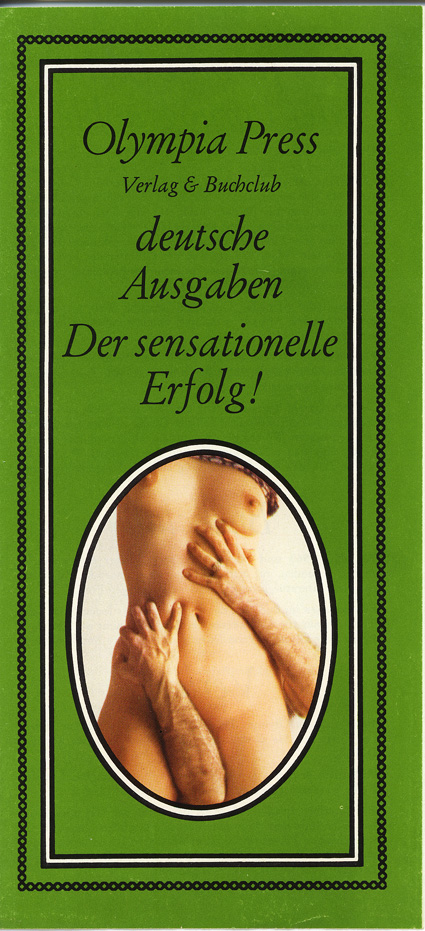
Ich hatte im Deember 1968 jene berühmte Anzeige für die Olympia Press entworfen mit der schönen Headline ›Das farbige Banner der Pornographie‹, dem Text über den Verleger Maurice Girodias und seine großen Autoren, dazwischen verstreut die briefmarkengroßen Fotos. Natürlich war der ›Spiegel‹ das einzige Organ, das für meine Werbung in Frage kam. Der hatte einen frühen Anzeigenschluß, bereits im Januar bestellte ich zwei Spalten neben Text im Kulturteil, die Anzeigenabteilung bestätigte den Auftrag und bat um Zusendung eines Andrucks. Ich schickte einen Abzug nach Hamburg, Erscheinungstermin 3. März, der geplante Auslieferungstermin der ersten beiden Olympia-Press-Titel. Prompt rief die Anzeigenabteilung an: »Es tut uns leid, Werbetexte erotischen Inhalts werden bei uns nicht veröffentlicht, eine grundsätzliche Entscheidung der Verlagsleitung.« Mit dieser Anzeige stand und fiel mein Geschäft, also redete ich erst auf die Sachbearbeiterin ein wie auf einen kranken Gaul, dann auf den Leiter der Abteilung, daß es doch hier nicht um Beate Uhse oder sonst einen schlickigen Versandhandel gehe, sondern um Henry-Miller- und Nabokovnahe Erotika, und rasselte ihm alle großen Olympia-Press-Autoren herunter. »Sie werben mit der Headline ›Das farbige Banner der Pornographie‹«, gab er mir zur Antwort, »und pornographische Anzeigen dürfen im ›Spiegel‹ eben nicht erscheinen.« Ich ließ nicht locker, schließlich seufzte der Mann, offenbar um mich loszuwerden: »Ich kann es nicht anders entscheiden, gebe den Fall an die Verlagsleitung weiter, die wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.«
Zwei Tage später meldete sich tatsächlich jemand, bestätigte aber nur die Ablehnung. Damit war die Sache eigentlich gelaufen, und lediglich als Abbinder, um mein Mütchen zu kühlen, trompetete ich ins Telefon: »Unmöglich! Sie können einen Verlag mit großem Namen doch nicht einfach abtun mit: ›Das ist Pornographie, so was veröffentlichen wir nicht.‹ Das ist Zensur! Die kann sich der ›Spiegel‹ gar nicht leisten!« Erstaunlicherweise legte der so Beschimpfte nicht auf, sondern sagte: »Ich sehe wenig Chancen, trotzdem werde ich mich bei der Redaktion kundig machen und eventuell das Büro des Herausgebers einschalten. Sie hören wieder von uns.«
Ich kann es nur nochmals betonen: Jedermann, der in Deutschland mehr buchstabieren konnte als die ›Bild-Zeitung‹, saß den geschlagenen Montag und lernte den ›Spiegel‹ auswendig – von hinten bis vorn, wegen des ›Hohlspiegels‹ und der ›Personalien‹. Deshalb war die Absage solch ein Schlag ins Kontor. Ich überlegte fieberhaft, was nun zu tun sei. Und, o Wunder, bald darauf rief wieder die Anzeigenabteilung an: »Wir sind im Prinzip bereit, den Text zu bringen. Allerdings ist ›Das farbige Banner der Pornographie‹ nicht zu vertreten! Sie müssen sich einen anderen Slogan einfallen lassen.« Also erschien statt des schönen Knallers die Zeile: ›Die Grenzen literarischer Freiheit …‹ Darunter stand unverändert mein ursprünglicher Text, der bei Henry Miller anfing und mit dem Bestellcoupon für die ersten beiden Titel aufhörte.
Als mich vier Monate später Maurice Girodias besuchte, um die inzwischen etablierte, erfolgreiche deutsche Olympia Press in Augenschein zu nehmen, erzählte ich ihm beiläufig, wie sie vor der Geburt fast an der Headline gestorben wäre. Er wippte eine Weile im Lounge-Chair, wackelte mit den Ohren und murmelte bedeutungsschwanger: »Das hat Rudolf Augstein entschieden.« »Wieso? Der kümmert sich doch nicht um Anzeigen!« »Oooooo«, raunte Maurice, »in meinem Falle ist das anders.« Und nun rückte er mit einer Mystifikation heraus, bei der mir dann die Ohren schlackerten. Erinnere dich an den »Das Kind gehört mir!«-Pasodoble, den Christian Schultz-Gerstein und Rudolf Augstein bei Weißwein und Budweiser tanzten. Mach dir mal klar, was solche Leute für Scheiße im Kopf haben – und so eben auch Freund Girodias. Er steckte mir nun in verschwörerischem Ton: »Das mußte er schon tun, weil ich nämlich mit seiner Frau …« Ich weiß doch nicht, mit welcher! Nein, die ihn in Italien wegen des Marihuanas verpfiffen hat, war es nicht, sondern eine der anderen. Jedenfalls behauptete Maurice, daß er der Vater eines der Augstein-Kinder sei, die Folge eines Buchmesse-Fehltritts. Und daraus zog er den aberwitzigen Schluß: Rudolf hätte aus Gründen der daraus resultierenden Quasi-Familienbande die Olympia-Press-Anzeige nicht kippen wollen. »Maurice, du spinnst! Auch wenn das Kind von dir sein sollte, du meinst doch nicht wirklich …?« »Ganz gewiß!«
Diesen Irrwitz hatte ich damals zwar Ernst Herhaus erzählt, der ihn auch treu und brav abschrieb, aber bei der Lektüre der Tonbandtranskription für ›Siegfried‹ kam er mir eben abstrus vor, und ich strich die Passage. Doch nun geht’s ja weiter: 1988, wir waren gerade dabei, unsere Zelte im Vogelsberg abzubrechen, rief Franziska Augstein in Schlechtenwegen an und erklärte, sie sei dabei, für die ›Zeit‹ ein Porträt des Verlegers Girodias zu schreiben, und befragte mich zu meinen Eindrücken aus der Zusammenarbeit mit ihm. Ich berichtete ihr etwas über die Rechtshändel um die Lizenzgebühren, und weil Maurice sich darüber lustig gemacht hatte, daß ich bei Gericht im Gewand eines Minnesängers erschienen sei, beschrieb ich ihr die Anzüge, die Geza Irwahn damals für mich nähte. Als Franziska mit ihrer Liste durch war, erwähnte ich beiläufig: »Girodias hat damals eine blödsinnige Geschichte kolportiert von einem Kind, das er angeblich mit einer Frau Ihres Vater hat …« »Ja, ja«, sagte die Augstein-Tochter, »das ist mein Bruder.« Da dämmerte mir, daß Maurice möglicherweise richtig lag, vielleicht war es tatsächlich so gelaufen, und ich verdanke Rudolf Augstein persönlich meine Karriere als ›Pornokönig‹.
Inzwischen vermute ich nicht nur, daß es so dumpf ablief, ich bin ziemlich sicher. Weil einerseits die dezentrale Struktur der Ereignisse immer zum reinen Lachen führt, während andererseits im Zentrum der ernsten Bedeutsamkeiten dieser Augstein mit seinem ›Spiegel‹ stand, der nicht nur über Politik berichtete, sondern sie machte, in dem er seine Leser zu liberalem, im Zweifelsfalle linkem Denken erzog. Von 1962 an war das so, als Konrad Adenauer sich im Deutschen Bundestag aufplusterte: »Meine Damen und Herren, wir stehen vor einem Abjrund von Landesverrat!« Woraufhin dann Rudolf Augstein in den Knast mußte, verhaftet vom später ermordeten Bundesanwalt Siegfried Buback. Und natürlich hatte Adenauer recht, es gab tatsächlich »einen Abjrund von Landesverrat«, denn der ›Spiegel‹ verriet ständig, was den Konservativen lieb und teuer war. Deshalb mußten sie es ihm heimzahlen, schickten Franz Josef Strauß vor, der sich seinerseits für den ›Onkel Aloys‹ und die ›Dr.-Deeg-Affäre‹ rächen wollte. Mit Hilfe seines ehemaligen Schongauer Spezls Achim Oster, der inzwischen Militärattaché in Spanien war, ließ er den Redakteur Conrad Ahlers während seines Urlaubs in Torremolinos festnehmen. Danach stellte Strauß sich im Deutschen Bundestag hin und schwor: »Es ist kein Racheakt meinerseits! Ich habe mit der Sache im wahrsten Sinne des Wortes nichts zu tun.« In den folgenden Tagen verfing er sich immer mehr in seinem Lügengewebe; er log halt, wenn er das Maul aufmachte. Damit kam er ausnahmsweise mal nicht durch, schließlich war ja Rudolf Augstein nicht umsonst Mitglied der F.D.P., die drohte mit dem Austritt aus der Koalition, erzwang den Rücktritt von Strauß als Verteidigungsminister. Von nun an bestimmte Augstein die Politik mit. Und weil das so ist, interessiert mich diese phänotypische Figur, ganz speziell aber deren sonderbare Anmischung aus zeitgeschichtlicher Bedeutung und Schürzenjäger. Denn als Mensch aus Fleisch und Blut habe ich ihn ja nie erlebt, sondern nur als Geist des Igels, der immer schon vor mir dagewesen war. Natürlich in persona, er war doch sehr lebendig! Der Typ regierte nicht nur wie ein absolutistischer Fürst in seinem ›Spiegel‹-Haus, sondern hatte auch schon die Frau, in die ich mich damals verliebte, in ›Cöllns Austernkeller‹ befummelt. Wenn ich Petra Nettelbeck dann in Luhmühlen besuchte, schmetterte er in ihr Telefon: »Na, ist dein Stecher wieder da?«
Fortsetung folgt
(BK / JS)




Nach 35 Jahren stolperte ich wieder mal über Schröder. So lange wird es nicht mehr dauern bis zum nächsten stolpern