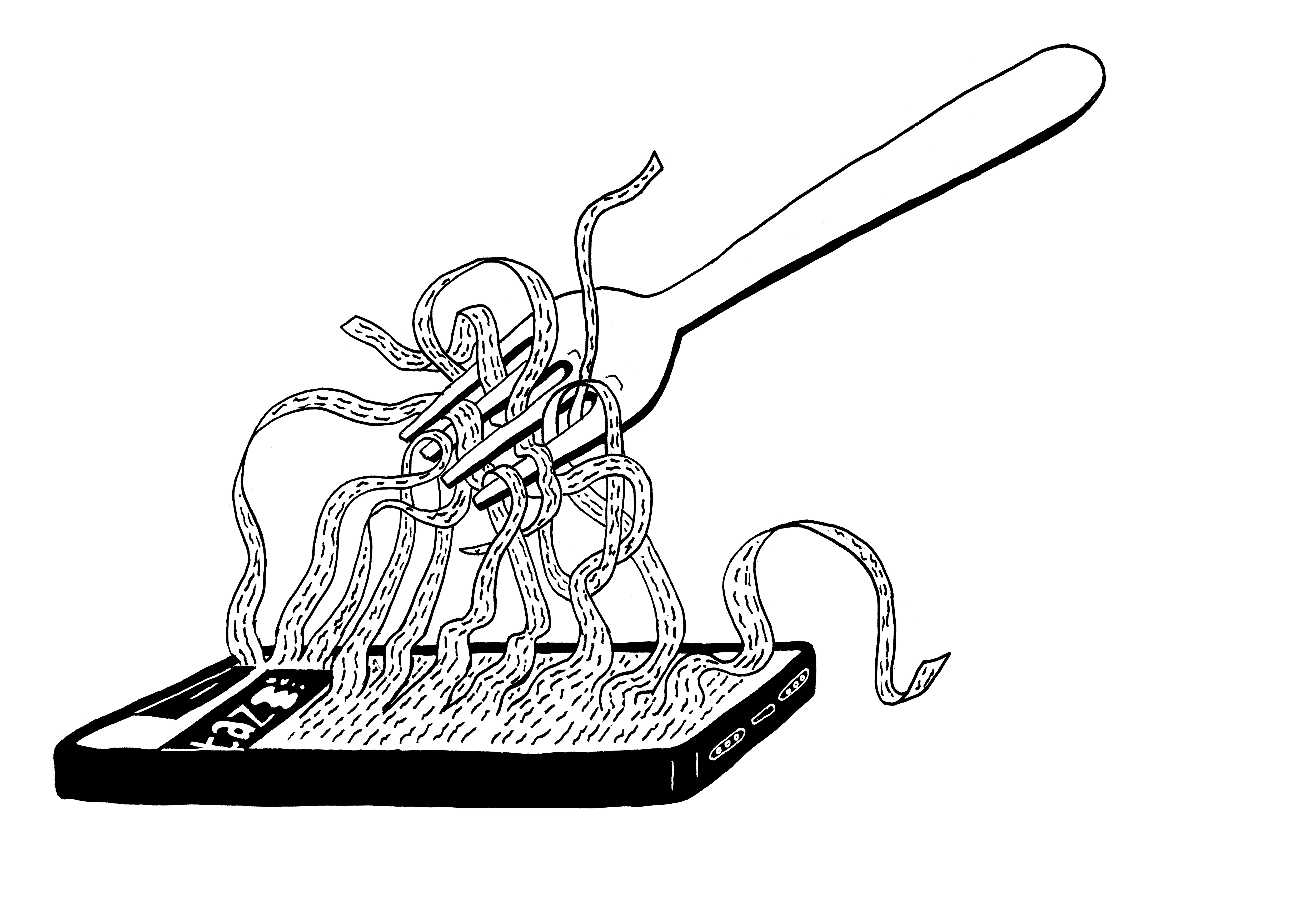Der Bär flattert in östlicher Richtung.
Am 4. November 2004 starb im Alter von 45 Jahren unsere Freundin Tine Plesch an einem septischen Schock. Tine war seit der im Jahr 2000 erschienenen ›Gender‹-Ausgabe Mitherausgeberin der Buchreihe ›Testcard‹ und arbeitete als Journalistin für das unabhängige Radio Z.
Aus diesem Anlaß bringen wir heute einen Aufsatz von Tobias Lindemann und Tine Plesch
»QUEENS UND DIVAS Rhythm´n´Blues zwischen, Kollektivtraditionen, Individualitätsmythen und Geschlechterpolitiken«
aus testcard # 13: „Black Music“, Mainz 2004
HERSTORY I
1996 hat sich Georg Stamelos in einem Artikel in der Frankfurter Rundschau (28.10.1996, S.6) mit der Gewalt in der HipHop-Szene der USA befasst. Gegen Ende des Artikels schrieb er von einem Konzert der FUGEES, in Harlem, das ein „Zeichen der Versöhnung setzen“ sollte. Als jedoch Lauryn Hill zu John Lennons Imagine rappte „Stellt euch vor, es gibt keine nachgemachten Gangsta-Rapper mehr die so tun als wären sie Al Capone,“ begannen einige Leute vor der Bühne Hill zu beschimpfen, es gab Unruhe, es fielen sogar Schüsse und im Publikum brach Panik aus. Stamelos kommentiert in seinem Abschlussabschnitt:
„Die Folge: 13 Schwerverletzte. Und die Gewißheit, dass Rapperinnen wie Lauryn Hill, McLyte oder Queen Latifah ein offenes Wort gegen Chauvinismus und falsch verstandene Hood-Attitüden durchs Mikro jagen müssen, um die nächste Generation der Ghetto-Kids zum Denken zu bewegen.“
Welches Frauenbild wird hier transportiert, welche Rolle den Frauen zugewiesen? Einmal mehr sollen sie die Friedfertigen, die Erzieherinnen sein, die Mütter, die die unartigen Jungs zur Räson bringen. Die sich, q.e.d., ja gar nicht um solche Botschaften scheren. Dieses eher bürgerlich konventionelle Frauenbild entspricht überdies auch gar nicht der historischen Wahrheit über die Arbeit afroamerikanischer Künstlerinnen – denn da finden sich auch Belege für die Historizität zum Beispiel des Kelis´schen Wutausbruchs gegen ihren ungetreuen Lover in Caught Out There:
„I hate you so much right now …
so sick of your games
I´ll set your truck to flames and watch it blow up …“
Rückblende: Blues und Feminismus
Had a man in black mountain, sweetest man in town
Had a man in black mountain, the sweetest man in town
He met a city gal, and he throwed me down
I´m bound für Black Mountain, me and my razor and my gun
Lord, I´m bound für Black Mountain, me and my razor and my gun
I´m gonna shoot him if he stands still, and cut him if he run.
[Bessie Smith. Black Mountain Blues. Zit nach Angela Davis, Blues Legacies and Black Feminism, S.34]
Bestimmte Bilder/Inszenierungen haben Tradition: Auch Bluessängerinnen wie Ma Rainey, Bessie Smith und Billy Holiday traten glamourös und elegant gekleidet auf. Liebe, aber auch Sexualität gehörten durchaus zu ihren Themen und wenn frau denn schon verlassen wurde, dann blieb sie nicht heulend sitzen, sondern suchte sich jemand neues oder – siehe oben – rächte sich. Angela Davis stellte in Blues Legacies and Black Feminism fest, daß durch die Texte der Bluessängerinnen feministische Haltungen schimmerten, unter dem patriarchalen Diskurs hindurch, in dem die Texte entstanden und gesungen wurden. Dies gilt auch für etliche spätere Blues-, R&B- oder Soulstücke. Obwohl die Forschung über schwarzen Feminismus sich oft auf Literatur konzentriert [1] und die eigenen Traditionen der armen Frauen und der Arbeiterinnen ausser acht läßt, hatten auch diese Frauen Zugang zur Veröffentlichung – nämlich gesprochener und gesungener Texte. Frauen waren in den 1920er Jahren für Schallplattenaufnahmen sehr begehrt, da sie sehr erfolgreich waren. Das änderte sich in den 1930ern mit dem Auftauchen des Countryblues, der Männer in den Mittelpunkt stellte. Die Musik von Bessie Smith, Ma Rainey, und Billie Holiday aber, so Davis, sei ein reiches kulturelles Erbe und ein ergiebiges Terrain, um historisches feministisches Bewusstsein zu untersuchen, das das Leben der ArbeiterInnencommunities reflektierte.
Da waren z.B. die Texte, eigenwillig und widersprüchlich, in ihrer Art „seemingly antagonistic realtionships as noncontradictory oppositions“ (Davis, xv) darzustellen. Die Sängerin zeigte sich als gehorsam männlichem Begehren gegenüber, drückte aber durchaus auch eigenes Begehren aus und die Weigerung, sich physisch wie psychisch fertigmachen zu lassen. [2] Die Widersprüche in den Texten, die Davis für jene Zeit konstatiert, finden sich – anders ausgedrückt bzw. mit thematischen Verschiebungen – auch in Songs von Jill Scott oder Meshell Ndegéocello; ebenso wie durch das Auftreten und die Lyrics von Künstlerinnen zwischen Millie Jackson (It´s All Over But The Shouting), Gwen Guthrie (Ain´t Nothing Going On But The Rent), Li´l Kim oder auch Missy Elliott sehr wohl die zeitgenössischen ökonomischen und patriarchalen Verhältnisse durchscheinen.
Feminismus ist, so Angela Davis, seit langer Zeit auch eine Angelegenheit schwarzer Frauen – auch wenn alle Diskussionen seit dem Feminismus der 60/70er trotz anderslautender Forschungsergebnisse dazu tendieren, Feminsmus als weiß zu sehen, auch um den Preis von Differenzdiskussionen, die den Feminismus bis zur Unkenntlichkeit zerfaserten. „The tendency to construct women like Anita Hill as race traitors is a dramatic by-product of the recalcitrant idea that black women who speak out against black men are following in the footsteps of white feminists. The fact, that a productive debate about the problematic gender politics (and indeed the overarching conservatism) of the Million Men March failed to emerge and that feminists … were harshly criticized for even desiring to initiate such a debate are yet further examples of widespread views in black communities that race must always take precedence and that race is implicitly gendered as male.“ (Davis, xix)
Sexualität und Zensur
Auch Gewalt in Beziehungen wurde von den Bluessängerinnen thematisiert, zuweilen in sarkastischer Performance, die jeder Möglichkeit eines masochistischen Einverständnisses Hohn sprach. Anders sah und sieht es immer mit Themen wie Vergewaltigung und Missbrauch aus, mit der Vergewaltigung schwarzer Frauen durch schwarze Männer, mit Vergewaltigung in Beziehungen und sexuellem Mißbrauch in Familien. The Story of Beauty (Survivor) von DESTINY´S CHILD thematisiert Mißbrauch durch den Stiefvater – der Text betont zwar, daß die Übergriffe des Stiefvaters nicht Beautys Fehler seien, empfiehlt allerdings vor allem „strength and prayer“ als Hilfe). Sexismus bleibt ein schwieriges Thema, nicht nur wenn es um Anita Hill oder den Million Men March geht. Tricia Rose weist am Besipiel der 2 LIVE CREW darauf hin, wie schwierig es für schwarze Frauen ist sich zu äussern – nicht nur, weil ihnen Verrat vorgeworfen wird, sondern weil ihre Äusserungen in einen – zudem von Medien beherrschten – Diskurs der Machtverhältnisse gestellt werden, der nahelegt, daß Frauen und Männer unter Einsatz der plumpsten Klischees (Mann = Sexist, Frau = Feministin/Erzieherin) gegeneinander ausgespielt werden, daß die Frauen nicht ernstgenommen werden, sondern benutzt werden, um den Männern zu schaden. Die (weiß dominierte) Gesellschaft hat Interesse dran, einmal mehr zu beweisen, dass schwarze Männer hypersexualisierte Vergewaltiger und dumme Sexisten sind. Um ein besseres Verhältnis zwischen Männern und Frauen oder eine weniger sexistische Gesellschaft geht es keineswegs. Andererseits werden Texte wie DE LA SOULS Millie Pulled a Pistol on Santa, die von Missbrauch handeln oder Date Rape in dem A TRIBE CALLED QUEST die Partei jener Frauen ergreifen, die allzugerne als willige Opfer denunziert werden, kaum diskutiert. Das gilt aber auch für die Zensur von TLC und Ain´t 2 Proud 2 Beg – einem Text, der frech das Recht von Frauen auf Sexualität einfordert und ironisch die üblichen sexuellen Besitzverhältnisse am Beispiel des Penis, der, egal ob 6 oder 60 Zentimeter, ihr gehört, auf den Kopf stellt. Dazu trugen TLC noch witzige, übergroße Klamotten, an denen Kondome in verschiedener Grösse befestigt waren. Für MTV musste der Text geändert werden und aus der „bekannt derben TV-Sendung In Living Color [3] wurden TLC ausgeladen. Ain´t 2 Proud 2 Beg wurde nicht etwa als Song gefeiert, der jungen schwarzen Frauen vorbildhaft einen anderen Umgang mit Sexualität vermitteln könnte, sondern – Kondome hin oder her – als „Aufruf zur sexuellen Verantwortungslosigkeit“, als Hymne zukünftiger Teenagemütter. [4]
Ein anderes Beispiel ist Your Revolution (Will Not Happen Between These Tighs) von Sarah Jones – eine Version von Gil Scott-Herons Your Revolution. Sarah Jones benennt und kritisiert all die sexistischen Inhalte von vor allem Raptexten und Videos, mit denen jede Menge Geld verdient wird: „Your revolution will not be you smacking it up, flipping it or rubbing it down, nor will it take you downtown or humping around….“ Darüberhinaus impliziert sie, daß sich so Verhältnisse nur bestätigen, aber nicht ändern – ergreift also auch gegen jene Partei, die einfach bloss durch Reichtum und dessen äußere Zeichen „dazugehören“ wollen. [5]
Im Gegensatz zu anderen Songs von u.a. Madonna oder Eminem, wurde den Radiostationen hier nicht die Möglichkeit geboten, fragliche Stellen mit Zensurtönen auszublenden. Die Radiostation KBOO wurde von der us-amerikanischen Zensurbehörde FCC mit einer Strafe von $ 7000 belegt. Daß Jones in ihrem Stück genau jene Texte und Videos angreift, die z.B. wie Sisquos Thong Song aus demselben Jahr nahezu nackte Frauen zeigen und in Heavy Rotation laufen, hat die Behörde wenig interessiert. Im Gegenteil wurde ihr vorgeworfen, sie sei „sexually pandering and intending to shock.“ Für Jones bedeutet das einen Angriff auf ihre Freiheit als Person, als Frau, und als schwarze Frau, ihre Meinung zu sagen und sich zu verteidigen. Ob es die Lage da verbessert, daß die renommierte Zeitschrift Wire ein Portrait von Sarah Jones mit den folgenden Worten beginnt, möchte ich dahingestellt lassen. „In the fight against the Majesticans more and more sexy feminine revolutionaries join the Infesticon forces, trying to rid the 21st century hiphop culture of the dangerous evils of money greed and power thriving. Superniggasoulsisters with luscious lips, pneumatic tits, shaking hips and voices that drip, move up in the revolutionary ranks, speaking up on issues that have been kept silent for too long.“ [6]
Das Problem ist, dass Rap leider nur allzu oft als letzte Zuflucht echter Männlichkeit begriffen und dargestellt wird. Roxanne Shantés Diktum „Rap is co-ed now“ (Rose, 154) hat da wenig geholfen. Rap sei letztlich ein Jungsding, sagte der afroamerikanische Musikhistoriker und Journalist Nelson George 2003 bei einer Lesung im Nürnberger K 4. George, so stellt Tricia Rose fest, sieht Rap nicht nur als Männersache, weswegen in seinen Aufzählungen keine Rapperinnen vorkommen, sondern kleidet auch berechtigte Ängste vor dem Ausverkauf einer Kultur, die er als gleichsam authentisch sieht, an eine gesichtslose Kommerzindustrie in mehr als seltsame, gendergefärbte Argumente – denn wenn der Rap sich zu sehr von seinen Strassenursprüngen entferne und sich immer mehr in die Welt der Konzernkonglomerate begibt, dann drohe die kulturelle Kastration. „For George, corporate meddling not only dilutes cultural forms, but it also reduces strapping, testosterone-packed men into women.“ (Rose, 152) Hier wird deutlich, so Rose, wie dringlich es notwendig wäre, die Konstruktion schwarzer, männlicher Heteorsexualität zu analysieren. Das täte sicherlich, auch das erwähnt Rose, den Texte von Frauen gut, die wie SALT´N´PEPA in Independent leider auch mal danebenlangen und Männlichkeit mit „ökonomischen Privilegien“ gleichsetzen und die das, was sie dann am gerade vorhandenen Partner auszusetzen haben, in Worte fassen, mit denen sie auch Schwule beschimpfen würden. Das eine wie all das andere ist unerträglich, schreibt es doch repressive Standards heterosexueller Männlichkeit fort und verhindert eine allzu feministische Lesart der entsprechenden Texte.
Wem das nun als argumentative Grundlage arg mäandernd und womöglich allzuweit hergeholt erscheint, sollte sich daran erinnern, dass sich R&B aus Blues, Gospel und Soul entwickelt hat und vor allem, daß R&B eigentlich eine rassistische Kategorie von Medien und Musikindustrie war, die die Segregation eben auch in schwarzen und weißen Hitparaden forgeschrieben hat. Der Hintergrund aber, vor dem sich die Identität, die Sexualität, die Körperbilder schwarzer Frauen ausgebildet haben, wirkt bis in die Charts dieser Tage hinein, was die Texte wie die Musik anbelangt. Angesichts der vorherrschenden Definition von Rap als Männerkiste erscheint R&B als gleichsam traditionell weiblicher Bereich, in dem Künstlerinnen erstmal leichter klarkommen, da sie einfach auch Vorbilder haben. Zum anderen wundern auch die grob materialistischen „pussy sells“-Texte nicht, die sich in Rap wie R&B finden, wenn sie deshalb auch nicht gefallen müssen. Da (populäre) Musik nicht mehr puristisch ist, und Zusammenarbeiten unter KünstlerInnen äußerst beliebt, gibt es auf verschiedenen Ebenen Überschneidungen zwischen Rap und R&B. Schon Queen Latifah, eine der ersten Rapperinnen, die bekannt wurden, hat selbst gesungen, während sich Erykah Badu auf ihrer jüngsten CD Worldwide Underground für das Stück Love of my Life Worldwide als Gäste und Co-Autorinnen Angie Stone, Bahamadia und – Queen Latifah eingeladen hat. Wie Angela Davis vertritt auch Tricia Rose die Ansicht, daß Musik ein geeigneter Ort ist, um das kollektive Bewusstsein der AfroamerikanerInnen und vor allem das musikalische Erbe der Frauen zu (unter)suchen. Musik, Politik und Identitätsbildung/Identitätskonstruktion hängen so gesehen zusammen. Als wichtige Themen des Rap nennt Rose „heterosexual courtship, importance of the female voice und black female displays of physical and sexual freedom“ (147). Diese Themen werden auf zwei Arten kontextualisiert – einmal im Dialog mit den sexistischen Diskursen männlicher Rapper, zum anderen im Dialog mit größeren sozialen Diskursen, Feminismus inklusive. Diese Themen, vor allem Liebe, Beziehungsgestaltung, Unabhängigkeit – auch materielle, ökonomische Unabhängigkeit – sind Rap und R&B gemeinsam.
Das Verhältnis zum eigenen Körper und zu Sexualität soll selbstbestimmt sein, was Frau zeigt, dient ihrem Spass und nicht unbedingt unmittelbar männlichem Vergnügen. In der von Rassismus geprägten Wahrnehmung erscheinen schwarze Männer- wie Frauenkörper als mindestens exotisch und – ein berühmtes Beispiel ist Josephine Baker – attraktiv und werden gleichzeitig als hypersexuell und damit pervers und sündig abgewertet. Im Hinblick auf die derzeit mediale Allgegenwart nackter Frauenkörper sieht es nicht weniger kompliziert aus. Denn sicher ist nicht jeder nackte Bauchnabel ein Zeugnis von sexueller Selbstbestimmung, sondern nachgerade ein modisches Muß. Was den einen als sexuelle Freiheit oder Selbstermächtigung erscheint, lesen die anderen als Selbstausbeutung. Ob der Betrachter/die Betrachterin immer unterscheiden kann, ob der Körper einer schwarzen Frauen verdinglicht bzw. als männlicher Besitz dargestellt wird oder Frauen sich selbst als Subjekte darstellen, die Spass haben oder ihre erotischen Möglichkeiten erproben wollen, bleibt offen. Tricia Rose meint jedenfalls: „In much of the video weork by female rappers, black women´s bodies are centered, possessed by women, and are explicitly sexual“(168). Dennoch, auch dies schreibt Rose, besteht immer die Gefahr der Ausbeutung und Selbstausbeutung, gerade für jene Frauen, die in den Videos als Statistinnen mitspielen. Sie werden von Regisseuren als austauschbar betrachtet, sind Objekte männlicher Projektionen – von Anerkennung oder Gleichheit keine Spur. Die Musikerinnen, Rapperinnen, Sängerinnen wollen als Künstlerinnen ernstgenommen werden, müssen aber in dieser sexistischen Welt der Musikproduktion arbeiten.
Rezeption
1997 überlegte Diedrich Diederichsen, wie es kam, daß die Spex-Community, die bislang eher dem Abstrakten in der Musik in seinen diversen Ausformungen gehuldigt hatte, auf einmal schwarze, amerikanische Frauen, die in weitestem Sinne dem Genre R&B zuzurechnen waren, nicht nur artikelwürdig, sondern sogar richtig gut fand. Was machte die Musik von Erykah Badu, Mary J. Blige, Janet Jackson und Missy Elliott so faszinierend? Sicher nicht die „minoritäre Subjektposition“ (passé), auch kein einheitliches identitätpolitisches Anliegen (out) – nein, Diederichsen betont die Unterschiede zwischen verschiedenen Künstlerinnen, die immer noch alle im weitesten Sinne dem Genre R&B zuzuordnen sind. Janet Jackosn (hochkodierte Symbolpolitik) habe wenig zu tun mit Li´l kims (bratzig, direkt), Erykah Badu (verquaste-brillanter Afrozentrismusadaption) nicht gemein mit Missy Elliott (HipHop-Soulversion des Stax Modells). Klar ist das erstmal prima, daß Diederichsen nicht alle in eine Schublade packt. Er kommt zum Schluß, daß Badu, Blige, Jackson und Missy Elliott Individualismus gemeinsam haben – und zwar einen, der „mehr einer alteuropäischen bürgerlichen Tradition geschuldet ist“ – und so führen sie gegen machistischen dumpfen Hiphop und gegen „hyperspezialisierte und anonymisierte Post-Technokuluren…die Möglichkeit des individuell begründeten Einwands symbolisch wieder ein.“ In Gestalt des Songs übrigens – auf dessen Inhalte DD leider nicht eingeht. Vielleicht erschien das 1997 tatsächlich als Möglichkeit – heute, wo Missy Elliott nicht nur – aber natürlich nur aus gesundheitlichen Gründen – abgenommen hat, sondern sich auf dem Backcover ihrer aktuellen CD This Is not A Test auch mit Kampfhunden zeigt, kann ich der schönen Idee auch nur der Möglichkeit des puren Individualismus in einem so übercodierten Genre wie gerade R&B nicht mehr zustimmen.
Ich denke vielmehr, dass es gewisse Traditionen (Körperbilder, Sexualität, Erfahrung von Rassismus und Sexsmus) gibt, denen sich die Künstlerinnen nicht entziehen können und es gibt Traditionen – die sich vorsichtig dem Black Feminism von Angela Davis zuordnen ließen oder dem „Womanism“[7], denen sich die Künstlerinnen gar nicht entziehen wollen. Schlußendlich gibt es dann noch die Musikindustrie, der frau, so sie denn Geld verdienen will, gar nicht recht entkommen kann. Relativ individualistische Künstlerinnen wie Meshell Ndegeocello werden erfahrungsgemäß weitaus weniger beachtet als Alicia Keys.
Einige in letzter Zeit veröffentlichte Sampler widmen sich den Aufnahmen von Soulmusikerinnen auf, sind also rezeptionsgeschichtlich, aber vor allem natürlich musikalisch hochinteressant. Das trifft – wenn auch in anderem Sinne – für Sampler zu, die fast alles aktualitätsbewusst als Nu Soul verkaufen und jede Sängerin zur Diva erklären.
Die Samplerreihe I´m a Good Woman – Funk Classics from Sassy Soul Sisters, von James Maycock gut, sachlich und aus Frauensicht dokumentiert, stellt auf drei Alben (erschienen zwischen 2000 und 2002) bekannte und dankenswerterweise auch weniger bekannte Künstlerinnen in den Mittelpunkt, die in den 1970ern veröffentlicht haben. Dies vermittelt einen Eindruck von der Bandbreite der Ausdrucksmöglichkeiten in durchweg mitreißenden Songs, in Produktionen, die eigenwillig und selbstbewusst klingen, in denen Frauen agieren, ihre Wünsche äussern, ihre Erfahrungen erzählen – frech, fordernd, laut und meist uptempo – und damit konsistent mit einer Zeit, in der sexuelle Freiheit als Allgemeingut zu gelten beginnt und als Statement gegen jene Männer, die glaubten, die Freiheiten gälten nur für sie.
Antwortsongs sind keinesfalls erst eine Neuerscheinung im Rap, sondern waren vorher schon beliebt – wie Mama´s Got Her Bag of Her Own, mit dem Anna King, die zuvor bei James Brown gesungen hatte, ebenjenem und seinem Ich-bin-der Coolste-auf-der Tanzfläche-Song Papa´s Got A Brand New Bag eines auswischte. Die große Betty Davis bringt in ihren Songs mehr Sex rüber als vermutlich der testosteronstärkste Rapper ertragen könnte und wischt jedes Argument beiseite, das geringste Zweifel an der kreativen wie sexuellen Selbstbestimmung schwarzer Frauen beinhalten könnte. Zeitgleich mit I´m A Good Woman erschien ein weiterer Sampler mit Soulsängerinnen aus den 60ern und 70ern, Sister Funk, doch nach dem Lesen des Booklets beschränkt sich die Freude allein auf die Musik, die ja nichts für den machistischen Unsinn kann, der da im Jahr 2000 immer noch verfasst wurde – auch wenn (oder gerade weil) der Sampler von Ian Wright, einem Londoner Rare-Groove-Idol, zusammengestellt wurde: „Introducing Sister Funk, or as we like to all it, Ian Wright´s ‚Harem’“ heißt es da und auch im folgenden wird klar gemacht, wer das musikalische Genie ist – nicht die Musikerinnen, sondern der DJ und Plattensammler, der hier quasi als verspäteter Entdecker fungiert. Ebenso traurig wie diese Linernotes bleibt die Tatsache, daß Künstlerinnen wie eben Betty Davis, Marva Whitney, Lyn Collins, Ann Sexton oder Mary Queenie“ Lyons sich nicht dem allgemeinen Soulgedächtnis fest eingeschrieben haben.
Schon Diana Ross hatte mit und dann auch ohne SUPREMES gemäß der Vision des Motown-Chefs Berry Gordy das Spektrum des Publikums für die sogenannte schwarze Musik erweitert. Nicht nur schwarze HörerInnen und weisse Teenager sollten die Musik hören und kaufen, sondern die erwachsenen, reichen Leute, die bessere Gesellschaft der Weißen. Das ist nicht unbedingt nur als Ausverkauf, Anpassung und Selbstaufgabe zu werten. Diane Cardwell sieht eine subversive Strategie am Werk: „For the first time, instead of a white artist putting an acceptable face on a black sound here was a black artist creating a unique synthesis of pop and black sensibilities – and, in some ways, outwhiting whitey“ (118). Diana Ross sei die Vorläuferin von Whitney Houston oder Mariah Carey, schließt Cardwell.
Die Vermischungen der Bilderangebote bleiben, nur gehen sie noch seltsamere Wege. Wurde das Publikum jahrelang glauben gemacht, daß Mariah Carey weiß sei, so versammelt ein Sampler unter einem Titel, den schwarze R&B-Sängerinnen und Rapperinnen als Statement von Selbstbewußtsein eigentlich für sich requiriert hatten – nämlich dem der Diva – weisse und schwarze Künstlerinnen, die sich alle irgendwie in das sehr modisch gewordene Genre R&B passen lassen – wenn es denn die Vermartkungsstrategie will. Mit der Musik muss das ja nicht notwendig viel zu tun haben bzw. die Musik ordnet sich dem Image unter, das verkauft werden soll – nämlich die irgendwie schon sexy selbstbewusste, aber doch feminine Frau. Neben Erykah Badu, Angie Stone, Brandy oder Mary J. Blige, neben Alicia Keys oder TLC – musikalisch unzweifelhalft dem R&B zuzurechnen, finden sich aber auch Pink (die anderweitig gern als Punk fürs 21.Jahrhundert gilt), Jennifer Lopez, die unvermeidlichen Christina Aguilera und Britney Spears, aber auch LeAnn Rimes. Bezeichnend erscheint es schon, wenn eine als Countrysängerin bekannte Künstlerin im allerweitesten Sinne unter R&B subsumiert wird – auch dies lässt sich natürlich mit leicht hämischem Grinsen als „outwhiting whitey“ goutieren, genauso wie die Tatsache, daß Musik R&B-kompatibel sein muß, um chartstauglich zu sein. Trotzdem bleibt der Spass begrenzt, denn auf Nu´ Divas verschwimmen die Genregrenzen munter in einer Art Soundtrack, der nun leider gar keine Reibungsflächen oder identifikatorischen Elemente mehr bietet, kaum Individualität zuläßt und schon gar keine Experimente, sondern sich an den Rhythmus der Großraumdisko und an den Sound der alltäglichen TV- und Radioberieselung angepaßt hat, ein Musikteppich, in dem die wenigen guten Songs, die tollen Stimmen von Erykah Badu oder Angie Stone nahezu untergehen. Künstlerinnen, die sich auch durch Innovation bei der Produktion auszeichnen – oder sich nicht strikt nach dem obengenannten Frauenbild definieren wie Aaliyah, Kelis oder Missy Elliot sind auf Nu´ Divas bezeichnenderweise nicht vertreten.
Musik – machen und machen lassen
Traditionell sind Soul und R’n’B (wie auch Jazz und Blues) Musiken, in denen „Songwriting“ an sich einen anderen Stellenwert hat. Es geht nicht in erster Linie darum, den besten Song zu schreiben, sondern durch Interpretation ein Stück Musik mit möglichst viel individuellem Ausdruck neu entstehen zu lassen, sei es nun ein Standard oder eine Eigenkomposition. Den konservativen Maßstab, nur, wer selbst seine Lieder schreibt, sei auch ein guter Musiker bzw. eine gute Musikerin, braucht mensch hier also erst gar nicht anzulegen. Um es positiver auszudrücken: vielleicht hatten Soul und R’n’B längst das AutorInnensubjekt als solches abgeschafft oder zumindest relativiert, bevor andere Stilrichtungen (Techno, Free Jazz) sich dies erst auf die Fahnen geschrieben haben. Eine kleinteiliges Ausklamüsern, wer denn nun selbst seine Songs schreibt und dadurch eine respektable Künstlerin ist, bleibt daher im Rahmen dieses Artikels ausgespart, zumal das musikalische Zitat spätestens durch das Sampeln im HipHop gang und gäbe ist. Wichtiger ist es, Produktionsweisen und Managemententscheidungen zu durchleuchten und hier die Rolle der selbstbestimmten Künstlerin zu analysieren.
R’n’B in seiner heutigen Form ist eine Musik, die in großen Teilen elektronisch produziert wird und am Computer entsteht. Als Mary J. Blige Anfang der 90er Jahre auftauchte und mit ihren über HipHop-Instrumentals gesungenen Gesangslinien die musikalischen Standards im Soul endgültig durcheinanderwarf (vorher hatten Produzenten wie Terry Riley sowie Jam & Lewis bereits Neuland betreten), entstand ein neues musikalisches Profil, das für die meisten Solokünstlerinnen und für fast alle Girlgroups immer noch Bestand hat. Selbst im sogenannten „NeoSoul“ (Erykah Badu, Jill Scott, india.arie – zu ihnen später mehr), wo sich eine Renaissance organischer Klänge mit Rückgriff auf Liveinstrumentierungen etabliert hat, bilden gesamplete Breakbeats und Sequencerspuren die Basis. Die Produktionsmittel sind also auch hier zugänglicher geworden, ein großes Studio nicht mehr die Voraussetzung für eine gelungene Produktion und selbst die Arbeit einer Einzelperson am mobilen Laptop denkbar. Entsprechend ergreift eine steigende Anzahl von Frauen selbst die Initiative, produziert Platten auf eigene Faust (Lauryn Hill) oder bildet zusammen mit Kolleginnen und Kollegen Produktionsteams (Erykah Badu und Freakquency, Missy Elliott und Timbaland, Angie Stone). Der Grad an Kontrollmöglichkeit über das musikalische Ergebnis steigt, die Selbstbehauptung vor den Reglements des Managements nimmt zu – entsprechend werden die vermeintlichen musikalischen Grenzen des Genres deutlich überschritten (Missy Elliott), aber auch gegen die Gesetze des Marktes kaum verkäufliche, sehr persönliche Platten veröffentlicht (Lauryn Hills Unplugged-Doppel-CD). Wie genau die Rolle der „Produzentin“ nun zu verstehen ist, bleibt in manchen Fällen schleierhaft, da z. B. Missy Elliott in frühen Interviews keine Probleme damit hatte, zuzugeben, daß ihr die eigentliche Produktion am Computer nicht vertraut ist, sie aber „viel an den Arrangements mitgearbeitet“ habe (Interview mit Torsten Schmidt in: SPEX 12/97). In den meisten Fällen entstehen hier wohl synergetische Joint Ventures, bei denen es frau um eines geht: Einfluss geltend machen, ohne sich auf den kompletten technischen Apparat der Produktion einzulassen.
Wie emanzipiert das nun ist, bleibt fraglich, aber das komplett selbstproduzierte (Indie-) Autorenalbum – also das autark eingespielte, authentische künstlerische Statement – ist auch im „männlichen“ Soul eher selten anzutreffen (früher Stevie Wonder, heute vielleicht Cody Chestnutt). Diese Meßlatte ist daher zu hoch angelegt. Interessant bleibt aber, welches Identifikationsmuster hier für Indie- und Elektronik-Musikerinnen der weißen Mittelklasse ‚rausspringt. Le Tigres Kathleen Hanna gibt gerne den als Sexisten bekannten, ominpräsenten Dr. Dre als ihr „Role Model“ an, („I love the way he makes beats sound“, in: THE WIRE 215), Künstlerinnen wie LAUB-Sängerin Antje Greye Fuchs alias agf oder Elena Lange von der Hamburger Band STELLA nennen die Musik von Aaliyah und DESTINY´S CHILD als eine ihre Hauptinspirationsquellen. Musik also, die im entferntesten subversiv ist, als Vorbild für Künstlerinnen, die sich – wie im Falle von Hanna und Lange – als explizit politisch und feministisch verstehen. Die Attraktivität liegt in einem Wissen über die Machbarkeit dieser Musik als Einzelperson (Produktion am Computer), gekoppelt mit einem für die Verhältnisse des Mainstreams großen Angebot an nutzbarer Oberfläche und musikalischer Freiheit. Die rumpelnden Beats von Brandys What About Us, die zerhäckselten Gitarren in DESTINY´S CHILDS So Good, die minimalistisch-bildhaften Texte und optisch umwerfenden Videoumsetzungen dazu bei Missy Elliott – wo, bitteschön, wird sowas sonst geboten? (Die Feststellung, daß selbst Independent-Drum’n’Bass- und -Electronica-Produktionen im Verhältnis zu dem, was in den R’n’B-Charts passiert, eher konservativ klingen, wurde in den letzten Jahren zu Recht zum Allgemeinplatz in der Popmusikjournaille.) Selbst wenn – wie schon erwähnt – das Versprechen des puren Individualismus sich hier auch nicht einlösen läßt: wo läßt sich für freidenkende Musikerinnen, die songorientiert arbeiten wollen, so leicht andocken und weiterformulieren? Zumal als optische Oberfläche dazu starke, selbstbewußte SISTERS angeboten werden – was für ein Gegensatz zum inhaltsarmen Photoshop-Overkill und den geheimbündlerischen Männercliquen der Elektroniklabels von Mille Plateaux bis Warp!
HERSTORY 3 (Bonus Track)
Die musikästhetische Revolution, die mit den veränderten Produktionsmethoden einherging, war interessanterweise nicht erst in den 90er Jahren mit weiblichen Künstlerinnen (Missy Elliott, Mary J. Blige) verbunden. Bereits 1986 ließ Janet Jackson mit der High-Tech-Produktion ihres Control-Albums eine Vision von R’n’B als „Zukunftsmusik“ aufblitzen – während männliche Kollegen noch Jahre brauchten (Bobby Brown) oder im Schmusesound versanken (so ziemich alle von Luther Vandross bis Johnny Gill). Ihre Produzenten, die Ex-THE TIME-Musiker Jam & Lewis, bauten um ihre Stimme herum Arrangements aus aggressiven Electro-Sounds und tief pumpenden Basslines. Futurismus war schon immer ein Thema afroamerikanischer Musik – von Sun Ra bis PARLIAMENT – hier fand er seine zeitgemäße und darüber hinaus kommerziell verwertbare Fortsetzung. Control wäre außerdem nicht zu der innovativen Blaupause für heutigen R’n’B geworden, wenn Janet Jackson nicht zur Promotion der ausgekoppelten Singles intensivst das sich gerade etablierende Medium des Musikvideos genutzt hätte. Die sich synchron zu den Stakkato-Beats von What have you done for me lately oder Nasty bewegenden, streng choreografierten TänzerInnen-Scharen in futuristischen Kulissen gehören heute noch zum Standardrepertoire fast jedes Black Music Videos, wenn auch in sich ständig wandelnder Form. Sowohl musikalisch, als auch textlich war eine Brücke zu HipHopperinnen wie Roxanne Shante oder SALT’N’PEPA geschlagen, schließlich war ein Text wie in What Have You Done For Me Lately an Selbstbewußtsein kaum zu überbieten. Diesen Faden sollte kurze Zeit später die junge New Yorker Rapperin Queen Latifah aufnehmen, die nicht nur selbstbewußt-feministisch auftrat (Ladies First zusammen mit Monie Love), sondern mit selbst gesungenen Hooklines (immer noch eher untypisch im Rap) den Brückenschlag zum HipHop-Soul von Mary J. Blige vorwegnahm.
Back to the roots?
Seit Mitte der 90er Jahre gibt es zu den chartsdominierenden R’n’B-Produktionen à la Aaliyah/DESTINY´S CHILD eine Alternative in Form des traditionsbewußten, sogenannten „NeoSoul“ oder „NuSoul“. Wichtigste weibliche Vertreterinnen sind hier wohl Erykah Badu, Jill Scott, Angie Stone und india.arie, wobei die Grenzen zum R’n’B teilweise fließend sind (Ist Mary J. Bliges an Billie Holiday gemahnendes Timbre nicht auch „retro/neo“? War Erykah Badus erstes Album nicht einfach reduzierter Swingbeat?). „NeoSoul“ wurde als Image dennoch gerne von den Medien aufgenommen, besonders in den USA, wo sich ein durch Black Empowerment in die höheren Gehaltsklassen vorgestoßenes, afroamerikanisches Establishment nicht mehr mit Attributen wie „real“, „streetwise“ und der Herkunft aus dem Ghetto beschäftigen mag. Entsprechend erfolgreich sind einige dieser Künstlerinnen, z. B. India.Arie, die mit ihrem bodenständigen, das Erbe von Stevie Wonder, Donny Hathaway und Roberta Flack beschwörenden Folk-Soul zum Newcomer-Liebling einer finanzstarken Käuferschicht wurde. An den über Glauben, Harmonie und Glückseligkeit fabulierenden Texten haben natürlich auch weiße KonsumentInnen nichts auszusetzen, eine harmlosere Variante der eh schon harmlosen Tracy Chapman, sowas macht sich gut neben Norah Jones und Whitney Houston im CD-Regal.
Die Argumente, mit denen India.Arie, aber auch Alicia Keys oder die Ex-Rapperin Angie Stone vermarktet werden, wühlen alle im Fundus des Authentischen, Echten, bleiben bei der romantischen Vorstellung des „selbst-Musik-machens“ als einzig wahren künstlerischen Ausdruck stehen. Aries Debütalbum hieß entsprechend Acoustic Soul und auch in deutschen Gazetten wird gerne pausenlos erwähnt, dass Alicia Keys sich bereits mit vier Jahren nichts sehnlicher wünschte als ein eigenes Klavier, das immer noch ihr ein und alles ist und auf dem sie natürlich in ruhigen Minuten gerne mal eine Chopin-Komposition „klimpert“ (siehe KulturSPIEGEL 12/2003). Das Korsett, in dem sich diese Musikerinnen bewegen müssen, erscheint bei genauerer Betrachtung also kein Stück bequemer als das ihrer chartstoppenden R’n’B-Kolleginnen. Es gibt ebenso Konventionen, um deren Einhaltung sich Management und Label kümmern, lediglich für „Crossover-Effekte“ wird ab und zu mal etwas riskiert (am besten in Form eines NEPTUNES-Remixes oder ähnlichem). Daß „NeoSoul“ dennoch musikalisch und textlich interessant ist, liegt an einigen individualistischen und reflektierten Künstlerinnen wie der von der Spoken Word Poetry kommenden Jill Scott, der sich von ihrem ehemaligen Ziehvater Kedar Massenburg freischwimmenden Erykah Badu oder an Lauryn Hill, die es wie kaum eine andere schaffte, mit ihrem Debütalbum, einen Musik gewordenen Diskurs mit der Gegenwart und Vergangenheit von Soul und HipHop zu führen , Reggae, HipHop und Folk mit einfliessen zu lassen und dabei noch an künstlerischem Profil zu gewinnen. Platten wie diese, Musik von Grenzgängerinnen, werden auch in Zukunft diejenigen sein, die das Hören von und die Beschäftigung mit dieser Musik lohnend machen werden.
Literatur
Anette Baldauf/Katharina Weingartner. Lips, Hits, Tits, Power? Folio Verlag, Wien, 1998.
Daraus: Tricia Rose, „Sechs oder sechzig Zentimeter“. Zur Zensur sexueller Artikulation schwarzer Frauen.
Angela Y. Davis. Blues Legacies and Black Feminism. Pantheon Books, New York, 1998
Barbara O´Dair (Ed.). Trouble Girls. The Rolling Stone Book of Women in Rock, Random House, New York, 1997
Daraus: Alice Echols. Smooth Sass and Raw Power: R&B´s Ruth Brown and Etta James. Ann Powers. Aretha Franklin. Diane Cardwell. Diana Ross.
Tricia Rose. Black Noise. Wesleyan University Press, Middletown, Connecticut, 1994
Vibe (Hg.). HipHop Divas. Three Rivers Press, New York 2001
[1] Auch die Intellektuellen und Künstler(innen) jener Zeit, die Vertreter der Harlem Renaissance hatten – mit Ausnahme von Langston Hughes – kein Interesse am kulturellen Ausdruck von Frauen aus der Arbeiterklasse, da sie Blues als ungeschliffen und roh ansahen, sie sich aber aus durchaus verständlichen Gründen Künsten wie klassischer Musik, Bildhauerei, Malerei und Literatur widmeten.
[2] Darüberhinaus stellt Davis fest: „That their aesthetic representations of the politics of gender and sexuality are informed by and intervowen with their representations of race and class makes their work all the more provocative.“ (xv)
[3] Tricia Rose, „Sechs oder sechzig Zentimeter“. Zur Zensur sexueller Artikulation schwarzer Frauen. In: Anette Baldauf, Katharina Weingartner (Hg), Lips,Tits, Hits, Power? Popkultur und Feminismus, Folio, Wien, 1998
[4] Siehe Tricia Rose, ebd.
[5] Your Revolution has nothing to do with murdering spouses, or for that matter with anti-male sentiments. Instead, Jones takes aim at the violence, materialism, and the sexual braggadocio of artists like LL Cool J and the late Notorious BIG, saying “The real revolution ain’t about booty size/ The Versaces you buys/ Or the Lexus you drives.” She quotes almost directly from LL Cool J’s hit “Doin‘ It,” a tune which was arguably after-hours fare (don’t get me started on the video). Nowhere in Your Revolution is there profanity, explicit sexual description, or boasts about violence and guns. It’s one woman, speaking her mind on something that she doesn’t like. And it’s the woman + issue equation that seems to equal a threat, as far as the FCC is concerned. (Carly Milne, Radio Is Cleaning up The Nation: Why Sarah Jones´Revolution Won´t happen On Your Airwaves. In Bitch, www.bitchmagazine.com, Sommer 2001).
[6] Das Sarah Jones-Portrait im Wire liegt mir leider nur als Kopie vor – Heftnummer und Erscheinungsjahr (wahrscheinlich 2001) lagen leider ausserhalb des kopierbaren Bereichs und waren auch via Wire-Internet Archiv nicht verifizierbar. Das Zitat funktioniert nur als einigermaßen ironisch, wenn LeserIn weiß, daß sich das Zitat wahrscheinlich auf das Majesticons/Infesticons-Projekt bezieht, eine Art sehr ironische HipHop-Konzeptoper von Mike Ladd, bei der Sarah Jones auch mitwirkt. Dort wird nämlich überspitzt den Frauen diese Rolle zugeteilt.
[7] Geprägt von der Schrifstellerin Alice Walker meint Womanism, daß Frauen einander respektieren, sich aufeinander beziehen und füreinander einsetzen. Das Reizwort Feminsimus, das sich zu sehr auf Ideen weißer Frauen bezieht, einen postkolonialen anklag hat und womöglich schwarze Frauen gegen schwarze Männer ausspielt und die Einigkeit im Engagement gegen Rassismus spalten könnte, wird hier bewußt vermieden.
(TL / TP)