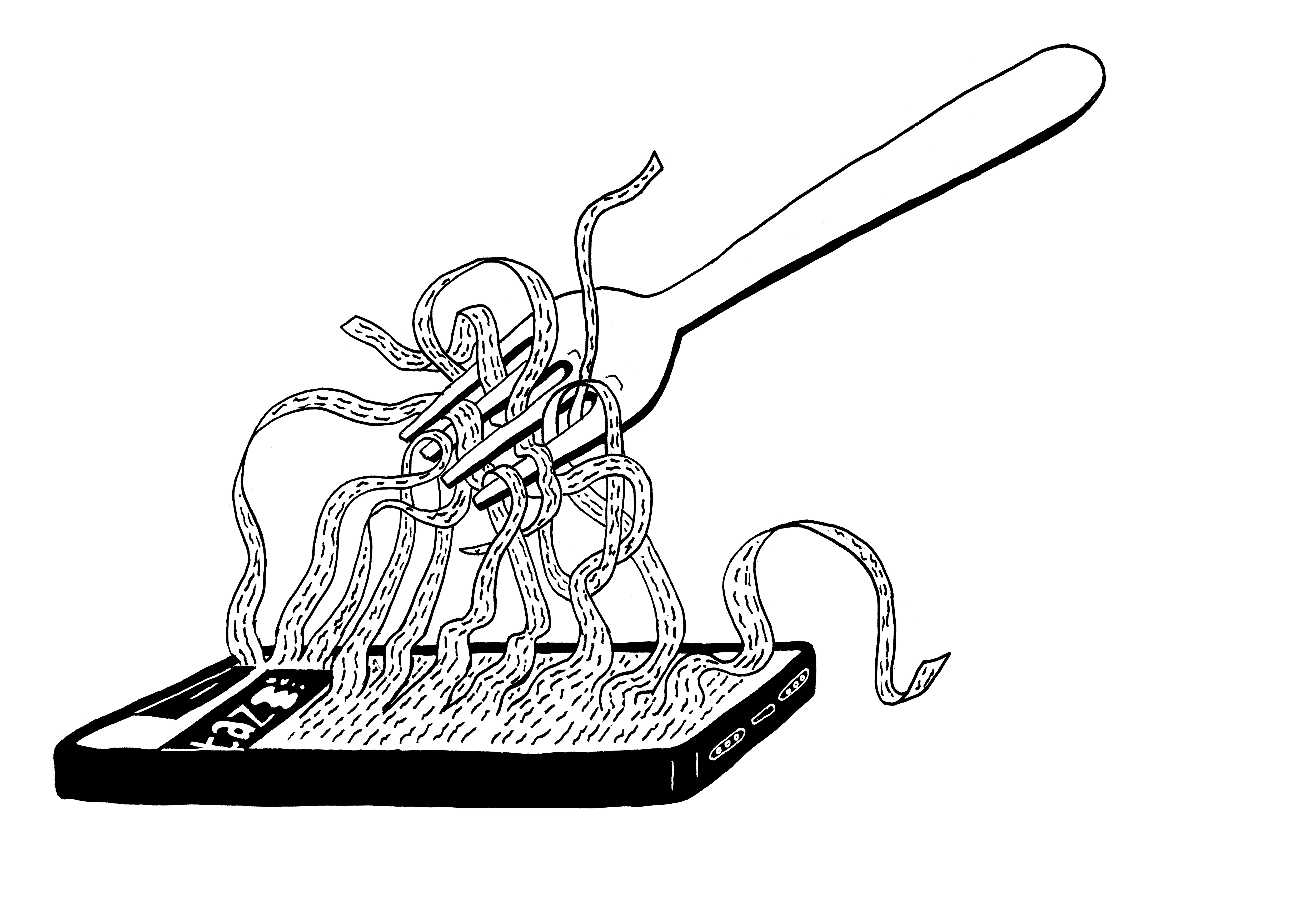Der Bär flattert in nördlicher Richtung.
Ich bin durch eine harte Geniegrundschule gegangen. 1945 wohnten wir in Berlin-Niederschönhausen, einem Ortsteil von Pankow, in der Bismarckstraße 36 A. Meine Mutter schickte mich eines Tages ohne Vorwarnung in die Bismarckstraße 10 schräg gegenüber, ein alleinstehendes Bürgerhaus neben der Volksschule, die als Krankenhaus genutzt wurde. In der Beletage residierte Siegfried Neusch van Deelen mit seinem Privatkonservatorium. Ich war acht Jahre alt, sollte Geige spielen lernen und taperte rüber. Es öffnete ein Mann mit langen mittelblonden, vermittels Brillantine streng nach hinten gekämmten Haaren, hoher gefurchter Stirn und braunen Augen, großem Zinken und tiefen Falten neben demselben — ein langes Gesicht mit leichten Hängebacken und großen, allerdings nicht abstehenden Ohren: »Na mein Junge, da bist du ja«, zu überschwenglich, es war mir gleich zuviel. Sie hatten sich offenbar schon ineinander verguckt, meine Mutter und Siegfried. Auch sie war zum Musikunterricht angemeldet, ihr Instrument hieß Konzertina, eine sechseckige Quetschkommode.

Mein Vater war bereits zurück aus der Gefangenschaft. Als er kam, lebte meine Mutter mit ihrem Beschützerverhältnis, wie es viele Frauen nach dem Krieg taten. Ediths Beschützer hieß Heiner Vanscheidt, ich mochte ihn, ich liebte ihn geradezu, denn er war ein wunderbarer Knabenfreund, der mir aus Regenschirmspeichen Flitzebogen machte und auch sonst viel Verständnis für Jungs und ihre Vorlieben hatte. Er war im Krieg Sanitäter gewesen und jetzt Krankenpfleger in dem Lazarett, in dem auch meine Mutter arbeitete, aus dem die verwundeten Russen abtransportiert worden waren. Danach war das Notlazarett, die frühere Friedrich-List-Schule, noch eine Weile Krankenhaus, ich ging gegenüber in die Anna-Magdalena-Bach-Schule, Volks- und Oberschule waren eine Weile nicht getrennt. Heiner Vanscheidt lebte meist bei uns in der Wohnung, ein blonder, nein, ein früh ergrauter weißhaariger jugendlicher Vierziger, kann auch fünfunddreißig gewesen sein. Er habe weißes Haar, weil er zwölf Stunden lang verschüttet gewesen sei, erzählte er.
Mir kam Heiner im Gegensatz zu anderen Erwachsenen viel jünger vor, er hatte scheint’s eine jugendliche Seele. Mit ihm lebten wir ab Mai 1945 zusammen, bis im nächsten Sommer Siegfried auftauchte. Wir hatten eine Drei-Zimmer-Wohnung, sie bestand aus Schlaf-, Wohn- und Kinderzimmer, Küche, Bad und Flur. Heute würde man sagen: kleine Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung, damals galt sie als modern und geräumig. Es herrschte Wohnraumrationierung wegen der Zerbombung und der Flüchtlinge, also hatten meine Mutter und ich nur das Anrecht auf einen Raum.
Unsere erste Einquartierung bestand aus einer dreiköpfigen Familie, dem Radrennfahrer Wiemer mit Frau und Sohn in meinem Alter. Sie wohnten im ehemaligen Elternschlafzimmer, zunächst durfte ich noch mein Kinderzimmer behalten. Wiemer war ein Schieber, er überflügelte nach kurzer Zeit alle anderen: Muckchen, Rockel und wer sonst noch in Niederschönhausen bekannt war dafür. Er war auch bereits wieder als Radrennfahrer zugange, hatte häufig Besuch von seinen Sportkameraden. Auf dem Flur waren immer zwei Rennräder aufgebockt, man konnte kaum vorbei, und ständig hatte er eine Felge zwischen den Knien und spannte Speichen. Er besaß einen kleinen Fahrradanhänger, in den er mich einmal setzte. In dieser Zeit war ich fromm, wollte Arzt werden und ging Sonntags immer in die Kirche, um beim Kindergottesdienst die Augen nach oben zu verdrehen. Wiemer sagte zu mir: »Ach was, Junge, laß ma’ die Kirche, fahr ma’ mit, wir fahren in den Wald, der ist Gottes natürlicher Dom.« Ich fuhr gerne mit, aber nach kurzer Zeit wurde ich seekrank, weil er in Schlangenlinien auf den rumpligen Straßen mit den Geschoßschlaglöchern in einen Außenbezirk strampelte, ich weiß nicht, wohin wir fuhren, das Rumpeln war sehr unangenehmen. Als wir schließlich in einem Wald, ich schätze mal, es war der Tegeler Forst, bei einem Forsthaus anlangten, kriegte ich zusätzlich Schiß. Dort wurden zwei Säcke zu mir in den Anhänger gewuchtet, Schieberware, vielleicht Mehl oder Zucker, auf diesen Säcken saß ich. Die Rückfahrt war also erheblich langsamer, und er strampelte vorn wie auf einer Bergetappe, aber das Rumpeln war jetzt erträglich. Nur, ich war ja nicht blöd, wußte, daß ich auf heißer Ware saß, und überall standen Schupo- und Alliiertenkontrollen, die Schieber suchten. Er wurde aber durchgewinkt in seinem komischen Trikot und den Rennfahrergummihosen, als populärer Sportler war er auch hier bekannt. Wiemer, den Namen habe ich später noch ein paarmal gehört in den Sportnachrichten in Rinteln, er gewann, glaube ich ›Rund um Berlin‹. Jedenfalls benutzte er mich als zusätzliche Tarnung für seine Konterbande, wieso nahm der eigentlich nicht seinen Sohn mit? Das verbot ihm wahrscheinlich seine Frau. Na gut, mal bin ich mitgefahren, dann ist mir Gottes künstlicher Dom, die Friedenskirche, doch lieber gewesen.
Es war verlockend, auf unserem Flur zwischen den Rennrädern stand ständig ein Sack mit Mehl oder Zucker, aber der Hund hat uns nichts davon abgegeben. »Wir sind anständig«, meinten meine Mutter und Heiner voll bescheuert, sie hätten doch sagen können: »Wir nehmen’s uns jetzt einfach, wenn du Arsch was willst, zeig uns doch an!« Nix, da wurde höchstens gekauft, es gab noch nicht mal einen Vorzugspreis. Später ist dann sogar eine Beschißgeschichte gelaufen: Meine Mutter und Siegfried wollten mit dem Rennfahrer mal das ganz große Geschäft machen, investierten in Nähmaschinennadeln, eines der sonderbaren Warentermingeschäfte jener Tage. Er machte ihnen weis: »Wenn Sie fünfzigtausend auf den Tisch legen, ist das das Geschäft Ihres Lebens.« Irgendwie brachten sie das Geld zusammen, natürlich ging es schief, die Nähmaschinennadeln tauchten nie auf, sie hatten sich die Hälfte des Geldes geliehen und setzten ihm so zu, daß er es sehr unwillig bis auf sechzehntausend wieder rausrückte. Aus dieser Zeit stammte der Schwur meiner Mutter: »Wenn mal wieder bessere Zeiten kommen, dann stellen wir uns eine Kiste Nähmaschinennadeln, eingeölt, auf den Boden, als eiserne Reserve für schlechte Zeiten.« Blöderweise hält man sich nie an solche guten Vorsätze.
Wiemer wohnte inzwischen allein mit seiner Familie in einer Villa in Niederschönhausen, da war keine Rede mehr von Bewirtschaftung, er hatte sogar ein Auto ohne Holzvergaser, einen Hanomag-Kurier-Pkw. Du mußt ihn dir wie einen größeren DKW, umgerüstet als Pritsche, als Pick-up vorstellen. Damit fuhr er umher, hinten seine Fahrräder und natürlich Schieberware drauf. Trotz strengster Benzinbewirschaftung hatte er den gelben Kreis auf dem Kotflügel, den bekamen sonst nur Leute in lebenswichtiger oder hochoffizieller Position: Ärzte, Funktionäre. Es war was sehr Wichtiges, das Radfahren, die kommunistischen Apparatschiks waren schließlich Sportsfreunde. So sah ich ihn dann später immer mal vorbeifahren mit seinen Rennrädern auf der Pritsche, eingereiht in die endlosen Demontagekolonnen, mit denen die Sowjets den deutschen Industrieschrott Richtung UdSSR abtransportierten, immer die Bismarckstraße runter, Richtung Blankenburger, Bernau, Stettin.
(BK / JS)