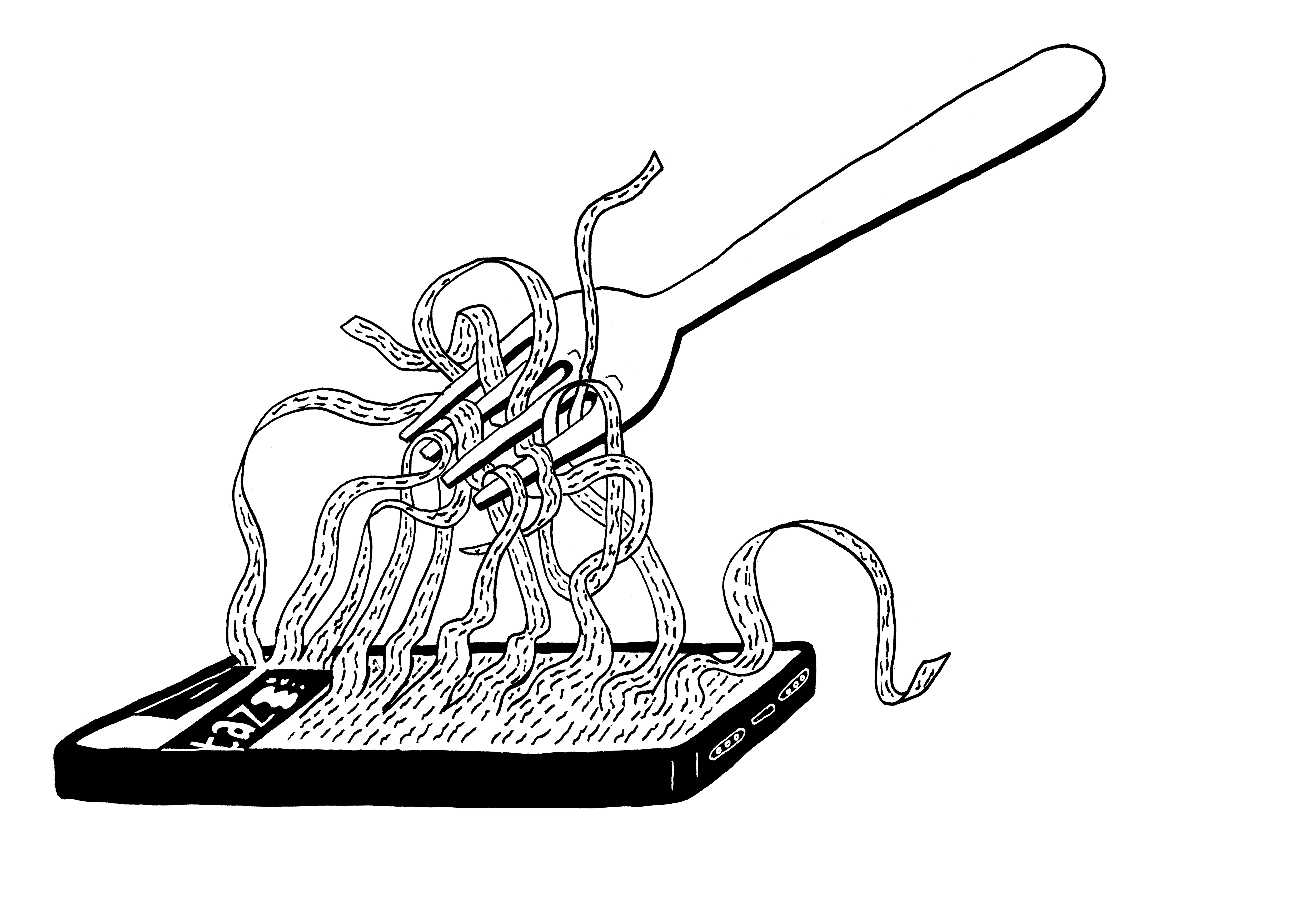***
Es ist dunkel, ich sehe nicht, wie der Bär flattert.
***
Diese Geschichte erschien zuerst in ›Schröder erzählt‹: Die Nacht in dem ungeheizten Berghotel in Tafraout war dann noch viel kälter als in Agadir, obwohl wir sämtliche Klamotten übereinander angezogen hatten. Entsprechend früh wachten wir am nächsten Morgen auf. Kein Personal zu sehen, weder in der Rezeption noch im Frühstückssaal, dort saßen nur ein paar bibbernde Gäste. Also suchten wir nach einem Kellner in der Halle. Eigentlich konnte man sie nicht übersehen in ihrer Uniform: weiße Pluderhose, rote Jacke mit Goldknöpfen und roter Fez auf der Birne. Das Hotel war prächtig dekoriert mit Fliesen, Mosaiken, Teppichen, polierten Messingtischchen auf geschnitzten Beinen, eben mit bombastischem Marokko-Kitsch.
Plötzlich sah ich und traute meinen Augen kaum, wie hinter einer dieser dicken Säulen, die in der Halle standen, ein dunkles Gesicht hervorlugte und ssssst wieder verschwandt. Hatte sich etwa die gesamte Brigade versteckt? Und das waren nicht wenige, da kamen auf einen der vielleicht zwölf Touristen drei Leute im Service. Wirklich, jetzt schlenzte der Hotelpikkolo durch die Drehtür, trug einen großen Plastiksack mit Pain, und wie auf der Bühne bei einem orientalischen Singspiel traten, als wäre das ganz selbstverständlich, hinter den Säulen und aus den Ecken die Kellner hervor. Die hatten sich versteckt, um nicht sagen zu müssen: »Tut uns leid, Monsieurdame, aber es ist noch kein Baguette im Haus.«
Endlich gab es Frühstück. Ein männliches Pärchen aus der Schweiz setzte sich an unseren Tisch, sie stellten sich als Vater und Sohn vor und erzählten, daß sie eine gefährliche Strecke mit steil abfallenden Hängen gefahren seien, eine alte Gebirgspiste nach Tafraout. Auch sie hatten sich einen R 4 gemietet – die haben in Marokko notorisch kein Profil auf den Reifen, und wenn die Bremsen funktionieren, ist es auch ein Wunder. Mit so einem Ding unternahmen Vater und Sohn, die wie Weicheier aussahen, eine halsbrecherische Fahrt?! Merkwürdig. Offenbar hielt mich dieser Vater auch für einen Papa, der mit seiner Tochter reist, denn jetzt erklärte er mir, er sei Steuerberater in Zürich, habe viele ausländische Klienten, speziell aus Deutschland. Versuchte der doch tatsächlich, mit mir in eine helvetische Verhandlung einzutreten, wie man die beiden jungen Leute – seinen Beat und meine Barbara – miteinander verbandeln könne. Wir nahmen es ihm nicht übel, lachten uns vielmehr kaputt. Schließlich fragte ich den sonderbaren Steuerberater, was ihn denn dazu bringe, solche Gefahren für Leib und Leben auf gefährlichen Pisten mit einer Schrottkarre auf sich zu nehmen. Und schon kamen wir wieder einem uns bisher unbekannten Verbrechen auf die Spur.

Carl Spitzweg: Der Kaktusliebhaber
Vater und Sohn waren Kakteensammler, sie fuhren in die entlegensten Gegenden, um die Objekte ihrer Begierde zu ergattern. Zunächst hielten wir die beiden nur für Sonderlinge, die einem absurden, aber harmlosen Hobby frönten. Mir fiel dazu der Niederländer ein, den ich vor Jahren, als ich mit dem Reisemobil in Marokko unterwegs war, beobachtet hatte, wie er in seinem Wohnwagen mit Kisten voller Sukkulenten hantierte.
Später ging ich der Sache nach und lernte etwas über den Beginn der europäischen Kakteenleidenschaft: Als das Greisenhaupt auf der Pariser Weltausstellung von 1889 erstmals gezeigt wurde, waren die Pariser so begeistert, daß sie zu Kakteensammlern wurden. Dieser Säulenkaktus, der in seiner Heimat Mexiko eine Höhe von fünfzehn Metern erreichen kann, erregte kaum weniger Aufsehen als der Eiffelturm. Und es dauerte nicht lange, bis geldgierige Exporteure die Greisenhäupter in Mexiko so hemmungslos räuberten, wie es vierhundert Jahre zuvor die spanischen Eroberer mit dem Gold getan hatten. Bald darauf erließ die mexikanische Regierung ein Gesetz, das den Export aller Kakteen verbot.
Aber bis heute sind die Sammler scharf auf seltene Spezies der wasserspeichernden Pflanzen, die bis zu tausend Jahre alt werden können. Besonders begehrt sind solche alten Sukkulenten, auf geheimen Schwarzmarktbörsen werden Tausende von Mark für rare Arten aus der freien Natur gezahlt. Um die Pflanzen vor der endgültigen Ausrottung zu schützen, hat die Züricher Sukkulentensammlung inzwischen einen Sicherheitstrakt eingerichtet, in dem die letzten Exemplare der aussterbenden Kakteen unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen in den Glashäusern gehalten werden.

Maghrebinische Säulenwolfsmilch (Euphorbia resinifera) in der Blütezeit. Foto: Valérie & Agnès – Wikipedia
Bei unseren Schweizern handelte es sich also um keine Einzelgänger, und der Grund für ihre Strapazen war noch nicht mal originell, sondern ordinäre Gier. Statt Papageien, Vogeleier oder Schmetterlinge jagten Vater und Sohn geschützte Sukkulenten. Die werden auch in Marokko immer seltener, weil eben solche skrupellosen Räuber die Landschaft plündern. Da wir das damals noch nicht wußten, hörten wir uns ihre Pistenabenteuer freundlich lachend an. Gnade ihnen Gott, wenn die Pflanzenliebhaberin Barbara schon etwas von ihren Verbrechen geahnt hätte, die beiden Biedermänner wären von ihr als Rachegöttin Loki giftig abgebürstet worden, und der Züricher Steuerberater hätte sie bestimmt nicht mehr für eine geeignete Schwiegertochter gehalten.
(Fortsetzung folgt)
***
Diese Geschichte erschien in ›Schröder erzählt: Pingpong‹ im März Desktop Verlag. Jörg Schröder und Barbara Kalender erzählten, die Transkription der Tonaufnahmen wurde von beiden Autoren redigiert.
***
(BK / JS)