Wie gründet man eigentlich eine Briefkastenfirma? Eine, die es gar nicht gibt? Diese Frage stellte sich zu Beginn meiner Schleichwerbe-Recherche. Ich wollte mich anderen Zeitungen gegenüber als Mitarbeiter einer Werbeagentur ausgeben. Denn wenn man als Journalist offiziell bei anderen Zeitungen nachfragt, ob es dort Schleichwerbung gibt, wird das bestritten. Ab und zu kommen aber doch Fälle von Schleichwerbung ans Licht. Sind das einzelne Ausrutscher? Oder gibt es Zeitungen, die durch und durch käuflich sind? Wie viel Einfluss können Anzeigenkunden nehmen?
Für meine neue Identität brauchte ich eine Adresse, eine Telefonnummer, eine Website, Visitenkarten und einen Namen. Visitenkarten waren einfach, die kann man bei jeder Druckerei in Auftrag geben, ohne dass überprüft wird, ob es die Person auf der Karte überhaupt gibt. Auch die Webadresse gab es problemlos: Ich registrierte unter falschem Namen die Internetadresse www.coram-publico.net (inzwischen wieder abgemeldet) und erstellte die Inhalte für die Homepage selbst.
Das mit der Postadresse klappte über ein Unternehmen, bei dem neu gegründete Firmen sich Büroräume in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofes in der Lehrter Straße mieten konnten. Der Anbieter ist inzwischen pleite. Die Briefkastenadresse bei ihm kostete rund 10 Euro pro Monat. Man bekam aber gar keinen eigenen Briefkasten am Haus, sondern es gab einen großen Briefkasten am Haus, in den die Post gesammelt eingeworfen wurde. Die Mitarbeiter des Anbieters verteilten dann im Sekretariat die Post auf die dort stehenden Fächer. Man konnte die Post dann dort abholen oder sich an eine andere Adresse weiterschicken lassen (wie ich es gemacht habe).
Besonders praktisch fand ich auch den Sekretariatsservice, der wurde von dem Anbieter wie folgt beworben (PDF):
Ihre Geschäftspartner erwarten eine schnelle Verbindung? Bei uns gibt es keinen Dauerbesetztton, kein Leerlaufklingeln, keinen Telefondienst durch den Chef. Ein durch unser Vorzimmer freundlich angenommenes Gespräch hinterlässt einen kompetenten Eindruck. Damit entgeht Ihnen kein Kunde mehr.

Ich bekam also eine eigene Durchwahl. Wenn jemand dort anrief, hob ein Mitarbeiter des Anbieters ab und meldete sich mit dem Namen meiner angeblichen Firma. Der Mitarbeiter fragte dann, wen der Anrufer sprechen wolle und sagte, dass ich nicht da sei. Der Anrufer wurde außerdem nach seinen Kontaktdaten gefragt und dem Grund seines Anrufs, diese Informationen erhielt ich dann per Mail. Als ich vor Ort war, um den Vertrag mit dem Anbieter abzuschließen, klingelte das Telefon mehfach und die Mitarbeiterin meldete sich mit immer wechselnden Firmennamen. Die Kosten für mich: 9,99 Euro Grundgebühr pro Monat plus 1,99 Euro pro angenommenem Anruf. Insgesamt verursachte die Briefkastenfirma also laufende Kosten von 20 Euro pro Monat. Ich hätte auch noch stundenweise Besprechungsräume mieten können, um mich mit den Vertretern der Zeitungen dort zu treffen und die Räume als die meiner Firma auszugeben, aber die Treffen waren immer bei den Mitarbeitern der Zeitungen.
Damit ist die neue Identität fertig. Mein neuer Name: Tobias Kaiser. Meine Funktion: Key Account Planning Effizienzer. Meine Werbeagentur: „Coram Publico“, das heißt „Vor aller Öffentlichkeit“. Mein Auftrag: Termine mit den Mitarbeitern von Zeitungen vereinbaren, um ihnen ein unmoralisches Angebot zu machen.
Bevor die verdeckte Recherche los geht, treffe ich mich aber noch mit einem Mitarbeiter der taz-Anzeigenabteilung. Er erklärt mir, wie das Agenturgeschäft funktioniert und was zum Beispiel eine „AE-Provision“ ist: Werbeagenturen bekommen von den Verlagen eine Vermittlungsprovision, die in der Regel 15 Prozent des Anzeigenpreises beträgt. „AE“ steht für Annoncen-Expedition, so hießen Werbeagenturen früher. Ich lerne auch, wer bei so einer Provision wem wann was in Rechnung stellt.
Als nächstes rufe ich die Anzeigenabteilungen der Zeitungen an: Meine Agentur berate angeblich Firmen bei der Entscheidung, in welchen Medien sie ihre bezahlten Anzeigen schalten. Ich hätte mich darauf spezialisiert, dass die Anzeigen in einem „geeigneten Umfeld“ erscheinen. Mit Umfeld sind die Artikel gemeint, die in der Zeitung direkt neben der Anzeige stehen. „Geeignetes Umfeld“ ist ein Codewort in der Branche, das für Schleichwerbung stehen kann. Ich knüpfe meine Anzeigen jedenfalls an die Bedingung, dass auch ein journalistisch anmutender Text zu dem von mir vorgegebenen Thema in der Zeitung erscheint. Wenn das klappt, taste ich mich weiter vor. Die Zeitung soll das Thema nicht nur aufgreifen, sondern sie soll es positiv und unkritisch machen. In der nächsten Stufe soll sie den Namen eines Unternehmens – meines angeblichen Kunden, von dem das Geld kommt – im Text erwähnen und dessen Produkte loben. In der höchsten Stufe möchte ich den Text gleich selber schreiben. Und natürlich darf der Text weder wie eine Anzeige aussehen noch mit dem Wort „Anzeige“ gekennzeichnet sein. Eine Zeitung, die darauf eingeht, verstößt gegen die Landespressegesetze und die Standesregeln.
Die Lockangebote dienen dazu, mit den Mitarbeitern der Zeitungen ins Gespräch zu kommen. Damit sie mir erzählen, was denn allgemein bei ihnen üblich ist. Schließlich will ich ja etwas über die strukturelle Käuflichkeit der Medien herausfinden. Da es nicht um die Bestechlichkeit einzelner Mitarbeiter geht, anonymisiere ich diese am Ende auch in meiner Veröffentlichung der Recherche-Ergebnisse. Da steht jetzt immer „ein Mitarbeiter der Anzeigenabteilung“, auch wenn es zwei Mitarbeiter waren oder eine Mitarbeiterin.
Es klappt immer völlig problemlos, einen Termin bei den Anzeigenabteilungen zu bekommen. Nun stehen die Reisen an, etwa nach Frankfurt, Darmstadt, Düsseldorf, Hamburg und Essen. Zu den Treffen fahre ich nie allein, sondern nehme immer eine Kollegin mit. Vier Ohren hören mehr als zwei. Und während einer das Gespräch führt, kann der andere die wesentlichen Inhalte gleich mitschreiben. Die Begleitung hilft auch gegen das Nervenzittern. Schlimm sind vor allem die fünf Minuten vor dem Treffen.
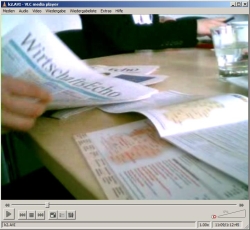
Das Nervenflattern gerade in den Minuten kurz vor dem Termin ist auch deshalb so kritisch, weil genau das die Zeitpunkt ist, zu dem auch die versteckten Kameras angestellt werden, die ich dabei habe. Immer mal wieder drücke ich in der Aufregung die Knöpfe einer Kamera in der falschen Reihenfolge, so dass sie nichts aufzeichnet – aber zum Glück funktioniert bei jedem der Termine mindestens eine Kamera. Ich habe die Kameras dabei, damit es die Möglichkeit gibt, bei der Veröffentlichung der Rechercheergebnisse mit einem TV-Sender zu kooperieren, also gleichzeitig einen Artikel zu drucken und einen Beitrag auszustrahlen. Zwar gibt es am Ende keine solche Kooperation, aber die Aufnahmen sind immerhin auch für die Beweissicherung wichtig. Weil ich die verdeckten Kameras vielleicht auch in Zukunft noch einmal verwende, möchte ich hier nicht verraten, wie genau sie aussehen. Auch zuvor war ich schon einmal mit einer versteckten Kamera bei einer Recherche unterwegs für eine Recherche, die in der ZDF-Sendung WISO lief.
Das Vorbild für meine Recherche ist übrigens Volker Lilienthal vom Fachdienst epd Medien, der Schleichwerbung in der ARD-Serie Marienhof aufgedeckt hatte. Lilienthal hatte sich dabei als Mitarbeiter einer Unternehmensberatung ausgegeben und dann Schleichwerbe-Angebote gemacht. Der Fall eignete sich auch deshalb als Vorbild, weil es ein rechtskräftiges Urteil des Oberlandesgerichtes München zu der Recherche gibt. Das Gericht erklärte die Veröffentlichung der Rechercheergebnisse für zulässig, inklusive der heimlich aufgenommenen Tonbandmitschnitte. Bereits bei der Auswahl meiner Rechercheziele hatte ich darauf geachtet, dass ich nur zu Verlagen gehe, die in einem ihrer Medien die von Lilienthal veröffentlichten Rechercheergebnisse aufgegriffen und weiterverbreitet hatten.
Der Besuch bei den Verlagen beginnt in der Regel damit, dass der Mitarbeiter der Anzeigenabteilung uns am Empfang abholt und durch das Verlagsgebäude in sein Büro begleitet. Dieser Teil ist immer besonders kritisch. Was ist, wenn ich auffliege? Wenn mich auf dem Weg durch die Gänge des Verlages ein Journalist von einer Fachtagung wiedererkennt und mich mit meinem echten Namen anspricht? Und während einem das so durch den Kopf geht, muss man gleichzeitig noch Small Talk mit dem Mitarbeiter der Anzeigenabteilung machen. Haben Sie unser Verlagsgebäude gut gefunden? Sind Sie mit dem Auto da? Haben Sie noch andere Termine hier in der Region? Tausend Möglichkeiten, sich zu verplappern.
Wenn das Gespräch erst einmal losgeht, lässt das Nervenflattern nach. Auf das Gespräch bin ich vorbereitet, das habe ich im Kopf durchgespielt. Es läuft auch alles immer ganz problemlos, wie erwartet. Schließlich will ich nichts von den Zeitungen, sondern die Zeitungen wollen etwas von mir: Das Geld der Unternehmen, die meine Kunden sind. Tatsächlich bezweifelt offenbar keiner der Zeitungsmitarbeiter, dass ich von einer Werbeagentur komme. Und niemand ist von meinen Forderungen überrascht – es scheint üblich zu sein, dass Anzeigenkunden auch Einfluss auf redaktionelle Inhalte verlangen.
Die Mitarbeiter in den Anzeigenabteilungen sind insgesamt viel formaler gekleidet als die oft locker angezogenen Journalisten. Die Männer in den Anzeigenabteilungen tragen Anzug und Krawatte, die Frauen Kostüm oder Hosenanzug. Offenbar haben viele eine kaufmännische Ausbildung. Bei einigen merkt man noch etwas Restscham beim Verkauf von Artikeln an Anzeigenkunden. Die meisten erklären aber einfach nur professionell, welche Inhalte in ihrer Zeitung käuflich sind und welche nicht.
Nur bei der Märkischen Allgemeinen Zeitung wird es gegen Ende des Gesprächs unangenehm für mich. Der Mitarbeiter hat nämlich überprüft, ob es meine fiktive Werbeagentur wirklich gibt. Er habe „versucht zu recherchieren, aber wir haben da niemanden gefunden“. Er informiere sich bei neuen Kunden vorab über die Bonität. Die Zeitung könne nämlich aus technischen Gründen keine Rechnungen vorab stellen und müsse daher wissen, ob wir (bezienungsweise unsere Kunden) die erschienenen Anzeigen auch zahlen könnten.
Ich hatte auf der Website geschrieben, die Werbeagentur sei eine GmbH. Alle GmbHs sind in öffentlichen Registern geführt. Doch der Mitarbeiter sagt, er habe da nichts gefunden. Ich komme ins Schwitzen. Ich stammele, die Werbeagentur sei bis vor kurzem eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gewesen – die müssen nirgendwo eingetragen sein. Die GmbH sei noch in Gründung, die Prüfung beim Amtsgericht ziehe sich leider länger hin als erwartet. Er hakt nicht weiter nach. Noch am selben Tag ändere ich die Website: „GmbH in Gründung“ steht nun dort. Eine Weile später meldet der Mitarbeiter sich wieder bei mir und verhandelt weiter über eine monatliche Versicherungs-Sonderseite – offenbar hat er keinen Verdacht geschöpft.
Die Kosten für die Recherche lagen übrigens bei wenigen hundert Euro. Der größte Teil davon entfiel auf die Bahnfahrten und Hotelunterkünfte für zwei Personen. Darin nicht enthalten sind allerdings die Kosten für meine Arbeitszeit. Der Zeitaufwand für die Treffen bei den zehn Zeitungen lag etwa bei acht Tagen (am Anfang habe ich nur einen Termin pro Tag gemacht, später auch zwei Termine hintereinander und gegen Ende der Recherche habe ich den Termin bei der BILD-Zeitung auch mal nebenbei in der Mittagspause erledigt, zumal der Verlag ja auch gleich gegenüber auf der anderen Straßenseite liegt). Die Vor- und Nachbereitung war nicht unerheblich. Zuerst ging es darum, die Zeitungen zu durchforsten und nach möglichen Schleichwerbefällen zu suchen. Viele Zeitungen hielt unser taz-Archiv vorrätig, aber die Westdeutsche Allgemeine gab es zum Beispiel nur in der Landesbibliothek, und auch dort nur auf Mikrofiche. Die Vorbereitung war tatsächlich allerdings nicht sehr praxisrelevant – bei den Gesprächen stellte sich oft heraus, dass man auf Seiten Einfluss nehmen konnte, von denen ich das nicht vermutet hätte. Die Nachbereitung war auch auch recht umfangreich, genau wie das Schreiben des Artikels. Unter dem Strich gehe ich von einer Netto-Arbeitszeit von rund 30 Arbeitstagen aus – aber nicht am Stück, sondern verteilt über einen längeren Zeitraum.
Siehe auch:
– Die Ergebnisse der Recherche
– Die Rechtslage bei Schleichwerbung
– Zur rechtlichen Zulässigkeit dieser verdeckten Recherche



