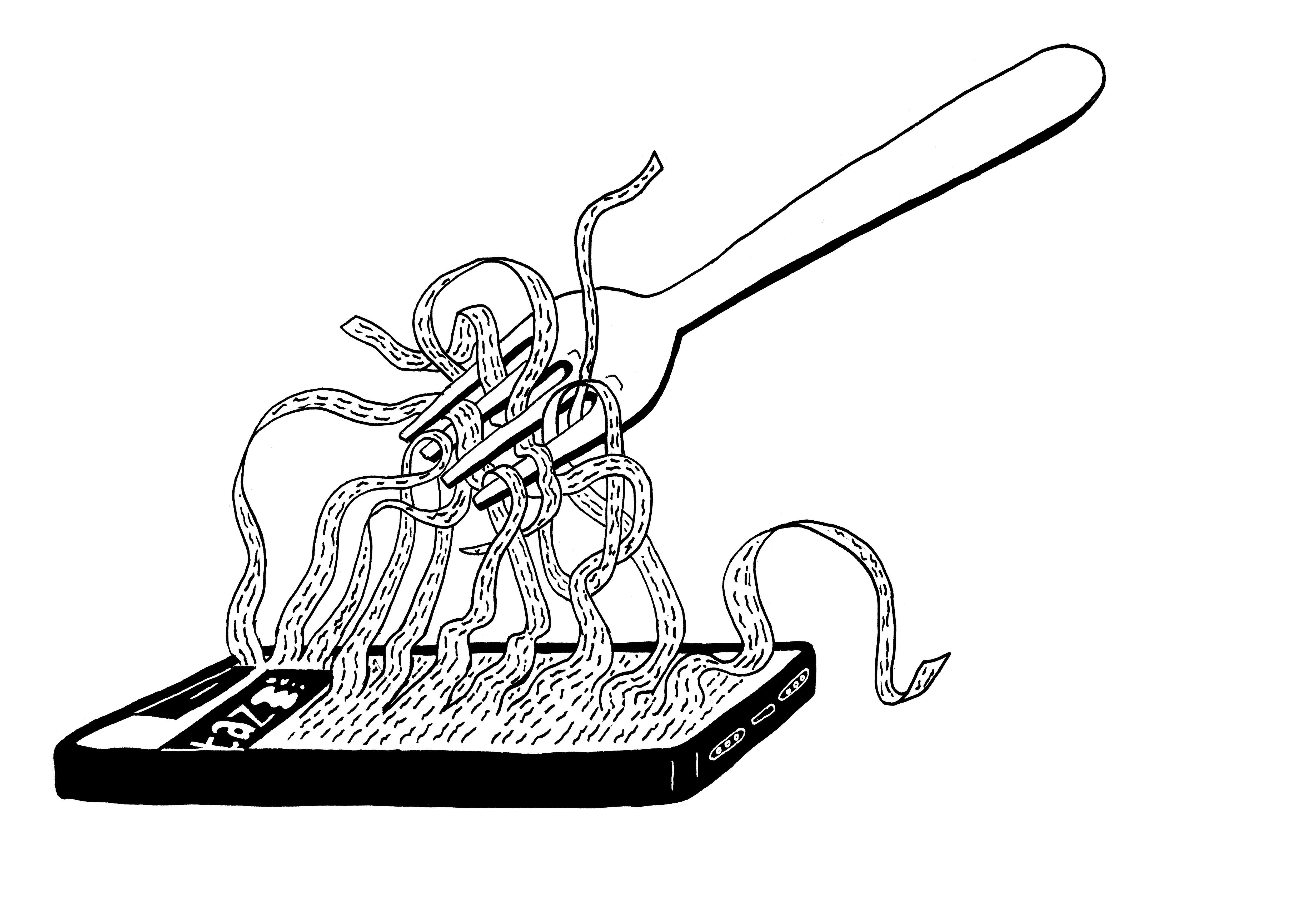Da ist dieses Café an der Ecke, ein bisschen Wien, ein wenig Größenwahn und doch auch Schöneberg, viele hat man dort gesehen, man wird gelistet, ein Laufsteg der Eitelkeiten, ein verschlissener literarischer Olymp mit Nebenräumen, in denen man zärtlich sein Manuskript auf den Tisch legt, weil man nicht weiß wohin damit, doch irgendein Lektor wird schon kommen, kommt aber nicht, nur manchmal, macht nix, denn ER war bislang immer da, war leuchtendes Inventar, freundlich, die Augen neugierig im Raum, dann wieder dieser lange Blick aus dem Fenster, der Griff zum Stift, um den Blick, den Traum zu notieren und danach ein kühles Glas Weißwein. Immer saß er da. Schon damals, als alle noch rauchten und er auch. Manchmal summte er sein Lied. Irgendwas von Dylan oder Hölderlin, glaube ich.
Sein Platz war an den hohen Fenstern zum Garten: zwei und mehr Bücher und Notizen auf dem runden Tisch und ganz in der Nähe saß oft genug ich, zwei Tische weiter, und wollte irgendwann wissen. An einem Februarmorgen, draußen tropfte der feuchte Winter von den Ästen der Bäume, sprach ich ihn an. ER freute sich: Setzen Sie sich doch. Fragen Sie nur. Es seien „Fenstergedichte“, die er gerade schrieb, antwortete er. Aber da wären auch Sonaten in seinem Kopf, für Cello, Klavier, manchmal eben auch der Dylan oder der Cohen zwischen den Zeilen, die er aufschrieb: „Dance me to the end of love.“ Fortan residierte ich am Tisch neben dem seinen, wir grüßten uns des Morgens höflich, plauderten kurz über die Tagespresse, verlachten die Herrschaften und ich begann ihn aufzuschreiben: Ein liebevoller Mann (älteres Modell, mit Cordjackett), der Gedichte aus langen, sehr genauen Blicken formuliert, Sätze wie Musik komponiert und immer sein Fenster zur Welt braucht.
Seit einigen Wochen aber kommt er nicht mehr. Ich hatte schon bemerkt, dass ihm alles schwerer wurde. Eine Müdigkeit umgab ihn, doch blieb er freundlich, erzählte von seinem nächsten Buch, schrieb sich, manchmal lächelnd, in den Tag. Der aufmerksame Kellner brachte, wie immer, was nötig war und nun weiß auch der Schwarz-Weiße nicht, wo und wann und warum. Man wird es in den Zeitungen lesen, meint er. Vielleicht. Wir werden also die Zeitungen lesen. Tag für Tag. Und auf den Tisch am Fenster schauen, den wir für ihn reserviert halten, genauso wie den stets gut gekühlten Pinot. All das nur, falls er doch mal wieder kommt. Woher auch immer. Und auf der Suche nach Worten aus dem Fenster schauen will. Falls. Ich weiß, für solch verrückte Wunder muss man seinen Träumen treu bleiben und hart arbeiten. Aber wer hat gesagt, dass es leicht wird?