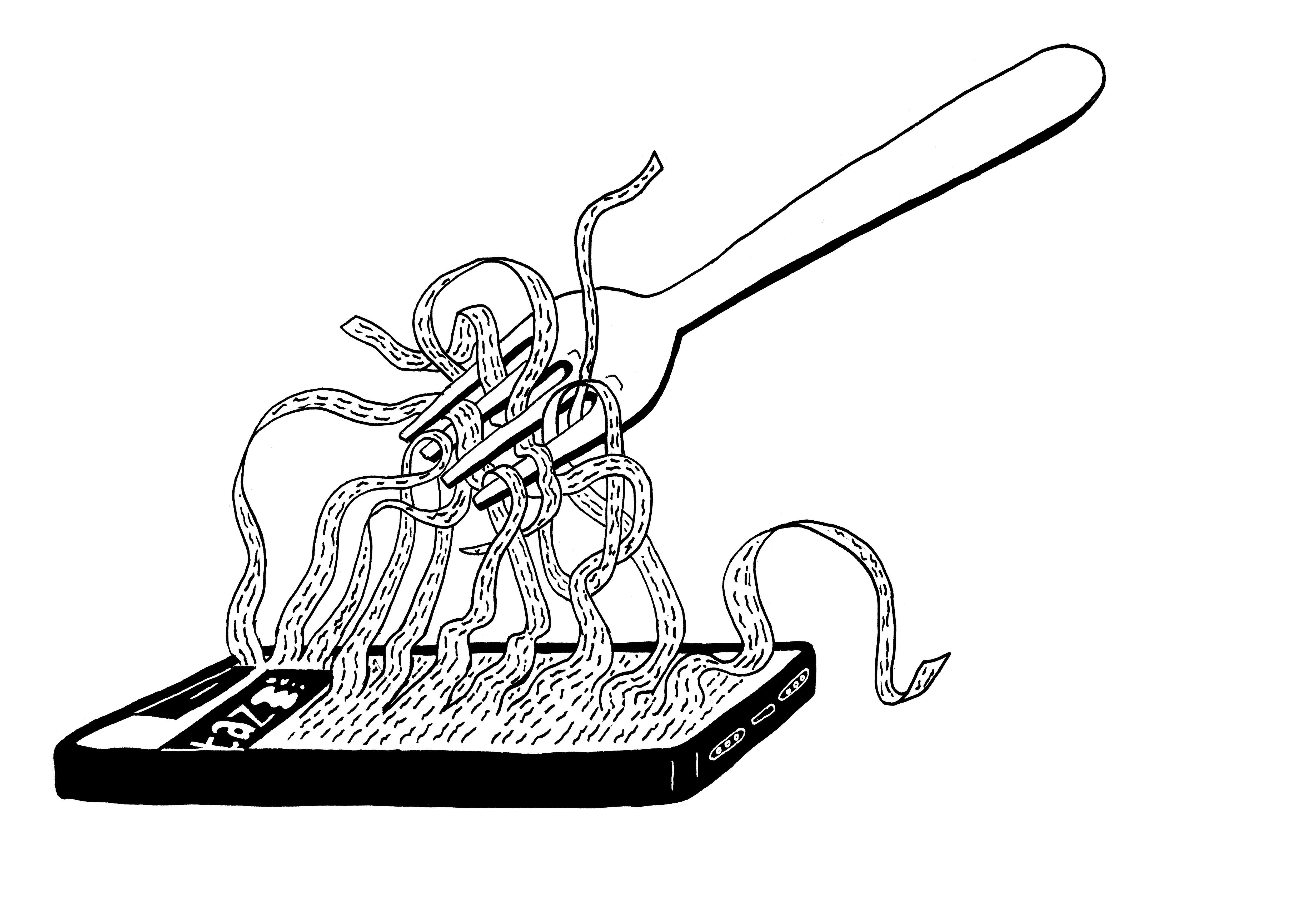Es gibt da ein Kind, das habe ich schon mein Leben lang am Hals. Es wird mit mir alt, trägt kurze Lederhosen, hässliche Sandalen, den Scheitel links, ein blaues Flanellhemd, eine dunkle Sonnenbrille und hat immer Schorf auf den Knien. Auf alle Fälle läuft es seit meinen frühesten Jahren neben mir her, schneidet Grimassen, bohrt viel zu tief in der Nase, liest unter der Bettdecke und will oft genug mit mir gelben Löwenzahn pflücken – mitten im Winter.
Oder es klettert auf meinen Schoß, wenn ich gerade irgendeinen Jammer über die Suche nach der nächsten Koalition schreibe und stellt mit leuchtend blauen Augen wichtige Fragen: Wie schreibt man eigentlich Ästhetik? Warum bekommt man in diesem Haushalt verdammt noch mal keine Schokolade? Und weshalb gibt es im Fernsehen immer nur schlechte Nachrichten? Ich habe nicht auf alle Fragen eine Antwort, aber zumindest weiß ich, wo die Schokolade liegt. Die nimmt das Kind, schnappt sich die Taschenlampe, schlüpft unter seine Decke und liest. Stundenlang. Jeden Tag.
Am Abend steht es dann wieder neben mir, zupft an meinem Flanellhemd und will wissen, was ich da wohl gerade geschrieben habe. „Über ein Kind, das man nicht los wird“, antworte ich und fummele verlegen an den Knöpfen meiner Lederhose. Das Kind fragt nicht weiter, grinst und hat jetzt großen Hunger auf kleine Frikadellen mit scharfem Löwensenf. Dazu frisches Brot mit guter Butter. Lecker.
Zur Nacht hören wir noch ein paar Takte Pink Floyd, putzen gründlich die Zähne, und im Bett lese ich dem Kind noch die Geschichte von dem verrückten Dichter vor, der in einem Turm am Neckar lebte und verdammt traurig war, weil er nicht auf dem Kopf gehen konnte. „Wir können das!“, lacht das Kind, macht die Augen zu und nimmt mich mit in seinen Traum – wir sind richtig gute Freunde, glaube ich. Und bleiben das auch.