Nenn mich einfach Schlund, hat er zu mir gesagt, als wir uns trafen. Verdamp lang her. Vor mehr als einem Jahr ist er gestorben: Joern Schlund, der Maler, der Dichter, der Kulturarbeiter – mein Freund. Fast 83 Jahre ist er alt geworden. Ein Bewegter, ein Verrückter, ein Dichter, ein Radikaler, ein Liebevoller. Er war einer, der Bilder brauchte. Bilder, die atmen. Bilder, um zu atmen. Ich habe versucht, ihm all die Jahre zuzuhören, in Kneipen, Zugabteilen, Theaterfoyers, Kirchen, Schulen, Krankenhäusern, Männerpissoirs, habe in das immer älter werdende Gesicht dieses genialen Kindes geschaut und von einem verrückten Leben erfahren, das endlich erzählt, das rekonstruiert, auch neu erfunden sein will.
Später zogen sie dem kleinen Schlund einen Kittel an. Da war er schon nicht mehr ganz so klein. Trank bereits Schnaps und Bier. Wußte auch artig zu lallen. Nur mit dem Schwarzmarkt – Feuerzeuge gegen Käserad, Käserad gegen Farbkasten – war es vorbei. Dafür bekam er jetzt diesen weißen Kittel.
Sie gaben ihm auch hellgrauen Filz, den mußte er sich um die Füße schlingen und die Auslagen dekorieren. Denn da waren all die Stoffe, ein ganzes Lager voll und die sollten alle sehen – in den Schaufenstern des „Hauses der Stoffe“. Doch, sowas gab es! Ah! sollten sie sagen und Oh!, sich ein paar Meter davon kaufen, Kleider nähen oder Hosen oder Jacken oder ein Leichentuch, egal was.
Alle nähten nach dem Krieg, Stoffe waren gefragt, die Nähmaschinen ratterten überall, in Wohnzimmern, Küchen und Fabriken, die Mode kam in Gang und auf den Laufsteg, und Schlund war „Fetzenmaurer“ – der Berliner Jargon hat eben so seine Eigenarten; alles, was irgendwie angenehm und wohlklingen könnte, verschwindet hinter ruppiger Wortware – „Is aber nich so jemeint, Alta, nix für unjut!“, meinte schon Nante, der olle Eckensteher. Doch der ist längst tot und Schlund mauert nun also Fetzen, entwirft, drappiert, ordnet und formt die Stoffe, …da hält ihn der Chef eines Tages am Arm fest und raunt: „Du hast was drauf, aber woher kommen die Farbkleckse auf deiner Hose?“.
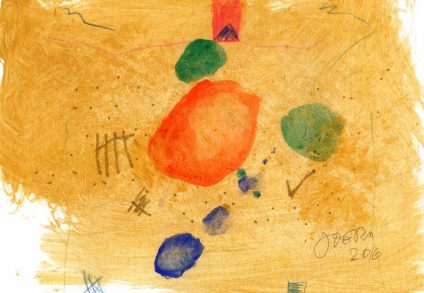
Schlund hätte eben lieber gemalt als zu dekorieren und die Mutter war nicht ganz unschuldig an seinem Farbentraum. Warum schleppte sie den Jungen auch in all die Ausstellungen und Galerien, wunderte sich, daß er nie mehr fortgehen, sondern dableiben wollte, geborgen in all den Farben, in den Bildern und Reproduktionen, die plötzlich nicht mehr ent-artet waren, sondern einfach wieder an rissigen Wänden hingen, heimkehrten aus ihrer Gefangenschaft, stöhnend düstere Lager verließen und wieder ins Leben der Hungrigen traten.
Sein Atem ging schneller, wenn er dieses blaue Pferd sah, das für ihn – ohne Sattel, ohne blauen Reiter – bereit stand und sein Herz klopfte heftig, wenn Max Ernst und dessen garstiger Hausengel ihn mit ihrem Schrecken streiften. Doch er geriet schier aus dem Häuschen, als er in Klees Bild nach „Saint Germain in Tunesien“ reisen durfte, denn dort standen Klees Stühle und Tische, den seinen gleich, vor dem kleinen Café.
Schlund setzte sich auf einen dieser Stühle, rief nach einem Mokka und der im blauen Burnus mit dem roten Fes (im hinteren Teil des Bildes zu sehen, da läuft er gerade weg) kam doch noch zurück und brachte ihm genau das, was er brauchte: er wollte nicht mehr fort aus den Farben. Besorgte sich Kataloge, Postkarten, saß zu Hause, mit Pinsel und Tuschkasten und kopierte. Auch Klees Café. Auch die Markisen. Der Künstler ist ein einfaches Werkzeug.

„Du bist nicht berufen“, maulte die Mutter beim Abendessen (Reibekuchen mit Apfelmus), und der neue Vormund, der alte Loverboy, der mit den schmalen Lippen, legte die Gabel beiseite, nahm die Serviette vom Hals, stand auf und schlug ihm mitten ins Gesicht: Was Anständiges werden und Schnauze!
„Verstanden, Schlund?“
Nein. Was gibt es da auch zu verstehen, wenn einer so eng im Kopf ist, ständig seine Bügelfalten zupft und mit stinkenden Zigarren im Vormund sabbert. Aber Tango tanzen, das konnte der Schmallippige. Mit der Mutter. Trieb es auch mit ihr. Egal. Also da waren die Farbkleckse auf der Hose von Schlund.
„Na und?“, sagte der Chef. „Wir sind Künstler.“ Ach, seufzte Schlund. Ganz warm wurde ihm. Also fiel er unter sie. Unter die Künstler. Verliebte sich in eine von der Akademie, Franzi hieß die und trug nur Hosen, vielleicht nicht immer, aber wenn, dann auch solche mit Farbklecksen darauf.
Franzi liebte ihn, war älter als er, ein sogenannter reiferer Jahrgang, versprach sich viel von ihm und stellte den jungen Schlund irgendwann einem veritablen Akademieprofesssor vor: „Das ist er!“
Franzi wies stolz auf ihren jungen Liebhaber und zeigte dem Professor Schlunds Kopien der neuen Meister, auch seine Dekorationsentwürfe, auch seine gemalten Stühle, auch die Tische und der Professor prüfte die Begabung des Schlund, befand ihn für irgendwas Besonderes, für was genau weiß keiner mehr, ist aber auch nicht weiter wichtig. Auf alle Fälle war der Fetzenmaurer plötzlich veritabler Student. Der freien Malerei. Und wußte eigentlich noch gar nicht, was das ist: Frei? Das war ihm zu abstrakt. Und so malte er dann auch.
Illustrationen: Joern Schlund
( to be continued)



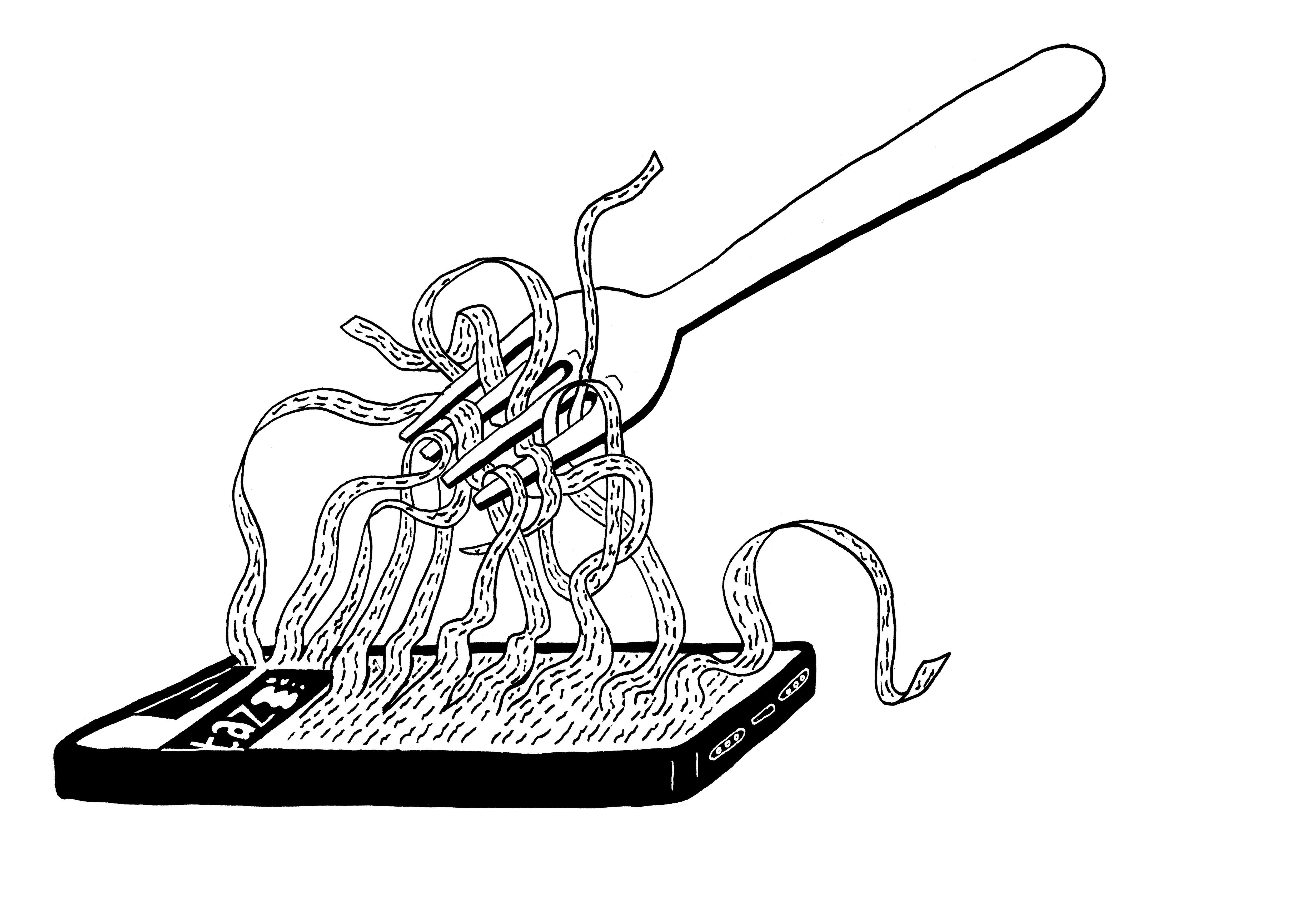
der schlund und ich waren vater und sohn….mein vater hat sich früh verabschiedet…zum sterben nach hannover…..schlund hat mich gesehen und wir wurden als vater und sohn auch freunde…freunde der kunst…ich nahm an seinem tisch platz….er hat mir beuys fühlen erklärt…ich war ratlos und interessiert..so viel neues …ich bin ein arbeiterkind
und ich glaube an den lottogewinn…
ich bin ein arbeiterkind….der geht mir nicht aus dem sinn…
49 kreuze …am richtigen platz und ich mach …nen satz …
vom boden zur decke…am arsch unter den füßen
und ihn nicht mehr grüßen….