Alle reden von “Uploadfiltern”, vom Ende einer Freiheit, die es in all dem Chaos nie gab, reden von Zensur, von Horkheimers autoritärem Staat und den dämlichen UrheberInnen, die mit ihren Forderungen den InfluencerInnen den Spaß versauen wollen. Es geht dabei wohl um Artikel 13 des Entwurfs zur europäischen Urheberrechtsreform. Weg damit! Meinetwegen. Und dann? Jeder darf alles, jeden Text, jedes Bild, jeden Ton und überall? UrheberInnen? Uncoole Typen, die für Ihr Schaffen auch noch all das Geld wollen, das sie in den letzten Jahrzehnten ohnehin nicht mehr verdient haben. Also: Que faire? Rechnungen schreiben vielleicht. Genau: An Google, Facebook, an die ganze Viererbande und ihre Komplizen. Per Einschreiben. Eine militante Sammelklage vielleicht!
Bleibt trotzdem noch der Artikel 12 des geplanten Urheberrechts. Von dem Zwölfer redet keiner, kaum einer. Die “Freischreiber” vielleicht und heute morgen auch das Deutschlandradio, das ebenfalls betont, das so gut wie niemand über den Artikel Zwölf redet, der z.B. die UrheberInnen der deutschstämmigen “VG-Wort” zwingen wird, die Tantiemen ihrer Verwertungsgesellschaft wieder mit den Verlagen zu teilen – was noch gerade neulich vom deutschen Bundesgerichtshof als Unrecht deklariert wurde und dafür gesorgt hatte, dass all die eher prekären KollegInnen, die nicht zu den Bestsellern gehören (und deshalb nach dem Motto “Brenne und sei dankbar!” leben), wenigstens mal einige Monate lang ihre ständig steigenden Mieten zahlen konnten. Aus der Traum! Dann, wenn sie die vorliegende Fassung der EU-Urheberrechtsreform unverändert lassen.
Die Herrschaften haben eben ihren Hölderlin nicht gelesen: Was aber bleibt, stiften die Dichter! Respekt, bitte schön! Womit wir wieder bei meinen “Radio Days” wären. Damals war’s und keine Rede von UrheberInnen und Tantiemen, ich war ja nur ein ziemlich junger Hörer. Aber einer, der in seinem und für sein Radio lebte. Von einer “Glotze” war noch keine Rede. Wir saßen abendlang vor dem Empfänger und hörten. Und all die Sounds aus der Kiste malten uns Bilder hinter die Stirn.

Wenn es im Radio von Oma Fini klassische Konzerte gab, waren wir ganz Ohr. „Schon so viele Jahre Frieden! Hoffentlich bleibt’s so!“ , seufzte sie immer zwischendurch und lauschte dann wieder. Wenn ich mit ihr vor dem Radio saß, sah ich sie alle vor mir, die StreicherInnen und Bläser, es war wie im Konzertsaal – richtig feierlich. Nach solchen Stubenkonzerten erzählte mir Oma Fini oft, wie ihre Eltern in Berlin den Beethoven noch von 78er-Schellackplatten gehört hatten und erklärte mir haargenau alle Positionen des Orchesters. Auch die Arbeit des Dirigenten. Stand auf und führte mir vor, wie man dirigiert und meinte dann irgendwann: Jetzt Du! So kam es, daß ich nach kurzer Zeit weder Kapitän noch Trinker, auch kein Zirkusdirektor oder Lokomotivführer mehr werden wollte. Nein, von nun an suchte ich mir Sender mit klassischer Musik und dirigierte Opern und Sinfonien. Mit großen Gesten. Und rotem Kopf.
„Nessun dorma!“ war die Lieblingsarie meiner Großmutter. Noch heute treibt mir der alte Jussi Björling (gern auch der dicke Pavarotti) Tränen in die Augen: „Vincero!“, das hat sie mir beigebracht und noch viel mehr: Wie hätte ich sonst so früh wissen können, wer Puccini ist und daß es eine Liebe gibt, die sich verkleidet als Musik aus dem Radio in die Herzen schwingt. Es gab damals sogar Nächte, in denen ich, den Kopf voller Musik, durchschlafen konnte und endlich einmal nicht des Nachts aufwachte und voller Schrecken war. Und wenn doch, dann hörte mich die alte Fini und nahm mich zu sich, auf ihre alte blaue Schlafcouch.
Zwar stand mein Vater damals oft genug vor der Tür, wollte, daß ich heimkam, dorthin, wo ich angeblich hingehörte, aber Oma Fini weigerte sich: “Der Junge bleibt hier! Geh zum Arzt! Du hast doch immer noch den Krieg in den Knochen!” Damals verstand ich nicht so recht, was sie damit meinte, doch erinnere ich unvergessliche Bilder: Eines Abends saßen wir alle, auch mein Vater, rund um den spitzengedeckten Tisch in Großmutters Stube. Der Alte trank Bier, die Frauen Eierlikör. Die Stehlampe leuchtete gelb, die Uhr tickte und Oma Fini schaltete ihre neue Phonotruhe ein: „Gleich fängt es an! Hört einfach zu!“
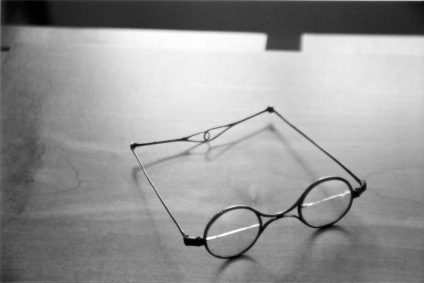
Ich heiße Beckmann. (Vornamen hast Du wohl nicht, Neinsager?) Nein, seit gestern, seit gestern heiße ich nur noch Beckmann. Einfach Beckmann, so wie der Tisch Tisch heißt. (Wer sagt Tisch zu Dir?) Meine Frau. Nein, die, die meine Frau war. Ich war nämlich drei Jahre weg in Russland, und gestern kam ich wieder nach Hause. Das war das Unglück. Drei Jahre sind viel, weißt Du. Beckmann, sagte meine Frau zu mir, einfach nur Beckmann!
Wolfgang Borchert und sein Stück „Draußen vor der Tür“ – wie oft habe ich es seitdem gehört und immer wieder gelesen. Ich merkte, daß mein Vater beim Zuhören immer unruhiger wurde, eine Zigarette nach der anderen rauchte. Und als Beckmann begann, von seinen Albträumen zu erzählen, liefen ihm Tränen über das Gesicht.
Aber sie rotten sich zusammen die Verrotteten und bilden Sprechchöre, Beckmann brüllen sie, Unteroffizier Beckmann, immerzu: Unteroffzier Beckmann und das Brüllen wächst, und das Brüllen rollt heran, so würgend groß, daß ich keine Luft mehr kriege und dann schreie ich, dann schreie ich los in der Nacht und davon werde ich dann immer wach…
Ich saß da, vor dem Radio, und konnte kaum noch atmen, die Kehle zugeschnürt und erinnerte meinen Vater, wie er noch Monate zuvor oft des Nachts gestöhnt hatte: „Ich krieg keine Luft mehr! Ich sterbe!“ Diesem Beckmann ging es nicht anders. All den Toten und Verrotteten auch nicht. Und mein Vater – dieser große, schwere Mann – hatte geweint. Richtig geweint. Ich schwitzte vor Angst. Oma Fini stand auf, nahm mich in den Arm und drückte meinen Kopf an ihre Brust. Sie roch nach Kittelschürze.
Dann setzten wir uns wieder. Hörten zu. Bis zum Ende. Hörten jenen Unteroffizier Beckmann, den ich später als Langhaariger auf der Berliner Vagantenbühne wiedertraf. Meine Großmutter hatte uns Karten gekauft. Danke, Fini! Auch für “Borcherts Gesammelte Werke”, die Du mir geschenkt hast und für all die Stunden, die wir gemeinsam vor Deinem Radio verbracht haben – aufgewühlt, staunend und lachend. Ganz ohne Internet und Uploadfilter.



