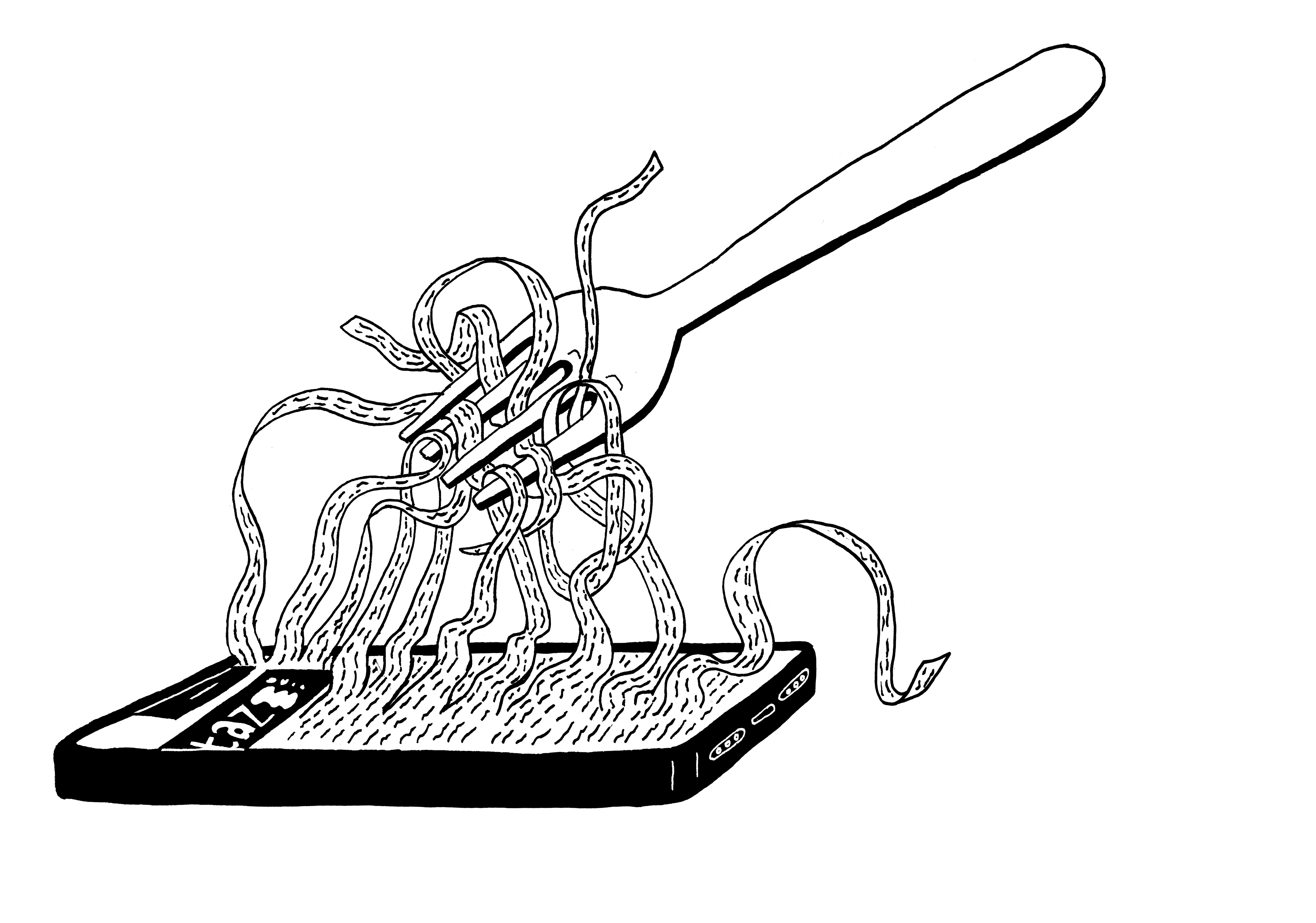Achtung, Berliner: Heute abend unbedingt zur Reformbühne Heim & Welt im Kaffee Burger kommen. Nicht nur, dass wir mit Falko Hennig den derzeit wohl meist äh, besprochensten Schriftsteller des Landes dabei haben (wenn Hermann Horstkotte auch wiederholt nicht in der Lage ist, mittels Google-Recherche den richtigen Namen unserer Veranstaltung herauszufinden), auch die Gäste haben es in sich: Der großartige Songwriter Danny Dziuk wird einige seiner neusten, noch unveröffentlichten Hits (und es sind Hits!) vorstellen, und Neuberliner Mischa-Sarim Verollet, dessen schwungvolle Frisur praktisch nur mit Gesine Schwan zu vergleichen ist, gibt sozusagen seinen Einstand bei uns. Aber: nicht vergessen, den Videorekorder zu programmieren. Denn neidlos muss zugestanden werden, dass die ARD heute ein Programm aufbietet, dass fast so gut ist wie die Reformbühne: der TATORT „Nie wieder frei sein“ vom BR, den ich für den Tatort-Fundus besprochen habe:
Dieser TATORT geht zur Sache. Und zwar auf für die Reihe sehr ungewöhnliche Weise.
Schon die Eröffnungssequenz hat es in sich: in fahlem Licht sehen wir, wie ein Mann an einer Kiesgrube vorfährt, einen übel zugerichteten, halbnackten Frauenkörper aus seinem Lieferwagen zerrt, wie einen Müllsack, der Kopf des leblosen Leibes schlägt unbarmherzig auf den Boden. Der Mann reißt die letzten Textilien vom Torso, besprüht den Körper mit einer Flüssigkeit mit der emotionalen Beteiligung eines Schlachters, der eine Sau für die Wurstwerdung vorbereitet. Er hat sein Werk verrichtet, ohne sein Opfer eines Blickes zu würdigen braust er davon. Wir schlucken. Und dann ein echter Schock-Effekt: Unter der blutverschmierten, durchsichtigen Plastikplane bewegt sich plötzlich der Kopf der vom Zuschauer sicher für tot gehaltenen Frau, eine kurze Szene wie in einem Horrorfilm. Der Auftakt sitzt.
Derart eingestimmt ist uns also schon nach Ablauf des Vorspanns klar: Herzenswarme Weihnachtsbesinnung ist nicht zu erwarten von diesem dritten TATORT aus München in diesem Jahr. Die Härte der Eingangsszene ist aber kein Effekt um des Effektes willen, sondern dient dazu, den Kontrast aufzubauen zwischen der archaischen Brutalität des Verbrechens und der Bastion der Zivilisation, in die der Film uns nun für längere Zeit führt, auch das unüblich im TATORT: in den Gerichtssaal nämlich. Es folgt ein ausführliches Justizdrama. Die Ermittlungen sind also bereits abgeschlossen, der Schlachter aus dem Lieferwagen ist überführt und dingfest gemacht, die Frau, so erfahren wir nun, wurde vergewaltigt, hat aber überlebt. Anders als ein früheres Opfer mutmaßlich desselben Täters, dessen Schwester als Nebenklägerin auftritt. Den Schreck von der bestialischen Eingangssequenz noch in den Knochen, schauen wir nun auf eine ordentliche, geregelte Welt mit klaren Regeln und Normen und Rechten für jeden. Das ist die entscheidende Errungenschaft des Rechtsstaates, und aufgrund der emotionalen Verwerfungen, die Verbrechen, erst recht so grausame, nun einmal auslösen, eine Errungenschaft, die immer wieder neu begründet und verteidigt werden muss.
Denn natürlich wollen alle den mutmaßlichen Täter möglichst hart verurteilt sehen, zumal einfach alles gegen ihn spricht. Es besteht kein vernünftiger Zweifel: Markus Rapp hat zwei Frauen vergewaltigt, eine von beiden hat es physisch nicht überlebt, die andere ist psychisch zerstört und schabt sich zwanghaft die Haut vom eigenen Leib. Eine dritte Frau nimmt eine ganz andere Rolle ein: Die junge Anwältin Regina Zimmer hat die Pflichtverteidigung Rapps übernommen, sie ist gut, talentiert und ehrgeizig. Und sie glaubt an das eiserne rechtsstaatliche Prinzip, dass auch der Beschuldigte das Recht auf eine möglichst gute Verteidigung hat. Auf die Einhaltung der Regeln. Jener Regeln, die er selbst wahrscheinlich auf widerlichste und größtmögliche Weise verletzt hat, sicher. Glaubt sie wirklich an ihre Rechtsethik? Oder interessiert sie sich mehr für ihre Karriere und weiß, dass es für sie das Beste ist, je erfolgreicher sie hier juristisch argumentiert?
Wie dem auch sei, sie hat Erfolg mit ihrer Strategie. Die Komissare Batic und Leitmayr haben einen Formfehler bei den Entwicklungen begangen, ein entscheidender Beweis ist daher nicht gerichtsverwertbar. Eine Bagatelle, eine pragmatische Selbstverständlichkeit eigentlich im höheren Interesse, den Täter zu stellen, natürlich. Die Rechtsverletzung durch die Ermittler ist lächerlich angesichts der Dimension des Verbrechens auf der anderen Seite. Aber, so sehr der Zuschauer sich auch über kleine Regelverletzungen im Dienst der guten Sache freut – ganze TV-Komissarskarrieren gründen schließlich darauf –, so klar ist es eben doch: Sie haben geltendes Recht gebrochen. Und das gilt für alle, auch für mutmaßliche Mörder und Vergewaltiger. Zum Entsetzen der Ermittler, des Opfers und der Angehörigen wird Rapp freigesprochen.
Es folgt der Ausnahmezustand für alle Beteiligten. Ich zumindest erinnere mich an keinen TATORT, der in derartig unerbittlicher Konsequenz die Verwerfungen ausleuchtet, die sowohl das Verbrechen als auch der Richterspruch für alle Beteiligten bedeutet. Da ist zunächst das Opfer, ohnehin ein psychisches Wrack, für die der Alptraum nun von Neuem beginnt. Dass das ihre Kräfte überfordern wird, erkennen wir schnell. Zumal der Täter durch den Warnschuss keineswegs verschreckt in Deckung geht, sondern im Gegenteil richtig aufdreht. Und doch lässt der Film immer einen klugen kleinen Zweifel: Ist er überhaupt der Täter? Alles spricht gegen ihn – auch in der Filmsprache –, aber haben wir Zuschauer genau das nicht schon oft genug erlebt, damit wir in die Falle gelockt werden? Und am Ende wird doch alles gedreht, und es stellt sich heraus, dass wir irgendein winziges Detail übersehen haben, dass der vermeintliche Täter in Wirklichkeit unschuldig war und nur durch irre Zufälle unter den erdrückenden Verdacht geriet? Und ist diese Vorverurteilung, der wir dann aufgesessen wären, nicht ebenso schrecklich? Wenn, wie hier vorgeführt, Nachbarschaft und Freunde der Opfer, emotional aufgewühlt, zum Bürgerwehrmob mutieren und das mutmaßliche Monster in Selbstjustiz richten wollen. Wenn der alleinerziehende Vater des Verdächtigen Schmähungen an seine Wand geschmiert findet, wenn er selbst es einfach nicht glauben will, dass sein Sohn so etwas getan haben könnte, wenn er sich verzweifelt leidend windet und, auch das ist klar, längst ebenso Opfer geworden ist. Und die Ermittler, die es ja wissen, die den Täter überführt haben und eben doch diesen einen Fehler begingen. Der Fehler, der nun zum Freispruch führte, sie also trotz geglückter Aufklärung zu völligen Versagern macht. Aber hätten sie überhaupt anders vorgehen können, zumal wenn es nur um eine Formalie ging? Eine Formalie allerdings, die nun den GAU ausgelöst hat. Die nun versuchen, ihre Schuld auszubügeln, die sich verantwortlich fühlen für die Katastrophe, die sie ausgelöst haben, und die fürchten müssen, es könne alles noch viel schlimmer kommen und am Ende sie ganz direkt Schuld sein lassen an weiteren Morden. Und die Anwältin, die doch nur ihren Job gemacht hat. Gut gemacht hat. Die im Grunde eine Heldin ist, weil sie das Recht Recht werden ließ. Weil es ohne solche Menschen nicht geht, die auf das große Ganze achten und sich nicht vom vordergründig Offensichtlichen ablenken lassen. Die übergeordnete Ideale verteidigen. Und die sich nun mit Morddrohungen und Schmähungen überzogen sieht, der blanker Hass entgegenschlägt, von den Angehörigen, den Ermittlern, der Öffentlichkeit, die keinen Frieden mehr finden kann. Die sich, obwohl sie alles richtig gemacht hat, ebenfalls schuldig fühlt und diese Schuld abzutragen versucht, indem sie auf den mutmaßlichen Täter einzuwirken versucht. Und seinem Vater zuspricht. Und dann sind da noch die Angehörigen der eigentlichen Opfer, die hilflos der Zerstörung zusehen müssen, die mit ihren eigenen Schuldkomplexen nicht mehr fertig werden, die irgendwann beginnen, sich selbst zu zerfleischen.
Nie wieder frei sein, so zeigt sich spätestens im zweiten Drittel des Films, das gilt hier für alle Beteiligten, so oder so. Ein hochkonzentriertes Stück um Recht und Gerechtigkeit, das sich nicht eine Sekunde sinnloser Abschweifung gönnt, dem es gelingt, der Diskurskrimi-Falle, in die man in Köln beispielsweise so konsequent wie bereitwillig tappst, nämlich eben alle Aspekte des verhandelten Themas irgendwie in die Handlung einzubauen und wie im Volkshochschulkurs abzuarbeiten, fast vollständig zu vermeiden. Fast – hier wäre mein einziger Kritikpunkt, denn ganz am Ende fehlt vielleicht der Mut zur filmisch ganz radikalen Lösung, in der Aufklärung wird die Schraube des „Ausleuchtens aus allen Perspektiven“ vielleicht eine Umdrehung zu weit gedreht.
Aber was soll’s: Es bleibt ein weit herausragender Film, und das keineswegs nur im Vergleich zu „normalen“ TATORTen.
Fast ist es eine feine Ironie der ARD-Sendeplanung: Gleich zu Beginn des TATORT-Jahres 2010 wurde uns mit „Weil sie böse sind“ ein außerordentlicher, mutiger, radikaler Film präsentiert, den ich damals hier besprochen habe und bei dem ich schrieb, dass die Nachfolger im Jahr es sehr schwer haben würden, an ihn heran zu kommen. Nun ist es (fast) zum Jahresabschluss doch noch einem Beitrag der Reihe gelungen.
Eine kleine Randnotiz soll hier nicht fehlen: Die zuständige Redakteurin des Produktionssenders BR, Silvia Koller, ist an diesem Mittwoch vor der Erstausstrahlung des jüngsten von ihr verantworteten Films im Alter von 68 Jahren gestorben. Die Süddeutsche Zeitung schreibt: „Ihr Gespür für Stoffe, für Figuren war fast einmalig im öffentlich-rechtlichen Konsenssystem. Sie verstand etwas vom Film und vom Fernsehen.“ Über 50 TATORT-Folgen hat sie mitentwickelt. Möglicherweise war ihr Letzter, dessen Fertigstellung sie noch erlebte, auch ihr Bester.