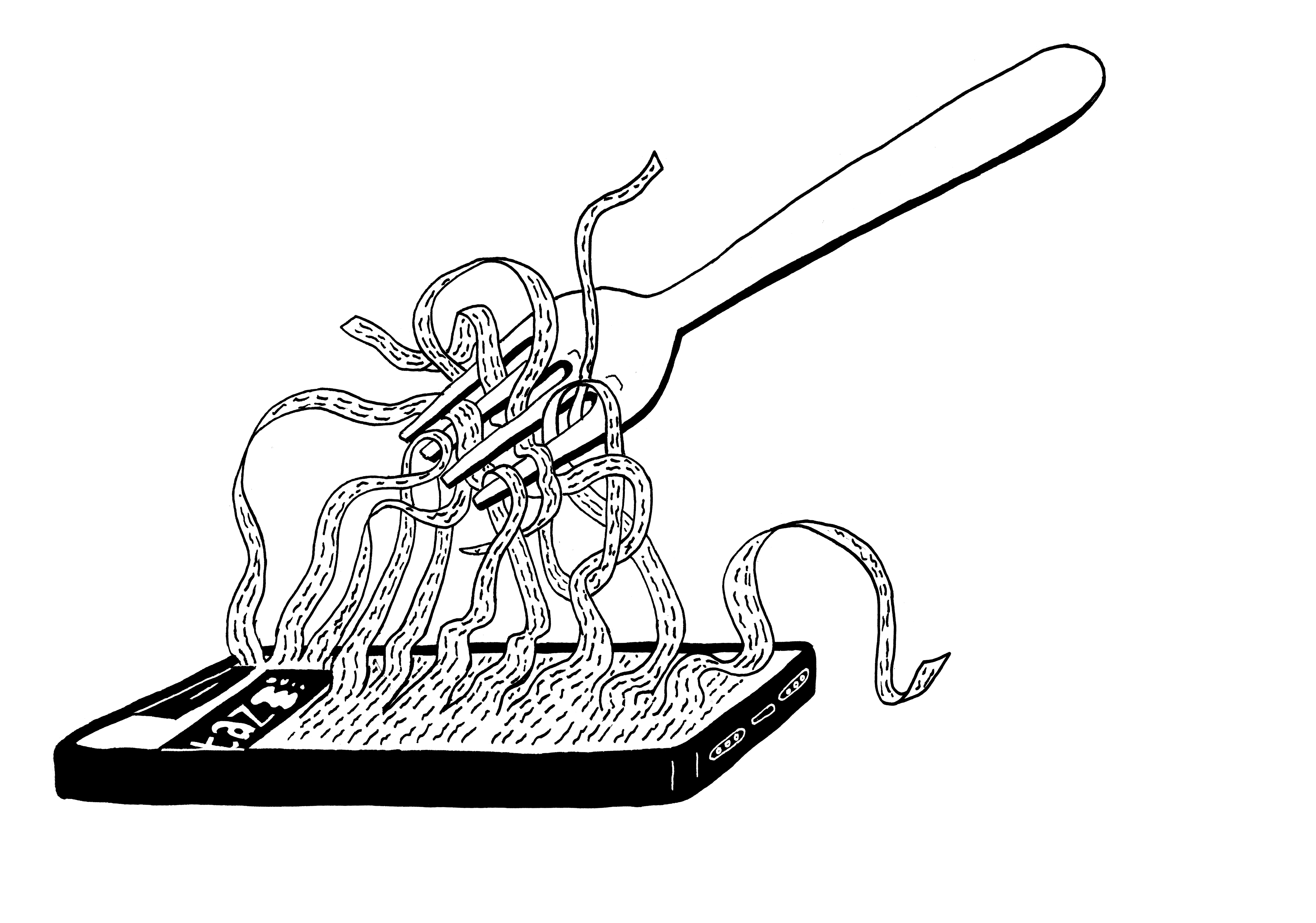„Wozu hat Geschöpf gelebt? Und warum ist es gestorben? Was heißt das: gelebt, und was heißt das: gestorben??“ Diese Worte des jüdischen Schriftstellers Sholem Aleichem begleiten Jean sein ganzes Leben. Was heißt Familie, welchen Platz nimmt sie ein, konfrontiert man sie mit Krankheit und Tod? Was bedeutet es, jüdisch zu sein?
Jean ist der mittlere Sohn der drei Popper-Kinder. In der frühen Kindheit ging er neben den impulsiven Eigenheiten seines großen Bruders Serge unter; war jedoch auch sein engster Kompagnon. Die jüngste Schwester, genannt Nana, war das Lieblingskind der Eltern. Die drei hatten nie einen besonders engen Bund, waren viel zu unterschiedlichen und hackten zeitweise gern aufeinander herum. Jahre später hat Nana mit ihrem spanischen Mann zwei Kinder, Serge mit seiner Frau Valentina ebenfalls. Bei Jean gibt es kein Hallo, wenn er heimkommt; es gibt aber eine lose liebevolle Beziehung zu einer Frau namens Marion. Jean kümmert sich verantwortungsvoll um ihren Sohn Luc; manchmal denken sie doch, man sollte zusammenziehen.
Nach langer Krankheit der Eltern und ihrem Tod finden sich die drei Geschwister fremd voneinander; Serges Tochter Josefine initiiert eine gemeinsame Reise nach Auschwitz. Wenn man sich bereits einmal mit der Vergangenheit auseinandersetzt, kann man es auch gleich richtig tun. Die drei Popper Kinder hatten eher wenig jüdischen Einfluss in ihrer Kindheit, Mutter und Vater waren gegensätzliche Pole in diesem Aspekt.
Die Reise verläuft nicht so, wie angedacht. Schuld daran trägt vor allem Serge, der aus den impulsiven Eigenheiten über die Jahre eine standfeste egoistische Ader ausgeprägt hat. Einzig in Jeans Gesellschaft zeigt er manchmal, wie er an sich selbst verzweifelt. Doch auch Jean der Vermittler schlägt sich nicht immer auf seine Seite.
In dem Buch treffen nicht nur die drei Lebensrealitäten und Charaktere der Geschwister zusammen. Yasmina Reza zeichnet auch ein facettenreiches Bild jüdischen Lebens an sich. Sie bricht Klischees auf und enttarnt Vorurteile, zeichnet Widersprüche nach und stellt die Heterogenität des jüdischen Lebens dar. Viele Aspekte werden berührt, es geht um Herkunft und Sprache, um Religion und Tradition, die Schoah und Israel, um den Umgang mit Erinnerung. All dies geschieht ohne Scham und ohne Urteil, bisweilen mit einer leichten Note Ironie, ganz im Charakter des personalen Erzählers. Rezas eigene jüdische Geschichte dient ihr als Inspiration, wie in einem Interview von 2000/2001 deutlich wird: „Für mich ist Schreiben eine Erforschung des Menschlichen, ein Erschließen des Unbekannten. Das Schreiben erlaubt mir, andere Leben zu leben.“
Für mich entsteht die Spannung des Werkes in Rezas Stil, der Kuriosität mit Banalität mischt. Die Spannung wird nicht ausschließlich inhaltlich hergestellt (wenn auch zu einem großen Teil), sondern auch durch den Stil und die damit verbundene Wortwahl selbst, durch die oft ironische Intonation und die allgemein nachdenklich-pessimistische Grundstimmung.
Yasmina Reza zeichnet mit diesem Buch eine konfliktreiche, komplizierte Wirklichkeit nach, in einem Stil, der uns jedoch nicht allein zurücklässt. Die Fragen, die sie nach Familie, Krankheit, und Tod stellt, betreffen jeden von uns. Früher oder später.
ISBN: 978-3-596-70694-5