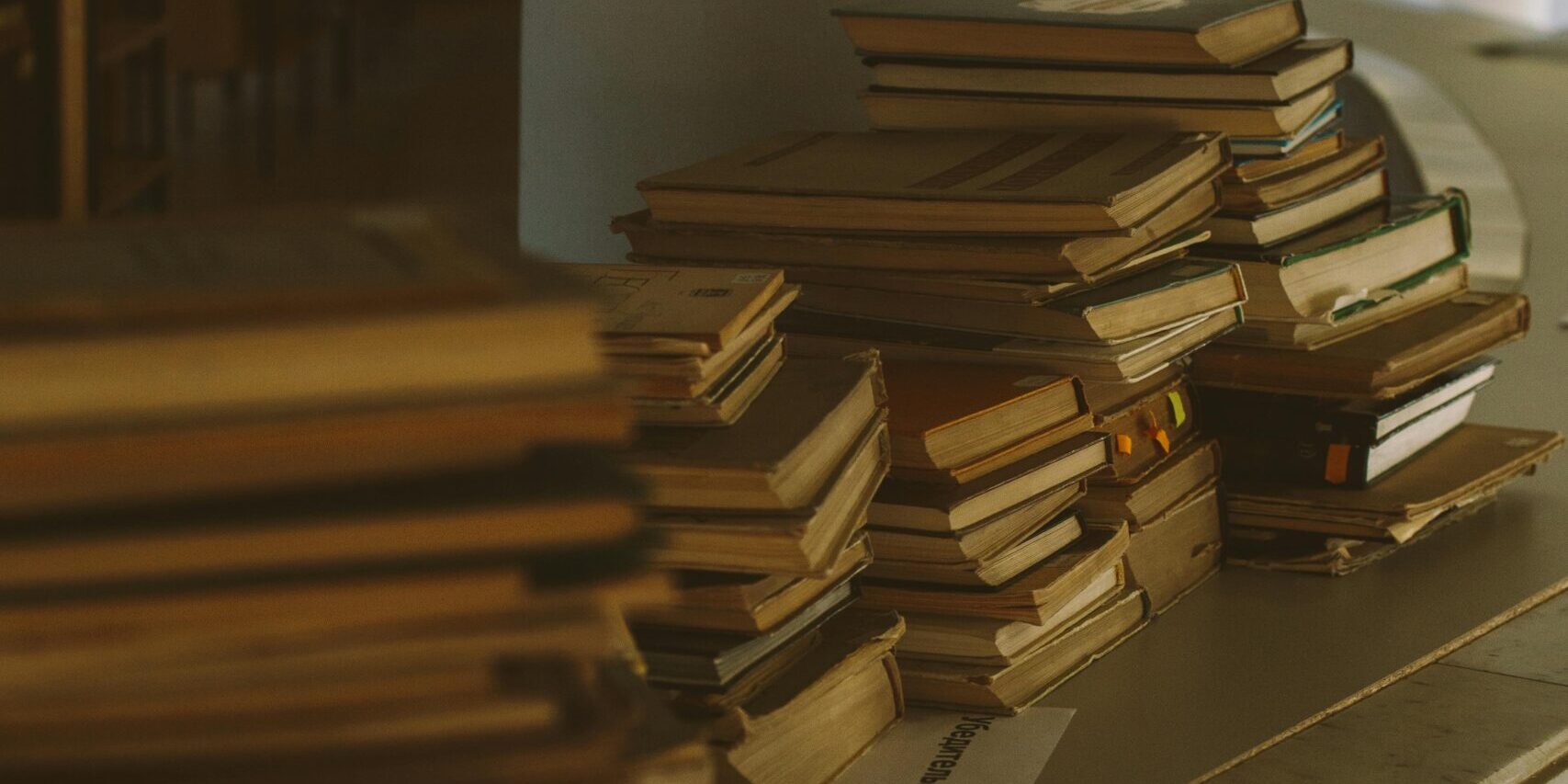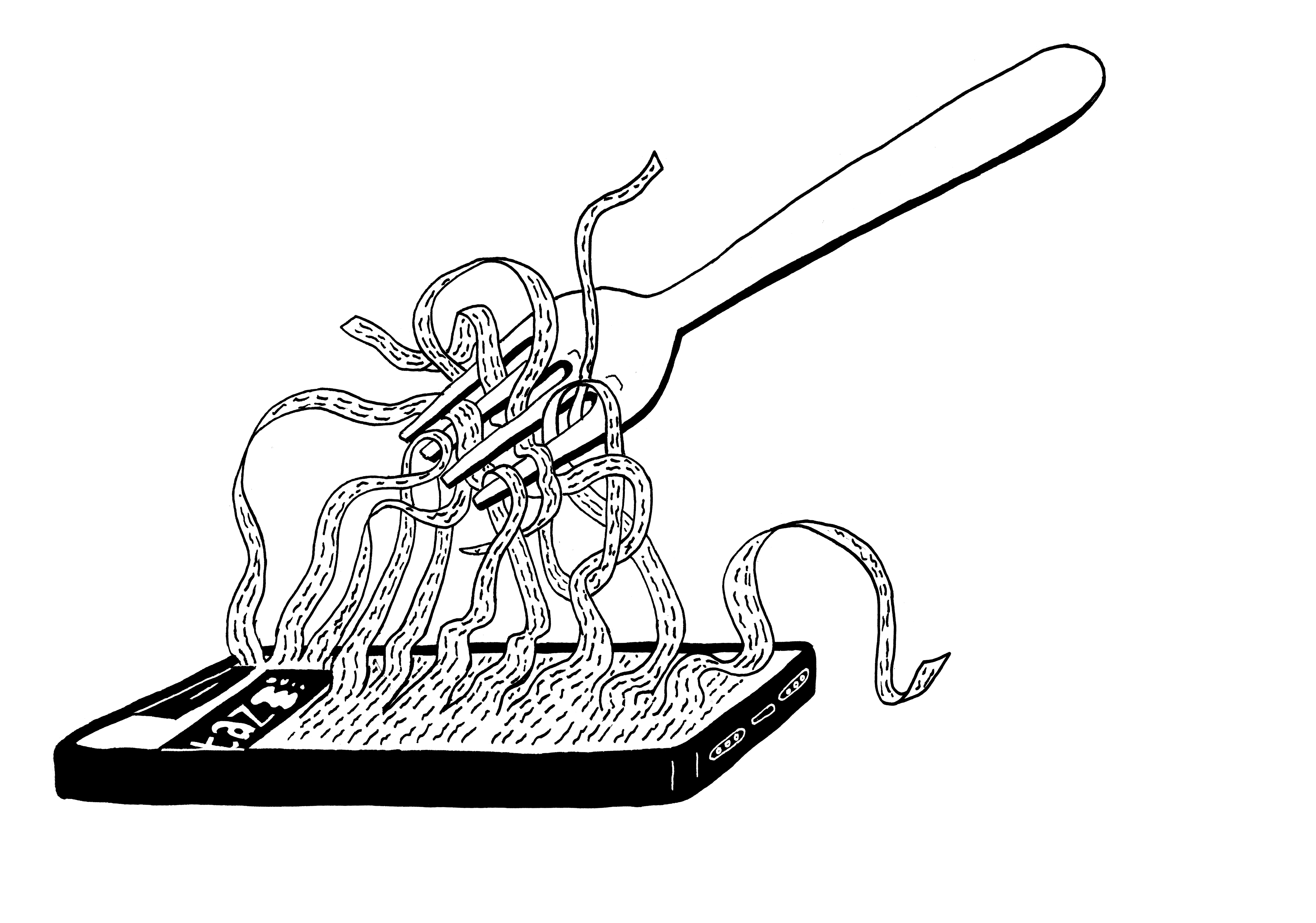Über das schönste Gefühl der Welt ist viel geschrieben worden; meist geht es um heterosexuelle Beziehungen. Heutzutage sind Liebesromane oft rein unterhaltender Natur; ich finde sie trotzdem vergleichsweise langweilig. Und oft viel zu kitschig. Vielleicht kommt daher meine eher negative Einstellung. Stefan Zweigs „Verwirrung der Gefühle“ von 1927 spielt in einer ganz, ganz anderen Liga.
Das Geschehen dreht sich um den jungen Studenten Roland W., der in Berlin alles tut, außer zu studieren. Nachdem sein Vater unerwartet in eine seiner Eskapaden platzt, muss er den Platz räumen. Es geht in eine kleine, bürgerliche Stadt Mitteldeutschlands, in der er kaum eine andere Wahl hat, als sich auf sein Studium zu konzentrieren. Am ersten Nachmittag platzt er unerwartet in eine Diskussion. Dort lernt den Professor für Philologie kennen und wird – wie viele Studenten – sofort magisch angezogen von seiner lebendigen Art zu erklären, rezitieren, argumentieren, unterrichten: „Mit einem einzigen Riss stellte er jene ungeheure Stunde Englands dar […]. Plötzlich war die Erde breiter geworden, ein neuer Kontinent entdeckt […], und unwillkürlich spannt sich die Seele ihr gleich zu sein – auch sie will weit sein, auch sie bis ins Äußerste dringen im Guten und im Bösen; sie will entdecken, erobern, jenen Konquistadoren gleich, sie braucht eine neue Sprache, eine neue Kraft.“
Doch der Professor scheint Roland wohlgesonnen, er bietet ihm sofort eine Unterkunft in seinem eigenen Haus an und hält ein Auge auf seine Studien. Er weckt in Roland die Begeisterung für die geistige Herausforderung. Als das Pendant zu dem, was ihn in Berlin fesselte, reißt es ihn gleichermaßen mit sich; alles, was ihn antreibt, ist die tiefe Bewunderung für seinen Lehrer, in dessen Haus er wohnt.
Mit der Zeit finden sie eine tiefe Freundschaft, sprechen jeden Abend und Roland lernt auch seine Frau kennen. Roland hilft seinem Professor schließlich, seinem Werk zur Literatur der elisabethanischen Epoche weiterzuarbeiten. Mit der Zeit entwickelt sich ein immer engeres Verhältnis zwischen ihnen und Roland weiß seine Emotionen kaum zu deuten. Doch viele Dinge bringen Rolands Gefühle in Verwirrung; einerseits ist es die unterkühlte Beziehung des Professors mit seiner Frau; anderseits die Tatsache, dass die Beiden sich gleichermaßen um Rolands Aufmerksamkeit zu reißen scheinen. Da ist die Abgeschlossenheit des Hauses von der Außenwelt, die Art, wie die Menschen ihn mit abschätzigen Blicken bedenken, umso mehr, je länger in der Umgebung des Professors verweilt. Und die Widersprüchlichkeit im Verhalten des Professors selbst, erst verweilen sie in tiefer Zuneigung, dann weist er ihn kalt zurück.
Je weiter die Arbeit am Buch voranschreitet, desto mehr steuert die Handlung auf eine Katastrophe zu. So wie es ist, kann es nicht bleiben. Nach einem Tagesausflug von Roland zusammen mit der Frau des Professors und einem befreundeten Ehepaar wendet sich schließlich das Blatt.
Ich habe dieses Buch verschlungen, in einem Stück. Und ich kann sagen, dass es eines der wenigen Liebesromane ist, die ich für immer hochhalten werde. Trotz der Kürze des Buches ist die Beziehung facettenreich ausgearbeitet, die Sprache Zweigs hat sicherlich ihren Anteil an der Intensität der Gefühle. Der respektvolle und unbefangene Umgang mit Homosexualität sowie die Verurteilung des allgemeinen gesellschaftlichen Umganges damit wirkt für 1927 fast … aus der Zeit gefallen. Dabei erhielt Zweig viel positives Feedback aus der damaligen europäischen Literaturlandschaft. Nicht nur zu seinem Stil, wie von Maxim Gorki, der schrieb: „Ihr Stil beinahe jene wundervolle Plastizität, Strenge und Kraft erreicht, die ich nur bei Leo Tolstoi antreffe. Ein höheres Lob als dieses kenne ich nicht, aber ich halte es in diesem Fall nicht für übertrieben.“, sondern auch zu seinem Umfang mit dem Thema selbst. Diese aufgeklärte Resonanz steht im starken Kontrast zu den Ideologien, die sich nur wenige Jahre später in Deutschland mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten verbreiteten. Diese Entwicklung beeinflusste auch Zweig, er floh ins Exil nach Brasilien und nahm sich in der Folge depressiver Episoden sein Leben.
In „Verwirrung der Gefühle“ zeichnet Stefan Zweig eine echte Liebesgeschichte, intensiv geprägt Widersprüchlichkeiten und Selbstverständnis, ekstatischem Glück und tiefem Leid. Es ist ein gesellschaftskritischer Roman, dessen Ideen und Darstellungen auch heute noch Anwendung finden können.
ISBN: 978-3-15-020691-1