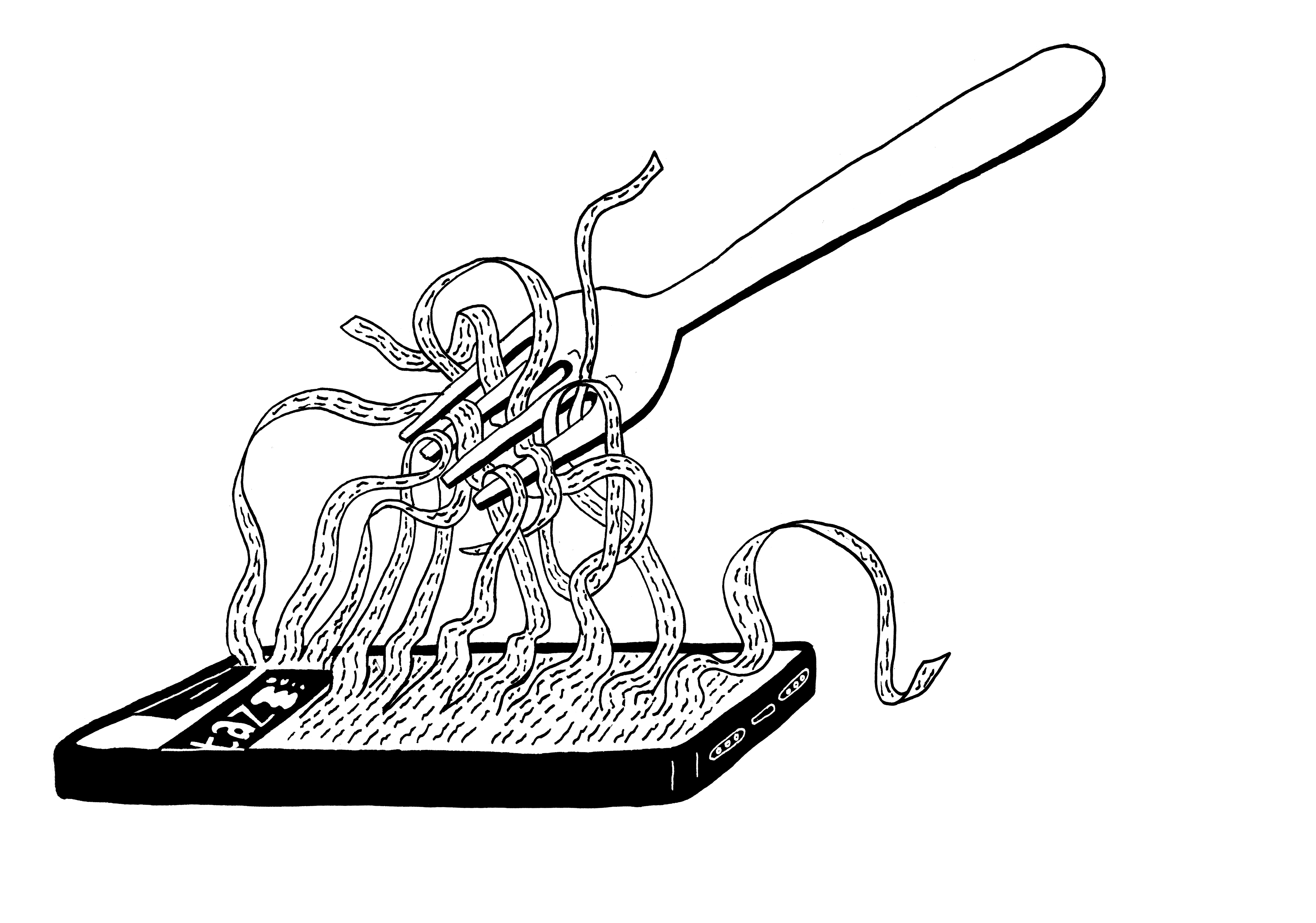Von Hitlers Kindervernichtung 1941-45 lässt sich nicht pathosfrei sprechen, das ergibt sich schon aus dem Koinzidieren von Kindheit und Tod. Entsprechend zurückhaltend wird das Thema in der Fachliteratur behandelt. Allerdings lässt sich auch nicht behaupten, dass es irgendwie vergessen oder tabuisiert wäre.
Der offizielle Reader des Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau zum Beispiel widmet zwanzig von 460 Seiten den Lebensbedingungen der jüngsten Häftlinge im Lager, gegliedert nach folgenden Abschnitten: 1. Jüdische Kinder und Jugendliche, 2. Kinder und Jugendliche unter den Zigeunern; 3. Polnische Kinder und Jugendliche, 4. Kinder und Jugendliche aus Weißrussland und der Ukraine, 5. Im Lager geborene Kinder, 6. Das Leben der Kinder im Lager.
Jeder auf Aufklärung und Rationalität setzende Umgang mit dem Holocaust wird auf große Gefühle und Melodramatik verzichten. Warum tun es die Kinderportraits von Manfred Bockelmann im Leopold Museum nicht? Vielleicht weil sie der Wirkung des rationalen Diskurses nicht trauen und an seine Stelle ein ikonenhaftes Zeichen zur Erinnerung an das Verbrechen setzen möchten. Welche Erkenntnismythe liegt diesem Werk dann zugrunde?
Wir haben zunächst gesehen, dass Bockelmanns Arbeiten den Zwangscharakter der Häftlingsfotografie ignorieren; wir haben weiters gesehen, dass auf der Ebene der psychologischen Motivation des Künstlers eine Familienaufstellung von geradezu epischem Ausmaß mitgedacht werden muss; schließlich hat sich in dieser Untersuchung der neuesten Kultursensation gezeigt, dass sich der Kunstbegriff kaum von einer Museuminstitution dekonstruieren lässt.
Wenden wir uns nun zum Abschluss dem bildnerischen Vorgang selbst zu. Kurator Diethard Leopold schreibt: »Die archaische, brüchige, von der Hand des Künstlers geführte Kohle wirkt auf ihre Weise gegen die Kälte und Stabilität der erkennungsdienstlichen Linse, gegen das Mörderische, kein Widerreden duldende Arrangement«.
Bockelmann möchte das Kreatürliche der gezeigten Menschen bestätigen, eine »plötzliche Präsenz« der Kinder erzeugen. »So werden aus Namen und Nummern wieder Gesichter, und die Anonymität der Statistik ein Stück weit aufgehoben«.
Tatsächlich sehen wir Bilder, auf denen die Kinder und Jugendlichen wie aus einem netten Familienalbum wirken: ein Ausflug in den Prater im Matrosenkostüm könnte das sein, daneben eine Art Bewerbungsbild, und dann wieder ausgemergeltes Elend in Sträflingskleidung mit Nummer und Winkel. Beim Marketing der Ausstellung setzt das Museum ausschließlich auf diese letztere Gruppe der kahlgeschorenen Köpfe.
Manfred Bockelmann hat einmal erklärt, seine Berufung zum Künstler auf einer dreimonatigen Fotosafari 1973 durch Ostafrika erfahren zu haben. Ostafrika? Hat nicht der deutsche Ethnologe Leo Frobenius genau diese Weltregion 1933 zum Herzstück einer Kulturtheorie gemacht, die die Ergriffenheit in den Mittelpunkt stellte?
Frobenius sprach von einer übergreifenden äthiopischen Kultur Schwarzafrikas, die nicht den Intellekt, sondern das Gemüt anspricht. Der Wille zum Sinn geht dort durch eine romantische Hingabebereitschaft; er verlangt die Fähigkeit, sich von einem Werk emotional ergreifen zu lassen.
Wohl seit Jahrtausenden agieren bildende Künstler mit der Arbeitshypothese, ihr Schaffen würde Sinn und Wirklichkeit überhaupt erst konstituieren. Da sie schon Wahrnehmung als einen kommunikativen Akt ansehen, bedeutet Verstehen in der Folge immer relationale Einordnung. Dieses Muster erreicht in der Kunst geradezu ontologische Qualität: Etwas, das sich prinzipiell dem Zeichencharakter entzieht, kann nicht mehr gedacht werden, weil der Gesamtrahmen möglicher Wahrnehmung als kommunizierendes System des jeweiligen Status und der Stellung seiner Elemente gedacht wird.
Im vorliegenden Fall heißt das: Noch das erkennungsdienstliche Relikt vergangener staatlicher Verbrechen signalisiert dem Erinnerungsarbeiter späterer Zeiten seinen Platz im Drama der Geschichte. Der Künstler übernimmt eine schamanische, kunstpriesterliche Funktion, indem er für die anderen in den Hades steigt. Genau diesen Gedanken hat Alfred Hrdlicka am Albertinaplatz in der Figur des Orpheus festgehalten.
Auf diese Weise verwandelt sich Kunst selbst von der immer neuen Benennung eines Transzendenten, die sie im Abendland lange war, zu einem Begriffscode, in dem Symbolelemente mit ihren eigenen Denotationsräumen spielen: der Künstler als Nichtkünstler, das Vernichtete als Erinnertes, der sinnlich Wahrnehmbare der Zeichnung als das paideumatisch Zugängliche.
Einzig dank dieser Erkenntnismythe der Bildkunst kann Bockelmanns Serie »Zeichnen gegen das Vergessen« suggerieren, die Kinder seien ermordet worden, weil sie Kinder waren. Doch das NS-Regime und seine Handlanger haben Kinder und Jugendliche unzweifelhaft aus rassistischen Motiven vernichtet, also weil sie Juden, Slawen oder Roma waren.
Diesen Gefallen macht uns der Hitlerstaat nicht, dass er vor den Nachgeborenen als das unbegreiflich Böse dastünde, das sich ohne ein politisches Motiv an den Schutzwürdigen per se vergriffen hat.
(Ende der Serie)
© Wolfgang Koch 2013
http://www.leopoldmuseum.org/de/ausstellungen/51/manfred-bockelmann