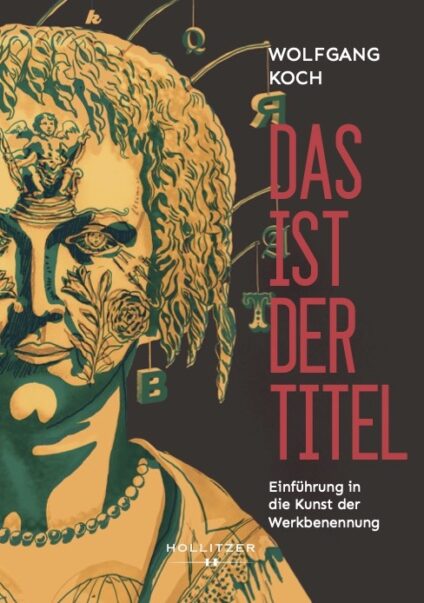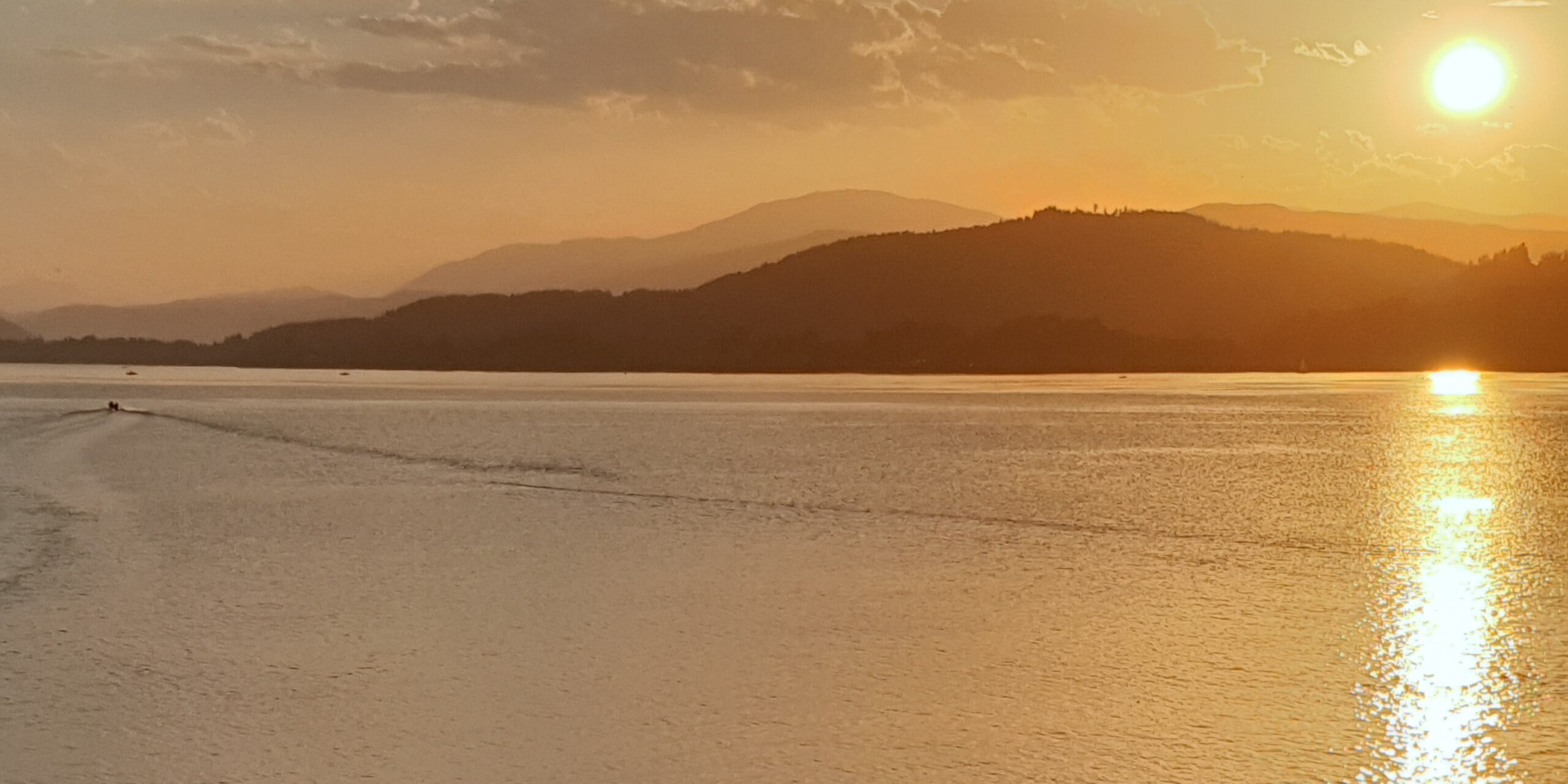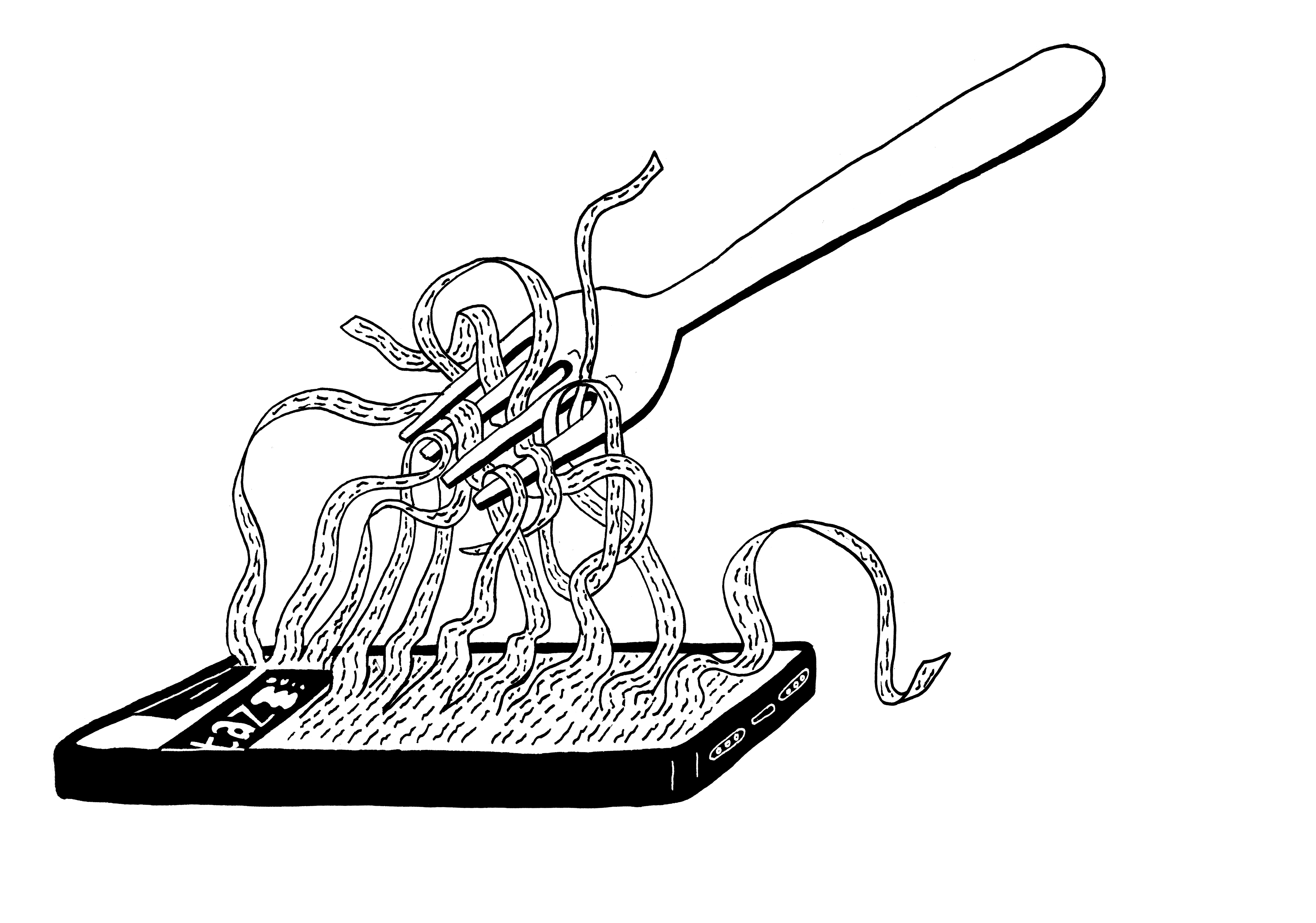Man wird mir kaum Glauben schenken, ich erinnere mich noch an die Grossen und Kleinen der Anfänge, an Peter Härtling, Adolf Muschg, Eckhard Henscheid, natürlich an den sich ständig zur Papstgrösse aufblasenden F.A.Z.-Literaturchef Marcel Reich-Ranicki, der zur Abendstunde am See von dem Bericht erstattenden taz-Redakteur Mathias Bröckers schreiend komisch nachgeäfft wurde. Ich erinnere mich an die austriakischen Finsterlinge Humbert Fink und Gertrud Fussenegger, an namhafte Juroren wie den Schriftsteller Manès Sperber, an den krawattentragenden Spiegel-Kritikaster Hellmuth Karasek, den vornehmen Literaturgelehrten Peter Demetz, an die Gens de lettres Volker Hage, Thomas Hettche, Iris Radisch, Elisabeth Bronfen, Burkhard Spinnen, Hubert Winkels.
Seit fast einem Halbjahrhundert haben uns die »Tage der deutschsprachigen Literatur in Kärnten« einiges zu bieten. Genau genommen leitete die Veranstaltung im südlichsten ORF-Zentrum des Landes die feierliche Vermählung von Literaturbetrieb und Fernsehen ein, – Erwachsenentaufe in Geplätscher der Wörtherseewellen inklusive.
Seit damals, 1977, gilt poëtische Kulturware, die nicht televisionär an ein breiteres Publikum vermittelt wird, am Buchmarkt als unverkäuflich, das heisst als nichtexistent. Warum es in der medienhistorischen Ehe von Wort und Live-Bildereignis dann fünf Jahrzehnte lang Schritt für Schritt nach unten ging, hat verschiedene, einander überlagernde Ursachen, von denen ich hier nur drei anreissen will.
1. Der IBP ist durch den medienhistorischen Wandel in eine Schieflage geraten.
Zunächst wurde die Literaturproduktion im Bewerb nach der Logik der TV-Maschine kolonialisiert. Bald verlangte man von den Autor·innen nicht nur einen guten Text, sondern vor allem persönliche Inszenierungskompetenz. Schon in den 1980er-Jahren verschob sich das Geschehen vom Fachseminar mit Publikum auf kalkulierte Theatralisierung. Ich erinnere mich an die Ejakulation homophiler Morbidität durch den Kärntner Bergbauernsohn Josef Winkler, eine barocke Suada, eine lachende Ungläubigkeit … an das aus einer präzisen Medienanalyse hervorgegangene Showbluten des Rainald Goetz. Ich erinnere mich an den ersten grossen Auftritt auf der literarischen Bühne von Sten Nadolny (›Entdeckung der Langsamkeit‹), – der Deutsche teilte hernach den errungenen Preis revolutionär unter seinen Mitbewerbern auf –, und ich habe auch die grandiose Performance von Substantivverkettungen des oberösterreichischen Multitalents Anselm Glück nie vergessen.
Zehn Jahre nach dem Start, 1987, reduzierte Jury-Reformer E.A. Rauter die Gerichtshof-Atmosphäre der Veranstaltung, und die aufmüpfige Jurorin Sigrid Löffler wollte die Live-Übertragung der Beratungen damals überhaupt beendet sehen. Daraus wurde natürlich nichts. Dem Autor Urs Allemann gelang es im selben Jahr, seine Mitbewerber dazu zu bewegen, »angesichts der Vergangenheit von [Bundespräsident] Kurt Waldheim« auf das Preisgeld zu verzichten und den Betrag an das Jüdische Dokumentationszentrum in Wien auszuzahlen (was die IBP-Veranstalter hartnäckig verweigerten).

Heute ist die Öffentlichkeit, in der solche politischen Symbolakte stattfinden könnten, eine einzige melancholische Ruine. Der ORF stellt die Livestreams der Lesungen und Diskussionen nicht einmal in der eigenen Mediathek zur Verfügung. Um sie zu sehen, zu studieren, um sich damit zu unterhalten, muss das literaturinteressierte Publikum auf 3sat herumsuchen oder Files eines dilettantisch gestalteten Internetspace ansteuern. Die Entscheidungsrunde der IBP-Jury, in der das Siegervotum von jedem einzelnen Mitglied am letzten Tag mündlich gegründet werden muss, ist in einem völlig verlorenen Winkel der virtuellen Realität archiviert.
Der Bewerb ist heute nicht nur ein mediales Desaster. Haben sich in den ersten Jahrzehnten die teilnehmenden Damen und Herren gegen das inszenierte Kunstprodukt von Autorenportraits gewehrt, beugen sich heute alle Versammelten vor werbekundigen Promotionvideos wie die ESC-Musiker vor dem Fluch der Tourismuskampagnen.
Ja, schlimmer noch, Autor·innen, Jury und Autorium nehmen es als vollkommen selbstverständlich hin, dass während Lesung und Diskussion wie in Talk-Shows nervige Bewegtbilder an den Wänden gezeigt werden. Das schöpferische Wort, das unerbittlich Stille und geistige Konzentration verlangt, wird in Klagenfurt-Celovec wie dekantierte Galle in einem telegenen Ritual gedemütigt.

Nach den Lesungen das nächste Ärgernis. Der Moderator plaudert ein fragwürdiges Resummée in die Kamera. Im Stil eines Redaktionsaspiranten wiederholt er ein paar griffige Sätze, die gerade gefallen sind, und gibt das ernsthaft als Zusammenfassung der Sitzung aus. Dass wir Zuschauer·innen dabei für noch dümmer gehalten werden, als wir sind, kommt dem »Kultur«-Fernsehen gar nicht mehr in den Sinn.
Seit 1981 dürfen die Lesenden am Ende zur Diskussion ihres Textes zu ihrer Beurteilung Stellung nehmen. Schon 1987 nahmen sie wieder Abstand davon und zeigten sich – mit wenigen Ausnahmen – unterwürfig und höflich wie Ministranten bei der Fronleichnamsprozession. Seither hat die Literatur unter den begrenzen Gesichtspunkten ihrer Selbst-Mediatisierung wieder eine grosse Schläfrigkeit erfasst. Die Zeichen des Spiels, das diese Kunst einmal war … verwischt, hinausgekrochen aus dem Studio. Die Unterhaltungsregie der Gesten und Gebärden allein bestimmt nun die Eindrücke des Geschehens.
Aus diesem Grund sitzen bei den »Tagen der deutschsprachigen Literatur« schon lange keine Meinungsmacher, Talentsucherinnen, Lektoren mehr beisammen. Das ORF-Studio ist keine unbeschwerte und günstige Gelegenheit für junge Schreibende mehr, ins Scheinwerferlicht der Literatur zu treten. Die Begutachtung der Feinstruktur von Texten wich dem Vermittlungsgeplauder von warenförmigen Identitäten, in den Lesungspausen weitergeführt von der Garten-Moderatorin Cecile Schortmann.
2. Der IBP verfügt über keine den Telehorizont überschreitenden Persönlichkeiten in der Jury.
Das Personal-Dilemma des Bewerbs, der einst das Grossfeuilleton der deutschsprachigen Intelligenzpresse an einem Tisch und anschliessend auf Holzpritschen im Seebad vereint hat, wird in dem einen Wort deutlich sichtbar, welches Berichterstattende heute am häufigsten verwenden: »Wettlesen«. Wettlesen! Könnte dieses hässliche Wort denn eine solche sprachliche Karriere machen, wenn die Autorität der Preisrichter·innen und die Souveränität der Lesenden von Dritten respektiert würden?

Nein, das könnte es nicht. Zeigen Sie mir ein Leichtathletik-Sprint oder ein Marathon-Rennen, das von einem Sportreporter »Wettlaufen« genannt wird! Zeigen Sie mir einen einzigen Jahrgang des Prix de Lausanne, Nachwuchsbörse der Talente in der Ballettwelt, der von irgendwem »Wetttanzen« genannt wurde! Unmöglich! Die Muse im Hase-versus-Igel-Format – eine solche Respektlosigkeit kennt nur der deutschsprachige Literaturbetrieb.
Im Jahr 1997 schrumpfte die Jury des IBP-Bewerbs von zehn beziehungsweise elf auf sieben Mitglieder. 2025 konnten nur mehr drei von ihnen – nämlich Philipp Tingler, Mara Delius und Thomas Strässle – einigermassen an das Niveau der Kritikerleistungen ihrer Vorgängergenerationen anschliessen. Von den Wortmeldungen Brigitte Schwens-Harrant gelang es mir nur jede dritte als konstruktiv zu werten.
»Unpassende« und irritierende Erscheinungen wurden als irrelevant ausgesondert und aus dem Beobachtungsbereich ausgeblendet oder aber in eine Beweisführung überführt, die den Denkstil des Gremiums nicht infrage stellte. Die Jurydiskussion verfügte, wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr, über Akkommodierungs- und Abwehrmechanismen, mit denen sie jede Gefährdung ihres Paradigmas neutralisierte.
Die folgenschwerste Änderung im Regime des Bewerbs war es sicher, den Preisrichtern die Texte aller Kandidaten und Kandidatinnen vorab zugänglich zu machen. Im 49. Jahr berichteten diese nun ganz ungeniert von ihren Eindrücken bei der Erst-, Zweit- oder Drittlektüre der Texte; das Gremium lobte Stimm- und Tonlagen der Lesenden; und es scheute sich trotzdem keinen Moment lang als Höchstes der Gefühle ein wirkliches Überraschungsmoment vor der Kamera einzufordern.
Jury-Vorsitzender Klaus Kastberger, ein Steirer, der mit elementarem Trieb durch die Papierwelt schritt und popige T-Shirts trug, um Jugendlichkeit zu suggerieren, verstand unter der Klagenfurter Textwerkstatt a) das wortreiche Inbeziehung-Setzen der Vorlage zu seinem literaturhistorischem Vorwissen, b) die Einordnung der Beiträge in die jeweilige Regionalliteratur und c) provokant hervorgesprudelte Geschmacksurteile. Der hemdsärmelige Literaturfunktionär entblödete sich nicht einmal, den dumpfen Kriegsprogagandasatz »Putin ist ein Verbrecher, der hunderttausende Menschen am Gewissen hat« in die Runde zu brüllen und damit am zweiten Tag des Bewerbs, nachdem er alles Pathos, das er aufzubringen vermochte, bei der Bekämpfung der für den Nachwuchs so gefährlichen Kritiker-Aversion verbraucht hatte, die ganze Veranstaltung zu seinem Wohnzimmer zu machen.

Kastbergers Ausfall ist mit Worten aus dem Epilog zu der Tragödie ›Die letzten Tage der Menschheit‹ (1917) von Karl Kraus hinreichend kommentiert: »Niemand wird je darüber zuverlässig aussagen, welches Gefühl in der Seele des sterbenden Soldaten mehr Raum hat: das des Grolls gegen die gotteslästerliche Macht, die den Menschen aus dem Glück der Sonne und der Liebe reisst, oder das des Danks an den Kaiser, der noch nie für das Vaterland gestorben ist, sondern zumeist an Altersschwäche und manchmal so spät, dass man erst durch sein Ableben von seinem Dasein Kenntnis erhielt.«
3. Die Trefferquote des IBP lag im Jahr 2025 niedriger als bei jeder Lotterie.
Bei sechs Auszeichnungen für 14 Autor·innen, eine davon durch das Publikum, sollte eigentlich nichts schief gehen. Man sollte meinen: Bei diesem Verhältnis kann man doch gleich eine Lotterie veranstalten. Aber dem war nicht so. Die beachtlichen Leistungen von Thomas Bissingers, Nefeli Kavouras und Josefine Rieks gingen bei der Prämierung komplett leer aus.
Die Bambergerin Kavouras, Mitglied im Team des mairisch Verlags, schilderte in leicht zugänglicher Sprache das zeitgenössische Sterben eines Vaters in seiner dreiköpfigen Familie. Die Jury erkannte weder die Brisanz des Themas: nämlich der Abschiedlichkeit als einer ständigen Variante des Selbstseins auf die Spur zu kommen (Burkhard Liebsch), noch würdigte sie das Charisma einer betont einfachen Sprache, die heute von jedem Menschen verstanden werden kann.
Bei einem Besuch der Tochter im Haus ihres Freundes nimmt Kavouras‘ Geschichte geradezu Robert-Altman’sche Qualitäten an. »Das ist doch auch irgendwie ungerecht«, heisst es da, »wie die hier sitzen und ein gutes Leben führen. Es ist sogar noch ungerechter, dass sie so nett sind und mich zu sich einladen und dass Max‘ Mutter immer nach meiner Mutter fragt. Meine Mutter würde gar nicht auf die Idee kommen, nach Max‘ Mutter zu fragen.«
Josefine Rieks, Autorin der Jetztzeit-Satire ›Dinner, Freitagabend‹ wurde im Promotionvideo wie für das ORF-Erfolgsformat ›Liebesg’schichten und Heiratssachen‹ vorgeführt. Das mochte ironisch gemeint sein; nichts jedoch wird durch den literarischen Kontext von alleine ironisch. An Rieks Text blieb die Darstellung generalisierter Konditionierung junger Erwachsener von Philipp Tingler nicht unbemerkt, doch die Verhexung des Lebens durch formalisierte Sprachbausteine der Selbstoptimierung und des urbanen Konsumismus prallte am UV-Strahlenschutz der übrigen Preisrichter·innen ab wie reizendes Sonnenlicht.

Der Siegertext der Multimedia-Performerin Natascha Gangl wenigstens steht zu recht am Podest, auch wenn seine mit Lob überschütteten formalen Mittel – getreppte Sätze, Weissraum-Orgien, Palindrom und Anagramm – seit Jahrhunderten zur Praxis lyrischer Prosa gehören. Mit der Behauptung, dass der Text ›DA STA‹ dem sträflich unbeachteten Dialekt endlich die verdiente Aufmerksamkeit schenke, ist es ebenfalls nicht weit her. Zur Erinnerung: Im letzten Winter hat der Suhrkamp Verlag mit eintausend Rezensionsexemplaren den Kärnten-Roman ›Wo der spitzeste Zahl der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht‹ von Julia Jost in die Bestseller-Listen gebomt.
Gangl versuchte genau wie Jost in ihrem Fremdenverkehrs-Transgender-Partisanen-Epos aus dem lokalen Idiom Funken für ihre Soundcollage zu schlagen. Das allgemeine erwachte Interesse an Dialekten ist im Augenblick ihres Verschwindens überhaupt nicht neu, und, eben weil es ein Abgesang ist, eigentlich auch kein Grund zur Freude.
Dass der Siegertext 2025 nicht ohne politische Erinnerungsarbeit, konkret: nicht ohne die Erinnerung an eine Massenhinrichtung von jüdischen Gefangenen am Ende des Zweiten Weltkriegs auskommt, dass er ohne der Anspielung auf der »Erbe rechtsextremes Gedankengut in Österreich« nicht funktioniert, weist ihn motivisch als Konfektionsware aus. Gangls Ich-Erzählerin spürt achtzig Jahre zurück liegenden Kriegsgreuel in der Kunstkopfatmosphäre bioakustisch nach. Die imaginierte Person registriert dabei selbst feine Luftbewegungen wie das Blätterrauschen im Wald.
Dieser morphologische Ansatz subjektiver Spurensuche in der Gewaltgeschichte riskiert im Grund genommen nichts. Sprachlich ist der Text souverän gestaltet, keine Frage! Jedoch im Vergleich zu Bissingers Romankapitel, das uns in das angstvolle Bewusstsein einer Jüdin während des lebensgefährlichen Gestapo-Verhörs versetzt, völlig risikolos.
›DA STA‹ ist ein Siegertext, poliert mit demselben Grenzland-Flair, das bereits vor 14 Jahren Maja Haderlap den Weihepokal des eingebildeten Widerstands eingetragen hat. Empathiearm die Agonie der Toten beschwörend, eine Geisterstimme, schmerzvoll sich nicht anerkannter Erinnerungen bedienend, letztlich wenig mehr erzählend als das Rauschen des übertretenden Baches.
© Wolfgang Koch 2025
Fotos: Heinz W. Schmid