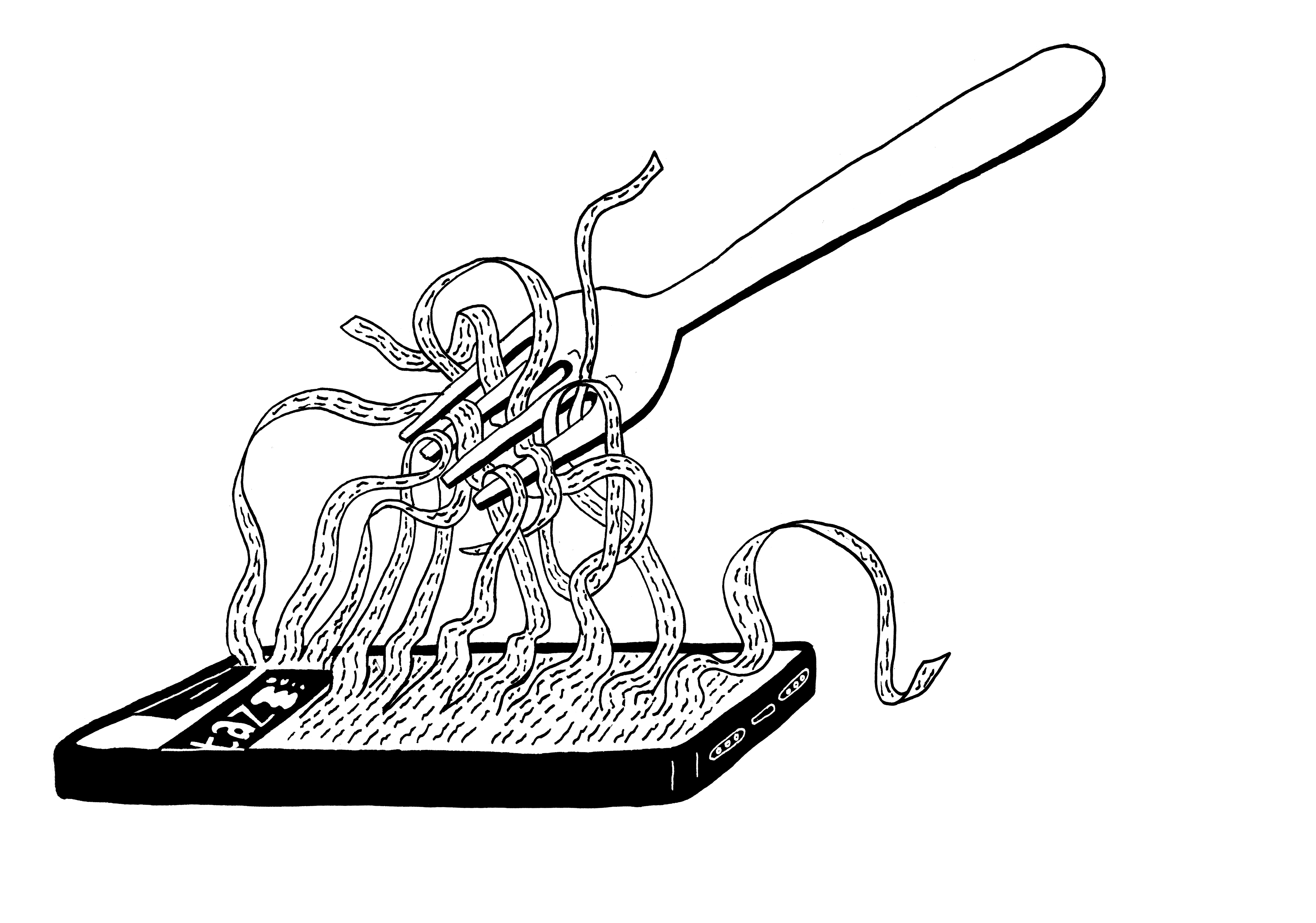Bundesdeutsche Literaturgeschichte / 20CC / Else Lasker-Schüler (*1869) □ Alfred Döblin (1878) □ Kurt Tucholsky (1890) □ (1894) □ Albert Vigoleis Thelen (1903) □ Arno Schmidt (1914) □ Helmut Heissenbüttel (1921) □ Uwe Johnson (1934) □ Hubert Fichte (1935) □ Rolf Dieter Brinkmann (1940) □ Sten Nadolny (1942) □ Peter Kurzeck (1943) □ Botho Strauss (1944) □ Frank Witzel (1955) □ Thomas Kling (1957) □ Wolfgang Herrndorf (1965)
Österreichische Literaturgeschichte / 20CC / Franz Blei (1871) □ Hugo von Hofmannsthal (1874) □ Karl Kraus (1874) □ Franz Theodor Csokor (1885) □ Georg Trakl (1887) □ Gabriele Bitterlich (1896) □ Christine Lavant (1915) □ Ilse Aichinger (1921) □ Heimrad Bäcker (1925) □ Ingeborg Bachmann (1926) □ Thomas Bernhard (1931) □ Konrad Bayer (1932) □ Engelbert Obernosterer (1936) □ Reinhard Priessnitz (1945) □ Anselm Glück (1950)
Deutschschweizerische Literaturgeschichte / 20CC / Robert Walser (1978) □ Adrien Turel (1890) □ Armand Schulthess (1901) □ Rosmarie Buri (1930) □ Jürg Federspiel (1931) □ Adelheid Duvanel (1936) □ Urs Widmer (1938) □ Hermann Burger (1942) □ Urs Allemann (1948)
Deutsche Ränder und Enklaven / 20CC / Gustav Meyrink (1868) □ Leo Perutz (1882) □ Franz Kafka (1883) □ Franz Baermann Steiner (1909) □ Eginald Schlattner (1933) □ Norbert C. Kaser (1947)
Ich setzte die gepflegten Provokationen fort, die ich im Oktober 2024 begonnen habe. Wieder sind vor allem die Zeilen zwischen den Namen der Geehrten zu lesen, wo nichts steht, weder gedruckt noch geschrieben, das heisst diesmal ist zu registrieren, welche im Mainstream und in der Schwedische Akademie verankerte Grössen in dieser Aufzählung still ausgespart bleiben.
Im Folgenden geht es um Sprachkunst aka Literatur, hauptsächlich aus der belletristischen und aus der lyrischen Werkstatt. Dramatische Texte sehe ich lieber auf der Bühne realisiert als am Papier; Hörspiele-Manuskripte im Radio. Darüber hinaus folgt die Nachgiebigkeit gegenüber den grossen Namen einfach der Lesererfahrung und meiner hartnäckigen Fähigkeit zu träumen.
Das Auffälligste an diesem privaten Kanon ist wahrscheinlich das unterschiedliche Gewicht der vier deutschsprachigen Literaturgruppen. Die Liste verzeichnet fast gleich viele Autor·innen a) aus dem Gebiet des getrennten und wiedervereinigten Deutschlands und b) aus der Alpenrepublik Österreich. Diese enorme Bedeutung österreichischer Schriftstellerei am gemeinsamen Lesemarkt lässt sich im ganzen 20. Jahrhundert verifizieren. Sie ist kein Ergebnis irgendeiner österreichischer Geistesart oder einer besonderen Verlagsförderung; die Schreibenden im Süden sind vollkommen abhängig vom Erfolg im bundesdeutschen Literaturbetrieb.
Noch seltsamer ist die Anzahl gelisteter Autor·innen aus der deutschsprachigen Schweiz. Nach der Bevölkerungszahl und den Quadratkilometern an Bodenfläche müsste ihre Zahl im Verhältnis zu den Nachbarn weit geringer ausfallen. Ein Rätsel, oder eine Verzerrung, gewiss! Der rasante Privatkanon hat noch weitere Mängel: A. Zur österreichischen Kultur zählen natürlich auch in Slowenisch und in Kroatisch verfasste Literaturprodukte. B. Die Dialektliteratur, die ebenfalls zu dieser Textfamilie gehört, bleibt in allen Ländern ausgeschlossen. C. Zu den Rändern der deutschen Literatur gehört neben Prag, Südtirol und Rumänien auch noch Luxemburg – hier eine Terra incognita.
G e r m a n y
Wer an seine Freunde schreibt »Allfarbig malen auf blauem Grund / Das ewige Leben«, so wie das Else Lasker-Schüler getan hat, gehört wohl zu den Guten. Die jüdische Avantgardistin gehörte aber sicher zu den Besten. »Totenstadt«, »Weltuntergang«, »der Küsse blauer Zaubermond« – noch schwebte der lichtspendende Falter sorglos dahin … Das tat er nicht lange. Die bedrohte Dichterin starb Jänner 1945 in Jerusalem.
Der Nervenspezialist und Kassenarzt Alfred Döblin hat mit seinem Stadtroman ›Berlin Alexanderplatz‹ (1929) nicht nur die deutsche Literatur für die Moderne gerettet, der Mann war sich auch nicht zu schade, die politische Geschichte der deutschen Revolution 1918, eingebettet in Alltagsschilderungen, im ruhigen Erzählton in vier Bänden zu einem Epos auszuwalzen. Dieses Monumentalunternehmen (1948-50) ist literarisch letztlich gescheitert, übertrifft aber an Spannung und Komplexität alles, was die Zunft der Historiker·innen bisher zu dem Thema vorgelegt hat.

Bei Kurt Tucholsky rannte der Sprachfluss schon fast so flüssig wie bei angloamerikanischen Kolleg·innen. Seinem nie nachlassenden Humor kann man sich heute lässig im Netz hingeben. Der Megadadaist Jürgen von der Wense »verkrümelte sich en detail in fast plemplemförmiger Totalverquirlung von allem mit jedem« (Ulrich Holbein in ›Narratorium‹). Albert Vigoleis Thelen bleibt mir wegen drei Dingen unvergesslich: seinem Mut zu der 1953 bereits altmodischen Form des Schelmenromans, der Kollaboration mit dem portugiesischem Mystiker Teixeira de Pascoaes, und wegen dem literarischen Denkmal, das er seinem österreichischen Exilgenossen Franz Blei am Ende seines Hauptwerks errichtet hat.
Arno Schmidt ist heute für den schwächsten Teil seines Werkes, die Karl-May-Analysen, einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. In seinem Hirn aber trieben Theodor Gottlieb von Hippel, Jean Paul und Lichtenberg, die experimentellen Geister der deutschen Aufklärung, weiter ihr Unwesen. Helmut Heissenbüttel ziehe ich – sicher ungerechtfertigt – Franz Mohn, Peter Rühmkorf und Horst Janssen vor, solange ich Faulpelz keinen eindrucksvolleren Text gefunden habe.
Uwe Johnson mögen alle, weil er, vom Entwurf eines eigenen Kosmos besessen, mit ›Jahrestage‹ etwas Grosses gewagt und ein Hauptwerk der deutschen Literatur geschaffen hat. Aber worin genau bestand die Leistung dieses Mannes, der u.a. mit Hanna Arendt befreundet war? 1. In der Schreibmethode des Sich-Erinnerns, 2. in Genauigkeit bis zur Pedanterie, 3. in unterlaufenen Klischees, 4. in der Haltung, Schreiben als Beruf wie jeden anderen aufzufassen.
Hubert Fichte, dessen Wiener Vorlesungen in der Alten Schmiede ich besucht habe, war ein besonders dicker Freund des halikarnasseischen Herodot, des ersten Erforschers der Fremde, des ersten Journalisten der Weltgeschichte, des ersten Prosaschriftstellers der ersten Psychopathologia Sexualis (»graziöser als Freud«), und also der zweite in all diesen Tages-, Ethno- und Homo-Disziplinen.
Bei Rolf Dieter Brinkmann studiere ich die Langsamkeit des Blicks im Verhältnis zu der Schnelligkeit seiner Worte, bei Sten Nadolny genau umgekehrt. Die Bücher von Peter Kurzeck, den ich als einnehmenden Aussenseiter in Erinnerung habe, lassen sich an jeder beliebigen Stelle aufschlagen. Der Sog ist unabweislich. Ein Beispiel:
»… Und der Bus rollt genau auf sie zu und hält seufzend. Direkt als ob er für sie einen Knicks sogar artig andeutet, Luftdruckbremsen. So verdreckt wie der ist, der Bus, als käme er von weither. Und ist stehengeblieben: jetzt steht alles. Und wird gleich zum Bild, wie ein angehaltener Film«.
Viele Aphorismen von Botho Strauss schweben so elegant (ich sage nicht: erhaben!) über den Wellen, dass man von Levitation überzeugt sein muss. Dieser Grossschriftsteller – im Bildungsduktus dem späten Rainald Goetz ebenbürtig – ist unter den lebenden Autoren gewiss am ernsthaftesten mit sich selbst beschäftigt. Warum jedoch kann ich mir so schwer vorstellen, dass seine Bücher in Übersetzungen auch indische oder arabische Intellektuelle interessieren könnten?
Frank Witzel: Mehrfachtalent, Poëtik-Dozent, Tieck-Leser, Titel- und Untertitel-Genie (›Blessuren, Klammern, Beharrungen‹) hat ebenfalls eine Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts skizziert. Darum sage ich nicht mehr als das. Thomas Kling: herzverstärkter Scharfsinn, ursprünglich in Klein- und Kleinstauflagen. Mit der Lektüre seiner Gedichte ist natürlich das Wiener Jazz- und Zettel-Duo Ernst Jandl & Friederike Mayröcker mitgemeint. Wolfgang Herrndorf: zuverlässig unzuverlässiger Erzähler, auch im Internet. Sein wunderbarer Blog ›Herrschaft und Struktur‹, bis zum Tod Herrndorfs 2013 nicht öffentlich, ist dank Carola Wimmer und Sascha Lobo immer noch online.
A u s t r i a
Hugo von Hofmannsthal steht hier einzig und allein wegen seiner Erzählung ›Reitergeschichte‹ (1899), die den suizidalen Starrsinn der Doppelmonarchie viel präziser einfängt als Joseph Roths sentimentaler Österreichroman ›Die Kapuzinergruft‹. Es wird uns für alle Zeiten ein Rätsel bleiben, warum der Wiener diese Erzählung nicht ein Jährchen vordatiert hat, wie Sigmund Freud seine Studie ›Die Traumdeutung‹. Über Karl Kraus sagen wir nur, dass es sich lohnt, sein überragendes schriftstellerisches Können mit dem seines kroatischen Bewunderers Miroslav Krleža und seinen Humor mit dem teuflischen Lachen der Yankee-Feder Ambrose Bierce zu vergleichen.
Wenn Sie die Geschichte Zentraleuropas in den finsteren Jahren der faschistischen Expansion als freundliches Lesebuch vor Augen haben wollen, dann greifen Sie zu Franz Theodor Csokors autobiographischen Berichten ›Als Zivilist im polnischen Krieg‹ (1940) und ›Als Zivilist im Balkankrieg‹ (1947). Schlanker und zurückhaltender hat seine Flucht vor Hitlers Armeen niemand sonst bezeugt.

Den Expressionisten Georg Trakl nehme ich für das Antikriegsgedicht ›Grodek‹ (1914) in der Liste auf. Die Engelseherin Gabriele Bitterlich scheint garantiert in keiner akademischer Literaturgeschichte auf. Nur der geringste Teil ihre Privatoffenbarungen im Opus Sanctorum Angelorum ist überhaupt veröffentlicht. Trotzdem nahm die religiöse Sektiererin Marianne Fritz und andere Schreibwütige wie den Vorarlberger Visonär Franz Huemer um Jahrzehnte vorweg.
Christine Lavant ist für mich die grösste Drogen-Dichterin auf der Almwiese. Mohn und Mutterkorn (»ein junger halmschmaler Mond im Hirn«, »Feuerräder, die sich mühen, ihre Radspur zu verschränken«) haben ebenso selbstverständlich Einzug in ihre Schattenordnung gehalten wie Tabak, Gott und der Maler Werner Berg.
Sicher gibt es in der Nachkriegsgeneration Österreichs eine Menge aufleuchtender Namen: die Schriftskeptiker der Wiener Gruppe, die Einzelgänger Hubert Fabian Kulterer, Erni Wobik und Max Hölzer, die wilden 1968er Gerhard Kofler, Gunter Falk, Otto M. Zykan, Bernhard C. Bünker und Barbara Frischmuth (›Amoralische Kinderklapper‹). Der Rekonstruktionswille im Nachkriegsösterreich blieb aber vor allem blind für die dramatischen Einsichten der folgenden beiden Grössen: Heimrad Bäcker verdichtete in zwei sogenannten Nachschriften 1968 und 1985 Sprachmaterial aus dem bürokratischen Kauderwelsch des Holocausts. Und von Ilse Aichinger, die ich gerne im Café Korb sitzen sah, schätze ich am meisten ihre Fasanviertel-Erinnerungen (›Kleist, Moos, Fasane‹).
Die Seegängerin Ingeborg Bachmann stahl sich als Jugendlektüre in meine Liste. Wir haben mit ihr auch gleich Paul Celan und Marlene Haushofer im Sack. In Bachmanns Namen reisst sich 2026 zum 50. Mal das Fernsehen die schöne Literatur unter den Nagel. Über Thomas Bernhard muss nichts weiter gesagt werden – ausser vielleicht, dass er auch ohne den Burgtheater-Direktor Claus Peymann existiert hätte.
Konrad Bayer wurde 2012 wiederentdeckt und sofort wieder vergessen. Die Literaturzeitschrift Schreibheft publizierte damals den Briefverkehr 1959-64 mit seiner Gefährtin Traudl Bayer. Auf diese Weise stehen ihm so lange »Auferstehungen« bevor, wie auch die ›Cantos‹ des Amerikaners Ezra Pound erinnert werden.
Was Peter Kurzeck im Norden zu seinem Lebensthema erwählte, die Zurichtung seines Landes in Mentalität und Landschaft hin zu einem nach funktionalen und merkantilen Gesichtspunkten straff durchorganisierten System (Christoph Schröder), das leistet an der Karawankenwand Engelbert Obernosterer, ein im Literaturbetrieb sträflich unterschätzter Autor, der heuer wenigstens zum Ehrenbürger seiner Provinzheimat Hermagor geadelt wurde.
»obwohl sprache ein teil von realität ist, ist sie nicht ein zureichendes mittel, diese realität voll auszudrücken«, lautet ein Merksatz in den Nachlass-Schriften des Wieners Reinhard Priessnitz. Und ein weiterer: »dichtung ist im wesentlichen eine form von erfahrung, die über ihre eigene mitteilungsfähigkeit reflektiert«.
Dieser epistomelogischen Ambition haben sich speziell die Nachfolger der Wiener Gruppe verschrieben. Noch in keiner Felsspalte verschwunden, wie Bodo Hell im Dachsteingebirge, ist das Doppeltalent Anselm Glück. In jungen Jahren konnte der Oberösterreicher seine Texte atemberaubend performen. Damals, vor vierzig Jahren, stellte er seinen visuellen orientierten Humor mit Pointen wie dieser unter Beweis:
»und mit der geburtststunde ereignen sich die menschen. aber mit einer bestimmten vernunft widerspricht sich ihr abbild ganz von selbst«.
S w i t z e r l a n d
Robert Walser war eine Art Übervater der deutschschweizer Literatur im 20. Jahrhundert. Seine Worte hat er so sorgfältig gesetzt wie sonst vielleicht nur sein Angestelltenkollege Franz Kafka. Nicht zufällig wurden die Texte Adelheid Duvanels mit denen Robert Walsers verglichen – beide durchliefen psychiatrische Heilkarrieren.
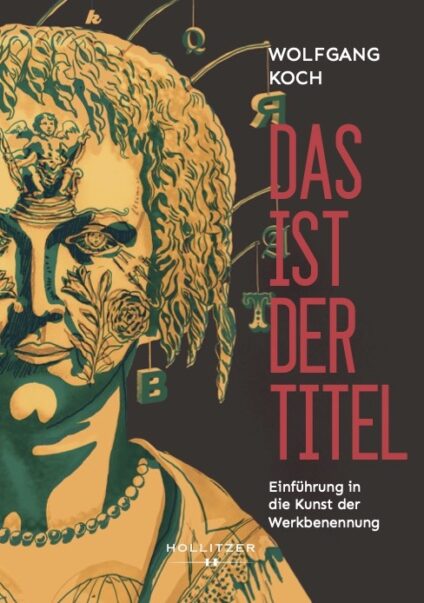
Das hätte auch dem Allesversteher und Alleserklärer Adrien Turel geblüht, wenn ihn nicht seine Frau mit Näharbeiten über Wasser gehalten hätte. Armand Schulthess wird seit Jahren nur in der bildenden Kunst rezipiert, weil sich die zerstörte ›Enzyklopädie‹ des Aussteigers im Tessiner Wald den Gesamtkunstwerk-Projekten zuschlagen lässt. Doch tatsächlich war das Hauptmedium dieses Eigenbrödlers die handgemalte Schrift.
Die Hausfrau Rosmarie Buri hat mit ihrer schweren Lebensgeschichte in den 1990er-Jahren eine kurze Modewelle von Autobiographien beim Publikum ausgelöst. Jürg Federspiel bleibt mir mit seinen New-York-Reportagen in Erinnerung. Urs Widmer hat mir in seinem Essayband ›Das Normale und die Sehnsucht‹ (1972) erklärt, was Kitsch, triviale Mythen, Pornografie und was Schweizerische Helden sind. Pseudo-naive Sätze wie »Der Tod ist nicht sehr differenziert, aber er ist äusserst unermüdlich« zogen mich unweigerlich in den Bann, bevor mich Widmer dann später mit Dialektstücken wieder verstörte.
Der artistische Erzähler Hermann Burger und der österreichische Sprachkünstler Gert Jonke schienen mir immer unterirdisch verbunden zu sein. Etwa so, wie sich der serbischstämmige Regisseur Emir Kusturica das kulturelle Europa vorstellt: felsige Tunnelwände im Neonlicht, lange geknickte Geraden, scheppernde Blechtüren zu Notausgängen. Urs Allemann, der letzte Könner, der aus dem 20. Jahrhundert in die Jetztzeit herein ragt, beherzigt bis dato den formalen Imperativ, dass ein Text nur schöpferisch ins Werk setzt, was im Voraus keine andere Sicherheit hat, als die, die der Autor selbst herstellt, indem er seiner inneren Ordnung folgt.
Suche den Unterschied zur Künstlichen Intelligenz.
O u t s i d e
Das Kulturmagazin perlentaucher führt aktuell sechs Bücher aus der und über die literarische Phantastik von Gustav Meyrink, darunter natürlich ›Der Golem‹, Pflichtlektüre der Kabbala-Freunde. Der Dandy-Schriftsteller und Bankier war mit München, Hamburg, Montreux, Prag, Wien und Starnberg verbunden, wo er abwechselnd mit Mystik und antibürgerlicher Satire den Schliess- und den Lachmuskel reizte. Mit dem nach stofflichem Leben strebenden Humunkulus in der Judenstadt hat Meyrink die letzte grosse Gestalt der deutschen Literatur in das Kabinett der Weltliteratur eingeschrieben. Danach kam nur noch die Biene Maja.
Dem Prager Versicherungsmathematiker Leo Perutz gelang es, Filmrechte an seinen Romanstoffen zu verkaufen, bevor er ins Exil gezwungen wurde. Mir ist vor allem der Rätselroman ›St. Petri-Schnee‹ (1933) in positiver Erinnerung, in dem sich die Traumgespinste eines Kranken aus der chemische Produktion von Mutterkornalkaloiden ergeben.
Über Kafka-Lektüren wusste der Literatur-Bewerter Rolf Vollmann zu sagen, der Roman halte diesen traurigen Tiefsinn des leeren Kreisens im syntaktischen Nichts nicht aus. »Schwer zu sagen, wer wir damals waren, als wir das mochten.« In kleineren Portionen wie in ›Die Wahrheit über Sancho Pansa‹ (1917) oder ›Forschungen eines Hundes‹ (1922) ist die Vollkommenheit von Kafkas Sätzen aber durchaus ein Gewinn. Mit der Formel »Kafka, c’est pas Astérix« (Kafka ist nicht Asterix) hat Suzanne Gabriello 1966 das tiefe Gefühl eines Einblicks umschrieben, mit dem uns dieser Autor erfolgreich täuscht.
Franz Baermann Steiner, der Soziologe im Schatten von Elias Canetti, hat enorm viel Energie in seine Lyrik gesteckt. Anspruchsvolle Reflexionsfreude jedoch lebte er von 1943 bis 1952 in seinen Aufzeichnungen ›Feststellungen und Versuche‹ aus. Der rumänisch-deutsche Pfarrer Eginald Schlattner hat sich vom kommunistischen Regime zum Kronzeugen in einem Hochverratsprozess gegen seine Kolleg·innen machen lassen, und dieses Verhalten später aufschlussreich verteidigt. Seine Werke thematisieren Schlüsselereignisse der siebenbürgisch-sächsischen Geschichte.
Der Südtiroler Norbert C. Kaser ist nach meiner forcierten Lektüre der aufregendste Autor aus der Protestgeneration von 1968. Man höre:
antike*
einmal werden
auch wir antike sein
eine folter den schuelern
gedankliche voraussetzung
den philosophen
alles ist schon gedacht
nichts ist ausgefuehrt
*) Zit. nach Norbert C. Kaser, Gesammelte Werke, Band 1, Innsbruck: Haymon 1988
Zigarettenmarken … Geburt auf der Leinwand … Furze … Partisanen … Kannibalismus … Kirchenglocken – kein Thema schien Nobert C. Kaser fremd zu sein. Wer derart schöne Gedichte schrieb, wollte vor allem Kunst.
© Wolfgang Koch 2025