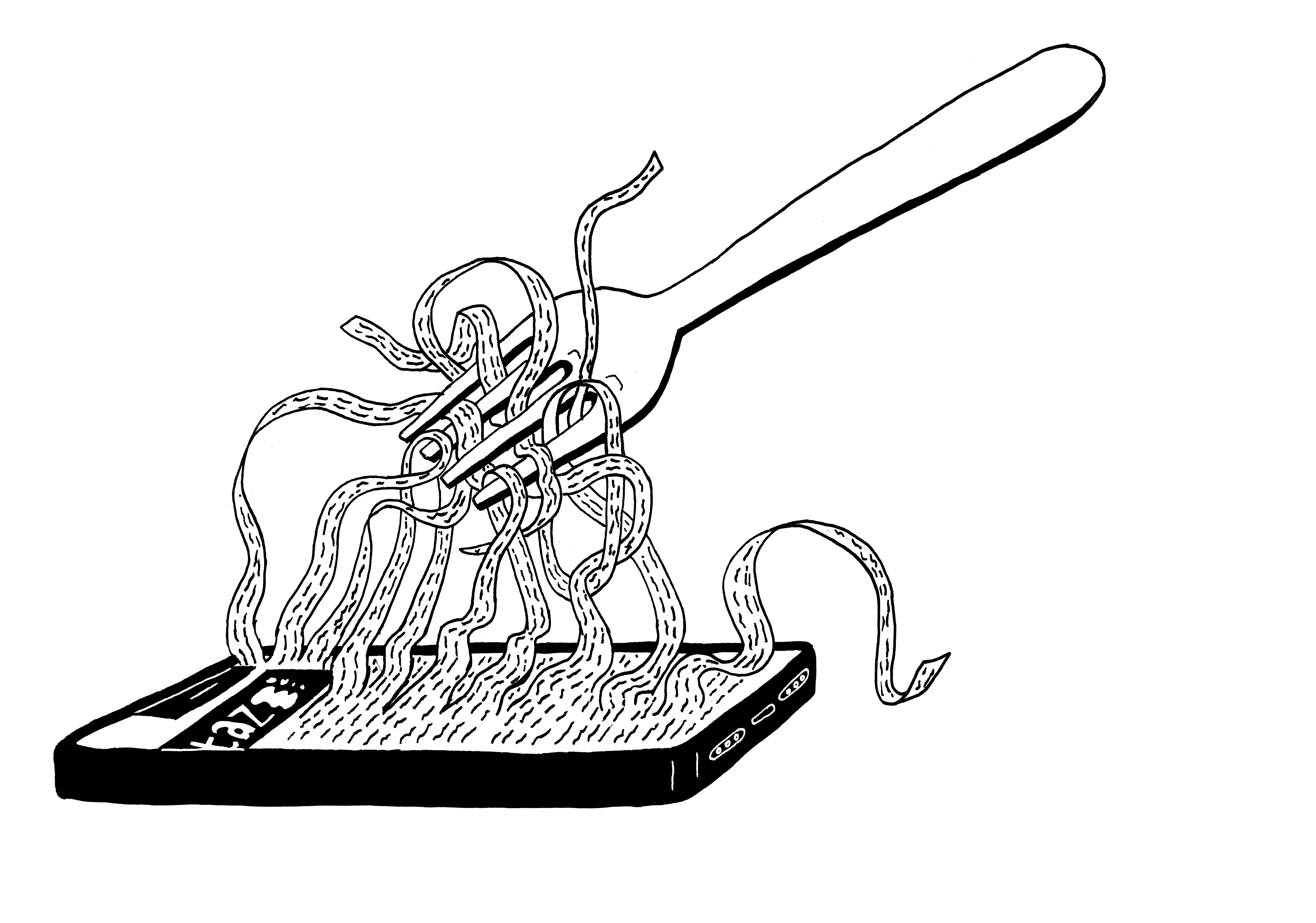Jahrzehnte lang wurden vor allem in Deutschland die Demokratievorstellungen von der Idee und Hoffnung auf Konsens geprägt – nicht ganz unschuldig ist daran sicher Jürgen Habermas. Die Vorstellungen zielten darauf, unsere unterschiedlichen Weltdeutungen, sozialen Positionen und Hoffnungen in einem gemeinsamen Gespräch auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, der politische und moralische Grundlage der Politik sein soll. Gute Gründe sollten dabei tragendes Moment sein, auch bei hartnäckigerer Abweichung Gemeinsamkeit zu stiften. Interessanter Weise stellt in diesem Ansatz das Motiv der Krise eine eher geringe Rolle da – und wenn sie auftritt, wird sie eher als Problem gedacht. Einerseits wird sie von der Hoffnung überlagert, Brüche durch gute Gründe und argumentativ erzielten Konsens überwinden zu können, andererseits von der Vorstellung, Krisen als nur technische Störungen der Gesellschaft zu betrachten, die ihrerseits technisch und nicht politisch gelöst werden (System vs. Lebenswelt). Auf jeden Fall stehen Krise und Konsens tendenziell in einem Ausschlussverhältnis, die Krise ist das durch Konsens zu überwindende.
Mit den gegenwärtigen Gesichtern der Krise des Klimas bekommt man nun den Eindruck, dass ein ganz anders gearteter Bezug der Krise zum gesellschaftlichen Handeln hergestellt wird. Man könnte denken, dass die Möglichkeiten der Konsensbildung zerstört werden, weil das Zeitalter der Krise(n) gekommen ist.
Ich glaube aber nicht, dass damit notwendig ein Ende des Konsens-Denkens eingeläutet ist (was nicht als normative Aussage verstanden werden soll) – ich glaube, dass man nachzeichnen kann, wie die >Tradition< des Konsens-Denkens durch die politischen Zugriffe auf die Krise eine Transformation erfährt – sich also in weiten Teilen eine gesellschaftliche Fortsetzung, Demokratie durch Konsens zu denken, absehen lässt.
Die Krise wird immer mehr als Takt-gebendes oder strukturierendes Motiv der Politik begriffen, so dass sich das Verhältnis von Krise und Konsens tendenziell umdreht, statt aufgelöst zu werden. Der Konsens wird nun von der Krise hergedacht – die Krise ist das, was in den Konsens führt, denn die Krise wird zu einem gesellschaftlichen Problem von so einer Dringlichkeit und Reichweite, dass es unhintergehbar wird, sich ihr zu stellen – sie gibt das vor, was die Politik leisten muss: ihre Einhegung. Vielleicht kann man sagen, dass, wenn eine Krise, die ja oft nur als praktisches oder technisches Problem verstanden wird, groß genug ist, sie selber zu einem konzeptuellen Faktor aufsteigt (statt von diesem >umrandet< zu werden).
Hier läuft die Krise, die doch Bruch und Problem für den Konsens gewesen ist, wieder auf den Konsens zu – der Konsens wird durch sie vermittelt, ist aus ihr hervorgebracht und durchläuft eine Verwandlung, da er jetzt inhaltlich (material) an die gebunden ist. Damit kehrt sich auch das störende Verhältnis um, das zwischen beiden Momenten zuvor bestand: Die Krise konstituiert den Konsens. Wichtig ist zu betonen, dass es dabei nicht nur um technische oder instrumentelle Fragen geht – ich denke, man kann (biopolitisch) Klimakrise, Coronakrise usw. verbinden, um zu sagen, dass dort wie hier Technisches und Politisches, also die Sachebene und die Ebene von politischen Prinzipien wie Freiheit und Gleichheit zusammenfallen.