Links sein heißt nach oben treten und nach unten ducken – Rechts sein ist das Gegenteil davon. Etwas anders hat es Walter Benjamin ausgedrückt: “Immer radikal – niemals konsequent!” In der taz gibt es stellenweise eine starke Ignoranz der Kopfarbeiter (“Diskursverwalter”) gegenüber den Handarbeitern (die z.B. das Geld reinholen und das Produkt vermarkten). Das hängt u.a. damit zusammen, dass sich erstere nicht selten als überqualifiziert und unterbezahlt begreifen (eine Lebenslüge natürlich – in doppelter Hinsicht beinahe), dass sie ferner die Abwesenheit von Gängelung (außer den Produktionszeiten und den im Kleinkollektiv selbst gestellten Aufgaben) nicht (mehr) richtig zu schätzen wissen – weil es ihnen z.T. an Vergleichsmöglichkeiten fehlt. Hinzu kommt natürlich partiell auch eine schlechte Erziehung, verstärkt gelegentlich durch schlechte Laune, sowie auch durch das alternative Projekt-Image, das dies nicht nur durchgehen läßt, sondern angeblich sogar verlangt.
Besonders zu klagen haben die Bediensteten im neuen taz-Café, wo täglich zur Halbzeit die taz-Mitarbeiter hinströmen, um zu essen – oder auch mal zwischendurch, um sich bei einer Tasse Kaffee vom “Produktionsstreß” zu erholen. Wenn die Café-Mitarbeiter nicht schnell genug sind oder kommunikativ aus dem Rahmen treten, müssen sie sich blöde Bemerkungen anhören. “So schlimm war es noch nirgendwo,” meint sogar einer enttäuscht.
Zur Entschuldigung kann man nur anführen, dass nach der Auflösung der taz-Kantine um die Wende herum dieser Bereich outgesourct wurde – erst an den Ostbildhauer mit Toskanamacke Blumhagen und dann an den ehemaligen Lotta-Continua-Berufsrevolutionär und zugleich Betreiber gehobener Berliner Gastronomien – Pierrot. Beim einen wie beim anderen waren die tazler nur Gäste zweiter Klasse: Mit ihren Essensmarken hatten sie auch nur die Wahl zwischen zwei Gerichten, an denen gespart und z.B. nur billiges Olivenöl gereicht wurde. Die tazler meinten jedenfalls, sie müßten sich andauernd wehren, um nicht Gäste dritter Klasse zu werden. U.a. dagegen, dass die Kellner erst andere bedienten, dass sie nicht jeden Tag Nudeln vorgesetzt bekamen usw.. Auf der anderen Seite gaben sie mit ihren Essensmarken natürlich auch so gut wie kein Trinkgeld – was im teuren “Sale e Tabacchi” für die Kellner ins Gewicht fiel. Man muß allerdings auch sagen, dass sich viele tazler wenigstens klammheimlich mit den Kellnern gegen ihren, um das mindeste zu sagen schwierigen Chef solidarisierten. Wie auch immer: Nun ist das taz-Café wieder in taz-Hand, also eine Abteilung der taz – nämlich des “taz-shops”.
Man sollte noch einen Irrtum berichtigen: die wahrhaft Qualifizierten, das sind in der Mehrzahl die Handarbeiter der taz: So arbeitete im taz-shop z.B. eine Anwältin, eine Heilpraktikerin, eine Modemacherin, in der Korrektur ein Dr. phil, im Layout ein Dichter, in der EDV-Abteilung ein Geograph, in der Abo-Abteilung eine Tänzerin, in der Telefonzentrale ein Rinderpfleger zur See usw.. Ich werde dieses “Thema” noch vertiefen, um zu verdeutlichen, wieviel mehr Sein als Schein bei den Einzelnen taz-Handarbeitern im Spiel ist – während es bei den Kopfarbeitern naturgemäß (möchte man fast sagen) genau andersherum ist. Früher habe ich mir manchmal den Spaß gemacht und den bzw. die eine oder andere(n) interviewt. In den frühen Achtzigerjahren war das u.a. die Vertriebsaushilfe Christiane Meyer, die dann eine zeitlang taz-Handverkäuferin in Schöneberg war, aber eigentlich eine armenische Künstlerin, die sich dann in Bremen mit einer Galerie selbständig machte – und hauptsächlich mit Pflanzen arbeitete. Dabei kooperierte sie eng mit drei anderen schon älteren Künstlerinnen: Elfi, Lena und Ohio (sie haben für sich nie einen brauchbaren “Gruppennamen” gefunden), In den 60er Jahren studierten die drei in Toronto Informatik und Botanik. 1968 fand dort – in den Räumen des Lectorum Rosicrucianum – die Komposition “Reunion” statt, bei der sie mitarbeiteten: Marcel Duchamp und John Cage spielten an einem präparierten Schachbrett eine Partei Schach, wobei über eine fotoelektrische Schaltung die Bewegung der Schachfiguren registriert wurde. Diese löste dann die Kombination elektronischer Klänge aus – Zufallsmusik. Oder Musik als Zufallserlebnis. Wobei dieses Erlebnis für die drei Frauen in der Folgezeit dann zu einem “Schlüsselerlebnis” werden sollte.
Ein anderes kam noch dazu. Ich muß dafür ein wenig ausholen: 1966 hatte der New Yorker Polizeipsychologe und Lügendetektorspezialist Cleve Backster in seinem Büro aus Langeweile seine Fensterbrettpflanze Dracaena massangeana an einen Detektor angeschlossen, genauer gesagt: an einen Polygraphen, der mit einem Galvanometer kombiniert war. Wobei letzteres der Teil ist, der die Änderungen der Körperleitfähigkeit mißt. Er wird mit dem Körper durch Kabel verbunden, die mit einem schwachen Strom beschickt werden. Starke Emotionen oder intensive Vorstellungen haben eine Änderung des elektrischen Widerstandes zur Folge und bewirken dadurch einen Ausschlag der Nadel oder Feder auf der laufenden Papierrolle (des Polygraphen). Der Galvanometer ist nach dem Physiker Luigi Galvani benannt, der die sogenannte “animalische Elektrizität” entdeckt hat (mit der man allerdings in der Volksmedizin schon lange arbeitete). Dieses Gerät wird heute meistens in Verbindung mit einer elektrischen Schaltung verwendet, die man “Wheatstonesche Brücke” nennt (zu Ehren des Physikers und Erfinders des automatischen Nadeltelegrafen Wheatstone). Vereinfacht ausgedrückt werden durch die “Brücke” Widerstände so ausbalanciert, dass Schwankungen des elektrischen Potentials gemessen werden können. (Derartige Schwankungen können z.B. im Verhör bei den an einen Galvanometer/Polygraphen angeschlossenen “Verdächtigen” dann auftreten, wenn die Körperleitfähigkeit sich aufgrund eines plötzlichen Angstschweiß- Ausbruchs oder ähnlichem verändert.) Um es aber hier kurz zu machen: Beckster versuchte alles mögliche mit seiner Zimmerpflanze – er tauchte eines ihrer Blätter in Kaffee, er schüttelte sie usw.. Nichts. Dann kam ihm eine Idee: “Die erfolgversprechendste Methode, bei einem Menschen eine Reaktion auszulösen besteht darin, ihn tödlich zu bedrohen”. Und genau das wollte er tun: Er dachte daran, ein Streichholz zu nehmen und das Blatt, an dem die Elektroden befestigt waren, zu verbrennen. Er dachte daran. Und das reichte schon, um das Diagramm auf dramatische Weise zu verändern. Die Pflanze hatte reagiert. “Sprich, oder ich bring dich um!” hatte der New Yorker Verhörspezialist gesagt (gedacht!). Und die Pflanze hatte “gesprochen”.
Das war 1966. Seitdem sprach man bei ähnlichen Pflanzen- Experimenten, auf die sich in der Folgezeit dann mehr und mehr Forscher stürzten, vom sogenannten “Beckster-Effekt”. 1969 veranstaltete der Botanik- Professor D.S. Thompson zusammen mit einigen Studenten der Universität Toronto ein Experiment mit einigen Bergpalmen. Der Botaniker, der neben seiner Professur Leiter des Botanischen Gartens von Toronto war, ist bekannt dafür, dass er das besaß, was man eine grüne Hand nennt. Der Elektroenzephalograph, den er bei seinen Experimenten verwendete, mißt normalerweise Gehirnströme, wobei dann zwischen Delta-, Theta-, Alpha-, Beta- und Gammawellen unterschieden werden kann, dies richtet sich je nach dem Alter der an ihn angeschlossenen Gehirne und entspricht jeweils einer Frequenz von 0-5, 4-7, 8-13, 14-30 und 31-60 pro Sekunde.
Bei diesem sogenannten “Toronto-Experiment”, bei dem auch Elfi, Lena und Ohio mitarbeiteten, registrierte das Gerät bei allen zwölf Jahre alten Bergpalmen alle fünf Frequenzbereiche, wobei die Differenzen – zwischen “Säugling” und “Greis” – von diesen Palmen innerhalb eines Tages, von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang, durchgespielt werden konnten. Allerdings nicht von sich aus, sondern immer jeweils abhängig von äußerer Beeinflussung. Ich muß wieder verkürzen: Bei positiver Zuwendung (etwa Begießen mit Wasser, Düngemitteln, bei sanfter Berührung der Blätter, bei Abspielen von klassischer Musik und mehr noch bei indischer Musik, usw.) retardierten die Pflanzen, d.h., das EEG registrierte Wellen aus dem sogenannten Säuglingsfrequenzbereich, während es bei extremer Vernachlässigung der voneinander vollständig isolierten Pflanzen oder gar bei ihrer Bedrohung/Beschädigung sich in dem sogenannten Greisenfrequenzbereich einschrieb – nach einigen kurzen, aber heftigen Frequenztumulten.
Bei dem Experiment ging es dem Botaniker darum, zu beweisen, dass und wie Pflanzen in die Lage versetzt werden können, dezidiert und vor allem selbst ihre Wünsche zu äußern, wobei dann – in einem Gewächshaus beispielsweise – andere an das EEG wieder angeschlossene Geräte diese “Wünsche” der Pflanzen automatisch befriedigen können, d.h., sie bestimmen ihre für sie notwendige Menge an Dünger, Bewässerung, Sonne, Dunkelheit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc. selbst über eine Reihe sensibler elektronischer Geräte. Dieser letzte – sozusagen perspektivische – Aspekt des Experiments interessierte die frei Frauen aber weniger. Sie beschäftigten sich damals schon mehr mit experimenteller Musik (Stockhausen, Musique Concrète, FuMu – “funktionale Musik”, “industrielle Musik”, Minimalmusik) und später dann mit dem, was Klaus Schulze (von dessen Musik Ernst Jünger sagte: “Sie bedeutet für mich so etwas Ähnliches wie die Sieben beim Würfeln.”) und Christoph Franke produzierten. Also “Elektronische Musik” (von der wieder der Hobbybotaniker Ernst Jünger meint, sie würde “Gefühl” und “Geist” auf neue Art zusammenbringen). Dem folgte eine Zeit der Auseinandersetzung mit der Musik von Robert Rental, Throbbing Gristle und Brian Eno. 1978 oder 1979 bekamen sie, inzwischen in Europa und Florenz zufällig Kontakt mit dem japanischen Zen-Buddhisten und Musiker Yushiko Mirota, der zu der Zeit mit Dauertönen experimentierte; mit ihm zusammen gelangten sie dahin, sich statt mit Musik mit Hörgewohnheiten zu beschäftigen. Sie verwiesen sich also sozusagen auf das andere Ende dieser ganzen Musik-Experimente.
Mirota experimentierte daneben aber auch noch mit Pflanzen, und zwar mit ihren “Hörgewohnheiten”, genauer gesagt: mit den Einflüssen von Musik auf Pflanzen. (Wie vor ihm auch schon der Hobby-Botaniker und Musiker J.J. Rousseau, der beispielsweise herausgefunden hatte, dass der damals noch sehr junge Mozart zwar besser oder virtuoser spielte als seine Schwester, dass ihre Musik aber geeigneter zu sein schien, zufällig in der Nähe stehende Pflanzen positiv zu beeinflussen: Jedenfalls wuchsen diese bei ihrer Musik schneller als bei seiner.) Als Mirotas CMIC-Stipendium in Florenz auslief, kehrte er nach Kyoto zurück. Elfi, Lena und Ohio blieben in der Toskana – sie mieteten sich in der Nähe von Arezzo die Molino di Capraia.
Dort bekam ich das erste Mal Kontakt zu ihnen. Ich besuchte sie einmal – mehr zufällig, da ich in der Nachbarschaft mit jemandem eine Verabredung hatte, den ich aber nicht mehr antraf, da ich mich um einige Tage verspätet hatte. Gelangweilt in der Gegend herumwandernd stieß ich auf die Mühle. Ein altes Bauernhaus, am Hang gebaut, der etwa 30 Meter zu einem Bach abfällt. Frühere Generationen von Besitzern hatten dort Terrassenfelder angelegt, manche nur einen Meter breit. Bis auf einen kleinen Garten mit einer Ecke zum Sitzen und Liegen (in Hängematten) oberhalb des Hauses war inzwischen alles total verwildert.
Zusätzlich hatten die drei Frauen einige Pflanzen, Sträucher un Bäume in die “Wildnis” (ital.: “Macchia”) gepflanzt, bzw. ausgesät. Und überall lagen isolierte oder abisolierte Drähte herum oder waren Leitungen gespannt. Einige Akazien beispielsweise waren fast vollständig von Drähten eingewickelt, zu anderen Bäumen führte nur eine Leitung hin, die dann aber mittels Elektroden und Klemmen an verschiedenen Ästen, Blättern und Zweigen befestigt war. Im Garten oben am Hang hatte man -zig Salat- und Kohlpflanzen schachbrettartig mit dem Drahtgeflecht verbunden, daneben wuchsen einige Lippenblütler, die nirgendwo angeschlossen waren, aber eine abisolierte Kupferleitung war exakt über ihre äußeren Blütenblätter gespannt, so dass etliche Pflanzen dem Metall auf einige Millimeter nahegekommen waren. Dann wieder, an einer Hausecke, ein Bougainvillea- Strauch, zu dem nur ein Kabel hinführte, das sich aber in -zig Pole verzweigte und so eine Vielzahl von Blättern verband. Zwei Feigenbäume hinterm Haus, am Rande des Staubeckens der Wassermühle, waren nicht nur an diverse Leitungen angeschlossen, die auf der Erde zu ihren Stämmen hinführten. Davor stand auch noch ein seltsamer Kasten, ein Transmitter, den man dazwischengeschaltet hatte.
Um einige weitere technische Details zu erklären, die mir das Funktionieren des Ganzen verständlich machen sollten, benutzten die drei Frauen italienische Begriffe wie “Contatto”, “Morsetto”, “Resistanza di ritorno”, “Interruttore di blocco”, “Bruciatore”, und ähnliche, die ich hier zwar übersetzt wiedergeben könnte, die aber die Funktionsweise im Detail auch nicht viel klarer machen würden. Den drei Frauen, das erfuhr ich dann in den nächsten Tagen, da ich sie fast täglich besuchte und mit weiteren Fragen bestürmte, ging es nicht darum, herauszubekommen, “was die Bäume sagen” – um die Auslotung dessen, was einige Zytologen “zellulares Bewußtsein” nennen oder Martin Buber “Ich-Du- Begegnung”. Noch weniger interessierte es sie, mittels Musikbeeinflussung optimale Ernten in ihrem Gemüsegarten oder bei ihren Eßkastanienbäumen zu erzielen (was ihre italienischen Nachbarn zu Anfang ein wenig gehofft hatten). Von jeder botanischen, landwirtschaftlichen oder informationstheoretischen Perspektive hatten sie sich mit ihren Arbeiten schon in Toronto entfernt. Und bis auf eine mehr schlechte als rechte Pflege der Gemüsebeete, Bäume, Sträucher, Weinreben und Unkräuter kümmerten sie sich um ihre “verkabelte Flora” so gut wie gar nicht.
Statt dessen waren sie die meiste Zeit in der gemütlich eingerichteten Mühle damit beschäftigt, die von den angeschlossenen Pflanzen permanent ausgehenden Impulse (oder “Sprachen”) auf Polygraphen/Galvanometer, Elektroenzephalographen und Elektrokardiographen aufzuzeichnen. Letztere haben den Vorteil gegenüber den anderen beiden Geräten, dass sie keinen Strom durch die Pflanzen schicken, sondern lediglich den Spannungsabstand ihrer Entladungen messen. Daneben benutzten die drei Frauen aber noch einige andere Geräte wie einen an der Stanford-University entwickelten E-Meter, den sie (für 40.000 Lire) nachgebaut hatten und der auf die sogenannte “Galvanic Skin Response” reagiert. Einige Teil zu einem anderen “brauchbaren piece” fanden sie zufällig auf dem Müllplatz einer Firma, die in der Nähe von Bibiena elektronische Geräte herstellt: mehrere phasenrückkopplungsblockierte, in mikroelektronische Silikonplatten eingelassene Diskriminatoren. Aus diesen “Abfällen” bauten sie sich eine “Meßbrücke”, wobei sie zur Messung des elektrischen Potentials Wechselstrom anstelle von Gleichstrom verwendeten, sowie einen automatischen Verstärkungsregler, mit dessen Hilfe sie die kleinsten Veränderungen im Kraftfeld von Pflanzen feststellen könnten. Ein weiterer Vorteil dieses Geräts war, dass hierbei – im Gegensatz beispielsweise zum Galvanometer – das oftmals störende “Rauschen” wegfiel. Diese Apparatur funktionierte zusammen mit einem Oszillographen, der fast immer in Betrieb war. Auf dem Leuchtschirm der Elektronenstahlröhre erschien dann eine helle 8, deren Schleifen laufend ihre Form entsprechend den von der daran angeschlossenen Pflanze ausgehenden Impulsen veränderten. Für mich hatte dieses Muster auf dem Leuchtschirm Ähnlichkeit mit den sich hastig bewegenden Flügeln eines flüchtenden Schmetterlings in Zeitlupe. Zwei EEGs besaßen ferner einen superschnellen Aufzeichner-“Schreiber”, der den Papierstreifen mit einer Geschwindigkeit von nahezu einem Meter pro Sekunde durchlaufen ließ. Mir war aufgefallen, ddassdie meisten Eßkastanienbäume nicht an irgendwelche Drähte angeschlossen waren. Hierfür benutzten sie ein anderes (fahrbares) Gerät: eine Röhre, die eine weite Öffnung, aber keine Linse davor hat und deren optische Achse parallel zur Achse einer Faradayschen Röhre verläuft, wird auf einen bestimmten Baum gerichtet, dadurch wird eine bestimmte Menge Elektrizität in ihn hineingepumpt. Die Veränderungen im lebenden Gewebe des Empfängers machen sich nicht auf einem Schreiber bemerkbar, sondern durch einen gleichbleibenden leisen Pfeifton (wie ihn etwa Sinuswellengenerationen hervorbringen), der in eine Reihe von einzelnen Impulsen zerfällt, sobald die Pflanze “reagiert” oder “kommuniziert”, einfacher ausgedrückt, sobald irgendeine Veränderung in ihr vorgeht.
Ferner besaßen Elfi, Lena und Ohio einen Ultraviolett-Spektrometer, der zwar meistens “außer Betrieb” war, der aber, wenn er funktionierte, die “mitogenetische Strahlung” von Zitronenmelisse, Ginster, Mohrrüben, Rhabarber, Christrose und zwei Olivenbäumen aufzeichnete, die sich dann mittels eines Decoders oder Umwandlers auf einem kleinen Kassettenrecorder speichern ließ. Letztere – die Olivenbäume – sind außerdem noch an einige Mikrothermistoren angeschlossen, weil sie innerhalb von 24 Stunden extreme Temperaturschwankungen produzieren, welche sich im Sinne einer Verstärkung bzw. Abschwächung der e.e. zu Tönen umgewandelten “Strahlung” benutzen lassen. In Elfis Zimmer stand eine Geranie, die sie mit einem umgebauten akustischen Sphymographen (Pulsschreiber) verkabelt hatte. In einem Raum hinter der Küche, der übrigens der einzige Raum im Haus war, in dem man keine Geräusche von Geräten und Aufschreibern hörte oder über irgendwelche Drähte und Leitungen stolperte, befand sich ihre Bibliothek, die so ziemlich alles enthielt, was seit ca. zwanzig Jahren auf diesem Gebiet – der Experimentiererei mit Pflanzen (in Japan, in den USA und in der UdSSR hauptsächlich) getan bzw. publiziert worden war.
Auch Jakob Böhme oder viele Indianer beispielsweise kommunizierten schon mit Pflanzen. Eines Abends, nachdem ich sie wieder einmal besucht, sie aber draußen in der Macchia beschäftigt gefunden hatte, nahm ich mir dort ein Buch aus dem Regal, das mich schon beim ersten flüchtigen Durchstöbern der Bibliothek interessiert hatte. Es handelte sich dabei um die Reiseaufzeichnungen eines portugiesischen Kapitäns, bzw. seines Sekretärs, d.h. insbesondere um deren Aufenthalt auf der Insel Locuta, südlich von Laputa. Diese Inselbewohner (der Reisebericht war allerdings schon 1903 in Lissabon veröffentlicht worden), die Locutaner, lebten ausschließlich vom Sammeln und Anbauen, also systematisierten Ernten von Pflanzen. Es gab außer einigen Insektenarten und einer von ihnen verehrten Fledermausart keinerlei tierisches Leben auf der Insel, und seltsamerweise verabscheuen die Locutaner, die im übrigen äußerst geschickte Auslegeboots-Bauer und -Benutzer sind, den Fischfang, bzw. das Verspeisen von Meerestieren jeglicher Art. Dieses Angewiesensein auf die Inselflora (zu der Maniok, Tapioka und Kokospalmen gehören, aber anscheinend erst seit einigen hundert Jahren) hat die Locutaner im Laufe der Zeit nicht nur zur Ausbildung und Anhäufung eines immensen botanischen Wissens getrieben, sondern ist auch noch völlig von dem unsrigen verschieden: Im Unterschied zu unserer kennt ihre Botanik anscheinend keine vertikale Achse in ihrem Klassifizierungssystem. (Man erinnere sich hierbei nur an das Linnésche “Ständesystem” beispielsweise – in dem die Moose die Ärmsten bilden, die Gräser als Bauern, die Kräuter als Adel und die Bäume als Fürsten anzusehen sind, ja, in dem auf gut darwinistischer Art und Weise sogar die Botaniker selbst noch innerhalb dieses “Systems” funktionieren. Linné ist in diesem von ihm als “Heer” Charakterisiertem ein General, Jussieu Generalmajor, Haller und Gesner müssen sich mit dem Rang eines Obersten zufriedengeben; und für Siegenbeck bleibt nur die Position eines Feldwebels – sublime Rache des “Generals”, der sich zuvor bei Haller über die Kritik Siegenbecks an seinem “System” beschwert hat.) Demgegenüber erstreckt sich das botanische Wissen der Locutaner – ohne abstrakte Begriffe wie “Baum”, “Strauch”, usw. überhaupt zu kennen – in der Unendlichkeit des Sprachraums, versucht gleichsam an das amorphe oder wildwüchsige Wachstum ihrer Objekte selbst sich anzupassen bzw. anzuschmiegen – dies ganz im Sinne einer “zarten Empirie”. So kommt es immer wieder vor, dass für (nach unserer Vorstellung freilich nur) ein und dieselbe Pflanzenart neue Wörter oder Wortverbindungen (unter reichlicher Verwendung sog. “Sufffixe”) gefunden werden, die auch – wenn sie gut gelungen scheinen – beibehalten werden, aber die “Sache” durchaus nicht abschließen. Wenn beispielsweise ein oder mehrere Locutaner das Gefühl haben, eine bestimmte Pflanze noch nie zuvor derart gewachsen und in einem bestimmten Licht an einem bestimmten Ort stehend, gesehen zu haben oder auch nur gerochen oder in ihrer Einbildung sich vorgestellt zu haben, dann versuchen sie sofort, einen “neuen” Begriff dafür zu finden, der natürlich aus verschiedenen “alten” Worten oder Wortteilen zusammengesetzt wird. Und deswegen kann man nicht – wie Lévy- Strauss es noch tut – sagen: Die Locutaner kennen 12.824 Pflanzennamen, wo wir auf Locuta (sowie auf einigen kleineren angrenzenden Inseln) nur 683 kennen würden. Sie werden nie und ein für allemal alle Pflanzen kennen, so müßte es genauer heißen. Oder vielleicht treibt sie auch einfach die Furcht vor der Tatsache, dass man unterhalb einer Pflanzenart nur noch die Pflanzen zählen kann, immer weiter? (Die Locutaner sind schlechte Rechner!). Egal.
Was mich besonders faszinierte an diesem portugiesischen Reisebericht, waren die seitenlangen ungläubigen Schilderungen einiger seltsamer Rituale der Locutaner, in und mit denen sie versuchten (ganz unabhängig von ihren zyklisch stattfindenden Erntefeiern), die Träume vieler ihnen anscheinend besonders wichtiger Pflanzen zu deuten. Man weiß mittlerweile, dass so ziemlich alle Säugetiere träumen, und selbst bei vielen Reptilien und Fischen wird die Traumphase in ihrem Schlaf nicht mehr für unmöglich gehalten, aber hierzulande hat man sich bisher kaum mit den “Trauminhalten” beschäftigt. Sieht man einmal davon ab, dass bei im Schlaf “laufenden” und “hechelnden” Hunden gemeinhin davon geredet wird, ein solcher Hund würde dabei von einer “Jagd” träumen. Auf jeden Fall hat man bisher träumenden Tieren zumeist nur unterstellt, sie würden dabei von ihrer jeweiligen “Lieblingsspeise” träumen oder von einer besonders attraktiven Ausgabe ihrer jeweilig entgegengesetzt-geschlechtlichen Spezies. Solches könnte man gewissermaßen als “platt-freudianische” Deutungsversuche tierliebender Laien bezeichnen. Aber die Locutaner “lieben” die Pflanzen nicht, mal ganz abgesehen davon, dass ihre “Deutungen” weitaus differenzierter (oder sollte man sagen: phantasievoller?) sind. Es ist vielleicht nicht übertrieben zu sagen, für sie bedeuten die Pflanzen – abgesehen vom Inzesttabu – das große Fragezeichen. Die Aufzeichnungen ihrer Deutungsrituale, die endlos tanzend um die Trauminhalte einiger Pflanzen kreisen, wie sie von jenem portugiesischen Sekretär (Laudade hieß er) niedergeschrieben wurden, lesen sich stellenweise wie das Traumtagebuch eines Irren (was nicht verwunderlich ist – halten sich nicht auf der anderen Seite viele Irre für “verpflanzlicht”?). Wie auch immer. Dieses Buch verdient es, ins Deutsche übersetzt zu werden.
Die drei Frauen meinten dazu, sie würden mehr an “Denotationen”, bzw. an deren “Variierungen” interessiert seien als an “Konnotationen”. Das hatte ich aber schon gesagt, dass sie weniger versuchen, Kommunikationsprobleme mit irgendwelchen Pflanzen zu lösen als vielmehr deren Kommunikationsprozesse untereinander aufzufangen und mittels Tongeneratoren und Verstärker in Töne umzusetzen, gewissermaßen zu “versprachlichen”, zumindest aber für das menschliche Ohr hörbar zu machen. So ähnlich vielleicht, wie ich die italienische Sprache, die ich nicht spreche, wahrnehme: ein wohlklingendes Rauschen zwischen zwei oder mehreren intelligenten Sprechern. Wegen meines Nicht-Verstehens halte ich nämlich alle auf italienisch geführten Gespräche für ziemlich intelligent. Nicht zuletzt deswegen zeige ich wenig Neigung, mich desillusionieren zu lassen. Beispielsweise könnte ich mich dann dort nicht mehr stundenlang dem ungeteilten Genuß des Schlagerhörens im Radio hingeben.
Die drei Frauen nun, um darauf zurückzukommen, versuchten die mittels Geräte hörbar gemachten pflanzlichen Lebensäußerungen parallel auf 26 Tonbänder und Kassetten im unteren ehemaligen Mühlraum aufzuzeichnen. An dieser Stelle im Erdgeschoß, im größten Raum des Hauses, der im Sommer zum Hof hin offen ist, weil dann die große Flügeltür ausgehängt wird, findet die eigentliche musikalische oder kompositorische Arbeit von Elfi, Lena und Ohio statt – mit Mischpult (8 auf 4), 4-Kanal-Aufnahmegerät, zweitem Mischpult (4 auf 2) und 2-Kanal-Mastermaschine. Früher haben sie (auf den ersten Platten ist das sehr schön nachvollziehbar) auch noch die Möglichkeiten elektronischer Verwandler und Verzerrer reichlich genutzt (dazwischengeschaltet): Vocoder, Sequenzer, Ringmodulatoren etc.. Derlei ist jetzt aber erst einmal wieder in den Hintergrund gerückt (und staubt vor sich hin). Statt dessen arbeiteten sie nur noch mit einer Stage-Box, mit der sich 10.000 Volt auf einige selbstgebaute “Instrumente” verteilen lassen – diese Instrumente werden allerdings von ihnen nicht “gespielt”, sondern von den mit der Musik der Pflanzen, Sträucher und Bäume gespeisten Tonbändern.
Spätestens hier stellt sich vielleicht die Frage: Was ist das denn nun überhaupt für eine “Musik”, die da zusammengeschnitten wird? Erst einmal: Zwar lassen sich die einzelnen Pflanzen einer Art oder Familie unterscheiden, was Lautstärke, Tonhöhe, Rhythmik, Schnelligkeit in der Tonfolge, Varianz etc. betrifft, aber es gibt auch innerhalb ein und derselben Pflanzenart gewisse Unterschiede in der Ausdrucksweise.
Lena hatte vier Kongogras-Pflanzen (ein Steppengras, das annähernd zwei Meter hohe wird) in der Macchia auf unterschiedlichen Terrassen angepflanzt. Die ersten Wochen hörten sie sich an wie vier im Eismeer bei Nebel vom Kurs abgekommene Fischkutter-Nebelhörner oder eher noch wie vier verwaiste Pottwalkinder, die wenigstens untereinander noch in Rufkontakt bleiben wollten. Dann wurde diese Rufe langsam lauter, fast schrill, aber zugleich selten und immer seltener. Dagegen Elfis Geranie, die ununterbrochen vor sich hin schwätzte – dabei Pfeif-, Schmatz- und Gurgelgeräusche produzierend. (Wobei man sich bewußt sein sollte, dass dergleichen Anthropologismen nur Annäherungswerte oder Übersetzungshilfen sein können, in Wirklichkeit sind ihre Äußerungen nicht mit “Gurgeln” oder “Schmatzen” identisch.) Der riesengroße Efeu, der an der Westseite des Hauses bis zum Dachrand sich bereits hochgerankt hatte, hörte sich genauso an wie eine Efeuranke, durch die der Wind weht und die Blätter gegeneinander bewegt bzw. gegen die Hauswand und an die Dachrinne scheuert, wobei er sich so oder so ähnlich auch “ausdrückte”, wenn es völlig windstill war und sich kein Blatt bewegte. Und eine blecherne Dachrinne gab es an dem Haus sowieso nicht. Einer der vielen Akazienbäume gab Geräusche von sich, die sich anhörten, als würde eine Kindergruppe fortwährend kleine Hölzchen zerbrechen oder aber mit den Fingern schnipsen. Einige Gräser, die zusammengenommen auf den ersten Blick wie ein kleines Stückchen ungepflegter englischer Rasen aussahen, produzierten auf einem umgebauten “Elektrovegetometer” (ehemals eine Erfindung von Bertholon) ein fortwährendes und an- und abschwellendes Rauschen, wie man es gemeinhin aus den “Störungen” der Kommunikation (zwischen irgendwelchen elektronischen Sendern und Empfängern kennt), hier aber, am anderen Ende der Evolution gewissermaßen, genauer: der Nahrungskette, bedeutete es genau das Gegenteil. Am meisten hatten es mir einige mit Kabeln verbundene Aprikosenbäume angetan. Mitunter waren sie fast vollkommen ruhig, aber dann fingen sie langsam an, wie ein heraufkommender Sturm, dazu oder daneben setzte ein Schlagen ein wie ein über Stethoskop verstärktes Herzklopfen. Dies wurde so schnell, dass es in ein Sausen überging, das seinerseits drei- oder vierfach zu hören war: ein tiefes und dumpfes Summen, ein klares Murmeln wie von einem klaren fließenden Wasser und ein sehr scharfes Pfeifen, dann noch ein hektisches Surren, das Ähnlichkeit mit dem Geräusch eines gestörten Bienenschwarms hatte. Einige Kürbispflanzen oder Wassermelonen (ich weiß nicht mehr genau, welche es waren), schienen mir weit entfernten Kongaspielern ähnlich. Ich erwähnte schon den Bougainvillea-Strauch: Er bzw. seine Blätter gaben Geräusche von sich wie ein Dutzend Kojoten (ich muß dabei gestehen, dass ich noch nie Kojoten gehört habe!) oder vielmehr wie zwei Kojoten, die sich paarweise in ihrem Geheul ablösten, wobei dazu noch so etwas wie ein feines Echo kam, dazu ein weiteres und noch ein weiteres, immer feiner werdendes Echo.
Die meisten Geräusche konnte ich natürlich nicht identifizieren in diesem Kabeldschungel im unteren Mühlraum, aber was es auch immer für ein Gefiepe, Gebrumme, Geblubber, Gesäusel oder Gemurmel war, eine gewisse Rhythmik war fast überall rauszuhören, d.h., gewisse Sequenzen wiederholten sich, wenn auch durchaus mit inneren Variationen oder Doppler-Effekten. Und obwohl die drei Frauen nur an dem musikalischen Aspekt der interpflanzlichen Artikulationsweisen interessiert waren und also diese nicht mit irgendwelchen intervenierenden Variablen (wie Wetter, Sonne, Bedrohung, Tageszeit, Blütezeit, Fruchttrieb, Fruchtreifung, Mondstellung usw.) in Zusammenhang brachten, wie sie ebensowenig darüber groß nachdachten, wie die Pflanzen diese Töne und Geräusche produzierten und warum und welche Rolle dabei den einzelnen Pflanzenteilen (Wurzel, Stamm, Ast, Blatt, Blüte usw.) zukam, bzw. wie diese dabei zusammenwirkten, so läßt sich doch immerhin so viel dazu sagen, dass diese pflanzlichen Verlautbarungen weder “dem arbeitenden Nervensystem” noch “dem pulsierenden Blut” geschuldet sind, also gänzlich außerhalb eines (mit solchem ausgestatteten) Organismus produziert werden. Was natürlich nicht heißen soll, dass diese Pflanzen nicht auch gewissen Harmonievorstellungen nachhängen – was dem Menschen recht ist, ist der Pflanze vielleicht nur billig. Der neuesten LP von Elfi, Lena und Ohio ist das sehr schön, sehr unverfälscht, zu entnehmen. Ihre Platten werden übrigens über das Sieneser Label “Niente Divertimento” vertrieben und sind fortlaufend durchnumeriert: “Canti di Macchia di Capraia” I/II/III usw..
Ich bin mir bewußt, dass ich hier – teilweise aus Gründen meines Dilettantismusses, aber auch wegen der hier erforderlichen Kürze, vieles unklar oder zu vage gelassen habe. Hinzufügen möchte ich aber wenigstens noch, dass Elfi, Lena und Ohio diese Musik nicht aus irgendwelchen intellektuellen oder ökologischen Überlegungen heraus zusammenstellen oder zusammenmischen, sondern aus dem ganz simplen Vergnügen an Musik und – damit zusammenhängend – Tanz. Sie ist zwar nicht ganz so eingängig wie der Pogo beispielsweise (sie entspringt ja auch ganz anderen Zusammenhängen), aber dennoch ist sie viel einfacher, will sagen: tanzbarer – als beispielsweise die Musik der “Großen Untergangsshow” auf den Tempodrom- Festivals, von der die drei Frauen sagten, man solle die Jungs ruhig machen lassen, sie sei immerhin für diejenigen gut, “die nur durch Vernünfteln zum Glauben kommen können”, wie es Hugo Ball wohl gesagt hätte. Wobei mir allerdings nicht klar geworden war, was sie mit “Glauben” dabei meinten, denn nichts liegt ihnen ferner als “Mystisches”, “Religiöses” oder ähnliches. Sie sind fanatische und geniale Techniker/Tüftler und Künstler/Musiker. Über diese Leidenschaft haben sie selbst die einfachsten botanischen Kenntnisse vergessen oder verschlampt. Nicht einmal der Salat im Garten wird von ihnen rechtzeitig geerntet, bevor er ins Kraut schießt. An einem Abend diskutierten wir bis in die späte Nacht hinein am Kamin in der Küche bei Kerzenlicht den “Fairlight CMI” von Bognermayr und Zuschrader. Ich kannte nur deren Platte “Erdenklang”, die drei Frauen hatten selbst einmal mit diesem von Peter Vogel entwickelten Gerät im österreichischen Forsthaus der beiden Musiker experimentieren können, wenn auch unter scharfer Beobachtung der beiden Männer. Ohio erzählte, entschuldigend lächelnd, dass die beiden österreichischen Musiker dabei eine ganze Menge von den Frauen gelernt hätten, was die spätere Produktion ihrer “Bio-Musik” betrifft, die sie dann mit Industrie-Tönen und sogar mit an Bruckner und Vivaldi gemahnenden Sentenzen vermischt und polyphon arrangiert zu grotesken Symphonien verschmolzen hatten. Bei ihren Bio-Musik- Sequenzen würde es sich allerdings nur um so offenliegende Geräusche wie fallende Wassertropfen oder die Donau bei Linz, eine Tierstimme und Ähnliches handeln, wobei die eigentliche “Arbeit” des Gerätes darin liege, gewissermaßen komplexe kombinatorisch-kontrapunktische Aufgaben zu übernehmen, ein elektronischer Leibniz sozusagen. So lasse sich aus dem “Wassertropfen” beispielsweise ein xylophonähnliches Instrument herstellen, unscharf ausgedrückt. Der “Fairlight CMI” also als ein durchaus traditioneller Komponist, dies auch noch in seiner Spielart als Pop-Musik- Produzent, der das “Knarren einer Bettfeder” in ein fast perfektes “Emotional Rescue” (von den Stones) verwandelt, vielleicht auch nur in ein “zu perfektes” Retro-Szenario.
Während es den drei Frauen in der toskanischen Mühle darum geht, ihrer Flora durch Verkabelung und Anschluß selbst den Swing zu entlocken, eigene kompositorische Überlegungen und Anstrengungen also möglichst auf Null zu reduzieren. Nach meinem letzten Besuch bei ihnen auf der Mühle brachten sie mich mit ihrem R4 runter in den Ort zum Bus. Der Ort, Talla, ist der Geburtsort von Guido di Monaco – auf dem Dorfplatz neben einem Goldfischteich steht ein kleines Denkmal mit seinen Lebensdaten. Außerdem kann man auf dem Weg zum Friedhof noch sein Geburtshaus besichtigen. Das taten wir aber nicht, sondern tranken wegen der Mittagshitze einen mit Wasser verdünnten Wein bei Senora Tassini, die eine der zwei Kneipen im Ort besitzt. Elfi, das darf ich zum Schluß vielleicht noch erwähnen, steht übrigens auf ganz konventionelle Rockmusik (Roch’n’Roll). Oder jedenfalls hat sie sich vor einigen Wochen mit einem in Berlin lebenden Saxophon-Spieler verheiratet, der im Hauptberuf den Bioladen “Sesammühle” betreibt. “Wir heiraten nur, weil wir so weit auseinander wohnen”, erklärte sie dazu. P.S.: Eines habe ich noch vergessen: Elfi, Lena und Ohio arbeiten jetzt schon seit mehreren Jahren mit Pflanzen. Dabei haben sie festgestellt, dass zwar keine Pflanze völlig stumm ist (Stummheit bedeutet Tod oder Defekt im angeschlossenen Gerät!), aber es gibt doch eine ganze Reihe von Pflanzen (nicht unbedingt eine ganze Pflanzenart!), die ziemlich “unmusikalisch” sind – einige Eichen beispielsweise, aber auch sehr viele Hülsenfrüchte und Aubergingen. Wobei “Unmusikalität” hier so viel bedeuten soll wie: Man kann auf ihren Sound einfach nicht abfahren, d.h., man kann ihn nur reichlich untergemischt verwenden, wenn überhaupt.
P.S.: Neuerdings gibt es eine weitere Künstlerin, die mit Pflanzen arbeitet, genauer gesagt: eine Musikerin, die Pflanzen als Instrumente benutzt. Die Zeitschrift “Texte zur Kunst” berichtete kürzlich darüber, deswegen erspare ich mir hier weitere Details. Christiane Meyer soll unterdes nach Armenien gezogen sein, wo sie mit wilden Pflanzen arbeitet, das hat sie in Bremen noch nicht gemacht – im Gegensatz zu Elfi, Lena und Ohio, auf deren Experimente ich mich hier konzentriert habe, weil ich in den frühen Achtzigerjahren schon mal ein Porträt von Christiane Meyer in der taz veröffentlicht hatte – kurz nachdem sie bei der taz in Berlin aufgehört hatte und nach Bremen gezogen war.
Abschließend möchte ich, ausgehend von meinen eigenen geringen Erfahrungen mit Zimmerpflanzen und Topfblumen, noch eine kleine Hypothese wagen: Für sie sind wir Gott – d.h. alles Gute kommt von oben (Wasser, neue Erde, ein neuer Topf, Dünger, Entlausung, Pilzvernichtung, die richtige Besonnung etc.) – oder es kommt eben nicht! Es ist jedenfalls von den Pflanzen nicht beeinflußbar – fällt also wie eine Naturgewalt über sie her. Franz Kafka hat das einmal – in den “Forschungen eines Hundes” – genauer ausgeführt: Das Denken eines von der (höheren) menschlichen Gunst vollkommen abhängigen Individuums. Wenn man Kafka folgt und dies auch für Pflanzen gelten läßt, dann sind ihre (hörbar gemachten) Lebensäußerungen nichts anderes als liturgische Gesänge. Wohlmöglich uns zu Ehren, wobei sie uns beschwören, es ja gut mit ihnen zu meinen – eine grauenhafte Vorstellung: diese Verantwortung!
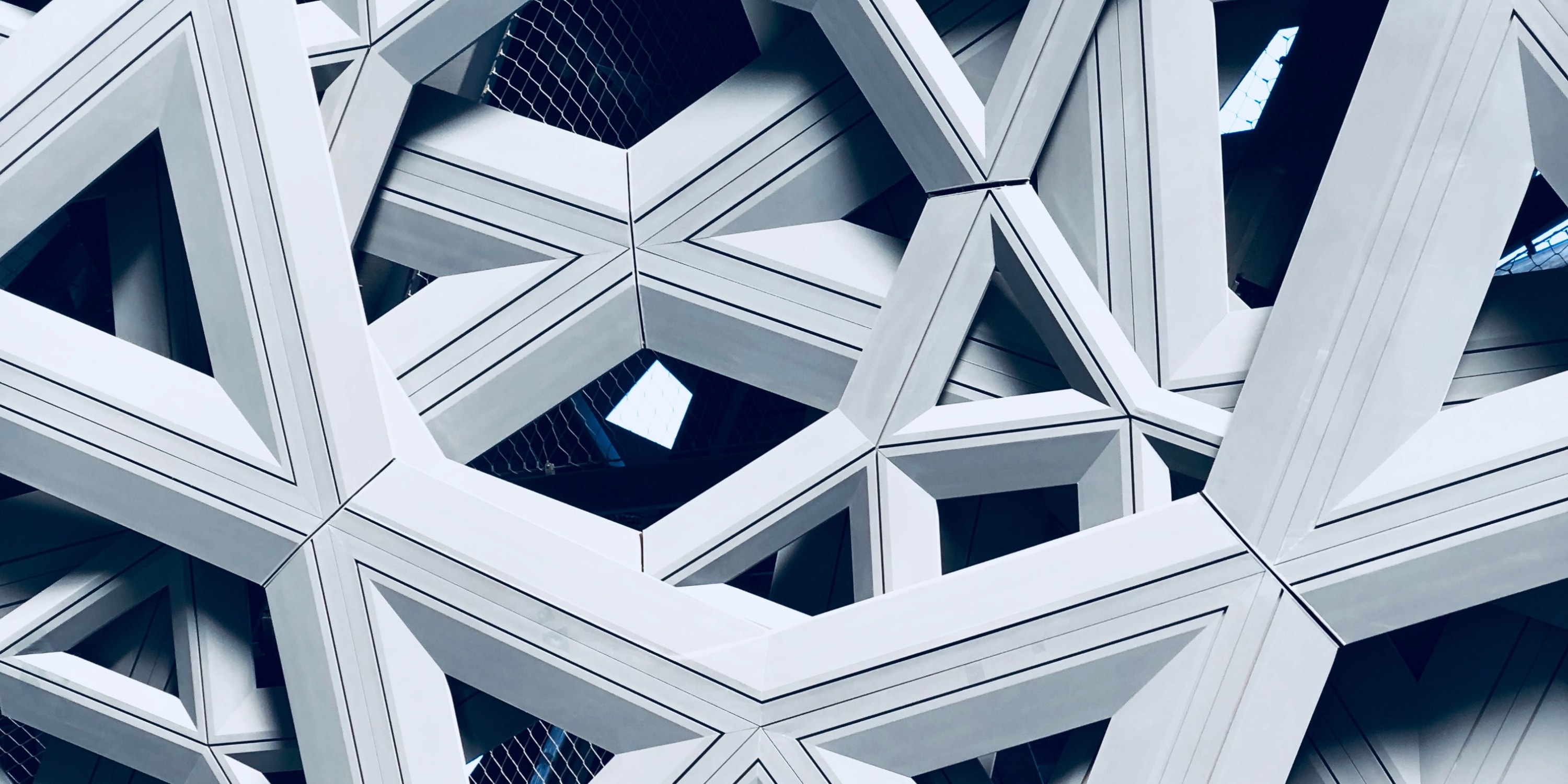



[…] 1) Vermeindliche Gefahren Pflasnzen vermehren sich nicht absolut unkontrolliert (wie Bakterien). Und man hatte auch bisher immer mit Unkräutern zu kämpfen. Und diese haben auch ständig versucht sich gegenseitig zu verdrängen. Zum einen kamen gewisse Gentransfers zwischen verschiedenen Pflanzenarten auch bisher gelegentlich vor. Und die Natur ist damit fertig geworden. Zum anderen sind die natürlichen Pflanzen so gut designt, dass es nicht möglich sein dürfte, plötzlich Wunderpflanzen zu schaffen die diese alle verdrängt. Denn auch gentechnische Pflanzen sind an die bisherigen biologischen abläufe gebunden. Man kann Pflanzen durchaus für eine oder mehrere Aspekte optimieren (ob Züchtung, Gentechnik, …),aber dies hat auch seinen Preis. Wunderpflanzen entstehen dadurch nicht. 2) Gefahren und Fehlschläge a) Man kann vielleicht durch Gentechnik alle möglichen Resistenzen zunächst realisieren. Nur diese Pflanzen dürften dann auch ziemlich viele natürliche Giftstoffe enthalten. Dies könnte durchaus zu einem Problem werden. Man will dan chemischen Pflanzenschutzmitteln entkommen und kommt dann eventuell vom Regen in die Traufe. b) In Deutschland hatte man vor einiger Zeit eine besonders vielversprechende Hybrid-Roggensorte gezüchtet (Name: Farino). (Hybrid-Zucht bei Roggen. Noch keine Gentechnik aber schon nahe daran). Leider hatte der einen kleinen Fehler. Diese Sorte hatte leider etwas wenig Blütenpollen. Das war normal aber kein Problem. Nur 99 (oder 98 ??) war die witterung so, dass dies dazu führte, dasssich bei dieser sorte auf vielen Feldern extrem viel giftiges Mutterkorn bildete. Teilweise war das Getreide zu verseucht,dass eine Ernte schon sinnlos war. Moral: Man sollte sehr sehr vorsichtig sein bevor man groß herumspielt. Sehr leicht übersieht man einfach etwas wichtiges. c) In den USA gab es eine gentechnische Baumwollsorte die gegen irgendeinen Schädling resistent war. Die wurde auch verbreitet angebaut. Leider gab es da auch in einem Jahr ein größeres Problem. da verlor diese Sorte bereits vor der Reife einen wesentlichen Tei des Ertrages (irgendwelche Kapseln platzten vorzeitig auf). Dies führte zu etwa 25% Ertragsrückgang. Dementsprechend ging auch der anbau dieser sorte zurück. Moral. Es wird noch viele Rückschläge bei der Gentechnik geben. 3) Antibitikaresistenz Ein anderes Thema ist wenn Antibitikaresistenzgene als Marker eingesetzt werden. Dies sollte auf jeden Fall verboten werden. Fazit: Gefahren sind nicht gigantisch, aber auch die Vorteile sind nicht so revolutionär wie oft versprochen • • • • […]