„Mein Herz ist rein, mein Popo ist schmutzig, ist das nicht putzig…“
Die UNO kürte 2008 zum „Jahr der Toiletten“. Dazu erklärte der UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon passend zum „Weltwassertag“, der seit 2003 jährlich am 22.März stattfindet: „Knapp 40% der Weltbevölkerung, 2,6 Milliarden Menschen, haben keinen Zugang zu ordentlichen Toiletten. Alljährlich sterben deswegen 15 Millionen – an ansteckenden Krankheiten wie Durchfall.“ Der Leiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO), David Heymann, ergänzte: „Die Zahl der Todesopfer könnte durch Verbesserungen bei Wasserversorgung und sanitärer Ausstattung um zwei Millionen gesenkt werden“.
In Deutschland ist eher das Gegenteil zu befürchten: Dass weitere „Verbesserungen“ zu irreversiblen Schäden führen. Hier sind aus den Klos im Zuge der Fitness- und Wellnessbewegung wahre „Wohlfühl-Oasen“ geworden. Mit der Folge, dass immer mehr Menschen sich bei der Ausgestaltung ihrer narzistischen Naßzellen pekuniär verausgabten. Auf der inzwischen sämtliche Hallen füllenden Frankfurter Sanitärmesse, die 215.000 Interessierte 2007 besuchten, wurde z.B. das „Dusch WC“ von Designer Uli Witzig am „Balena“-Stand geradezu umlagert: „eine Kombination aus Klo und Bidet – mit einem ausfahrenden Duscharm für sanfte Reinigung, weiters mit Geruchsvernichtung, Fernbedienung und einem Fön ausgestattet.“ Der Preis – 900 Euro – schien keinen abzuschrecken.
Noch extremer ging und geht es in Ostdeutschland zu, wo sofort nach der Wende Privatkredite in Höhe von mehreren Milliarden DM primär zur Modernisierung von Bädern und Latrinen ausgegeben wurden und ganze Kommunen sich mit dem Bau von utopisch überdimensionierten Kläranlagen sowie neuer Kanalisation ruinierten. Der Journalist Wolfgang Sabath schreibt in seinem Buch „Das Pissoir“ über das Ostberliner Intelligenzblatt „Sonntag“, wo er Redakteur war, dass zwei seiner Kollegen 1991 plötzlich anfingen, das Klo zu putzen, als der Zeit-Herausgeber Bucerius sich zu einem Besuch ansagte. Sie hofften, dass er den „Sonntag“ übernehme, der damals noch dem Kulturbund gehörte. Bucerius ließ sich dort jedoch überhaupt nicht blicken, nachdem ihm der neue Chef des Kulturbunds die Abokartei verkauft hatte. Ich selbst erinnere mich, dass man in dem an die Treuhand gefallenen Batteriewerk in Oberschöneweide das gerade geräumte Büro des Parteisekretärs als erstes zu einem dort so genannten „Investorenscheißhaus“ umbauen ließ. Der Raum wurde eierschalenfarbig gekachelt und mit Topfpalmen dekoriert. Die Spülung der Pißbecken funktionierte fortan automatisch über Lichtsensoren. Dieser Einzug der Hightech in den „stillen Ort“ galt dem Philosophen Jean-Francois Lyotard als Signum der Postmoderne. Er begegnete ihm bereits 1980 auf der Toilette des Fachbereichs Informatik der dänischen Universität Aarhus, wo er ihn als „neue Aussage“ begriff sowie als eine „Gewissheit“ darüber, „daß es keine Ohnmacht gibt, außer durch Depression“.
Die Ostler fielen mit dieser „Aussage“ jedoch bloß in eine neue – postsowjetische – Depression, und kamen damit quasi vom Regen in die Traufe: „Früher hatten wir Gäste ohne Ende, aber keine Waren, jetzt haben wir jede Menge Waren, aber keine Gäste mehr,“ so sagte es der Wirt der „Truckerstube“ bei Magdeburg, der 21.000 DM allein in seine Gästetoiletten investierte: „Jeder Klodeckel ist anders!“ In manchen Ost-Baumärkten gibt es bis zu 100 verschiedene Toilettendeckel. Besonders beliebt sind dort durchsichtige Plastikdeckel mit eingegossenem Stacheldraht. In Thüringen verkaufte eine West-Santärfirma vielen Kneipen Klobrillen zum Auflegen auf die Klobrillen. Die Aufleger hingen nach Art von Rettungsringen über den Becken an der Wand. Die Erfindung war ein Flop, aber noch heute sieht man dort in vielen Abtritten diese inzwischen leeren Halterungen an den Wänden.
Vollends verarscht fühlten sich die Ostler, als auch noch überall auf den öffentlichen Plätzen farbig illuminierte „City-Toiletten“ auftauchten, die „Challenge“, „Campo“, „Avenue“, „Helios“ oder „Streetline“ hießen. Und von der Privatfirma „Wall AG“ aufgestellt wurden, die dafür bis in alle Ewigkeit alles drumherum mit Reklame zuscheißen darf. Der Klobesitzer Hans Wall bekam das Bundesverdienstkreuz, während gleichzeitig die Klofrauen in den ganzen DDR-„Pachttoiletten“ schnöde „abgewickelt“ wurden. Der „Wall“-Wahn ist inzwischen schon so weit gediehen, dass z.B. die Redakteure der Kreuzberger Schülerzeitung „Borsign“ in ihrem Artikel über einen Wandertag, der sie nach Tegel führte, diese Klos als einzige Sehenswürdigkeit dort lobten: Wegen Regen hatten sie sich in eine dieser neuen musikbeschallten „City-Toiletten“ verdrückt – und sich darin prächtig amüsiert. Weil Bucerius den „Sonntag“ nicht übernahm, durften wenig später einige seiner Redakteure, die ganz umsonst das Klo für ihn geputzt hatten, ein Zeit-Magazin („Start ins neue Deutschland“) füllen. Sie schrieben darin: „Die Werbung überzieht das Land flächendeckend, wie früher die Stasi!“ Und bekamen dafür, ebenso wie die Zeit-Chefredaktion, sofort Ärger – vom „Zentralausschuß der Werbewirtschaft“. Dieser hat nebenbeibemerkt seit 2003 auch noch die Klowände in Gaststätten als Werbeflächen entdeckt. Dem Vernehmen nach experimentiert er gerade mit akustischer Werbung, die beim Hochheben des Klodeckels aus dem Becken tönt.
Wie wäre es z.B. mit dem neuesten Album der Berliner Popband „Die Türen“, es heißt „Popo“ und die Musiker verweisen darauf bereits auf das „Jahr der Toiletten“, wobei sie sich jedoch nicht auf den UNO-Generalsekretär, sondern auf die – ebenfalls in Berlin ansässige – „German Toilet Organization“ (GTO) berufen, die sich für „nachhaltige Abwassersysteme“ einsetzt. Eine ihrer Forderungen lautet: „Das ‚Toiletten-Tabu‘ muß gebrochen werden!“
Aus seinen Analysen der bürgerlichen – von allen Exkrementen säuberlich abgesonderten – Psyche gewann Sigmund Freud einst die Erkenntnis, das ihre Erziehung zur Reinlichkeit, speziell in der frühkindlichen analen Phase, zu einer fatalen Entsprechung von Scheiße und Geld führe – beides halten sie später zwanghaft zurück. Noch in der Studentenbewegung bezeichnete man deswegen nervige Zwangscharaktere, die übergroßen Wert auf Sauberkeit und Ordnung (bis ins Demographische und Biologische hinein) legen, als verschissene „Analkacker“.
Seit der gigantischen nachgeholten Aufrüstung der Naßzellen im Osten ist nun ganz Deutschland quasi analfixiert. Und so weiß man nicht mehr: Ist z.B. die „German Toilet Organization“ ein verkackter Klowitz, eine bloße Webpage-Windbeutelei oder eine ernsthafte „Bürgerinitiative“? Schon früher war Deutschland das Land mit den meisten Anal-Schimpfwörtern. Inzwischen wird in den Autobahn-Toiletten jede etwa zweistündige Reinigung schriftlich an der Tür festgehalten. Und Klosprüche scheinen für viele Deutsche die beliebteste Form der freien Meinungsäußerung zu sein. Wegen eines solchen (führerkritischen) Spruchs – auf die Wand der öffentlichen Toilette am Kreuzberger Mariannenplatz – wurde 1943 der Arbeiter Wilhelm Lehmann hingerichtet.
Erwähnt seien ferner die mobilen Dixi-Klos: Weit über Deutschland hinaus gibt es kaum noch eine öffentliche Veranstaltung, auf denen diese Chemietoiletten nicht stehen, die von der Ratinger Firma ADCO hergestellt werden – und das in solchen Mengen, dass sie damit inzwischen laut Wikipedia ein „umgangssprachliches Begriffsmonopol“ etablierten. Weltweit einzigartig ist auch „www.toilette.oglimmer.de“: die „1.Webseite, die sich ausschließlich mit dreckigen und verschissenen Toiletten beschäftigt“ – und zwar mit Fotos und in Farbe! Typisch deutsch dürfte auch sein, dass die neue Mode, seine Arsch- und Schamhaare abzurasieren, sich hier sofort bis in die untersten Klassen durchsetzte. Und ein Lied wie „Katzenklo“ (von Helge Schneider) zu einem Dauerhit werden konnte.
Dazu gehört auch der beliebte „Flachspüler“, den die Nazis einst als echtdeutsch favorisierten, und der sich noch immer nicht gegen die „Tiefspüler“, wie ihn alle anderen Völker benutzen, durchsetzen konnte. Der korsische Naßzellenforscher Guillaume Paoli spricht deswegen bei dieser Form der fäkalen Entsorgungs-Zwischenlagerung, bei der man sein „Geschäft“ vor dem Wegspülen noch einmal kritisch bzw. begeistert begutachten kann, von einem „deutschen Sonderweg zum Gully“, der nur äußerst langsam – mit der Amerikanisierung – verschwindet. Wie überhaupt das Wort „Zwischenlager“ geradezu kerndeutsch ist. So wie auch das einstige „Torfklo“ für Arme, das sich heute bei den Hardcore-Ökos, insbesondere auf dem Land und in Schrebergärten, als – nunmehr teure und edle – „Komposttoilette“ wieder durchsetzt.
Was den Umweltschutz angeht, ist Deutschland inzwischen führend. Am ökologisch sauberen deutschen Wesen wird dereinst die Welt genesen. Der ehemalige KZ-Häftling Wieslaw Kielar besc hrieb 1979 Auschwitz unter dem Titel „Anus Mundi“. Diese Metapher vom „Arsch der Welt“ griff später der Partisan und Auschwitzhäftling Primo Levi auf.
1918 war bereits ein Roman über die deutsche „Arschkriecherei“ erschienen – von Heinrich Mann: „Der Untertan“. Das Buch, von Kurt Tucholsky als „Herbarium des deutschen Mannes“ gelobt, löste auch noch in seiner 1951 von Wolfgang Staudte verfilmten Fassung heftige Kontroversen aus. Erst recht dann Daniel Goldhagens Analyse des nazideutschen Untertanengeistes. Der sich hier und heute auch unter Heteros immer größerer Beliebtheit erfreuende „Arschfick“ könnte eine postmoderne Variante dieses spezifischen autoritären Charakters sein, die sich bis in die Systemzeit meist noch mit Pornos begnügte, auf denen Frauen „anständig der Hintern versohlt“ wurde, und dann langsam in das massenhafte „Schleifen“ von Rekruten überging – bis ihnen „das Arschwasser kochte“.
Für „die deutsche Tiefgründigkeit“ machte Nietzsche einst „eine harte und träge Verdauung“ verantwortlich. Jetzt gibt es dagegen für die „deutsche Elite“ in Frankfurt am Main einen Proktologen, der einen sündhaft teuren Einlauf zusammenstellte, den er seinen Patienten vor wichtigen Sitzungen und Entscheidungskonferenzen rektal verpaßt – das Mittel sollte sie entspannen und vitalisieren. Bald war es unter dem lokalen Führungspersonal derart begehrt, dass er seinen Naßzellenbereich vergrößerte und ein spezielles Klistier konstruierte sowie einen Bock, auf den der betreffende sich rüberlegen mußte. Schließlich stellte er noch einen Bademeister ein. Der Einlauf darf nicht zu oft gemacht werden, aber seine Patienten bestachen den Bademeister schon bald mit immer höheren Summen, um auf den Bock zu gelangen. Entscheidend ist, was hinten reinkommt, um hier ein Bonmot des Restaurationskanzlers Kohl zu paraphrasieren.
Zum Vergleich:
Russland:
Russland ist toilettenmäßig das genaue Gegenteil von Deutschland. Nachdem schon das verdreckte sowjetische Primitivklo von Ilja Kabakov auf der 9. Kassler documenta die antikommunistische deutsche Kunstseele umschmeichelt hatte, kommt uns nun der Moskauer Kunsthistoriker Pavel Pepperstejn erneut mit einer Analanalyse, indem er die Künstlerscene in das teilt, was er „Zellendasein“ und „Gemeinschaftsleben“ nennt – und auf christliche „Eremiten/Mönche“ bzw. „Priester“ zurückführt. Im Kommunismus tauchte diese Dichotomie noch einmal mit den „Massen“ einerseits und „Stalins Lokus“ andererseits auf. In diesen Zusammenhang sieht er auch noch die endlosen Besucherschlangen, die sich nach unten ins Lenin-Mausoleum bewegend – so quasi „durch den Darm der Initiation schieben“. Zur damaligen Öffentlichkeit gehörten ferner die sowjetischen Zeitungen, die hernach (beim Endverbraucher) als Toilettenpapier benutzt wurden. Das erzeugte auf Dauer eine „besondere Art des analen Lesens und der analen Information.“ Darüberhinaus fanden die Zeitungen, in noch kleinere Schnipsel zerrissen, auch als Einstreu in Katzenklos und Meerschweinchenkäfigen Verwendung. Und dies sei der „Punkt, wo sich ‚Gemeinschaftlichkeit‘ und ’stille Zurückgezogenheit‘ verbinden. Für den Moskauer Pepperstejn ist „die Welt der Toilette in einer Stadtwohnung die maximale Variante der stillen Zurückgezogenheit“.
Das „Zellendasein“ der heutigen Künstler äußere sich im Gebrauch von Homecomputern, privaten Videorekordern und halluzinogenen Effekten“. Sie sind damit technisch in der Regel besser ausgestattet als die „gemeinschaftlich orientierten“ Künstler, die fortwährend Anschluß an die Medienöffentlichkeit suchen. Während erstere die Medien meiden und gewissermaßen „ständig auf dem Klo sitzen“. Dabei kommunizieren sie mit der Öffentlichkeit nicht in der „mentalen Horizontalen“, sondern eher in der „mentalen Vertikalen – wobei sie „das Kanalisationssystem in den Häusern der Stadt“ imitieren.
In seinem Peenemünde-Roman „Die Enden der Parabel“ hat Thomas Pynchon diese exkrementale Initiation mit ihrer ganzen schmutzigen Verlaufsform und anschließenden Unsterblichkeit bzw. „Langlebensdauer“ bereits am Beispiel von „Byron, der Glühbirne“ buchstäblich durchgespielt.
P.S. An den sowjetischen Umgang mit Zeitungen erinnert erinnerte auch schon der 1969 veröffentlichte Roman von Jurek Becker „Jakob der Lügner“, der seine „Radionews“ aus Zeitungsschnipseln zusammenstellte, die er aus der Toilette der deutschen Wachmannschaften des jüdischen Ghettos entwendete.
Frankreich:
Die von Managern vor wichtigen Sitzungen aufgesuchte Naßzelle des Frankfurter Proktologen, das ist keine „Klappe“! Die Macht macht sich daran, das Geschlechtliche zu überwinden.
In seinem Film „Weekend“ (1967) hat Jean-Luc Godard dies bereits – allerdings nicht in restaurativem, sondern mit revolutionärem Schwung – auf den Punkt gebracht, an einer Stelle – mit dem Zwischentitel „Anal Ysis“. Alle erotischen Handlungen sind dort auf den Anus bezogen: Paul bewundert Corinnes Arschbacken, Monique steckt ihren Finger in Corinnes Arschloch, Paul fickt mit Corinnes Hilfe Monique von hinten, Monique sitzt mit dem Arsch in einer Milchschüssel, und Paul steckt Corinne ein Ei in den Arsch.
Für den französischen Schwulentheoretiker Guy Hocquenghem ist der Anus als sexueller Bereich dem Geschlecht gegenüber indifferent: Während der Penis und die Vagina der Differenz zuarbeiten, stiftet der Anus Ähnlichkeiten. Das gilt auch für die Macht und ihre Arschkriecher – deswegen ist es Jacke wie Hose, ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelt. Die Naßzelle aber, in dem der Arsch genüßlich entblößt wird, ist eine „Heterotopie“, mit Michel Foucault zu sprechen, der darunter reale „Gegenorte“ versteht, die immer an ein „System von Öffnungen und Schließungen“ gebunden sind. Demgegenüber stehen all jene „ordentlichen WCs“, die von der WHO in diesem „Jahr der Toiletten“ für die Armen eingefordert werden: es sind „Utopien“ – „stille Orte“, die es noch nicht gibt und wahrscheinlich auch nie geben wird, weil unsere heterotopischen Aborte alles Wasser verbrauchen.
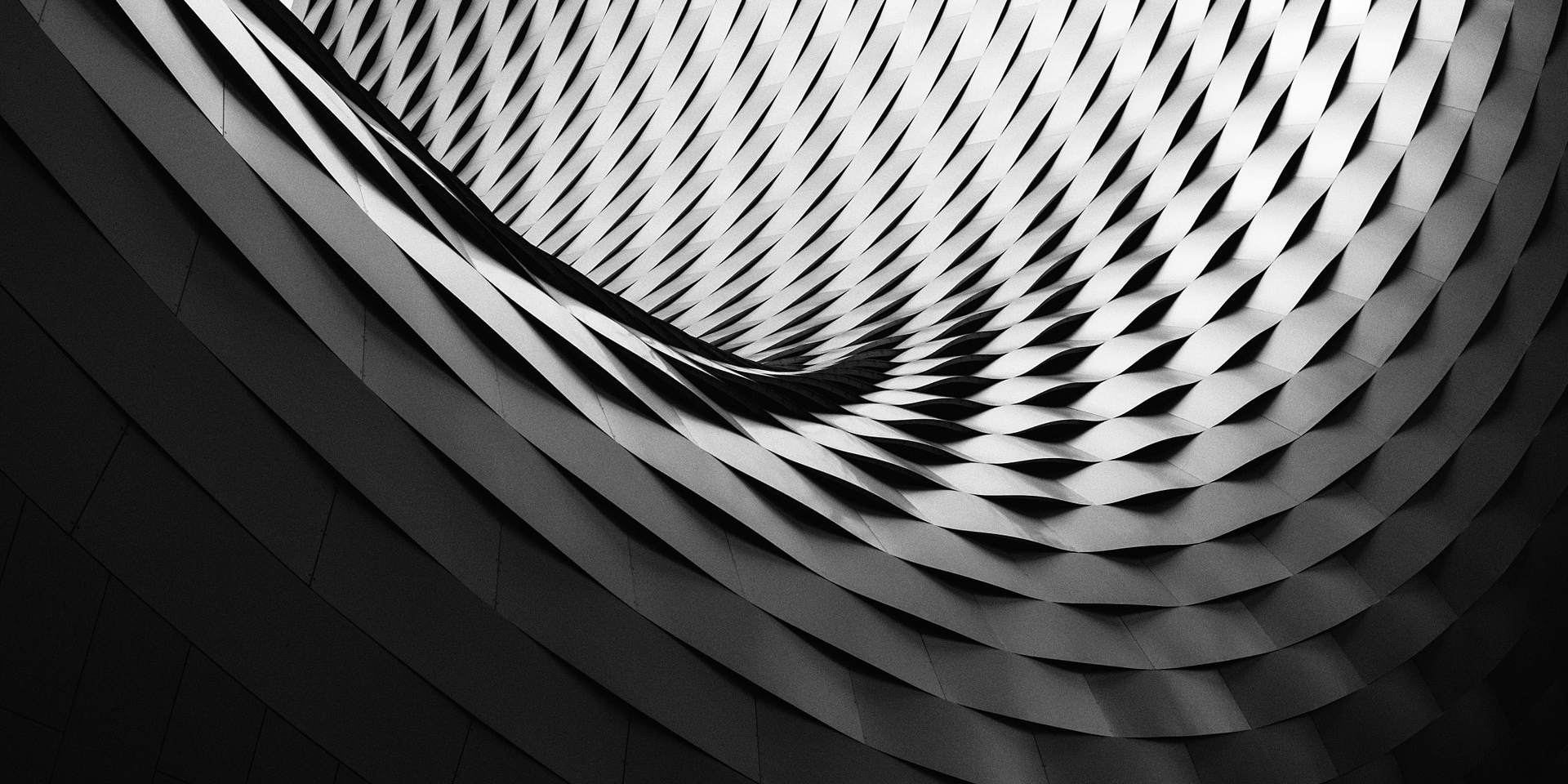



jup,jup…ganz cool gibt aber tollere witze;-)