1. Aktuell:
Die Pflicht zur Widernatürlichkeit
In der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften hielt vorgestern der Leiter des Harvard-„Center for European Studies“ David Blackbourn die „Besondere Vorlesung“ – über „Landschaft und Umwelt in der deutschen Geschichte“. Organisiert wurde die Veranstaltung von der interdisziplinären Arbeitsgruppe der Akademie „Globaler Wandel – Regionale Entwicklung“ und ihrer acatech-Arbeitsgruppe „Georessource Wasser“ – im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2009 „Forschungsexpedition Deutschland“. Sie hatten Blackbourn als Autor eines Buches über deutsche Umweltgeschichte – „Die Eroberung der Natur“ – eingeladen, das hierzulande auf großes Interesse gestoßen war. So beschäftigte die taz sich gleich mehrmals mit dem Buch und in ihrer Beilage „Le Monde Diplomatique“ veröffentlichte Neal Ascherson einen zweiseitigen Text dazu: „Herren der Landschaft“ betitelt. Er gipfelte – ganz im Sinne von Blackbourn – in einer Kritik des deutschen „grüne Denkens“, das eine „totale Verantwortung des Menschen“ für seine Umwelt reklamiere: Ein Anthropozentrismus, der „die realitätsferne Vorstellung eines ‚Gleichgewichts der Natur‘ beinhaltet – als ob in der Umwelt zu Lande wie zu Wasser eine konstante und unveränderliche ökologische Balance herrsche, die nur durch die Intervention der Menschen ‚aus dem Lot‘ gebracht würde.“
Bereits 2002 hatte der grüne Umweltminister Jürgen Trittin den auf Deutschland spezialisierten Umwelthistoriker Blackbourn zu einer Tagung über „Nationalsozialismus und Naturschutz“ eingeladen. Dabei, so führte er in der Akademie nun aus, gab es über den Zweiten Weltkrieg hinaus eine Kontinuität, aber zu Zeiten des Umweltkanzlers Willy Brandt „machte die Sache des Naturschutzes einen Linksruck.“ Im übrigen seien die seit 250 Jahren erfolgten „Eingriffe in die Natur“ – speziell die Trockenlegung des Oderbruchs, die Veränderung des Rheintals und die Errichtung der Stauseen im Sauerland – „nicht nur negativ gewesen“; zudem im Vergleich mit den „großen hydrologischen Projekten“ der Sowjetunion und den USA noch harmlos. Aber die „Wasserkriege“ wurden in Deutschland nicht selten mit Hilfe des Militärs angegangen und dienten ihm auch insofern, als die Trockenlegung der Sümpfe und Moore den Deserteuren ihre Verstecke nahm. Blackbourn beruft sich dabei auf eine äußerst gründliche, aber auch kleinräumigere Studie der Berliner Historikerin Rita Gudermann über die Kultivierungsprojekte in Westfalen und Brandenburg mit dem Titel „Morastwelt und Paradies“.
Ihrem Werk, das sich auf den Zeitraum von 1830 bis 1880 beschränkt, ist zu entnehmen, dass der Meliorationsprozeß keinesfalls linear „vom Schlechteren zum Besseren verlief, sondern ganz im Gegenteil von harten Auseinandersetzungen geprägt war.“ Er nahm nämlich den Armen das Gemeindeland (Allmende) und privatisierte es. Dadurch kam es auch auf dem Land zu einer Spaltung zwischen Konsumenten und Produzenten. Obwohl Blackbourn für die Geschichte – z.B. der deutschen Moorgebiete – so unterschiedliche Quellen wie die Balladen von Annette von Droste-Hülshoff, Pollenanalysen und Moorarchäologie heranzieht, kommen die gravierenden sozialen, ökonomischen und politischen Folgen der „Umgestaltung der deutschen Hydrologie“ bei ihm viel zu kurz. Von den Nutzern, zwischen denen jeder Eingriff in die Natur „Zwietracht sähte“, erwähnt er nur Jäger/Fischer, Bauern, Binnenschiffer, Wassermühlenbesitzer, die Industrie, Badende/Touristen und die auf das Trinkwasser Angewiesenen. Wenn man Blackbourns Studie mit der von Rita Gudermann und mehr noch mit den auf das Oderbruch beschränkten Arbeiten des Eberswalder „Büros für Landschaftskommunikation“ (siehe taz v. 19.6.2008) vergleicht, dann ist es eher ein populärer Beitrag zur deutschen Kulturgeschichte als eine (neue) Umweltgeschichte. Dafür spricht auch, dass Blackbourn als „typisch deutsch“ in dieser Hinsicht nur unsere (übertriebene) Liebe zum Wald gelten läßt, der jedoch nicht sein Thema, sondern das seines ähnlich populärwissenschaftlich ambitionierten Harvard-Kollegen Simon Schama ist.
2. Noch mal nachgefaßt:
Laute Meliorisierung – leise Demeliorisierung
Das Wort Melioration kommt aus dem lateinischen: „melior“ heißt besser (machen). Gemeint ist damit das Trockenlegen von Sümpfen und Mooren, die Begradigung von Flüssen, das Stauen von Talflüssen und das Drainieren von Äckern und Wiesen. Wie diese Arbeiten seit dem 18. Jahrhundert die deutschen Landschaften verändert haben, beschreibt der Bestsellers „Die Eroberung der Natur“ von David Blackbourn, der in Harvard das europäische Studienzentrum leitet. U.a. beruft sich der „Umwelthistoriker“ dabei auf eine gründliche Forschungsarbeit der Berliner Historikerin Rita Gudermann: „Morastwelt und Paradies“. Ihrer kleinräumigen Studie, die sich auf das Ostmünsterland sowie auf das Havelland und zudem auf den Zeitrum von 1830 bis 1880 beschränkt, ist zu entnehmen, dass der Meliorationsprozeß nicht linear „vom Schlechteren zum Besseren verlief, sondern ganz im Gegenteil von harten Auseinandersetzungen geprägt war.“ Die Trockenlegungen schufen zwar neues (privates) Ackerland, vertrieben jedoch zum die vormals dort Lebenden und Wirtschaftenden (inklusive vieler Pflanzen- und Tierarten, Wölfe und Biber z.B.), aber auch die Landarmen, die auf dieses „unwirtschaftliche“ Gemeineigentum (Allmende) angewiesen waren. Es war in der Tat „ein erklärtes Ziel der auf wirtschaftsliberalen Vorstellungen beruhenden Agrarreformen,“ schreibt Rita Gudermann, „mit der Durchsetzung des Privateigentums am Boden auch eine intensivere Bewirtschaftung zu ermöglichen, der die vielfältigen rechtlichen Bindungen und den Auseinanderfall von Besitz- und Nutzungsrechten zuvor einen Riegel vorgeschoben hatten.“ Kurz gesagt, schuf die Zerschlagung des Gemeindeeigentums einen Binnenmarkt, der die Bevölkerung in Konsumenten und Produzenten aufspaltete – auch auf dem Land. Wer dort kein Auskommen mehr fand, der mußte nun in die Stadt ausweichen.
Noch detaillierter als die Studie von Gudermann sind die Arbeiten des Eberswalder „Büros für Landschaftskommunikation“ (Kenneth Anders und Lars Fischer), die sich ausschließlich mit dem Oderbruch befassen. Im Mai 2008 präsentierten sie in einer Ausstellung des nach der letzten „Oderflut“ gegründeten „Forums Oderbruch e.V.“ vier „Zukunfts-Szenarien“ für diese Region, von der der Preußenkönig Friedrich II. einst sagte: „Hier habe ich eine Provinz im Frieden erobert“ – nämlich durch Melioration, auch wenn diese noch großteils von seinen Soldaten durchgeführt wurde und nebenbei auch den Zweck hatte, den Deserteuren seiner Armee die letzten Verstecke zu nehmen. Über die vier Eberswalder Szenarien schrieb der Rezensent Uwe Rada in der taz: „Drei der vier Prognosen ist gemeinsam, dass sie eine Absage sind ans ‚Weiter so‘.“ Im Szenario „Intensivierung“ erobert die Biomasse das Oderbruch, schnellwachsende Weiden und ‚Chinaschilf‘ ersetzen den bisherigen Anbau von Kartoffeln und Gemüse. „Infolgedessen bricht der Tourismus ein, die Eisenbahnverbindungen werden eingestellt, Böden und Grundwasser sind mit Düngemitteln verseucht.“ Nicht viel optimistischer ist das Szenario „Extensivierung“: „Weil die Entwässerung der Niederungslandschaft zu teuer geworden ist, lässt die Landesregierung weite Teile des Bruchs vernässen. Weidewirtschaft und Fischerei erleben eine Renaissance.“ Um den rasanten Bevölkerungsverlust aufzuhalten, setzt die Landesregierung auf eine „Disneylandisierung“ des Oderbruchs. Auch der Naturschutz muss deshalb zurücktreten. Die düsterste Prognose freilich hält das Szenario „Katastrophe“ bereit: Erneut kommt es zu einer Jahrhundertflut an der Oder. Anders als 1997 beschließt die Landesregierung jedoch, „das Oderbruch aufzugeben und die Bevölkerung umzusiedeln. Doch auch die Bundeswehr kann nicht verhindern, dass zahlreiche Bewohner zurückkehren und wilde Siedlungen auf Subsistenzbasis gründen. Darüber hinaus rufen Aktivisten die ‚Freie Republik Oderbruch‘ aus. Weil die Hochwasser jedes Jahr im Sommer und Winter das Bruch fluten, haben die Siedler ihre Häuser auf Warften errichtet – wie vor der Trockenlegung im 18. Jahrhundert.“
Das ist jedoch kein Zukunftsszenario mehr, sondern bereits Gegenwart, wobei für die beiden Eberswalder Landschaftsforscher sowieso „klar ist, dass die Zukunft, die die Szenarien beschreiben, an der Oder längst begonnen hat“. „Biber setzen Oderbruch unter Wasser“ titelte die Berliner Morgenpost bereits vor kurzem. Laut einer aktuellen Studie wurden schon „60 Ansiedlungen mit etwa 250 Exemplaren gezählt“. Und einige Wölfe sind inzwischen auch zurückgekehrt.
3. Als Vortrag in der Villa Romana (Florenz), wo gerade Ideen für eine Neugestaltung des dortigen Gartens gesucht wurden:
„Der Gestus Münchhausens, wie er sich und sein Pferd am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht, wird zum Schema einer jeden Erkenntnis, die mehr sein will als bloßer Entwurf.“ (Theodor W. Adorno)
Die Schlacht am Teutoburger Wald im Jahr 9 nach Christi, in der einige germanische Stämme unter der Führung von Hermann dem Cherusker drei Legionen des römischen Feldherren Varus partisanisch aufrieben, jährt sich im kommenden Jahr zum 2000. Mal. Die Nachkommen der Sieger von damals wollen das ganz groß feiern – unter der Schirmherrschaft von Angela Merkel. „Die Kanzlerin wagt sich damit auf sumpfiges Gelände“, erklärte dazu Gustav Seibt in der Süddeutschen Zeitung. Damit ist nicht das ursprünglich moorige Schlachtfeld gemeint, dass sich im übrigen neuesten englischen Erkenntnissen zufolge gar nicht mehr dort befindet – bei Detmold in Westfalen, wo Kaiser Wilhelm I. ab 1838 das die „Freiheitskriege“ besiegelnde Hermannsdenkmal errichten ließ, sondern im niedersächsischen Kalkriese – bei Osnabrück, wo man 2001 ein Museum errichtete – auf den Resten der erschlagenen Römer sozusagen.Es war der wohl letzte große deutsche Museumsbau. Er bündelt nun die archäologische Erforschung der einzigen deutschen Freiheitsbewegung, die nachhaltig siegreich war – im Gegensatz zu allen nachfolgenden: Bauernkrieg, Befreiungskriege, 1848, 1918, 1953 und 1989. Und hält die Erinnerung daran wach – mit Kostüm- und Volksfesten aller Art. Die Schlacht bei Kalkriese, die endgültig die römische Besatzungsmacht vertrieb, ist nun auch nicht mehr nach dem Germanenführer Arminius (vulgo: Hermann) benannt, sondern nach dem von ihm einst besiegten römischen Heerführer Varus. Bis hin zur linksalternativen „tageszeitung“ hat sich inzwischen die politisch korrekte Meinung durchgesetzt, dass der einzige deutsche Sieg im Partisanenkrieg auf heimischem Territorium – „im sumpfigen Germanien“, wie Gustav Seibt schreibt, ein großer Fehler war: Uns entgingen dadurch nämlich mindestens 500 Jahre Zivilisation: Wenn Rom die Germanen ebenso wie zuvor die Gallier, die eher soldatisch als partisanisch kämpften, besiegt hätte, dann sähe hier jetzt alles noch viel kultivierter aus. Der Altertumsforscher Rudolf Borchardt sprach 1942 von der „verfehlten Romanisierung“ der deutschen Nation. Und bereits 1919 hatte der Schriftsteller Hugo Ball in seiner „Kritik der deutschen Intelligenz“ den Reformator Martin Luther als Zerstörer des „Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation“ ausgemacht, indem dieser unselige Mönch für den Feudaladel und gegen die Bauern Partei ergriff. So ähnlich wie dann 1918 die SPD-Führung um Ebert und Noske mit Hilfe der finstersten Reaktion die Aufstände der Arbeiter und Soldaten niederschlagen ließ.
Über den gallischen Umweg hatten die „Römer“ es unter Napoleon Anfang des 19. Jahrhunderts noch einmal mit den Deutschen versucht. Aber auch hierbei waren die an sich überlegenen französischen Truppen schließlich wieder in den „germanischen Sumpf“ – und in partisanischen Hinterhalt – geraten. Zwar gelang der deutsche Sieg diesmal nur dank des entschlossenen Widerstands der verbündeten Slawen (des russischen Heeres), aber die Ehre, dafür 1808 eine erste partsanische Kampfanleitung geschrieben zu haben, kommt dem Dichter Heinrich von Kleist zu – mit seinem Drama „Die Hermannsschlacht“. An einer Stelle heißt es darin: „Das ist der klassische Morast/ Wo Varus steckengeblieben./ Hier schlug ihn der Cheruskerfürst./Der Hermann, der edle Recke;/ Die deutsche Nationalität,/Die siegte in diesem Drecke.“ Die antinapoleonischen Insurrgenten in Preußen hatten inzwischen Probleme mit einem solchen Kampf: Immer wieder ermahnte der damals ins Exil nach Moskau ausgewichene Freiherr vom Stein die meist unter der Führung von Offizieren gegen Napoleon antretenden deutschen Freikorps, keine schneidigen Attacken zu reiten und sich auch nicht soldatisch zu verschanzen, sondern nach überfallartigen Angriffen rasch den Rückzug – z.B. in die „Emsländischen Moore“ – anzutreten. Umsonst. Erst als die napoleonische Armee bei Moskau ins Leere gesiegt hatte, wendete sich das Blatt. Dennoch waren es schließlich doch die Kosaken, die Berlin von der Franzosenherrschaft befreiten, die Bürger jubelten ihnen bloß zu. Desungeachtet sah sich die Partei- und Staatsführung der DDR stets in der Tradition der Guten, d.h. der wenigen aufständischen Preußen. Nach der Wiedervereinigung 1990 beschäftigte sich deswegen eine Reihe jüngerer westdeutscher Wissenschaftler noch einmal mit dem antinapoleonischen Volkswiderstand in Preußen – und kam dabei in Anlehnung an die Zivilisationstheorie von Norbert Elias zu dem zeitgemäßen Schluß, daß bei der Enthegung des Krieges durch Elemente von Partisanentum „ein Prozeß der Dezivilisierung“ eingeleitet wurde und werde. Besonders an der „Hermannschlacht“ des „Psychopathen“ Heinrich von Kleist liesse sich das Wieder-Barbarisch-Werden des Volkes im Widerstand klar herausarbeiten. Zudem erfolgte die Befreiung von den zivilisierten Franzosen mit Hilfe der eher barbarischen Russen (die Schleswig-Holsteiner erinnern sich angeblich noch heute schaudernd an den damaligen „Kosaken-Winter“), so dass man auch diesen Sieg – rückblickend – eigentlich als eine Niederlage ansehen muß.
Was war da in der Zwischenzeit geschehen? Aus dem „sumpfigen Germanien“ war ein blühendes Deutschland – ein regelrechtes Gartenland geworden. Derart, dass der Wiedervereinigungskanzler Helmut Kohl auch den Ostdeutschen im Falle ihres Anschlusses an den Westen sogleich „blühende Landschaften“ versprach. Und das tat auch augenscheinlich not, denn die DDR war im Laufe der kommunistischen Herrschaft seit 1945 immer „grauer“ und unansehnlicher geworden. Eine solche Sichtweise gehört jedoch selbst noch zur deutschen Nationwerdung.
Schon den römischen Gelehrten Gajus Plinius Secundus hatten einst die Germanen, in Sonderheit die küstenkultivierenden Friesen, ins Grübeln gebracht: dieses „armselige Volk“, das auf „hohen Erdhügeln“ in Schilfhütten lebt und mit „getrocknetem Kot“ seine kärglichen Speisen kocht, damit sich „ihre vom Nordwind erstarrten Eingeweide erwärmen“. Bei Flut, „wenn die Gewässer die Umgebung bedecken, gleichen sie mit ihren Hütten den Seefahrern, Schiffbrüchigen aber, wenn die Fluten zurückgetreten sind. Dennoch wollten die Friesen sich partout nicht den reichen, zivilisierten Römern unterwerfen: „wahrlich,“ seufzte Plinius, „viele verschont das Schicksal zu ihrer Strafe“. Ähnlich äußerte sich auch der römische Historiker Tacitus – über ganz Germanien: Das Land „zeigt zwar im einzelnen Unterschiede; doch im ganzen macht es mit seinen Wäldern einen schaurigen, mit seinen Sümpfen einen widerwärtigen Eindruck.“ Dennoch mußte er zugeben: „Eine schärfere Waffe als der Arsakiden [d.h., der persischen] Herrschergewalt ist die Freiheit der Germanen.“ Tacitus‘ Schrift „Germania“ galt den Nazis deswegen als Gründungsurkunde ihres Reiches, Mussolini wollte dem Führer das Manuskript schenken. Er kam aber nicht mehr dazu, es ihm persönlich zu übergeben. Ein SS-Kommando unternahm deswegen 1944 einen Überfall auf eine Villa am Comersee, wo sie das Schriftstück vermuteten. Es befand sich auch dort, aber so gut versteckt, in einer Truhe, dass sie es nicht fanden.
Die von Tacitus gerühmte „Freiheit der Germanen“, ebenso wie ihr unwirtlicher Lebensraum und dessen gemeinschaftliche Bewirtschaftung, waren nach und nach geschwunden. Aber noch im 18. Jahrhundert „durchstreiften hier Wölfe die Wälder und Sümpfe, zumal im Osten,“ schreibt der Landschaftshistoriker David Blackbourn in seiner 2007 erschienenen „Geschichte der deutschen Landschaft – ‚Die Eroberung der Natur'“. Dann ging es jedoch los – mit dem Preußenkönig Friedrich I.. Zuvörderst nahm der sich die große „morastige Wüste“ vor, wie der 1777 durch Ostelbien gereiste Johann Bernoulli das Oderbruch nannte: eine „natürliche Auenlandschaft“, die zwei Mal im Jahr überschwemmt wurde. Der Sohn des „Alten Fritz“ – Friedrich II., auch der Große genannt, führte das Trockenlegungsprojekt seines Vaters mit Hilfe holländischer Entwässerungsfachleute und dem Einsatz von Soldaten fort. „Ländereien urbar zu machen, beschäftigt mich mehr als Menschenmorden,“ hatte er bereits vor seiner Inthronisierung in Küstrin gemeint. Beim Oderbruch konnte er abschließend stolz verkünden: „Hier habe ich eine Provinz im Frieden erobert.“ Auch in anderen Teilen Brandenburgs, sowie in der Magdeburger Börde, im Emsland, in Friesland, im bayrischen Donaumoos und am Teutoburger Wald begann man im 18. Jahrhundert Sümpfe und Moore massiv anzugehen – d.h. trocken zu legen, den Torf abzubauen und landlose Bauern, gerne auch aus dem Ausland, auf den neugeschaffenen, z.T. sehr fruchtbaren, Böden anzusiedeln. Der Preußenkönig war jedoch geradezu besessen davon, aus „grauen, trostlosen“ Sümpfen „blühende Gärten“ zu schaffen. Ständig entdeckte er bei seinen Provinzvisiten neue Feuchtgebiete und Moore, die der Entwässerung gewissermaßen harrten. Noch kurz vor seinem Tod schrieb er dem Präsidenten von der Goltz in Königsberg: „Hiernechst ist von der Seite von Tilsit annoch ein großer Morast zu defrichiren.“
Mit der Verwandlung von Sümpfen in Siedlungsland ging die Vernichtung bzw. Vertreibung der Schädlinge (vom Wolf über die Malariamücke bis zu den Spatzen) einher. Der König von Preußen setzte Prämien dafür aus: Zwischen 1734 und 1767 wurden allein in den Grenzen der Alten Mark Brandenburg fast 12 Millionen Spatzen getötet. Den Abschuß der Biber behielten sich die Preußenkönige des wertvollen Felles wegen selbst vor. Wegen der Wölfe ermahnte Friedrich der Große zwei Monate vor seinem Tod noch seinen Kammerdirektor: „…dass die Wolf Jagen in Preußen nicht in Vergessenheit kommen, damit diese Raub Thiere nicht wieder überhand nehmen, sondern vielmehr, soviel es möglich, ausgerottet werden.“
Seit der Wiedervereinigung gibt es nun aber einerseits – infolge der Arbeitslosigkeit – eine zunehmende Abwanderung aus Ostelbien, andererseits jedoch eine starke Zuwanderung – von Wölfen: Sie sind jetzt ganzjährig geschützt und werden von promovierten Wolfsforscherinnen flankiert, darüberhinaus wurde ein „Wolf-Management-Plan“ aufgestellt.. Geradzu eine 180-Gradwende – nicht nur in landschaftspolitischer Hinsicht. Aus der kleinräumigen Gartenlandschaft wurde unterdes eine großflächige Felderwirtschaft mit Nutzwäldern und postindustriellen Ödflächen.
Bei den Geräten zur Bodenbearbeitung unterscheidet man grob zwischen Hacke und Pflug – zur Garten- bzw. Feldbestellung. Ersteres ist die effektivste Art, ein Stück Land zu bewirtschaften und letzteres -namentlich in seiner hochtechnisierten Form – die profitabelste. Neuerdings kommt dazu noch ein Mehrgewinn durch die immer billiger werdenden Erntehelfer, die hierzulande meist aus Osteuropa stammen. Von Staats wegen möchte man sie mittelfristig durch deutsche Arbeitslose ersetzen, die dann jedoch in Konkurrenz zu Ernterobotern treten werden. Deren Einsatz hat allerdings nicht nur „quadratische Felder“ und Beete, sondern auch schier „quadratische“ – d.h. genormte – Früchte zur Voraussetzung.
Der Philosoph Michel Serres hat darauf hingewiesen, dass sowohl Hacke als auch Pflug „Opfermesser“ sind, mit dem alles kurz und klein geschlagen wird, die ganze chaotische Vielfalt, um hernach auf dem sauber gemachten Geviert die Homogenität zu zelebrieren, zu züchten. „Wenn die Wut des Messers sich gelegt hat, ist alles bearbeitet: zu feinem Staub. Geeggt. Auf die Elemente zurückgeführt. Analyse oder: Nichts ändert sich, wenn man von der Praxis zur Theorie übergeht. Agrikultur und Kultur haben denselben Ursprung oder dieselbe Grundfläche, ein leeres Feld, das einen Bruch des Gleichgewichts herbeiführt, eine saubere, durch Vertreibung, Vernichtung geschaffene Fläche. Eine Fläche der Reinheit, eine Fläche der Zugehörigkeit.“
Diese „Ordnung“ erstreckte sich auch auf den Straßen-, Brücken- und Kanalbau sowie auf die 1200 Dörfer, die allein in Preußen von Mitte bis Ende des 18.Jahrhunderts entstanden – sie wurden streng „geometrisch“ angelegt, und die Felder später der Erntemaschinen wegen „quadratisch“. Es gab Widerstand dagegen: einmal im Osten von den armen, meist slawischen Fischern, die aus ihren „sumpfigen Kietz-Siedlungen“ vertrieben wurden, zum anderen von Gewerbetreibenden, das sich nicht zuletzt ihretwegen dort angesiedelt hatten, aber auch von Deserteuren und gesuchten Kriminellen, die sich im Bruch versteckt hielten. Auch die ersten, romantisch eingestimmten Naturschützer im Westen meldeten Bedenken an. Am Ende wurde jedoch die „ungesunde, entlegene brotarme Sumpf- und Wasserwüste der Slawen durch die lange unentwegte Arbeit der Siedler umgeformt in das prangende Grün der fruchtbaren Wiesen,“ wie Otto Schlüter schrieb, der sich vor allem dem Deutschritterorden (Ordo Teutonicus) widmete, mit denen recht eigentlich die als Kultivierungsarbeit verstandenen Eroberungen des Ostens begannen.
Goethe hat diesen Kultur-„Kampf“ 1830 am Ende seiner Tragödie „Faust II“ thematisiert: Dort ordnet Faust kurz vor seinem Tod noch die Vertreibung/Ermordung der letzten Bewohner an, die seinem großen „Kanalbau-Projekt“ im Wege stehen und sich weigern, ihm zu weichen. In einer Weimarer Inszenierung brachte neulich ein junger Westregisseur diese drei letzten Opfer des Faust als ewig „nörgelnde Ostrentner“ auf die Bühne. Inspiriert hatten den Weimarer Dichter aber vor allem die Trockenlegungsversuche in den „Pontinischen Sümpfen“ bei Rom, die er 1787 besichtigte. Hier siedelten bis etwa 300 vor Christi die Volsker. Nachdem die Römer sie besiegt und alle Wälder ringsum abgeholzt hatten, weil sie das Holz zum Schiffsbau brauchten, war die rund 780 Quadratkilometer große einst „blühende Kulturlandschaft“, als die Plinius den „Agro Pontino“ beschrieben hatte, versumpft. Bald war die ganze Ebene malariaverseucht. Bereits Caesar und einige Kaiser nach ihm sowie mehrere Päpste und auch Napoleon versuchten dann, die Sümpfe trocken zu legen. Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte der preussischen Offizier Fedor von Donat einen neuen Entwässerungsplan, der den Bau eines Ringkanals und mehrere Pumpwerke vorsah. Die Elektrizität dafür sollte von Wasserkraftwerken an den Talsperren des Gebirges kommen. Das Deutsche Patentamt registrierte sein Großprojekt unter der Nummer 17120. Zur Realisierung gründete er zusammen mit Emil Rathenau und dessen AEG um 1900 die „Pontinische Syndikats GmbH“. Donats Plan scheiterte jedoch daran, dass die italienische Regierung sich bereits bei der Trockenlegung der Sumpfgebiete in der Po-Ebene finanziell verausgabte. 1930 nahm Benito Mussolini die Pontinischen Sümpfe in Angriff. Für die Durchführung der Arbeiten wurden 10 Jahre veranschlagt. Italien gewann mit der Realisierung dieses Projekts die Bewunderung der Weltöffentlichkeit. Mussolini nutzte das Arbeitsbeschaffungsprogramm für propagandistische Zwecke. So ließ er sich häufig zwischen den Arbeitern mit nacktem Oberkörper und Schippe in der Hand fotografieren. Da seine Ingenieure die Donatschen Pläne verwandt hatten, ließ der Duce eine Straße im Zentrum der neuen Stadt Pontina nach Donat benennen. Besiedelt wurde das damals nahezu menschenleere Gebiet durch arme, in der Landwirtschaft zumeist unerfahrene Familien aus der Emilia-Romagna, woraus sich die wirtschaftlichen Fehlschläge der ersten Jahre erklären. Heute werden dort hauptsächlich Weizen, Obst und Wein angebaut. „Der Agro Pontino ist nun wieder eine blühende Landschaft mit modernen Städten aus der Nachkriegszeit. Um das Jahr 2000 bewohnten 520.000 Mensche den ehemals öden Landstrich,“ heißt es bei Wikipedia.
Die innerdeutschen Landgewinnungsprojekte begannen etwa zur gleichen Zeit wie die nordamerikanische Besiedlung durch europäische Einwanderer. Was dort dann jedoch die immer weiter in den „Wilden Westen“ verschobene Frontier (die Zivilisationsgrenze) war, geschah hier nach Osten hin, den man nach 1990 ebenfalls als „wild“ bezeichnete. Und so wie man in Amerika die Indianer bekämpfte, ging es hier gegen die Polen, die von den Nazis dann gleichfalls als „Indianer“ bezeichnet wurden – vor allem, als sie begannen, sich zu Partisanengruppen zu formieren, und aus den riesigen Sümpfen und Wäldern heraus die deutschen Soldaten und Neusiedler angriffen. Auch die Rechtfertigung für die Vertreibung bzw. Vernichtung der slawischen Nachbarn – ihre „Umvolkung“ – hatte man in Amerika vorformuliert. Dort war noch US-Präsident Theodore Roosevelt der Meinung, die Ausrottung der büffeljagenden Indianer durch die meist armen weißen Siedler und Pioniere sei ein „gerechter Krieg“ gewesen: „Dieser großartige Kontinent konnte nicht einfach als Jagdgebiet für elende Wilde erhalten werden“. In Deutschland hatte bereits Friedrich der Große „das liederliche polnische Zeug“ mit „Irokesen“ verglichen, und den neuen „geometrisierten deutschen Dörfern Namen wie Florida, Philadelphia und Saratoga“ gegeben. Der Generalgouverneur des besetzten Polen Hans Frank bezeichnete darüberhinaus 1942 auf einer Parteiversammlung in Lemberg die Juden als „Plattfußindianer“. Adolf Hitler befahl etwa zur gleichen Zeit – angesichts der sich entfaltenden Partisanenkriegs im Osten: „und immer aufknüpfen! Das wird ein richtiger Indianerkrieg werden.“ Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, seinen Soldaten zur moralischen Festigung Karl Mays „Winnetou“-Roman mit auf dem Weg an die Front zu geben. (Im Ersten Weltkrieg hatte man ihnen Goethes „Faust“ in den Tornister gepackt.) Der polnische Schriftsteller Ludwik Powidaj hatte bereits 1864 in seinem Essay „Polacy i Indianie“ das Schicksal der amerikanischen Indianer dargestellt und dabei die Frage gestellt: „Welcher Pole wird darin nicht die Lage seines eigenen Landes erkennen?“ Nachdem Ostelbien kommunistisch geworden war, entstand dort eine ganze Indianerbewegung, die offiziell „Indianistik“ betrieb, d.h. sich dem Studium der Ureinwohner Nordamerikas widmete, die als Pioniere im Kampf gegen den Imperialismus begriffen wurden. Einige Aktivisten sahen darüberhinaus aber auch Parallelen zwischen den letzten Indianern und sich – den Bewohnern der Ostzone: „Wir lebten in der DDR ja auch in einem Reservat.“
Wenn in Deutschland im Zusammenhang der Trockenlegung der Sümpfe und Moore, der Begradigung der Flüsse und der Errichtung von Talsperren die „Vernichtung der Arten“ beklagt wurde und eine auf Erhaltung bedachte Natur- und Landschaftsschutzbewegung entstand, dann waren damit immer Bio- und so gut wie nie Soziotope gemeint. Auch wenn „Romantiker“ von „Heimatverlust“ oder gar von einem „verlorenen Paradies“ sprachen – angesichts der zunehmenden Vernutzung der Landschaft. Schon der Heilige Augustinus war der Meinung gewesen, Adam und Eva hätten sich glücklich preisen können, in einem Garten zu arbeiten, „denn gibt es einen wunderbareren Anblick als das Säen, das Setzen von Stecklingen, das Umsetzen von Sträuchern?“ Neuerdings hat die Historikerin Rita Gudermann ein Buch über die Trockenlegung von Sümpfen und Mooren in Westfalen und Brandenburg veröffentlicht – mit dem Titel „Morastwelt und Paradies“. Ihrer kleinräumigen Studie, die sich auf das Ostmünsterland sowie auf das Havelland und zudem auf den Zeitrum von 1830 bis 1880 beschränkt, ist zu entnehmen, dass der Meliorationsprozeß keinesfalls linear „vom Schlechteren zum Besseren verlief, sondern ganz im Gegenteil von harten Auseinandersetzungen geprägt war.“ Dazu beruft sich die Autorin u.a. auf den westfälischen Bauern Philip Richter, für den sich das Verschwinden der „alten Morast-Welt“ mit der Auflösung der Allmende im 19. Jahrhundert verband: Es war in der Tat „ein erklärtes Ziel der auf wirtschaftsliberalen Vorstellungen beruhenden Agrarreformen,“ schreibt sie, „mit der Durchsetzung des Privateigentums am Boden auch eine intensivere Bewirtschaftung zu ermöglichen, der die vielfältigen rechtlichen Bindungen und den Auseinanderfall von Besitz- und Nutzungsrechten zuvor einen Riegel vorgeschoben hatten.“ Kurz gesagt, schuf die Zerschlagung des Gemeindeeigentums einen Binnenmarkt, der die Bevölkerung in Konsumenten und Produzenten aufspaltete – auch auf dem Land, d.h. es entstanden dort wenige reiche Bauern und viele landlose Arme, die sich irgendwo und irgendwie durchschlagen mußten. Diese „Vergrößerung der sozialen Ungleichheit seit dem Ende des 18. Jahrhunderts barg einen enormen Konfliktstoff, der während der Krisenjahre der 1830er und 1840er Jahre geradezu explodierte.“ Was lag da näher als, wo es nur ging, Neuland zu schaffen – und für die Trockenlegungsarbeiten eben diese neuen Dorfarmen, d.h. alle „Überflüssigen“, zu verpflichten. Es ging dabei um die „Begradigung von Fließgewässern, die Anlage von Kanälen, die Ziehung von Ab- und Zuleitungsgräben und das Ablassen von Seen und Teichen.“ Nicht nur die Landesherren, auch Gutsbesitzer und reiche Bauern nahmen nun, z.T. genossenschaftlich organisiert, solche Entwässerungsprojekte in Angriff. Die steigenden Feldfruchtpreise wirkten dabei als Motor: Es lohnte sich. In der thüringischen Rhön inspizierte Goethe bereits 1780 umfangreiche Meliorationsarbeiten – in seiner Eigenschaft als Mitglied der obersten Regierungsbehörde seines Landesherrn.
Parallel zu solchen Landschaftsumgestaltungen im Kleinen und Großen entstand eine „Landesverschönerungsbewegung“. Sie wollte keinen Gegensatz von Ökonomie und Ästhetik konstruieren, sondern im Gegenteil, „das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden,“ um „die Erde in eine irdisches Paradies zu verwandeln.“ Ihre „Verschönerung“ wurde geradezu als ein „göttlicher Auftrag an den Menschen begriffen“. Dabei kam es zu einer süd- und einer norddeutschen Ausprägung: In Bayern verstand der Baurat Gustav Vorherr unter einer schönen Umwelt eine Art Gesamtkunstwerk, die „Verbesserung der in ihr Lebenden“ begriff er als eine soziale und politische Aufgabe, während in Preußen der Gartenarchitekt Peter Joseph Lenné „stärker vom Gartenbau geprägt war“. Hier wie dort galt es jedoch, „die vorgefundene Landschaft in eine arkadische zu verwandeln“ – bis, mit den Worten Jonathan Schuderoffs – „ganz Deutschland ein großer Garten“ geworden sei. Und man, wo dies z.B. in und um Potsdam beherzt und mit aller gestalterischen Strenge durchgeführt wurde, mit Herder sagen konnte: „Hier ist die Natur zur Kunst und die Kunst zur Natur erhoben“.
„Preußens Arkadien“, so hat Wolf-Jobst Siedler in einem gleichnamigen Buch diese „Residenzlandschaft“ – das 180 Quadratkilometer große Gebiet des Potsdamer Werders – dann auch 1990 genannt. Die Idee dazu kam aus England. Vorreiter des Landschaftsgartens war hierzulande Fürst Franz von Anhalt-Dessau mit seinem bereits 1768 angelegten „Wörlitzer Park“. Dabei wurde das gesamte Flußdreieck zwischen Elbe und Mulde östlich von Dessau bis hin nach Wittenberg tiefgreifend umgestaltet. Dies geschah hier allerdings sehr viel „schonender“ als im Oderbruch und war eher von humanistischem als von merkantilistischem Denken beseelt. Ähnliches gilt für den Landschaftspark in Muskau an der Neiße und in Branitz bei Cottbus, die der Fürst Hermann von Pückler 1816 anlegen ließ und womit er sich zwei Mal finanziell ruinierte. Das heute sogenannte „Dessau-Wörlitzer Gartenreich“ ebenso wie der seit 1945 zwischen Deutschland und Polen geteilte „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ wurde inzwischen ins Weltkulturerbe-Verzeichnis aufgenommen. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV weitete die Bemühungen seiner Vorgänger und die der eben genannten Gartengestalter Mitte des 19. Jahrhunderts dahingehend aus, ganz Dorfgemarkungen zu verschönern und zu verbessern. Daneben gingen die Anstrengungen zur landwirtschaftlichen Intensivierung weiter. Aber die ästhetische Betrachtungsweise – der Rest-Moore und -Heiden beispielsweise – führte gleichzeitig zu einer Identifikation mit der „unberührten Natur“ – ihr Verschwinden wurde zunehmend als Verlust erlebt. Ab 1880 gewann die deutsche Naturschutzbewegung an „politischer Schlagkraft“, schreibt Rita Gudermann. 1904 gründete sich der „Bund Heimatschutz“. Trotz wachsender Kritik an der „Denaturierung“ wurden die Meliorationsarbeiten (lat. melior – besser) jedoch unvermindert weitergeführt.
„Dieser Prozeß der Landschaftszerstörung verstärkte sich sogar noch, als ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts professionell und mit Hilfe des Staates gegen die verbliebenen Moore vorgegangen wurde.“ Das Scheitern vieler Moor-Kolonisierungsprojekte erzwang allerdings einige Korrekturen: „1876 wurde eine Zentral-Moor-Kommission eingesetzt; ihr folgte ein Jahr später eine Moorversuchsstation in Bremen…Das Ergebnis der Tätigkeit beider Institutionen war der Entschluss, auch weiterhin Hochmoorkolonien einzurichten, jedoch nach einer neuen ‚wissenschaftlichen Methode‘. Die deutsche Hochmoorkultur war entstanden,“ schreibt David Blackbourn.
Bei Rita Gudermann findet sich der Hinweis: „Erst gegen Ende der 1960er Jahre wurde die neuere Ökologiebewegung aus den USA importiert. Auf den Schutz der verbliebenen, marginalen Reste der früheren Moor- und Heideflächen wird seither besondere Energie verwandt.“ 1921 erklärte man die Lüneburger Heide zum ersten deutschen Landschaftsschutzgebiet. Weitere folgten – bis heute. 1991 wurde z.B. die Rhön zum „Biosphärenreservat“ erklärt, ABM-Kräfte halten dort seitdem die seltene Rhöndiestel von Überwucherung durch Unkraut frei und am dortigen „Schwarzen Moor“ bzw. an dem, was davon noch übriggeblieben ist, steht nun statt eines Arbeitslager-Wachtturms ein behindertenfreundlicher Aussichtsturm für Öko-Touristen. Ähnlich hat man heute auch den kleinen Rest, Stapeler Hochmoor genannt, der von den einst großen Mooren im Oldenburger Land übrig blieb, unter Naturschutz gestellt. Dazu wurden in diesem „Wiedervernässungsgebiet“ die Entwässerungsgräben, die einst Strafgefangene mit dem Spaten ausheben mußten, wieder zugeschüttet – diesmal mit Baggern. Seitdem die Gegend feuchter geworden ist, haben sich viele bereits so gut wie verschwundene Pflanzen und Tiere dort erneut angesiedelt. Der alte Bauer Georg Streekmann, der jetzt Führungen durch das Stapeler Hochmoor organisiert, befürchtet bereits, dass sich irgendwann auch wieder die Malariamücke einstellen wird.
Mitte des 19. Jahrhunderts hatte der deutsche Historiker Heinrich von Treitschke alles daran gesetzt, den Gegensatz zwischen dem „neuen Grün germanischen Fleißes“ und den „Sümpfen und Morästen der Polen“ ins allgemeine Bewußtsein zu heben. Diese waren grau und düster, jenes licht und farbenprächtig: „Die Zuordnung von Farben gehörte unweigerlich dazu, wenn Deutsche die eigene und die polnische Landschaft charakterisierten,“ schreibt David Blackbourn. Währenddessen brachte das Zusammendenken von Sumpf und Slawen einen ganzen neuen Wortschatz hervor, der z.T. noch heute gültig ist: Prostituierte hießen „Sumpfblüten“, sumpfen wurde zu einer Bezeichnung für herumhuren, aber auch durch zu viel Alkoholgenuß versumpfte man – und/oder geriet in den „linken“ bzw. „kriminellen Sumpf“. Das größte Sumpfgebiet auf dem Kontinent – die Pripjet-Sümpfe in Podlasien, mit einer Ausdehnung von 270.000 Quadratkilometern, wo sich ab 1941 gut 100.000 weissrussische, ukrainische, polnische, jüdische und sowjetische Partisanen versteckt hielten – dieser noch heute riesige Sumpf, in dem damals eine Bevölkerung von zwei Millionen Menschen angeblich „in hoffnungslosem Stumpfsinn vegetierte“, wurde 1939 von dem Raumordnungsplaner Martin Bürgener kurzerhand zur „Urheimat“ aller Slawen erklärt. Nach Abschluß des Versailler Vertrags und dem Verlust der Ostgebiete war bereits eine Flut von Veröffentlichungen entstanden, mit denen bewiesen wurde, dass die Deutschen Siedler dort der wilden Natur „lachende Fluren und blühende Felder“ abgerungen – kurzum: einen wahren „Garten“ geschaffen hatten, den die Polen nun verkommen ließen. Mit dem Einmarsch in Polen 1939 versuchten die nationalsozialistischen Gärtner erneut, den Osten, diesmal bis hin nach Moskau, zu kultivieren. Dazu gab es einen „Generalplan“ (unter der Federführung des Agararwissenschaftlers Konrad Meyer), den man zwei Jahre zuvor in einer der ärmsten Gegend Deutschlands, in der Rhön, quasi erprobt hatte. Er hieß dort „Dr.Helmuth-Plan“ und sah die Trockenlegung von Mooren und Sümpfen, die Entsteinung der Äcker, den Straßen- und Brückenbau sowie die Anlage von Truppenübungsplätzen vor. Der in Wildflecken geriet 1938 zur „größten Baustelle Deutschlands“. In der Region wurden mehrere Arbeitsdienstlager eingerichtet, die man zunächst mit zwangsverpflichteten Arbeitslosen, dann mit Polen und zuletzt mit russischen Kriegsgefangenen besetzte. Vor der Umsetzung des „Hellmuth-Plans“ waren erst einmal die Arierexperten der NSDAP über die Region hergefallen, um die Bevölkerung rassisch zu selektieren. Dazu verkündeten sie: „Wissend, dass Erbgut das Wesen des Menschen bestimmt, tritt der Politiker heute an den Erbbiologen heran mit der Frage: aus welchem Holz ist der Rhöner geschnitzt. Im Vordergrund muß also die Erforschung der menschlichen Tüchtigkeit der Bewohner stehen, und hier galt es nach nationalsozialistischen Grundsätzen, über die Untersuchung des Einzelnen hinauszugehen und nicht mehr und nicht weniger zu erforschen als den Erbwert der gegenwärtig lebenden und in der Zukunft zu erwartenden Bevölkerung. Im Gau Mainfranken ist erstmals an die Verwirklichung dieser Forderung herangegangen worden, um hieb- und stichfeste Grundlagen für das Menschenproblem in der Rhön zu schaffen.“
Der Schriftsteller und spätere Institutsleiter an der Akademie der Künste in der DDR, Bodo Uhse, versuchte in den Dreißigerjahren die Landarbeiter und Kleinbauern in der Rhön zu organisieren, später veröffentlichte er einen Artikel in einer Exil-Zeitschrift über den „Dr.Helmuth-Plan“: „Hitlers Pontinische Sümpfe“ betitelt. Sein Text beginnt mit einem Besuch des Autors im Rhöndorf „Sparbrot“, wo er von einem Kleinbauern zum Essen eingeladen wird. Er bekommt eine magere Kartoffelsuppe vorgesetzt. „Das Fleisch“, entschuldigt sich der Bauer, „sitzt bei uns um den Tisch“. Er zeigt dabei auf seine Frau und sieben Kinder. Solche und ähnliche Familien, „etwa 100.000 Menschen insgesamt“, will man, gemäß des „Hellmuth-Plans“, von ihren zu kleinen Äckern vertreiben – und dafür lebensfähige Erbhöfe in der Rhön schaffen. Uhse spricht von einer „Klassenbereinigung – die Halbproletarier sollen völlig proletarisiert werden. Das ist der ökonomische Sinn des ,Aufbauplans‘.“ Die Frankfurter Zeitung meldete 1938, dass man von 13.735 landwirtschaftlichen Betrieben in der Rhön 11.552 als „nicht lebensfähig“ eingestuft habe. Der Marburger Politologe Martin Bongards schrieb 2004 über den „Dr.Hellmuth-Plan“: „Bei der Durchführung kam es zur Zusammenarbeit von einer Unzahl verschiedendster nationalsozialistischer Organisationen und staatlicher Stellen, so dass wirklich jeder Rhöner von diesem Plan erfaßt wurde…Die Hauptlast bei den durchzuführenden Arbeiten trug der Reichsarbeitsdienst (z.T. eben die ehemaligen Saisonarbeiter und sonstige Arme der Rhön), die eigentliche ,Finanzierung‘ erfolgte also durch Zwangsarbeit.“ Bei seinen Recherchen vor Ort über die Folgen des Hellmuth-Plans für die Betroffenen konnte Bongards durch Interviews nichts mehr darüber in Erfahrung bringen, auch auf Fragen „nach dem Zustandekommen des jeweiligen Besitzes reagierten die Bewohner störrisch. Der Dr.Hellmuth-Plan gilt z.B. in Bischofsheim als frühe Flurbereinigung und weitsichtige Infrastrukturmaßnahme.“
Als dann ab 1939 der „Generalplan Ost“ griff, den man als eine riesige „Aufgabe des Aufbaus im Osten“ bezeichnete, wozu ebenfalls eine rassische Selektion der Bevölkerung gehörte, wurden die Deutschen schon bald von einem regelrechten „Ostrausch“ ergriffen. Fachleute, wie Heinrich Wiebking-Jürgensmann, sprachen von einer „Blütezeit für…deutsche Landschafts- und Gartengestalter,“ die nun angebrochen sei. „‚Rausch‘ ist fast eine Untertreibung für eine derartige Verzückung,“ meint Blackbourn. Es ging darum, dort eine Fläche rassischer Reinheit zu schaffen: Polen und Juden wurden deportiert, „Judenweiber sind in die Sümpfe zu treiben,“ ordnete der Reichsführer SS Heinrich Himmler an. Noch als man Massenvernichtungsmittel anwandte – u.a. im KZ Auschwitz, das auf einem oberschlesischen Moor errichtet wurde, war das „In-die-Sümpfe-Treiben“ laut Blackbourn ein „Euphemismus für Ermordung“. Auschwitz galt dem dort inhaftierten Partisan Primo Levi dann als „die letzte Kloake des deutschen Universums“. In den norddeutschen Moorlagern entstand das Lied der „Moorsoldaten“. Allein im Emsland gab es 15 solcher Arbeitslager.
In einem – Esterwegen – war der Heilpraktiker Arnold Eickmann inhaftiert. Er wurde dann von dort in das KZ Sachsenhausen verlegt, wo er in der Gärtnerei arbeitete. Zu allen KZs gehörten umfangreiche Gartenanlagen mit Gewächshäusern, daneben mußten die Gärtner auch die Freiflächen in den Lagern und die Appellplätze „verschönern“. Eickmann, der in mehreren KZs inhaftiert war, schreibt in seiner „Erinnerungen“ über das KZ in Oranienburg: „Im Lager und rundherum grünt und blüht alles.“ Jeder Angehörige der SS-Wachmannschaft konnte sich auch noch „einen Garten nach seinem Geschmack einrichten lassen.“ Eickmann wird die Ausgestaltung des Privatgartens von Richard Glücks übertragen: „Ich konnte dabei alle meine Pläne durchführen, denn für den SS-Gruppenführer stehen unbegrenzte Mittel zur Verfügung, Menschen, Geld und Baumaterial.“ Mit Hilfe von 100 Häftlingen bepflanzt Eickmann den breiten Weg vom Toreingang bis zu Glücks Haus mit einer Doppelreihe Pappeln, er legt Blumenbeete, Staudengruppen, einen riesengroßen Steingarten und einen mit Trauerweiden umrandeten künstlichen Teich an. Die Frau von Glücks ist so „erfreut, dass aus der Sandwüste nun nach fünf Monaten ein kleines Paradies geworden ist,“ wie Eickmann schreibt, dass sie ihn mit Rauchwaren verwöhnt. Anschließend soll er den Privatgarten des Generals der Waffen-SS Theo Eicke in Sachsenhausen ausgestalten. Dafür waren bereits fertige Pläne vorhanden: „Der Entwurf trägt die Kennzeichen einer Gartengestaltung, wie sie die Mode gerade vorschreibt. Ich weiß, dass er den Geschmack des Obergruppenführers in keiner Weise trifft.“ Deswegen machte Eickmann einen neuen Plan, den er dann auch sogleich realisieren soll – innerhalb von sechs Wochen: „Mit tausend Häftlingen beginne ich meine Arbeit. Viel ist zu schaffen. Dem Wohnhaus gegenüber soll ein großer Springbrunnen angelegt werden. In drei Kaskaden muß das Wasser in einen großen Teich inmitten des Gartens fließen. Im Park pflanzen wir Vogelschutzgehölze an und errichten ein großes Pfauenhaus. Vier Kilometer Wege sind allein zu bauen. Weite Rasenflächen müssen angelegt, Bäume und Sträucher gepflanzt, Blumen gesät und lange Hecken gezogen werden. Eine gewaltige Arbeit. Aber Hände sind genug vorhanden. So kommen wir schnell voran.“ Später legt er für die Kinder der Familie noch einen Spielplatz an, außerdem wird ihm die Pflege des Wintergartens im Haus übertragen. Aber dann erfolgt seine Verlegung in das KZ Dachau. Seine Arbeit erstreckt sich dort „nicht nur auf die Anlage und Erweiterung der Heilkräuter-Plantage“, die mit Hilfe von 2000 Häftlingen aufgebaut wird. „Wenige hundert Meter vom Gewächshaus I entfernt liegt ein Teich,“ schreibt er, „um diesen muß ich rundherum einen Steingarten anlegen, der an einigen Stellen bis zu drei Meter erhöht werden soll. Die erforderlichen Steine liefert uns das KZ-Lager Mauthausen. Meine Arbeit wird durch den nassen Moorboden und das feuchte Klima in dieser Gegend sehr erschwert…Ich entwerfe, plane, mache Saatberechnungen, lege Verbesserungsvorschläge vor und führe meine eigenen Entwürfe aus.“
Weitere – ähnliche – Aufzeichnungen hinterließ der tschechische Maler Karel Kasak. Er arbeitete als Botanischer Zeichner in der Gärtnerei des KZ Dachau, wo auch der bayrische Pfarrer Korbinian Aigner einsaß. Aigner züchtete dort neue Apfelsorten, die er KZ1, 2, 3 und 4 nannte. Die Sorte KZ3 war die beste. Sie wird heute unter dem Namen „Korbinian-Apfel“ vermarktet. Eickmann wurde dann von Dachau nach Auschwitz verlegt. Er soll dort die Lagergärtnerei übernehmen sowie die Privatgärten des SS-Offiziers de Fries und des Lagerführers Höss gestalten: „Höss befiehlt mir, mich im Laufe des Tages bei seiner Frau vorzustellen und von ihr alle Befehle für die Gärtnerarbeiten entgegenzunehmen.“ Nach dem Krieg sagte Rudolf Höss bei seiner Vernehmung aus: „Meine Frau hatte ihr Blumenparadies. Die Häftlinge taten alles, um meiner Frau und den Kindern etwas Liebes zu tun…An den Gärtnern hingen die Kinder besonders.“ Neben Eickmann berichtete später auch der polnische Häftling Stanislaw Dubiel über seine Gärtnertätigkeit im KZ Auschwitz. Er war dort ebenfalls an der Gestaltung des Privatgartens der Familie des Lager-Kommandanten beteiligt. Neuerdings erschien noch ein Buch über einen SS-Offizier, der in Auschwitz die dortige Vogelwelt erforschte – zusammen mit einem polnischen Häftling, der Zeichnungen von den Vögeln anfertigen mußte. Der SS-Ornithologe wurde nach dem Krieg von einem polnischen Gericht zu acht Jahren Haft verurteilt.
Zurück zum Rhönplan des Gauleiters Dr.Helmuth: Dieser fand lange nach dem Krieg über den 1944 von der Roten Armee gestoppten „Generalplan Ost“ doch noch seine Verwirklichung – im Kleinen: als „Aufbau Ost“ für die ehemalige DDR, nachdem diese der BRD „beigetreten“ war, wie man das ab 1990 nannte. Dabei war – wie erwähnt – von „blühenden Landschaften“ die Rede. Auch diese „Aufgabe“ versetzte die daran Mitgestaltenden in eine Art Ostrausch. Der für die wirtschaftliche Verwaltung Ostelbiens zuständige Treuhandchef Detlef Rohwedder klagte über seine Managerkollegen: „Die benehmen sich im Osten schlimmer als Kolonialoffiziere!“ Einer seiner Privatisierungsmanager meinte z.B. auf einer Berliner Treuhandkonferenz: „Ich muß unbedingt mal wieder Ostweiber beschlafen!“ Fast genauso äußerte sich auch der auf einer Lesetournee durch die untergehende DDR in Leipzig pausierende West-Schriftsteller Michael Stein. Der „Ostrausch ist also keine Frage von „links“ oder „rechts“, sondern Ausdruck eines Hormonstoßes – hervorgerufen durch die Kapitulation eines Nachbarlandes. Schon bei Thomas Pynchon heißt es – in seinem Peenemünde-Roman „Die Enden der Parabel“: „Immer wenn ich Beethoven höre, will ich Polen überfallen.“
Und so stammte auch das politische Drehbuch für die Wiedervereinigung noch aus der Zeit des nationalsozialistischen Ostrausches, d.h. nach dem Scheitern der DDR wurde das Territorium noch einmal von der ihr vorangegangenen antikommunistischen deutschen Raub- und Raumplanung eingeholt – überrollt, indem bei der Treuhandpolitik ein alter Plan zur Verwirklichung kam, den der Jurist Friedrich Ernst in den Fünfzigerjahren ausgearbeitet hatte. Er begann seine Staatskarriere 1919-31 im preußischen Handelsministerium. Anschließend wurde er Reichskommissar für das Bankgewerbe. 1935 ernannte ihn der Führer zum Reichskommissar für das deutsche Kreditwesen. 1939-41 war er für die Verwaltung des „feindlichen Vermögens“ verantwortlich, dazu arbeitete er die „Richtlinien“ zur Wirtschaftsführung in den „neubesetzten Ostgebieten“ aus. Diese Instruktionen – Hermann Görings berühmte „Grüne Mappe“ – waren dann Grundlage für die Tätigkeit des „Wirtschaftsstabes Ost“: das Drehbuch für die Ausplünderung der Sowjetunion, was die Vernichtung sämtlicher „unnützer Esser“ mit einschloß, d.h. die planmäßige Ermordung von mehreren Millionen Juden, Alten, Zigeunern, Bettlern, Partisanen, Kindern usw.. Dr. Ernst nahm daran nicht mehr aktiv teil, er wurde 1941 Teilhaber einer Hamburger Bank. 1949 holte man ihn aber erneut in ein öffentliches Amt. Bis 1957 half er, das Wirtschaftswunder anzukurbeln: erst als Verwaltungsratsvorsitzender der Berliner Zentralbank, seit 1951 auch noch als Leiter des Kabinettsausschusses für Wirtschaft – damit war er der Vordenker in Adenauers „Wirtschaftsnebenregierung“. 1952 wurde er überdies Vorsitzender des „Forschungsbeirates für Fragen der Wiedervereinigung Deutschlands“. Es ging um eine detaillierte Zusammenstellung „der bei der Wiedervereinigung voraussichtlich erforderlichen Sofortmaßnahmen“. Die Arbeit gipfelte in einer „Empfehlung zur Einfügung der ,volkseigenen‘ Industriebetriebe der SBZ in die nach der Wiedervereinigung zu schaffende im Grundsatz marktwirtschaftliche Ordnung“. Einen Monat nach dem Tod von Dr. Ernst wurde die Empfehlung abgeschlossen.
Im Einzelnen wurde darin u.a. vorgeschlagen: 1. die VEB als potentiell selbständige Unternehmen zu „modifizieren“, 2. von diesen „modifizierten VEB“ eine DM- „Eröffnungsbilanz zu verlangen, und 3. mit dem Übergang eine „Obere Behörde“ (Treuhandanstalt) zu betreuen. Diese obere Behörde sollte Aufsichtsräte einsetzen und die „modifizierten VEB“ gemäß marktwirtschaftlicher Einschätzungen teilen oder mit anderen vereinen. Mit Staatsmitteln errichtete Werke sollten von der oberen Behörde verkauft, d.h. privatisiert werden. Für die LPG sah die Empfehlung vor, sie nach einer Phase als „Übergangsgemeinschaften“ aufzulösen. Als Prinzip galt: „Rückgabe vor Entschädigung“. Dabei würde es zu Arbeitslosigkeit kommen, deswegen wurde empfohlen, gleichzeitig Vorsorge für einen reibungslosen Übergang von landwirtschaftlicher zu anderer Beschäftigung zu treffen (Massen-Umschulung und -ABM). Auch die „Altschulden“-Frage wurde vom Forschungsbeirat bündig geregelt, sowie die Währungsumstellung auf 1:1 – mit Einschränkungen. Außerdem war man bereits 1960 davon ausgegangen: Es gibt jetzt schon in der „sowjetisch besetzten Zone bei Kali Kapazitäten, die im Falle der Wiedervereinigung eine Ausweitung nicht erfordern“, da sich daraus „Überkapazitäten für Gesamtdeutschland ergeben würden“. Dr. Ernst hatte also bereits damals die Schließung u.a. des Kaliwerks in Bischofferode 1993 fest im Blick: Unglaublich!
Seine praktischen Wiedervereinigungs-Empfehlungen waren 1960 bereits so ausgereift, daß sie noch dreißig Jahre später als „Masterplan“ der Treuhand-Privatisierungspolitik in Ostdeutschland taugten – und auch weitgehend zur Anwendung gelangten. Bei diesem neokonservativen Reloading des „Dr.Ernst-Plans“, über den gerade der letzte DDR-Botschafter in Jugoslawien Ralph Hartmann ein kluges Buch veröffentlicht hat, fehlte es auch nicht an Stimmen, die noch sozusagen „live“ aus dem nationalsozialistischen Ostrausch herübertönten – indem sie von „verwüsteter Raublandschaft“, „sterilen Halden und Abbauflächen, von Dämpfen und Gasen überlagert, von eklen Gewässern durchsetzt.“ sprachen, wie einst der Ostraumplaner Erhard Mäding, sowie auch von einer, inzwischen kommunistisch regierten, „Welt“, weit entfernt von „dem grünen Garten, der von der „[west-] deutschen Hochkultur“ geschaffen worden war. Selbst die eilig eingeflogene Amerikanerin Jane Fonda war sich nicht zu schade, für CNN am chemievergifteten „Silbersee“ (!) zwischen Wolfen und Bitterfeld zu posieren – und bitterlich zu weinen ob des dort zerstörten Naturschatzes. „Das hat uns schwer geschadet,“ meinte 1996 einer der Geschäftsführer der dort inzwischen abgewickelten Filmfabrik Orwo.
Nach Abschluß des Aufbau Ost in der Ex-DDR wird nun zweierlei deutlich: Die diesmal fast friedliche Vertreibung der vom slawischen Schlendrian quasi durchseuchten Ostdeutschen – mittels Arbeitslosigkeit, Hartz IV, Zwangsarbeit und Ernteeinsätzen: Das schafft Platz – nicht nur für viele neue Naturschutzgebiete sowie für die Wiederansiedlung von (russischen bzw. polnischen) Wölfen, es ermöglicht auch immer mehr Westdeutschen, sich dort großzügig anzusiedeln – um vor Ort rekultivierend zu wirken, indem sie ihre Umgebung aufs Liebevollste umgestalten – auf privater Basis diesmal. Die einzigen halbwegs partisanischen Formationen dagegen, das scheinen nun die Neonazis zu sein: Sie begreifen sich als umherschweifende Schlägertrupps in der Tradition der Freikorps, die zuletzt in der SA bzw. SS aufgegangen waren.
Während die deutsche Kultivierungs- bzw. Kulturgrenze immer weiter nach Osten verschoben wurde, entstanden im bereits so gut wie trockenen Kernland ab Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr idyllische Gartensiedlungen. Die erste – „Marga“ genannt- ab 1907 bei Senftenberg. Sie war für Bergarbeiter gedacht, während die in den 20erjahren gebaute „Gartenstadt Leuna“ für Handwerker geplant wurde.In Staaken und Falkensee bei Berlin entstand etwa zur selben Zeit“Europas größte Gartenstadt“. Jeder Mieter sollte dort über einen eigenen Garten verfügen. Zuvor hatten die Bürger bereits in vielen Städten Botanische und Zoologische Gärten gegründet und die Stadtverwaltungen öffentliche Parkanlagen anlegen lassen, nicht selten mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Arbeitslose verbunden. Für die einkommensschwachen und zudem prekär beschäftigten Schichten wurden zur Not-Selbstversorgung Schrebergärten ausgewiesen.In der DDR kamen später zur Erholung der Werktätigen noch viele Datschensiedlungen hinzu. Die Erbauungszeitschrift „Gartenlaube“, 1853 gegründet, entwickelte sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts zum ersten erfolgreichen deutschen Massenblatt, sie wurde 1944 eingestellt. Zuvor hatten die Nazis noch für jedes deutsche Dorf ein Naturschutzgelände und für jeden Kreis ein Naturschutzgebiet geplant gehabt, der Abschuß eines Adlers wurde zu einem todeswürdigen Verbrechen erklärt.
Heute ist es schon fast wieder so weit: So wurde im Herbst 2007 z.B. der in Ostdeutschland aufgewachsene Schreiadler Sigmar auf seinem Flug nach Afrika über Malta abgeschossen. Da die Insel Malta inzwischen das „Sorgenkind“ der Vogelschützer ist, dem sie sich besonders intensiv widmen, wurde dem jungen Schreiadler schnelle Hilfe zuteil: „Die Naturschützer sammelten das verletzte Tier auf ließen es per Flugzeug in die Tierklinik der Freien Universität Berlin bringen, aber es überlebte nicht. Die Ärzte mussten den Greifvogel wenige Wochen später wegen einer infizierten Wunde einschläfern. Ein bitterer Verlust, denn in Deutschland leben nur noch 90 Paare dieser Art. Auch auf Sigmar ruhte die Hoffnung, dass sich die Schreiadler-Population erhalten lässt,“ schrieb die Süddeutsche Zeitung. Diese ganze naturfürsorgliche Entwicklung bahnte sich in den Siebzigerjahren an – mit der Sonnenblumenpartei Die Grünen, mit Öko und Bio, mit Hinterhofgärten, Dachgärten, Schulgärten, Gemüsebeeten auf Balkonen, immer anspruchsvolleren Blumenläden und immer gigantischeren Gartencentern bzw. Blumengroßmärkten sowie bis heute 70 Zeitschriften, die ausschließlich Gärten thematisieren. Sie heißen „LandLust“, „Mein schöner Garten“, „Country“, „Demeter-Gartenrundbrief“, „Flora“ usw.. (1)
Für die Berliner Gewässer wurde ein „Röhrichtschutzgesetz“ erlassen. Die deutsche „Hauptstadt der Nachtigallen“ ist inzwischen derart begrünt, dass einige New Yorker Urbanisten neulich nach einer Stadtbesichtigung per Schiff – vom Humboldthafen über die Spree zum Landwehrkanal – schon erstaunt fragten: „Where is the city?“ Bei den Agrarwissenschaftlern an der Humboldt-Universität hat man einen Lehrstuhl für „Stadtgärten“ eingerichtet und in einigen Bezirken gibt es bereits „besetzte Gärten“ sowie auch Wohnkomplexe mit einem Hinterhofsumpf als dezentrale Kläranlage. Den Reichen, die ein Haus von einem berühmten Architekten in einer Villengegend erwarben, bietet das beim Innenministerium angesiedelte Gartendenkmalamt sogar an, die bis in die Millionen gehenden Kosten zur detailgenauen Rekonstruktion ihres Gartens zu übernehmen. Die Besitzer dürfen dann allerdings keine Gartenmode mehr mitmachen.
Diese besteht derzeit vornehmlich im Anlegen von Gartenteichen und -sümpfen. Es gibt in Deutschland bereits gut drei Millionen davon. Der neue deutsche Hang zu Miniatursümpfen, Feuchtbiotopen, Teichen und Sumpfbeeten bzw. „Gartensümpfen“, ein Wort, das auf den Husumer Eindeichungsexperten Theodor Storm zurückgeht, hat bereits eine ganze Industrie nebst dem entsprechenden Bedarfsmarkt entstehen lassen. Das Angebot reicht von Tier- und Pflanzenzüchtungen bis zu Umwälzpumpen, Fertigteichen und qualifizierten Sumpfgarten-Beratern. Einer, Jens Beiderbeken, der über das Gartencenter Havelland vermittelt, reichen Gartenbesitzerinnen in und um Spandau beim Anlegen ihrer Feuchtbiotope hilft, spricht von einem „regelrechten Sumpffieber“. Aber auch z.B. der Bund Naturschutz bzw. seine Ortsgruppen wetteifern beim Anlegen von immer neuen Teichen – Biotopen mit Flachwasser- und Feuchtzonen sowie Ablaichmöglichkeiten für Amphibien. Es gibt außerdem inzwischen einen Studentenclub „Sumpf e.V.“ und eine Kulturkneipe namens „Der Sumpf“, sowie auch einen fortdauernden „Stasi-Sumpf“ und einen „Braunen Sumpf“, den die Bundesregierung angeblich „austrocknen“ will. Überhaupt ist das Wort „Sumpf“ in der Öffentlichkeit immer noch durchaus negativ konnotiert – außer bei den Partisanen: So heißt z.B. ein Beitrag von Sepp Gutsche in einer Sammlung von Erinnerungen deutscher und sowjetischer Partisanen: „Der Sumpf – Freund der Partisanen“. Dieser Sumpf befindet sich jedoch in Weissrussland.
In Ostdeutschland hat man dafür 1995 das sich etwa ab Hohenwutzen flußabwärts an das Oderbruch anschließende Untere Odertal fast bis zum Stettiner Haff zu einem „Nationalpark“ erklärt. Auf polnischer Seite kamen dazu noch zwei „Landschaftsschutzparks“ – zusammen ist damit eine Fläche von 1172 Quadratkilometern erfaßt. Dort darf die Landschaft nun langsam wieder den Charakter eines Feuchtbiotops annehmen. Zur Einweihung erklang auf deutscher Seite die neue Nationalhymne Brandenburgs, sie beginnt mit der Strophe: „Steige hoch, du roter Adler, hoch über Sumpf und Sand“.
Noch seltsamer: Im Oderbruch selbst, wo die ganze Trockenlegung der deutschen Sümpfe einst begann, wurde im Mai 2008 eine Ausstellung von zwei Kulturwissenschaftlern – Kenneth Anders und Lars Fischer – eröffnet, mit der ihr Eberswalder „Büro für Landschaftskommunikation“ vier Zukunfts-Szenarien für diese Region vorstellte. Gleich mehrere bestanden darin, auch diese einst völlig denaturierte preußische Landschaft wieder versumpfen zu lassen. Veranstaltet wurde ihre dort vielbeachtete Ausstellung vom „Forum Oderbruch e.V. – „ein Zusammenschluss aus Honoratioren und Honoratioren-Vereinen, der unter dem Eindruck der Hochwasserbedrohung 1997 gegründet wurde und sich das Schicksal des Oderbruchs angelegen sein lässt. Dieses Forum hat die zwei Kulturwissenschafter beauftragt, Szenarien für mögliche Entwicklungstendenzen der Region zu entwerfen und einen regionalen Meinungsbildungsprozess dazu auszulösen,“ schreibt die Rezensentin der Dorfzeitung von Reichenow, Imma Harms, die das Projekt für sehr gelungen hält. Zu die beiden Autoren aus Eberswalde meinte sie: „Das ist wie eine Wiederholung der Geschichte von Hermann dem Cherusker. So wie der in Rom erst eine militärische Ausbildung bekam, um dann als Experte für den germanischen Guerillakampf antreten zu können, sind diese zwei Kulturwissenschaftler auch erst mal von hier weggezogen und haben sich woanders, u.a. bei Thomas Macho an der Humboldt-Universität, ihr Wissen geholt, um nun im Oderbruch, wo sie herkommen, als Experten im besten Sinne aktiv zu werden.“
Ein taz-Redakteur, Uwe Rada, schrieb über ihre Ausstellung: „Drei der vier Prognosen ist gemeinsam, dass sie eine Absage sind ans ‚Weiter so‘. Im Szenario ‚Intensivierung‘ erobert die Biomasse das Oderbruch, schnellwachsende Weiden und ‚Chinaschilf‘ ersetzen den bisherigen Anbau von Kartoffeln und Gemüse. Infolgedessen bricht der Tourismus ein, die Eisenbahnverbindungen werden eingestellt, Böden und Grundwasser sind mit Düngemitteln verseucht. Nicht viel optimistischer ist das Szenario ‚Extensivierung‘. Weil die Entwässerung der Niederungslandschaft zu teuer geworden ist, lässt die Landesregierung weite Teile des Bruchs vernässen. Weidewirtschaft und Fischerei erleben eine Renaissance. Um den rasanten Bevölkerungsverlust aufzuhalten, setzt die Landesregierung auf eine ‚Disneylandisierung‘ des Oderbruchs. Auch der Naturschutz muss deshalb zurücktreten. Die düsterste Prognose freilich hält das Szenario ‚Katastrophe‘ bereit. Erneut kommt es zu einer Jahrhundertflut an der Oder. Anders als 1997 beschließt die Landesregierung jedoch, das Oderbruch aufzugeben und die Bevölkerung umzusiedeln. Doch auch die Bundeswehr kann nicht verhindern, dass zahlreiche Bewohner zurückkehren und wilde Siedlungen auf Subsistenzbasis gründen. Darüber hinaus rufen Aktivisten die ‚Freie Republik Oderbruch‘ aus. Weil die Hochwasser jedes Jahr im Sommer und Winter das Bruch fluten, haben die Siedler ihre Häuser auf Warften errichtet – wie vor der Trockenlegung im 18. Jahrhundert.“
Neben dem Wolf darf sich nun auch der Biber an der Oder wieder ausbreiten, nachdem er im 19. Jahrhundert so gut wie ausgerottet worden war. Das ist jedoch kein Zukunftsszenario mehr, sondern bereits Gegenwart, wobei für die beiden Eberswalder Landschaftsforscher sowieso „klar ist, dass die Zukunft, die die Szenarien beschreiben, an der Oder längst begonnen hat“.
„Biber setzen Oderbruch unter Wasser“ titelte die Berliner Morgenpost im Mai 2008. Laut einer aktuellen Studie wurden bereits „60 Ansiedlungen mit etwa 250 Exemplaren gezählt“. Die ersten hatte man dort schon 1986 ausgesetzt. Sie vermehrten sich und bilden heute eine stabile Population. „Sehr zum Leidwesen der Oderbrücher, die ein Lied davon singen können, wie Biber ganze Felder unter Wasser setzen, dickste Bäume fällen, Gräben umleiten und selbst vor den neu gebauten Oderdeichen nicht Halt machen. Naturschützer schätzen hingegen vor allem die Nützlichkeit des Bibers. Laut europäischer Wasserrahmenrichtlinie soll Regenwasser nicht sofort aus der Landschaft abgeführt, sondern dort gehalten werden. ‚Um Fließgewässer zu renaturieren, werden Millionen ausgegeben. Der Biber macht das mittels Anstauen zum Nulltarif‘, sagt Peter Streckenbach von der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Märkisch-Oderland.“
In Ostdeutschland leben inzwischen wieder mehr als 6000 Biber. In der märkischen Uckermark, wo ihre Dammbauten bereits große Seen entstehen ließen, gehen Biberschützer heute davon aus, dass diese neuen Feuchtregionen die Landschaft vor dem „Austrocknen“ schützen. Sie begrüßen also im Gegensatz zu den Oderbrüchern die erneute Versumpfung – und die Biber als die noch viel sensibleren Landschaftsumgestalter: „Sie haben ein El Dorado für all jene Tiere geschaffen, die am Wasser leben,“ freut sich z.B. der Leiter des Naturparks Uckermärkische Seen Roland Resch, dem ein solch quasi-natürlicher Rückbau, also die Wiederversumpfung, gar nicht weit genug gehen kann.
In eine ähnliche Richtung argumentiert die Schriftstellerin Charlotte Roche mit ihrem Bestseller „Feuchtgebiete“, in dem es um die positive Besetzung der bisher eher kulturell-eingedämmten weiblichen Körperöffnungen geht, ihre flüssigen bis sämigen Ausscheidungen, Gerüche, Geräusche und Miasmen. Auch der Münchner Biologe Reichholf hat in sein Buch „Stadtnatur“ ein Kapitel über Gartenteiche bzw. -sümpfe mit hineingenommen. Er gibt darin zu bedenken, dass sie früher oder später „verlanden“, d.h. dass die Teiche über den Tümpel in einen Sumpf übergehen und „dieser nach und nach ähnliche Verhältnisse annimmt wie das umliegende Land.“ Der neue deutsche Hang zum Sumpf ist also nicht nur eine Garten-Modeerscheinung, sondern der Sumpf selbst ist ein Zwischenstadium. Im Gegensatz zur Literatur darüber, die, wie Reichholf schreibt, inzwischen „schier unübersehbar“ geworden ist. Ein Text sei abschließend noch erwähnt: „La Science de Dieu“ von Jean-Pierre Brisset. Der Sprachgenealoge schreibt darin: „Alle Sprachen haben die Erinnerung an die Zeit bewahrt, als man von Fliegen lebte. Das größte Glück für einen Deutschen ist es, zwei davon auf einmal zu töten: Zwei Fliegen mit einer Klappe tot zu schlagen. Wir sehen ihn immer noch leben, unseren ersten Vorfahren, in den Mooren und Sümpfen; er kommt auf die Erde und steigt zur Sonne. Er ist ein Hüpfer, der von Grashüpfern, von Grillen, von allem, was summt, vor allem von Fliegen lebt. Dieser Ahn ist, man ahnt es schon, der Frosch.“ „Es geht darum, sagt Brisset, „die Erschaffung des Menschen mit den Materialien aufzuweisen, die wir in seinem Mund finden, wo Gott sie hingetan hat, bevor der Mensch erschaffen ward.“
Michel Foucault beschreibt Brissets Vorgehensweise wie folgt: „Um irgendein Wort seiner Sprache herum ruft er mit lautem Gestabreime andere Wörter herbei, von denen ein jedes die alten urvordenklichen Szenen des Begehrens, des Krieges, der Wildheit, der Verwüstung nach sich zieht – oder eben das Gezänk der Dämonen und der Frösche, die am Rande der Sümpfe herumhüpfen. Er gibt die Wörter wieder den Schreien, die sie zur Welt gebracht haben; er inszeniert wieder die Gebärden, die Anstürme, die Gewaltsamkeiten, deren nunmehr schweigendes Siegel sie bilden. Er gibt dem thesaurus linguae germanicae und gallicae dem anfänglichen Heldenlärm zurück; er rückverwandelt die Wörter in Theater, er bringt die Laute wieder in die quakenden Kehlen…“ Heinrich Heine sprach einmal vom „klassischen Morast“, in dem die „Hermannschlacht“ mit der Zeit zur „Geburt der Deutschen“ (so Tillmann Bendikowski) aufgeblasen wurde.
Der Ökologe Josef H. Reichholf will mit seinem Buch über die „Stadtnatur“ einmal mehr beweisen, dass es in der Großstadt eine größere Artenvielfalt als auf dem Land inzwischen gibt, ja, dass einige Wildarten fast nur noch in der Stadt vorkommen. Der ehemalige englische Partisan Stuart Hood, der einst in der Region Chianti und dann in der Umgebung von Florenz gegen die Deutschen kämpfte, argumentierte ähnlich, nachdem er 1981 das letzte Mal seine ehemaligen Kampfgefährten in der Toskana besucht hatte: „Als ich ging, verstand ich ein wenig, warum der heutige Partisan wahrscheinlich der Stadtguerillero ist, weil mit dem Tod der bäuerlichen Kultur und den bäuerlichen Netzwerken, von denen ich zum Überleben abhängig gewesen war, auf dem Land kaum mehr ein Maquis aufgezogen werden kann“.
In Mitteleuropa wurden darüberhinaus inzwischen aus den letzten großen Wäldern, die noch sicheres Versteck boten, kleine durchforstete Nutzwälder – bis auf eine Ausnahme: in Ostpolen – der Urwald von Bialowieza (Podlasien), „der Rumpfheimat des Wisent, aber auch aller echten Männer, sowie der polnischen Outlaws und Partisanen,“ wie Simon Shama in seiner Studie „Der Traum von der Wildnis“ schreibt. Ferner Jagdgebiet der Könige, dann kurzzeitig das Revier von Hermann Göring – und Ausgangspunkt der polnischen Forstwirtschaft bzw. -wissenschaft, die wiederum oft Beziehungen zu den Partisanen in ihren Wäldern unterhielt. 1930 erklärte die Pilsudski-Regierung den Urwald zum ersten polnischen „Nationalpark“. Hier beginnen die ersten Gefechte zwischen Nationalökonomie und -ökologie.
In Weißrussland hat der jetzige Staatspräsident einen Teil der Pripjetsümpfe, wo es heute in fast jedem Dorf ein Partisanendenkmal gibt, unter Naturschutz gestellt – und gleichzeitig auch die Biber. Der russische Autor Wladimir Kaminer berichtete kürzlich: „Der Biber gilt dort als Symbol für den Arbeitsfleiß, die Intelligenz und Bescheidenheit der Weißrussen, er lebt in speziell für ihn eingerichtete Reservate – unter der Schirmherrschaft des weissrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Nun kann niemand mehr dem weissrussischen Biber etwas anhaben.“
(1) Kritik an dieser Entwicklung, bei der sich eine Bio-Politik von oben mit einer Öko-Politik von unten verbindet, kommt u.a. von dem englischen Publizisten Neal Ascherson. In einer „Le Monde Diplomatique“-Rezension des Buches „Geschichte der deutschen Landschaft – Die Eroberung der Natur“ von David Blackbourn schreibt Ascherson, wobei er sich insbesondere auf das Oderbruch bezieht: „Grüne Aktivisten, aber auch Regierungen, die sich für die ‚Entwicklung‘ der natürlichen Ressourcen verantwortlich fühlen, stoßen bei ihrem Bemühen um die ‚Rettung der Umwelt‘ immer wieder auf irritierende Fragen. Denn es ist keineswegs eindeutig, wie die Beziehung der Menschen zu ihrer Umwelt zu verstehen sei. Es gibt ja kaum noch Zeitgenossen, die sich auf den Wortlaut der Schöpfungsgeschichte berufen, wonach der Mensch zur Herrschaft über alle Kreatur bestimmt sei, also ‚über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht‘. Längst vorüber ist auch die Selbstgewissheit der Totalitarismen des 20. Jahrhunderts, die sich auf die ‚ehernen Gesetze der Geschichte‘ beriefen, um die technische Umgestaltung der Landschaft und der Biosphären zu rechtfertigen – unter Berufung auf den menschlichen Fortschritt, der doch nur eine neue Variante des Anspruchs auf ‚Herrschaft‘ über die Natur darstellt. Solche alten Überzeugungen leben im Verborgenen fort und beeinflussen nach wie vor unser Denken.
Das gilt auch für die Vorstellung, dass der Mensch zum ‚Treuhänder für die natürliche Schöpfung‘ bestellt sei. Das klingt nach guten Absichten und bewirkt in der Praxis häufig Positives, und doch drückt sich darin der alte anmaßende Anspruch der menschlichen Gattung auf den Status eines über der Natur stehenden Souveräns aus. Seltsamerweise klingt dieses Dogma auch in gewissen Aspekten des ‚grünen‘ Denkens wieder an, wenn es nämlich behauptet, die Menschen seien für alles verantwortlich, was im Meer und in Seen und Flüssen ’schiefgeht‘, zum Beispiel für die Vermehrung oder das Verschwinden einzelner Tier- und Pflanzenarten und für Veränderungen von deren natürlichen Lebensräumen.
Damit will ich keineswegs verharmlosen, wie stark das Handeln der Menschen in den letzten zehntausend Jahren zur Verwüstung unseres Planeten und zur Vernichtung vieler Formen des Lebens beigetragen hat. Doch die Formel von der ‚totalen Verantwortung‘ des Menschen bleibt einer anthropozentrischen Philosophie verhaftet. Sie beinhaltet die realitätsferne Vorstellung eines ‚Gleichgewichts der Natur‘ – als ob in der Umwelt zu Lande wie zu Wasser eine konstante und unveränderliche ökologische Balance herrsche, die nur durch die Intervention der Menschen ‚aus dem Lot‘ gebracht würde.“
4. Spaziergang durchs Moor:
Helmut Salzinger geht in der Nähe seines Dorfes Odisheim mit dem Hund spazieren, „auf einem Weg zum Raterbusch hinüber“. – ins „Lange Moor, das zu einem System von Hoch- und Niedermooren gehört, welches sich vom Ahlenmoor im Norden bis Ebersdorf im Süden erstreckt“.
Dabei kommen sie an ein Schild: „Achtung! Floratorf Produkt. Aus dem vor Ihnen liegenden Hochmoor – werden die reinen Rohtorfe für die Herstellung der natürlichen Floratorf-Produkte gewonnen. Floratorf-Produkte helfen, alles besser wachsen und blühen zu lassen. Gärten werden schöner und Städte grüner. Helfen Sie mit, daß unsere Flächen und Gräben sauber bleiben und eine Zerstörung durch Feuer und Abfälle unterbleibt. Köhlener Torfwerk WK. Strenge GmbH“.
Helmut Salzinger merkt dazu an: „Das Hochmoor als Betriebsgelände des Torfwerks. Und die Floratorf-Produkte, die mit der Vollkraft der Natur das Geschäft der Stadtbegrünung betreiben. Man stellt sich ein gutes Zeugnis aus und nutzt die Gelegenheit zur Werbung. Inzwischen wird das Hochmoor hier in Torf verwandelt und in den Städten auf Blumenbeete und -töpfe gekrümelt. Wenn man die Flächen, wo der Torf abgeräumt worden ist, sich selbst überläßt, ziehen sie das Wasser an und haben sich in wenigen Jahren neu begrünt. Das renaturierte Moor erstreckt sich bereits kilometerweit. Ob nun auch das Hochmoor anfangen wird zu wachsen, das wird sich erst noch zeigen. Vorerst erstreckt sich vom Firmenschild aus ein unabsehbares, weiß schäumendes Meer von nickendem Wollgras“. Helmut Salzinger und sein Hund gehen einen verbotenen Grenzweg am Moorrand entlang, dabei entdecken sie: „Nach Nordosten erstrecken sich jetzt die Torfstiche mit ihrem ausgedehnten System von Gräben, Wällen, Wegen und zum Trocknen gestapelten Torfsoden, alles Braun in Braun. Inselartig haben sich bereits Gräser auf dem Torf angesiedelt. Es folgen Sauerampfer und Brombeere, Glockenheide…Dahinter ist der Abbau in vollem Gange. Vor meinem Auge walzt ein Gefährt, irgendetwas zwischen Raupe, Wanze oder Käfer mit Pflug, es schält im Vorbeifahren den Torf als ununterbrochenen Streifen vom Boden, der dann wohl in handliche Soden geteilt und geschichtet wird. Ob es das ist, was sie ,ringeln‘ nennen? An einem halb verfallenenen aber noch benutzten Schuppen habe ich ein Papier angeheftet gefunden, mit dem die Firma bekannt gab: ,Am 13.7. wird wieder geringelt‘.“ Helmut Salzinger kommt über diese Nachricht leicht ins Grübeln: „Nun, heute ist erst der 9.7.. Für wen die Nachricht wohl ist? Der 13. ist doch erst nächste Woche, und es sieht nicht so aus, als würde bis dahin jemand hier vorbeikommen, um sie zu lesen. Doch wer weiß? Ich bin ja auch vorbeigekommen. Und damit konnte keiner rechnen“. Am Ende des Randweges stoßen Helmut Salzinger und sein Hund auf einen „knallrot aufgemotzten BWM, der dort abgestellt ist“. Ein paar hundert Meter weiter stehen Hütten und schweres Räumgerät. Helmut Salzinger kommt dabei der Gedanke: „Für mich wäre die Vorstellung, dass das Moor abgetorft wird, leichter erträglich, wenn ich dabei Menschen sähe, die mit dem Torfspaten persönlich dem Moor zuleibe gehen…Aber was hier geschieht, ist mechanisierter, industrieller Abbau, professionelle Ausbeutung des Moors“. Wieder zurück in seinem Haus wird Helmut Salzinger diese und andere Gedanken/Eindrücke als „Versuch, nichts zu erzählen“ niederschreiben.
5. Meine Kindheit im Moor:
Die „norddeutschen Sümpfe und Moore“ waren schon einmal ins Gespräch gekommen – als die Nationalsozialisten ihre Trockenlegung und den Torfabbau in großem Stil in Angriff nahmen: mit Zwangsarbeitern und schließlich KZ-Häftlingen. Von ihren Arbeitsbedingungen im Lager „Börgermoor“ bei Papenburg erzählt das berühmt gewordene Lied „Wir sind die Moorsoldaten“. Eine Strophe darin lautet: „Auf und nieder gehn die Posten,/ keiner, keiner kann hindurch./ Flucht wird nur das Leben kosten,/ Vierfach ist umzäunt die Burg.“/ „Wir sind die Moorsoldaten/ und ziehen mit dem Spaten/ ins Moor.“
Ebenfalls von einem „Emslandlager“ bei Papenburg handelt der Film „Der Hauptmann von Muffrika“: im April 1945 überwältigte ein 19jähriger Gefreiter mit einer Bande versprengter Soldaten die Leitung und errichtete im Lager einen Monat lang ein Schreckensregime – bis ihn die Engländer verhafteten. 2006 hat sich ein Sohn der Papenburger Werftfamilie Meyer, der in Freiburg lebende Historiker Paul Meyer noch einmal mit einem „Emslandlager“ befaßt: Für seinen Dokumentarfilm „Konspirantinnen“ interviewte er eine Gruppe von polnischen Frauen, die als Verbindungssoldaten im Warschauer Aufstand gegen die Deutschen gekämpft hatten. Nach ihrer Niederlage waren sie gemäß des Kapitulationsabkommens als Kriegsgefangene in ein emsländisches Moorlager bei Oberlangen gebracht worden. Da sie die ersten weiblichen Kriegsgefangenen waren, kamen sie in ein extra für sie neuerrichtetes Moorlager.
Heute ist durch die auch nach dem Krieg noch fortdauernden Trockenlegungs-, Meliorations- und Torfabbaumaßnahmen kaum noch etwas von den norddeutschen Mooren übrig geblieben.
Wie sie, aber auch andere „deutsche Landschaften“ in den vergangenen Jahrhunderten umgestaltet wurden, hat der Historiker David Blackbourn 2007 in seinem Buch „Die Eroberung der Natur“ an einigen Beispielen dargestellt: Von Friedrich dem Großen, der die Trockenlegung von Sumpfland, insbesondere im Oderbruch, als „Eroberungen von der Barbarei“ bezeichnete, über den „Bezähmer“ des Rheins Johann Gottfried Tulla und den Dammbauer Otto Intze bis zu den Nationalsozialisten, die im Inneren wie im Äußeren „Lebensraum“ erobern wollten.
Mit der Niederlage im Zweiten Weltkrieg hörte diese „Kultivierung“ nicht auf. Das norddeutsche Teufelsmoor mit seiner Geestinsel Weyerberg, auf der das Künstlerdorf Worpswede liegt, geriet erst in der Nachkriegszeit ins Visier der Politik. Im Dorf lebten jedoch seit langem schon derart viele Künstler, die sich von der Moorlandschaft inspirieren ließen, dass sie selbstbewußt genug waren – als eine der ersten Bürgerinitiativen in der neuen Bundesrepublik den Widerstand gegen alle „Projektpläne“ – abgesehen von den agrarischen – zu organisieren.
Carl Einstein hatte speziell die „nordische Kunst“ der berühmten Moormalerin Paula Becker-Modersohn, aber auch die Werke ihrer Kollegen im Dorf verächtlich als „Worpswederei“abgetan. Desungeachtet wird der „staatlich anerkannte Erholungsort“ am Weyerberg mit dem weiten Himmel überm Teufelsmoor heute täglich von mehreren tausend Touristen besucht. 130 Künstler leben nun dort sowie 70 Millionäre. Worpswede wimmelt von „Museen, Kunsttreffs, Galeriepassagen und Malschulen“. Es ist wohl der einzige deutsche Ort, in dem am zentralen Parkplatz statt eines Gebührenautomaten ein Bronzebuddha lacht. Noch immer gilt hier die These des ersten „Verschönerungsvereins“: Je mehr Kunst desto weniger Polizei! (Die öffentliche Toilette ist doppelt so groß wie die Wache.) Es gibt ferner zwei kreative Managerschulungszentren und zwei Bordelle, eins für leitende Angestellte und eins für Freischaffende, sowie zwei Atelierhäuser: eins von oben (vom Land) und eins von unten (vom Gatten einer Künstlerin) initiiert: Martin Kausche. Die gesamte Dorf-Atmo wird von humanistisch-musisch gebildeten Frauen mit grauen Haarsträhnen geprägt, die sich nun nach Ehe und Kinderaufzucht voll der Selbstverwirklichung widmen. Erwähnt sei die Worpsweder Lampenfabrikantin Barbara Lippold, die gerade – mit 61 – eine Töpferlehre begann.
Die markantesten Gebäude wurden in den zwanziger Jahren im Auftrag des Kaffee-HAG-Gründers und Erfinders des coffeinfreien Kaffees Ludwig Roselius vom Bildhauer Bernhard Hoetger entworfen, der erst für die Arbeiterbewegung künstlerisch tätig war und sich dann – vergeblich – Hitler andiente.
Während der Gründer der Künstlerkommune, Heinrich Vogler, nach Rußland auswanderte, wo sein Sohn Jan eine ML- Professur bekam, wurde sein Mitkommunarde Uphoff während der Nazizeit „Kulturwart“ vor Ort, und der „erste Worpsweder“, Fritz Mackensen, ließ sich mit „Major“ anreden. Er hatte während der „Systemzeit“ ein Gewehr erfunden, das um die Ecke schoß und das er als Patent an die Firma Zeiss verkaufte, die es dann nach England weiterverscherbelte. Mackensen brachte das wenig später die Rüge ein, den Feind unterstützt zu haben. Das Gewehr tauchte erst 1965 in dem Mexiko-Revolutionsfilm „Viva Maria“ wieder auf, nach dem sich dann einige Jahre später eine Münchner Kommune benannte.
Nach dem Krieg war es zunächst wieder eine Künstlerin gewesen, mit der Worpswede in Schwung kam: die Keramikerin Heide Weichberger. Sie war erst mit dem Mexiko-Exilanten und Vogler-Schwiegersohn Gustav Regler liiert und dann mit dem Botaniker und Vagabunden Gustav Schenk, den die Amerikaner 1945 zum Bürgermeister von Worpswede machten. Sein Sohn, der Seemann und Dichter Johannes Schenk, wohnte bis zu seinem Tod 2006 immer wieder im Ort, und ebenso – bis 1998 – sein malender Halbbruder Tobias Weichberger, dessen Vater Philip zuletzt mit ihrer Mutter liiert war. Wichtig für das Dorf wurde ferner der „Edelkommunist“ und Galerist Fritz Netzel. In den fünfziger Jahren gründete er die oben erwähnte erste Bürgerinitiative: Sie verhinderte den Abbau des Weyerbergs durch ein Kalksandsteinwerk und wandelte sich dann in eine „unabhängige Wählergemeinschaft“, mit der die Nutzung des Teufelsmoors als „Nato-Bombenabwurfplatz“ abgewehrt wurde, ebenso dann auch der SPD-Plan, aus den Hamme-Wiesen ein „Surf- und Badeparadies“ zu machen. Diese „heimliche Regierung“ wurde jedoch 1972 mit der SPD-Gebietsreform, die der bäuerlichen CDU aus den Dörfern eine Mehrheit bescherte, ausgebremst. Erst 1986 versuchten die „Künstler“ – im von Vogler erbauten Bahnhof – einen neuen Anlauf, der sich diesmal auch gegen die „Trittbrettfahrer“ (die Schickimicki-Kunstladenbesitzer) richtete, ihre Partei kam diesmal jedoch nicht mehr über den Stammtisch hinaus. 1994 starb Netzel. Aus seiner Galerie wurde eine Stiftung. Als Ortsberühmtheit gilt außerdem noch Frau Laves, die Schmuckschmiedin: Zu ihren „Kursen“ – mit echten Sufis, indischen Yogis und dem Indianer Sunbear – reisen authentische Frauen von weither an.
Das Teufelsmoor kann man unterdes nur noch ahnen, wenn man heute dort über die Wiesen spazieren geht. 1750 begann unter der Leitung von Moorkommissar Jürgen Christian Findorff die Kolonisation der gesamten Teufelsmoorniederung. Die Siedler waren einfache Knechte und Mägde, die sich mit der Aussicht auf eigenes Eigentum und Befreiung von Steuern und Militärdienst aus der Umgebung bewarben. Die Lebensbedingungen in den Moorkolonien waren noch bis weit in das 20. Jahrhundert alles andere als malerisch. Ausdruck der sehr ärmlichen Verhältnisse gibt der plattdeutsche Spruch „den ersten sin Tod, den tweeten sin Not, den dritten sin Brot“. Die Lebenserwartung in den dunklen und feuchten Moorkaten war niedrig und der Moorboden eignete sich nicht für die Landwirtschaft.
Meine Familie zog deswegen – aus einem Dorf nahe Worpswede – irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts wieder zurück nach Bremen, sie nahm aus dem Moorabenteuer nur den Dorfnamen – Höge – mit und an. Ein umfangreiches Entwässerungsnetz wurde angelegt, wobei die Hauptentwässerungsgräben gleichzeitig als Schifffahrtskanäle ausgebaut wurden – bis hin zu einem neuen „Torfhafen“ in Bremen. Zu dieser Zeit wurde massiv in die Natur eingegriffen und Millionen von Kubikmetern Torf gestochen. Weiter heißt es bei Wikipedia: „Die neben den Kanälen aufgetragenen Dämme dienten dem Treideln und der Erschließung der einreihig angelegten Straßendörfer, nach Vorbild der Fehngebiete. Vom Damm aus wurden die schmalen und sehr langen Landstücke (Hufen) ins Moor hinein bearbeitet. Noch heute sind diese Siedlungsstrukturen (Reihendörfer) in weiten Teilen der Gemeinden Grasberg und Worpswede gut zu erkennen. Durch den Abbau des Torfkörpers und die Entwässerung haben sich auch die klimatischen Bedingungen des gesamten Landstriches wesentlich verändert. Bis in die 1980er und 1990er Jahre wurde aber weiterhin das Moor zerstört. „Meliorationen“ wie Drainierungen, Tiefumbruch und Flussregulierung sollten den Ertrag der Landwirtschaft steigern und ermöglichten sogar Ackerbau. Zumeist wird von der Landwirtschaft dort Mais als Silofutter angebaut. Diese Maßnahmen wurden seit Mitte des 20. Jahrhunderts durch verschiedene nationale und europäische Subventionsprogramme unterstützt. Das ging so weit, dass die Gräben im Sommer trocken fielen, Moorbrände entstanden und bei anhaltender Trockenheit z.T. künstliche Bewässerungen eingesetzt werden mußte. In den 1990er Jahren begann ein Umdenken. Mit Flächenstilllegungen und Wiedervernässungen wird seitdem versucht, die Landschaft zu erhalten. Das Moor in seiner ursprünglichen Form ist aber heute nicht mehr vorhanden.“
Anders das etwa zwölf Kilometer entfernte Radmoor zwischen Brundorf und Heilshorn am Rande des Waldes, der „Schmidts Kiefern“ heißt und bis 1994 Teil des deutsch-amerikanischen Truppenübungsplatzes „Garlstedter Heide“ war. Dort gibt es noch so etwas wie eine Moorlandschaft. Das kleine Radmoor heißt so, weil die umliegenden Bauern es sich einst wie eine Torte aufgeteilt hatten, damit jeder sich sein Heiztorf dort stechen und in trockenen Sommern Wasser fürs Vieh holen konnte. Hierher kamen auch immer die Waldtiere zum Trinken, weswegen die Jäger am Rand des Radmoores mehrere Hochstände errichteten. Sie wurden jedoch von meinem tierliebenden Vater, nachdem er dorthin von Bremen „aufs Land“ gezogen war, immer wieder nächtens umgesägt. Als die Bauernhöfe an die Gemeindewasserversorgung angeschlossen wurden, widmete der Gemeinderat die Brachfläche Radmoor zu Wochenend-Siedlungsland um. Die tortenförmigen 1-4 Morgen großen Grundstücke kosteten 1 DM pro Quadratmeter.
Gleich die ersten Käufer zäunten sie ein. Auf diese Weise liefen irgendwann mehr als zwölf Zäune spitzwinklig auf eine Kiefer zu, die in der Mitte des Moores auf einer kleinen Insel wuchs. Manche Wochenendhaus-Besitzer, die das Moor lieber ohne Zäune belassen hätten, lebten jetzt doch auf einem eingezäunten Grundstück, weil ihre Nachbarn links und rechts sich anders entschieden hatten. Zwar blieb das Moor – vielmehr seine Flora und Fauna: Sonnentau und Wollgras, rote Ameisen, Mücken und Libellen – noch nahezu unberührt, aber schon bald fingen die ersten Wochenend-Siedler an, Teile ihres Grundstücks einzudeichen, trocken zu legen, auszuheben und dann mit viel Kalk – gegen das saure Moorwasser – wieder mit Wasser vollaufen zu lassen. Auf diese Weise wollten sie kleine Fischteiche anlegen. Ihre Karpfen und Goldfische überlebten darin jedoch nicht lange. Irgendwann gaben sie auf und und die Moorfauna und -flora nahm langsam wieder Besitz von diesen abgesonderten Teichen. Andere Eingriffe der Moorsiedler hielten sich jedoch: Zuerst das Wiesengras, das einige vor den Veranden ihrer Wochenendhäuser, die sie sukzessive zu Hauptwohnsitzen ausbauten, gesät oder in Soden angepflanzt hatten. Das Gras verdängte langsam die Heide an den Moorrändern und auf den festeren Inseln. Hier gediehen bald auch die Rhododendronbüsche üppig, denn sie mögen sauren feuchten Boden. Auch das von den Fischteich-Erbauern angeschleppte Schilf und die Entengrütze konnten sich gegen die Moorpflanzen behaupten. Zusammen bildeten sie einen so dichten Teppich, dass bald kaum noch freie Wasserflächen übrig blieben, so dass sich die Wasservögel dort immer seltener niederließen. Von den Siedlern wurden die Kreuzottern vertrieben und die Wiesenfrösche verdrängten die seltenen Moorfrösche, die zur Paarungszeit himmelblau anlaufen und bellen statt quaken. Einzig eine alte Ringelnatter blieb standhaft.
Als vom ursprünglichen Radmoor, so wie es die ersten Siedler, die dort ab den Fünfzigerjahren hinzogen, vorgefunden hatten, nur noch wenig übriggeblieben war, begann auch hier ein Umdenken: Man war sich einig, dass die Einzäunungen in den Sechzigerjahren die langsame Veränderung des Radmoors eingeleitet hatten. Dabei gab es sie ab den späten Neunzigerjahren gar nicht mehr; Die Holzpfähle waren im sauren Boden und im Moorwasser stehend schnell verfault und der Draht mit der Zeit verrottet. Die Grundstücksbesitzer hatten ihre Zäune nur nach hinten – zum Wald hin – immer wieder erneuert und verstärkt. Dort führte eine Art Wanderweg entlang und sie wollten keine Neugierigen auf ihrem Grundstück, außerdem hielt der Zaun die Hunde ab – ihre eigenen und die der Spaziergänger. Allerdings auch die Waldtiere, die nun in trockenen Sommern sich andere Wasserlöcher suchten mußten. Die Hochstände entlang ihres Trampelpfades ins Moor fielen mit der Zeit in sich zusammen, auch ohne dass mein Vater sie noch um- oder ansägte. Trotz des zuwachsenden Radmoors war die Pflanzendecke noch immer so schwankend, selbst an den dicksten Stellen, dass ein Moorunkundiger – Fremder – es kaum gewagt hätte, dort spazieren zu gehen oder sich den Wochenendhäusern übers Moor zu nähern. Die Einzäunung der Grundstücke bis zur Kiefer in der Mitte war also mehr als überflüssig gewesen. Sie geschah anscheinend nur aus einem tiefsitzenden Grundbesitz-Sicherungsbedürfnis heraus. Nach getaner Tat stand einer der Nachbarn meines Vaters z.B. auf seiner Veranda – mit Blick auf die Moormitte, und rief ein dreimal kräftiges „Mien Land“ aus. Das wiederholte er fortan mindestens zwei Mal im Jahr: einmal, wenn er im Frühjahr dort hinzog, und dann wieder im Herbst, wenn er zurück in die Stadt ging und sich vom Radmoor verabschiedete.
Wir blieben nach einiger Zeit ganzjährig dort: mein Vater baute das kleine Wochenendhaus schwarz immer weiter aus – und mir auf Pfählen mitten im Moor ein Pfahlhaus als „Kinderzimmer“. Es steht immer noch, man kommt aber nicht mehr über den hölzernen Steg dort hinein: alles ist morsch und eingefallen. Dafür haben sich dort jede Menge Mäuse und Spinnen eingenistet und unter dem Pfahlhaus lebt eine alte Ringelnatter, ob es die selbe ist, die früher dort im Moor lebte, weiß ich nicht.
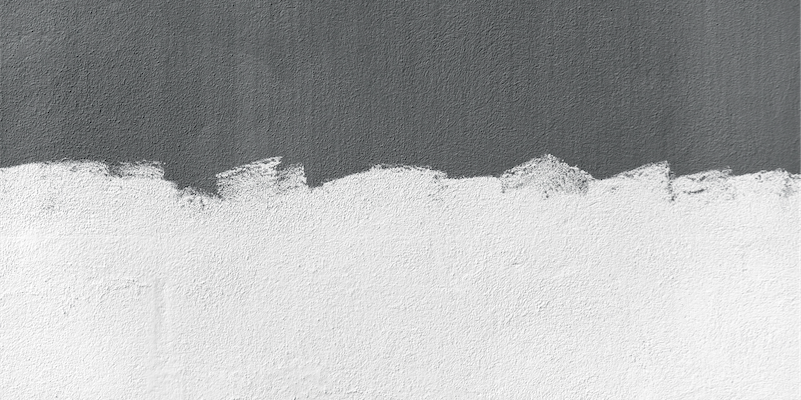



Auf die Frage „Was macht eigentlich Worpswede“ gibt „ad-hoc-news.de“ die Antwort:
«Wir wollen durch unsere museale Qualität neue Touristen nach Worpswede holen», sagte der Geschäftsführer des neugegründeten Worpsweder Museumsverbundes, Matthias Jäger. Derzeit lockt das Künstlerdorf im Teufelsmoor rund 25 Kilometer von Bremen entfernt jährlich rund 280 000 Tagestouristen und etwa 50 000 Übernachtungsgäste an. Worpswede sei verpflichtet, das kulturelle Erbe zu bewahren und ein lebendiges Künstlerdorf zu bleiben, sagte Bürgermeister Stefan Schwenke (parteilos).
Allein rund 6,3 Millionen Euro gibt das Land Niedersachsen aus Fördergeldern des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). «Kein Ort in Niedersachsen erhält eine so hohe Förderung für Kultur und Kulturtourismus», sagte Wanka, die sich im Ort über das großangelegte Zukunftsprojekt informierte.
Je knapp eine Million Euro kommen von der Gemeinde Worpswede und dem Landkreis Osterholz. «Wir stehen angesichts der demografischen und finanziellen Entwicklung in einem Wettbewerb um Einwohner und Besucher», sagte der Osterholzer Landrat Jörg Mielke (parteilos). Insofern sei das Geld gut angelegt.
Die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt:
Die Kulturplaner sitzen unweigerlich in der Zwickmühle: Einerseits muss sich das Künstlerdorf Worpswede verändern, um wieder mehr Menschen für sich zu interessieren. Andererseits zerstört jedes schicke Marketing ein wenig von dem Charme eines Ortes, in dem die Zeit auf wundersame Weise stehen geblieben zu sein scheint.
Zentrales Anliegen muss es dabei sein, nicht einfach glattes Wohlfühl-Ambiente zu installieren, sondern mit Ausstellungsprojekten Inhalte neu zu definieren. Sosehr Worpswede mit seiner Nostalgie auch lockt – die Zukunft muss gewonnen werden.