Seit einigen Wochen sind die Intelligenzblätter voll mit Artikeln über Bauern. In diesem Sommer sind jedoch nicht deren Erntehelfer das Thema, da es wegen der Finanzkrise genügend Saisonarbeitskräfte aus dem In- und Ausland gibt, sondern die Milchbauern.
Darüberhinaus findet man lauter mehr oder weniger launische Texte über Kühe aus aller Welt. In der westfriesischen Hauptstadt Lieuwarden hat man auf dem Marktplatz der Kuh ein Denkmal gesetzt. Sie heißt „Us Mem“ (Unsere Mutter). In Friesland lebte man lange Zeit vor allem von der Rinderzucht und dem Verkauf von Milchprodukten. In der niedersächsischen Gemeinde Emsbüren wurde vor einiger Zeit eine Ausstellung „Kühe find ich gut“ eröffnet. „Die Kuhfladen sind das Fundament unserer Städte,“ meinte der Kuhexperte Dr. Michael Brackmann in seiner Rede.
In Oldenburg wurde kürzlich unter 178 Kühen die schönste gekürt: Sieger wurde die Holstein-Frisian Kuh „Krista“ aus der Zucht von Jörg Seeger aus Großenkneten. „Wir wollen schon Schönheiten, aber natürlich auch Kühe, die einen ehrlichen Job machen und Geld bringen“, erläuterte einer der Preisrichter die Entscheidung. Der Berliner Kurier titelte: „Germany’s next Superkuh“. Im niedersächsischen Tieraltersheim „Hagelhof“ bei Löningen leben u.a. auch Kühe – z.B. Evi: Sie stammt aus dem „Big-Brother-Dorf“. Nach der Show wußte man nicht wohin mit ihr, „und die Teilnehmer der Sendung sammelten Spenden, so dass sie auf dem Gnadenhof unterkommen konnte,“ berichtet die FAZ. Die SZ vermeldet dagegen halbseitig, dass die Kühe in Indien nicht mehr so richtig „heilig“ sind, sondern zunehmend als eine „Plage“ empfunden und aus den Städten gejagt werden.
Die Schweizer Regierung verkündete kürzlich, dass es rund 25.000 Kühe zu viel gäbe in der Schweiz, man wollte sich jedoch nicht durch Schlachtungen reduzieren, sondern durch Geburtenkontrolle.
In einem Kuh-Blog wird erklärt: “ Die Rinder, also auch unser Kühe stammen vom Auerochsen (Ur) ab, sie sind verwandt mit dem Wisent und dem Bison, und die wiederum mit dem Yak sowie mit dem Gemsbüffel (Anoa). Zur selben Familie gehören außerdem noch die Wasserbüffel (Arni) und die Kaffernbüffel.“
Die FAZ interviewte den Leiter des Schweizer „Zentrums für tiergerechte Haltung Tänikon“:
Herr Gygax, sind die Tiere, die in der Forschungsanstalt Tänikon leben, glücklich?
Um Tierwohl zu beurteilen, würden wir dem Tier am liebsten einen Fragebogen geben. Den könnte es ausfüllen und uns verraten, in welcher Umgebung es ihm am besten gefällt.
Leider geht das nicht.
Ja, leider. Um etwas über tierische Emotionen in Erfahrung zu bringen, brauchen wir einfache und direkt einleuchtende Indikatoren. Diese zielen darauf ab, Schmerz, Leid und Krankheit zu vermeiden. Dann gibt es sogenannte Verhaltensindikatoren. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Liegebox von Kühen so konzipiert sein muss, dass die Kuh in gleicher Art und Weise aufstehen kann, wie sie es auch auf der Weide tun würde. Ich finde es sehr gut, dass man seit geraumer Zeit vermehrt darüber spricht, dass es nicht nur wichtig ist, negative Zustände zu vermeiden, sondern den Tieren auch positive Erfahrungen zu geben. Die Forschung steckt hier aber noch in den Kinderschuhen.
Bild der Wissenschaft berichtet: 1998 wurde auf dem Versuchsgut nahe Oberschleißheim bei München die erste Klonkuh Uschi unter dem Mikroskop gezeugt. Wenige Monate später stakste sie im Stall umher. Uschis Enkel weiden heute einige Dutzend Kilometer entfernt in Hilgertshausen, auf dem Gelände der Firma Agrobiogen. Seither hat Eckhard Wolfs Team dort 30 weitere Klonrinder erschaffen. Noch mehr werden folgen.
Den 63 Kühen, die Wolf „Leihmütter“ nennt, werden eines Tages Klonembryonen eingesetzt werden. Diese Embryonen enthalten das Erbgut von anderen Rindern, die Wolf als „Spendertiere“ bezeichnet und die in einem anderen Stall stehen. Den Spendern wird etwas Haut hinter dem Ohr entnommen. Der Zellkern aus den Hautzellen wird mit einer feinen Nadel unter dem Mikroskop herauspräpariert und in eine entkernte Rinder-Eizelle hineinbugsiert. So entsteht ein Klonembryo, eine genetische Kopie des Spendertiers. Noch erkennt man unter dem Mikroskop allerdings nicht mehr als einen Zellhaufen.
Mit diesem Verfahren, dem somatischen Zellkerntransfer, hauchte der Schotte Ian Wilmut 1996 dem Klonschaf Dolly Leben ein und erzeugte damit das erste geklonte Säugetier. Dolly war allerdings schon in jungen Jahren altersschwach und starb 2003 vorzeitig an einer Lungeninfektion. Es gibt keinen gesunden Klon, lautete Wilmuts ernüchternde Bilanz nach diesem und weiteren Klonversuchen. Später gab er das Klonen auf (siehe bild der wissenschaft 4/2008, „Dolly-Vater Wilmut: Klonen war ein Irrweg“).
Umso erstaunlicher ist es, dass Klonen nun die Tierzüchter interessiert. Die Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde hält das Klonen „mittel- bis langfristig für ein wichtiges Instrument, das die vorhandenen Züchtungstechnologien sinnvoll ergänzen kann“, wie sie in einer Stellungnahme vom 18. März 2008 schreibt. „Mittel- bis langfristig“ klingt nach ferner Zukunft. Tatsächlich wird die Zahl der Klonkühe schon heute weltweit auf 4000 geschätzt, die der Klonschweine auf knapp 1500. In vielen Ländern sitzen Unternehmen, zumeist Tierzuchtbetriebe oder Genetikfirmen, die das Klonen längst im Portfolio haben. Sie heißen Cyagra, Viagen, Trans Ova Genetics, Minitube (alle USA) oder AG Research (Neuseeland). Allein die texanische Firma Viagen verkauft jedes Jahr 150 geklonte Rinder an Tierzüchter.
Die Besamungsstation „Bavarian Fleckvieh Genetics“ in Poing bei München hat den Vorzug der bayerischen Standardkuh erkannt. Im Internet kann man erlesenes Fleckvieh bestaunen. Etwa die drei Turbokühe „Marlene“, „Biene“ und „Flittchen“. Von jedem Exemplar können Landwirte und Tierzüchter künstlich befruchtete Eizellen bestellen. Sie entstehen im Reagenzglas. Die Rinder-Eizellen werden mit Sperma künstlich befruchtet. Wohlgemerkt: Bei diesen zweigeschlechtlichen Embryonen handelt es sich nicht um Klone.
Der weltweite Trend geht jedoch in Richtung kontrollierte Fortpflanzung: Der Export der Embryonen von Bavarian Fleckvieh Genetics boomt, seit das Unternehmen 2006 damit begonnen hat. Mehr als 16 000 Rinderembryonen wurden seither isoliert. Der Nachwuchs aus den bayerischen Keimzellen ist bei mehreren Tausend Farmern in allen Erdteilen untergebracht.
Der Vorteil für Bavarian Fleckvieh Genetics: Mit den Embryonen passieren Hunderte von Rindern die Grenzen. Preiswert, platzsparend, scharenweise. Entsprechend viele ausgewachsene Rinder ließen sich kaum an Bord eines Frachters pferchen. Noch dazu bestünde die Gefahr, dass mit ihnen Tierseuchen verschleppt würden. Solche Sorgen sind durch den Embryonenversand ausgeräumt. Am Ziel angekommen, werden die Embryonen in den Bauch heimischer Kühe eingeschleust – ein Verfahren, das als Embryotransfer bezeichnet wird und ebenso wie die künstliche Besamung zu den Techniken der „assistierten Reproduktion“ gehört. Mittlerweile werden in den Industrienationen acht von zehn Rinder mittels assistierter Reproduktion gezeugt.
In Zukunft könnten Tiergenetiker schon am Erbgut erkennen, wie fett oder saftig das Fleisch, wie proteinreich oder mager die Milch oder wie widerstandsfähig ein Rind sein wird. Schon heute kann das Gen DGAT beim Rind darüber Auskunft geben, wie viel Milch die Kuh später produzieren wird. Weitere Gentests für die Tierzucht sollen folgen.
Bis die Visionen der Forscher Wirklichkeit werden, haben Politiker und Bürger aber noch ein Wörtchen mitzureden. Das Europäische Ethikgremium hält Klonen für die Nahrungsmittelversorgung nicht für gerechtfertigt, weil die Tiere dabei leiden: Geklonte Tiere haben häufig ein erhöhtes Geburtsgewicht, einen zu großen Rumpf im Vergleich zu den Gliedmaßen, manchmal Fehlbildungen an Organen sowie Atemprobleme. Häufiger als sonst muss der Klonnachwuchs per Kaiserschnitt geboren werden. Das Europäische Parlament will deshalb das Klonen und den Verkauf von Produkten geklonter Tiere verbieten. „Den Tierschutz kann man im Moment in der Tat anprangern. Über 90 Prozent der Klonembryonen sterben“, räumt Oback ein. Allerdings, so betont er, scheinen die Nachkommen von Klonen gesund zu sein, wenn sie durch Befruchtung gezeugt wurden.
Unbestritten ist, dass Klone keine perfekten Kopien sind: Sie unterscheiden sich von den Spendertieren durch die Aktivität ihrer Gene. Weil die Protein-Baupläne im Erbgut unterschiedlich stark abgelesen werden, bilden sich die Proteine in den Zellen in abweichenden Mengen. Das erklärt beispielsweise, weshalb Copycat – die erste geklonte Katze – ihrer genetischen Vorgängerin nicht besonders ähnlich sah. „Dieser epigenetische Unterschied ist statistisch hochsignifikant. Was er besagt, wissen wir aber noch nicht“, urteilt Wolf. Er ergründet dieses Phänomen derzeit in einer europaweiten Studie. Uschis Enkel gehören zu den Studienobjekten. Trotz der offenen Fragen würde Wolf vor dem Steak eines geklonten Rindes nicht zurückschrecken.
Im April berichtete die F.R. über eine Demonstration hessischer Milchbäuerinnen vor der Wiesbadener Staatskanzlei. Sie forderten einen „Milchkrisengipfel“. Ihr hessischer Verband der Milchviehhalter sieht das Problem im Überangebot an Milch, deswegen fordert er die „Festschreibung einer Höchstmenge, um den Preisverfall zu stoppen“. Die derzeit existierende Milchquote sei zu hoch, man brauche eine „flexible Mengenregulierung“.
Im Juli 2007 hatte die FAS in einem langen Artikel über „Kraftwerke auf dem Melkkarussel“ noch geschrieben: „Glückliche Kühe. Ihre Milch ist so begehrt wie lange nicht.“ Dennoch forderte damals schon der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) mindestens 35 Cent pro Liter, besser wäre aber noch 40 Cent, „um kostendeckend zu wirtschaften“. In dem Artikel kommt außerdem noch der Chef einer Käserei zu Wort. „Sein Fazit: Milch sei knapp und werde es vorerst bleiben.“ Denn „Milch ist eben ein sehr langsames Geschäft“.
Ende Mai 2009 veröffentlichte die FAS einen ganzseitigen Report „Die Milchbauern-Rechnung“ über das Ehepaar Dammeyer, die in Sachsen-Anhalt eine LPG für 200.000 DM kauften. Sie haben 240 Kühe und bestellen 440 Hektar Land, von denen ihnen 100 Hektar gehörten – bis sie es der Bank verpfändeten. „Die Dammeyers erwirtschaften derzeit 13.000 Euro Verlust im Monat, seit der Milchpreis so niedrig ist…Knapp 23 Cent gibt es pro Liter Milch. Vor einem Jahr waren es 50% mehr.“
Die Lage der Milchbauern in der EU ist katastrophal. Die gesunkenen Preise sind für viele Milchbetriebe „akut existenzbedrohend“.Deswegen stellte das European Milk Board (EMB), ein Dachverband von rund 100.000 Milchbauern aus 14 europäischen Ländern, dem EU-Agrarrat und der EU-Kommission ein Ultimatum, das am 30. Juni 2009 ablief. Die Milchproduzenten drohen nun erneut mit einem europaweiten Lieferstreik, sollte sich die Politik den notwendigen Reformen in der Milchwirtschaft verweigern. Das beschlossen sie kürzlich auf einer Tagung in Kappel am Albis in der Schweiz. Zahlreiche Bauern hätten wegen des Verfalls der Milchpreise „Probleme, Essen und Kleidung für ihre Familien zu bezahlen“, erklärte der Präsident des Europäischen Bauernverbandes Padraig Walshe (Irland). Die Preise für Butter seien seit September um über 40 Prozent, die Käsepreise sogar um durchschnittlich 50 Prozent gefallen, sagte Walshe. „Ich selbst muss meine Milch zu Preisen unterhalb der Produktionskosten verkaufen“, erklärte der irische Bauer. In mehreren Städten fanden Bauerndemonstrationen statt.
Die Agrarministerin Ilse Aigner (CSU) will sich jedoch nicht umstimmen lassen: „Wo ich auch stehe, sage ich: Die Milchquote, die einer künstlichen Verknappung der Milchmenge gleichkommt, läuft nach derzeitiger Beschlusslage aus.“ Von „Die Zeit“ wurde sie daraufhin gefragt: „Die Pleite Tausender kleiner Milchbetriebe steht also fest?“ Aigner: „Das ist nicht gesagt. Es überlebt nicht zwingend der größte, sondern derjenige, der sich am besten auf den Strukturwandel einstellt.“
So ähnlich sah das auch die FAZ, Anfang des Jahres bereits, als sie meinte, den Bauern schon mal „Trost“ zu spenden und Mut zu machen: „Die deutschen Landwirte haben offenbar viel gelernt in diesen volatilen [beweglichen] Märkten, sie sind selbstbewusster und unternehmerischer geworden. Dies gilt letztlich auch für die Milchbauern.“
„Das Säemann“, das Zentralorgan der Landarbeiter-Gewerkschaft, die in die IG BAU aufging, meldete gestern: Die 42.000 Arbeitnehmer in der Milch erzeugenden Landwirtschaft in Deutschland sehen einer Gefährdung ihrer Arbeitsplätze entgegen: „mehrere hundert haben wegen der viel zu niedrigen Milchpreise schon ihren Arbeitsplatz verloren“. Die Hoffnung auf neue Zuwachsraten im Absatz durch Erschließung neuer Exportmärkte entpuppe sich „als Märchen“. Die Gewerkschaft fordert ein gemeinsames Vorgehen der „Lieferkette“ – Produzenten, Verarbeiter und Handel.“ Das klingt fast nach der alten Genossenschaftsweisheit: Die Produzentengenossenschaften haben nur dann eine Überlebenschance, wenn sie sich mit Konsumgenossenschaften verbinden/verbünden. Die Milchbauern bilden hierzulande jedoch selten eine Genossenschaft, eher schon die Molkereien und die Handelsunternehmen (Edeka/Rewe/Migros/Coop z.B.). Die Agrargewerkschaft fordert jedoch nicht die Bauern auf, sich genossenschaftlich zu organisieren, sondern die Molkereien und den Handel, „über ihren Schatten zu springen“.
Der Deutsche Bauernverband, der größten Interessensorganisation der Bauern, will zur Verbesserung seines Ansehens seine Öffentlichkeitsarbeit ausbauen – und sich dabei u.a. auf die taz stützen, wie spiegel-online am 13.Juni berichtete. Der Grund dafür ist laut Spiegel die Unzufriedenheit der Milchbauern mit dem Verband. Diese wurde in der Vergangenheit und wird immer noch dominiert von Großagrariern nicht selten adliger Herkunft. Und sie sind auch die größten Profiteure von den EU-Subventionen, die zumeist nach Hektar gezahlt bzw. wenn es sich um Quoten handelt zugeteilt werden. Nicht umsonst weigert sich Bayern, die Subventionsempfänger im Freistaat namentlich zu nennen, wie es die EU fordert.
Einige Jahre nach der Wende herrschte scheinbar Frieden im Bauernverband. Da öffneten sich riesige neue Möglichkeiten im Osten – für unternehmerisch denkende Landwirte und landwirtschaftliche Unternehmen. Vorher hatte es nur ein stilles langsames Bauernsterben/-legen gegeben, indem immer mehr kleine Höfe aufgegeben wurden, wobei das „zu klein“ immer größer wurde – „wachsen oder weichen“ lautete dafür die EU-Formel. Die wachsende Nachfrage nach biologischen Landwirtschaftsprodukten ließ dann daneben eine weitere Existenzmöglichkeit entstehen. Für diesen Wachstumsmarkt galt jedoch bald das selbe: Wachse oder weiche! Auch im Handel, wo immer mehr der in den Siebzigerjahren gegründeten „Bioläden“ den „Bio-Supermärkten“ und Bioprodukt-Regalen in den normalen Läden bzw. Supermärkten weichen mußten.
Nun begehrt die Basis des Bauernverbandes auf: die Milchbauern, die bisher alles richtig,. d.h. mitgemacht haben: Immer mehr Kühe aufgestallt, immer aufwändigere Technik angeschafft, immer mehr Land dazugepachtet haben. Kürzlich demonstrierten sie vor der Zentrale des bayrischen Bauernverbands. Sie forderten u.a. den Rücktritt des derzeitigen DBV-Präsidenten Gerd Sonnleitner. Er besitzt einen 100-Hektar-Veredlungsbetrieb bei Passau, der laut Wikipedia seit dem 13. Jahrhundert in Familienbesitz ist.
„Vor allem das Thema Milch spaltet den Verband nachhaltig,“ meint Ulrich Jasper dessen linke „Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft“ (und ihrem Organ „unabhängige Bauernstimme“) sich seit den Siebzigerjahren in Opposition zum Bauernverband befindet. Auf der letzten Seite hat dort der schleswig-holsteinische Biobauer Matthias Stührwoldt eine Kolumne. Einmal berichtete er darin über seine „Lieblingskuh“ namens Schwarzer, der in Sachen „flache Lsktationskurve“ niemand etwas vor macht: „Hätte ich nur Kühe so wie Schwarzer – niemals hätte ich ein Problem mit der Überlieferung meiner Milchquote!“ Schwarzer ist die Kuh der Zukunft: Sie bringt zwar kaum Milchgeld ein, auf der „Euro-Tier“ wird sie jedoch mit Sicherheit Sieger werden, „wenn die Kuh mit der niedrigsten Leistung und dedr flachsten Kurve prämiert wird!“
Mit der Wende entstand neben der „Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft“ noch eine weitere Opposition – im Osten, die sich jedoch erst von ihrem Okkupationsschock erholen und wieder neu sammeln mußte.
Rückblickend stellte sich die Situation dort damals folgendermaßen dar:
Der Dorf- und LPG-Korrespondent der Neuen Deutschen Bauernzeitung der DDR, Werner Wühst, riet davon ab, auf den „Bauerntag 1990“ nach Suhl zu fahren: Dort würden nur noch die zweit- und drittklassigen Bauernfunktionäre der DDR ein letztes Mal um ihre Fortexistenz ringen, aber das sei alles vergebliche Mühe. Nach dem Auftritt des westdeutschen Bauernpräsidenten von Heeremann, der den LPGen bloß noch den Charakter einer „Übergangslösung“ zubilligte und überdies meinte, die einstmals Bodenenteigneten müßten ihr Land wieder zurückbekommen – wurde jedoch auch den ganzen anwesenden LPG-Vorsitzenden klar, daß sie nun anfangen mußten, für sich und ihre Leute zu kämpfen. Zumal dann auch noch ihre eigene Partei, die Bauernpartei der DDR, sowie ihr eigener Verband, die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB), kurz darauf zum Feind überliefen, d.h. sich der CDU anschlossen bzw. dem westdeutschen Bauernverband und den Raiffeisenorganisationen. Auch die Bauernzeitung verhandelte dann mit einem Münchner Agrarzeitschriftenverlag und währenddessen ging bereits – in vorauseilender Anpassung – ein Ruck durch die Redaktion. Werner Wühst hielt das nicht länger aus und kündigte: „Jede Woche über Gülle zu schreiben, das ist für mich keine Perspektive!“
In der DDR gab es über 2000 landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, daneben noch volkseigene Güter und einige andere landwirtschaftliche Staatsbetriebe. Die LPG-Mitglieder wurden zwar in der Regel zum Eintritt gezwungen, brachten ihre Flächen jedoch nur zur Nutzung ein, sie blieben ihr Eigentum. Deswegen konnte der kommunistische bayrische Abgeordnete und Bauer Richard Scheringer auch noch in den Sechzigerjahren darauf bestehen: „Daß die Kommunisten den Bauern das Land wegnehmen wollen, ist einfach nicht wahr!“ Etwa zur gleichen Zeit ging man jedoch umgekehrt – im „Forschungsbeirat für Fragen der Wiedervereinigung“ in Bonn – davon aus, daß die Einheit, „wenn sie morgen käme“, es zwingend erforderlich mache, daß die LPGen der auch in Ostelbien dann wieder gültigen „marktwirtschaftlichen Ordnung“ zuliebe aufgelöst werden müssten, nach einer Phase von „Übergangsgemeinschaften“, wobei das Prinzip „Rückgabe vor Entschädigung“ gelten sollte. Dabei würde es zu Arbeitslosigkeit kommen, deswegen empfahl der Forschungsbeirat schon damals, Vorsorge für einen reibungslosen Übergang von landwirtschaftlicher zu anderer Beschäftigung zu treffen – also Massen-Umschulung und ABM. 1965 war der Wiedervereinigungsplan der Bundesregierung fertig – und landete erst einmal in der Schublade.
Darüberhinaus ging man dann im Westen 1989/90 davon aus, wegen der „Zwangsmitgliedschaft“ in den LPGen würden ihre Mitglieder sich nach der Wiedervereinigung mit ihrem Land sowieso mehrheitlich wieder selbständig machen wollen und damit würde sich das „LPG-Problem“ quasi von selbst erledigen. Dies war jedoch ein Irrtum! Obwohl die Neu- und Wiedereinrichter großzügig gefördert wurden.
Der Rechtsanwalt und LPG-Umwandlungsberater Dr. Geyer führte am 4.5.1996 anläßlich einer Besichtigung der umgewandelten Groß-LPG in Golzow durch den Hildesheimer Rotary-Club aus: „Nach der Wende standen die LPGen als eigentumslose Großbetriebe da, wären sie in westliche Rechtsform umgewandelt worden, hätten sie die von ihnen bearbeiteten Flächen in der Regel pachten können, da die Landeinbringer mit Kleinflächen zumeist keine Betriebe wieder aufbauten. Für die Landwirtschaftspolitik gegenüber den LPGen war die ideologische Losung von Kiechle, einem Kleinbauern aus dem Allgäu, maßgebend: ‚Die LPG ist ein Musterbeispiel sozialistischer Schlampwirtschaft‘. Dabei war die LPG als genossenschaftliches Gebilde noch eine Restinsel gelenkt-privaten Wirtschaftens im Sozialismus.
Deshalb zielte das Landwirtschaftsanpassungsgesetz darauf ab, möglichst die LPG nicht umzuwandeln, sondern zu liquidieren. Zu den Initiatoren zählten viele Alteigentümer, jedoch kein einziger (der in der Wende zumeist neugewählten) LPG-Vorsitzenden. Bei der Liquidation einer LPG konnte man billig Gebäude und Gerätschaften erwerben sowie billig Land pachten, was viele westliche Neueinrichter auch taten. Wurde die LPG dagegen umgewandelt, musste sie zunächst auch für sämtliche Alt-Schulden geradestehen. Das Landwirtschaftsanpassungsgesetz gab – entgegen dem LPG-Recht – den Mitgliedern ein Kündigungsrecht, verbunden mit einem Abfindungsanspruch in Geld für 30 Jahre fiktive Pachtzeit. Da außerdem jeder Landeinbringer bei Eintritt in die LPG – vor rund 30 Jahren – einen Inventarbeitrag zu leisten hatte, 500 Mark/DDR je Hektar Fläche – weitgehend in Naturalien, musste auch dieser Beitrag jetzt von der LPG vergütet werden – und zwar 1:1 in DM (!), obwohl der Westen sonst die Ostmark nie so eingeschätzt hatte. Gleiches galt für die rückwirkende Verzinsung von drei Prozent. Für die Landeinbringung, also bei etwa 50 Bodenpunkten und 20 Hektar ergibt sich folgende Leistung: 2 DM x 50 Punkte x 20 Ha x 30 Jahre = 60.000 DM plus 10.000 DM Inventarbeitrag plus ca. 10.000 DM Verzinsung = 20.000 DM, insgesamt 80.000 DM. Geht man bei 6.000 Ha Nutzfläche der LPG von 300 Abfindungsberechtigten aus, so entspricht das einer Abfindungssumme von 24 Mio. DM – in bar. Es liegt auf der Hand, dass kein Betrieb so etwas leisten konnte. Zusätzlich wären auch noch Arbeitnehmerinteressen zu bedienen gewesen.
In der Regel war also eine solche LPG schon zu liquidieren, wenn auch nur 10 oder 15 Prozent ihrer Mitglieder kündigten und die Abfindungsansprüche verlangten. Die dann folgenden Liquidationen führten in der Regel allerdings dazu, dass die Aktiva verschleudert wurden, die Liquidatoren und Gutachter Geld verdienten, die Alt-Schulden voll auflebten und die Anspruchsberechtigten herausgingen. Hätte der westliche Gesetzgeber gerecht sein wollen, so hätte er die ostdeutsche Landwirtschaft rechtlich umgewandelt und nicht zerstört. Nahezu alle LPGen wären sanierbar gewesen, hätte man lediglich eine Umwandlung in westliche Rechtsform vorgeschrieben. Dann hätte auch jedes Mitglied seinen gerechten Anteil an dem Unternehmen erhalten und diesen frei am Markt verkaufen können. Der Verkaufserlös des Anteils hätte sich nach der Ertragskraft des Anteils gerichtet. Es hätte nur ein Gesellschafterwechsel stattgefunden. In vielen Fällen ist es jedoch den Beratern und Leistungen der LPGen gelungen, den Mitgliedern die verheerende Folge der Kündigung durch Gruppen klar zu machen. Dies geschah u.a. auch in der LPG Golzow.“
Die nach der Wende noch nicht sofort auf die neue „Deutungsmacht“ (W. Thierse) eingewestete „Wochenpost“ berichtete bereits Anfang 1991 von einem schnellen Neueinrichter: den Augsburger Großpächter Albrecht von Stetten, der mit nagelneuen „MB-Tracs“ bei einer LPG in Queis aufgetaucht war: Der Genossenschaft fehlte bald nicht nur das Geld zu solch Edelgerät, sie gab überhaupt entmutigt auf – und „von Stetten nutzte die Gunst der Stunde, um auf dem fruchtbaren Lößboden einen großstrukturierten Ackerbaubetrieb einzurichten. Dazu bietet er den Landeinbringern Pachtverträge auf 12 Jahre pro Ha 300 DM Zinsen jährlich. Rund 4500 von 5800 Ha hat er auf diese Weise zusammengebracht. ‚Gut Landsberg‘ heißt der neue Großbetrieb. Früher hieß die LPG ‚Thomas Müntzer‘.“
Sogar noch schneller als von Stetten in Sachsen, war der Sohn des ehemaligen mecklenburgischen Gutsbesitzers in Alt-Pannekow, von Paetow, zur Stelle. Zu BRD-Zeiten bewirtschaftete er einen Hof bei Kiel. Bereits im Dezember 1989 besuchte er den väterlichen Gutshof, der Teil einer LPG geworden war. Anfang 1990 lud von Paetow mehrere LPG-Vorsitzende des Kreises zu sich nach Kiel ein, wo er sie üppig bewirtete. Anschließend enthüllte er ihnen auf einer Kreidetafel die neue „landwirtschaftliche Marktwirtschaft“, in dem er ihnen darlegte, was fortan Einnahmen und Ausgaben sowie der Gewinn waren. Heute bewirtschaftet er 900 Ha eines Staatsgutes im benachbarten Schlutow (bei Gnoien), die er gerade von der BVVG zu kaufen beabsichtigt, ebenso den väterlichen Gutshof. Er sitzt mittlerweile auch im Gemeinderat von Schlutow, wo einer seiner Gegenspieler – ein ehemaliger LPG-Vorsitzender – zum Bürgermeister gewählt wurde.
Anders die Familie von der Osten, die nach Mecklenburg-Vorpommern (zurück) ging, um dort vor allem die „Adelstraditionen im modernen Gewand – mit westlichen Werten“ wiederzubeleben. Dazu wollen sie jedoch vor allem ihre Ländereien wiederhaben, den Gutshof hatten sie bereits gekauft. Derzeit kämpfen sie vor allem um das Schloß, das der Bürgermeister und ein LPG-Vorsitzender jedoch lieber an einen Hotelbetreiber verkaufen möchten. Nach Auskunft einer Journalistin haben sich die von der Osten geradezu in ihre altneue Scholle verkrallt.
Wegen der allseits von interessierten Westkreisen unterstützten „Begehrlichkeiten“ von LPG-Landbesitzern waren die reichsten LPGen schon bald am massivsten gefährdet. Und von dubiosen Beratern bzw. Anwälten geradezu umzingelt. Eine dieser wohlhabenden LPGen gab es auch im Berliner Umland: die Tierproduktion in Fresdorf – mit einer nagelneuen Milchviehanlage. Diese gehört heute einem Viehzüchter aus dem Rheinland. Eine arbeitslose Melkerin erklärte das Scheitern ihrer Muster-LPG so: „Als die Wende kam, haben wir gedacht, jetzt können wir richtig loslegen. Aber von unserem Vorsitzenden kam nichts, gar nichts“. Ein früherer Produktionsleiter, der von neuen Besitzer mitübernommen wurde, meint: „Das hätten wir auch alleine so hingekriegt“. Sein alter LPG- Vorsitzender, Jürgen Krebs, äußerte jedoch bereits am 10. August 1990 – gegenüber der Frankfurter Rundschau: „An der Liquidation führt kein Weg vorbei – mit sechs Mio. DM Altschulden.“ Heute erklärt Krebs, der inzwischen Bürgermeister in Wildenbruch ist: „Es fehlte uns damals auch an den intellektuellen Kapazitäten in der LPG.“ Als Bürgermeister hat er jedoch gerade mit durchgesetzt, dass an Stelle der dortigen früheren LPG „Fortschritt“ in Wildenbruch Berlins reichster „Golf- und Country-Club“ entstehen konnte. Für ihre 230-Hektar- Golfanlage am Seddin-See mußten die Investoren F. von Bismarck und A. Siddig 164 Grundstücke von Altund Neu-Eigentümern erwerben.
Bei land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen ist die BVVG meist Verkäuferin. Von ihr erwarben jüngst z.B. der Herzog von Mecklenburg, Christian Ludwig und Franz-Albrecht Metternich-Sandor Prinz von Ratibor und Corvey einen 1.000-Hektar-Forst bei Raben-Steinfeld, und der Fürst von Isenburg-Birstein 850 Hektar Wald bei Schleiz-Langenbuch. Von einer Bevorzugung des Adels beim Verkauf des ostdeutschen Waldes könne jedoch überhaupt keine Rede sein, meinte dazu der Geschäftsführer der BVVG, Ranz- Ludwig Graf Stauffenberg, der zugleich Vorsitzender des westdeutschen „Verbands der (meist adligen) Waldbesitzer“ ist. Mindestens in der BVVG-Geschäftsstelle kann man von einer Bevorzugung des Adels sprechen, als es darum ging, die wichtigen Posten dort zu besetzen: an fast allen Türschildern prangen Adelsnamen.
„‚Adligsein‘ verlangt eine besondere Gesinnung, eine geistig-seelische Haltung, die als Eigenschaft vor allem dem Adel zugehörig sein sollte, wenn seine Mitglieder im heutigen Staatsleben eine Funktion ausüben sollen“, schrieb der Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg im Nachwort eines Buches zur 1000jährigen Geschichte des oberhessischen Fürstengeschlechts Ysenburg- Büdingen, dessen vorletzter Sproß, Fürst Friedrich-Otto, gleich nach der Wende von der Treuhand sein altes Porzellanwerk in Lichte mit 120 Mitarbeitern wiedererworben hatte. Sein ältester Sohn, Erbprinz Wolfgang- Ernst, ließ die Firma 1993 jedoch in Konkurs gehen: „Das ist wie mit dem Beschneiden der Bäume – das alte Holz muß weg“, erklärte er dazu in bester Forstbesitzermanier der FAZ.
Bei einer ähnlichen Charade sprach jedoch selbst diese Zeitung wenig später von einem „Raubritterspiel“: Gemeint war damit die Politik des Düsseldorfer Fürsten von Putbus auf Rügen: Erst erschlich dieser sich das Vertrauen der Rüganer, dann wurde er dort CDU-Abgeordneter, um mit seinen „Agenten“ die jetzt auf seinen 1945 enteigneten Ländereien Lebenden unter Druck zu setzen: Bei Zahlung „erklecklicher Summen“ versprach er ihnen, auf die Restitution zu verzichten: Viele gingen darauf ein, weil sie die sofortige Räumung nach seinem möglichen Sieg vor Gericht befürchteten. Die Greifswalder Verwaltungsrichter kamen jedoch kürzlich zu dem Urteil, daß die Enteignung des Fürsten gültig bleibt. Da kam Freude auf Rügen und in ganz Mecklenburg-Vorpommern auf. Sie hält immer noch an.
Im Gegensatz zum Putbusser Fürsten bekam der Historiker und Polizeipräsident von Potsdam, Graf von Schwerin, seinen umfangreichen Landbesitz im Norden zurück, weil sein Vater von den Nazis als Widerständler hingerichtet wurde. Sogleich schoß sein Sohn jedoch über den Pudding – und versuchte auch noch ein winziges Kulturzentrum dort auf dem Klageweg in seinen Besitz zu überführen – mit der Begründung, daß der Besitzer, ein Berliner Künstler, es zu spät – nämlich erst nach Verabschiedung des so genannten „Modrow-Gesetz“ – erworben habe.
Das Info der Umweltbibliothek „Telegraph“ berichtet in seiner Mai-Ausgabe 1996, dass sogar schon westdeutsche Bürger mitunter – vom adligen genius loci im Ostelbien inspiriert – Junker-Attitüden entwickeln: Im mecklenburgischen Strasburg ist es der schwerreiche Fabrikant H. Redwisch, der sich dort mit seinen Kontakten zur BVVG und einigen maßgeblichen Leuten im Kreis zum „neuen Gutsherr“ mausern konnte, der mit „gütiger Hand“ über alles wacht, und als Jäger und Waldpächter selbst im Dorf inzwischen von seinem Schußrecht Gebrauch macht, wenn die „Problemlage“ es erfordert.
Anders die Familie von Wulffen, gebürtig aus dem sächsisch-anhaltinischen Wulffen bei Köthen, wo sie seit der Wende um ihren Schloßbesitz kämpft, den der Gemeinderat partout nicht herausrücken will, weil er mit dem Besitzer des Hansa-Parks in Sierksdorf an der Ostsee ins Geschäft kommen möchte. Hanno von Wulffen wanderte 1992 verbittert in die USA aus und denkt dort jetzt sogar – laut FAZ – darüber nach, „die deutsche Staatsbürgerschaft zugunsten der amerikanischen aufzugeben. Er sei vom Vaterland tief enttäuscht. Das kommunistische Unrecht von einst werde heute durch die deutsche Justiz positiv sanktioniert. Seine Bekannten und Freunde in Amerika seien beunruhigt, wenn er von den Geschehnissen im postkommunistischen Deutschland berichte, das Eigentümern auch nach dem Mauerfall keine Rechtssicherheit biete.“
Bei der überaus erfolgreichen LPG-Nachfolge-Großlandwirtschaft Golzow (bei Strausberg) ist es der Landadlige von Wittig, der sich – ebenso wie die LPG als bisherige Pächterin – mit einem Konzept um den Kauf von 300 Hektar Ackerland bewarb: Obwohl seine Bewirtschaftungspläne geradezu kindisch waren im Vergleich zu denen der LPG, gab die BVVG ihnen den Vorzug. Die LPG klagte dagegen. Erst einmal bestritt sie erfolgreich, dass von Wittig überhaupt Wiedereinrichter sei. Schließlich schlug das Gericht als Vergleich vor, die Wirtschaftskonzepte von der brandenburgischen Landesboden-Kommission begutachten zu lassen – das lehnte von Wittigs Anwalt jedoch ab – aus gutem Grund.
Ganz ähnlich sieht der Fall bei Witilo von Lochow aus, der ebenfalls über die BVVG an die Landwirtschaftsflächen der Kümmritzer Agrar GbR (bei Guben) heranzukommen versucht. Von Lochow will nicht einmal auf seinem zukünftigen Landbesitz im Osten wohnen, er will es nur haben. Auch dieser Streit beschäftigt noch immer die Gerichte. Anwalt der von Lochows ist Fritz Lohlein, der überaus aktiv im Beitrittsgebiet ist, u.a. auch als Liquidator. Als solcher wird er jetzt jedoch gerade in Brandenburg aus einem Landwirtschaftsbetrieb nach dem anderen rausgeschmissen. Laut FAZ gehört „der Bonner Spezialist Lohlein ebenso wie der Tübinger Dozent Winfried Schachten, der Münchner Anwalt Rainer Stumpf und der Steueranwalt Werner Kuchs zu einer kleinen Gruppe von westdeutschen Anwälten, die allen Widrigkeiten zum Trotz wenigstens denen zu helfen versuchen, die den Mut aufbringen, vor Gericht zu gehen. Jeder von ihnen hat inzwischen hunderte von Fällen zu bearbeiten.“
Der fast ganzseitige FAZ-Artikel haute auf die selbe Pauke wie ein halbes Jahr später der im Osten noch berüchtigter gewordene „SPIEGEL“-Aufmacher – über das anhaltende Unwesen der „roten Junker“ und ihre „alten Seilschaften“, die nicht einmal vor „Erpressung und Nötigung“ zurückschrecken, beim Versuch, auf Kosten von Alteigentümern und Wiedereinrichtern die „alten Strukturen“ zu erhalten. Und das auch schon fast geschafft haben: „Die Landwirtschaft gehört zu den Branchen in den neuen Ländern, die den Übergang in die Marktwirtschaft am besten bewältigt haben.“ (So Bundeslandwirtschaftsminister Jochen Borchert – zitiert in der FAZ, für die das freilich „wie ein Hohn“ klingt.)
In der darauffolgenden Zeit versuchten FDP-Teile im Osten und die Lohlein-Truppe wiederholt, juristisch gegen die großen Agrar-Betriebe vorzugehen, indem sie Unregelmäßigkeiten bei der Umwandlung anprangerten. Diese Gefechte wurden auch in der fast zur Gänze westdeutschen Konzernen gehörenden ostdeutschen Presse um so heftiger ausgetragen, je näher das Ende der Frist zur Einreichung von Ansprüchen gemäß des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes näher rückte: der 1.1.1997. Ein halbes Jahr vorher, im Juni 1996, waren die an der Zerschlagung der ostdeutschen Großlandwirtschaft anscheinend besonders interessierten Bauernverbände Baden-Württembergs und Bayerns endlich so weit: Unter Federführung von Wolfgang Schäuble legten sie einen Novellierungsentwurf zum Landwirtschaftsanpassungsgesetz vor. Die wesentlichen „Knackpunkte“ darin sind: 1. Die Abfindungsansprüche verjähren erst nach zehn Jahren (im Jahr 2001). 2. Landwirte-Verbände mit mehr als zehn Mitgliedern erhalten Klagebefugnis. 3. Das Gericht bestellt einen gemeinsamen Klagevertreter für alle Mitglieder auf Kosten der Agrar-Gesellschaft. 4. Wird das Eigenkapital in einer Klage verbindlich für alle Verfahren festgesetzt, wobei Rückstellungen nur bedingt berücksichtigt werden. 5. Es erfolgt eine Bekanntmachung im Bundesanzeiger darüber. 6. Alle geschlossenen Abfindungsverträge können widerrufen werden.
Dr. Geyer und sein Partner Rechtsanwalt Prinz, die bei über 100 Umwandlungen berieten, sahen sich nach Bekanntwerden dieses Novellierungsentwurfs (im „Agrarrecht“ 7/96), der noch in dieser Ernteperiode durchgesetzt werden soll, zu größter Aktivität und Eile gezwungen. Etliche LPGen sowie Anwaltskanzleien schlossen sich ihren Initiativen an, die auf einen Kampf-Verband für die ostelbischen Großlandwirtschaften hinauslaufen. Bereits am 16.8.96 fand die Gründungsversammlung dafür statt. In ihrem Rundbrief schrieben sie: „Eine Meute von Interessenvertretern steht bereit, das Streit- und Abwicklungsgeschäft mit Leben zu erfüllen, das heißt mit Massenklagen. Außerdem erhält jeder LPG-Nachfolger einen Volkstribun als Gegenregierung. Dagegen und gegen andere Benachteiligungen der Großlandwirtschaft etwa der Berufsgenossenschafts-Beiträge hilft nur eine Maßnahme: Die Gründung eines Verbandes der Großlandwirtschaften, der als politisches Sprachrohr dient … Es ist höchste Zeit zum Handeln.“
Am 23. August 1996 trafen sich rund 60 Vorsitzende von LPG- Nachfolgeorganisationen in der Heimvolkshochschule Jagdschloß Glienicke. Eingeladen hatte die vor allem mit Problemen industrieller Agrarbetriebe befaßte Berliner Anwaltskanzlei Dr. Geyer & Partner, der es dabei um die Gründung eines ostdeutschen Verbands für Großlandwirtschaften ging. Anlaß dazu war die jüngst von Schäuble (CDU/CSU) und von Solms (FDP) vorgelegte 4. Novelle zum Landwirtschaftsanpassungsgesetz, die noch in diesem Jahr verabschiedet werden soll. Nach Einschätzung von Dr. Geyer, aber auch fast aller anderen Teilnehmer an der Diskussion in Glienicke ist diese Gesetzesänderung, so sie den Bundestag passiert, geeignet, den umgewandelten LPGen „endgültig den Todesstoß zu versetzen“. Die Großlandwirtschaften sind heute nicht selten die einzigen nennenswerten Arbeitgeber in ihren Regionen. Durchweg sind sie Mitglied im deutschen Bauernverband und gehören dort auch aufgrund der von ihnen bewirtschafteten Großflächen zu den Hauptbeitragszahlern.
Dennoch kann bisher von einer Zurückweisung der 4. Novelle des LwAnpG durch den Bauernverband keine Rede sein, im Gegenteil: gerade die schwäbischen und bayerischen Familien- Landwirtschaften befürworten eine endgültige Zerschlagung der ostdeutschen Großlandwirtschaften aufs heftigste, und mit ihnen die dortigen Landes- Bauernverbände. Im Kern geht es in der Novelle darum, dass die LPGen in ihren DM- Eröffnungsbilanzen nach der Wende ein zu niedriges Eigenkapital ausgewiesen hätten und demzufolge ihren ausgeschiedenen Mitgliedern zu geringe Abfindungen zahlten. Zwar haben verschiedene Gutachter im Auftrag von Landwirtschaftsgerichten wiederholt das Gegenteil festgestellt: dass nämlich „die Wertansätze für das bewegliche und das unbewegliche Anlagevermögen“ von den LPGen in Umwandlung eher zu hoch angesetzt wurden – und damit die Höhe der Barabfindung für ihre ausscheidenden Mitglieder eigentlich sogar niedriger hätte ausfallen müssen, aber im Westen geht man nach wie vor davon aus, dass sich die ostdeutschen Rechtsnachfolger der LPGen, 2680 insgesamt, auf Kosten ihrer einst zwangskollektivierten Mitglieder bereichert haben – und quasi nur deswegen noch existieren (können).
Im Zusammenhang der Beantragung von Fördergeldern aber auch wegen Beschwerden von ehemaligen LPG-Mitgliedern wurden von den obersten Landesbehörden in den fünf neuen Ländern bis jetzt insgesamt 1825 ostdeutsche Agrarunternehmen überprüft. Dies ergab jüngst eine Kleine Anfrage der SPD an die Bundesregierung. Achtzehn Betriebe wurden anschließend von der Förderung ausgeschlossen, zuvor waren bereits neun Betriebe liquidiert worden – nachdem es bei ihrer Umwandlung zu registergerichtlichen Beanstandungen gekommen war. Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Zahl der von Agrar- Förderung ausgeschlossenen Betriebe höher als 18 ist, weil einige Unternehmen nach einer ersten Ablehnung keine weiteren Anträge mehr einreichten, bleiben doch weit über 1500 vollständig überprüfte ostdeutsche Großlandwirtschaften übrig, deren Umwandlungs- und Abfindungspraxis unbeanstandet blieb – und die sich nun schon seit sieben Jahren in der Marktwirtschaft behaupten, d.h. zum Nutzen ihrer Gesellschafter, Mitarbeiter und Landverpächter wirtschaften.
Allein in Brandenburg entstanden seit 1990 301 Genossenschaften, 470 GmbHs, neun Aktiengesellschaften und 32 Personengesellschaften. Diesen Betrieben soll es mit der erneuten Novellierung des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes endgültig an den Kragen gehen. Dazu wurde auf der Versammlung in Glienicke erklärt: 1. Die Verlängerung der Verjährungsfrist ist zwar zu begrüßen; 2. Aber prozeßinteressierte Anwaltskanzleien können stets eine solch kleine Anzahl ehemaliger LPG- Mitglieder finden, die an einer Klage um höhere Abfindungen interessiert sind. Auch wenn sich diese in vielen Fällen als „Seifenblase“ erweist – die Kosten hätten in jedem Fall die beklagten Agrar-Gesellschaften zu tragen, die dabei ständig eine Art „Gegengeschäftsführung“ im Haus dulden müßten; 3. Die Verlagerung des Kostenrisikos stellt die Grundsätze der prozessualen Risikotragung auf den Kopf; 4. Mit der Bekanntmachung im Bundesanzeiger hört die Kreditfähigkeit der Großbetriebe auf – und damit droht ihnen die Liquidation. Zudem sind sie damit faktisch von staatlichen Förderungen und insbesondere vom Flächenerwerbsprogramm ausgeschlossen. Dies bringt die ehemaligen Gutsbesitzer und meist adligen Alteigentümer in Vorteil.
Der Leipziger Anwalt Andreas Felgentreff, dessen Kanzlei im Vorstand des neuen Verbands der Großlandwirtschaft vertreten ist, berührte in seiner Kritik der Novelle, die in der neuesten Ausgabe der (ostdeutschen) „Briefe zum Agrarrecht“ abgedruckt wurde, auch den Aspekt der öffentlichen Meinungsbildung über die LPG-Nachfolgeorganisationen. Sie stellen beinahe den einzigen Bereich der einstigen DDR-Wirtschaft dar, der noch existiert, der nach wie vor in der Hand ostdeutscher Kader/Manager und dazu noch erfolgreich ist. Die Großlandwirtschaften hätten eigentlich Vorbild für die fast ausschließlich durch EG-Subventionen am Leben erhaltenen bäuerlichen Kleinbetriebe in Westdeutschland sein müssen, politisch-ideologische und revanchistische Bestrebungen haben das bis jetzt jedoch verhindert.
Felgentreff schreibt: „Es muß herausgefunden werden, wie groß der Kreis der Unzufriedenen im Territorium ist und worauf diese Unzufriedenheit zurückzuführen ist. Bei all den Diskussionen zur neuerlichen Novelle zum Landwirtschaftsanpassungsgesetz darf nicht vergessen werden, dass die nunmehr verstärkt aufgebrochene Wunde nicht ausschließlich auf den Entwurf zurückzuführen ist. Seit längerem schon wird immer wieder behauptet, die Rechtsnachfolgebetriebe hätten Millionenbeträge beiseite gebracht. Sollte es nicht zur Verabschiedung der Gesetzesnovelle kommen, wäre es trotzdem zweckdienlich, diesen Gerüchten nachzugehen. Die Versuche, die durchgeführte Vermögensauseinandersetzung mit den Mitgliedern in einem negativen Licht darzustellen, werden nicht aufhören. Gerade mit der neuerlich einsetzenden Diskussion ist es an der Zeit darüber nachzudenken, in welcher Form die Rechtsnachfolgebetriebe unter Beweis stellen können, dass der doch im wesentlichen erreichte Rechtsfrieden in den Dörfern nicht durch Betrug und Verlogenheit zustande gekommen ist, sondern im Ergebnis eines breiten Dialogs und der Findung hunderttausender einvernehmlicher Kompromißlösungen erreicht wurde.“
Die alt-neuen oftmals wissenschaftlich geschulten Landwirte, denen die umgewandelten LPGen nicht gehören, sondern die sie nur für ein Geschäftsführergehalt bis zu ihrer Verrentung leiten, haben immer noch Schwierigkeiten mit der West-Öffentlichkeit. Sie stehen nicht selten der PDS nahe, was zwar ehrenvoll ist, aber ihrer gesellschaftlichen Anerkennung nicht gerade förderlich. Zudem warten selbst viele ihrer Vor- und Nachliefer-Betriebe oftmals nur darauf, dass sie scheitern. Auf der Verbands-Gründungssitzung in Glienicke meinte der aus Westdeutschland stammende Dr. Geyer – „als Rotarier und CDU-Mitglied“ scherzhaft: „Der Klassenfeind schläft nicht!“ Dieser hat sich neben der 4. Gesetzesnovelle auch noch die Treuhand-Bodenverwertungs- und Verwaltungs-GmbH (BVVG) ausgedacht, die den land- und forstwirtschaftlichen Flächenverkauf auf Grundlage eines Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzes (ELAG) in Ostdeutschland durchführt. Grundvoraussetzung für den Erwerb durch Pächter ist, dass am 1. Oktober 1996 ein mindestens sechsjähriger Pachtvertrag über die treuhandeigenen Flächen besteht. Die Pächter müssen zudem einer der folgenden Gruppen angehören: „Wiedereinrichter“, die ortsansässig ihren ursprünglichen Betrieb wieder eingerichtet haben, dazu gehören aber auch „Alteigentümer“, die zu Recht enteignet wurden. „Neueinrichter“, die am 3. Oktober 1990 ortsansässig waren. Ferner „Agrar-Genossenschaften, -GmbHs, -AGs, sowie -GmbH & Co KGs“. Dann einzelne „Gesellschafter“ dieser juristischen Personen und „Alteigentümer ohne Pachtvertrag“, die jedoch nur Vorrang bei der Flächenauswahl haben.
Obwohl der BVVG-Geschäftsführer Graf Stauffenberg meint, von einer Bevorzugung des Adels beim Flächenverkauf könne keine Rede sein, behaupteten einige sächsische Agrar-Genossenschaftsvorsitzende auf dem Glienicker Treffen: „Bei uns sind sie bereits voll da!“ Aber auch dort, wo sie noch nicht zum Zuge gekommen sind, ergreifen Politik und Presse aus dem Westen allzu gerne flankierende Maßnahmen zu ihren Gunsten. Es gibt bereits mehrere „Nebenerwerbslandwirte“ mit bis zu 200 Hektar im Osten. Nicht selten sind es Wirtschaftsanwälte oder ähnliche Erfolgsmenschen, die am Wochenende mit ihren jungen Bräuten da draußen Junker spielen.
Im Anschluß an die Gründungsversammlung des „Vereins für Großlandwirtschaften“, bei der – vor allem gegenüber dem Bauernverband – Wert auf die Feststellung gelegt wurde, dass man „sich nicht abspalten, sondern spezialisieren“ wolle, traten etwa ein Dutzend Vorsitzende von Rechtsnachfolgebetrieben dem Verein bei. Laut Dr. Geyer geht es in Zukunft vor allem darum, „die Basis zu verbreitern“, wobei auch an die Mitarbeiter, Verpächter und Zulieferer der Agrarunternehmen, bis hin zu den Banken, gedacht ist.
Um die Interessen dieser Basis nicht nur lobbyistisch, sondern auch politisch zu vertreten, gründete er wenig später noch eine regelrechte Partei. Damit hatte er aber weniger Erfolg. Mit den Jahren wurde es auch ruhig um den Verein für Großlandwirtschaften. Nicht wenigen gelang es jedoch, sich zu konsolidieren und zu expandieren. Man nennt sie noch immer LPGen in ihren Regionen, leider unterscheiden sie sich beim Wirtschaften immer weniger von den Großagrarbetrieben im Westen, wird behauptet.
Und nun versuchen es also die Milchbauern – fast EUweit. Der bäuerliche Mittelstand gewissermaßen. Die Intelligenzblätter geben ihnen publizistischen Flankenschutz. Die FAZ ehrte gestern ganz groß den Bauern-Historiker Le Roy Ladurie aus der französischen „Annales“-Schule – und insbesondere dessen Buch über das häretische Pyrenäendorf „Montaillou“, das einst sogar die Inquisition überstand.
Dieser Bestseller trug mit dazu bei, dass die Lage der Bauern in Frankreich nie ganz aus dem Blickfeld geriet. Nicht nur gründete sich hier aus dem Widerstand gegen die Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen eine linke Bauerngewerkschaft – ihr Sprecher ist der „Bauernrebell“ José Bové. Die Süddeutsche Zeitung berichtete – unter der Überschrift „Wo Bauer war, wird Bauer sein“ über die Sehnsucht der Franzosen nach dem Land – in Zeiten der Krise. Belegt wird das von der SZ mit dem Hinweis, dass 1,5 Millionen Franzosen Jäger sind. Ihre Interessen vertritt eine 1989 gegründete eigene Partei „Jagd, Angeln, Natur und Tradition“. Unter ihrem Präsidenten Saint-Josse, „ein Krautjunker französischer Prägung“, errang die Partei bei den Europawahlen 1999 1,2 Millionen Stimmen – und damit sechs Mandate im Europaparlament. Dieses Wahlergebnis verdankte sie laut SZ „vor allem dem Protest gegen eine europäische Richtlinie zum Schutz der Zugvögel, gegen die bereits 1998 rund 150.000 Menschen in Paris demonstrierten“. Sie wollten weiterhin Singvögel jagen.
Die FAZ lobte im Mai August Strindberg als Experte der französischen Landwirtschaft. Der nordische Dramatiker bereiste Frankreichs Dörfer 1886. Er erlebte die Bauern als eine „Art Rebellen der Scholle gegen den die Welt bedrohenden Zangenbiss von Kapitalismus und Sozialismus“. Die FAZ zitierte dazu Thomas Steinfeld, der in einem Nachwort zu der 2009 erschienenen Strindberg-Reportage „Unter französischen Bauern“ schrieb: „August Strindbergs Parzellenbauer lebt in einer im Grund gutmütig verfassten Anarchie.“ Seine Reportagen sind auch kulturgeschichtlich interessant, weil sie den „Wechsel von der Agrar- zur Kommerz- und Industriegesellschaft aus unmittelbarer Anschauung nachempfinden lassen. Sie sollten einführende Pflichtlektüre sein für wissenschaftliche Monumente wie Eugen Webers ‚Peasants into Frenchmen‘.
Erwähnt sei dazu auch noch ein Aufsatz von Timothy Mitchell über die ägyptische Landwirtschaft: Sein Text „Das Objekt der Entwicklung“ erschien gerade auf Deutsch in dem Reader „Vom Imperialismus zum Empire“, den der Afrikanist Andreas Eckert und die Ethnologin Shalini Randeria herausgaben, um zu dokumentieren, wie sich die Globalisierung aus Sicht der Dritten Welt darstellt. In Ägypten waren es Weltbank und IWF, die aus einem Lebensmittel-Exportland mit Hilfe ihrer Agrarexperten ein Getreide-Importland machten, wobei aus dem riesigen „Freiland-Gewächshaus“ des Nil-Schwemmlandes armselige Weiden für deutsche Rinderzuchten wurden – und zigtausende von Fellachen in die Städte abwandern mußten. Seitdem sprechen die westlichen Experten dort malthusianisch-zynisch von „Überbevölkerung“.
Neu herausgegeben wurde auch Knut Hamsuns Weltbestseller „Hunger“ aus dem Jahr 1899. Ein vom Land in die Stadt Vertriebener wird an der Armut langsam irre. Keine Anklage wie bei Ibsen oder Zola – gegen das Gesellschaftssystem, das so etwas zuläßt, schreibt die FAS im Mai, sondern aus der Sicht des „hungernden Helden“ erzählt. Schließlich gibt dieser seine bohèmehaften Künstlerträume auf – und wird Seemann.
Der spätere Bundeskanzler Willy Brandt entfaltete 1935 im norwegischen Exil eine regelrechte Pressekampagne gegen den allzu Nobelpreisträger und Schollenverherlicher Hamsun. Es ging Brandt dabei um den im KZ inhaftierten Carl von Ossietzky, der als Kandidat für den in Oslo vergebenen Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden war. Im Zusammenhang damit legte Willy Brandt sich mit dem norwegischen Nobelpreisträger Knut Hamsun an, der als Nazisympathisant gegen die Verleihung des Preises an Ossietzky polemisierte. In Norwegen geht man heute davon aus, dass Hamsuns Frau eigentlich die viel schlimmere „Nazisse“ war. Dazu hat zuletzt Klaus Theweleit Erhellendes beigesteuert.
Nach ihm hatte der alte nordische Dichterkönig die junge Schauspielerin Marie Andersen, die er in einem Theatercafé kennen lernte (sie sollte in einem Hamsunstück die Hauptrolle spielen), dazu gebracht, ihn stattdessen zu heiraten, auf einem einsamen Hof jenseits des Polarkreises auf einer Halbinsel als Bäuerin zu leben und dort seine Kinder groß zu ziehen: „Sie sollte sich also opfern“, schreibt Theweleit, während der Mann – in einer Pension sitzend „Segen der Erde“ schrieb, „die Hymne auf das karge Nordland mit seinen gequälten Leuten, die ihm den Nobelpreis einbringt“. Zwar versprach Hamsun daraufhin seiner Frau, dass sie bald wieder in die Stadt – in „eine Luxusvilla“ gar – ziehen würden, stattdessen kaufte er ihr jedoch einen noch „größeren Hof“, wo er sich noch seltener blicken ließ, weil er in Oslo Anschluß an die „Weltliteratur“ gefunden hatte – und dort im „Gauklermilieu“ verkehrte. Von seiner Frau verlangte er, dass sie weiterhin der „Bühne/Öffentlichkeit“ fern blieb. Nach einer gelungenen Psychoanalyse – wegen einer Schreibblockade 1926, bringt er auch Marie Andersen dazu, sich ebenfalls auf die Couch zu legen, beim selben Analytiker – damit sie „sexuell aufwache“. Dort leistet sie jedoch erfolgreich Widerstand. Schließlich trennen sich die beiden. Sie rächt sich später, in dem sie des deutschen Führers „erste Braut“ in Norwegen wird.
Zwar konnte Hamsun dann aufholen, in dem er Goebbels während einer Deutschlandreise seinen Nobelpreis vermachte, aber in der Öffentlichkeit ist sie fortan die dominierende. Zu Ossietzky erklärte Hamsun öffentlich, dass er in einem deutschen Konzentrationslager doch gut aufgehoben sei. Selbiges wünsche er im übrigen auch einigen norwegischen Pazifisten – wie „unseren lieben Kullmann“. Dieser, ein Marineoffizier, wurde dann tatsächlich von den Deutschen verhaftet – und kam in ein KZ, wohin insgesamt 9000 Norweger verschleppt wurden, 1400 von ihnen starben dort, auch Kullmann. 1940 veröffentlicht Hamsun einen „Aufruf“, der ihn acht Jahre später wegen Kollaboration mit dem Feind vor Gericht bringt: „NORWEGER! Werft die Gewehre fort und geht wieder nach Hause. Die Deutschen kämpfen für uns…“ Das Gericht hält ihn, gestützt auf die Aussagen seiner von ihm getrennt lebenden Frau, für „Altersgeistesschwach“ und verurteilt Hamsun nur zu „einem Lebensabend in Armut“.
Nach seinem letzten Buch „Auf überwachsenen Pfaden“ schreibt er Marie Andersen einen Brief – und sie kommt zurück, pflegt ihn bis zu seinem Tod. Nach dem Krieg und während seines Prozesses waren viele Norweger zum Stadthaus von Knut Hamsun gepilgert und hatten ihm wütend und enttäuscht seine Bücher in den Vorgarten geworfen. Die Diskussion über Hamsun und die „Landesverräter“ flammte Mitte der Neunzigerjahre noch einmal wieder auf, als der norwegische König den Hof der Hamsuns im Norden, Hamaröy, besuchte.
In Deutschland wurden kürzlich mehrere junge Schriftsteller, unter ihnen auch Wladimir Kaminer, über Hamsun und „Hunger“ interviewt.
Vielgelobt wurde das 2009 erschienene „Kuh-Lexikon“ von Florian Werner: „Die Kuh. Leben, Werk und Wirkung“. Der Autor bedauert darin, dass die Kuh ähnlich wie die kolonisierten Völker „immer nur als gesichtsloser Vertreter einer bestimmten Rasse oder Rolle wahrgenommen wird: der Sklave, Der Schwarze, die Kuh. An anderer Stelle zitiert er Nietzsche, der sich um die Verrinderung der Menschen sorgte, jedoch meinte, „der Fortschritt in Richtung Kuh ist noch aufzuhalten. Und zwar dadurch, dass man den Versuch unternimmt, „die Kuh…den echten menschlichen Idealen anzupassen“. Florian Werner zieht daraus den Schluß, dass es nun höchste Zeit sei, „die Kühe wie Menschen zu behandeln“.
In den letzten Tagen gab es mehrere Rezensionen, u.a. in FAZ und SZ, über das „Provinzlexikon“ von Henning Ahrens, in dem Begriffe aus seinem (modernen) Provinzumfeld von A-Z beschrieben oder wenigstens angerissen werden. Die FAZ nennt dieses West-Buch eine „intelligente Kulturkritik“. Unter dem Stichwort „Kuh“ steht da: „Je schonender, sanftmütiger und freundlicher die Kuh behandelt wird,“ heißt es in „Das Reich der Bäuerin“, „umso stärker und gleichmäßiger schießt die Milch in das Euter ein.“
Daneben gibt es noch ein „Relaxikon“ aus dem Osten: „Der Große Stockraus“ von Henner Reitmeier, das bisher vom Feuilleton ignoriert wird. Auf meine Frage, ob auch Kühe darin vorkommen, antwortete mir der Autor: Leider nein, aber dafür findet sich in dem Buch etliches über Landkommunen.
Beiden Autoren ist gemeinsam, dass sie, auf dem Land lebend, alle Dinge und Begriffe auflisteten, die ihnen wichtig erschienen bzw. zu denen ihnen etwas einfiel. Dabei geriet ihnen „die große Welt“ jedoch nicht aus den Augen und aus dem Sinn, so dass man dabei von einem „Klein-Werden Schaffen“ eigentlich nicht reden kann. Insbesondere Henner Reitmeiers „Relaxikon“ erinnerte mich an Olga Tokarczuks neuestes Buch „Unrast“, das zwar im Gegensatz zum „Großen Stockraus“ vom Nomadismus der Autorin „lebt“, aber eine ähnliche Erzählhaltung einnimmt.
Während Olga Tokarczuk Dies und Das als immer wieder „Fremde“ verfremdet, wenn man so sagen darf, werden die Seßhaften, besonders die auf dem Land lebenden, vor „Fremden“ gewarnt – in der Zeit vom 10.Juni: „Vorsicht, Fremde!“ Es geht in dem langen Artikel um „Invasive Alien Species“, die – nicht zuletzt wegen der Klimaerwärmung – über die deutsche Scholle herfallen. Genannt werden der sibirische Marderhund (mit dem in Polen schon die Fremdenverkehrsämter werben), den Riesen-Bärenklau, das Grauhörnchen, das beifußblättrige Traubenkraut Ambrosia, das bereits Schäden in Höhe von 73 Millionen Euro anrichtete und die Tigermücke. Darüberhinaus wird demnächst auch der Schakal in Mittel- und Nordeuropa erwartet. Ich sah neulich in der Uckermark italienische Grillen sowie mehrere der fast ausgestorbenen Laubfrösche.
Noch ganz andere Tiere erwartet man im Osten durch die Wiedervernässung ganzer Landstriche. Im „Sumpfgebiet Rhinluch“ bekämpfen sich deswegen Naturschützer und Bauern – ähnlich wie im Nationalpark Wattensee zuvor. Ein Hauptanziehungspunkt im Rhinluch ist das „Storchendorf“ Linum, das von Touristen geradezu belagert wird. Dort befindet sich auch die Naturschutzstation Rhinluch, wo man dafür sorgt, dass sich immer mehr Kraniche, See- und Fischadler in der Region niederlassen – mit zunehmendem „wieder vernässen“, wie die Zeit am 15. Mai schreibt. Daneben werden dort „Brutflöße“ für Flussseeschwalben angelegt und der Biber als „Verbündeter! der Naturschützer“ umhütet.
„Die brandenburgischen Landnutzer wollen jedoch trockenlegen statt vernässen.“ Der Anbau von Raps, Mais und Weizen lohnt sich wieder, „nicht zuletzt als Folge der Biospritwelle“. Der Leiter der Naturschutzstation, Norbert Schneeweiß, befürchtet bereits, „diese Intensivierung droht unsere Fortschritte im Amphibien- und Reptilienschutz zunichte zu machen, und zwar in ganz Brandenburg.“ So sieht die Zukunft der Sumpfschildkröte z.B. „keineswegs rosig“ aus. Neben den expansionsfreudigen Landwirten fürchtet der Naturschützer u.a. auch die Vermehrung der einst eingeschleppten Waschbären, die den Schildkröten die Beine abfressen.
Die SZ lobte Mitte Juni die Verwaltung des kroatischen Naturparks „Lonjsko Polje“: Dort „gedeihen Pflanzen und Tiere gerade deswegen, weil der Mensch eingreift“. Er ist sozusagen das Zünglein an der Waage, dass die einmal erreichten Populations-Balancen quasi fixiert – und zwar in Kroatien durch Abschüsse. Der Chef der Naturparkverwaltung hat zwei Jahre bei der Bundeswehr gedient und leitet seine Einrichtung militärisch. „Optimieren statt maximieren,“ ist sein Credo. Um als „Unesco-Weltkulturerbe“ anerkannt zu werden, muß er ein Dilemma lösen: „Den strengen Naturschützern ist hier zu viel Kultur, und den Denkmalschützern ist es zu viel Natur.“
In einer Rezension des Buches von David Blackburn „Die Eroberung der Natur“, in dem es u.a. um die Trockenlegung des Oderbruchs geht, schrieb Neal Ascherson in der „Le Monde Diplomatique“:
„Grüne Aktivisten, aber auch Regierungen, die sich für die ‚Entwicklung‘ der natürlichen Ressourcen verantwortlich fühlen, stoßen bei ihrem Bemühen um die ‚Rettung der Umwelt‘ immer wieder auf irritierende Fragen. Denn es ist keineswegs eindeutig, wie die Beziehung der Menschen zu ihrer Umwelt zu verstehen sei. Es gibt ja kaum noch Zeitgenossen, die sich auf den Wortlaut der Schöpfungsgeschichte berufen, wonach der Mensch zur Herrschaft über alle Kreatur bestimmt sei, also ‚über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht‘. Längst vorüber ist auch die Selbstgewissheit der Totalitarismen des 20. Jahrhunderts, die sich auf die ‚ehernen Gesetze der Geschichte‘ beriefen, um die technische Umgestaltung der Landschaft und der Biosphären zu rechtfertigen – unter Berufung auf den menschlichen Fortschritt, der doch nur eine neue Variante des Anspruchs auf ‚Herrschaft‘ über die Natur darstellt. Solche alten Überzeugungen leben im Verborgenen fort und beeinflussen nach wie vor unser Denken.
Das gilt auch für die Vorstellung, dass der Mensch zum ‚Treuhänder für die natürliche Schöpfung‘ bestellt sei. Das klingt nach guten Absichten und bewirkt in der Praxis häufig Positives, und doch drückt sich darin der alte anmaßende Anspruch der menschlichen Gattung auf den Status eines über der Natur stehenden Souveräns aus. Seltsamerweise klingt dieses Dogma auch in gewissen Aspekten des ‚grünen‘ Denkens wieder an, wenn es nämlich behauptet, die Menschen seien für alles verantwortlich, was im Meer und in Seen und Flüssen ’schiefgeht‘, zum Beispiel für die Vermehrung oder das Verschwinden einzelner Tier- und Pflanzenarten und für Veränderungen von deren natürlichen Lebensräumen.
Damit will ich keineswegs verharmlosen, wie stark das Handeln der Menschen in den letzten zehntausend Jahren zur Verwüstung unseres Planeten und zur Vernichtung vieler Formen des Lebens beigetragen hat. Doch die Formel von der ‚totalen Verantwortung‘ des Menschen bleibt einer anthropozentrischen Philosophie verhaftet. Sie beinhaltet die realitätsferne Vorstellung eines ‚Gleichgewichts der Natur‘ – als ob in der Umwelt zu Lande wie zu Wasser eine konstante und unveränderliche ökologische Balance herrsche, die nur durch die Intervention der Menschen ‚aus dem Lot‘ gebracht würde.“
Ein Beispiel ist der Kuckuck: Früher befürchteten einige Ornithologen, dass er, der seine Eier gerne in die Nester von Rotkehlchen und Rohrsängern legt, diese langsam aber sicher dadurch selten werden läßt. Nun ist es anscheinend jedoch umgekehrt: Infolge der Klimaerwärmung kommen die Singvögel immer früher zurück nach Europa bzw. ziehen sich nur noch nach Südeuropa zurück im Winter, so dass sie immer früher mit Nestbau und Aufzucht beginnen, während der Kuckuck bisher noch bei seinem alten „Zeitplan“ geblieben ist – und dadurch immer öfter zu spät kommt, um noch seine Eier von z.B. Rotkehlchen und Rohrsängern ausbrüten lassen zu können. „Der Kuckuck wird selten“, heißt der diesbezügliche Zeit-Artikel vom 25.Mai. „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben,“ titelte ein ornithologisches Fachblatt.
Im März meldete „Die Zeit“: „Anleger sollen in das Überleben einzelner Arten investieren können, fordern Naturschützer.“ Der Artikel über das Für und Wider dieser Ami-Idee hieß „Die Specht-Aktie“. Ähnlich ruft auch der Verein „Rettet den Regenwald“ mit seinem Organ „Regenwald-Report“ immer mal wieder seine Mitglieder bzw. Leser zum Kauf von Regenwald-Grundstücken auf, um die darin lebenden Menschen, Tiere, Pflanzen und Pilze sowie Mikroorganismen vor dem Ausgerottetwerden zu bewahren. Zwar ist es fraglich, ob die betreffenden Regierungen nicht im Zweifelsfalle, d.h. wenn erhebliche Gewinne zu erwarten sind, die Regenwald-Privatgrundstücke einfach enteignen, aber in den USA hat dieses Vorgehen unter ökologisch denkenden Millionären und Milliardären sowie bei einigen reichen Naturschutzorganisationen bereits seit längerem Schule gemacht.
Hierzulande gibt es noch eine andere Möglichkeit: über EU-Subventionen:
Der philosophisch ausgebildete Biologe Andreas Weber schreibt in seinem zweiten Ökologie-Buch „Bio-Kapital“, in dem es noch einmal um die Versöhnung von „Wirtschaft, Natur und Menschlichkeit“ geht, über einige „Orte“ an denen dieses „neue Denken bereits Früchte trägt“ und stellt „Visionäre“ vor, die es „entwickeln, und Möglichkeiten zu einem neuen, sinnerfüllten Leben ausloten.“ Als erstes hat er dafür zusammen mit dem Biologen Edgar Reisinger von der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie den einst von den Nazis auf ABM-Basis angelegten Truppenübungsplatz Ohrdruf besucht. „Wenn man es richtig anfängt, dann könnte man hier einen zweiten Krüger-Nationalpark erschaffen,“ meinte Reisinger. Noch üben dort jedoch gelegentlich die Militärs.
Deswegen gehen die beiden ins nahe Crawinkel, wo „bereits heute Geld damit verdient wird, dass Schönheit und Ursprünglichkeit zunehmen“ – und zwar vom Landwirt Heinz Bley: ein Wessi, der nach der Wende die örtliche LPG übernahm, sein Betrieb ist jetzt eine „Agrar GmbH“. Das ehemalige Ackerland (6000 Hektar) wandelte er in eine „Weidewildnis“ um, auf der heute 500 Pferde und 1500 Rinder grasen. Pro Jahr und Hektar bekommt Bley dafür 300 Euro von der EU als Zuschuß, daneben vermarktet er Bio-Rindfleisch und organisiert Kutschfahrten für Öko-Touristen. Damit kommt er gut hin. Ich kenne dort in der Gegend einige Weidewildnis-Wirtschafter, die das nicht schaffen: Sie haben aber auch nur 60 bis 80 Hektar jeweils. Auf 6000 Hektar EU-subventioniertem Territorium könnte wahrscheinlich jeder „humanistisch wirtschaften“…
Im Mai kam „Die Zeit“ noch einmal auf das o.e. Thema zurück: „Artenschutz lohnt sich. Pflanzen und Tiere liefern Wirkstoffe für Arzneimittel.“ Aber die „Entwicklungsländer wehren sich gegen die Beutezüge der Pharmaindustrie. Der Zeit-Artikel hieß „Die Patentierung der Natur“ und befaßte sich mit den juristischen Lösungen zwischen den Pflanzen-Privatiseuren in den Industrieländern und einigen afrikanischen Staaten, die aus den Pflanzen am Liebsten selbst Medikamente machen würden, um sie anschließend in die Industrieländer zu exportieren.
In Island hatte man die Fangquoten der Fischtrawler privatisiert, mit der Folge, dass es nach einem regen Quotenhandel einige in spanischen Villen lebende „Quotenkönige“ gab. Nun – in der Krise – möchte Island die Fangquoten-Inhaber wieder enteignen. Die waren anfangs z.T. zwar ebenfalls gegen die Quote, jetzt möchten sie sie jedoch nicht verlieren – und wehren sich gegen die Enteignung. Die FAZ findet das Regierungsvorgehen „nicht gerecht“, wie sie im Juni schrieb. Island war zwar nicht in der EU, um sich nicht in seine Fischereipolitik reinreden zu lassen, zahlte aber trotzdem brav die EU-Beiträge. Und nun – in der Krise – möchte man doch EU-Vollmitglied werden – was die FAZ gestern höhnisch kommentierte.
Wegen der selben Wirtschaftskrise bleiben immer mehr Bundesbürger im Land während ihrer Urlaubszeit. Gestern warb die FAZ mit einem großen Artikel für „Ferien auf dem Bauernhof“, was angeblich immer mehr „Anhänger“ finde. Zwei Drittel der Urlauber sind „Stammgäste“ auf den Höfen, wo die Kinder spielen und die Eltern im Stall mithelfen können, wird dazu der Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft für Urlaub auf dem Bauernhof zitiert. Viele Gäste kommen auch im Winter, etliche Betriebe haben sich spezialisiert – z.B. Pferdehöfe auf Reiturlaub oder Winzer auf Weinproben, Milchbauern auf Mitmelken usw.. „Dass es die Städter vermehrt aufs Land zieht, kann am Ende nicht nur für die Urlauber – ein Kuheuter hat im übrigen vier Zitzen – und die Bauern Vorteile haben,“ so endet der FAZ-Artikel. Der Autor meint, auch für die Nutztiere springt dabei einiges raus: Sie werden angeblich besser behandelt, wenn die Hofgäste sie einmal als Urlaubsattraktion angenommen haben. Es prallen da dann wahrscheinlich früher oder später zwei verschiedene Arten von Tier- und Pflanzenverwertung aufeinander. Das kann ein heiterer Urlaub auf dem Land werden.
Auf einen ähnlichen Aufprall kam gestern die SZ zu sprechen – in der Prosa des „einzig wirklichen Arbeiterschriftstellers der DDR: Wolfgang Hilbig„, dessen „Erzählungen und Kurzprosa“ gerade veröffentlicht wurden. Er arbeitete als Heizer und schrieb aus der Perspektive der Arbeiter, die er in einem unausgetragenen Konflikt mit dem Ingenieur sah: „Es ist ein Kampf zwischen der Sprache des Ingenieurs und der Sprachlosigkeit der Arbeiter“ – in der DDR. Dieser Kampf bestand auch noch zwischen dem Ingenieurdenken und den Landarbeitern bzw. LPG-Bauern. Letztere wehrten sich sprachlos, indem sie, wie Hilbig schreibt, zwar nur zwei Stunden arbeiteten, aber acht bezahlt bekamen. Der englische Filmemacher der Working-Class, Ken Loach, scheint auch die Kühe zur Arbeiterklasse zu zählen – oder jedenfalls drehte er 1967 einen Film mit dem Titel „Poor Cow“. Bei einem Bauern an der Mosel geriet ich als landwirtschaftlicher Betriebshelfer einmal in einen regelrechten Milchkrieg, der über die Euter ausgetragen wurde. Er hatte seinen alten Kuhstall mit Fördergeldern erweitert und umgebaut: Statt auf Stroh sollten die Tiere in Zukunft auf Beton-Spaltenböden stehen. Ich half ihm beim Bau. Die Unzufriedenheit der Kühe steigerte sich in dem neuen Stall von Tag zu Tag: Es kam zu immer mehr Euterverletzungen. Wir nähten ihnen schließlich Euterhalter zum Schutz. Diese wurden von den Tieren aber immer wieder abgerissen, so daß wir ständig die Konstruktion verbessern mußten. Wochenlang waren wir fast mit nichts anderem als mit dem Widerstand der Tiere beschäftigt. Dabei war uns klar: Sie werden auf immer größere Michleistungen hin gezüchtet, zudem wird ihre Hochleistungzeit immer kürzer, so daß ihr ganzes schnelles Leben vom Euter abhängt, dessen Krankheiten sich denn auch fortwährend mehren – und die deswegen das einzige sind, was den Bauern wirklich noch interessiert. Ansonsten mehren sich auch auf dem Land die Fälle von „Tierverwahrlosung“, ein Tatbestand, den es früher dort nicht gab.
Der Arbeiter-Widerstand bestand auf der LPG „Florian Geyer“ in Saarmund z.B. in Folgendem:
Wenn ich einmal die Stallgasse zu gründlich fegte, sagte mein Kollege Günther: „Mach es nicht zu gut, daß stecken sich nur die da oben wieder an den Hut!“ Einmal meinte ich zum Essensfahrer, er solle doch ein bißchen Putz mitbringen nächstes Mal – beim Ausmisten mit dem Traktor sei an der Stalltür ein großes Stück Putz abgeplatzt. Das könnten wir nebenbei nach und nach wieder ausbessern. „Bist Du verrückt!“ schalt mich während der Kaffeepause im Frauenruheraum mein Kollege Michael, „solche Arbeiten vorzu schlagen – dafür ist die Maurerbrigade zuständig!“ „Aber die gibt es doch gar nicht mehr, die wurde doch auf die Stallbrigaden aufgeteilt, das weißt du am Besten, du warst doch selber Maurer,“ entgegnete ich. „Das ist aber nicht unser Problem,“ beendete Michael das Gespräch, „da müssen die da oben sich einen Kopf drüber machen.“
Während Ernst Jünger die Verwandlung der deutschen Arbeiter in Soldaten besang, wunderte sich der Kriegskorrespondent Curzio Malaparte in den sowjetischen Kolchosen über die dort gelungene Umschmiedung der Bauern zu Soldaten. Was hier in der DDR später zu der Gegen-Formel „Schwerter zu Pflugscharen“ geriet, daß begann also mit einer Proletarisierung der „LPG-Bauern“ – mit „Ernte-Kampagnen“ und „Ernteschlachten“ etc.. Der Chefredakteur des „Sonntag“ dichtete einst als Redakteur einer Dorfzeitung „Mit Teterower Schwung in die Frühjahrsbestellung!“ „Unser“ LPG-Vorsitzender war einst in der Kampagne „Kader aufs Land“ mobilisiert worden – und dann hier bei Babelsberg hängengeblieben. Auch die LPG-Barackenarchitektur mit ihrem hohen Zaun drumrum und den Desinfektionsbecken an den Ein- bzw. Ausfahrten erinnerte stark an militärische Einrichtungen, wenn nicht gar an Konzentrationslager.
Auch die Haltung der meisten Mitarbeiter in der Rinderbrigade ähnelte der von Akkordarbeitern bzw. von dienstverpflichteten Soldaten. Ständig mußten die Rinder umgetrieben werden – wobei elektrische Schlagstöcke zum Einsatz kamen. Im Potsdamer Schlachthof erzählte mir später jemand, daß sie früher bei den Rindern oft ganze Partien Leder rausschneiden und wegschmeißen mußten, weil sie voller Blutergüsse waren: Die Ausstattung der Tierproduktions-Genossenschaften mit elektrischen Schlagstöcken sollte dem abhelfen. Von einem DDR-Agrar-Funktionär erfuhr ich noch später, daß wir im falschen Objekt gearbeitet hätten: In den stadtnahen LPGen – mit großer Fluktuation – sei das „bäuerliche Bewußtsein“ leider schon so gut wie verschüttet.
In den West-Landwirtschaften schien mir dies primär ein „Eigentümer-Bewußtsein“ gewesen zu sein, das dann doch einen pfleglicheren Umgang mit den Tieren gebot. Oder jedenfalls besteht der Idiotismus des Landlebens dort anders als im Sozialismus fort. Hier schimpfte ich z.B. einmal gegenüber dem Traktoristen Egon laut über das nasse, teilweise schon schwarzvergammelte Stroh, das er aus einer unabgedeckten Feldmiete holte und daß kaum mehr zum Einstreu zu gebrauchen war: Nach 20 Minuten standen die Rinder schon wieder im Mist. Sowohl im alten Anbindestall des ehemaligen Gutshofs als auch in den neuen Freilaufställen, einzig in dem einst von Chruschtschow durchgesetzten „Rinderoffenstall“ konnten sich die Tiere auch im nassen Stroh noch einigermaßen wohl fühlen. Dort gab es auch die wenigsten Erkrankungen. Egon entgegnete mir daraufhin: Beim Ausmisten mit dem Traktor sei gerade das nasse Stroh sehr praktisch – und daher dem trockenen vorzuziehen.
In Westdeutschland war es dagegen mehrmals vorgekommen, daß ein Spediteur mit LKW und großem Anhänger zu einem Bauern gekommen war, bei dem ich gerade arbeitete, um Stroh für holländische Viehzüchter einzukaufen. Wir stapelten den Lastwagen äußerst sorgfältig mit den Ballen voll – trotzdem fehlten am Ende immer etliche hundert Kilo am Gewicht. Kurzerhand schloß der Bauer einen Schlauch an und bespritzte die Strohballen so lange mit Wasser – bis der Transport das nötige Gewicht hatte, und der Fahrer zufrieden abfuhr. Auch dieser marktwirtschaftlich rationale Irrsinn geht auf Kosten der Tiere.
Ähnlich in Ost und West war auch der Zwang zu ihrer immer schärferen Vernutzung – aufgrund des Verbraucher-Drucks, allzeit preiswertes Fleisch zu bekommen. Die Kippstelle hierbei, das war vielleicht der „Sonntagsbraten“ in den Arbeiterhaushalten, von dem der Ernährer jedesmal das größte Stück abbekam. Seitdem will jeder am Tisch in den Genuß kommen – und das täglich. Die Landwirtschaft, der Viehhandel und die Schlachthöfe vernutzen seitdem die Rinder, Schweine und Hühner wie am Fließband. In Amerika bereits so schnell, daß das Fleisch dieser junggeschlachteten Tiere noch „geschmacksneutral“ ist – und deswegen extra „Flavour“ zugesetzt werden muß, zudem wird es so portioniert, daß jeder Hinweis auf seine tierische Herkunft getilgt ist. Dazu trägt schließlich auch noch die Beleuchtung der Fleisch-Verkaufstresen bei. Eine US-Ökologin entwarf für die dortigen Schlachthöfe gerade eine neue sprialförmige Rampe, auf der die Tiere zum Töten hochgetrieben werden – dabei sollen sie angeblich bis zum letzten Moment nicht mitbekommen, was mit den vor ihnen passiert ist. Also wir sollen nicht mehr wissen, was für Tiere wir essen und die sollen nicht mehr merken, daß wir sie essen!
Selbst als Landwirtschaftshelfer bekommt man das nicht mit: Sie kommen entweder nach einiger Zeit in die Hauptmast oder große Speditionsfirmen holen sie ab und transportieren sie irgenwohin. Dafür füllen sich die Ställe dann mit neuen Tieren. Unter den schon etwas älteren Kälbern gibt es immer ein paar, die man besonders sympathisch findet. Solche suchte zu DDR-Zeiten gelegentlich das Studio Babelsberg sich in den Ställen „unserer“ LPG aus: Sie sollten in Kinderfilmen mitspielen – und wurden daraufhin für die Dauer der Dreharbeiten dem Studio zur Pflege überlassen. Anschließend waren sie jedoch derart „verzogen“, daß sie in der LPG ständig Prügel bezogen, weil sie in ihrer Anhänglichkeit die Stallarbeit behinderten.
Die US-Journalistin Anjana Shrivastava kam in einer Studie zu dem Schluß, daß all die obigen Probleme in der „Demokratisierung des Fleisches“ angelegt seien, so daß durchaus eine Rückkehr zum alten Jagd- und Fleisch-Privileg für alle das Wünschenswerteste wäre. Nur wer würde diesmal die priveligierte Kriegerkaste stellen, die all die anderen – Vegetarier – hegt und pflegt? Nein, wir müssen wohl durch diesen ganzen Scheiß hindurch – damit am Ende jeder freiwillig zur Selbstzucht (und sei es von Fleischkaninchen) gelangt, oder sich den „Sonntagsbraten“ wieder so selten leistet wie den Sonntags-Ausflug (mit der ganzen Familie). In der Kochklasse von Professor Kubelka im Frankfurter Städel geht man inzwischen von der Annahme aus: „Ein wirklich guter Koch kann das getötete Tier in der Pfanne widerauferstehen lassen“. – Und darauf komme es letztendlich an!
Die SZ schlug Anfang Juni im Rahmen ihrer Serie „Charles Darwin und die Evolution“ vor, sich stattdessen ein Beispiel an der afrikanischen Weberameise zu nehmen. Es geht in dem langen Artikel um das neue Buch „Der Superorganismus“ der Ameisenforscher Bert Hölldobler und Edward Wilson, in dem sie nachweisen, dass „diese hochentwickelten Ameisenstaaten, die in vielen Punkten an menschliche Gesellschaften erinnern, reibungsloser als diese funktionieren“. U.a. gehen sie dabei der Frage nach, wie z.B. das „altruistische Verhalten“ der Ameisensoldatinnen im Laufe der Evolution entstehen konnte – was eine der zentralen Fragen der Evolutionsbiologie sei. Der erste Schritt dahin war wahrscheinlich eine „kleine Veränderung (Mutation)“.
Die Darwinisten rutschen immer in das selbe ärgerliche Argumentationsschema rein. Selbst Biologen, die meinen, dass sie eigentlich davor gefeit sind. So argumentiert der Münchner Biologe Josef Reichholf in seinem Buch „Der Tanz ums goldene Kalb“: Auf der Erde leben derzeit etwa 1,48 Milliarden Rinder, dagegen 6,2 Milliarden Menschen. Aber unser Lebensgewicht beträgt insgesamt nur 0,3 Milliarden Tonnen, während das der Rinder vier Mal so hoch ist – und dementsprechend fällt auch ihr Energieverbrauch aus. Reichholf meint, dass die Rinder es damit zur erfolgreichsten Säugetierart gebracht haben – indem sie sich als „Haustier“ dem Mensch andienten: man könnte sie als unsere „Number-One-Exosymbionten“ bezeichnen.
Ähnlich argumentiert auch der US-Philosoph Mark Rowlands in seinem Buch „Der Philosoph und der Wolf“, in dem es um das Zusammenleben des Autors mit dem von ihm gekauften Wolf namens „Brenin“ geht: „Warum habe ich Brenin geliebt?“ Fragt er sich nach dessen Tod – und kommt dabei zu dem Ergebnis: Weil „dieser Wolf weiß, dass Glück nicht in der Berechnung zu finden ist.“
Da Rowlands aber noch Wolfsseele (-gene) genug besitzt, liegt ebendort auch unser aller Glück. Als Darwinist ist Rowlands jedoch erst einmal vom (statistischen) Erfolg des Hunde-Werdens als einer Überlebensstrategie beeindruckt: Es gibt heute über 40 Millionen Hunde auf der Welt, aber nur noch etwa 40.000 Wölfe, schreibt er. Das Wolf-Bleiben ist also nicht (mehr) erfolgreich. Es geht diesen Tieren wie den letzten präzivilisierten Völkern: Sie sind vom Aussterben bedroht.
Der Ultradarwinist Richard Dawkins geht davon aus dass alle Lebewesen sich „ständig darum bemühen, ihre ‚Fitness‘ zu maximieren“ – und das heißt für ihn, die „Gesamtzahl der Nachkommen“ zu erhöhen. „Erfolg wird dabei also rein statistisch an der Ausbreitung einer Population gemessen. Im Falle der Rinder und Hunde ist das jedoch ziemlich absurd, denn den Individuen geht es bei diesem Erfolg ihrer Art immer schlechter: Kühe leben nur noch etwa vier Jahre und sind eigentlich nur noch Milchproduktionsanlagen. Und männliche (Mast-) Rinder leben sogar nur noch rund 18 Monate: Sie werden noch in der Pubertät geschlachtet.
Als „Konsequenzialist“ beschloß der Philosoph Rowlands erst einmal pragmatisch, keine Tiere mehr zu essen, die zum Zwecke des Verzehrs gezüchtet und aufgezogen werden. Diesen Schritt mochte er seinem Wolf natürlich nicht zumuten: „Am Ende schlossen wir einen Kompromiß: Ich wurde Vegetarier und er wurde Pescetarier.“
Abschließend sei noch ein weiteres Praxis-Buch erwähnt: „Die natürliche Radioaktivität der Pflanzen, Tiere und Menschen“ von I.N. Schewtschenko und A.I. Danilenko aus Kiew. Erschienen ist ihr Buch auf Deutsch im Elbe-Dnjepr-Verlag in Klitzschen. Die beiden Autoren untersuchten die Radioaktivität vor Beginn der ersten Atombombenversuche und danach (nach Tschernobyl) – in der Ukraine. An einer Stelle heißt es darin:
„Bei Tieren, die auf Feldern mit einem Niveau der natürlichen Radioaktivität leben, die um das 10- bis 100fache erhöht ist, wurden Störungen der Korrelation der Dehydrogenase – des Schlüsselfermentes der Glykolyse (LDG) und des Krebszyklus (PDG, CDG) festgestellt, in dessen Folge die Glykolyse über die Atmung in den lebenswichtigen Organen überwiegt und die Homöostase der Zellen gestört wird.“ Dies führt zu genetischen Fixierungen, die Geschwülste und Leukosen (Erkrankung der weißen Blutkörperchen) hervorrufen.
Über die Kühe als „Klimakiller“ schrieb ich vor einiger Zeit:
Ist es auch Rinder-Wahnsinn, so hat er doch Methode
Früher war der tägliche Genuß von Fleisch dem Adel vorbehalten, mit der Demokratisierung des Konsums essen nun in den Industrieländern fast alle Menschen Steaks, Lammkoteletts oder Hamburger – und das täglich mehr: Im Durchschnitt verzehrt heute jeder Erdenbürger fast doppelt so viel Fleisch wie 1970. Bis 2050 wird sich der weltweite Fleischverbrauch nochmals verdoppelt haben. Dem ging eine globale Ausbreitung der Rinder- und Schafzucht voraus. Ein Viertel der gesamten Landmasse der Erde dient heute als Weideland. Vor allem in Südamerika müssen immer mehr Wälder den Rinderherden Platz machen: In Brasilien wurde seit 1960 knapp ein Fünftel des Amazonas abgeholzt – mehr als zweimal die Fläche von Deutschland. Doch das Mastrind im deutschen Stall ist nicht ökologischer gehalten als das auf der argentinischen Weide. Wenn wir Rinder bei uns im Maststall halten, wird das Kraftfutter importiert und das belastet Luft und Böden ebenfalls: Durch den Anbau und Transport des Futtermittels und die nicht bodengebundenen Ausscheidungen der Tiere – mit schlechter Ökobilanz. Doch abgesehen von der Belastung der Böden – zu viel Fleisch zu essen ist schädlich für das Klima. Einem aktuellen UN-Bericht zufolge belastet der globale Rinderbestand das Weltklima genauso stark wie alle Menschen Indiens, Japans und Deutschlands zusammen. 70 Prozent des vom Rind freigesetzten Methans stammt vom Erhaltungsumsatz des Tieres. Mit Hochleistungszüchtungen ließe sich die Methanbildung pro Liter Milch oder pro Kilo Fleisch zwar senken. Doch das Tier erbringt die höhere Leistung nur mit Kraftfutter und dessen Produktion kurbelt wiederum die klimaschädlichen Gase an.
Für 300 kg Fleisch (Mastrind bei durchschnittlichem Lebensalter von zwei Jahren) werden verbraucht: 14.600 Liter Wasser, 3,5 Tonnen Soja und Getreide. Daraus entstehen: drei Mio Liter Kohlendioxid aus der Verbrennung der 2.500 Liter Treibstoff für den Futtermittelanbau, 200.000 Liter Methan aus dem Verdauungstrakt, 14,6 Tonnen Dung. Sinnvoll wäre also in erster Linie, sich auf die Produktionskapazitäten in unserem Land zu beschränken und unabhängig von Fremdfuttermitteln aus Übersee zu werden. Das reduziert den Energieverbrauch und verhindert, dass Methan in den Tropen und Subtropen freigesetzt wird. Die Landwirtschaft wiederum könnte angemessene Preise für gute Produkte bekommen…So argumentiert der Münchner Biologe Josef Reichholf.
Wenn Schafe und Kühe aufstoßen, atmen sie Methan aus und tragen damit zur Erwärmung der Erdatmosphäre bei. Seit dem Ende der Adelsprivilegien ab 1789 nahm die Methankonzentration in der Atmosphäre um mehr als 150% zu. In Australien machen die Methanausdünstungen der millionenköpfigen Schaf- und Rinderherden heute 14 Prozent der gesamten Treibhausgas-Emissionen aus. Die Verdauungsorgane dieser Wiederkäuer, speziell ihr Pansen, sind derart voll mit celluloseabbauenden Bakterien, dass man mit der Molekularbiologin Lynn Margulis sagen kann: „Sie sind die Kuh.“ Das Methan, das diese Bakterien bei ihrer Verarbeitung der Gräser im Pansen freisetzen, kann der Körper nicht absorbieren, er gibt es deswegen durch Furzen und vor allem Rülpsen frei – und das in solchen Mengen, dass man inzwischen die Rinder dieser Welt fast für den gesamten Methananteil in der Atmosphäre (etwa 15%) verantwortlich macht. Das ist mehr als beunruhigend, aber im Kapitalismus darf es dagegen nur technische – d.h. profitable – Lösungen geben: So wollen z.B. die Agrobiologen den Methanausstoß der Rinder mit Bakterien aus Känguruhmägen reduzieren: Känguruhs produzieren wegen dieser speziellen Bakterien in ihren Vormägen kein Methan. Als erstes Agrarland will Dänemark damit das Klima verbessern. Allein die dänischen Kühe geben pro Jahr 140.000 Tonnen Methangas in die Atmosphäre ab. In der „Technology Review“ wurde darüberhinaus kürzlich ein neuer Impfstoff angepriesen,
der das Immunsystem der Tiere mobilisieren und den Methanausstoß eindämmen soll. Um acht Prozent konnte André-Denis Wright, Molekularbiologe vom australischen CSIRO-Institut und seine Kollegen damit die Methan-Ausdünstungen bei Schafen bereits reduzieren. Ein Schaf produziert rund 20 Gramm Methan pro Tag. Das macht sieben Kilogramm pro Jahr. Neuseeländische Forscher setzen dagegen auf eine neue Futtermittelpflanze: Legume Lotus mit kondensierten Tanninen soll den Methanausstoß bei Tieren um bis zu 16 Prozent reduzieren. Wissenschaftler der dortigen AgResearch Grasslands haben die neue Futtermittelpflanze bereits getestet und für brauchbar befunden.
In Deutschland, wo 13 Mio Rinder leben, die jährlich 500.000 Tonnen Methan produzieren, kommen rund drei Viertel des landwirtschaftlichen Methanausstoßes aus der Rinderhaltung. Jürgen Zeddies von der Universität Hohenheim, die mit 16 Instituten an der interdisziplinären Erforschung der Quellen klimarelevanter Gase und umwelttoxischer Stoffe arbeitet, will diesen Ausstoß um bis zu einem Fünftel durch die Zugabe bestimmter Fette, Tannine und weiterer Substanzen vermindern: „Wird die Futterration der Kuh verändert, läuft die Methanproduktion anders ab“.
Prof. Dr. E. Pfeffer führte auf einer Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Wirkstoffe in der Tierernährung (AWT) aus: Eine extensive Tierhaltung ist nicht immer die umweltfreundlichste. Eine Kuh, die 2.500 kg Milch im Jahr gibt, scheidet, bezogen auf die Milchleistung, 41 kg Methan je kg Milch aus. Eine Kuh mit 5.000 kg Jahresleistung dagegen nur 22 kg Methan je kg Milch. Bei einer 7.500-kg-Kuh sind es nur noch 17 kg Methan je kg Milch. Umgerechnet sind das bei der 2.500-kg-Kuh rund 102.500 kg Methan. Das bedeutet: werden für 5.000 kg Milch (wegen der Extensivierung) zwei Kühe benötigt, wird die Umwelt mit ca. 205.000 kg Methan im Jahr belastet; bei nur einer Kuh dagegen mit 110.000 kg. Weltweit werden derzeit von den Wiederkäuern 80 Millionen Tonnen Methan produziert. Das Gas wirkt sich 32 mal schädlicher auf das Klima aus, als die Kohlendioxid-Emissionen von Autos oder Industrieanlagen. Der Anteil des Gases in der Atmosphäre steigt jährlich um 0,6 Prozent. Um den Trend zu stoppen, müsste die Produktion um 320 Prozent zurückgeschraubt werden. Seit der Klimakonferenz in Kyoto 1997 spielt das Thema eine große Rolle. Professor Winfried Drochner vom Institut für Tierernährung der Universität Hohenheim will die Kühe auf eine Spezialdiät setzen. Obendrein will er ihnen eine Riesenpille – einen pflanzlichen Vormagen-Bolus – verabreichen. Und damit gleich drei Dinge erreichen: weniger Kosten, weniger Treibhausgas – und letztlich ein gesteigertes Wohlbefinden der Tiere. „Wir suchen dafür noch Sponsoren“.
Da die „Riesenpille“ aber nicht nur klimafreundlich wirkt, sondern sich in barer Münze auszahle, ist er optimistisch, in Kürze fündig zu werden. Einige Experten der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft sind dagegen eher skeptisch: Die Anstrengungen, Kühe durch Bakterien-Impfungen oder Spezialfutter „methanärmer“ zu machen, halten sie für Ablenkungsmanöver, weil die heutigen Milchkühe Hochleistungsproduzenten sind – und jegliche Beeinflussung der komplizierten Bakterienflora im „Gärreaktor“ Kuhmagen ein schwieriges Unterfangen ist. Seit 1990 hat sich jedoch der CH4-Ausstoß der Bundesrepublik bereits halbiert, dennoch lag Deutschland bis 2004 im europäischen Vergleich noch in der Methan-Spitzengruppe. Aber BSE (Rinderwahn) und andere Lebensmittelskandale haben den Deutschen dann den Appetit auf Fleisch verdorben – was dem Klima zugute kam.
Ein weiterer Wahnsinn bahnt sich nun mit den sinkenden Milchpreisen an: Bloß noch etwa 5 Cent bekommten z.B. die bayrischen Bauern für einen Liter, deswegen gehen immer mehr dazu über, daneben Biogasanlagen aufzustellen, die mit Gülle und Grünfutter Methan produzieren, das einen Generator antreibt, der Strom in das Netz einspeist – etwa 12 Megawattstunden pro Tag. Für jede Kilowattstunde zahlt ihnen der lokale Energieversorger 14,7 Cent. Wenn in drei Jahren die EU-Milchgarantieverordnung abgeschafft wird, lohnt sich die Kuhhaltung für die Bauern gar nicht mehr – sie werden dann nur noch Methan produzieren: ebenfalls mithilfe von auf Regenwaldböden angebautem Grünfutter. Die Biogasanlage, das ist die Kuh – und umgekehrt. „Um an Biogas zu kommen, müssen nur die im Innern der Kuh ablaufenden Prozesse kopiert werden,“ schreibt die FAZ in einem langen Artikel über Biogasanlagen, deren Energieausbeute zumeist nicht über 55% hinauskommt – angestrebt werden 90%, indem man die Abwärme auch noch nutzt. Aber das ist Zukunftsmusik. Derzeit steigen gerade die Milchpreise weltweit, weil wegen der Klimaveränderung und der dadurch verursachten Trockenheit Australien und Ozeanien als große Milchlieferanten auf dem Weltmarkt zurückstecken mußten. Hinzu kommt noch: „Die Nachfrage aufstrebender Länder wie China und Indien sowie der Boom bei Biokraftstoffen treiben die Preise vieler Rohstoffe nach oben“, so Torsten Schmidt vom Essener Institut für Wirtschaftsforschung RWI. Nach Angaben des Milchindustrie-Verbandes (MVI) kostet ein Päckchen Butter demnächst wahrscheinlich 1,19 Euro statt bisher 79 Cent. Der Quark werde 40 Prozent teurer, der Liter Milch 5 bis 10 Cent. „Die Butter ist auf einem 20-Jahrespreishoch“, stellte die Export-Union für Milchprodukte kürzlich fest.
Die Milchbauern waren darüber erst einmal froh. Aber dann gingen wie eingangs erwähnt mit der Wirtschaftskrise die Milchpreise wieder nach unten. Anfang des Jahres interviewte die taz den friesischen Bauern Onno Poppinga anläßlich seiner Emiritierung an der Universität Kassel, wo er Landwirtschaft lehrte. Er war Mitbegründer der „Bauernstimme“ und in den Siebzigerjahren einer der „rebellischsten Bauern“ hierzulande, wie die taz einmal schrieb. In dem Interview äußerte sich Poppinga auch über die Agrarpolitik in bezug auf die Milchbauern. Das Interview sollte auf „seinem“ Versuchsgut an der Kassler Uni stattfinden:
Also auf nach Frankenhausen, dem Versuchsbetrieb der Uni Kassel. „Hm, ist ein bisschen matschig hier“, sagt Poppinga und stapft schmatzenden Schrittes zu einer großen Holzhalle. Ein breiter Mittelgang, links und rechts stehen, auf Stroh, Rinder. „Das gefällt mir aber gar nicht“, sagt der Professor und zupft einer Kuh ein Büschel Fell vom Horn. Offenbar hat sie sich mit einer Kollegin gestritten. „Wenn die Haltung stimmt, sind die ganz friedlich“, sagt Poppinga, „dann kann man die Hörner auch dran lassen.“ Ihm widerstrebe es, an Tieren rumzuschnippeln, wenn es nicht sein müsse. „Vielleicht brauchen sie mehr Platz, oder wir müssen die Gruppen anders zusammensetzen.“ Schwarz-bunte Niederungsrinder stehen hier im Stall, eine vom Aussterben bedrohte Haustierrasse. „Dabei können die beides“, schwärmt Poppinga, „die liefern viel Milch und gutes Fleisch.“ Er befasst sich im Versuchsbetrieb vor allem mit der Zucht. „Das da ist eine sehr gute Milchkuh“, sagt er. Kennt er jedes Rindsviech persönlich? „Natürlich“, sagt er staunend.
Kurz lässt ihn die Frage innehalten. Aber nur kurz. Das soll ostfriesische Schweigsamkeit sein? Wer Poppinga folgen will, muss gut aufpassen, denn er redet viel, und er redet schnell, jeder Halbsatz eine These. Das Niederungsrind könne der Rasse der weit verbreiteten und völlig überzüchteten Holstein-Friesen aus der Misere helfen, aber das habe für die Bauern natürlich Konsequenzen, bedeute es doch einen Ausstieg aus der wachstumsorientierten, industriellen Landwirtschaft, die das Land veröde und die Umwelt zerstöre.
Gegen diese Idee von Landleben und Landwirtschaft kämpft Poppinga an, seit Jahrzehnten schon. „Er hat die herrschende Agrarpolitik immer aus einer linken Perspektive heraus kritisiert“, sagt der EU-Parlamentarier Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf. Den mag Poppinga, obwohl er bei den Grünen ist. „Parteien sind mir Wurst“, sagt er, „mit denen wollte ich nie etwas Näheres zu tun haben.“
Gleichwohl schätzt er Mitstreiter, „Ich finde überall einen sympathischen Querkopf“, sagt er. Anfang der 70er-Jahre gründete er zusammen mit anderen Bauern aus der Stuttgarter Studentenbewegung heraus einen Arbeitskreis, der sich mit der Dritten Welt auseinandersetzte, aber auch kritisch mit der Rolle des Deutschen Bauernverbandes. Die daraus entstandene Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), deren Vorsitzender Graefe zu Baringdorf heute ist, bildet das Zentrum der „Agraropposition“ in Deutschland und formuliert hörbar eine alternative Landwirtschaftspolitik. In ihrem Zentralorgan, der Bauernstimme, schreibt Poppinga noch heute gerne. In die etablierten Zeitschriften der Agrarwissenschaft hingegen hat er es nicht geschafft, auch nicht in die offiziellen Diskurse der Agrarpolitologen. „Da hab ich auf Granit gebissen.“ Er trenne nicht zwischen Ideologie und Wissenschaft, lautet der Vorwurf der Fachkollegen. „Das kenne ich“, schnaubt Weggefährte Graefe zu Baringdorf, „die herrschende Lehre ist Wahrheit und alles andere Meinung.“
Die herrschende Lehre. Onno Poppinga zeichnet sie mit einem Daumen in die Luft im Kuhstall. „Hier ist die Nachfragekurve, hier die Angebotskurve“, sagt er. So errechne der Agrarökonom den Milchpreis. Unfug sei das. „In Deutschland haben wir hunderttausend Bauern, hundert Molkereien und einen Aldi“, sagt er. Die Rechnung funktioniert so also nicht.
Den Weg, den die rebellischen Milchbauern vom Bundesverband Deutscher Milchviehhalter gehen, findet er richtig. Wenn die bloß weiterdenken würden! Die angebotene Milchmenge zu begrenzen, ja klar. Aber immer nur Quoten fordern? Langweilig. Zum Beispiel könnten die Bauern ihre Kälber mit Milch füttern, und nicht mit dem üblichen, milchfreien Milchaustauscher. „Da hätten sie schon mal eine große Menge vom Markt.“ Oder in der Zucht umdenken. Man könnte in die allgegenwärtigen Holstein-Friesen, die im Schnitt nach viereinhalb Jahren Dauermilchgeben erschöpft an die Schlachtbank treten, das schwarzbunte Niederungsrind einkreuzen. Die geben ordentlich Milch, aber weniger als ihre Hochleistungsverwandten. Auch dies eine Produktionsbegrenzung.
Das richtige Maß – das hat Poppinga auf dem elterlichen Hof kennengelernt. Zusammen mit drei Brüdern wächst er im Dörfchen Upgant bei Norden auf. Der Hof liegt genau auf der Grenze zwischen Geest und Marsch, zwischen dürrem und fruchtbarem Boden. Die Familie ist nicht reich, aber auch nicht arm. „Man kann ihn gar nicht verstehen ohne seine große emotionale Nähe zum Hof“, meint sein langjähriger Mitarbeiter Götz Schmidt.
„Quer denken“ hätten sie bei ihm gelernt, sagen seine Studierenden. Ein kleines Büro mit einem weiten Blick über den Hang, an den sich die Uni Witzenhausen würfelt. Über allen Instituten und Gewächshäusern thront „meine Villa Hügel“, stellt Poppinga vor. Ein kleiner zweckmäßiger Bungalow mit Linoleumboden, Stundenplänen an den Wänden und Kurt-Tucholsky-Sprüchen an den Türen: Hier lehrt und forscht das „Fachgebiet Landnutzung und regionale Agrarpolitik“ unter seiner Leitung. Noch bis Ende März, dann geht Poppinga in Rente. Und seine Stelle mit ihm.
Darum sitzen jetzt, an einem kalten Februarnachmittag, die Studentinnen Maggi Selle und Marlin Krieger um einen Teller Donauwellen herum und sind auf einmal ganz verzagt. „Jetzt wird erst so richtig greifbar, was mit ihm verloren geht“, sagt Maggi. 24 Jahre alt, 5. Semester Agrarwissenschaften. Seit über einem halben Jahr organisiert sie den Studierendenprotest gegen den Wegfall von Poppingas Stelle. Zwar wird es weiter eine Professur für Agrarpolitik geben, aber sie ist besetzt von einer Ökonomin. „Das ist an allen Unis so“, kritisiert Marlin. Im Streit um OnnoPoppinga kristallisiert sich die Krise einer Agrarwissenschaft, die den Bauern gepredigt hat, sie seien Unternehmer. Und die sich nun fragen lassen muss, wieso die Branche eine eigene theoretische Betrachtung verdient.
„Agrarpolitik in der Leehre?“ ist die von Studierenden organisierte Ringvorlesung im auslaufenden Semester überschrieben. Sie war auch als Abschiedsgeschenk für ihren Lehrer gedacht, dessen Forschung immer fest im Ackerboden verwurzelt war. Wie und zu welchen Preisen können Ganztagsschulen ihr Schulessen aus regionalem Bioangebot decken?“, erkundete Poppinga etwa in einem seiner letzten Forschungsprojekte. Davor interessierte ihn die Funktion von Pferden in der modernen Landwirtschaft. „Der Breitensport Reiten holt die Städter wieder aufs Land“, sagt er, „das ist wichtig.“ Abgesehen davon, dass er den Bauern eine neue Einkommensquelle eröffne. Noch eine These.
Während die taz mit dem Landwirt Onno Poppinga u.a. über Kühe redete, interviewte Die Zeit den Wissenssoziologen Bruno Latour – unter der Überschrift:
Die Kühe haben das Wort
Hinter sieben Treppen und Winkeln der Elitehochschule französischer
Ingenieure, in der École des Mines am Pariser Jardin de Luxembourg,
sitzt in einem winzigen Arbeitszimmer Bruno Latour und denkt über
Demokratie und Mischwesen nach. Über die Frage, wie Menschen künftig mit
all den Kreaturen und Dingen auskommen können, die durch menschlichen
Zugriff erst ihre hybride Gestalt erhielten: ob Tiermehl oder
wahnsinnige Kühe, ob Ozonloch oder genetisch manipulierte Organismen.
Der Winzersohn Latour lehrt heute nicht nur als Professor der Soziologie
in Paris, sondern auch an der London School of Economics. Seit er 1979
mit Steven Woolgar ein grundlegendes Buch über die Fabrikation
wissenschaftlicher Tatsachen schrieb, irritiert der gelernte Philosoph
und Anthropologe das moderne Weltbild der Wissenschaft und verleiht
dabei den Begriffen eigensinnig neue Bedeutungen. Mit dem Soziologen
Ulrich Beck versteht er sich. Auch seine Arbeiten umkreisen das
Verhältnis von Natur, Wissenschaft und Politik: Wie entsteht, was wir
für eine Tatsache halten? In seinem neuen Buch Die Hoffnung der Pandora
fragt Latour nun: Was folgt auf die traurige Geschichte der despotischen
modernen Vernunft? Und während die Gazetten streiten, ob das Verbot von
Tiermehl rational ist, ob das Prinzip der Vorsorge nicht mehr
politischen Raum einnehmen müsste, beginnen wir das Gespräch.
DIE ZEIT: Jeder scheint heute zu wissen, was Gene sind. Was ist ein Gen
für den Wissenschaftsforscher Latour?
BRUNO LATOUR: Wir haben es wie bei der Auslegung des Evangeliums mit
Lesarten zu tun, die sich nicht vereinheitlichen und vereindeutigen
lassen. Das Gen ist vielerlei. In Frankreich gibt es zum Beispiel seit
Jahren eine Patientenorganisation, die zur Erforschung der genetisch
bedingten Krankheit ihrer Mitglieder, der Muskeldystrophie, Millionen an
Forschungsgeldern gesammelt hat. Da geht es um ein isolierbares Gen und
eine präzise Hoffnung auf Heilung; auf Befreiung. In diesem Zusammenhang
treten Gene in der Öffentlichkeit anders auf als in der Lesart des
Oxforder Zoologen Richard Dawkins, der gegen den klassischen Humanismus
argumentiert und meint, es seien die „egoistischen Gene“, die das
menschliche Verhalten bestimmten. Der Populationsgenetiker Richard
Lewontin in Harvard hingegen hält die Informationen der Gene für zu
unbestimmt, um aus ihnen kausal etwas zu folgern. Wäre der Organismus
ein Computer, meint Lewontin, hätte er ihn längst weggeworfen, weil sich
aus seinen Informationen nichts berechnen lässt. So vielfältig wie die
Deutungen der Gene, so komplex ist auch ihr Zusammenspiel. Genetiker,
die die Karte des Genoms vor sich haben, wissen das selbst am besten.
ZEIT: In Hoffnung der Pandora fragen Sie nach der Realität
wissenschaftlicher Entdeckungen und überlegen, ob die Milchsäurefermente
existierten, bevor Pasteur sie entdeckte. Gab es das Humangenom, bevor
es entdeckt wurde?
LATOUR: Wissenschaftliche Entdeckungen wie die der Gene hängen von einer
Ausstattung ab, von Maschinen, Darstellungstechniken, Geldern. Die
Tatsachen sind natürlich objektiv und real, aber ohne ihre Verfertigung
im Labor gäbe es sie nicht. Nur im Nachhinein kann man sagen: Die Gene
existieren. Es gibt sie nicht ohne die Geschichte ihrer Erforschung.
ZEIT: Ist es das, was Sie meinen, wenn Sie schreiben, dass die
Wissenschaftsforschung der Wissenschaft Wirklichkeit hinzufügt?
LATOUR: Ja. Wenn ein Genetiker vom Gen spricht, will ich wissen, wie
seine Tatsachen zustande kamen. Wer die Umstände des Forschens nicht
hinzufügt, nimmt durch die Behauptung von Eindeutigkeit und
Einheitlichkeit eine reine Position der Macht ein. Nimmt man dem
Genetiker sein Labor weg, bleibt von den Genen nichts übrig. Nimmt man
den Ökonomen ihre Rechenmaschinen weg, ergeht es ihnen nicht anders. Die
Frage nach der Realität des Erforschten finde ich nicht so wichtig wie
die andere, ob es demokratisch sozialisiert wird. Mich interessiert, wie
sich in der Forschung soziale, ethische, ästhetische, politische,
instrumentelle Aspekte durchdringen. Das ergibt eine offene Landkarte
vielfältiger Handlungen und Verwicklungen. Das Thema der Biomacht, das
Foucault aufgeworfen hat, ist Teil einer verästelten politischen Kultur.
ZEIT: Fürchten Sie nicht, dass die Genetik die politische Diskussion
ersetzen könnte?
LATOUR: Nein. Die politische Diskussion muss sich nun um die Vorschläge
der Genetik kümmern. Dafür muss ein öffentlicher Raum geschaffen werden,
ähnlich wie ein neues Stadtbild Berlins entsteht. Und die Wissenschaft
muss vom Anspruch der Autonomie befreit werden.
ZEIT: Sie unterscheiden in Ihrem Buch zwischen autonomer „Wissenschaft“
und „Forschung“, die sich ihrer Abhängigkeiten und Allianzen bewusst
sind. Der Forschung soll die Zukunft gehören. Was ändert sich damit für
den Genetiker?
LATOUR: Ändern muss sich weniger seine Arbeitsweise als vielmehr die
öffentliche und humanwissenschaftliche Deutung seiner Arbeit. Die
Forscher im Labor wissen genau, wie komplex ihre Abhängigkeiten sind.
Wenn sie sich an ihre Sponsoren wenden, sprechen sie sehr offen über
Deutungen, Risiken, Mittel und Alternativen. Aber wenn sie ihr Labor
verlassen und sich an die Öffentlichkeit wenden, spricht bisher zumeist
der reine Newton aus ihnen.
ZEIT: Newton, das heißt: Tatsachen ohne Relativität. Eine gereinigte
Wissenschaft, frei von Störungen und Unsicherheit.
LATOUR: Das klassische Paradigma der Moderne eben, das ein
einheitliches, von Werten gereinigtes Weltbild hervorbringen sollte.
Aber die gegenwärtige Situation ist neu, das zeigen etwa Treibhauseffekt
oder Rinderwahnsinn: Wir haben es mit viel mehr divergierenden
Expertenmeinungen zu tun und auch mit mehr Forschungsgegenständen, die
alle prompt ihre Risiken nach sich ziehen. Das Politische zieht in die
Wissenschaften ein. In die Dinge selbst. Die Natur ist ein politischer
Prozess.
ZEIT: Und die Hoffnung der Pandora?
LATOUR: Der Mythos besagt doch, dass Pandora die Büchse aus Neugier
öffnet und alle Übel entfleuchen lässt. Das sind die Übel der modernen
Wissenschaft. Der Mythos besagt aber auch, dass sie die Büchse vor
Schreck zu früh schließt: nämlich bevor die Hoffnung, die auf dem Boden
der Büchse ruht, ins Freie gelangen kann.
ZEIT: Welche Hoffnung?
LATOUR: Sie besteht in der Vielfalt der wissenschaftlichen Optionen, in
der Kontroverse von und mit Wissenschaftlern in der demokratischen
Gemeinschaft. Deren vornehme Rolle besteht nun nicht mehr darin, die
politische Debatte zum Schweigen zu bringen, sondern darin,
stellvertretend und öffentlich zu sprechen: in einer Art Parlament der
Dinge.
ZEIT: Was heißt für Sie „Dinge“? Sie unterscheiden nicht zwischen
Objekten und Subjekten, sondern zwischen Menschen und nichtmenschlichen
Wesen. Warum?
LATOUR: Ich wollte den alten Gegensatz von Subjekt und Objekt hinter uns
lassen. Der isolierte Geist und die kalten, toten Dinge, das ist eine
Unterscheidung, die sich Descartes, Kant und der modernen Wissenschaft
verdankt, aber sie ist überholt. Die Dinge sind zu Hybriden, zu
Mischwesen geworden. Menschen und Dinge sind ja ineinander verschränkt.
Wir hängen von ihnen ab, sie wirken auf uns ein. Und bilden mit uns
gemeinsam Kollektive.
ZEIT: Zum Beispiel?
LATOUR: Der Aids-Virus, die Homosexuellen, die Virologen, die
Medikamente bilden solch eine Assoziation von Menschen und
Nichtmenschlichem. Eine verlangsamende Straßenschwelle, Verkehrsplaner
und Autos: noch ein Kollektiv. Je weiter die Technik fortschreitet,
desto mehr vermengen sich Dinge und Menschen, die ein gemeinsames
Schicksal teilen.
ZEIT: Sie sprechen mit Empathie für die Dinge. Weil sie sich nicht
wehren können?
LATOUR: Der Ökologie geht es um allerhand Wesen, die von uns abhängen,
Wälder, Gewässer, Tiere. Die Frage ist nun, welche Politik zu dieser
Situation passt. Welche Institutionen wir für eine demokratische Politik
der Dinge, für eine Politik der Natur brauchen. Die Wissenschaftler sind
nur Parlamentarier unter anderen inmitten einer Vielzahl von Lobbyisten.
Wir müssen klären, wer mit in die Arena gehört.
ZEIT: Und wer nicht.
LATOUR: Sicher, es wird auch darum gehen, Feinde auszuschließen, in der
Bereitschaft, sie später wieder aufzunehmen. Die wichtigsten Fragen
heißen heute: Wer von den Milliarden Wesen, ob menschlich oder
nichtmenschlich, wird in Betracht gezogen? Und: Um welchen Preis sind
wir bereit, gut miteinander zu leben? Wir haben lange den Frauen und
Sklaven das Stimmrecht verweigert. Heute stellt sich die Frage neu, wer
es erhält und wer nicht.
ZEIT: Die Vorschläge in Hoffnung der Pandora sind nicht eben leicht zu
verstehen. Welche Wesen sollen in Ihrem Parlament vertreten sein? Alle
Mischwesen vom verschmutzten Wasser über das Tiermehl bis zum Chip in
der Netzhaut?
LATOUR: Das ist genau die Frage. Wir leben in einem gewaltigen
Laboratorium – das ist heute die ganze Welt -, in dem viele
experimentieren. Da wird an allerhand Dingen gearbeitet, ohne dass wir
deren Zustimmung erhalten hätten. Das Tiermehl wurde ja ebenso wenig um
seine Meinung gebeten wie die Kühe. Der Autoverkehr ist ein anderes
Beispiel: In diesem Versuch kommen auf den Straßen jährlich Tausende von
Leuten um. Das scheint ein Experiment zu sein, dem kollektiv zugestimmt
wird. Diese Toten gehören heute, unausgesprochen, zu den
Ausgeschlossenen. Aber gegen ein paar hundert Tote durch den
Rinderwahnsinn spricht sich eine Mehrheit aus.
ZEIT: Die Arena existiert schon.
LATOUR: Ja. Mir geht es nun darum, dass wir nicht länger sagen, auf die
Erhebung der Tatsachen folge die moralische Bewertung, sondern dass wir
kollektiv mit den Wissenschaftlern in einem offenen Prozess entscheiden,
welche Risiken wir tragen wollen.
ZEIT: Ist das Parlament der Dinge nur eine diskutierende Öffentlichkeit?
LATOUR: Nicht nur. Wir müssen künftig im globalen Maßstab und für den
Kosmos entscheiden. In welchem Kosmos wollen wir leben? Zur Beantwortung
dieser Frage müssen wir neu über die Institutionen nachdenken. Ein
globales Phänomen wie die Erwärmung der Atmosphäre ist weltweit schnell
begriffen worden. Auch das Prinzip der Vorsorge hat eine rasante
Karriere hinter sich.
ZEIT: Klar ist das nicht. Plädieren Sie nicht einfach für eine vitale
Subpolitik? Also für eine entscheidungsfähige Gesellschaft der
Individuen unterhalb der institutionalisierten Politik?
LATOUR: Tatsächlich findet Wissenschaftspolitik heute schon in der
Gesellschaft statt. Die Schweiz hat über genetische Forschung durch ein
Referendum abgestimmt. Jene Patientenorganisation entscheidet über die
Verwendung von Forschungsgeldern. Und wenn Sie individuell nach einer
Diagnose bei einem anderen Arzt eine zweite Expertise einholen, handeln
Sie wissenschaftspolitisch. Sie beeinflussen mit ihrer Entscheidung
Forschungszweige.
ZEIT: Das geschieht alles ohnehin.
LATOUR: Wir müssen vor allem konzeptuell nachholen, was schon geschieht.
Ich bin gar nicht so revolutionär, wie manche denken.
ZEIT: Was ist nun der Unterschied zwischen Ihrer Politik der Dinge und
Habermas‘ Vorstellung von einer diskutierenden Öffentlichkeit?
LATOUR: Um zum Parlament der Dinge zu gelangen, muss man eine Portion
Habermas mit einer Portion Gedanken vermischen, die er entsetzlich
fände. Habermas bemüht sich ja gerade darum, die menschliche
Kommunikation frei von instrumenteller Vernunft zu halten. Die will ich
aber, in einer verwandelten Form, in der Arena laut werden lassen:
dadurch, dass stellvertretend für die nichtmenschlichen Wesen gesprochen
wird. Diese Stimmen mischen sich dann mit den menschlichen Interessen.
Für Anhänger von Habermas klingt das monströs.
ZEIT: Für Anhänger der Goetheschen Naturphilosophie eher nicht.
LATOUR: Ja, in Deutschland stehen Sie auch in einer Tradition, die den
menschlichen Geist nicht verabsolutiert.
ZEIT: Wie sollen wir uns denn vorstellen, dass die rinderwahnsinnige Kuh
im Parlament der Dinge ihre Stimme erhebt? Und mit uns diskutiert?
LATOUR: Nach der Katastrophe des Rinderwahnsinns sind wir klüger als
zuvor. Wir haben Tiermehl verfüttert – aber haben wir zuvor nach der
Meinung der Konsumenten gefragt? Wir haben auch die Kühe nicht gefragt,
ob sie Tiermehl fressen wollen. Sie haben nicht das Recht, sich zu
äußern, wir haben einfach ein unkontrolliertes Experiment mit ihnen
durchgeführt. Wir müssen also ein Verfahren finden, die Kühe und die
Konsumenten zu Wort kommen zu lassen. Bisher hat nur die instrumentelle
Vernunft gesprochen mit Argumenten wie dem, das Tiermehl sei effektiver.
Nun brauchen wir Assoziationen, die vor einer Katastrophe präventiv
beraten und entscheiden. Das Parlament der Dinge stellt die Balance
zwischen Menschen und nichtmenschlichen Wesen wieder her.
ZEIT: Jeder, der die Kuh sprechen lässt, spricht mit eigenen Interessen.
Als Konservativer, als Grüner, als irgendwer, aber als Mensch.
LATOUR: Wie bei jedem politischen Problem.
ZEIT: Aber dann sind wir wieder mitten in der Verständigung unter
Menschen, in der Intersubjektivität angelangt.
LATOUR: Nein, in der Verständigung mit den Dingen, in der Interobjektivität.
ZEIT: Wie höre ich im Stimmengewirr der Interessen ausgerechnet die
Stimme der Kuh?
LATOUR: Indem sie Thema ist, und durch die verschiedenen Färbungen der
Meinungen hindurch vernehmen Sie auch die Kuh. Das Entscheidende ist für
mich, dass die Debatte über die Kuh nicht mehr auf der Basis
feststehender wissenschaftlicher Tatsachen geführt wird, sondern dass
die Wissenschaft politisch wird. Jeder Landwirt, jeder Konsument
beinhaltet in gewisser Weise nicht nur die Kuh, sondern ein Weltbild,
eine Vorstellung von Landschaft, Natur, Gesundheit. Die Situation der
Moderne ist vorbei, und also ist auch Ihre moderne Hoffnung überholt:
den Wissenschaftlern die Kühe zu überlassen und den Politikern die
Entscheidungen für die Menschen. Jetzt stehen die Kühe, vertreten durch
vielfältige Interessen, mitten in der Arena. Die objektive Kuh gibt es
nicht.
ZEIT: Das ist ein Fortschritt?
LATOUR: Ja, weil wir jetzt Kosmologien, Weltbilder gegeneinander
diskutieren. Es ist ein Krieg der Welten. Zwischen verschiedenen
Auffassungen vom Gehirn, von den Genen, vom Tier, von der menschlichen
Gesundheit.
ZEIT: Wenn die nichtmenschlichen Wesen nicht für sich selbst sprechen
können, wie steht es dann mit den Menschen? Können die es?
LATOUR: Auch nicht. Sie sprechen abhängig von Einflüssen. Ich behaupte
doch nicht, dass die Tiere wie im Märchen ihre Stimme erheben. Aber die
Menschen sprechen durch Vermittlungen. Gäbe es keine Flüsse, könnten wir
nicht von Flüssen sprechen. Menschen ohne Außenwelt gibt es nicht, die
Worte vermitteln immer etwas, das auf Menschen wirkt.
ZEIT: Das symbolische Wesen ist der Mensch. Niemand sonst.
LATOUR: Aber er spricht nicht aus heiterem Himmel. Wenn die Menschen
heute finden, Hühner sollten frei laufen können und Flussbetten sollten
nicht begradigt werden – dann zeigt das, dass ihre Worte und Werte in
einer Wechselbeziehung mit den Dingen stehen. Denn in Zeiten der
Massentierhaltung oder Flusskorrekturen haben sie das anders gesehen.
Wir wissen heute mehr über die Lebewesen, das wirkt auf unsere Haltungen
zurück.
ZEIT: Wie steht es um die technologischen Hybriden wie den Netzhautchip?
Gehören sie auch ins Parlament der Dinge?
LATOUR: Ich habe nichts gegen die Technik. Das ist eher eine deutsche Angst.
ZEIT: Aber Sie erfinden die Politik der Dinge doch, damit wir die
globalen Schäden bändigen, die Menschen anrichten. Haben wir ein
Interesse daran, alle Innovationen zu vertreten? Auch jene, die den
Menschen künstlich werden lassen, jedenfalls eine Minderheit der Menschen?
LATOUR: Künstlichkeit ist kein Kriterium, das mich interessiert. Ob der
Kosmos aus Monstern besteht, das ist entscheidend.
ZEIT: Was sind Monster?
LATOUR: Monster sind Konstruktionen aus technischen Objekten, die man
für beherrschbar und berechenbar hält. Das ist die Figur des Cyborg, die
viele Postmoderne feiern. Hybride hingegen sind Mischungen aus
menschlichen und nichtmenschlichen Wesen, die nicht beherrschbar, die
dynamisch sind. Und also Vorsicht erfordern. Erst wenn wir technische
Innovation sozialisieren, verwandeln wir Monster in Wesen. Das heißt
auch, sie der demokratischen Entscheidung zu unterziehen. Wir müssen die
Technik erziehen. Das ist die Lehre aus der Geschichte von Frankenstein:
Sein Fehler ist nicht, dass er eine künstliche Kreatur schafft, sondern
dass er sie entsetzt im Stich lässt. Das ist das Verbrechen, erst so
wird sie gefährlich. Sie kann nicht mehr sozial werden.
ZEIT: Ähnelt unsere Situation nicht vielmehr der des Zauberlehrlings,
der die Geister nicht mehr los wird, die er rief? Wir spielen
fortgesetzt Gott, entscheiden etwa über das Abschalten von Maschinen,
die Frühgeborene am Leben halten. Der Zauberlehrling steht vor
Herausforderungen, die zu groß für ihn sind.
LATOUR: Keine ist zu groß für ihn. Die Frage ist, ob der Zauberlehrling
einen Nestor hat, der ihm beisteht. Der Nestor ist die Demokratie. Oder
um mit dem Mythos der Pandora zu sprechen: Eine Demokratie muss auf dem
Boden der Büchse nach der verbleibenden Hoffnung suchen. Wenn ich die
Wahl habe zwischen den Posthumanisten, die den Cyborg feiern, und der
prometheischen Haltung, der keine Herausforderung zu groß ist,
entscheide ich mich für Letztere.
ZEIT: Demokratie ist ein zu allgemeiner Begriff angesichts von
Entscheidungen über globale Risiken, über die Fortsetzung von Leben.
LATOUR: Ich will nur sagen: Solche Entscheidungen dürfen nicht allein
von einer Lobby getroffen werden. Nicht allein von den Medizinern oder
Patientenorganisationen, den Priestern oder Rabbinern, den Biologen oder
Politikern. Die Frage, ob man Embryonen nehmen darf, um Parkinson-Kranke
zu heilen, muss in der großen Arena entschieden werden. Aber ein Grund,
warum diese Fragen so schwer zu entscheiden sind, liegt darin, dass wir
bisher zwischen Tatsachen und Werten unterschieden haben.
ZEIT: Die Qualität der Entscheidung hängt auch davon ab, wie viele
Alternativen in der Diskussion zugelassen sind.
LATOUR: Es gibt ja Biologen, die ein Moratorium in der
Embryonenforschung fordern, um in der Zwischenzeit bessere Alternativen
erarbeiten zu können. Wir müssen mehr Forschungszweige eröffnen, damit
wir die besten Entscheidungen treffen können.
ZEIT: Nach welchem Kriterium entscheiden Sie sich gegen eine Option?
LATOUR: Jeder, der seinen Forschungsgegenstand als risikolos und
beherrschbar beschreibt, sollte keinen Sou Unterstützung bekommen.
ZEIT: Wer hat die Geduld und Zeit, um der Langsamkeit neuer Verfahren zu
trauen?
LATOUR: Eine öffentliche Meinung zu bauen ist so mühsam wie die Arbeit
im Labor. Aber es sind gegenwärtig genug Kontroversen auf dem Tisch, um
wissenschaftspolitische Alternativen zu formulieren. Eine Schwierigkeit
liegt natürlich darin, dass wir gleichzeitig in verschiedenen Zeiten
leben. Es gibt Bürger, die wissen wollen, was sie essen, es gibt die
überzeugten Postmodernen, die sich gern als artifizielle Monster sehen,
es gibt die eingefleischten Modernen, die an der wertfreien
Tatsächlichkeit der Natur festhalten.
ZEIT: Sie schrieben, der Fall der Berliner Mauer zum 200. Geburtstag der
Französischen Revolution wäre umsonst gewesen, wenn wir nicht begriffen,
dass wir den Naturalismus hinter uns lassen müssen. Also den Glauben an
die Tatsachen, der im Namen der Natur die Politik zum Schweigen bringt.
Ist die Mauer umsonst gefallen?
LATOUR: Nein, der Naturalismus ist besiegt, seitdem wir es öffentlich
mit genetisch manipulierten Organismen zu tun haben.
ZEIT: Das würde nicht jeder so sehen.
LATOUR: Vielen Humanisten ist die Welt verloren gegangen, sie kennen sie
nicht mehr gut genug. Ich verstehe nicht, wie Anthropologen noch
behaupten können, es gäbe keine Beweise dafür, dass unser Verhalten auch
auf biologischen Grundlagen ruht. Das ist schlicht eine
naturwissenschaftsfeindliche Haltung. Aber ich stehe zwischen den
Fronten. Wir dürfen andererseits die Genetiker nicht verdummen lassen,
indem wir sie ihre Arbeit fortsetzen lassen, ohne ihnen mehr
Wirklichkeit zu verleihen und sie zu demokratisieren. Es ist wie mit dem
Feminismus: Die Männer werkeln weiter wie bisher, wenn Frauen ihnen ihr
Feld nicht streitig machen. Die Naturwissenschaftler arbeiten auch
einfach weiter, wenn man sie nicht sozialisiert.
Auf Deutsch sind folgende Bücher von Bruno Latour erhältlich:
– „Die Hoffnung der Pandora. Untersuchungen zur Wirklichkeit der Wissenschaft“; Frankfurt a. M. 2000
– „Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie,“ Frankfurt a. M. 1998
– „Der Berliner Schlüssel. Erkundungen eines Liebhabers der Wissenschaften,“ Berlin 1996
– „Politiques de la nature Comment faire entrer les sciences en démocratie;
La Découverte,“ Paris 1999
Die Akteur-Netzwerk-Theorie im Feld:
In dem von Martin Voss und Birgit Peuker herausgegebenen Reader „Verschwindet die Natur. Die Akteur-Netzwerk-Theorie in der umweltsoziologischen Diskussion“ findet sich u.a. ein Beitrag von Cordula Kropp: „Enacting Milk. Die Akteur-Netz-Werke von ‚Bio-Milch'“.
Eingangs heißt es darin: „Milch, und erst recht Bio-Milch, erscheint zunächst als ein einfaches Produkt – quasi das ‚Naturprodukt‘ par excellence: dem Kuheuter entnommen, abgefüllt und verkauft. Und doch erweist schon der zweite Blick ‚Trink-Milch‘ als ein überaus veränderliches Ergebnis von zu Grunde liegenden Produktions-, Verarbeitungs- und Vermarktungsleistungen, die ihrerseits Teil sehr komplexer und vielfältiger Beziehungen von heterogenen Komponenten sind: Im Rahmen dieser Beziehungen interagieren Kühe, Euter, Ställe, Futtermittel, Bauern, Quoten, Mikroben, Milcheigenschaften, Qualiktäts- und Hygienestandards, aber auch Regionen, Erfassungsstrukturen, Molkerei(technik)en, Verpackungen, Verkaufswege, Märkte aus Handelskonzernen neben kleinen Naturkostfachhändlern, Kühltheken, Einkaufstaschen, Vorratskammern und VerbraucherInnen und verändern sich mehr oder weniger erfolgreich wechselseitig zugunsten strukturbildender Festschreibungen.“
Gerade bei der Milch sind die bestehenden Verflechtungen in den letzten Jahren „als politischer Gegenstand konfliktreicher Festschreibungen geworden“. Das begann Ende 2000 mit dem ersten deutschen BSE-Fall, da verkündete die damalige grüne Landwirtschaftsministerin Renate Künast: „Der BSE-Skandal markiert das Ende der Landwirtschaftspolitik alten Typs. Wir stehen vor einem Scherbenhaufen.“ Die daraus resultierende politische Forderung an die Landwirtschaft hieß: fürderhin „Mehr Klasse als Masse“ zu produzieren. Und für die an der Latourschen Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) orientierte Autorin des Aufsatzes über die Bio-Milch bedeutete das: „Milch wäre in der Konsequenz Gegenstand und Resultat der konkreten Netze, innerhalb deren sie zirkuliert, nicht eine biologisch bestimmbare Essenz.“
Innerhalb dieses Netzes geht es dabei um „Übersetzungen“ – und diese müssen empirisch verfolgbar sein, sie treten als physische Veränderungen in den Blick. „Senkt im uns interessierenden Zusammenhang beispielsweise ein Anbieter den Preis für Bio-Milch, verändert er in aller Regel erfolgreich den Absatz: Die Milchtüten verschwinden schneller, in größerer Anzahl und/oder auf anderen Wegen. Der Anbieter hat die bestehende Assoziation aus Milchtüten, Preisen, Lagerhaltung, Konkurrenz und Kundinnen verändert; er kontrolliert einen gewissen Raum, hat seine (Vermarktungs-)Interessen in neuer Weise übersetzt und damit nolens volens im Laufe der Zeit auch sich selbst modifiziert: Vielleicht hat er nun das Gesicht eines Discounters. Vielleicht hat er seinem Handlungsprogramm ‚Milchabsatz‘ neue Aktanten (Konsumentinnen) hinzugefügt und die Assoziation von Angebot und Nachfrage verstärkt. Vielleicht hat er aber auch nur die bisherigen Konsumenten durch preissensiblere substituiert und muss in der Folge auch weitere Produkte seines Sortiments unter stärkerem Preisdruck anbieten. Vielleicht benötigt er heute größere Kühltheken und morgen andere Lieferanten, die einen geringeren Erzeugerpreis akzeptieren. Welche Folgetransformationen die erste Übersetzung nach sich zieht, ist zunächst eine empirische Frage: Gemäß ANT wird nicht die Theorie darüber entscheiden, sondern die Bewegungen im Problemfeld und ihre Spuren in Datenform. So wäre es denkbar, dass die empirische Studie herausstellte, dass weniger der Handel erfolgreicher, preissenkender Aktant war, sondern dass er nur als Vermittler (intermediary) der Preissenkung auf der darunter liegenden Wertschöpfungsstufe der Molkereien in Erscheinung trat: Im Bericht wäre an dieser Stelle dann nicht über das Angebot des Marktes zu sprechen, sondern über die Vermarktungsstrategien der Molkereien. Aber das ist nicht der Fall. Empirisch zeigt sich vielmehr eine starke Abhängigkeit der Hersteller vom Handel, die letztlich zur Handelsmarkenproduktion, zur Austauschbarkeit der Lieferanten und einem intensiven Preiswettbewerb führt.“
Es folgt ein kurzer Abriß der Entstehung von Trinkmilch, in dem die Autorin darauf hinweist, dass die Laktose-Intoleranz von Nord nach Süd steigt, in Äquator-Nähe vertragen nur noch 2% der Bevölkerung Milch. „Die Rede von Milch als ‚Grundnahrungsmittel‘ und ‚Fitmacher‘ ist also sozial, biologisch und symbolisch ethnozentrisch, unterschlägt den Multinaturalismus der Kuh-Mensch-Beziehungen.“ Der knappe Tour-d’horizon läßt bereits ahnen, „dass Milchviehaltung keineswegs eine kulturelle Universale ist, sondern mit weitreichenden Entscheidungen für Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft verbunden ist. Von den ca. 1,3 Milliarden Rindern weltweit leben 15 Millionen in Deutschland, sie liefern jährlich fast 29 Millionen Tonnen Milch und machen uns zum größten Milchproduzenten in der Europäischen Union.“
Die Molkereien kommen nicht erst ins Spiel, wenn die Milch im Rahmen klar definierter Erfassungskontingente, -wege und -zeiten die landwirtschaftlichen Betriebe verlassen hat. „Unter ihre dominanten Perspektive von der ‚Verderbniskontrolle‘ definieren sie die Milchqualität bereits in den Ställen mit strengen hygienischen Vorgaben zu allen Abläufen und bspw der Präferenz solcher Futtermittel, die nur wenige und nur dünnwandige Bakterien in die Milch tragen.“ Sie kontrollieren die Produktionsbedingungen nach ihren Ansprüchen. „Während die meisten Verbraucher die Wissenschaft in der Lebensmittelproduktion fürchten und naturbelassenen Lebensmitteln zumindest rhetorisch den Vorzug geben, fürchten die Lebensmittelwissenschaftler die Natur.
Für die Landwirtschaft bedeutet das, dass sie immer sterilere Milch abzuliefern haben. Die zulässigen Keimzahlen wurden mehrmals herabgesetzt. Aber bei der Ermittlung der Keimzahl wird nicht unterschieden zwischen gefährlichen und nützlichen Keimen, entscheidend ist nur die Zahl. So wurde Sterilität zum Wert an sich. Das Natürliche wird zur Gefahrenquelle, das künstlich Sterile zur Norm. Deshalb wird Vollmilch heute nicht mehr Dickmilch, wenn sie ungekühlt stehen bleibt, sondern faul. Mit Milchqualität hat das wenig zu tun.“
Über den Endverbraucher heißt es im Aufsatz: „Die VerbraucherInnen erwiesen sich in der Untersuchung als perfekt kontrollierter Intermediär: Ihre eigenen Handlungsmotive und -ansprüche (etwas nach weidenden Kühen, ‚frischer‘ Milch ‚von hier‘ und dem individuellen Bedarf anpassbaren Mengen) bleiben im Milchmarkt weitgehend folgenlos.“ Das gilt auch für Bio-Milch, denn der „Öko-Bereich beugte sich sukzessive den neuen Bedingungen auf dem Markt“ – z.B. indem er sich 2001 für „ultrahocherhitzte Bio-Milch“ öffnete, „auch wenn sie seinen Überzeugungen von ‚gesunder‘ und ’natürlicher‘ Milch widersprach. ‚Involvement‘ hat ihren Preis.“ Dann kam noch die bis zu drei Wochen haltbare ESL-Milch dazu. Sie ist teurer als pasteurisierte Frischmilch. Inzwischen ist jedoch nicht mehr klar, „wie lange die ’neue‘ Milch noch als Frischmilch verkauft werden darf, noch ob aus verbraucherpolitischer Perspektive über die Unterschiede hinreichend informiert wird.“
Die Autorin meint: „Die erste deutsche BSE-Kuh kann als Glücksfall der Akteur-Netzwerk-Theorie betrachtet werden,“ weil sie ein so „mächtiger Aktant“ war, dass sie nahezu alle ausgedehnten Verflechtungen sichtbar machte – bis hin zum Verbraucher. Der BSE-Kuh gelang darüberhinaus, woran die Agraropposition Jahrzehnte scheiterte: nämlich die – zumindest symbolische – Neuorientierung der Agrarpolitik weg vom durchgesetzten Protektionismus und dem Rent-Seeking von Agrarlobbies für Agrarlobbies. ‚Das Argument: Mehr Verbraucherschutz! ist das Ergebnis eines Lebensmittelskandals (BSE), schreibt dazu Onno Poppinga.“ Über die Formel „Mehr Klasse statt Masse“ und was sie für den Verbraucher bedeutet, meint er, „es erwies sich schnell, das die Verbraucher die ihnen [dabei] zugedachte Aufgabe nicht erfüllten bzw. nicht erfüllen konnten.“ Poppinga kritisiert, dass versäumt wurde, „unmittelbare Qualitätsunterschiede bei Lebensmitteln – Frischmilch statt pasteurisierte, Milch auf der Grundlage von Weidegang statt aus Futterkonserven (um nur zwei Beispiele zu nennen) als Ansatzpunkte für eine Transformation von ‚Masse zu Klasse‘ zu nutzen.“
Weitere Kuh-Literatur:
Josef H. Reichholf: „Der Tanz ums goldene Kalb“, Berlin 2004
Jeremy Rifkin: „Das Imperium der Rinder“, 1994 Frankfurt/Main
Eric Schlosser: „Fast Food Gesellschaft – Die dunkle Seite von McFood & Co“, 2001 München
Al Imfeld: „Blitz und Liebe – Geschichten aus vier Kontinenten“, Zürich 2005
Vilém Flusser: „Vogelflüge – Essays zu Natur und Kultur“, München 2000
Florian Werner: Die Kuh. Leben, Werk und Wirkung, Zürich 2009.
Markus Schürpf: „Artur Zeller 1881-1931. Vieh- und Wanderfotograf im Simmental. Fotografien 1900-1930.“ Zürich 2008
Weitere Kuh-Bücher findet man im Katalog „Trüffelschwein“ des Versandantiquariats für Land- und Forstwirtschaft c/o Bernd Keller, Domäne Hebenshausen, 37249 Neu-Eichenberg bzw. www.antiquariat.net/trueffelschwein
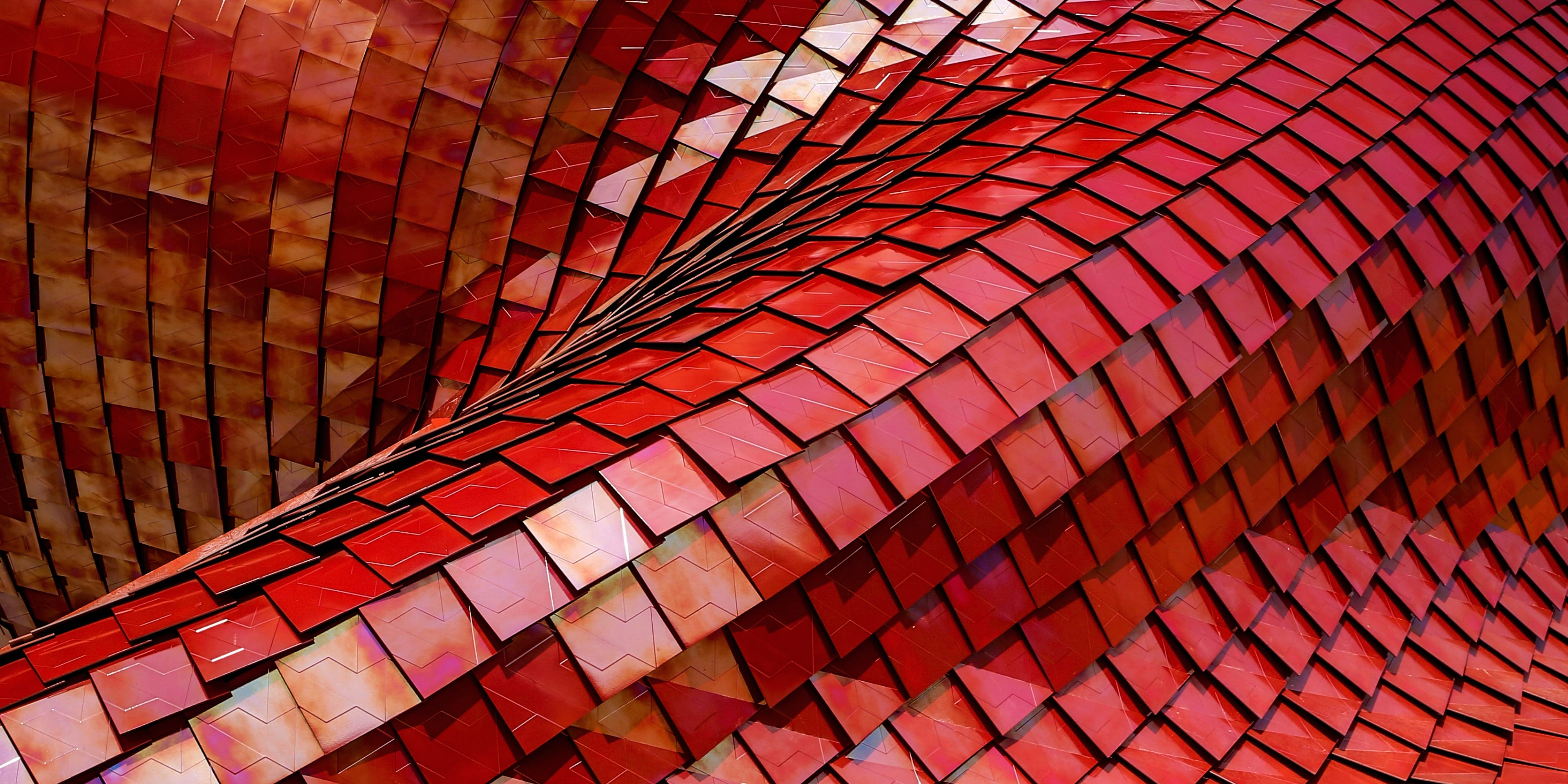



In der Krise reagieren viele, gerade die global Gesinnten, wieder national. Aus Italien kommt die Nachricht:
Milchbauern haben den Brenner besetzt
Rund 1.000 Demonstranten aus allen Teilen Italiens sind zu der heute angelaufenen Protestaktion der Milchbauern am Brenner angereist. Gelb-grüne „Coldiretti“-Fahnen, „Analyse- und Kontrolle“-Rufe, Kuhglockengeräusche und Traktoren dominierten das Bild am Parkplatz an der Staatsgrenze. Sie forderten Transparenz und die Kennzeichnung nicht-italienischer Waren. Auch der italienische Landwirtschaftsminister Luca Zaia war gekommen.
„Jedes Jahr werden 21,3 Mrd. Kilo Milch über den Brenner nach Italien gebracht – und das ohne Kennzeichnung“, schilderte Arianna Giuliodori vom Italienischen Landwirtschaftsverband „Coldiretti“. Die Industrie verkaufe die Produkte dann als italienische, weshalb die Verbraucher die Herkunft nicht nachvollziehen können. Auf Plakaten forderten die Landwirte auf: „Verlange die Herkunftsbezeichnung auf Etiketten, um dich vor den Banditen zu verteidigen, die auf Kosten deiner Gesundheit spekulieren.“
Kurz zuvor hatten bereits tausende von Milchbauern in Straßburg demonstriert. Aufgerufen hatte dazu der „European Milk Board“. Wir hatten zu Hause auch immer so ein Milch-Bord – der hat jedoch nie zu irgendetwas aufgerufen.