
Sind die Rosen nicht prächtig?!
„Der Garten, das war das Einzige, was mich vor dem Verrücktwerden bewahrt hat.“ (Ludvik Vaculik über die Zeit nach 1968; ähnlich äußerten sich auch Bohumil Hrabal, Vaclav Havel und Pavel Kohut)
Im Frühjahr 2009 widmeten sich zwei Berliner Künstler im Haus der Demokratie dem Thema „Arm-Reich“. Zuvörderst hatten sie jede Menge Leute angeschrieben, sich dazu im Rahmen eines „Mail Art Projekts“ brieflich zu äußern. Deren Rückmeldungen hingen oder standen nun im „Robert-Havemann-Saal“, während sich zwei Referenten über „Gemein und Gut“ aussprachen. Die erste Künstlerin, Eva Willig, sah eine Möglichkeit, die „Spaltung in Arme und Reiche“ aufzuheben, in der Landnahme und -bearbeitung. Sie begann bei Karl dem Großen, der ein „Regelwerk“ erließ, mit dem festgelegt wurde, wie und womit seine Lehensgüter zu bestellen waren, u.a. mit 73 Pflanzen und 16 Gehölze, die zum Wohle der Bevölkerung angepflanzt werden sollten. Daraus zog sie für „Heute“ den Schluß: „Wir nehmen die öffentlichen Flächen in unseren Besitz, wir vergesellschaften sie und sähen und pflanzen das, was uns versorgt.“
Diesem Rat ließ sie sogleich eine Tat folgen, indem sie „Samenbomben“ verteilte: Säckchen mit Wildblumen-, Kräuter- und Gemüse-Samen. Damit sollten aus uns, Zuhörern, allesamt „GartenPiraten“ werden: eine Art Radikalisierung der „Stadtgärten“-Propaganda von Maria Mies. Der nächste Referent, Winfried Schiffer, empfahl Ähnliches: Ausgehend von seinem „Wriezener Freiraum Labor“, wo man ebenfalls mit „Samenbomben“ nur so um sich schmeißen darf, warb er für ein weiteres Freiraum-Projekt im Friedrichshainer Park an der Helsingforser Straße: ein vom Bezirk gefördertes „Kunstprojekt im öffentlichen Raum“, an dem sich jeder mit eigenen „Seedballs“ beteiligen kann. Der Künstler will dabei als „Feldmoderator vor Ort“ (an heißen Tagen ggf. auch noch als Notbewässerer) fungieren. Und beweisen will er damit nicht zuletzt, dass eine Durchschnittsfamilie bereits von einer 1000 Quadratmeter großen Fläche leben kann. Schiffer beruft sich dabei auf die Lehre von der „Natürlichen Landwirtschaft“ des japanischen Mikrobiologen und Bauern Masanobu Fukuoka, wie ebenso auf den „Agrar-Rebellen“ Sepp Holzer, der dies seit Jahren zur Verblüffung der Wissenschaft mit „Perma- und Aquakulturen“ 1500 Meter hoch in den Alpen beweist. Die Schweizer Biologin Florianne Koechlin hat ihn dazu in ihrem neuen Buch „Pflanzenpalaver“ interviewt. „Es gibt keinen schlechten Boden“, meint Holzer, „es gibt für mich auch kein Unkraut und kein Ungeziefer, sondern es gibt nur unfähige Leute, die sich ihr eigenes Paradies zerstören“ – und deswegen permanent nach mehr als 1000 Quadratmeter gieren (müssen). Fukuokas Prinzipien lauten: „Nicht fragen, was man tun sollte, sondern sich fragen, was man unterlassen kann. Es gibt wenig landwirtschaftliche Praktiken, die wirklich nötig sind. Keine Maschinen, keine Chemikalien, keine Kompostierung, keine Bodenbearbeitung! Dauerbegrünung!“
Die „GartenPiraten“ berufen sich vor allem auf das „Botanische Manifest ‚Guerilla Gardening'“ von Richard Reynolds und Max Annas, das rechtzeitig zur Frühjahrsaussaat auf Deutsch erschienen war.
2.
Die Schweizer Biologin Florianne Koechlin hat erneut einige neuere Pflanzenforschungsergebnisse in einem Buch zusammengetragen. Dazu interviewte sie in mehreren Ländern Botaniker, Mikrobiologen, Bauern, Gärtner, Neurobiologen und Künstler. „Pflanzenpalaver“ heißt dieser Reader, den sie kürzlich in den Berliner Räumen der anthroposophischen GLS-Bank vorstellte, zusammen mit dem Genmais-Bekämpfer Benny Härlin von der anthroposophischen „Zukunftsstiftung Landwirtschaft“. Er hatte kürzlich u.a. mit ihr die „Rheinauer Thesen zu Rechten von Pflanzen“ zusammengestellt. Sie sind nun Grundlage dafür, dass der Schweizer Ethikrat beschließen möge, Pflanzen sind nicht länger eine „Sache“ – ein seelenloser Gegenstand. Für Florianne Koechlin selbst, die sich als „Forschungsfreak“ bezeichnet, ist seltsamerweise bzw. ausgerechnet die Malerei der „Zugang zu den Pflanzen“. Man kann diese nahen Verwandten der Tiere und Menschen (erst vor etwa 500 Millionen Jahren trennte sich unsere Entwicklung, d.h. 3 Milliarden Jahre davor verlief sie ungetrennt) alles zutrauen bzw. attestieren: Pflanzen können riechen, schmecken, fühlen, hören (also Schallwellen wahrnehmen), ja, sie können diese sogar gedanklich auswerten (denn an der Spitze jeder Wurzelfaser befinden sich Zellen, die „gehirnähnliche Funktionen“ wahrnehmen, wie der Bonner Biologe Frantisek Baluska meint herausgefunden zu haben) und darüberhinaus können sie noch vieles mehr, was wir nicht können, aber eines nicht – nämlich sehen. Während die Menschen andererseits absolute Sehtiere sind: Unsere ganze Gesellschaft ist auf das Sehen hin orientiert – und dies zunehmend. Der Sozialphilosoph Ulrich Sonnemann sprach beizeiten bereits von einer „Okulartyrannis“, die es zu bekämpfen gelte, weil sie alle anderen Sinne und Sinneswahrnehmungen unterdrücke bzw. herabwürdige. Ähnlich bezeichnet der Filmemacher Harun Farocki unsere Gesellschaft als eine, „die vollständig auf ihr Abbild hin organisiert ist“.
Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften hat die neueste (20.) Ausgabe ihrer Zeitschrift „Gegenworte“ komplett diesem Thema gewidmet. Es heißt „Visualisierung oder Vision?“ Den Anfang macht darin die Kulturwissenschaftlerin Doris Bachmann-Medick: Sie fragt, ausgehend von den „Urhebern“ der mit den elektronischen Medien aufgekommenen „ikonischen Wende“, ob der „Iconic/Visual Turn“ sich sogar gegen die Worte richtet. Und spricht in diesem Zusammenhang von Bildforschung, Bildanthropologie, Bild-Akte, Welt-Bilder und Bilderfragen. Der Molekularbiologe Frank Rösl macht sich Gedanken zur visuellen Evidenz in der Biomedizin. Klaus Töpfer äußert sich zur Macht des Bildes in der Politik. Der Kunsthistoriker Pablo Schneider berichtet über einen wissenschaftlichen Bilderkrieg. Der Medienwissenschaftler Thomas Hensel nennt seinen Text über den Maler und Erfinder Samuel Morse „Das Bild im Spannrahmen“. Und der berühmte Berliner Bilderklärer Horst Bredekamp geht der amerikanischen „Picture“-Manie in der noch berühmteren Zeitschrift „Nature“ nach: In den naturwissenschaftlichen US-Journalen stieg zwischen 1989 und 2001 der Prozentsatz manipulierter Bilder von 2,5% auf über 25%; das „Journal for Cell Biology“ beschäftigt seitdem sogar einen „Bild-Detektiv“. Der Emeritus und Mitbegründer der Akademie Conrad Wiedemann lästert über diese ganzen „Imagologen“ – ob ihrer Bemühungen um saubere Bilder und der Etablierung einer eigenen „Bildwissenschaft“. Ihm ist der „Turn-Begriff zutiefst verdächtig“: Als man noch von „Protest“ sprach und damit „starke Bewegungen“ lostrat, war ihm wohler. Damals wie heute ging es um die „Deutungshoheit“, aber 68 gab man das wenigstens noch zu. „Ich habe das Gefühl, dass eine Emanzipation in diesem Fall gar nicht gelingen kann“, auch und erst recht nicht, wenn „Bachmann-Medick mehr als 30“ mal von einem (Iconic) „Turn“ spricht.
Die steigende „Bilderflut“ spornt aber nicht nur die Wissenschaft an, sondern überschwemmt auch zunehmend unseren Alltag; die Handy-Generation ist geradezu bildbesessen. Das geht bis zum einst unausgeleuchteten Geschlechtsakt, an dem früher noch alle Sinne beteiligt waren. So berichtete kürzlich z.B. das Sexmodel Jill Ann Spaulding in einem Interview, wie der Playboy-Herausgeber Hugh Hefner seine „Sex-Nächte“ zwei Mal wöchentlich aufs Sorgfältigste inszeniert – inszenieren muß, um überhaupt noch so etwas wie Befriedigung zu empfinden. Dieser völlig vom Bildlichen vereinnahmte Gefühlskrüppel braucht dazu erst einmal zwölf Mädchen, „Bunnys“, die zuvor aus hunderten von Bewerbungen nach optischen Gesichtspunkten ausgewählt wurden, u.a. von seiner Tochter. Die jungen Frauen müssen vorher baden und sich rosarote Pyjamas anziehen, die sie dann in seinem Schlafzimmer ausziehen, „während sie so tun, als hätten sie miteinander Lesbensex“. Paralell dazu laufen auf zwei Großleinwänden Schwulenpornos. Hefner liegt währenddessen mit einer „Viagra-Erektion“ auf seinem Bett. Seine „Hauptfreundin macht ihm dann Oralsex und besteigt ihn auch als erstes“. Danach ist ein Mädchen nach dem anderen für jeweils zwei Minuten dran, während die anderen elf Hefner „wie eine Gruppe Cheerleader“ anspornen – mit Rufen wie „Nimm sie, Papi, nimm sie!“ Abschließend hat er noch kurz „Analsex mit seiner Hauptfreundin“, die ihm dann auch, wenn er endlich einen Orgasmus bekommt, „den Schwanz abwischt“. Danach wird das Licht ausgemacht.
So sieht der momentane Gipfel an Okkulartyrannis aus. Aber auch von vielen bildenden Künstlern und Kunstkritikern, die besonders hoch über das Auge besetzt sind, weiß man, dass sie mit zunehmendem Alter (Hefner ist 79) Gefühlskrüppel werden. Und grundsätzlich gilt: Die Welt primär mit den Augen wahrzunehmen, ist eine schwere Behinderung. So wie eine allzu forcierte Intelligenzschulung jede soziale Empfindung erstickt. Bei der Entwicklung eines Einfühlungsvermögens, das sich auf (blinde) Pflanzen richtet, ist ein sorgfältig oder professionell kultivierter Augensinn geradezu ein Handicap. Umgekehrt sind Blinde für den Umgang mit Pflanzen bzw. für das Verstehen floralen Lebens besonders prädestiniert. Und so ist es eigentlich zu bedauern, dass die Pflanzenforscherin Florianne Koechlin sich zum Einen mit Malerei abgibt und zum Anderen keinen blinden Gärtner bisher interviewt hat.
Dabei scheinen sich die Blinden schier zur Beschäftigung mit Pflanzen zu drängen. In England gibt es nicht nur viele lokale „Blind Gardener’s Clubs“, sondern inzwischen auch einen „Nationalen“, ferner Diskussionsgruppen von blinden Gärtnern, Gartenführer für Blinde und schon seit mehreren Jahren einen „Blind Gardener of the Year“-Wettbewerb, an dem sich jeder Pflanzenliebhaber mit eingeschränkter Sehfähigkeit beteiligen kann. 2008 gewann der 12jährige Elliot Rogers den Titel „Young Blind Gardener of the Year“. Ähnliche Aktivitäten kennt man auch in den USA. Und in Deutschland gibt es immerhin schon in vielen Botanischen Einrichtungen sogenannte „Duft und Tastgärten“ – auf Initiative des „Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenvereins“ (ABSV). Spezielle „Blindengärten“ findet man u.a. in Bremen, Berlin, Weihenstephan, Heidelberg und Bad Wörishofen. In Radeberg bei Dresden hat die blinde Pastorin Ruth Zacharias ihren 14.000 Quadratmeter großen Privatgarten für andere Sehbehinderte zugänglich gemacht. „Es gibt ein Menschenrecht auf Duft,“ meint sie, „die menschliche Nase kann 10.000 Nuancen unterscheiden“. Das gilt jedoch nicht für Sehende, wohl aber für die meisten Pflanzen. Und erinnern wir uns, wie Blinde sich im Straßenverkehr verhalten: Indem sie mit ihrem Stock kreisende Bewegungen auf dem Boden vollführen, um etwaige Hindernisse aufzuspüren. Genau solche Kreisbewegungen unternehmen auch Kletterpflanzen mit ihrem obersten Sproß, um auf diese Weise an eine Mauer oder einen Baum zu stoßen, an dem sie sich dann hochranken. Und noch etwas haben Blinde (Menschen wie Tiere) und Pflanzen gemeinsam: Ihr mangelndes oder fehlendes Sehvermögen kompensieren sie dadurch, dass ihre anderen Sinne weitaus stärker entwickelt sind (als unsere). Derart kann man sie gut und gerne als Widerständler gegen die Okkulartyrannis unserer völlig vom Visuellen beherrschten Gesellschaft bezeichnen. Anders gesagt: Blinde sind die natürlichen Bündnispartner der Pflanzen. Wohingegen alle sehenden Pflanzenforscher bloß im Dunkeln tappen. Schlimmstenfalls machen sie dabei nur eine wissenschaftliche Karriere – auf dem Rücken von Pflanzen quasi, die sie dann auch noch als simple „Reiz-Reaktions-Maschine“ begreifen: So wie ein Forscher des Max-Planck-Instituts für Chemische Ökologie in Jena, den Frau Koechlin interviewte, der aber dennoch Interessantes über die olfaktorische Kommunikation von Pflanzen herausfand. Und bestenfalls entwickeln sie dabei trotzdem eine gewisse florale Sensibilität – so wie etwa Doktor Zepernick vom Botanischen Garten Berlin, als ich ihm einmal während eines Interviews eine Zigarette anbot, die er jedoch ablehnte – mit der Bemerkung: „Nein, also Pflanzen verbrennen, das kann ich nicht, können wir alle nicht – bis auf eine Kollegin sind alle Wissenschaftler hier Nichtraucher, eigentlich merkwürdig.“ Helmut Höge
Literatur:
Florianne Koechlin: „Zellgeflüster – Streifzüge durch wissenschaftliches Neuland“, Lenos Verlag Basel 2005, 256 Seiten, 20 Euro 50.
“ Pflanzenpalaver. Belauschte Geheimnisse der botanischen Welt“, Lenos Verlag Basel 2008, 237 Seiten, 19 Euro 90.
„Gegenworte“, Heft 20. „Visualisierung oder Vision?“ herausgegeben von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Redaktion: Wolfert von Rahden, 10117 Berlin, Jägerstraße 22/23, 9 Euro.
3.
Ein alter Araber, der seit mehr als 40 Jahren in Chicago lebt, würde gerne in seinem Garten Kartoffeln pflanzen, aber er ist allein und alt und schwach. Sein Sohn studiert im Paris. Er schreibt eine Email an ihn: ‚Lieber Achmed, ich bin sehr traurig, weil ich in meinem Garten keine Kartoffeln pflanzen kann. Ich bin sicher, wenn du hier wärest, du könntest mir helfen, und für mich den Garten umgraben. Ich liebe dich. Dein Vater.‘ Am folgenden Tag erhält der alte Mann eine Email: ‚Lieber Vater, bitte berühre nicht den Garten. Dort habe ich ‚die Sache‘ versteckt. Ich liebe dich auch. Achmed‘. Um 4 Uhr morgens kommen die US Army, die Marines, das FBI und die CIA zum Haus des alten Mannes. Sie suchen überall, nehmen den ganzen Garten auseinander, aber finden nichts. Enttäuscht gehen sie weg. Am folgenden Tag erhält der alte Mann wieder eine Email von seinem Sohn: ‚Lieber Vater, sicherlich ist jetzt dein Garten komplett umgegraben und du kannst die Kartoffeln pflanzen. Mehr konnte ich für dich nicht tun. Ich liebe dich. Achmed‘.
Anderswo, in New York z.B., wurden in den letzten Jahren die meisten Gärten auf städtischem Grund und Boden angelegt – auf Brachflächen und Müllhalden, die Immobilienspekulanten links liegen ließen. Elisabeth Meyer-Renschhausen, eine Dozentin an der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät der Humboldt-Uni, hat sich in den dortigen „Gemeinschaftsgärten“ umgetan – und darüber gerade ein Buch veröffentlicht: „Es handelt sich dabei um eine neue soziale Bewegung“ – und sie wird von Frauen dominiert. Ihre Vereinigung zählt heute über 6000 „Nachbarschaftsgärten“ – in 38 US-Städten. Die in den Armenbezirken, wie Harlem und der Bronx, werden meist für Gemüseanbau genutzt, bei anderen „steht das gemeinsame Handeln im Vordergrund“. Zwischen den Gärtnern und dem Staat vermitteln Organisationen wie „Green Thump“, „More Gardens“ und „Green Guerillas“: Sie kümmern sich auf der einen Seite um Pachtverträge und Zäune und liefern frische Erde für die Kastenbeete, auf der anderen um die Vermarktung – z.B. von Ökogemüse auf Bauernmärkten. Diese illegalen „Basare“ werden geduldet, weil sie eine Art Sozialhilfezusatz bilden. Für den „Community Garden“ in Midtown-Manhattan haben „weit über 4000 Menschen“ einen Schlüssel, es gibt dort „108 Gemüsebeet-Inhaber“ und „56 Vogelarten“. Das Land wurde, als es bebaut werden sollte, mit Spendengeldern Quadratdezimeterweise der Stadt abgekauft. „Alle sind sehr stolz auf ihren Garten“. Und jeder ist anders: In East New Yorks Garten „Euclid 500“ z.B. hält man nichts von individuellen Beeten und macht alles gemeinsam, die Ernte wird einer Suppenküche für Arme gespendet.
„Erst durch unser Gärtnern hat sich die Gegend wieder in einen menschenwürdigen Wohnort verwandelt,“ meint einer der Aktivisten. Doch diese Wohnumfeldverbesserung hat erneut die Spekulanten angezogen – denen gerade eine Reihe „gut geführter Gärten“ zum Opfer fielen. Im Brooklyner Garden of Union gibt es eine Gruppe „Master Composter“, die gerade eine neue Kompostiermethode erfunden hat, um die Gemüsereste aus der nahen Food Coop noch besser verwerten zu können. Eine der Aktivistinnen aus dem „Herbal Garden“, der mit 1000 Quadratmetern relativ groß ist, verkauft jeden Samstag auf dem Farmers Market Kräuter und Gemüse – außerdem selbst hergestellte Saucen und Gewürztee. Die Hauptkundengruppe besteht aus 4000 Frauen, die Lebensmittelmarken beziehen. Im Pleasant Community Garden von East Harlem teilen die Gärtnerinnen die Ernte unter sich auf. An dem Tag, als die Autorin dort aufkreuzte – und mithalf, wurde gerade „eine Art Unkraut“ geerntet, das zwischen den Tomatenpflanzen wuchs: Kreuzkümmel, den die Frauen als Gewürz für ihre Hühnereintöpfe verwendeten. In Central Harlem wird ein Garten nur von älteren Männern bewirtschaftet, die dort in langen Reihen Bohnen, Mais, Okras und sogar Baumwolle anbauen. Gerade hat ihnen die Stadt den Hydranten abgestellt, von dem sie bisher – wie überall kostenlos – ihr Wasser bezogen. Den Ernteüberschuß verschenken die Männer an alte Leute in der Nachbarschaft, deren Renten zu niedrig sind, um sich frische Lebensmittel leisten zu können. Die Autorin fragte sich dort: „Befinde ich mich wirklich im reichsten Land der Erde…oder irgendwo in einem Teil der Dritten Welt?“
4.
Neulich stritten wir uns im taz-Café über „Baumscheiben“. Dabei ging es um die eigenmächtige Inbesitznahme und Begrünung dieser unversiegelten kleinen Flächen um die Straßenbäume der Stadt, inklusive ihrer Einzäunung und Ausgestaltung mit Kunst, Sitzecken, Campingtischchen, Lichtergirlanden und Ähnlichem. Diese Inbesitznahme weitete sich gerade zu einer wahren Massenbewegung in Berlin und anderswo aus.
Der Kreuzberger Hausmeister Marenke hatte dazu bereits in der von ihm gegründeten Zeitung „Kiez & Kneipe“ eine Pro- und Contra-Diskussion veröffentlicht. In Berlin begann diese seltsame Freiraum-Besetzer-Bewegung harmlos damit, dass immer mehr Mieter, vom Umweltschutz angetan (in Kellogg’s Cornflakes-Packungen gab es dafür sogar “Umweltsheriff”-Sterne) angefangen hatten, die Straßenbäume vor ihren Häusern, im Sommer z.B., zu gießen. Einige sprachen auch mit ihren Bäumen – und unterhielten sich abends in ihren Gartenkneipen unter Linden bzw. Kastanien darüber, Was die Bäume sagen. Dabei ärgerten sie sich gelegentlich über die Verschmutzung der Baumscheiben mit kaputten Flaschen, Plastik und allzu viel Hundescheiße. Es erschienen jede Menge teure Photobände über einzelne Bäume. – und es entstanden die ersten “Baumschützer”-BIs. In Berlin fingen daraufhin einige Mieter, angeblich zuerst in Reinickendorf, an, die Baumscheiben vor ihrer Haustür mit kleinen Zäunchen zu umgeben und zu bepflanzen. Bald taten es ihnen andere in anderen Bezirken nach, darunter viele Gewerbetreibende, die sich damit gewissermaßen einen kleinen Vorgarten für ihre Gäste auf dem Bürgersteig schufen, den sie sowieso schon mit Tischen und Stühlen quasi-privatisiert hatten.
In Kreuzberg 61 gab es bald die ersten alternativen Trägergesellschaften , die mit vom Arbeitsamt bezahltem (ABM/MAE-) Personal diese ausufernde Baumscheiben-Inbetriebnahme von unten gewissermaßen staatlich ausweiten und zugleich steuern wollten. Gesagt – gefördert – getan. Dazu ließen sie Schilder für die bereits bepflanzten Baumscheiben herstellen und aufstellen, auf denen sie darum baten, die kleine Grünanlage um den jeweiligen Baum herum zu schützen (oder wie man heute gerne sagt: zu respektieren). Und das mit Unterschrift vom Bezirksamt oder gleich vom Senat. Mit diesen Scheißschildern, die sich nun nach überallhin ausbreiten, wird eine slowmobartige Eigenmächtigkeit quasi im Handstreich legalisiert.
Interessant bleiben natürlich trotzdem die Unterschiede bei der Gastaltung und Nutzung der Baumscheiben durch die Mieter: mal ganz spießig mit geschorenem Rasen und irgendwelchen Stiefmütterchen ind Reih und Glied, mal mit nützlichem Gemüse und mal mit üppigen exotischen Pflanzen. Die KPD/RZ war nebenbeibemerkt die erste Gruppe, die eine – vom Bezirk auf den Heinrichplatz abgestellte Baumscheibe (ohne Baum) mit einer Sitzbank versah. Bald fingen auch die Künstler an, sich der Baumscheiben vor ihren Ladengalerien bzw. – ateliers anzunehmen – natürlich ebenfalls erst Mal ökologisch inspiriert, aber schon bald platzierten sie auch immer mehr Eigen-”Objekte” darein. Die Blumenläden in den “Problembezirken” freuten sich ob des ständig steigenden Umsatzes. Einige spezialisierten sich geradezu auf Baumscheibengrün. Die Architektin Antonia Herrscher fing an, schon fast systematisch die von den Bürgern gestalteten Baumscheiben zu photographieren. Früher oder später mußte es zu einem ersten Berliner Baumscheiben-Photoband kommen – sowie auch zu einem Bezirkswettbewerb “Unsere Baumscheibe soll schöner werden!” Im Vorfeld kam es in vielen Kneipen zu erhitzten Pro- und Contra-Diskussionen.
Wenn der Schrebergarten die Landwirtschaft des in die Stadt verschlagenen kleinen Mannes ist, dann ist die Baumscheibe der Schrebergarten des ganz kleinen Mannes, meinte eine Freundin verächtlich – und auch die o.e. “Kiez & Kneipe”-Ausgabe war voller Verachtung für diesen neuen urbanen Ökotrend, der bereits pandemische Ausmaße angenommen hat. Der in dieser Kreuzberger Zeitung die Contra-Position vertretende Autor war allerdings zuvor im Suff nachts über den Zaun einer Baumscheibe in der Solmsstraße gestolpert – und zwischen die Blumen und Rabatten gefallen, woraufhin er von den Mietern, die diese Baumscheibe angelegt und seinen Sturz mit angesehen hatten, auch noch beschimpft worden war. Cornelia verstieg sich später sogar zu dem Satz “In einer Straße mit lauter bepflanzten und eingezäunten Baumscheiben möchte ich nicht wohnen.”
Das war aber nun doch übertrieben, fand ich, der eine zeitlang die Dachgärten sowie die Hinterhof-Biotope der meist grünalternativen Mieter in S.O.36 photographiert hatte. In einigen Abschnitten der Oranienstraße sah es, wenn man sich auf einem dieser Dachgärten umkuckte – und dabei in allen Ecken und Nischen sowie Höfen weitere Gärten entdeckte, schon fast aus wie in den Tropen. Natürlich wurden auch diese Biotope nächtens gerne vom juvenilen Amüsierpöbel in Beschlag genommen. Vor allem war es jedoch die ebenso üppige wie teure Bepflanzung dieser Dachgärten und Hinterhöfe denen gegenüber ich die Baumscheiben vorne vor den Türen als geradezu bescheiden empfand. Zudem war dieses Grün im Gegensatz zu jenem öffentlich, d.h. für alle da.
Kurzum: die Baumscheiben vor den Häusern kamen mir vor wie eine vorsichtige, aber nachhaltige Realisierung der blöden, weil englischen Autonomenparole “Reclaim the Street”. Die derzeitig gültige heißt übrigens “Did you ever squatted an airport? – und bezieht sich auf die demnächst anstehende Besetzung des Flughafens Tempelhof, den seine komische CDU-Pseudobürgerinitiativler, die ihn weiter als Flughafen (für Privatjetbesitzer) betreiben wollten, bereits in “Airport” umbenannt hatten. Solche Squatter-Parolen auf Plakaten in Englisch zu verbreiten, zeigt bereits, wie sehr die Linke inzwischen mit dem per Easyjet anreisenden Amüsierpöbel identisch geworden ist.
Man müßte vielleicht jede einzelne Baumscheibe für sich diskutieren. In Neukölln fand ich mehrere Baumscheiben, bei denen die Mieter statt eines Genehmigungsschildes vom Bezirk ein eigenes aufgestellt bzw. an den Baum in der Mitte gehängt hatten: “Nicht kaputtmachen!” oder “Hunde bitte fernhalten!”, aber auch: “Wer das liest ist doof!” und “Vorsicht beim Einparken!” sowie “Straßenbegleitgrün (under construction)”. Außerdem bemerkte sie, dass Füchse und Marder, aber auch Spatzen und Amseln, sowie Mäuse und Ratten, diese Baumscheiben dort als sichere Oasen in den Straßenwüsten benutzen – sie hetzen wie Nomaden oder genauer gesagt: Inselhopper von einer zur anderen. Auf der einen Seite die Straße rauf und auf der anderen wieder runter.
Kann man vielleicht sagen: Während die Baumscheibenbesetzer sich nach draußen vor die Tür bewegen, igeln die Hausbesetzer sich ein, sie ziehen sich von der Straße zurück – bauen sich Hochbetten, Sauna, Veranstaltungsräume und Baumhäuser (im Garten). Der Baum ist nun mal immobil – von altersher sozusagen, aber dass die Autonomen sich freiwillig derart immobilisieren…

Das hier ist das Modell eines russischen Schrebergartens.
5.
Die Mehrheit ist nie produktiv, nur Minderheiten! meinten die französischen Marxisten Gilles Deleuze und Félix Guattari. Im Bürgerhaus der größten friesischen Stadt – Schortens/Heidmühle – las im Frühsommer wie bereits oben erwähnt Wladimir Kaminer einige Kapitel aus einem neuen noch unveröffentlichen Buch über seinen Schrebergarten in Pankow vor. Die Friesen sind eine Minderheit in Deutschland und die Russen in Berlin auch – erst recht im heutigen Friesland, aber beide eint, dass sie einen starken Hang zur Gartenarbeit in ihren Schrebergärten bzw. Datschen haben, wobei jedoch hervorgehoben werden muß, dass die diesbezüglich wahren Weltmeister die Tschechen sind. So besteht z.B. das halbe Werk ihres ersten Nationaldichters Karel Capek aus Gartenliteratur, erwähnt sei sein „Jahr des Gärtners“. Ihr zweiter Nationaldichter Bohumil Hrabal leerte alljährlich ausgerechnet während der 1.Mai-Demonstration in Nymburk die Fäkaliengruben – um seine Landsleute an diesem Festtag olfaktorisch an die wahre Bestimmung des Lebens zu erinnern, außerdem schrieb er die meisten seiner Romane in der Datschensiedlung Kersko, wo jetzt alljährlich der Datschenverein ein Hrabal-Gedächtnisfest organisiert. Zu erinnern sei ferner an die berühmten Prager Dissidenten Vaclav Havel und Pavel Kohuth, die sich nach 1968 auf ihre Datschen zurückzogen, von wo aus sie den Widerstand gegen die Okkupation organisierten und dazu die „Charta 77“ ausarbeiteten. Kohuth ließ sich damals für seine Gartenarbeit sogar von einem Gärtner ausbilden.
Erwähnt sei ferner, dass auch die Bezeichnung Land-Kreis für eine politische Einrichtung mit Verwaltungsaufgaben aus dem Tschechischen kommt – sie geht auf das Wort „kraj (Land) zurück und ist wahrscheinlich den hussitischen Freiheitskriegen zu verdanken. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts versuchte der Preußische Staatsmann Freiherr vom Stein eine seit den Bauernkriegen anstehende und nunmehr nachholende Modernisierung einzuleiten – d.h. nach dem Modell der Städteordnung von 1808 auch im ländlichen Raum die „Selbstverwaltung“ der Bürger einzuführen. Realisiert wurde sein Vorschlag erst in den achtziger Jahren, als die ersten „Kreisordnungen“ erlassen wurden, z.B. für die preußische Provinz Westfalen 1886 und die Rheinprovinz 1887. Heute werden diese und ähnliche „Selbstverwaltungen“ mehr und mehr steuerrechtlich sowie verwaltungszentralistisch ausgehöhlt.
Eine ihrer Regionen haben die Tschechen „Böhmisches Paradies“, ein anderes im Böhmischen Mittelgebirge „Böhmens Garten“ genannt. Das böhmische Mittelgebirge (Ceske Stredohori) war erst keltisch, dann markomannisch und schließlich tschechisch, bis es von (Sudeten-)Deutschen herrschaftlich dominiert wurde, die dann jedoch, ab 1945, fast alle „heim ins Reich“ vertrieben wurden. Zuvor hatten die Deutschen dort die KuK-Garnison Theresienstadt zu einem jüdischen Ghetto und die vorgelagerte Kleine Festung in ein KZ umgewandelt. Heute ist Terezin eine Museumsstadt mit mehreren Gedenkstätten, wo Ausstellungen und Symposien über den Nationalsozialismus und die Judenvernichtung stattfinden.
Das böhmische Mittelgebirge, das sich von Usti nad Labem (Aussig) bis Ceska Lipa (Böhmisch Linde) erstreckt, gleicht einer Ebene, auf der sich etwa 100 erloschene Kegelvulkane, bis zu 850 Meter hoch, erheben. Eine ähnliche Landschaft gibt es sonst nur noch in Japan. Sie ist sehr fruchtbar: Es wird dort u.a. Obst und Gemüse angebaut. Die Gegend um Litomerice und dem nahen Terezin nennt man deswegen auch „Böhmens Garten“. Die barocken Kleinstädte und Dörfer sind zum großen Teil gut erhalten – und ihre Ortskerne seit der „samtenen Revolution“ teilweise wie mit Kamelhaarpinseln renoviert, außerdem haben sich dort amerikanische Banken (vor allem General Electric) und westdeutsche Supermärkte (Lidl und Kaufland) breit gemacht. Auf vielen Kegelbergen befinden sich „romantisch verfallene“ Burgen oder gar Schlösser, von denen einige zu Kurhotels, Seniorenheime und Restaurants umgebaut wurden, andere stehen zum Verkauf.
Vom Tafelberg Rip aus soll einst der Urvater Cech mit seiner Sippe beschlossen haben: „Hier bleiben wir!“ Und so begann vom böhmischen Mittelgebirge aus die tschechische Siedlungsgeschichte. Später haben sich auch Goethe und Alexander von Humboldt für diese Landschaft begeistert, das so genannte „Humboldt-Plateau“ am Buchberg erinnert noch daran. Die tschechische Gründungssage wurde von etlichen Dichtern, u.a. von Jaroslav Seifert, bearbeitet. Und es kamen viele die Gartenarbeit liebende tschechische Künstler und Intellektuelle, die ihre Datschen im böhmischen Mittelgebirge errichteten bzw. in leerstehende Bauernhäuser zogen. Dadurch bewahrten sie die Dörfer vor dem Aussterben. Einige Kegelberge des Mittelgebirges weisen eine Besonderheit auf: In ihren Hohlräumen und Kavernen speichern sie sommers die warme Luft und geben sie im Winter nach oben hin ab, so daß sich dort nie Eis und Schnee hält. Auf einigen Bergen hat sich deswegen oben Lebermoos (Targionia hypophylla) angesiedelt, das nur im Winter wächst. Im Sommer, wenn die Berge kalte Luft oben ausströmen, verdorrt es. Das böhmische Mittelgebirge ist schon seit langem Naturschutzgebiet und die mit Lebermoos bewachsenen Berge sind seit 1951 Naturdenkmäler. Die in diese Gegend gezogenen Städter haben nicht nur alte Höfe und Wirtschaftsgebäude restauriert, sondern kümmern sich auch um Naturschutzbelange – sie pflanzten z.B. in Eigenregie Alleen und renaturierten Dorfteiche. Neuerdings sind sie in einer Bürgerinitiative namens „Kinder der Erde“ organisiert, die gegen den Bau einer Autobahn kämpft. Es handelt sich dabei um die E55 zwischen Hamburg und Istanbul, deren tschechischer Abschnitt, die D8, durch das böhmische Mittelgebirge geführt werden soll. Die Planung dafür wurde bereits 1968 erstellt. Als man sie vor einigen Jahren wieder hervorholte, weil Deutschland und die EU für die Realisierung großzügige Subventionen versprachen, lehnte der tschechische Umweltminister die Streckenführung zunächst ab, woraufhin der Ministerpräsident ihm den Rücktritt nahelegte. Weil der Umweltminister aber seinen Job behalten wollte, stimmte er der Autobahnplanung schließlich doch zu.
Die 1994 gegründete Bürgerinitiative der Intellektuellen wird von den Alteingesessenen nur zögernd unterstützt: „Die Protestunterschrift einer Oma ist mir lieber als die von zehn Städtern,“ meint z.B. der Bürgermeister des kleinen Dorfes Borec, wo u.a. ein Italiener, der in den Fünfzigerjahren vor der Mafia flüchtete, ein Engländer, der Londonder Busse sammelt, ein junger Psychiater aus Prag und der bekannte Botaniker Doktor Faustus leben. Der Protest der Naturschützer und -liebhaber weitete sich trotz der Zurückhaltung der einheimischen Dorfbevölkerung langsam aus. Die Bürgerinitiative möchte zum einen die Autobahntrasse aus dem Mittelgebirge raus durch das Braunkohletagebaugebiet von Most führen und fordert zum anderen zwischen den Orten Dobkovicky und Radejcin den Bau eines 3,35 Kilometer langen Tunnels. Zwar hat der Investor bereits grünes Licht aus Prag für den oberirdischen Autobahnbau bekommen, gleichzeitig haben aber der Ombudsmann im Amt für Bürgerrechtsschutz und einige andere Kontrollbehörden Bedenken dagegen angemeldet. Ihre Berichte stehen inzwischen im Internet. Unterstützung findet die Bürgerinitiative darüberhinaus bei der Architekturfakultät der Technischen Universität (CVUT) von Prag, die sich in einem Gutachten ebenfalls für den Tunnelbau ausspricht. Daneben haben sechs von einer oberirdischen Trassenführung betroffene Anwohner Klagen gegen den Autobahnverlauf eingereicht, was erst einmal eine aufschiebende Wirkung beim Bauvorhaben hat. Die Bürgerinitiative verspricht jedoch, wenn die Bezirksregierung von Usti nad Labem sich für den Bau des Tunnels entscheidet, werde sie ihre Klagen zurücknehmen. Der Tunnel hätte ihrer Meinung nach zudem folgende Vorteile: Die Strecke würde sich um 640 Meter verkürzen; sie hätte keine Steigungen oder Gefälle; den Dörfern Prackovice und Litochovice bliebe der Autolärm erspart; die Touristen würden die Nichtverschandelung der Landschaft honorieren; es käme zu keinen Verkehrsunfällen mit Wild und Vögeln; und der Berg müßte nicht gegen Erdrutsche abgesichert werden.
Tschechien erlebte nach 1989 durch die Verschleuderung des Volkseigentums an ausländische Investoren bzw. Konzerne zunächst einen scheinbaren Wirtschaftsboom. Inzwischen stagniert die ökonomische Entwicklung jedoch und es droht auch hier die Abwanderung ganzer Industriezweige – in weiter östlich gelegene Länder, wo die Löhne noch niedriger sind. Da den markt- und privatwirtschaftlich orientierten Politikern jedoch bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze die Hände gebunden sind, können sie fast nur noch durch große Bauvorhaben wie Behördenunterkünfte, Autobahnen, Flughäfen etc. regionale Wirtschaftskonjunkturen induzieren bzw. simulieren. Insofern kommt dem „Streit“ um die Streckenführung der D8 durch das böhmische Mittelgebirge eine wichtige Bedeutung zu, die weit über Tschechien hinausreicht. Schon haben ähnliche Bürgerinitiativen in Sachsen, wo im Zuge des E55-Baus bereits eine Umgehungsstrecke für Dresden fertiggestellt wurde, mit der böhmischen BI Kontakt aufgenommen.
Gerade in den von besonders hoher Arbeitslosigkeit betroffenen ostdeutschen Ländern lassen sich die Politiker immer gewagtere und größere Bauvorhaben einfallen, wobei nicht nur zigtausende von Hektar Ackerland oder Wald versiegelt werden, sondern ganze Dörfer verschwinden müssen. Bislang kam es hier zu solchen Flächenenteignungen nur, wenn Belange der Landesverteidigung, der nationalen Rohstoff- bzw. Energieversorgung und des Infrastrukturausbaus (Straßen, Brücken, Kanäle etc.) tangiert waren. Angesichts der steigenden Arbeitslosigkeit sind die Gerichte jedoch zunehmend bereit, auch aus ganz anderen, niederen Gründen Enteignungen zuzulassen, wenn die Bauherren nur vollmundig genug versprechen, dort viele neue Arbeitsplätze zu schaffen bzw. bereits vorhandene mit ihren Bauvorhaben langfristig zu sichern. So sollen z.B. die von Experten so genannten „Nonsens-Airporte“ in Hof/Plauen und Kassel-Calden nun gigantisch ausgebaut werden, letzterer für 151 Mio Euro. Die brandenburgischen Großprojekte Cargolifter und Lausitz-Ring erwiesen sich bereits als Fehlplanungen, ähnlich wie hunderte von überdimensionierten Kläranlagen und Gewerbeparks auf dem Land und die neue Chipfabrik in Frankfurt/Oder sowie das Space-Center in Bremen, das schon kurz nach der Einweihung Konkurs anmelden mußte. Bei all diesen Pleiteprojekten ging es primär um vom Staat forcierte und großzügig geförderte Arbeitsplatz-Schaffungsmaßnahmen. Auch beim Autobahnbau im böhmischen Mittelgebirge meinen viele Experten, dass er gänzlich überflüssig sei, weil der Gütertransport ebenso gut und wie bisher – mit Schiffen auf der Elbe und auf Schienen – erfolgen könnte.
Desungeachtet eröffnete der Verkehrsminister Manfred Stolpe im Sommer 2005 ein weiteres Teilstück der Autobahn 17 zwischen Dresden und Prag. Die gesamte Strecke soll bis Ende 2006 fertig sein. Ähnliche Konflikte wie auf dem Abschnitt, der durchs Böhmische Mittelgebirge führt, gibt es seit einiger Zeit auch beim Bau einer neuen Autobahn im „Böhmischen Paradies“ (Cesky ráj). Diese „Felsenstadt“ liegt auf halbem Wege zwischen Prag und Zittau. Dort soll nun eine Autobahn Liberec mit Hradec Králové verbinden. Um die einzigartige Felsenlandschaft zu retten, haben sich dort Bürgerinitiativen und Umweltschutzorganisationen zu einem Kampfbündnis „SOS Böhmisches Paradies“ zusammengeschlossen. Gleichzeitig beantragte die Region Cesky ráj bei der Unesco, dass ihre „Felsenstadt“ als Naturdenkmal anerkannt wird. Derzeit sind drei Streckenvarianten im Gespräch: So ließe sich die bestehende R 35 vorsichtig ausbauen. Die EU hingegen favorisiert zwei andere Lösungen – eine „Südvariante“ um das Böhmische Paradies herum, für die sich auch die Gemeinden und Umweltschutzorganisationen aussprechen. Im Gespräch ist zudem ein „Nordkorridor“, der allerdings das Böhmische Paradies „berühren“ würde.
6.
Auf meine Frage an einige Jever Friesen, ob sie auch so eine Kleingartenmacke haben, antworteten die Kaminer und mich in der Kreisstadt begleitenden Sparkassenmanager unisono: „Und wie!“ Auf unseren Fahrten kreuz und quer durchs Jeverland sahen wir dann vor allem Männer, die ihren Vorgartenrasen mähten – und das selbst an Sonn- und Feiertagen. In allen Variationen: elektrisch, mit Motor, mit Muskelkraft, mit Mähbalken, mit Rasenkantenschere, auf einem gelben, roten oder grünen Selbstfahrgerät usw.. Selbst links und rechts der Landstraßen und der langen Privatalleen, die zu den großen alleinstehenden Bauernhöfen führten, war der Rasen auf 3-3,5 Zentimeter gestutzt. Auch Wladimir kam dann in seinen Texten über die Pankower Kleingartenkolonie und speziell über sein dortiges Laubenleben immer wieder auf das Rasenmähen zurück. Es stand ihm eine Kommission des Kleingartenvereins ins Haus, die für den ordnungsgemäßen Zustand der Gärten Punkte verteilte und z.B. gerne verwilderte Rasenflächen kritisierte.
Das erinnerte mich an einige Westberliner Kleingartenkolonien, in die ab Ende der Siebzigerjahre ein Linker nach dem anderen einsickerte (so wie jetzt die Russen in die Pankower Kolonie) – und dann mit dem Vereinsvorstand wahre Kämpfe führten, um ihre kleinen Rasenflächen nicht ständig mähen zu müssen. Hierbei kamen ihnen die Türken und die Grünen entgegen. Erstere, indem sie einen öffentlichen Rasen nach dem anderen, an denen Schilder „Betreten verboten“ standen, als Liege-, Spiel- und Grillwiesen benutzten. Die Deutschen taten es ihnen später nach. Und die Grünen setzten es dann durch, dass z.B. in den Parks immer mehr Rasenflächen nicht mehr gemäht wurden, weil man sie arbeitskräftesparend als „Langgraswiesen“ ausschilderte. In den Westberliner Kleingartenkolonien gab es gegen so etwas berechtigten Widerstand: „Da wehen die ganzen Unkrautsamen in meinen Garten!“
Dennoch setzte sich auch hier langsam der nahezu ungemähte Langgrasrasen durch – und trug so mit dazu bei, dass inzwischen die Flora und Fauna in der Stadt weitaus artenreicher ist als auf dem Land, das man mit seinen agrarischen Monokulturen geradezu als verödet, wenn nicht gar tot bezeichnen muß, weswegen es zunehmend unverständlicher wird, warum die Umwelt- und Naturschützer sich nach wie vor auf das Land konzentrieren – und nicht auf die Städte, von wo aus schon immer der Fortschritt ausging. Irgendwann wird man also auch im Jeverland den letzten Rasenmäher ins Museum tragen – und die Ferien-auf-dem-Erlebnishof-Touristen bekommen vom Bauern-Animateur eine Sichel in die Hand, wenn sie sich partout in kurzes Gras legen wollen. Im übrigen hat natürlich auch dieses anhaltend Böse etwas Gutes bewirkt: So sehen z.B. die Drosseln und Stare die Regenwürmer auf Kurzrasen schneller, was bewirkt, dass die Regenwürmer immer schneller werden müssen, um sich in Sicherheit vor ihren Freßfeinden zu bringen, was widerum bewirkte, dass auch die Drosseln und Stare immer schneller und pfiffiger wurden – kurzum: das ewige Rasenmähen in Mitteleuropa hat die hier lebenden Drosseln, Stare und Regenwürmer immer intelligenter und kreativer gemacht.
7.
Während der Sohn, Gerichtspräsident Daniel Paul Schreber, mit seinen „Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken und durch die Freud’sche Analyse seiner Paranoia berühmt wurde, ist sein Vater, Professor Daniel Gottlieb Moritz Schreber, wegen seiner Leipziger Grün- und Sportflächeninitiative für sozial benachteiligte Familien bekannt geworden. Daraus entwickelte sich um die Jahrhundertwende die „Schrebergarten-Bewegung“. In Wien sprach man von „Heimgärten“, was auf Peter Roseggers gleichnamige Literaturzeitschrift zurückging. Auch in Berlin gibt es seltsamerweise eine Kolonie „Heimgarten“: am Steglitzer Munsterdamm 53. Sie feierte im Sommer 2004 ihr 100-jähriges Jubiläum – mit dem „Heimgarten-Quartett“ und eigenen, von den chinesischen, jugoslawischen, türkischen sowie deutschen Kleingärtnern zubereiteten Spezialitäten. Einer, der Kolonist Gerhard Niederstucke (Pfarrer i. R.), hat dazu rechtzeitig eine „Festschrift“ im Steglitzer Christian Simon Verlag veröffentlicht. Ihr kleiner „Garten Eden“ war wie das große Vorbild immer wieder bedroht: 1931 wurde ein Teil des Geländes planiert und es entstand dort eine „rauchfreie Siedlung“ (also Wohnungen, die nicht mehr mit Kohle und Holz, sondern mit Fernwärme vom Kraftwerk Teltow geheizt wurden). 1932 baten die verbliebenen 83 Vereinsmitglieder, die in ihrer Mehrheit arbeitslos geworden waren, das Bezirksamt, den Pachtzins von 6,5 Pfennig pro Quadratmeter auf 2 zu senken. 1934 wird ihnen eine Reduktion von 2,5 Pfennig bewilligt, gleichzeitig ist jedoch von einem „Stadtgruppenführer“ die Rede und dass die Laubenpieper fortan im „Reichsbund der Kleingärtner“ zusammengefasst sind. Wenig später will man aus der Kolonie „Heimgarten“ gar ein paramilitärisches „Ertüchtigungsgelände“ machen.
Dieser Kelch ging jedoch an den Steglitzern – zusammen mit dem Dritten Reich – vorüber. Ihre Selbstversorgungsanlage wurde zunächst – nach 1945 – sogar noch aufgewertet: mit Hühner- und Kaninchenställen, während des Ersten Weltkriegs hielt einer dort sogar eine Kuh. Aber 1972 beschließt das Bezirksamt den Bau eines Berufsbildungs-Oberstufenzentrums – und kündigt 64 Kleingärtnern ihre Parzellen – insgesamt eine Fläche von fast 40.000 Quadratmetern. Die verbliebenen 31 Mitglieder der Kolonie „Heimgarten“ verfügen danach nur noch über 8.780 Quadratmeter, wovon sie auch noch durch Abtrennung von Gartengelände acht gekündigten Mitgliedern neue Parzellen einrichten. Zwei der altruistischen Abtreter behalten sich aber bei einigen Obstbäumen bzw. -sträuchern ein „Mitpflückrecht“ vor: Man spricht deswegen in der Folgezeit vom „Helke-Apfel“ und von der „Hartlep-Brombeere“. Die Berufsfachschule wird wegen Asbestverseuchung schon Mitte der Achtzigerjahre wieder geschlossen und 1995 abgerissen. Dafür entsteht dort zusammen mit einem Sportplatz ein noch größeres Oberstufenzentrum für Farbtechnik und Raumgestaltung, dem die „Heimgarten-Kolonie“ als „Erweiterungsfläche“ dienen soll. Dies kann jedoch der einst eher arbeiterlich und links orientierte Verein zusammen mit der Nachbarkolonie „Schutzverband“ (die von Beamten dominiert und einst „gleichgeschaltet“ war) verhindern. Zwei „Heimgärtner“ traten nach dem Krieg der SED bei, wovon der eine, Gartenfreund Skubisch – er war bis 1933 Vorsitzender der Steglitzer SPD gewesen -, regelmäßig Urlaub auf der Krim machte. Der Gartenfreund Tworoger war dagegen in der CDU, sowie Steglitzer Baustadtrat und Mitglied in der Jüdischen Gemeinde.
Die Politik war und ist jedoch Privatsache bei den Laubenpiepern. Deswegen kam es 1983 auch zu einem Konflikt, als der Sohn des Kolonisten Reiß die Parzelle in Abwesenheit seines Vaters zu einem „Friedensgarten“ umfunktionierte und dort Zusammenkünfte so genannter „Friedensfreunde – darunter Ausländer“ organisierte. Der Vereinsvorsitzende Hartleb wandte sich dieserhalb an seinen Steglitzer Bezirksverband sowie an die Rechtsabteilung des Landesverbandes der Kleingärtner. Letztere befand, dass solche Meinungsäußerungen auf den Parzellen gestattet sein müssten. Der Chronist Niederstucke merkt dazu an, die vom Stud6.enten Reiß damals veranlasste Diskussion in der Parzelle 1a sei „eine der vielen tausend kleinen Beiträge dazu gewesen, dass die raketenbestückte Ost-West-Konfrontation nicht tödlich endete“. Seine Chronik schließt mit einer Vorstellung all der seitdem neu hinzugekommenen „Ausländer in der Steglitzer Kolonie Heimgarten“ – und einem großen Gruppenfoto in Farbe.

Die da fängt glaube ich bald an zu blühen.
8.
Blumen gehören zu den schon lange globalisierten Produkten, dementsprechend umtriebig müssen die Blumen-Großhändler sein. Es gibt inzwischen zwölf Großmärkte am Berliner Stadtring, von denen die Einzelhändler ihre Ware beziehen. Hinzu kommen Blumenmärkte, die nicht nur den Wiederverkäufer, sondern auch den Endverbraucher bedienen und meist als Cash-&-Carry- oder Garten-Center firmieren. Daneben erweitern die Supermärkte, Tankstellen und Heimwerkermärkte ständig ihr Blumenangebot. Schlechte Zeiten also für den Fachhandel – die Blumenläden in Berlin – sollte man meinen. Zumal die Leute bei steigenden Lebenshaltungskosten zuerst an den Blumen sparen. Andererseits kommt es laufend zu neuen Büro- und Geschäftseröffnungen sowie Umzügen von Verbänden, Vereinen und ganzen Ministerien nach Berlin. „Der Markt ist in Bewegung“, sagt man.
Allein das kleine Auswärtige Amt (AA) gibt etwa 200.000 Mark jährlich für Blumen aus. Alle Rednerpulte und Veranstaltungen sowie Büfetts werden mit Pflanzen bzw. Tischgestecken geschmückt. Außerdem bekommen der Minister, die zwei Staatssekretäre und die zwei Staatsminister regelmäßig frisches Grün auf ihre Schreibtische. Das wird über das Protokoll abgerechnet. Diese ganze Blumenpracht versteckt sich hinter unterschiedlichen Haushaltstiteln, etwa bei Restaurantabrechnungen, sodass der AA-Blumenetat in Wirklichkeit noch viel höher ist. Einen noch größeren Blumenbedarf haben die über 100 Botschaften in Berlin, da sie fast ausschließlich hübschen Repräsentationspflichten nachkommen müssen. Darüber hinaus legen in den ganzen Behörden und Botschaften auch die Mitarbeiter großen Wert auf Blumen und Topfpflanzen in ihren meist kahl-modernen Büros.
Eine Floristin in Mitte, die jetzt schon viele ihrer Flobs (Floristische Objekte) an Regierungsangestellte verkauft, meint, dass die meisten von ihnen ihre Büropflanzen beim Umzug aus Bonn mitgebracht hätten. Berlin habe einen schlechten Ruf, was die Qualität der Blumen betreffe. Das mag in Westberlin an den vielen Studenten und Singles liegen, die sich eher theoretisch mit Blumen befassen. Erinnert sei an FU-Seminare über „Das Spießige der Nelke“ und den „Faschismus von Topfblumen“. Selbst beim regelmäßigen Plündern der Hanfpflanzen im Botanischen Garten bewiesen die angehenden Akademiker nicht immer Sachkenntnis. Grad neulich schenkte ein Mitarbeiter der Grünen einer Frau einen Strauß Frühlingsblumen – ohne zu merken, dass er ihr aus Versehen Stoffblumen gekauft hatte. Die (parteilose) Beschenkte war erschüttert. In Ostberlin war man „blumenbewusster“. Dort gab es zwar kaum Importblumen, aber wegen des ständigen Kaufkraftüberhangs waren die DDR-Bürger in der Lage, geradezu Unsummen für Blumen auszugeben. Das Angebot wurde zudem durch die vielen Kleingartenbesitzer ergänzt. Die Massenware kam aus den volkseigenen bzw. genossenschaftlichen Großgärtnereien. Berühmt waren deren Nelken und Chrysanthemen sowie die Kamelien, die meist aus Leipzig kamen. In Westberlin gab es nur den genossenschaftlichen Blumengroßmarkt an der Friedrichstraße, der sich vor 113 Jahren aus der Linden-Markthalle entwickelte. Nach der Wende musste dieser Markt einen Teil seiner gepachteten Flächen abgeben, dafür wurde gerade für mehrere Millionen Mark die Halle renoviert.
Viele Westberliner Gärtner und Großhändler klagen über starke Umsatzeinbrüche seit den blühenden Achtzigerjahren. Einige von ihnen treffen sich regelmäßig auf der Trabrennbahn Mariendorf, wo sie eigene Rennställe besitzen. Westdeutsche Blumenhändler meinen, seit den vielen Blumengroßmärkten am Stadtring sei das Angebot in der Stadt besser geworden: Konkurrenz belebe das Geschäft. Es gebe jetzt jedoch große Unterschiede zwischen den einzelnen Märkten. So sei die Ware auf dem Cash-&-Carry-Markt in Rangstedt miserabel, und der Laden werde lieblos geführt. Der in Buchholz sei jedoch ganz prima. Der Holländer am Olympiastadion habe gute Sonderangebote und Kölle im Einkaufscenter Havelpark zu viel Kitsch im Angebot. Die Schnittblumen kommen mittlerweile von überall her. Die Rosen der nächtlichen Rosenverkäufer stammen aus Venezuela. Sie werden eingeflogen. Das sei günstiger und auch sinnvoller, als sie hier in Gewächshäusern mit Kunstlicht und -wärme zu produzieren, sagen die Blumendealer.
Die Großhändler kaufen ihre Schnittware auf Versteigerungen. Anders bei den Topfpflanzen, die meist aus Europa kommen. Hierbei müssen die Großhändler die Gärtnereien kennen: Eine Warenprobe reicht nicht. Sie müssen die Kulturen sehen, das heißt regelmäßig dort hinfahren. Dabei kommen schnell 100.000 Kilometer im Jahr zusammen, Dafür kennt jeder jeden: „Wir sind eine große Familie“, heißt es „und informieren uns telefonisch ständig über alles Neue“. Die in Deutschland so beliebten Margeriten kommen etwa aus der Nähe von Genua, Alpenveilchen aus Dänemark, Topfrosen aus Polen, Araucaria und Pseudo-Bonsai-Bäumchen aus Sizilien, Azaleen aus Sachsen. Und die zu Figuren geformten Koniferen und Liguster sind eine Spezialität der Toskana. Belgische Gärtnereien boten heuer Geldbäume in Zinkeimern an und die süddeutschen ungespritztes Katzengras in flachen Schälchen sowie vierblättrigen Klee – als Glücksgeschenke zum Jahreswechsel. Sie wurden jedoch von den Kunden nicht gerade überschwänglich angenommen. Überall arbeitet man an neuen Züchtungen.
Die Mode bei den Pflanzen ebenso wie bei den Flobs wechselt immer schneller. Gerade ziehen die Zimmerpalmen wieder an. Ein holländischer Händler bezieht seine Palmensamen – mit Schwarzgeld – aus Australien, anschließend verkauft er sie an Gärtnereien in Spanien. Noch immer wird der größte Teil des Blumenumsatzes vom Einzelhandel (der ca. 50 Prozent draufschlägt) erbracht, die Supermärkte machen nur 15 bis 22 Prozent aus. Sie kalkulieren flacher, dafür ist ihr Angebot meist ungepflegter. Ein Lastwagen mit rund 20.000 Topfpflanzen kostet von Palermo nach Berlin etwa 6.000 Mark. Auf solche Speditionen haben sich vor allem die Holländer spezialisiert. Die Blumengroßmärkte versuchen durch Fusionen voranzukommen. So wie die US-Supermarkt-Kette Wall Mart, die hier auch durch Aufkäufe Fuß fassen will und in diesem Zusammenhang ihren zukünftigen deutschen Blumenlieferanten schon mal zu „strategischen Allianzen“ rät. Dadurch können zum Beispiel die Lieferstrecken verkürzt werden.
Unlängst verbanden sich die beiden Branchengrößten NBV (Neusser Blumen-Versteigerung) und UGA (Union gartenbaulicher Absatzärkte) – beides westdeutsche Gärtnerei-Genossenschaften, die sich nun auch und vor allem im Osten ausbreiten. Einer ihrer Großmärkte befindet sich in Langerwisch. Daneben betreibt der schleswig-holsteinische Großgärtner Petersen noch zwei Märkte bei Berlin: in Buchholz und in Fretzdorf. Dort hat er zusammen mit einem Holländer noch eine weitere Großgärtnerei aufgebaut. Im Gegensatz zu den Genossenschaften haben die Privaten nichts gegen den Endverbraucher als Kunden (z.B. Hotels), auch sind ihre Öffnungszeiten nicht auf den frühen Morgen beschränkt, wie es beim Kreuzberger Blumengroßmarkt der Fall ist. Der Branche fehlt es mittlerweile an Fachpersonal mit Führungsqualitäten, deswegen kann ein guter Marktleiter 10.000 Mark monatlich verlangen.
In den Gärtnereien arbeiten mehr und mehr Polen, Tamilen und Russlanddeutsche. Der Gartenbau ist aber auch immer noch ein beliebter Lehrberuf. Die Ernüchterung bei den Lehrlingen, dass sie es bloß mit einer Massenware zu tun haben, die mehr und mehr künstlich hochgepäppelt und sogar gedopt wird, kommt schnell. Bei den Floristinnen geht die Entwicklung hin zum kunsthandwerklichen Objekt, wobei die Blume bzw. Pflanze nur noch Beiwerk ist. Generell geht der Anteil der Topfpflanzen am Umsatz zurück, zugunsten von Schnittblumen, die immer frühzeitiger ins Angebot kommen müssen: Tulpen also möglichst schon im Oktober, Love-Parade-Sonnenblumen ganzjährig – und die Flobs mehrsprachig. „Sag es mit Blumen!“, hieß einmal der Werbespruch des westeuropäischen Blumenhändler-Netzwerks Fleurop.
9.
In unseren Schulbiologiebüchern war in den Sechzigerjahren noch neben dem Mendelschen Erbsen-Vererbungsschema das der Familie Bach und ihrer Musikalität abgebildet. Für viele Genetiker gibt es – bis heute – kaum einen Unterschied zwischen Pflanzen, Tieren und Menschen, d. h. ihre materialistischen Mikroanalysen sind mit sozialen Makropolitiken verknüpft. Sie glauben, dass die Minderwertigen aufgrund ihrer Vermehrungsfreudigkeit die Hochwertigen an den Rand drängen und dass man etwas dagegen tun muss. Bei den Menschen geschieht dies einerseits, indem man Entwicklungshilfegelder mit dem Zwang zur Massensterilisation (z. B. in Indien) verbindet, und andererseits, indem unfruchtbaren reichen weißen Frauen mit kompliziertester Technik doch noch zu einem Wunschkind verholfen wird. In einem zusammen mit Ulrike Schaz 1996 herausgegebenen Buch „Berechnung und Beschwörung“ ist die Genetik- und Faschismusforscherin Susanne Heim den letzten Verfeinerungen dieser G-7-Politik nachgegangen.
Nun ist sie noch einmal auf die Hochzeit dieser wissenschaftlichen Weltanschauung zurückgekommen – auf die Pflanzenzucht und Agrarforschung im Nationalsozialismus – und hat eine Aufsatzsammlung über „Autarkie und Ostexpansion“ herausgegeben. Gleich im ersten Beitrag – von Jonathan Harwood – ist dabei von „Politischer Ökonomie“ die Rede: im Zusammenhang der Saatgutverbesserung und -vereinheitlichung und den daran anknüpfenden deutschen Züchtungsforschungen bis 1933. Vier Jahre später spricht der Züchtungsforscher Wilhelm Rudorf angesichts der bevorstehenden rassistischen Osterweiterung von den „politischen Aufgaben der deutschen Pflanzenzüchtung“. So heißt dann auch der Beitrag des Wissenschaftshistorikers Thomas Wieland, in dem er nach „den Ursachen für die auffallende Bereitschaft der akademischen Pflanzenzüchter, ihre Forschung an nationalsozialistischen Zielen auszurichten“ fragt. Nach den Erfahrungen des verlorenen Ersten Weltkriegs ging es darum, die „Ernährungsfreiheit“ des deutschen Volkes sicherzustellen, was im Kontext der deutschen Expansionspolitik ab 1941 bedeutete, dass gleichzeitig Millionen von Menschen im Osten dem Hungertod ausgeliefert wurden, weil sie nun als „unnütze Esser“ galten.
Für die Pflanzenforscher tat sich dabei jedoch ein Eldorado auf, denn ihnen fielen dutzende polnische und sowjetische Agrarinstitute sowie Versuchsgüter in die Hände, gleichzeitig wurden – u. a. vom späteren DDR-Genetikpapst Hans Stubbe – „Sammelkommandos“ durchgeführt, „um Wild- und Kulturpflanzensortimente in den besetzten Gebieten zu rauben“. Die Sowjetunion hatte zunächst einen Vorsprung in der Saatgutverbesserung – und in der genetischen Grundlagenforschung. Dann war sie jedoch ab 1932 von „jeglicher Verbindung biologischen Gedankenguts mit sozialplanerischen Konzepten“ abgerückt. Nicht nur wurde die Eugenik als faschistisch kritisiert, die sowjetische Genetik wurde faktisch liquidiert, und einige Genetiker kamen sogar in Arbeitslager. Während die bürgerliche Forschung bis heute eher auf die Hochzüchtung erworbener Eigenschaften setzt, ging der Lyssenkoismus umgekehrt von der Möglichkeit der „Umerziehung“ sogar von Pflanzen aus: Keimlingen wurde Intelligenz attestiert und Setzlingen solidarisches Verhalten.
Einer der sowjetischen Genetiker, Timofejew-Ressowsky, konnte sich diesem revolutionären „Wahn“ entziehen, ging nach Berlin und brachte es sogar zum bedeutendsten Genetiker des „Dritten Reiches“, seine Forschungsergebnisse veröffentlichte er u. a. in Der Erbarzt. Tatsächlich kann man sagen, dass die deutsche Pflanzenforschung direkt in Auschwitz kulminierte: Es gab dort eine Anlage zur Kautschukpflanzenzüchtung. Die Wissenschaftler trugen nicht selten SS-Uniformen, auf der anderen Seite betrieb die SS selbst ein eigenes Pflanzenforschungsinstitut. Im Sammelband von Susanne Heim befasst sich nun Michael Flitner mit dem damaligen „genetischen Diskurs“ im internationalen Vergleich – unter dem Aspekt der „agrarischen Modernisierung“. Sowohl in Russland als auch in den USA und in Deutschland ging es zunächst um die Verbesserung der Erträge von Nutzpflanzen, um die Versorgung ihrer Bevölkerungen zu gewährleisten, in Deutschland noch forciert durch die Erfahrung der „Hungerwinter“ des Ersten Weltkriegs. Hier entwickelt sich daraus eine zunehmende Affinität zwischen Nationalsozialismus und Eugenik bzw. Rassenhygiene, die als „antiindividualistische Genpool-Orientierung“ bezeichnet wird. Während man in den USA ab Ende der Zwanzigerjahre mehr und mehr von der Eugenik abrückt, wird in der UdSSR mit der Genetik auch gleich die gesamte bürgerliche Biologie verworfen.

Das haben die von meiner Frau angestellten Rußlanddeutschen alles neu angepflanzt.
10.
„Ich vermöchte kaum zu sagen, wie viele Freuden ich den weißen Mäusen verdanke,“ so beginnt ein Kapitel des Buches „Meine Tiere“ von Theodor Lessing. Der 1933 von den Nationalsozialisten in seinem tschechischen Exil ermordete Philosoph widmete es 1926 seiner Tochter Ruth. Im Jahr darauf veröffentlichte er ein weiteres Buch – über „Blumen“. Beide wurden nun im Rahmen einer Gesamtausgabe seiner Werke vom Verlag Matthes und Seitz neu aufgelegt, und dazu noch um einige im „Prager Tagblatt“ zwischen 1928 und 1933 erschienene Aufsätze ergänzt. Bekannt wurde der Hannoveraner Professor, der 1925 wegen einer charakterologischen Hindenburg-Studie seinen Lehrstuhl verlor, mit einem Buch über den Antisemitismus „Der jüdische Selbsthaß“ sowie mit seiner Philosophiekritik „Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen“.
In den zwei Büchern über Blumen und Tiere, die meist auf seinen Erfahrungen mit Vertretern verschiedener Arten basieren, verficht Lessing die These, dass die Domestikation und Züchtung sie ihrem wilden Leben in Freiheit entfremdet habe – zum Schlechteren hin. So beschreibt er z.B. den Truthahn, „Heiliger Vogel der untergegangenen Welt, stolze Seele der Urwälder von Louisiana“, der heute „auf allen Hühnerhöfen heimisch und betriebstätig“ ist, als einen „Zerbrochenen: Wenn ich dich kollern und toben sehe, dann lache ich nicht mehr, wie ich als Kind über dich lachte. Ich nehme den Hut ab und sage: ‚Das ist mein großer Lehrer Arthur Schopenhauer. Das ist mein geliebter Johannes Scherr. Das ist Eugen Dühring. Das ist August Strindberg. Das sind alle Besten meines Vaterlandes. Verbittert… jawohl verbittert!'“ Auch das so lange gezähmte und gezüchtete Pferd, in dem immer „irg9.endein Stück Irrsinn lauert“ ist ihm ein Symbol jenes Weltprozesses, den er „Untergang der Erde am Geist“ nennt. „Der Eindruck eines lastenden Wahnsinns verschwindet“ dagegen, wenn man dessen nahe Verwandte (Zebra, Tapire), die noch im „ursprünglichen Naturzustand“ leben, betrachtet. In ihrer domestizierten (vergeistigten) Form dagegen anverwandtschaften sie sich fatal dem Menschen – als eines aus der Natur herausgetretenen Geistesschaffenden.
Beim Spiel mit dem Lämmchen seiner Ziege im Garten stößt ihm die „Gleichheit unserer Naturen“ dagegen in umgekehrter Weise auf, was noch durch den Umstand gefördert wird, „daß wir Milchbrüder sind“, denn Lessing und das Lämmchen Nanekobo leben gleichermaßen von der Milch der Mutterziege. Wenn sie auf dem Rasen spielen, stoßen sie mit tief gesenktem Kopf gegeneinander und reiben sich die Stirne: „Man berennt sich gegenseitig mit dem Kopf und versucht übereinander hinwegzuspringen. Es ist eine Sportübung, die ich vom akademischen Leben her gewohnt bin…Wir sind beide hervorragende Kopfarbeiter.“ Eine ähnlich geistige Nähe spürt Lessing aber auch bei quakenden Fröschen, was er jedoch eher abfällig registriert: „Wenn ich nämlich sagen sollte, welche Erscheinung in der Menschenwelt schon vorgebildet liegt im Dasein der Frösche, so kann ich nur sagen: ‚Kulturbetrieb’…Sie sitzen im Sumpf und ‚produzieren‘.“ Das haben sie mit vielen Dichtern und Künstlern gemeinsam, die sich ebenfalls durch eine „anatomisch bedingte Hypertrophie der Sprechzentren im Schläfenlappen und der Ausdruckszentren im dritten Ventrikel des Großhirns auszeichnen“.
Wir haben es aufs Ganze seiner Tiergeschichten mit einer doppelten geistigen Bewegung zu tun: Er setzt den Menschen (und sich selbst) herab („Die verfluchte Kultur“, so ein weiterer Buchtitel von Lessing), um dem Tier nahe zu kommen, gleichzeitig erhöht er das Tier, vor allem das wilde, aus dem nämlichen Grund: Der Anarchist Lessing hat Kropotkins Studien über die „Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt“ noch an Empathie zu überbieten versucht, um (wieder) mit allen auf gleicher Augenhöhe zu verhandeln – bis hin zu den Pflanzen, denn „Natur spricht durch die Blumen von uns selbst“. Deswegen lassen sich auch „durch Beobachtung eines Blumenstraußes eine Fülle Seelenkunde gewinnen“, mehr noch: „Die Blume ist der Stern und Kern der Natur, indem sie aus Verwesung und aus all dem durch Tier und Mensch geschaffenen Abfall des Kreislaufes wieder Frieden und Schönheit gewinnt“. Erst einmal gilt aber in bezug auf den Gegensatz zwischen wilden und gezüchteten Formen das selbe für die Flora wie für die Fauna, denn neue Blumensorten haben laut Lessing bloß eine begrenzte Lebensdauer: „Nur der natürliche Same hat die dunkle Kraft, eine Art am Leben zu erhalten. Die künstlich gezüchteten Blumen dagegen sind wie die Genies der Dichtung und des Geistes: Höhepunkte einer Entwicklungsreihe. Nach ihrem Erscheinen schlägt die Gattung wieder in die Wildheit zurück.“ Sie sind aber auch noch etwas anderes: Manche Blume könnte man „als ein festgebanntes Insekt“ bezeichnen – oder andersherum: „viele Insekten, zumal die Bienen und Schmetterlinge als frei bewegliche Blumen“. Diese mit den höher entwickelten Arten zunehmende „Freiheit“ – „das Heraustreten bewegter und bewegender Willensmächte in Pflanze, Tier und Mensch aus der ruhenden Schwere des Vororganischen“ – könnte aber auch als ein „Vorgang des Lebensverminderns und das Absterbens“ verstanden werden.
Lessing fügt damit seiner radikalen Biologie die letzte Konsequenz hinzu: Wenn beispielsweise „der Hund ein durch jahrtausendelange Zucht geknebelter und sozusagen in sich hineingeprügelter Wolf“ ist, und „die Biene das Leben dem Werk opfert, die Wespe dagegen alles Werk dem Leben opfert“ – dann entfernen wir uns mit jeder Verfeinerung und Hochzüchtung vom „Wesen“ – das der stets verbrecherischen „großen Einzelpersönlichkeit“ entgegensteht. Das letzte Kapitel in Lessings Blumenbuch heißt dann auch „Steine“: Von ihnen ist „zu erfahren, was ich auf Euren Märkten verlernte: Leben.“ Für Charles Darwin war sein aus den Erfahrungen der Tier- und Pflanzenzüchter gewonnener Begriff der „natürlichen Selektion“ zwar kein teleologischer Prozeß mehr, aber ein teleonomischer, das heißt ein Prozeß mit Zweckmäßigkeit ohne Zweck, wie Wolfgang Lefevre das mit Kant nennt: „Es ist diese teleonomische Eigentümlichkeit der Beziehungen unter den Lebensformen, die in ihren Entwicklungsprozeß Tendenz hineinbringt, eine Tendenz, die man als Tendenz zur Entwicklung und Optimierung der ’natürlichen Technologie‘ (Marx) bezeichnen kann. Der Entwicklungsprozeß der Lebensformen hat so eine Entwicklungs-‚Logik‘; er unterliegt den Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung der ’natürlichen Technologie'“. Indem Theodor Lessing demgegenüber die fortschreitende Denaturierung der Lebensformen verwünscht – und ihre Entwicklungslogik beklagt hat, gehört er in die Reihe der entschiedenen Anti-Darwinisten. Vielleicht erklärt sich daraus be reits zum Teil der Haß, mit dem die Nazis ihm nach dem Leben trachteten?
11.
Anfang Juni fand auf Schloß Ippenburg bei Bad Essen am Teutoburger Wald eine große Gartenschau statt. Hier hat die Schloßherrin Viktoria Freifrau von dem Bussche mit Hilfe von 30 Rußlanddeutschen aus dem weiträumigen Schloßpark eine Ansammlung üppiger Gärten geschaffen. Ihr Mann züchtet Schweine und baut Getreide an. Wie jedes Jahr gibt es rund ums Schloß neben 200 Gartenbedarfs-Ausstellern auch eine Garten-Sonderausstellung. Die diesjährige stand unter dem Motto „Der Schrebergarten“. 70.000 Besucher schauten sich das heuer alles an.
Wiewohl die gärtnerische Elite nach wie vor in England und Holland zu finden ist, versuchen doch die Deutschen – voran die Freifrau – aufzuholen. Allgemein ist das Interesse an Gärten enorm gestiegen. Sie sind die effektivste Form der Bodenbewirtschaftung – im Gegensatz zur industrialisierten Großlandwirtschaft, die die profitabelste ist. Ein Garten ist für Zeiten der physischen Not ebenso wie für psychisches Leiden, und sei es bloß eine samstägliche Sinnkrise, bestens geeignet. Auf alle Deregulierungsmaßnahmen folgte noch immer ein wahrer Gartenboom. Plötzlich veröffentlichen die Zeitungen wie blöd immer mehr Gartenseiten und ständig erscheinen neue Gartenmagazine. In einem heißt es z.B.: „Die Kombination aus Stadtleben und ländlichem Flair wird immer gefragter.“ Radio Bremen sendet allwöchentlich plattdeutsche „Gespräche über den Gartenzaun“, während der SFB nach dem Vorbild BBC eine eher hochdeutsche Gartensendung ins Programm genommen hat. An der Humboldt-Universität gibt es einen Lehrstuhl für „Stadtgärten“. Die Lehrer lassen sich immer neue Schikanen bei ihren „Schulgärten“ einfallen. Die Berliner Zeitung hat eine Schrebergärtner-Kolumne eingerichtet. Wladimir Kaminer veröffentlichte ein Buch über sein erstes Jahr als Schrebergärtner in Pankow. In einigen Stadtteilen gibt es bereits die ersten besetzten Gärten. Die organisierten Baumschützer gehören inzwischen zu den aktivsten Bürgerinitiativlern der Stadt. Und bei einigen Hardcore-Grünen liegen Geheimpläne bereit – zur floralen Umvolkung aller Golfplätze im Speckgürtel.

Hier stehts doch: Modell eines deutschen Kleingartens.
12.
Viele Blütenpflanzen sind von „ihren“ Insekten nicht zu trennen – und umgekehrt. Deswegen sind auch die Gärtner nicht von den Imkern zu trennen. Und wie es bei den Botanikern und Gärtnern eine wachsende Trennung von Kopf- und Handarbeit gibt, so auch bei den Imkern und Bienenforschern.
In Berlin gibt es eine starke Bienenforschung. An der FU findet sie am Institut für Tierphysiologie und Angewandte Zoologie statt – unter der Leitung des Neurobiologen Professor Randolf Menzel. Dort ist auch ein Imkermeister beschäftigt. Wenn die angehenden Wissenschaftler ihn allzusehr mit Fachfragen bedrängen, sagt er – etwas spöttisch: „Ihr seid doch die Bienenenforscher.“ Diese Bemerkung deutet einen alten Konflikt zwischen Kopf- und Handarbeitern an, der spätestens in der Renaissance seinen Anfang nahm – als aus dem Handwerkerstand das neue besitzlose Proletariat erwuchs. Aber vereinzelt auch die ersten Künstler und Wissenschaftler daraus hervorgingen, die vom Verkauf ihres Wissens lebten – und zwar nicht selten an Handwerker, die sie damit zu bloßen Ausführern degradierten. Eine ähnliche Trennung zwischen Theoretikern und Praktikern gab es z.B. im Berliner Botanischen Garten, wo spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg die Gärtner nicht einmal mehr selbständig – d.h. ohne Anweisung der Botaniker- „Um- und Neupflanzungen vornehmen“ dürfen. Dass die Hand- und Kopfarbeiter sich immer weiter voneinander entfernen, hängt nicht zuletzt auch mit den Wissenschaftskonjunkturen zusammen, denen die Forschung in ihrer Finanzierungsnot folgt.
Laut dem „Pressedienst Wissenschaft“ und anderer Internetseiten wollten die Berliner Bienenforscher von Professor Menzel zuletzt herausbekommen, wie die Bienen Informationen aus beiden Hirnhälften miteinander verarbeiten, wobei es primär um ihre Orientierung anhand von Düften ging: „Bienen können dreidimensional riechen“, entnahm ich einem Zwischenbericht. In einem anderen Projekt wurde eine Methode entwickelt, „mit der man selektiv die Ausgangssignale des Antennallobus messen kann.“ Bei diesem „Integrationszentrum der Duftwahrnehmung“ von Insekten, wie es auch genannt wird, „können Input- und Output-Signale … miteinander verglichen werden, was Aufschluß gibt, welchen Beitrag die verschiedendsten Hirnzellenarten der Biene im Antennallobus bei der Duftverarbeitung leisten.“ Der Biologietheoretiker an der FU Werner Backhaus beschäftigt sich mit den „Gegenfarbenneuronen“, die vor einiger Zeit auch bei Bienen entdeckt wurden. Es geht ihm dabei um die Frage, ob auch Bienen Elementarfarben sehen, aus denen ihre Farbeindrücke bestehen: „Sehen sie also wirklich Farben oder funktionieren sie eher wie Roboter, bei denen ein bestimmter Reiz nur eine Vielzahl komplizierter elektrischer Impulse auslöst, deren Gesamtheit am Ende eine Reaktion zur Folge hat?“
Wie ich feststellen konnte, interessieren diese und ähnliche Fragestellungen, die auf Veröffentlichung in „Science“ oder „Nature“ hoffen können, zwar auch die Imker, aber gleichsam nur am Rande. So schwärmte z.B. die Kreuzberger Imkerin Rita Besser mir gegenüber von einer ganz anderen Dreidimensionalität bei den Fühlern der Bienen: „Sie können damit nicht nur riechen, sondern auch hören und tasten.“ Oft herrscht zwischen Wissenschaftlern und Praktikern eine kalte Verachtung. Die Weddinger Imkerin Ramona Mai, der 2002/2003 fast die Hälfte ihrer Bienenvölker einging, meint, dass sei geschehen, weil sie die Stöcke in der Nähe von Mais- und Rapsfeldern aufgestellt hatte – deren Saatgut mit einem starken Gift gebeizt worden war. Nachdem sich ihr Mann mit dem dabei verwendeten Pflanzenschutzmittel näher befaßt und darüber auch mit französischen Imkern korrespondiert hatte, besaß sie genug Beweise für ihren Anfangsverdacht, „dass diese Mittel für Bienen schädlich sind“. Auf den Einwand, dass das Bieneninstitut Hohen Neudorf, wo sie zu DDR-Zeiten noch ihre Ausbildung als „Tierwirtin mit der Spezialisierung Imkerei“ absolviert hatte, einen solchen Zusammenhang zwischen der Saatbeize und dem Bienensterben für nicht eindeutig belegt halte, antwortete Ramona Mai: „Sehen Sie, die Institute müssen von irgendwas leben. Die Forschung über Schädlinge, vor allem die Varroa-Milbe, ist eine wichtige Geldquelle. Gerade Hohen Neuendorf kriegt Millionen dafür, dass sie die Milbe erforschen. Wenn die jetzt plötzlich kein Problem mehr wäre – was ist denn dann mit dem Institut?“ Die Vergiftung ihrer Völker stellte sich der Weddinger Imkerin so dar: „Die Bienen sind auf dem Feld, verlieren die Orientierung und finden nicht mehr zurück. Am Stock stellt man nur fest: Die Völker werden schwächer, entwickeln sich nicht, brüten wie verrückt und haben trotzdem keine Bienen oder die Bienen kommen nicht mehr zurück. Im Sommer füttern sie die Brut mit verseuchten Rapspollen, und die Jungbienen sind vergiftet und schwach, wenn sie auf die Welt kommen. Als wir mit unseren Stöcken im Oderbruch noch in die Sonnenblume wanderten, war es besonders schlimm. Dort sind Mais- und Sonnenblumenfelder gebeizt.“
Ramona Mai bekam mit zehn Jahren ihre ersten Völker zur Pflege: von ihrem Vater, und durfte – „ganz wichtig“ – den Gewinn aus dem Honigverkauf behalten. „Das war zu DDR-Zeiten eine lukrative Sache“. Nach der Wende gaben dagegen viele Imker auf: Es lohnte sich nicht mehr. In Ramona Mais Familie werden schon seit fünf Generationen Bienen gezüchtet. „Ich saß bereits mit drei Jahren bei meinem Vater und seinen Stöcken, nur in meinem Spielhöschen. Meine Mutter war immer völlig aufgelöst, aber das sind meine schönsten Kindheitserinnerungen.“ Nach ihrer Ausbildung als Imkerin studierte sie jedoch erst einmal „Saat- und Pflanzgut“ und wurde Agraringenieurin. Danach arbeitete sie als Buchhalterin in einem Büro. Erst nach der Wende machte sie sich selbständig: als Imkerin. Mit ihren derzeit 25 bis 30 Völkern ist es aber immer noch eine Art Nebenerwerb für sie: „Erst ab 100 Völker gilt man als Berufsimker“. Wie diese verrät sie jedoch nicht, wieviel Honig sie im Jahr produziert: „Das erzähle ich noch nicht einmal meinen Imkerkollegen. Bei den Anglern ist es genau andersherum: Die Fische werden immer größer, bei uns Imkern werden die Honigmengen immer kleiner. Schon in den Büchern geht dieses Tiefstapeln los: Glaubt man den Angaben, braucht man mit Bienen gar nicht erst anzufangen, weil es sich nicht lohnt. Wegen der Verschwiegenheit der Imker kommt man übrigens auch beim Thema Völkerverluste nicht zu Potte. Niemand gibt gerne zu, dass ihm Völker wegsterben.“
Die Kreuzberger Imkerin Rita Besser erzählte mir dagegen gerne, wieviel Honig ihre zwei Bienenvölker produzieren, die für ein kleines Halbliterglas 2,5 Millionen Blüten anfliegen müssen: „Etwa 30 Kilogramm ernte ich im Jahr, wobei ich den Bienen einige Kilo, drei oder vier Waben, lasse sowie den ganzen Pollen – für den Winter. Das ist bestimmt gesünder für sie, als wenn ich ihnen stattdessen Zucker hinstellen würde, wie es üblich ist. Den meisten Honig verbrauche ich selber, ich backe auch damit, den Rest verkaufe ich – hier im Haus, damit die Mieter auch was von meinen Bienen haben.“ Rita Besser hat seit zehn Jahren Bienen. Sie kam über eine Heilpraktikerinnen-Ausbildung, bei der sie sich auf Pflanzenheilkunde spezialisierte, zur Imkerei: „Mein Lehrer hatte mehrere Völker und an den Bienen fand ich so toll, dass es absolute Sonnentiere sind, ihr ganzer Tagesablauf wird vom Licht bestimmt – und dass sie vollkommen auf Blumen bzw. Blüten orientiert sind.“ Als ein Freund von ihr nach Honduras auswanderte, kaufte sie ihm seine zwei Völker ab, die sie auf dem Dach ihres Mietshauses aufstellte. Im Neuköllner Imkerverein, dessen Mitglied sie dann wurde, lernte man sie an, außerdem lieh sie sich einen kurzen Film über Bienen – zur Aufklärung in Schulen. Diesen Film hat Rita Besser später den Kindern in ihrem Mietshaus vorgeführt, um ihnen die Angst vor den Insekten zu nehmen, „die schon mal den Himmel über den Hinterhof verdunkeln können, wenn sie schwärmen. Wenn im Herbst die Blütenstetigkeit der Bienen nachläßt, dann fliegen sie auch den wilden Wein an der Hausmauer an: der summt dann ein paar Tage lang richtig.“
Vor einiger Zeit bemerkte sie eine seltsame Verhaltensänderung bei ihren Bienen: „Sie wurden immer aggressiver, im Winter ist mir dann ein Volk eingegangen.“ Die Ursache dafür sieht sie darin, dass eines Tages ein Mobilfunk-Sendemast auf dem Dach des Nachbarhauses errichtet wurde. Ihr Mann der eine Ausbildung als Baubiologe macht, beschäftigte sich näher damit. Er meint: „Ihre Fühler wirken wie Antennen, das macht die Bienen verrückt. Die Stöcke standen ja nur 10 Meter Fluglinie entfernt von dem Mast – das war zu nahe. Die können von den elektromagnetischen Wellen sterben“. Obwohl die Industrie das abstreitet, gibt eine Broschüre des Kreuzberger Stadtteilausschusses mit neuen Forschungsergebnissen über diesen Elektrosmog ihm recht: „Informationen zu Mobilfunk und UMTS“, ein neusseländischer Forscher meint darin: „Die Handys werden innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre mit hoher Wahrscheinlichkeit die Fallzahl vieler neurologischer Krankheiten sowie der Gehirntumore ansteigen lassen.“ Rita Besser entschärfte das Problem für die Bienen kurzerhand, indem sie ihre Völker in den Hinterhof stellte, wo die Strahlung nicht mehr so stark ankommt: „Die Feldstärke eines elektromagnetischen Feldes im freien Raum nimmt mit dem Quadrat des Abstands zur Sendeantenne zu,“ heißt es dazu in der e.e. Broschüre.
„Auch die Hauswände haben eine abschwächende Funktion“, meint Rita Besser, „ich mußte jedoch erst mal ausprobieren, was die Mieter dazu sagen.“ Sie schenkte ihnen Honig und kaufte einige Bienen-Bücher für die Kinder. „Niemand hat sich beschwert.“ Dennoch pachtete sie dann einen Schrebergarten in Treptow und stellte ihre zwei Stöcke dort auf. Seitdem lebt sie sozusagen getrennt von ihren Völkern – ähnlich wie Ramona Mai, deren Stöcke bei Oranienburg stehen: „Wir haben dort einen tollen Standort gefunden. Es ist alles da, was wir brauchen: Frühlingsblüte, Raps, Robinien und Linde. Je nach Tracht kann man alle zwei, bis drei Wochen den Honig ernten, dann ist die Kiste voll. Natürlich versuchen wir, nach einer Blütephase zu leeren, damit wir reinen Sortenhonig bekommen. Bienen sind sehr blütenstet. Wenn es eine Blüte reichlich gibt, fliegen sie die auch bevorzugt an. Deshalb bestäuben sie auch so gut. Stellt man seine Stöcke zum Beispiel auf eine Obstbaumwiese und alles blüht, dann fliegen sie von Apfelblüte zu Apfelblüte.“ Die Baumbesitzer haben auch was davon: „ihre Früchte werden dadurch größer als durch Windbestäubung“.
Während Ramona Mai behauptet, dass die meisten Imker ältere Männer über 60 sind, bekommt man bei den Erzählungen von Rita Besser den Eindruck, dass fast nur jüngere Frauen sich für Bienen interessieren: In ihrem Schrebergarten, in ihrer Straße am Görlitzer Park, in der Manteuffelstraße, in der Waldemarstraße – überall leben Imkerinnen in Kreuzberg, obwohl gerade dieser Bezirk die wenigsten Grünflächen hat. Die Bienenhalter dort kennen sich und helfen sich mit Geräten (z.B. einer Honigschleuder) aus. Und die Feuerwehr verschenkt hier gerne von ihr eingefangene Schwärme – an „Starter“. An den Straßen stehen Linden und Kastanien. Diese werden auch von Rita Bessers Bienen gerne angeflogen, „sie beginnen jedoch mit den Weiden und Robinien im Görlitzer Park und zuletzt fliegen sie die Balkonblumen an. Ramona Mai erzählt: „Die erste Tracht – also das erste reichliche Nahrungsangebot – ist die Obstblüte, dann folgt der Raps. Das eigentliche Bienenjahr beginnt erst im Juli. Ab dann bereiten sich die Völker auf den Winter vor und produzieren Winterbienen. Eine Sommerbiene lebt nur sechs Wochen, aber die Tiere, die die kalte Zeit überstehen müssen, schaffen vier Monate. Gleichzeitig produziert das Volk Honig als Vorrat, das ist Blütennektar, den die Biene in ihrer Honigblase transportiert und in Waben eindickt.“ Um zu verdeutlichen, was die Bienen ihr außer Honig noch geben, wählt sie „ein Beispiel: Anfang des Jahres war ich stark erkältet, fühlte mich total mies. Dann, zum Saisonstart, konnte ich endlich wieder an die Bienen. Der herrliche Geruch! Bei den Bienenvölkern riecht es ganz intensiv nach Propolis. Diesen Kittharz, der antibakteriell ist, sammeln die Tiere an Knospen von Kastanien oder Pappeln und dichten damit die Ritzen in ihrem Stock ab. Der Geruch hat mir wahnsinnig gut getan, die Erkältung war schnell weg.“
Rita Besser meint, dass die Bienen eines Stockes den Geruch der Königin annehmen, und dass diese auch den Charakter ihres ganzen Volkes bestimmt: „ist sie aggressiv, sind die Bienen es auch.“ Aber gleichzeitig sind sie auch lernfähig. „Das sieht man z.B. an den Pollenfallen: Damit der Imker in den Besitz der Pollen kommt, verkleinert er das Einflugloch so, dass sie nach ihren morgendlichen Pollenflügen diesen beim Durchschlüpfen in das enge Loch von den Beinen abstreifen. So ist es gedacht, aber die Bienen lernen schnell, wie sie, wenn sie ganz vorsichtig erst das eine Bein und dann das andere mit hineinnehmen, den Pollen nicht verlieren. Sie brauchen den für die Brutaufzucht.“ Rita Besser arbeitet mit Rauch, wobei sie den Rat des Imkers im Botanischen Garten beherzigt, der ihr sagte, sie solle Rainfarn zum Verbrennen nehmen, dessen Rauch sei am Besten. „Das Interessante an der Räucherei ist: Erst denken die Bienen, es brennt – und werden nervös, dann fressen sie sich aber schnell mit Honig voll – auf Vorrat, und werden so träge, dass sie nicht mehr so schnell stechen. Wenn ich aber zu lange am Stock rumarbeite, dann werden sie doch mit der Zeit wieder unruhig.“
Da sie sich aber die Bienen „primär wegen ihrer Begeisterung für diese Tiere“ angeschafft hat, sitzt sie am Liebsten einfach vor den Stöcken und beobachtet die Fluglöcher – „da ist viel zu lernen; ich habe auch ein Buch, das heißt ‚Am Flugloch‘. Wenn z.B. die Bienen keine Pollen mehr bringen, dann kann es sein, dass die Königin gestorben ist. Und dann sieht man das mit den Wespen – wie sie deren Angriffe abwehren. Wenn die Wespen es schaffen, den Stock zu plündern, dann ist das Volk zu schwach – und kommt wahrscheinlich sowieso nicht über den Winter. Aber man kann ihnen helfen, indem man im Herbst das Flugloch verkleinert, das erschwert den Wespen ihre Angriffe: Ein kleines Loch können die Bienen besser verteidigen. Einen Varroamilben-Befall kann man auch sehen – ein deutliches Anzeichen sind verkrüppelte Flügel. Unser Verein hat im übrigen einen staatlich bezuschußten Ausgleichsfond für Verluste durch Varroabefall. Im Mitgliedsbeitrag ist außerdem eine Haftpflichtversicherung enthalten – die ist aber eher dafür, falls mal ein Passant gestochen wird und umfällt.
Ramona Mai behauptet: „Für viele Imker ist Entspannung die Hauptsache, Honig nur das Nebenprodukt. Sie halten sich Bienen, weil sie die Tiere lieben, so wie andere sich Kaninchen halten. Wir stehen mit unserer Imkerei ‚Maiblume‘ auf Wochenmärkten, unser Hauptverkauf ist Samstags der Kollwitzplatz.“ Als „hohe Kunst des Imkerns“ bezeichnet sie die Trennung der Honigsorten. Zwar sind die Bienen blütenstet, aber wenn sie „zum Beispiel zu Robinienhonig, der eigentlich flüssig ist,nur ein bißchen Raps sammeln, der sehr schnell auskristallisiert, dann wird der Honig fest.“ Hier muß man dann versuchen, „ordentlich zu trennen“. Rita Besser hat bereits Erfahrungen mit diversen Bienenkrankheiten gesammelt: „Einmal war die Amtstierärztin schon bei mir – wegen ‚Faulbrut‘, das ist eine übertragbare Krankheit: die Brut verfault dabei in den Zellen. Sie war 2003 in Neukölln ausgebrochen. Meine zwei Völker waren aber zum Glück gesund, sonst hätte man sie vernichten müssen. Dann die Varroa – aus Amerika: Damit haben heute alle Imker zu tun, das sind kleine Milben, die saugen die Bienen aus, schon die Larven. Im Spätsommer muß man dagegen einen ‚Nassenheider Verdunster‘ in die Stöcke stellen, der funktioniert mit Ameisensäure: Die Dämpfe betäuben die Milben, sie fallen von den Bienen ab – in eine Schale, die mit Vaseline eingestrichen ist, damit sie kleben bleiben. Im Winter 2004/05 sind viele Bienen daran gestorben, bei mir jedoch kaum welche. Aus Afrika kommt der kleine Beutenkäfer, der ist neu: Dessen Larven zerfressen die Bienenzellen und minimieren dadurch die Brut. Den habe ich aber noch nicht gehabt. Eher harmlos ist dagegen die Wachsmotte: Die stiehlt sich in den Stock zu den leeren Zellen, wo die Larven ausgeschlüpft sind und frißt die Häutchen, mit denen die Zellen von den Bienen ausgekleidet wurden. Diese Motten hatte ich schon mal: Dann muß man die befallenen Waben einschmelzen. Den Bienen tut die Motte nichts, es ist nur lebensmittelhygienisch – für uns also – unangenehm.“ (1)
In Amerika ist man derzeit wegen eines grassierenden Bienensterbens beunruhigt, in Deutschland beteiligten sich etliche Imker an Aktionen gegen Freilandversuche mit genetisch behandeltem Saatgut, vor allem Mais – in dem sie eine Bedrohung für ihre Bienenvölker sehen. Aber die Genforschung und -technik hat inzwischen alle anderen Ausrichtungen bzw. Möglichkeiten der Lebenserforschung (Biologie) an den Rand gedrängt – auch in der Bienenforschung. Dabei kommen bei genauer und ausdauernder Beobachtung – nicht nur eines Volkes, sondern einzelner Bienen (die man dazu mit Nummern markiert) immer noch überraschende Ergebnisse bei heraus: So fanden die Bienenforscher Roesch und Lindauer u.a. heraus, dass es mit dem sprichwörtlichen Fleiß der Bienen nicht allzu weit her ist: „Die Biene 107 z.B., die vom ersten Lebenstag an fortlaufend beobachtet wurde, hat in den 20 Tagen ihres Innendienstes, bis zum ersten Trachtflug, von 139 Beobachtungsstunden nur 50 Stunden gearbeitet und 89 Stunden müßig verbracht. Von diesen 89 Stunden saß sie 39 1/2 still, und 49 1/2 ging sie langsam und ungezwungen auf den Waben umher, wobei sie bald eine Zelle flüchtig inspizierte, bald mit einer Nachbarin kurz Kontakt aufnahm.“ Solche und ähnliche Beobachtungen legen nahe, langsam aber sicher von der Erforschung der Arten weg zu kommen und sich den Individuen zuzuwenden, denn selbst diese staatenbildenden Insekten haben sich laut Karl von Frisch „bei aller erblichen Gebundenheit einen Grad von individueller Freiheit bewahrt“. Die biologische Forschung treibt heute jedoch in die entgegengesetzte Richtung – indem sie partout und dumpf-materialistisch alle Lebensvorgänge in Chemie und Physik auflösen möchte.
In bezug auf Bienen und Imker könnte man auch andersherum forschen: Im Spiegel heißt es über das Internet und seine Nutzer: „Ein Heer von Freizeitforschern und Hobbyjournalisten, von Amateurfotografen, Nachwuchsfilmern und Feierabendmoderatoren hat das World Wide Web als Podium erobert.“ Man könnte noch hinzufügen: auch Massen von Dilettanten, Projektemachern, Erfinder, Verbesserer, Querulanten und Sonderlinge – bloggen alles ab, was und wo es nur geht. Dazu fand im Berliner Zentrum für Literaturforschung gerade ein Symposium über den „Dilettantismus als Beruf“ statt, wo u.a. das Wort „Universal-Spezialist“ fiel und der Abschlußvortrag dem „Existentiellen Besserwissen“ gewidmet war.
In bezug auf dessen Ausbreitung im Internet fragte sich der Spiegel: „Bedeutet Masse auf einmal Klasse?“ Da er seine entscheidenden Fragen stets von einem „US-Wissenschaftler“ bzw. „US-Journalisten“ beantworten läßt, war das „Ja“ hier quasi vorprogrammiert: „Der amerikanische Wirtschaftsjournalist James Surowiecki glaubt: ‚Unter den richtigen Umständen sind Gruppen bemerkenswert intelligent – und oft klüger als die Gescheitesten in ihrer Mitte.‘ Wenig später heißt es noch pointierter: „Im kollektiven Wissen liegen die Lösung“.
Ein anderer US-Wissenschaftler, Thomas Seeley von der Yale-Universität hat dazu die Bienen und ihre Meinungsbildung per Tanz erforscht. Es ging ihm dabei nicht um den von Karl von Frisch erforschten „Rund- und Schwänzeltanz“ im Stock, mit denen die Bienen sich über die Größe und die Entfernung von Blütentrachten verständigen, sondern um jene Tänze, die „Spurbienen“ aufführen, um ihrem an einem Baum hängenden Schwarm, mit der Königin in der Mitte, mitzuteilen, was für eine neue Unterkunft sie für das Volk gefunden haben. Die „ideale Höhle“ muß 1. einen Rauminhalt von 15 bis 80 Litern haben, 2. einen nach Süden weisenden Eingang, 3. ein Einschlupfloch von weniger als 75 Zentimetern und 4. muß sie sich einige Meter über dem Boden befinden. All diesen Faktoren und noch weiteren müssen die Spurbienen nachgehen. Es sind dazu manchmal bis zu 500 unterwegs. Zurück beim Schwarm, der immer noch am Baum hängt, berichten sie darüber mit einem „Schwänzeltanz“ – und zwar um so heftiger und nervöser, je mehr die einzelne Tänzerin von der Qualität der von ihr gefundenen neuen Behausung überzeugt ist. Daraufhin fliegen die anderen „Spurbienen“ noch einmal aus, um sich selbst von diesem „Supernistplatz“ zu überzeugen.
Das alles kann mehr als drei Tage dauern – „bis es schließlich zu einer Übereinstimmung darüber kommt, welcher Ort das geeigneteste neue Zuhause für das Volk darstellt,“ so faßt die englische Zoologin M.S. Dawkins diese US-Forschung an Bienen zusammen, wobei sie noch hinzufügt: „Am Ende steht die Entscheidung des gesamten Volkes darüber, welches der beste Nistplatz in der Umgebung ist. Die Entscheidung ist so effizient und genau, dass alle Menschen sie beneiden müßten, die ebenfalls versuchen, durch Übereinstimmung zu Entscheidungen zu gelangen.“ (2)
(1) Anderswo – in Island – macht vor allem der lange Winter den Bienen zu schaffen. Deswegen werden die meisten Blüten dort von Hummeln bestäubt. Siehe dazu den blog-eintrag: http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2006/08/21/hummeln-auf-island-und-drumrum/
(2) Das Interview mit Ramona Mai führte Ulrich Schulte

Das ist unser bester Baum.
13.
Seit dem verheerenden Sturm über Norddeutschland am 10. Juli 2002, der allein in Berlin rund 4.000 Bäume und in Brandenburg 0,5% der gesamten Waldfläche (von 1,09 Mio Hektar) umriss, wird viel über den Baum nachgedacht. Und mancher Landbesitzer ist nachgerade erschüttert, dass seine schöne Akazie am Haus oder sein alter Birnbaum im Vorgarten nun nicht mehr steht. Bei Carwitz sah ich das halbe Dorf zu einer solitären Eiche am Feldrand pilgern, wo man traurig um den völlig zerfledderten Riesen herum Aufstellung nahm. In Vorpommern waren noch Tage danach ganze Straßen gesperrt, weil die vielen umgestürzten Bäume und abgerissenen Äste nicht so schnell beseitigt werden konnten. Überall knatterten Motorsägen. Auch dieses Geräusch quälte die Baumfreunde landauf, landab. Wochenlang standen deswegen die Bäume immer wieder im Mittelpunkt ihrer Gespräche. Ein Berliner Dokumentarfilmer wollte bemerkt haben, dass die Wurzelballen der umstürzenden Bäume immer kleiner werden. So als ob sie sich – wie die Menschen drum herum – selbst zu dem immer öfter notwendig werdenden Standortwechsel befähigen wollten. Die Bäume sind den Menschen inzwischen auf Gedeih oder Verderb ausgeliefert. Ein englischer Botaniker meinte, dass sie auch oberirdisch immer kleiner und dünner würden. Das gelte insbesondere für die Eichen, die man vornehmlich für den Schiffsbau benutzte und die somit Englands Seemacht mitbegründeten, weswegen dort schon vor Jahrhunderten über jeden Eichbaum Buch geführt wurde. Die Bäume sterben aus, behauptete der Botaniker, „so wie die Dinosaurier einst!“.
In Berlin sind gerade die rund 20.000 Kastanien besonders bedroht – von einer mazedonischen Motte. Und in den USA die letzten Mammutbäume – von einem Waldbrand, den man an ihrem Standort nicht löschen will. Aber auch anderswo in Kalifornien sind diese „letzten Riesen“ gefährdet. Die Tochter eines amerikanischen Wanderpresdigers Julia Hill kletterte auf einen dieser Redwood-Bäume – und blieb dort oben in 60 Meter Höhe zwei volle Jahre, um ihn vor dem Gefälltwerden durch eine gewissenlose Nutzholz-Mafia zu schützen – wobei sie schließlich zu einem „höheren Selbst“ gelangte. Seitdem nennt sie sich „Butterfly“. Die Schilderung ihres Weges zur individuellen Erleuchtung (Satori) erschien in nahezu allen Kultursprachen, auf Deutsch im Verlag Bertelsmann-Riemann – unter dem Titel „Die Botschaft der Baumfrau“. Die Autorin ist eine Öko-Mystikerin von Rang und mittlerweile einiger Prominenz – und ihr Werk, abgesehen von der gelungenen Rettung des Mammutbaums, ein Erlebnisbericht, der nichts zu wünschen übrig läßt, außer, daß ihre Extremerfahrung nicht leicht Nachahmer finden wird – obwohl: So wie sich derzeit die Selbstmordattentäter im Islam vermehren, könnten bald auch die Säulenheiligen unter den Ökoaktivisten epidemisch werden – die Schlauchboot-Ninjas von Greenpeace sind bereits auf dem Weg dahin. Julia Butterfly Hill jedenfalls ist weiterhin in diesem oberen Bereich (der Bäume) aktiv.
Die Deutschen denken aber anders – das gilt auch für die Ökoaktivisten. Ein aufs Land gezogener Genetiker aus Gießen sah das Übel im Baumdenken an sich begründet: das heißt, darin, dass man den Baum isoliert denkt und pflanzt. Denn eigentlich handele es sich dabei nur um ein herausragendes Teil eines komplexen Ökosystems, das aus Gräsern, Pilzen, Sträuchern, niedrigen und hohen Bäumen sowie einer vielfältigen Fauna – bis hin zu Insekten, Würmern, Pilzen und Bakterien – bestehe. Indem wir jedoch den Baum theoretisch wie praktisch isolieren, weihen wir ihn dem Untergang. So wie es der Mönch Bonifatius einst mit der riesigen Donareiche bei Fulda tat – indem er ihn fällen ließ. Im vorpommerschen Feldberg gibt es noch heute einen „Heiligen Hain“ aus uralten Buchen; ähnliche Baum-Pilgerstätten sind über ganz Deutschland verstreut – und die Menschen unternehmen Gruppenreisen dorthin. Mein Freund, der Baum! Das Zentralorgan der deutschen Baumdenker, die FAZ, listete unlängst sogar die „100 schönsten und größten“ solitären Bäume Deutschlands auf. Anti-AKW-Aktivisten ketten sich in Gorleben regelmäßig an Fichten, um sie vor dem Fällen zu schützen.
Die dergestalt quasi individualisierten Bäume, aber auch all die individuell gepflanzten und umhegten in unseren Gärten, Straßen und Parkanlagen können inzwischen auf unser Mitgefühl rechnen. Nicht jedoch die sozusagen industriell angebauten und hochmaschinell bewirtschafteten Nutzwälder, deren Bäume zerschreddert nach wie vor den Grundstoff für unsere Ikea-Möbel, Spanplatten, Zeitungen und Bücher abgeben. Diese wie überdüngte Spargelfelder aussehenden Nutzforste rücken ebenfalls den letzten noch einigermaßen organisch gewachsenen, „gesunden“ (Misch-)Wäldern zuleibe, die zudem von oben – durch Luftverschmutzung – und von unten – durch Grundwasserbelastungen – angegriffen werden. In Bayern will man gerade den Wald privatisieren und damit seine Nutzung optimieren – die FAZ-Herausgeber befanden in einer internen Sondersitzung, dass das zu weit geht. Bereits 1984 seufzte der erste Ökoredakteur der taz, Manfred Kriener, in seinem gleichnamigen Buch: „Er war einmal“ – und sprach von einem „deutschen Abschied vom Wald“. Dieser Wald ist nicht erst seit der ruchlosen Tat des baumfeindlichen irischen Fanatikers Bonifatius ebenso überdeterminiert wie gefährdet. Zu römischen Hoch-Zeiten bereits machte ein kleines Partisanenheer um Hermann den Cherusker im Teutoburger Wald gegenüber einer ganzen römischen Legion die Schmach wett, dass die Germanen ansonsten nur allzu willig mit den Besatzern kollaborierten und dadurch ihre Freiheit und das wilde Waldleben verrieten, die selbst der römische Geschichtsschreiber Tacitus so gelobt hatte, dass daraus in Italien eine richtige „Germanenmode“ und „Waldverherrlichung“ wurde. Die Nazis drehten dies dann um, indem sie selbst den deutschen Wald und alles was darin kreuchte und fleuchte unter strengstem Staatsschutz stellten.
Schon bald hatten die gemeinen „Volksgenossen“ jedoch andere Sorgen: nämlich in den kalten Nachkriegswintern 1945 bis 47 ein Brennholzproblem, dem bald ganze Wälder zum Opfer fielen. Erst als alle Schornsteine wieder rauchten, erinnerte man sich auch wieder an den deutschen Wald – als eine vergängliche Nationalressource. Der Jammer über seinen Zustand war so groß, dass das Wort „Waldsterben“ bald in aller Welt von Umweltschützern auf Deutsch übernommen wurde. In diese Spanne – zwischen Teutoburger Wald, Buchenwald und Waldtrauer – gehören auch zwei künstlerische Bewältigungen der Waldproblematik: Ernst Jüngers nachkriegsdeutscher Entwurf eines leichthinnigenen Privatpartisanen, sein „Waldgänger“, sowie die schwermütigen Waldmythen des im Odenwald lebenden Malers Anselm Kiefer. Aus Frankreich kam zur selben Zeit – von der Pariser Philosophie – der Anstoß, sich endlich von jedweglichem „europäischen Baum- und Wurzeldenken“ zu verabschieden – zugunsten eines eher nomadisch-horizontalen „Rhizom“-Begriffs. Dieser sorgte besonders bei den Deutschen für Furore, bei denen noch kurz vorher ein lückenloser (arischer) „Stammbaum“ über Wohl und Wehe aller Lebensläufe entschieden hatte. Darüber hinaus war damit aber auch gemeint, sich endlich von allen Führungskraft-Anstrengungen und der Sehnsucht nach Vertikalität überhaupt zu entbinden. Heute spricht hier schon fast jeder von „flachen Hierarchien“ und sogar die deutsche Forstwirtschaft lässt sich vom „Outsourcing“ anstecken.
In der FAZ wurde kurz nach der letzten Waldzerstörung am 16. Juli „Die Pflanzenseele im Zeitalter der Stadtbegrünung“ diskutiert, denn „nie war der Baumhass größer als heute“, klagen angeblich „Beobachter“ und sprechen von einer „professionellen Abhackmentalität“, die als „Baumpflege“ verkauft wird. Der Autor Ulrich Holbein schwang sich deswegen zu einem gütlichen Vorschlag auf, um den „alten Zwist zwischen heidnischer Baumvergötterung und baumfällenden Christen“ zu schlichten. Dabei ging er von dem (germanischen?) Zusammenhang zwischen „geistlicher Erleuchtung und Fotosynthese“ aus – nach Art einer „Vernetzung“ oder „morphischen Resonanz“? – und empfahl den deutschen „Baumfreunden“ kurzerhand, doch einfach in der ununterbrochenen Zeitungs- und Buchproduktion das aktuelle Murmeln der „Baumgeister“ zu vernehmen. Die FAZ-Redaktion gab dem gegenüber jedoch bereits in der Bildunterschrift zum Thema zu bedenken, dass dieser Vorschlag nur bis zur Durchsetzung des „papierlosen Büros“ gelte. Dann nämlich brauchen wir endgültig keine Texte mehr, die sich einem Baumopfer verdanken – wenn schon sonst nichts.
Bis jetzt ist aber eher eine sogar noch anschwellende Papierflut zu verzeichnen, die sich thematisch immer öfter mit Bäumen befasst – und so deren „geistliche“ Impulse quasi kurzschließt: überbrückt. Mit Titeln wie „Baumgenossen“, „Geist der Bäume“, „Die Botschaft der Baumfrau“ und „Die Frau in den Bäumen. Eine Biologin erforscht das Leben in der Baumkrone“. Nicht zu vergessen, bebilderte Verkaufskataloge über „Baumhäuser – weltweit“. Daneben gibt es längst populärwissenschaftliche Zeitungen, die sich derart spezialisiert haben, dass sie sich nur noch mit Birken, Weiden oder Ahorn zum Beispiel beschäftigen. In Großdiashows zeigt man „Die schönsten Baobab-Bäume der Welt“ und „Die teuersten Bonsai“. In Talkshows über hiesige Waldstreifen werden Schweigeminuten eingeblendet. Schulklassen übernehmen Baumpatenschaften – und denken sich englische Vornamen für ihre einstämmigen Lieblinge aus. Bürgerinitiativen kämpfen mit Baumschulen für weitere Alleen. Und Künstler konzentrieren ihr ganzes Werk auf einen einzigen Baum – den Gingko beispielsweise. Wenn das papierlose Büro nicht bald kommt, dann treten die letzten alten Bäume womöglich noch selbst an die Stelle der jungen Autoren – mit Titeln wie „Die Laubacher Linde – in Selbstzeugnissen“ und „Wenn der große Ilex erzählt. Geschichten aus dem Unterholz“. Das rhizomatische Denken dagegen wird wieder in die Kleinverlage abgedrängt – wo es auch hingehört. Denn das haben ja angeblich sogar die Bäume bereits begriffen: Es gilt, ein Kleinwerden zu schaffen, wo alles individuell nach oben und zur Größe strebt.
Aus Westafrika kam dazu bereits der (filmische) Vorschlag – von einigen Bäumen: sich einfach hinzulegen! Und sonst weiter nichts zu tun. „Tired Standing Up and Lying Down“ heißt der Film von Jean Rouch. Schon Tacitus hatte einst über die Germanen geurteilt: „Kein Volk gibt sich so gerne dem Nichtstun hin!“ – Nun aber nicht mehr unter, sondern neben einem Baum. Leider ist hier vom alten Müßiggang nicht viel übrig geblieben, im Gegenteil: Etliche Berliner Spaziergänger in den märkischen Wäldern beschwerten sich sogar beim Forstamt, daß die Aufräumarbeiten nicht vorwärtskämen. Einer der Revierförster im Nordosten von Berlin verteidigte sich: „Schneller gehts nicht…Wir haben hier für 1200 Hektar Wald nur noch zwei Arbeiter“. Aus anderen Revieren wurden ihm zusätzlich sechs weitere überstellt. Sie müssen insgesamt 7000 Festmeter fällen: „Das ist mehr als doppelt so viel, wie wir in diesem Jahr normalerweise geerntet hätten“. Insgesamt sind in den märkischen Forsten 190.000 Festmeter auf die Schnelle zu beseitigen – aus Sicherheitsgründen, aber auch um dem Borkenkäfer- und Pilzbefall vorzubeugen. Einen Teil der Sturmschäden wird man diesmal dennoch nicht beseitigen: Auf 30 Hektar soll die Natur sich selbst helfen. Für die Waldökologen ist das ein „Experiment“: Dort entsteht nun unter ihrer Beobachtung ein „Mini-Urwald“.
Hier kommen später noch zwei Aprikosenbäumchen hin.
14.
Ein Kriminalbeamter, der für Versicherungsbetrügereien im Großraum Berlin verantwortlich ist, erzählte mir, daß er neulich einen ganzen „Familienverband“, bestehend aus ehemaligen LPG-Mitarbeitern, am Stadtrand hochgehen ließ. Einer der Männer hatte laufend Unfälle mit Gebrauchtwagen fingiert, indem er mit 40 Kmh gegen irgendwelche Alleebäume gefahren war – seine Frau saß immer neben ihm. Vor Gericht erklärte sie: „Was mein Mann aushält, das halte ich auch aus!“ Der Kriminalbeamte meinte: „Ob Sie es glauben oder nicht, den Alleebäumen ist nie was passiert. Die sind robust – besonders die im Osten, an denen seit der Wende fast täglich junge Leute mit ihren Westautos verunglücken. Die Alleen sind bereits voll mit Kreuzen und Mahnmalen. Damit habe ich aber direkt nichts zu tun: Das ist ja kein Versicherungsbetrug, wenn diese jungen Leute in ihren Toyotas sich mit überhöhter Geschwindigkeit um einen alten Alleebaum wickeln“. Diese Alleen wurden in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts von immer mehr Herrschern in Europa angepflanzt – vor allem, damit ihre ihnen teuer gewordenen Soldaten im Schatten marschieren konnten. In Rußland ordnete Katharina die Große die Baumbepflanzung der Landstraßen an. Dort wurden dann auch die nach Sibirien Verbannten auf diesen Alleen transportiert bzw. unter Bewachung in Marsch gesetzt. Und noch Jahrhunderte später gedachten die Verbannten, wenn sie im Ural ankamen, der großen Katharina für ihre fürsorgliche Alleenbeschattung – mit einem Dankesgebet.
In Preußen ließ Friedrich Wilhelm I. im großen Stil Alleebäume anpflanzen. Während sie jedoch im Westen nach und nach den Straßenverbreiterungen, – begradigungen und Sicherheitserwägungen (zuletzt vor allem des ADAC) zum Opfer fielen, blieben sie im Osten – wie so vieles – nahezu unverändert erhalten, ja, sie erholten sich dort sogar von den letzten Kriegsschäden. Im Berliner Raum wurden die Bäume dafür von den 1949 enteigneten „Späthschen Baumschulen“ geliefert. Diese Firma war 1720 von einem Christoph Späth gegründet worden, zunächst als Obst- und Gemüsegärtnerei in Kreuzberg. Bis zum Ende des 19.Jahrhunderts wurde daraus dank der preußischen Alleebaum-Programme die „größte Baumschule der Welt“ – mit zuletzt 800 Mitarbeitern. Zu DDR-Zeiten waren es noch 250. Nach der Wende bekam der Alteigentümer Dr. Manfred Späth, ein Beamter, der einer Erbengemeinschaft vorstand, seinen Familienbetrieb zurück, der inzwischen noch einmal weiter an den Stadtrand – zwischen Britz und Johannisthal – gerückt war, wo er den Ostberlinern fast den Botanischen Garten in Steglitz ersetzte. Zumal der 1877 angelegte Schaugarten der Späthschen Baumschulen dann auf fünf Hektar zu einem Arboretum ausgebaut wurde, den die Humboldt-Universität verwaltete.
Zwar gibt es in Pankow auch noch einen „Botanischen Volkspark“, aber den kannten nur wenige, er war nach dem Krieg zunächst zur Zentralstation der Jungen Naturforscher „Walter Ulbricht“ erklärt worden und wurde dann ebenfalls der Humboldt-Universität zugeschlagen. Nach der Wende kam er in die Verwaltung des Bezirks, der die dortigen Hochgewächshäuser wegen Baufälligkeit schließen ließ, jetzt will man sie jedoch renovieren – und den Volkspark überhaupt attraktivieren. Eher das Gegenteil passierte mit den „Späthschen Baumschulen“: Erst einmal mußten sie wegen des Ausbaus der Stadtautobahn A 113 einige Hektar abgeben, wobei wegen der Abgase jetzt auch die Qualität der Jungbäume in unmittelbarer Nähe der Autobahn gefährdet ist. Es ist deswegen vor Gericht noch eine Entschädigungsklage gegen den Senat anhängig. Außerdem wurden aber auch noch die kommunalen Dienstleistungen in Berlin immer teurer, so daß der Betrieb jetzt z.B. allein für die Straßenreinigungsgebühren vier mal so viel bezahlt wie für die Pacht seiner Flächen am Treptower Baumschulenweg, wo die Baumschule insgesamt 36 Hektar bewirtschaftet. Der Umzug der „Späthschen Baumschulen“ nach Ketzin ist mit einem weiteren Personalabbau verbunden – 16 Mitarbeitern wurde bereits gekündigt. Man will jedoch die Firmenzentrale in Treptow belassen, auf den frei werdenden Flächen soll ein Pflanzengroßmarkt – „mit bis zu 100 neuen Arbeitsplätzen“ – entstehen.
Die Alleebaum-Schulen sind heute ähnlich arbeitsteilig organisiert wie das staatliche Schulsystem: In der Grundstufe wird das Saatgut vermehrt und Jungpflanzen produziert. In der Mittelstufe bezieht man von überall her Jungware, die dann – „halbfertig“ – mit einem Stammumfang von 8-10 Zentimeter und einer Höhe von 2-3 Metern an die Oberstufe verkauft wird. Zu diesen so genannten Hochbaumschulen zählt auch der Späthsche Betrieb, der seine Ware in Deutschland, Holland und Kanada einkauft. Oftmals handelt es sich dabei um Bäume – Ahorn und Wildkirsche beispielsweise, die man als „Unterlage“ mit einer Okkulation veredelt hat, wobei dann nur noch dieser aufgesetzte Trieb kultiviert wird. Als Absatzmarkt ist dem einstigen preußischen Monopolisten Späth bloß noch Berlin und Brandenburg geblieben, aber man will sich – bedrängt von den westdeutschen und holländischen Baumschulen und bedroht von den Sparmaßnahmen der Kommunen – wenigstens in Ostelbien weitere Marktanteile sichern.
Seit einiger Zeit breitet sich in den US-Staaten Kalifornien und Oregon das „Eichensterben“, dort „Sudden Oak Death“ genannt, aus. In den Achtzigerjahren kam es bereits in Berlin zu einem „Eichensterben“. Dieses war jedoch der Frosteinwirkung geschuldet, vor allem an den Wurzelanläufen, während die kalifornische Eichen-Krankheit von einem Pilz namens „Phytophthora ramorum“ hervorgerufen wird, den man hierzulande vor allem bei den Tomaten als „Kraut- und Braunfäule“ und bei der Kartoffel als „Kraut- und Knollenfäule“ kennt. Im 19. Jahrhundert löste er in Irland die „Große Hungersnot“ aus, die wiederum eine Massenauswanderung der Bevölkerung nach Amerika zur Folge hatte – und in der englischen Kolonie Irland selbst einen erstmaligen massenhaften Einsatz von unsinnigen ABM-Projekten. In Kalifornien trat der Pilzbefall zuerst in der Gegend von Big Sur bei den so genannten „Showcase Trees“ auf, so nennt man dort die besonders schönen und großen Bäume auf den Grundstücken der Milliardäre, die den eigentlichen (Millionen-)Wert ihrer Grundstücke ausmachen. Inzwischen sterben aber auch Blaubeer-Sträucher, Philodendron, Lorbeerbäume, der großblättrige Ahorn und zwölf weitere Pflanzenarten an Phytophthora ramorum. Zudem breitet sich die Pilzseuche trotz Quarantänezonen immer weiter nach Osten und Norden aus. Im September befiel sie bereits die ersten Redwood- und Tannen-Kulturen in den Hauptanbaugebieten der Weihnachtsbaum-Industrie, die allein einen Umsatz von mehreren Milliarden Dollar jährlich verzeichnet.
Zwar arbeiten die US-Biologen fieberhaft an einem Gegenmittel, aber bisher noch ohne Erfolg. Schon stehen etliche kalifornische Baumschulen wegen der zunehmenden Zahl von Verkaufsbeschränkungen für die Bäume aus ihrer Region vor dem Ruin. Was die deutschen Importe aus Kanada betrifft, so besteht nach Auskunft das Berliner Pflanzenschutzamtes noch keine akute Gefahr. Dafür würden die Pflanzenbeschau-Richtlinien der EU bzw. die Pflanzenbeschau-Verordnung sorgen, die gegebenenfalls Einfuhrbeschränkungen vorsehen. Es werden bei den Importen auch schon Kontrollen im Hinblick auf den „Sudden Oak Death“ durchgeführt – und bei bestimmten Herkünften zusätzliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen eingefordert. Jeder Baum- oder Pflanzensamenimporteur braucht sowieso ein Internationales Pflanzengesundheitszeugnis für seine Ware, und, wenn sie aus dem Inland bzw. dem EU-Binnenmarkt kommt, einen „Pflanzenpaß“ für jeden Baum und jeden Strauch. Mit diesem Instrumentarium meint man, auch fürderhin die deutschen Alleebäume vor dem tödlichen Pilzbefall aus Amerika bewahren zu können. Alle diesbezüglichen Fäden laufen bei der Biologischen Bundesanstalt in Braunschweig zusammen, d.h. in deren Abteilung für nationale und internationale Pflanzengesundheit, die darüber laufend auf ihrer Homepage „www.bba.de“ berichtet.
Auch die „Späthschen Baumschulen“ haben eine eigene Homepage – für ihr umfangreiches Alleebaum-Angebot. Beim „Sudden Oak Death“ verläßt man sich jedoch einstweilen noch auf die Pflanzenschutzämter. In den USA befürchten einige Biologen indes, daß die Pilzseuche vielleicht erst in etlichen Jahren wirklich flächendeckend ausbricht, so wie bei der Kastanienkrankheit und der holländischen Ulmen-Krankheit, die 50 Jahre brauchten, um auszubrechen. Der „Sudden Oak Death“ wurde vor sieben Jahren erstmalig beobachtet. Aber bevor noch die ersten Pilzsporen hier gesichtet werden, hat schon ein allgemeines Baumbangen eingesetzt, das sich hier und da sogar schon gegen die staatlichen Umweltschützer formiert. Anfang Oktober z.B. am Stuttgarter Platz in Berlin, wo eine Bürgerinitiative zusammen mit der Polizei in letzter Minute das Fällen von drei Bäumen verhinderte, die zuvor von der grünen Stadträtin zu einem „Sudden Death“ verurteilt worden waren, weil sie angeblich wie aus heiterem Himmel ihre „Standsicherheit“ aufgegeben hätten. Insgesamt geht es dort um etwa 100 Bäume – die der Standortverlegung des Bahnhofs im Weg stehen.
Speziell um den Erhalt der Alleebäume kämpft auch die Vereinigung der deutschen Landesdenkmalpfleger. In ihrem neuesten Bericht (Nr.8) druckten sie einen „Alleenerlaß“ aus dem Jahr 1841 ab, in dem der preußische König sich beklagte, dass so viele Alleebäume überflüssigerweise bei Straßenbaumaßnahmen gefällt werden. Er befahl deswegen, „daß Lichten und Aushauen prachtvoller Alleen künftig“ zu unterlassen. Die Landesdenkmalpfleger merkten dazu an: „Möge das königliche Vorbild, welches offensichtlich im 19. und frühen 20. Jahrhundert Schlimmeres verhindert hat, Richtschnur auch für das 21. Jahrhundert sein“.

Kuck mal da, der Onkel photographiert unsere Baumblüte.
15.
Der französische Semiologe Roland Barthes unterschied die Metasprache, die in der Stadt gesprochen wird, von der Objektsprache – auf dem Land. „Die erste Sprache verhält sich zur zweiten wie die Geste zum Akt: Die erste Sprache ist intransitiv und bevorzugter Ort für die Einnistung von Ideologien, während die zweite operativ und mit ihrem Objekt auf transitive Weise verbunden ist.“ Zum Beispiel der Baum: Während der Städter über ihn spricht oder ihn sogar besingt, da er ein ihm zur Verfügung stehendes Bild ist, redet der Dörfler von ihm – gegebenenfalls fällt er ihn auch. Und der Baum selbst? Wenn der Mensch mit einer Axt in den Wald kommt, sagen die Bäume: „Sieh mal! Der Stiel ist einer der Unsrigen.“ Dies behaupten jedenfalls die Waldarbeiter in der Haute-Savoie. Wenn man dem Augenschein und den Neodarwinisten glauben schenkt, dann herrscht jedoch auch unter den Bäumen ein ständiger Konkurrenzkampf (um Nährstoffe, Licht, Bakterien, Pilze usw.). Die russisch-sowjetischen Forstexperten sahen das jedoch – symbiotisch gestimmt – ganz anders: „Es klingt paradox, aber der Wald braucht den Wald,“ so sagte es einer von ihnen und fügte hinzu: „Sonst stünden viel mehr Bäume einzeln, wo sie sich doch angeblich besser entfalten könnten.“
Der in den Dreißiger und Vierzigerjahren führende Agrarbiologe der UDSSR Trofim D.Lyssenko empfahl deswegen bei der Wiederaufforstung gleich die Anpflanzung von Bäumen in „Nestern“. Er begründete dies sehr revolutionsromantisch: „Erst schützen sie sich gegenseitig und dann opfern sich einige für die Gemeinschaft“. Der Forstwissenschaftler G.N. Wyssozki ging nicht ganz so weit, aber auch er unterschied zwischen vegetativem Freund und Feind: Damit z.B. die Eiche gut wachse, dürfe man sie nicht zusammen mit Eschen und Birken anpflanzen, sondern sollte sie „von Freunden umgeben“ – Büsche: Weißdorn, gelbe Akazie und Geißblatt z.B.. Laut dem Wissenschaftsjournalisten M. Iljin lehrte uns bereits der Gärtner Iwan W. Mitschurin, „dass sich im Wald nur die verschiedenen Baumarten bekämpfen, aber nie die gleichen“. (Wenn das stimmt, dann ist es im tropischen Regenwald genau andersherum.) Der russische Wald wird von der Steppe bedroht. Deswegen riet Lyssenko: aus Eiche (Wald) und Weizen (Feld) Verbündete gegen sie zu machen. Seinen Vorschlag begründete er quasi partisanisch: „Wenn einer zwei andere stört, dann lassen sich diese beiden stets, mindestens für einige Zeit, gegen ihren gemeinsamen Feind verbünden.“
Aus dieser (allzumenschlichen) Wahrnehmungsnot hat der baltische Biologe Jakob von Uexküll eine Tugend gemacht: Es gibt keinen Wald als objektiv festlegbare Umwelt, sondern nur „einen Wald-für-den-Förster, einen Wald-für-den-Jäger, einen Wald-für-den-Botaniker, einen Wald-für-den-Spaziergänger, einen Wald-für-den-Holzleser“ und, so dürfen wir hinzufügen: einen für Partisanen, Eulen, Eichhörnchen, Ameisen etc.. „Jede Umwelt ist eine in sich geschlossene Einheit, die sich aus der Selektion einer Reihe von Elementen oder ,Merkmalsträgern‘ aus der Umgebung konstituiert,“ so faßt Giorgio Agamben die Uexküllsche Umweltlehre zusammen, die dieser u.a. am Beispiel der „Weltbilder“ von Zecken und Stichlingen entwickelte, wobei er zu dem Schluß kam: „Die Heimat ist ein reines Umweltproblem“. Ein Satz, der mir immer sehr eingeleuchtet hat, wie ebenso der, dass auch Pflanzen ständig mit „Bedeutsamkeit“ konfrontiert werden. Daraus folgt eine ganz andere „Zeichenlehre“ als die „Codes“ der angloamerikanischen Genetiker.
1929 gründete Uexküll in Hamburg ein „Institut für Umweltforschung“, heute ist der „Pionier der theoretischen Biologie“ zusammen mit dem „Vitalismus“ in Vergessenheit geraten. Wie dieser wandte er sich gegen den „Mechanizismus“, der bei allen Tierhandlungen und Pflanzenäußerungen bloß Ursache-Wirkungs-Schemata gelten läßt. Bei Uexküll ist jedes Lebewesen erst einmal „Subjekt“. Das eröffnet uns einen Zugang zu ihm, der sich forschend vertiefen läßt, wobei man jede „Psychologisierung“ vermeiden sollte. Mehr Anerkennung hat in den letzten Jahren, vor allem in den USA, die frühe Symbioseforschung der russischen Botaniker des 19. Jahrhunderts gefunden, die teilweise explizit „antidarwinistisch“ argumentierten: Beginnend mit Andrey S. Famintsyn, der bereits 1907 einen Aufsatz über „Die Rolle der Symbiose bei der Evolution von Organismen“ veröffentlichte, wobei er sich vor allem auf Flechten bezog, die aus einer Verbindung zwischen einer Alge und einem Pilz bestehen, sowie auch auf Chloroplasten: in allen Pflanzenzellen integrierte Einzeller, die das Sonnenlicht durch Photosynthese in nutzbare chemische Energie und Nährstoffe umwandeln. Ferner Konstantin S. Mereschkowsky, der die „Organellen“ (Orgänchen) in den Zellen als ehemals freilebende Organismen identifizierte, die irgendwann von einem Einzeller „einverleibt“ bzw. „verstaatlicht“ wurden: Bis heute teilen sie sich unabhängig von ihrer Wirtszelle selbständig.
Mereschkowsky publizierte 1920 in Genua seinen Aufsatz „Die Pflanze als symbiotischer Komplex“. Schließlich Boris M. Kozo-Polyansky, der 1924 eine „Theorie der Symbiogenese“ veröffentlichte, die sich wesentlich auf Bakteriensymbiosen bezog, u.a. auf ehemals frei lebende Mytochondrien, die in der Lage sind, mithilfe des Sauerstoffs der Luft aus Nährstoffmolekülen chemische Energie zu produzieren. Sie befinden sich heute in jeder unserer Körperzellen. Kozo-Polyansky interessierte sich jedoch speziell für die Orchideen und das Erika-Heidekraut. Seine Biographin Liya N. Khakhina bemerkt dazu – in „Concepts of Symbiogenesis“: „He saw an unusual physiological picture in orchids [Orchideen] in that symbiosis is a necessary condition both for the germination of the seed and for the formation of the roots and tubers and the stages of flowering. Citing M. Rayner’s work of 1915-23, Kozo-Polansky noted that even ordinary heather [Erikaheide] is essentially a symbiotic organism, formed from a flowering plant and an (ascomycotous) mycorrhizal fungus.“
Wenn sich heutige Biologen/Ökologen unter und zwischen den Bäumen umtun, dann konstatieren sie erst einmal: Dem Wald geht es schlecht! In Südamerika, in Sibirien, auf Sumatra – und in Mitteleuropa sowieso. Die Fichten leiden unter Industrieabgasen, Überdüngung der Felder und unter ihren dumpf profitorientierten Monokulturen. Die Ulmen leiden an tödlichen Pilzen, die Kastanien an der Miniermotte. Die Abwehrkräfte dieser Bäume scheinen langsam zu erlahmen. Schon vermelden englische Baumforscher: Auch die Wurzelballen der Eichen werden immer kleiner. Geben die Bäume, die es einst uns Landtieren überhaupt erst ermöglichten, das Wasser zu verlassen, nun unsretwegen auf? Das käme Nietzsches Gedanken nahe: „Genug, überall da, wo wir Ursache und Wirkung sehen, müssen wir anerkennen, das Wille auf Willen stößt“. Demnach hätten wir das „Willensfeld“ der Bäume bereits derart zerstört und zerhackt, dass sie drauf und dran sind, resigniert aufzugeben. Dabei gab es mal Zeiten, wo sie umgekehrt uns beeinflußt haben. Goethe war sich noch „gewiß! Wer sein Lebenslang von hohen ernsten Eichen umgeben wäre, müßte ein anderer Mensch werden, als wer täglich unter luftigen Birken sich erginge.“
Um eine solche oder ähnliche „Kommunikation“ zwischen Pflanze und Mensch ging es vor einiger Zeit einer Dame aus der spirituellen englischen Landgemeinschaft Findhorn in ihrem Vortrag im Berliner Botanischen Garten. Sie hatte zwei Ahornblätter von daheim mitgebracht, wovon sie das eine immer wieder gebeten hatte, nicht zu verwelken – und siehe da: Es war im Gegensatz zum anderen grün geblieben. Ihr kommunikatives Bemühen hatte quasi Früchte getragen. Ähnliches berichtet auch die Moskauer Kafkaübersetzerin Jewgenia Kazewa in Ihrer „Lebensgeschichte“: „Meine Kastanie…Ich wohne im dritten Stock, und die Kastanie ist so hoch und breit, dass sie die beiden Balkonfenstertüren von Wohnzimmer und Küche ausfüllt; wenn auch jetzt nur noch mit einer Hälfte, die andere Hälfte ist dem schrecklichen Orkan zum Opfer gefallen, der im Sommer 1998 in Moskau wütete. Er war kurz, aber sehr zornig. Die Kastanie wurde entzweit, die eine Hälfte, die vor der Küche, ist sofort umgefallen, die andere, vor dem Zimmer, hat sich ohnmächtig ans Balkongeländer gelehnt. Ich habe mit ihr geredet, ihr immer wieder gut zugesprochen und sie flehentlich gebeten, sich aufzurichten, sie gestreichelt und ihre schlaff werdenden Blätter geküßt. Bedeutet sie doch soviel für mich: Wenn ich am Schreibtisch sitze, der vor dem Fensterbrett steht und sich bei Festen zum Eßtisch verwandelt, hebe ich ab und zu die Augen, hefte den Blick auf sie oder starre sie einfach an, bis mir etwas einfällt. Man mag es glauben oder nicht, aber allmählich und ganz langsam begann sie sich vom Geländer zu lösen, richtete sich auf, bis sie wieder ganz gerade stand. Und die Krone rundete sich. als wäre der ,Schädel‘ nie gespalten worden.“
Wenn das Sprechen mit dem Baum ins Mystische lappt, ebenso wie umgekehrt das, „Was die Bäume sagen“ (wie ein vielverkauftes Buch einer US-Landkommune in den Siebzigerjahren hieß), dann berührt das Sprechen über den Wald oft das Mythische. Für viele Kulturen gehört der Wald sogar zu ihrem Ursprungsmythos – erhoffte man sich durch den Rückzug in den Wald eine Art Wiederauferstehung. Simon Shama hat in seiner Studie über „Den Traum von der Wildnis“ einige dieser Heiligen Haine durchforstet: In Polen den Urwald von Bialowieza (Podlasien), der Rumpfheimat des Wisent, aber auch aller echten Männer, sowie der polnischen Outlaws und Partisanen. Ferner Jagdgebiet der Könige, dann das Revier von Hermann Göring – und Ausgangspunkt der polnischen Forstwirtschaft bzw. -wissenschaft, die wiederum oft Beziehungen zu den Partisanen in ihren Wäldern unterhielt. So gehörte z.B. zu den Partisanen, die sich nach der Niederschlagung des Warschauer Aufstands Ende 1830 und der Auflösung Polens in die Wälder von Podlasien – der puszcza – zurückzogen, auch Emilie Plater, „eine Soldatin, aus deren Familie zu Beginn des Jahrhunderts mehrere Forstbeamte gekommen waren.“ 100 Jahre später erklärte die Pilsudski-Regierung den Urwald zum polnischen „Nationalpark“. Im Wald finden die ersten Gefechte zwischen Nationalökonomie und -ökologie statt!
Die Deutschen erklärten zehn Jahre später sogar das Abschießen eines Adlers zu einem todeswürdigen Staatsverbrechen. Mit dem Einmarsch der Deutschen in Polen flüchteten viele Juden als Partisanen in die Wälder – sie kamen „in eine neue Welt“, schreibt Simon Shama, „…die Veteranen, die sich als ,Wölfe‘ bezeichneten, brachen in der Nacht auf zu Beutezügen in die Walddörfer…Von allen Generationen der ,Puszcza‘-Kämpfer waren sie die verzweifeltste“. Nach 1945 versteckten sich auch etliche Deutsche in den Wäldern, wo sie sich zu antikommunistischen Partisanengruppen zusammenfanden. Erst in den Fünfzigerjahren gelang der Roten Armee die Liquiderung der letzten „Waldmenschen“, wie die Illegalen in Litauen hießen, die jungen nannte man „Wolfskinder“. Etwa zur selben Zeit bezeichnete der Schwarzwald-Philosoph Heidegger die Widerstände gegen die (amerikanische) Nachkriegs-Moderne als „Holzwege“. Der Holzweg ist jener Weg, der unvermutet im Forst abbricht. Als Martin Heidegger und Carl Friedrich von Weizsäcker einmal auf einem Spaziergang durch den Stübenwasener Wald waren, stellten sie überrascht fest, dass sie sich auf einem Holzweg befanden. Noch mehr aber liess sie erstaunen, dass sie an der Stelle, wo der Weg endete, auf Wasser gestossen waren. Heidegger soll da frohlockt haben: „Ja, es ist der Holzweg – er führt zu den Quellen!“
Von den Franzosen stammt dagegen die Erfindung des „Wanderwegs“ (im Wald von Fontainbleau), der eine ganze Malschule begründete. Die Mythifizierung des deutschen Waldes begann mit dem römischen Ethnologen Tacitus, der die Germanen in seinem Bericht „Germania“ als edle Wilde pries. Als Urheld des Widerstands gegen die korrumpierende (römische) Moderne gilt seitdem Hermann der Cherusker, der im Jahre 9 n. Chr. eine ganze römische Armee unweit des Teutoburger Waldes niedermetzelte. Als es Anfang des 19. Jahrhunderts darum geht, die französische Moderne aus Deutschland zu vertreiben, d.h. den Guerillakampf gegen die napoleonischen Truppen aufzunehmen, veröffentlichte Heinrich von Kleist „Die Hermannschlacht“ – als eine Anleitung zum Volksaufstand. Für den Germanisten Wolf Kittler ist sein Drama „Die Geburt des Partisanen aus dem Geist der Poesie“. Für den damaligen Chefstrategen der Befreiungskriege, Freiherr vom Stein, markierte dagegen die Insurrektion des Freikorps von Major Schill den Anfang. Immer wieder riet er ihm, statt sich altmodisch in Festungen zu verschanzen, in die norddeutschen Moore zurück zu ziehen, um von dort aus wie die Wölfe über den Gegner her zu fallen. An der Ems hatten seinerzeit schon Hermanns Partisanen die feindliche Übermacht zermürbt: „Tagelang zappelten die römischen Truppen in den Sümpfen und versuchten sich gegen Überraschungsangriffe der cheruskischen Kämpfer zu wehren“, schreibt Simon Shama, für den „sich die klassische Zivilisation immer im Gegensatz zu den Urwäldern definiert hat“.
Die Nationalsozialisten, die diesen Prozeß umdrehten, haben sich dann auch mehrere Waldabenteuer geleistet: 1. ließen sie im Herbst 1943 ein SS-Fallschirmspringerkommando bei einer Villa im norditalienischen Fontedamo abspringen, um dort das taciteische Urmanuskript zu rauben, nachdem Mussolini diese famose germanische Gründungsurkunde bereits dem Führer als Geschenk versprochen hatte – jedoch nicht mehr selbst dazu gekommen war, sie ihm auch zu übergeben. Das Manuskript – Codex Aesinas – hatten die Italiener jedoch rechtzeitig in einem Vorratskeller der Villa versteckt, so dass die Deutschen unverrichteter Dinge wieder abziehen mußten. 2. zogen die Nazis alle wegen Wilderei inhaftierten Deutschen im KZ Oranienburg zusammen und formierten daraus die erste Partisanenbekämpfungseinheit – unter dem Kommando des Kommunistenschlächters Dr.Dirlewanger. Sie wurde später immer wieder mit antikommunistischen ukrainischen Waldpartisanen aufgefüllt, die nach dem Krieg von den Amerikanern übernommen wurden – um dann in Kennedys „Green Berets“ gegen die im vietnamesischen Dschungel kämpfenden Vietkong eingesetzt zu werden. 3. wurde in den letzten Kriegsmonaten noch ein Partisanenheer aus Teilen der Hitlerjugend zusammengestellt: die Werwölfe. Sie sollten sich in den Wäldern verstecken und von dort aus Angriffe auf die Alliierten unternehmen. Die Rote Armee und die Amerikaner nahmen diese mehr in der Nazipropaganda als real existierenden Gruppen sehr ernst: Erstere ließen unbarmherzig alle des Werwolftums Verdächtigen erschießen und letztere änderten sogar ihren Vormarsch, indem sie von Westen kommend auf Berlin zustoßend nach Bayern abschwenkten, wo sie in den Voralpen die hauptsächlichen Werwolf-Sammelgebiete vermuteten.
Die Seenation England, wo man beim Bau eines einzigen Schlachtschiffes mit 74 Kanonen über 2000 Eichen verarbeitete, versuchte mit Eichen-Pflanzaktionen ihrer Landbesitzer unabhängig von Fremdwald zu bleiben, zudem war ihre wahre Freiheit im alten Sheerwood Forest beheimatet, wo man zu Zeiten von König Jakob I. noch 23.370 Eichen gezählt hatte – und wohin sich in der Zeit der Rosenkriege die letzten Königstreuen zurückgezogen hatten: Laut Simon Shama entstand diese Robin-Hood-Legende „in der Oberschicht und endete in der Unterschicht“ – nachdem die englischen Romantiker den Wald und seinen Helden – den ehemaligen Holzdieb Robin Hood – „als Anwalt der Armen“ entdeckt hatten. In Amerika diente die Wildnis dann als immerwährende Regenerationsmöglichkeit für die Zivilisation, als moralische Anstalt gar für Zivilisationsmüde – und -kritiker (von Henry David Thoreau über Ken Kesey bis zum Una-Bomber Kaczinski).
Überblickt man die verschiedenen Wald-Kulturen, dann flüchteten sich dort stets die (illegalen) Wölfe rein – und heraus kamen (legale) Hunde oder umgekehrt! Und diese Verwandlung wird gerade wieder ideologisch-metaphorisch forciert, obwohl oder weil von einem „richtigen Wald“ zumindestens in Europa so gut wie nirgendwo mehr die Rede sein kann – und einige polnische Biologen deswegen wenigstens Waldstreifen zur Erleichterung der Wolfswanderungs-Bewegung von Ost nach West anlegen wollen. Selbst „um den tropischen Regenwald steht es sehr schlimm,“ schreibt der Münchner Ökologe Josef H. Reichholf. Dieser Urwald „erhält sich selbst. Er hat sich über Jahrmillionen entwickelt und sich dabei ein Eigenklima geschaffen, das seine weitere Existenz garantieren würde, wenn ihn der Mensch nicht zerstückelt, in unzusammenhängende Teilflächen zerlegt und als Einheit zerstört. Kein Großlebensraum der Erde dürfte so schwierig zu behandeln sein und so empfindlich auf Eingriffe vom Menschen reagieren wie der tropische Regenwald.“
Ähnlich sehen das auch einige lateinamerikanische Guerillas. Der Sandinista Omar Cabezas veröffentlichte seine Erinnerungen unter dem Titel „Der Wald ist etwas mehr als eine große grüne Hölle“. Nämlich auch Rückzugsgebiet der Partisanen, Ort ihrer Klärung, Zweifel und Einsamkeit. Gleichzeitig bietet er ihnen aber auch Nahrung und gibt ihnen die Möglichkeit, die komplizierten Lebensverhältnisse und -stile im Wald zu verstehen. Die immer noch kämpfenden Zapatistas, die man heute Neozapatistas nennt, senden ihre „Erklärungen“ stets aus dem „Selva Lacandona“ ab, aus dem lakandonischen Urwald – als „Geheimes Revolutionäres Indigenes Komitee“. Ihre 6.Erklärung 2005 – die bisher letzte – begann mit den Worten: „Dies ist unser einfaches Wort, das danach sucht; die Herzen der Menschen zu berühren, die, wie wir, bescheiden und einfach sind, aber auch, wie wir, würdig und rebellisch. Dies ist unser einfaches Wort, um darüber zu berichten, was unser Schritt gewesen ist und wo wir uns nun befinden, um zu erklären, wie wir die Welt und unser Land sehen, um zu sagen, was wir zu tun beabsichtigen und wie wir es zu tun beabsichtigen, und um andere Menschen dazu einzuladen, mit uns gemeinsam in etwas sehr Großem zu gehen, das sich Mexiko nennt, und etwas noch viel Größerem, das sich Welt nennt.“
Die mexikanische Regierung bekämpft nicht nur die Dorfbewohner als Basis der Zapatistas militärisch, sie hat den dort lebenden Menschen auch verboten, z.B. ihr Feuerholz im Wald zu schlagen, gleichzeitig erhalten Konzerne jedoch Abholzgenehmigungen und es werden große Siedlungsflächen gerodet: Nicht nur chiapanekische Indigenas, sondern auch Gemeinschaften aus anderen südlichen und zentralen Bundesstaaten, die z.B. in Guerrero, Veracruz oder Michoacan eine Landzuteilung forderten, wurden in die Selva Lacandona geschickt – wo sie nun ein kleines Stück Land bewirtschaften. Darüberhinaus will die mexikanische Regierung generell den Boden privatisieren und das Prinzip des kollektiven Eigentums abschaffen – was den kleinen indigenen Völkern weltweit droht. Unser Bild vom tropischen Regenwald als grüne Hölle speist sich primär aus Rudyard Kiplings und Walt Disney’s „Dschungelbuch“. Josef H. Reichholf veröffentlichte 1990 ein neues Buch über den „Dschungel“. Die ÖTV-Gewerkschaftsgruppe bei der BVG sortierte gerade ihr Exemplar aus der Präsenzbibliothek aus, woraufhin ich es im Antiquariat erwarb. Wie schon in bezug auf das „ökologische Denken“ und die Land-Stadt-FFH (Flora-Fauna-Habitate) stellt der Autor auch hier wieder unser bisheriges „Bild“ auf den Kopf: Der südamerikanische Urwald ist keine „Grüne Hölle“, in der alles wild durcheinander wächst und wuchert – im Überfluß lebt, sondern ganz im Gegenteil: eine extreme Zone des Mangels.
Die Bäume, nicht der Boden sammeln hier die Nährstoffe, auf dem die übrigen Pflanzen wachsen, von und auf denen wiederum die meisten Tiere leben. Aus Mangel an Mineralstoffen, um Eiweiß zu bilden, das für die Fortpflanzung notwendig ist, sind die Vermehrungsraten im tropischen Regenwald sehr niedrig und die Nachkommensaufzucht aufwendig. Das gilt auch für alle anderen von den Bäumen abhängigen Pflanzen und Tiere, von denen viele bis hin zu Fröschen – in den Baumkronen angesiedelt sind. Sie mußten den „Epiphyten“ nach oben folgen. Bei diesen „Überpflanzen“ oder „Aufsitzern“ handelt es sich vor allem um Bromelien und Orchideen. Letztere sind hinsichtlich ihres Blütenbaus die „fortschrittlichsten unter den Blütenpflanzen:“ Sie haben die Fehler bei der Pollenübertragung „bis zu fast vollständiger Treffsicherheit verringert“. Nicht zuletzt dadurch, dass sie sich z.B. einer ganz bestimmten Wespenart anverwandelten – so dass sie wie eine solche aussehen, wobei jedoch umgekehrt für die betreffende Wespenart das selbe in bezug auf die Orchideen gilt. Die französischen Marxisten Gilles Deleuze und Félix Guattari haben daraus in den Siebzigerjahren ein ganzes involutives Beziehungsmodell („Macht Rhizom!“) kreiert.
Alle Dschungel-Flora und -Fauna ist laut Reichholf undenkbar ohne den Pilz. „Basis des Baumlebens“ ist speziell der Wurzelpilz, der sich entweder an den Enden der Baumwurzeln ansiedelt oder sogar in ihnen. Diese „innere oder äußere Mykorrhiza“ bildet die Grund-Symbiose. Dabei übernehmen die Pilzfäden „in großem Umfang die Aufnahme von Wasser und mineralischen Nährstoffen. Sie leiten diese an die Baumwurzeln weiter, von denen sie im Gegenzug vor allem Zucker und Vitamine bekommen…Die Pilzfäden sind viel feiner als die Haarwurzeln der Bäume und kommen deswegen noch an geringste Nährsalzkonzentrationen heran“. Der Autor spricht hierbei von einer „Kooperation“. Als gemäßigter Darwinist stellt er zur Erklärung gerne Kosten-Nutzen-Rechnungen an, auch sein diesbezügliches Vokabular wird dann betriebs- bzw. volkswirtschaftlich. Ähnliches wie für die Bäume gilt auch für die Epiphyten auf ihren Ästen: „Oben in den Baumkronen brauchen die Orchideen die Keimhilfe von Pilzen“. Auf dem Urwaldboden sorgen wieder andere Pilze für eine schnelle Rückverwertung der abgefallenen Blätter und abgestorbenen Baumteile, wobei ihnen die Baumwurzeln buchstäblich entgegenkommen: Sie wachsen im Dschungel aus der Erde nach oben – „der eigentlich schon ziemlich ausgelaugten Nährstoffquelle ,totes Blatt‘ entgegen.“ Zusammen sorgen sie dann dafür, dass das Blatt schließlich in seine letzten Reste zerfällt „und keinen Humus hinterläßt.“
Während hier auf einen Hektar bis zu 500 Baumarten vorkommen, sind es in den „geradezu monotonen Wäldern“ z.B. Europas höchstens 100 – oft nur ein knappes Dutzend. In den tropischen Regenwäldern wachsen die Bäume um so besser, „je weniger Artgenossen in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft“ wurzeln. Dies ist nicht dem Überfluß, sondern dem Mangel geschuldet – für Reichholf der „Kern der Regenwaldproblematik“. Die dominierenden Tiere sind hier die Blattschneiderameisen und die Termiten – und beide ernähren sich von Pilzen, die sie in ihren Bauten züchten. Also: „Soziale Insekten“ unten (tagsüber Ameisen, nachts Termiten) und „soziale Pflanzen“ oben (Orchidee-Pilz-Wespe-Symbiosen). Dazwischen ist die immer feuchtwarme Urwaldluft erfüllt von winzigen Pilzsporen: Schon nach kurzer Zeit ist jeder Gegenstand mit einem Schimmelfilm überzogen. Selbst das Faultier setzt an seinem Fell Pilze und Algen an, von denen sich wiederum die Larven einer kleinen Schmetterlingsart ernähren. Die Faultiere leben meist auf „Ameisenbäumen“, das sind Bäume der Gattung Cecropia, deren hohle Stämme Ameisen beherbergen. Der Baum scheidet „extraflorale Nektarien“ (für sie) aus, sie wiederum halten ihm Insekten und andere Feinde vom Leib – noch eine Symbiose. Gleichzeitig schützen die Ameisen auch die gerade wegen ihnen sich so langsam fortbewegenden Faultiere vor deren Feinden. Weitere Exo- und Endoymbiosen finden sich oben in den das Regenwasser auffangenden Trichtern und Blattachseln von Bromelien, die die Flüssigkeit zusammen mit Staubpartikeln und ertrunkenen Kleininsekten durch Bakterien aufarbeiten lassen: „umgekehrte Hydrokulturen.“ Unten im Boden nehmen u.a. Käferlarven die Hilfe von Mikroben an, um den wenigen „Mulm“ – organische Abfallstoffe – dort zu verdauen.
Gerade über die Rolle der Arthropoden (Gliederfüßer) im Ökosystem der tropischen Regenwälder wird derzeit viel geforscht. Für den tropischen Regenwald insgesamt gilt zum einen: „Der hochgradig geschlossene Nährstoffkreislauf begründet sich auf den Artenreichtum“ – zum anderen: „Die Nutzer tropischer Fruchtbäume müssen weit umherschweifen,“ das gilt für die meisten Tiere sowie für die Menschen – die Waldindios, die oft nur in kleinen Gruppen leben. In einigen ihrer Kulturen spielen nicht zufällig „Magic Mushrooms“ (psilozybinhaltige Rauschpilze) eine wichtige Rolle. „Und ähnelt ein schöner, giftiger Gedanke nicht einem Fliegenpilz in allem, sogar noch in der Wirkung zwischen Rausch und Brechreiz?“ fragt sich die Pilzforscherin Gabi Schaffner. An anderer Stelle ihres Buches „Phänomene der inneren Topografie“ schreibt sie: „Ein ungenießbarer Pilz ist wie ein falscher Gedanke am richtigen Ort.“ Ferner hat sie „eine Analogie zwischen den Gesetzen und Eigenschaften der Pilzwelt und der Struktur eines ,untergründigen Denkens'“ festgestellt. „Der Pilz ist etwas Unvorhersehbares, etwas Verrücktes.“ Und dann ist der Pilz auch nicht der Pilz, sondern nur sein Fruchtkörper: „Das Mycel ist der eigentliche Pilz – unterirdisch, feine Fäden über Kilometer unter dem Boden unsichtbar zu einem wirren Netz gesponnen. Und wenn man bedenkt, wie viele Sporen ein Pilz verstreut, ist das Mycel eine ins Unendliche reichende Exponentialfunktion.“
Gabi Schaffner ist vornehmlich in Nord- und Osteuropa unterwegs, wobei sie sich u.a. von den „Betrachtungen eines Pilzjägers“ (Wladimir Solouchin) leiten läßt. Im tropischen Regenwald muß man sich aber gleichzeitig auch gegen die Pilze wehren – „bevor alles verpilzt“. Bei der Körperpflege der Waldindios kommt deswegen „dem Schutz vor Verpilzung eine herausragende Bedeutung zu“, meint Josef Reichholf. Wenn sie nicht umherziehende Jäger und Sammler sind, betreiben die Waldindios einen bescheidenen „Wanderfeldbau“, d.h. Brandrodung von kleinen Flächen, deren Erträge schon nach drei vier Ernten nicht mehr den Aufwand der Feldbestellung lohnen. Reichholf erwähnt Henry Fords riesige Großplantage mit Gummibäumen „Fordlandia“ genannt, die wegen der nährstoffarmen Böden wieder aufgegeben werden mußte: Auch die Gummibäume brauchen viel Platz zwischen sich. Etwas anders ist es bei den Tieren: Ameisen, Bienen, Wespen und Termiten bezeichnet Reichholf „als bewegliche Sammler feinstverteilter Nährstoffe“.
Die Treiberameisen schleppen auf ihren Streizügen sogar ihr ganzes Nest einschließlich der Königin mit. Ihnen schließen sich die Ameisenvögel an, die von den durch die Ameisenkolonnen aufgescheuchten Kleintiere und Insekten profitieren. Zwar ist an Wasser kein Mangel im tropischen Wald, aber die Flüsse sind teilweise reiner als Regenwasser, Kleinlebewesen wie Moskitolarven finden darin nicht genug Nahrung. Und seitdem man den Kaiman durch die Jagd enorm reduziert hat, finden nicht einmal mehr die Jungfische in den Lagunen genug Kleinlebewesen, da diese vom Kot der Reptilien lebten. Es gibt Arten, die sich von tierischer auf pflanzliche Nahrung umstellen können, dazu gehören auch die Leguane, bei denen sich nur noch die Jungen von Insekten ernähren (müssen). In der Zucht gelang es sogar, junge fleischfressende Piranhas zu pflanzenfressenden „umzuerziehen“ – sie ernährten sich zunächst übergangsweise vom Kot der pflanzenfressenden Piranhas – und nahmen dabei die für die Verdauung von Pflanzenteilen notwendigen Darmbakterien auf. Viele Fische ernähren sich in Amazonien von vorneherein von Baumfrüchten, die in den überschwemmten Wäldern ins Wasser fallen: Nicht wenige haben dafür inzwischen „ein schräg nach oben gerichtetes Maul“. Dazu hat Michael Goulding in seinem Buch „Die Fische und der Wald“ quasi aus der Sicht der Fische Erhellendes beigesteuert. Umgekehrt gibt es z.B. Tausendfüßler, die Überflutungsresistent geworden sind. Mit solchen „Überlebensstrategien“ von Arthropoden im Regenwald beschäftigt sich der Kieler Limnologe Joachim Adis.
Die hochspezialisierte und -assoziierte Urwald-Flora und Fauna besetzt dennoch immer nur Nischen: „Nicht einmal auf einem einzelnen Baum herrschen gleiche Verhältnisse“. Das und die mangels eiweißbildender Nährstoffe geringe Fortpflanzungsrate hat laut Reichholf zur Folge, dass die Arten sich keine großen Verluste z.B. durch Freßfeinde, leisten dürfen. Deswegen entwickelten sie wie nirgendwo sonst auf der Welt eine große Vorliebe für Mimikry bzw. Mimese: Gleich mehrere ungiftige Schlangenarten ähnelten sich z.B. einer giftigen an, Raupen, Falter und Käfer entwickelten große Augen oder ganze falsche Köpfe (von Schlangen) am Hinterleib, Heuschrecken nahmen Form und Farbe von Blättern und Zweigen an, wohlschmeckende Schmetterlinge imitierten das Aussehen von abscheulich bitteren, usw.. Daneben wird im tropischen Urwald gerne mit Giften gearbeitet: winzige schreiend-bunte Baumfrösche z.B. sind hochgiftig – die Waldindios nutzen sie zur Pfeilgiftherstellung. Tausendfüßler sondern Blausäure ab, ebenso wie das wichtige Nahrungsmittel Maniok, den man vor dem Verzehr erst einmal umständlich entgiften muß. Überhaupt schützen sich viele Pflanzen mit Gift, u.a. Lianen, die die Waldindios beim Fischfang zum Betäuben ihrer Beute verwenden. Viele Arthropoden verstehen es, Pflanzengifte zu ihrem eigenen Schutz gewissermaßen umzunutzen. Einige Libellenarten haben durchsichtige Flügel mit farbigen Augenmustern drauf. Im Halbdunkel des Dschungels sieht man nur diese Augen: „Überhaupt die Augen“ – als Tarnung und Drohung! Die südamerikanischen Grubenottern und Riesenschlangen haben umgekehrt ein drittes, echtes „Auge“ ausgebildet, zwischen Augen und Mund – mit denen sie (wie mit einem Nachtsichtgerät) Infrarotstrahlen, also Wärmebilder, sehen können.
Und dann gibt es neben der Mimikry und Mimese von Arten, die sich auf Orte und andere Arten beziehen, anscheinend auch noch welche von Orten, die sich auf dort lebende Arten erstreckt: „So traf ich im südlichen Brasilien eine ganze zirkumskripte Waldstelle, bei der mir sofort die lebhafte Blaufärbung aller hier vorhandenen Tiere auffiel. Von zwanzig Schmetterlingen, welche an mir vorüberflogen, waren wenigstens zehn ganz blau und die übrigen zum Teil,…- diese Übereinstimmung der Farben erstreckte sich aber nicht allein auf die Schmetterlinge, sondern auch Käfer, Hemiteren, Dipteren zeigten alle mehr oder weniger blauen Schimmer. Das merkwürdigste bei dieser Erscheinung war ihre enge Begrenzung. Nur wenige Meilen nach Norden von dieser Örtlichkeit hatte die Vorliebe für Blau nicht nur aufgehört, sondern es erschien die rote Farbe in ähnlicher Weise dominierend, wenn auch nicht in so auffälligem Grade.“ (Von Hanstein, „Biologie der Tiere“) Unter den blauen Tieren ist der Auffälligste der große „Morpho-Falter“. Er produziert statt eines blauen echten Farbstoffs, anders als viele andere Tiere und Pflanzen, eine so genannte Strukturfarbe, die durch Lichtbrechung auf seinen Flügeln erzeugt wird. Damit sieht man ihn im Flug auf der Flucht immer nur kurz aufblitzen. Wenn er aber einigermaßen ruhig z.B. durch die Straßen von Rio flattert, bleiben die Passanten angesichts dieses „blauen Wunders“ andachtsvoll stehen.
Noch immer werden tausende von Hektar tropischer Regenwald täglich gerodet oder sonstwie zerstört (50% sind es bereits). Aber auch die Basispolitik – die regionalen Selbstverwaltungsversuche vor Ort – der Zapatistas im Lacandonischen Urwald von Chiapas ist anscheinend erst einmal ins Stocken geraten. In ihrer letzten „Erklärung aus den Bergen/Wäldern des mexikanischen Südostens“ heißt es am Schluß: „Nach unserem Ermessen und dem, was wir in unserem Herzen sehen, sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir nicht weiterkommen können, und an dem wir außerdem alles verlieren könnten, was wir haben, wenn wir so bleiben, wie wir sind und nichts mehr tun, um weiter fortzuschreiten. Das heißt, dass der Moment gekommen ist, wieder alles zu riskieren und einen gefährlichen Schritt zu wagen, der es aber wert ist. Denn vielleicht können wir vereint mit anderen sozialen Sektoren, die unter den gleichen Entbehrungen wie wir leiden, das erreichen, was wir brauchen und was wir wert sind. Ein neuer Schritt nach vorn im indigenen Kampf ist nur möglich, wenn sich der Indígena zusammenschließt mit den Arbeitern, Bauern, Studenten, Lehrern, Angestellten … also mit den Arbeitern aus Stadt und Land“ (- mithin also durch noch umfangreichere Symbiosen).
Kurz danach schlossen die Zapatistas alle legalen Stützpunkte und zogen sich in den Untergrund zurück. Von dort aus wollen sie jedoch (vorerst) nicht wieder zu den Waffen greifen, sondern eher in sich gehen – und ihre Organisation, die EZLN, eventuell für „oppositionelle Organisationen“ nicht-indigener Bevölkerungsgruppen öffnen. Die „Le Monde Diplomatique“ spricht von einem angestrebten „Schulterschluß der Linken“. Man fragt sich, ob sie damit aus einer „Minderheit“, die sie sind und die laut Deleuze/Guattari allein produktiv sein kann, eine „Mehrheit“ machen wollen? Und ob dies auf das „alte europäische Baumdenken“ hinausläuft – dem Deleuze/Guattari ein rhizomatisches bzw. myzelisches Denken gegenüber stellten.

Da brütet ein Rotkehlchen.
16.
Rechtzeitig zum Darwinjahr 2009 verkündete die Verwaltung des Nationalparks „Galapagos-Inseln, dass sie das Naturschutzgebiet noch mehr als bisher schützen wolle, nicht zuletzt um den Tourismus zu fördern. So soll u.a. der Fischfang verboten werden, die Fischer will man dazu bewegen, Arbeitsplätze in der Tourismusindustrie anzunehmen. Sie weigern sich jedoch einstweilen noch. Während die eine Seite von Umweltschützern unterstützt wird, bekommt die andere Hilfe von Menschenrechtlern.
Über diesen Konflikt – zwischen Natur- und Menschenschutz – diskutierte der Anthropologe Mac Chapin im Berliner “Mehringhof”. Er ist Direktor des “Center for the Support of Native Lands” in Arlington, Virginia und arbeitet seit 40 Jahren mit indigenen Völkern im Lateinamerika zusammen. 2008 war zu dem Problem bereits das Buch “Naturschutz und Profit” von Klaus Pedersen erschienen, das sich nicht zuletzt einem Artikel von Mac Chapin im “World Watch”-Magazin 2004 verdankt (die Amis wollen immer gleich die ganze Welt overwatchen!).
Darin werden die großen amerikanischen Naturschutzorganisationen (WWF, The Nature Conservancy, Wildlife Conservation Society u.a.) kritisiert – in ihrem Umgang mit den Einheimischen, die von ihren “Projekten” betroffen sind. Vordergründig wollen beide das selbe: Im Amazonasgebiet z.B. wollen die “conservationist” (Umweltaktivisten) den Regenwald schützen – und die dort lebenden “indigenous people” (Waldindianer) ebenfalls. 1990 unterzeichneten sie ein Kooperationsabkommen, aber es funktionierte nicht: Die Umweltschützer hatten das Geld und machten Pläne, die Einheimischen sollten helfen, diese umzusetzen. Ersteren ging es um den Erhalt der “Biodiversität” (ein Begriff, der damals gerade aufkam), letztere wollten verbriefte Rechte für ihr Territorium. Die Naturschutzorganisationen planten dessen “nachhaltige ökologische Entwicklung”, während die Einheimischen ihren Lebensunterhalt weiter mit den natürlichen Ressourcen dort bestreiten wollten. Dazu mußten und müssen sie sich mit mächtigen Gegnern (als Partner) arrangieren: Neben den Naturschutzorganisationen waren und sind das internationale Konzerne, sowie Großgrundbesitzer und die nationalen bzw. regionalen Regierungen und ihre bewaffneten Organe. Die “Waffen” der indigenen Völker sind diesen Mächten meist intellektuell und technisch unterlegen. Immer häufiger finden sie sich deswegen in Nationalparks oder Naturreservaten wieder – und werden fortan z.B. als “Wilderer” verfolgt, wohingegen zahlende Touristen in ihrem angestammten Territorium nach Herzenslust jagen und fischen dürfen. Anderswo werden sie von Agrarkonzernen vertrieben, die ihre Wälder abholzen, um Monokulturen anzulegen oder – wie in der Mongolei – von Bergbaukonzernen, die das Nomadenland ebenfalls großflächig verwüsten. In Somalia wurden die Viehzüchter dadurch dezimiert, dass man auf Druck von IWF und Weltbank ihre Brunnen privatisierte.
In den Neunzigerjahren bekamen die “Conservationist” hunderte von Millionen Dollar an Spenden, sogar von der Weltbank und von umweltschädigenden Multis, u.a. von Ölkonzernen, die sich damit “grünwaschen” wollten. “Das Geld ist das größte Problem,” meinte Mac Chapin, “es unterminiert jede lokale Initiative.” Aber auch die Menschenrechts-Aktivisten benötigen spenden für ihre Arbeit – und müssen ebenso wie die Umweltschützer Erfolge vorzeigen, um weiter an Spenden heranzukommen. Dazu hat sich die Konzentration nahezu aller NGOs auf “Single Point Issues” bewährt. In der wirklichen Welt hängt jedoch alles mit allem zusammen.
Die kalifornische Anthropologin Shirley Strum studierte, ähnlich wie die Schimpansenforscherin Jane Goodall, 14 Jahre lang Paviane – auf einer englischen Rinderfarm in Kenia, die 18.000 Hektar umfaßte. Als diese verstaatlicht wurde und man Kleinbauern auf dem Land ansiedelte, kam es zum Konflikt: Die Paviane plünderten deren Maisfelder. Dabei wurde immer wieder einer der Räuber getötet. “Ich hasste die Bauern,” schrieb Shirley Strum in ihrem Buch “Leben unter Pavianen”. Dennoch bemühte sie sich um Deeskalation. Sie war während ihrer 13jährigen Feldforschung nicht ganz so menschenfeindlich geworden wie ihre US-Wissenschaftskollegin Dian Fossey, die Berggorillas in Ruanda studierte (1).
Die FAZ schrieb über die 1985 von einem US-Kollegen ermordete Forscherin: Ihre Begabung, sich in das Wesen der Gorillas einzufühlen, habe in “extremem Gegensatz zu ihrer Unfähigkeit gestanden, im zwischenmenschlichen Bereich Feingefühl, Diplomatie oder Kompromissbereitschaft zu zeigen”. Shirley Strum erreichte es zusammen mit einem US-Kollegen, den sie später heiratete, dass eine Schule für die Bauern gebaut wurde und man ihnen Landwirtschaftskurse sowie “Wildlife-Erziehungsprogramme” anbot. Zwar änderte sich daraufhin ihre Einstellung gegenüber dem US-Forschungsvorhaben – bis dahin, dass einer der Bauern meinte: “Lieber haben wir Überfälle durch die Paviane und ein Pavian-Projekt, das sie studiert und uns hilft, als keine Paviane und kein Projekt,” aber schließlich mußte die Forscherin mit ihren etwa 120 Paviane doch weichen: 1984 fing sie die Tiere ein und siedelte sie auf dem Gelände einer anderen Farm in Kenia an. Sie selbst kaufte sich mit ihrem Mann ebenfalls eine Farm – in der Nähe der Hauptstadt Nairobi. Ein anderer US-Anthropologe, Robert Sapolsky, erforschte ebenfalls jahrzehntelang Paviane in Kenia. Diese lebten in einem Schutzgebiet, das dann jedoch zerstört wurde – und mit ihm die Pavianhorde. Sapolsky kehrte daraufhin nach Amerika zurück, wo er sich seitdem mit den neuronalen Ursachen von Depressionen befaßt.
Von einer anderen Vertreibung berichtete die in New York lehrende Anthropologin Paige West, die auf Papua-Neuguinea acht Jahre lang Menschen studierte – den Stamm der “Gimi”. Um deren Lebensraum war ferner die US-Naturschutzorganisation “Biodiversity Conservation Network” (BCN)” besorgt. U.a. kartographieren die BNC-Ökologen, ähnlich wie die Geologen früherer Zeiten, die im Auftrag von Staaten und Bergbauunternehmen unterwegs waren, eine “definierte Fläche” im Hinblick auf seine Bodenschätze. Nur dass es hier jetzt im Auftrag von Pharma- und Gentechnik-Unternehmen um lebende Organismen ging. “Ziel von BCN war es”, schreibt Klaus Pedersen, “das soziale Leben der Gimi innerhalb von vier Jahren naturschutzkompatibel umzukrempeln”. Paige West bezeichnete deren Aktivitäten zusammenfassend als eine “neoliberale Herangehensweise an den Naturschutz.” Das Problem bestand nicht darin, dass die Gimis dem Wald, den Pflanzen und Tieren einen anderen “Wert” beimaßen als die Ökoaktivisten von BCN, sondern darin, dass sie diesen “Dingen” überhaupt keinen Wert beimaßen, weil sie sich nicht als getrennt von ihnen begriffen. Pedersen zitiert dazu einen Dorfältesten aus Kamerun: “Der Wald gehört nicht uns. Wir gehören dem Wald. Mó-bele hat ihn als unser Zuhause geschaffen. Wenn wir nicht im Wald leben, wird Mó-bele wütend, weil dies zeigt, dass wir Mó-bele und seinen Wald nicht lieben.”
Statt von einer Ökonomie sollte man ihre Wirtschaftsweise besser als “anökonomisch” bezeichnen, schlug deswegen Jacques Derrida vor. Diese hat auch in anderer Hinsicht Folgen: Eine Mitarbeiterin einer Umweltschutzorganisation, die sich in Laos engagierte, meinte auf der Veranstaltung mit Mac Chapin: “Wir standen unter dem Zeitdruck, dort in fünf Jahren etwas zu erreichen, die Indigenen hatten jedoch ein ganz anderes Zeitkonzept.” Und auch ganz andere Mittel: Ich sprach einmal mit zwei “Health-Officers” aus Papua-Neuguinea, die sich auf Einladung der UNESCO zur medizinischen Weiterbildung in Manila befanden: Sie gewährleisteten die medizinische Versorgung und Gesundheitsprävention in schwer erreichbaren Gegenden, in einem lebten auch ihre Eltern als Subsistenzbauern. Ihr Rang war etwas unterhalb von ausgebildeten Krankenschwestern, man könnte sie als “Barfußärzte” bezeichnen, eingebunden jedoch in ein englisches Gesundheitssystem, das kostenlos war. Einer der beiden “Health-Officer”, er war etwas devoter als der andere, bezeichnete die “Heiler” und “Zauberdoktoren”, die Geld für ihre Behandlung nahmen, als seine “Hauptgegner”, die er bekämpfte, indem er sie als “Betrüger” entlarvte. Während der andere, der souveräner wirkte, bei dem “Hauptproblem” in seiner Region – die Bisse einer bestimmten Giftschlange – sogar die “Heiler” um Unterstützung bat, die in solchen Fällen die Bißstelle mit Lehm und bestimmten Pflanzensäften beschmierten und dazu Zaubersprüche murmelten: “Das hilft fast immer – und ich spare mein teures Serum,” erklärte er mir.
Die Allmende, das Gemeineigentum (oder “Common), das jeder nutzen, aber keiner besitzen darf, wird weltweit immer kleiner, allerdings erstarkt auch der Widerstand – gegen seine Privatisierung (die bis hin zur Patentierung von Zelllinien geht) sowie gegen die Vernutzung auch noch seiner letzten Ressourcen. Das geschieht ebenfalls weltweit. Gleichzeitig wird in den industrialisierten Ländern infolge des Internets die Forderung nach Übertragung der neuen virtuellen Allmenden (freie Software, Linux, Wikipedia) auf die Realökonomie laut. Also auf eine Ausweitung der Kampfzone. Von ihren um Patentschutz und Kopierverbot besorgten Gegnern (Universitäten und Konzernen) werden diese Vorkämpfer einer neuen “Peer-Ökonomie” als (kriminelle) “Netz-Piraten” beschimpft. Während umgekehrt die Menschenrechtler und die um freie Nutzung etwa des Saatguts besorgten “NGO”s (Via Campesina z.B.) von “Biopiraterie” sprechen, wenn Konzerne – wie Monsanto, Unilever oder BASF – Anspruch auf Saatpatente anmelden oder das “Wissen ganzer Stämme (um den Nutzen bestimmten Pflanzen z.B.) klauen”, wie der “Planet Diversity”-Kongreß 2008 in Bonn befand. Er wurde von der anthroposophischen “Zukunftsstiftung Landwirtschaft” organisiert, namentlich von Benny Härlin, der zuvor bei Greenpeace arbeitete und früher Hausbesetzer sowie taz-Lokalredakteur war. Heute organisiert er die Kampagnen gegen Genmais-Anbau. Den Begriff der “Biopiraterie” hatte zuvor bereits die indische Ökofeministin Vandana Shiva popularisiert, deren gleichnamiges Buch 2002 auf Deutsch erschien.
Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Böse so nah ist?! Überall mehren sich die Zwangsnomaden. Und alles kann privatisiert werden – sogar die Sonne und der Wind. In Deutschland wurden einst die Windkraftanlagen gegen die Gebietsschutz beanspruchenden Stromkonzerne und den Staat durchgesetzt – von unten, aber kaum hatten die “local people” das geschafft, wurde ihnen das Geschäft von den selben Konzernen abgerungen, die nun mit internationalem Venture-Kapital von oben den Gemeinden und Dörfern ganze “Windparks” vor die Tür knallen. Im Alten Land bei Hamburg versuchte der Senat und der Airbus-Konzern ein Obstbauerndorf per Gesetz zu enteignen, um die Landebahn für ein neues noch größeres Flugzeug zu erweitern. Auf der Eiderstedter Halbinsel gibt es nicht nur einen Widerstand gegen die meist grünen Naturschützer, die hier laut Aussage des Kehdinger Bauern Schmoldt gegenüber dem Spiegel “das Land beherrschen wie einst die Gutsherren”, sondern auch einen wachsenden Unmut gegen die staatlichen grünen BSE-Maßnahmen – vor allem um die existenzzerstörenden Massentötungen von Rindern zu verhindern .Und in der Lausitz baggert der schwedische Energiekonzern Vattenfall trotz Widerstand ein sorbisches Dorf nach dem anderen ab, jüngst wurde gerade das schönste dort – Horno – “devastiert”.
Die letzten Regenwälder der Welt werden vor allem von Öl- und Gasgesellschaften heimgesucht, meinte Mac Chapin, “die großen Umweltschutzorganisationen bekommen Geld von ihnen – und sagen deswegen nichts zu deren Zerstörungen”. Diese Erfahrung machte er in Brasilien, bestätigt wurde sie von der Kassler Soziologin für Entwicklungsländer Clarita Müller-Plantenberg, die Mac Chapin mit Hilfe ihrer Organisation “Forschungs- und Entwicklungszentrum Chile-Lateinamerika” (FDCL) nach Deutschland eingeladen hatte. Ein im Publikum sitzender Entwicklungshelfer berichtete später von einer ähnlichen Erfahrung in Peru. Zwar gibt es allein in Lateinamerika noch insgesamt 40 Millionen Indigenas, aber viele Völker sind schon so dezimiert, dass die im märkischen Naturschutzgebiet Brodowin von der Biologin Hannelore Gilsenbach redigierte “Zeitschrift für gefährdete Völker – Bumerang” mitunter sogar ihre kleinsten Ausbreitungserfolge für anzeigenswert hält. Im letzten Heft heißt es z.B.: “Die ‘Negrito’-Ureinwohner der Andamanen vom Volk der Onge freuen sich über die Geburt eines Mädchens. Es kam am 9.Juli 2008 in Dugong Creek gesund auf die Welt. Damit stieg die Zahl der Onge auf 98 Menschen.” An anderer Stelle wird vermeldet, dass der kanadische Premierminister sich bei den nahezu zehntausend Ureinwohnern des Landes für ihre jahrelange Mißhandlung durch weiße Erzieher entschuldigt habe: Diese hätten versucht, “den Indianer im Kind” zu töten. Im Gegensatz zur australischen Regierung, die sich bei “ihren” Ureinwohnern nur entschuldigte, sicherte ihnen die kanadische auch noch eine Entschädigung in Höhe von zwei Milliarden Dollar zu.
Ein Zehntel der Fläche Brasiliens und ein Viertel der Fläche von Kolumbien sind als Indigene Territorien und ein Drittel der Mongolei ist als Nationalpark ausgewiesen. “Aber”, wie mir ein Förster und GTZ-Mitarbeiter in der Wüste Gobi, wo der Nationalpark alleine 5,4 Millionen Hektar umfaßt, sagte: “das meiste steht nur auf dem Papier”. Immerhin gelang es der GTZ dort, die Viehzüchter in 80 Kooperativen zu organisieren und in die Nationalparkverwaltung einzubinden. Daneben profitieren diese auch vom neuen Naturtourismus. Bisher mußte noch niemand aus der Gobi mangels einer Erwerbsmöglichkeit wegziehen, dafür nahmen die “Communities” jedoch schon viele Viehzüchter aus anderen Teilen der Mongolei auf, wo sie von großen Bergbauvorhaben vertrieben wurden. Und statt der “Armutswilderei” gibt es im Gobi-Nationalpark heute nur noch gelegentlich eine “Neureichen-Wilderei”.
Die Zerstörung der Regenwälder begann laut Mac Chapin in den Fünfziger- und Sechzigerjahren: Bis dahin hatten Malaria und Gelbfieber noch jedes Kolonisierungsprojekt verhindert: “die Hälfte der Leute starb jedesmal.” Aber dann wurde 1. das DDT entwickelt – und von den amerikanischen Soldaten zum ersten Mal im Krieg gegen Japan eingesetzt, 2. 1947 die Motorsäge erfunden – in Oregon, und 3. Straßenbaugeräte und die Asphaltierung. Dies geschah überall auf der Welt – und bis heute, wobei die medizinischen Mittel immer besser wurden, die Straßenbaugeräte immer größer und die Motorsägen immer mehr. Ein ehemaliger Umweltschützer, der im Publikum saß, ergänzte Mac Chapins Ausführungen dahingehend, dass ein Teil dieser “Errungenschaften” auch den indigenen Völkern zugute komme. In dem Teil Boliviens, wo er arbeitete, hätten sie das dortige Ökoystem allerdings völlig zerstört, allein “weil sie zu viele waren.“
Dieses Problem – der “Überbevölkerung” einer Region – hat Timothy Mitchell thematisiert – am Beispiel Ägyptens. Sein Text “Das Objekt der Entwicklung” erschien gerade auf Deutsch in dem Reader “Vom Imperialismus zum Empire”, den der Afrikanist Andreas Eckert und die Ethnologin Shalini Randeria herausgaben, um zu dokumentieren, wie sich die Globalisierung aus Sicht der Dritten Welt darstellt. In Ägypten waren es Weltbank und IWF, die aus einem Lebensmittel-Exportland mit Hilfe ihrer Agrarexperten ein Getreide-Importland machten, wobei aus dem riesigen “Freiland-Gewächshaus” des Nil-Schwemmlandes armselige Weiden für deutsche Rinderzuchten wurden – und zigtausende von Fellachen in die Städte abwandern mußten. Seitdem sprechen die westlichen Experten dort malthusianisch-zynisch von “Überbevölkerung”. In Vietnam, wo die US-Luftwaffe mit dem Entlaubungsgift “Agent Orange” Ähnliches anrichtete, sprachen US-Soziologen von einer “nachgeholten Urbanisierung”. Während man in China und im Iran die “Überbevölkerung” durch Umwandlung von Weide- in Ackerland und die Ansiedlung von immer mehr Seßhaften auf Nomadenland forciert. Die Mongolen in China fühlen sich bereits auf ihrem eigenen Territorium als Minderheit bedroht, zumal der Staat auch noch ihre Kultur als sezessionistisch angreift.
Die Veranstaltung im Kreuzberger Mehringhof endete versöhnlich: “Menschenrechtler wie Umweltschützer,” so meinte einer aus dem Publikum, “müßten in einen Dialog mit den Vorstellungen und Ideen der Indigenen treten”, bisher hätten sie sich damit noch nie richtig auseinandergesetzt.
Die Mitarbeiter der GTZ-Ökoprojekte in der Mongolei haben das bisher sehr wohl getan – indem sie sich hüteten, “als Experten aufzutreten”. Eine Viehzüchterin aus der Wüste Gobi erzählte mir: “Nach 1990 war jede Familie auf sich selbst gestellt, und sie wanderte so gut wie gar nicht. Das konnte nur durch die Communities gelöst werden. Das sind Kollektive wie im Sozialismus, aber diesmal bestimmen wir selbst, was zu tun ist. Etwas 2000 Viehzüchter haben sich bisher hier zusammengeschlossen. Schon im ersten Jahr 1999 haben wir das Positive daran gemerkt. Nach sieben Jahren können wir nun sagen, dass es richtig war. Wir haben uns kundig gemacht, wie die negative Entwicklung zustande kam. Außerdem haben wir jetzt bessere Möglichkeiten, unsere Produkte zu vermarkten. Wir bekommen bessere Preise für Kaschmirwolle und Leder, die Schafwolle verarbeiten wir selbst. Die Wilderei hat völlig aufgehört und keine Familie sammelt mehr Feuerholz. Wir wissen heute, wie die Natur zu verbessern ist. Außerdem waren wir drei Mal im Ausland, haben viel gesehen und sind auf neue Ideen gekommen. Ich bin selbst ein Beispiel dafür: Obwohl eine einfache Viehzüchterin habe ich mich in den letzten Jahren sehr verändert und mein Leben verbessert. Wir sind 35 Familien, 144 Menschen und haben 7000 Tiere. 1999 ging es nur sechs Familien gut, der Rest war arm. Wir hatte keinen Zugang zu Informationen und waren zerstreut. Heute geht es uns allen gut.”
Die Gobi-Nomaden sind Mitglied in der “World Alliance of Mobile Indigenous People” (WAMIP). Einmal im Jahr treffen sich Delegierte von potentiell allen nomadischen Völkern zu einer internationalen Konferenz, die von der UNESCO gesponsort wird. 2005 fand sie in Äthiopien statt, Gastgeber waren hier die Guji-Oromo, die nahe am “Omo Nationalpark” leben. Ende 2004 hatte die Polizei zusammen mit der Parkverwaltung 463 Hütten der Guji-Oromo niedergebrannt, um die Guji (nomadische Viehzüchter) und Kore (Mais- und Sorghum-Anbauer) aus dem Nationalpark und seiner nahen Umgebung zu vertreiben. Dieser wird von der niederländischen “African Parks Foundation” gemanagt, die den Park zu “einer Attraktion für Dollar-Touristen ausbauen will”, wie die davon Betroffenen in ihrem Bulletin “The Human Cost of Tourist Dollars” schrieben.
Neben einer Kritik an solchen und ähnlichen Vertreibungsaktionen sprach sich der Kongreß der nomadischen Völker für eine Unterstützung des Widerstands der Massai in Kenia aus, die dafür kämpfen, dass ihre Weideflächen, die ihnen einst durch englische Kolonialverträge genommen wurden, für ihre Rinderherden wieder zugänglich sind. Außerdem wurde noch auf die anhaltende Verfolgung der “sea gypsies” (Seezigeuner) in Burma und Indonesien aufmerksam gemacht, deren “Existenz als Kultur und Volk” besonders gefährdet ist. Während es über die burmesischen “Meeresnomaden” einige neuere Untersuchungen von französischen Ethnologen gibt sowie auch einen Dokumentarfilm, werden sie in Indonesien als “Piraten und Verbrecher” begriffen – und seit Auflösung der DDR von der indonesischen Marine mit NVA-Schiffen verfolgt, die ihnen ihre Schiffe abnimmt oder versenkt. Ansonsten waren sich die etwa 120 Delegierten durchaus uneinig, ob sie für die Umwandlung der Weideflächen in Nationalparks oder für eine legale Selbstverwaltung ihrer Territorien votieren sollten, wie es einige Waldnomaden aus Peru forderten. In jedem Fall ging es um “den Erhalt der biologischen und kulturellen Vielfalt”.
Im Herbst 2008 wurde das auf der Konferenz in Barcelona noch einmal in Form einer Deklaration bekräftigt. Obwohl die Naturschützer dies nur begrüßen können, gibt es doch einen gravierenden Unterschied zwischen ihnen und den nomadisch lebenden Indigenen: Während die Nomaden den Raum beherrschen, nehmen die Seßhaften ihn in Besitz, sie zerstückeln und markieren ihn, um ihn aufzuteilen. Zwar hat auch der Nomade Punkte (Wasserstellen, Winterplätze, Versammlungsorte), aber die Frage ist, was ein Prinzip des nomadischen Lebens ist und was nur eine Folge: “die Punkte sind den Wegen, die sie bestimmten, streng untergeordnet, im Gegensatz zu dem, was bei den Seßhaften vor sich geht,” schreiben Gilles Deleuze und Félix Guattari in “Mille Plateaux”. Während der Seßhafte “einen geschlossenen Raum unter den Menschen aufteilt, verteilt der Nomade die Menschen und Tiere in einem offenen Raum, der nicht definiert und nicht kommunizierend ist”. Anny Milovanoff kommt in “La seconde peau du nomade” (Die zweite Haut des Nomaden) zu dem Schluß: “Der Nomade hält sich an die Vorstellung seines Weges und nicht an eine Darstellung des Raumes, den er durchquert. Er überläßt den Raum dem Raum.”

Hier, die habe ich eben im Wald gefunden.
Anmerkung:
(1) Der holländische Autor Midas Dekkers fragte einmal den Tierfilmer Sir David Attenborough, ob die Primatenforscherin Dian Fossey, mit der Attenborough befreundet gewesen war, nicht zu weit gegangen wäre – bei ihrer Verteidigung der Berggorillas gegenüber den von ihr sogenannten Wilderern: “Ja,” antwortete der. “Und sie ging überhaupt zu weit in ihrer Abneigung gegen die Afrikaner. So ließ sie die Bauern in Ruanda wissen, dass sie ihr Vieh nicht im Naturpark weiden lassen durften. Aber es ließ sich kaum sagen, wo der Park begann und endete. Und die armen afrikanischen Bauern hatten nur wenig zu essen. Wenn ihr es doch tut, sagte sie, treffe ich Gegenmaßnahmen. Trotzdem tat es einer von ihnen. Also jagte sie jeder seiner Kühe eine Kugel ins Rückrat. Sie tötete sie zwar nicht, doch sie lähmte sie und raubte dem Besitzer damit Hab und Gut.
Einst verschwand ein Gorillababy. Dian glaubte, zu Recht oder zu Unrecht, dass sie den Täter kannte und kidnappte seinen Sohn. Sie band Afrikaner mit Stacheldraht an einen Baum und prügelte sie durch. Das ist keine Art, um die Unterstützung der ansässigen Bevölkerung zu bekommen. Wie auch immer – seit dem Tod von Dian Fossey [sie wurde 1985 ermordet] ist kein einziger Gorilla mehr verschwunden.”
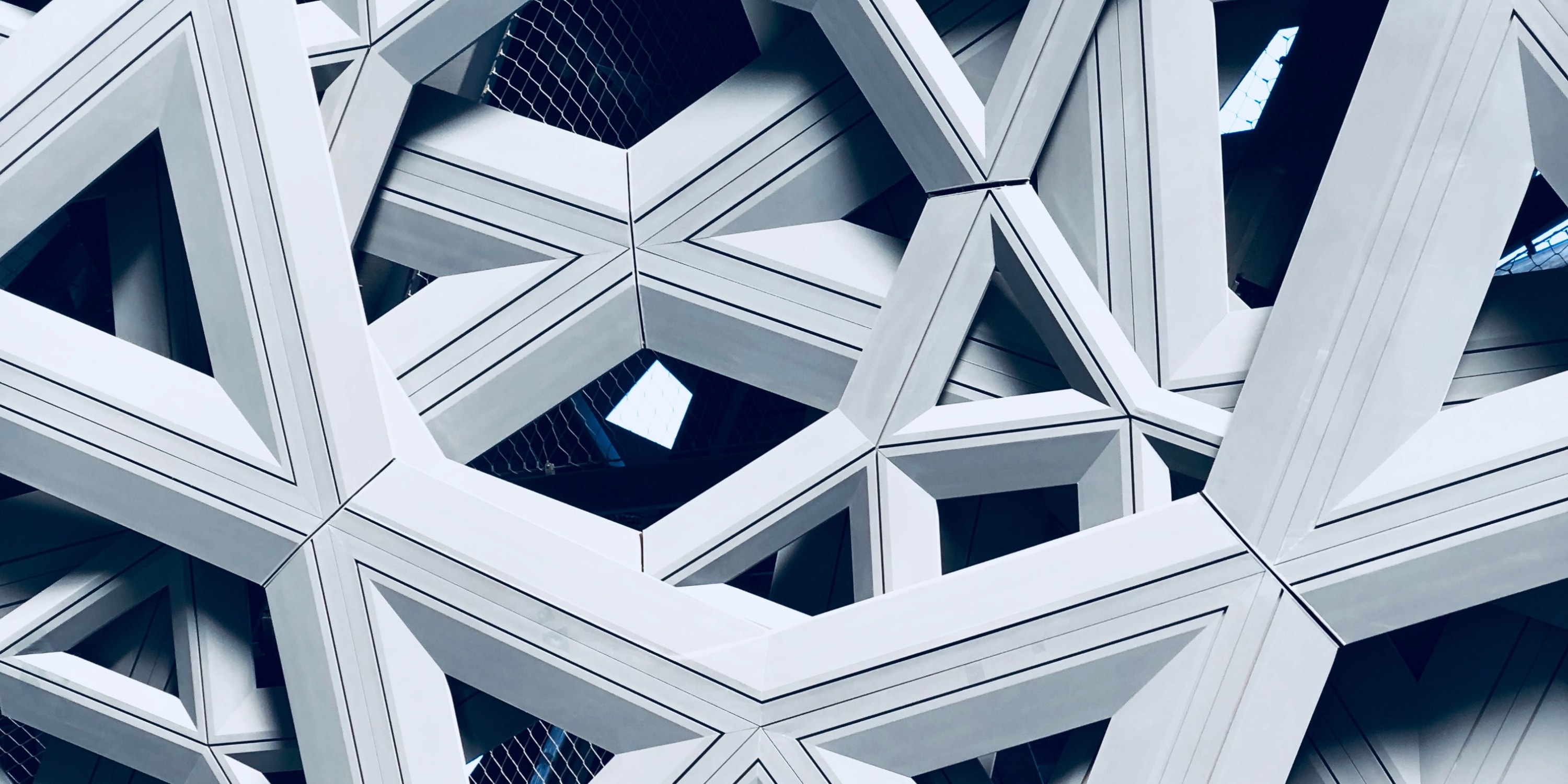




Lieber Autor,
Das ist ein sehr interessanter Artikel, den ich im Unterricht
verwenden werde. Literaturangaben würden diesen Aufsatz
noch wertvoller machen.
Vielen Dank,
Hermann Schultka