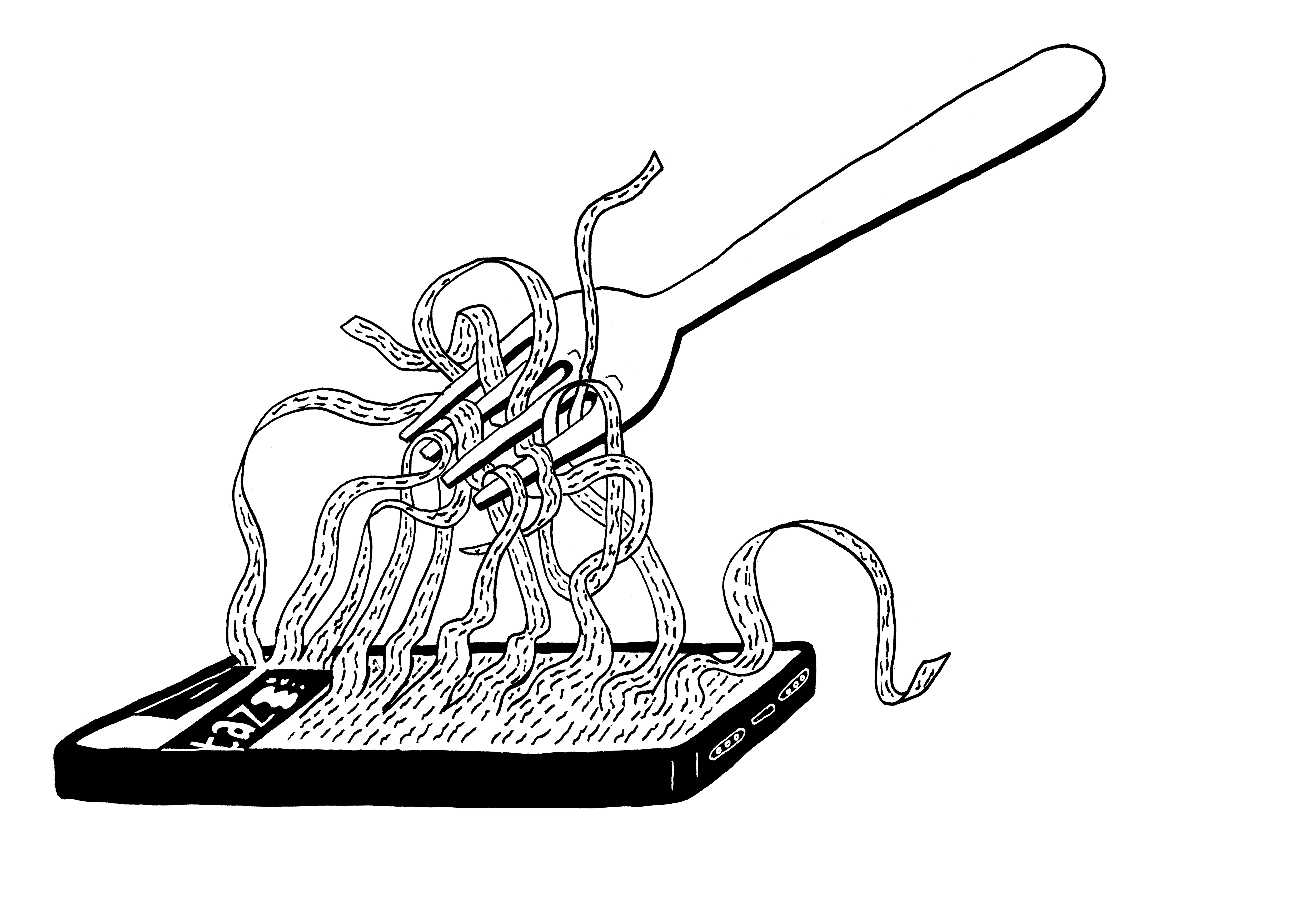***
Der Bär flattert in nördlicher Richtung.
***
Vom Berliner Ostbahnhof fuhren wir mit der Bundesbahn durchs Urstromtal nach Finsterwalde, dort biegt die Strecke nach Osten ab, und geht an Calau vorbei nach Cottbus. Der Begriff ›Kalauer‹ hat mit dieser Kleinstadt im Spreewald nichts zu tun, er ist vielmehr eine Verballhornung des französischen Wortes Calembour, was soviel wie öde Witzelei bedeutet. Während Calau sich eben vom niedersorbischen Kalawa herleitet.

***
Von Cottbus ging es auf einer Nebenstrecke ins ›Neuseenland‹, so genannt nach den gefluteten Brachen des Braunkohletagebaus. Die Gegend war früher dicht bevölkert und ist reich an Bodenschätzen. Nicht nur Braunkohle wurde gefördert, auch Kaolin, das zur Herstellung von Porzellan oder Fliesen benötigt wird, und es gab eine vielseitige Textilindustrie. Bei der gottverlassenen Station Neupetershain stiegen wir aus. Patricia wartete bereits mit ihrem kleinen Mercedes vor dem Bahnhofsgebäude, gegenüber standen zwei verfallene, ehemals stattliche Backsteinhäuser mit Fachwerkgiebeln, die Fenster mit Brettern vernagelt, und in ungelenken Buchstaben war auf die Fassade »100 % DEUTSCH« gesprayt.
Das konnte ja heiter werden! Jedoch diese verfallenen Häuser am Bahnhof waren die einzigen Ruinen und Graffiti, die wir während der Fahrt nach Welzow sahen. Stattdessen fuhren wir auf neu gebauten Straßen vorbei an sauberen Einfamilienhäusern, umgeben von kurzem Rasen und symmetrischen Blumenrabatten. In jedem Dorf, das wir passierten, gab es eine ehemalige Unternehmervilla mit korinthischen Säulen und überladenen Sopraporten, nicht ganz so proper in Schuss wie die Einfamilienhäuser der Rentner daneben, aber umso prunkvoller.
Wir hatten Hunger, Patricia schlug vor, den besten Pflaumenkuchen der Gegend zu probieren. Den machte Gitti, sie betrieb ihre Gaststätte in einem Schrebergarten am Ortsrand. Vor »Gittis Schlemmerstübchen« standen acht Tische für vier Personen, alle waren besetzt. Zum Glück wurde einer frei, und wir bekamen die letzten drei Stücke Kuchen. Beim Kassieren erzählte uns Gitti, eine Frau in den Fünfzigern, aus ihrem Leben. Sie hatte mit ihrem Mann zu DDR-Zeiten die einzige Gaststätte Welzows bewirtschaftet, ein HO-Betrieb. Ihr Restaurant war in der Gegend berühmt für gute Küche gewesen, sie kochte für Hochzeiten und andere Feste. Nach der Wende wurden Haus und Restaurant den Eigentümern, die im Westen lebten, zurückübertragen. Das Gebäude wurde mit Aufbau-Ost-Mitteln aufwendig renoviert, Gitti musste raus, weil sie die hohe Miete nicht zahlen konnte. Das renovierte Haus mitsamt Restaurant steht seit zwanzig Jahren leer und verfällt langsam wieder. Gitti funktionierte ihren Schrebergarten zum ›Schlemmerstübchen‹ um, so schlägt sie sich durch.
Auf der Fahrt zur Zahnarztpraxis erzählte Patricia, dass der Schein von Wohlstand und Zufriedenheit, den die Gegend ausstrahlt, trügt. Vielmehr gibt es fast nur noch Rentner, die in den mit Hilfe von Subventionen des Aufbaus Ost renovierten oder neu gebauten Häusern leben. Die qualifizierten Fachkräfte sind sämtlich in den Westen abgewandert. Jugendliche, die hier herumhängen, beziehen durchgehend Hartz IV. »Woher weißt du das so genau?«, fragte Barbara. »Das steht alles in der Patientenkartei. Es gibt kaum Arbeit außer im Braunkohletagebau, den Leuten geht es nicht wirklich schlecht, aber die Stimmung ist trostlos.«
Unter solch deprimierenden Berichten erreichten wir ein großzügiges Zweifamilienhaus in Welzow, darin befand sich die Praxis. Auch hier waren offensichtlich reichlich Subventionen geflossen: außen Hoyerswerder Barock, innen moderne medizinische Ausstattung. Ich lag in einem luxuriösen neuen Zahnarztstuhl, und Patricia nahm sich meinen Zahn vor. Sie erklärte mir, dass er gut aufzubauen sei und schrieb für mich in ihrer gestochenen Handschrift auf, worauf ich achten solle, damit der Kollege in Berlin es ordentlich macht. Unser Zug fuhr erst abends, und weil Patricia nur Telefonbereitschaft hatte, wollte sie uns das Schloss Altdöbern zeigen, die Sehenswürdigkeit der Gegend.

***
Altdöbern gehört zu den »Perlen des sächsischen Barock«. Das Schloss strahlte in frisch renoviertem Glanz, an den Seitenmauern standen noch die Gerüste. Die beiden Wolfsskulpturen links und rechts des Wasserbeckens im Schlosspark spien in hohen dünnen Bögen asymmetrisch sich kreuzende Strahle aus dem zum Geheul erhobenen Schnauzen – minimalistisch und schön. »Das sind vermutlich die sorbischen Wölfe«, sagte Barbara. Auf einer Bank am Becken saßen zwei junge Männer in Nazikampfjacken, die uns – nein, nicht belästigten, sondern höflich grüßten. Irgendwie müssen Barbara, Patricia und ich für sie 100 % DEUTSCH ausgesehen haben. Unbehelligt passierten wir den großen Barockbrunnen an der Stirnseite des Beckens, spazierten an den Redouten und ausgedehnten Orangerien entlang.

Der Zeitpunkt für unseren Besuch war günstig, denn im Park hatte man am Wegrand Schautafeln zum ›Tag des Denkmals‹ aufgereiht, auf denen die Geschichte des Schlosses dargestellt war: Ursprünglich stand hier eine Wasserburg, diese wurde durch einen Renaissancebau ersetzt, der wiederum einem Barockbau weichen musste. Dessen Erbauer war Carl Heinrich von Heineken, der eigentliche Gründer des berühmten Dresdner Kupferstichkabinetts. Er fiel wegen seiner Tätigkeit als Privatsekretär des Grafen Brühl, dem Wirtschaftsminister des Kurfürsten August II. von Sachsen und Königs von Polen, in Ungnade, weil Brühl die Gelder der königlichen Kassen durch Spekulationen verspielt hatte. Und weil Brühl verstorben war, wurde seinem Sekretär der Prozess gemacht, man konnte Heineken jedoch keine Bereicherung auf Kosten des Königshauses nachweisen. Denn Geld hatte Heineken selber, er erbte ein großes Vermögen von seinem Schwiegervater, dem Hofkoch Möller. Erstaunlich, was sich so ein Erbküchenmeister an Vermögen zusammenkochen konnte! Nach seiner Rehabilitierung zog sich der Kunstfreund nach Altdöbern zurück, lebte dort als Privatier, ließ prunkvolle Parkanlagen anlegen und mit Kanälen und Plastiken ausstatten, außerdem handelte er mit Bildern von Dürer, Rembrandt und van Dyck.
Fortsetzung folgt
***
BK / JS