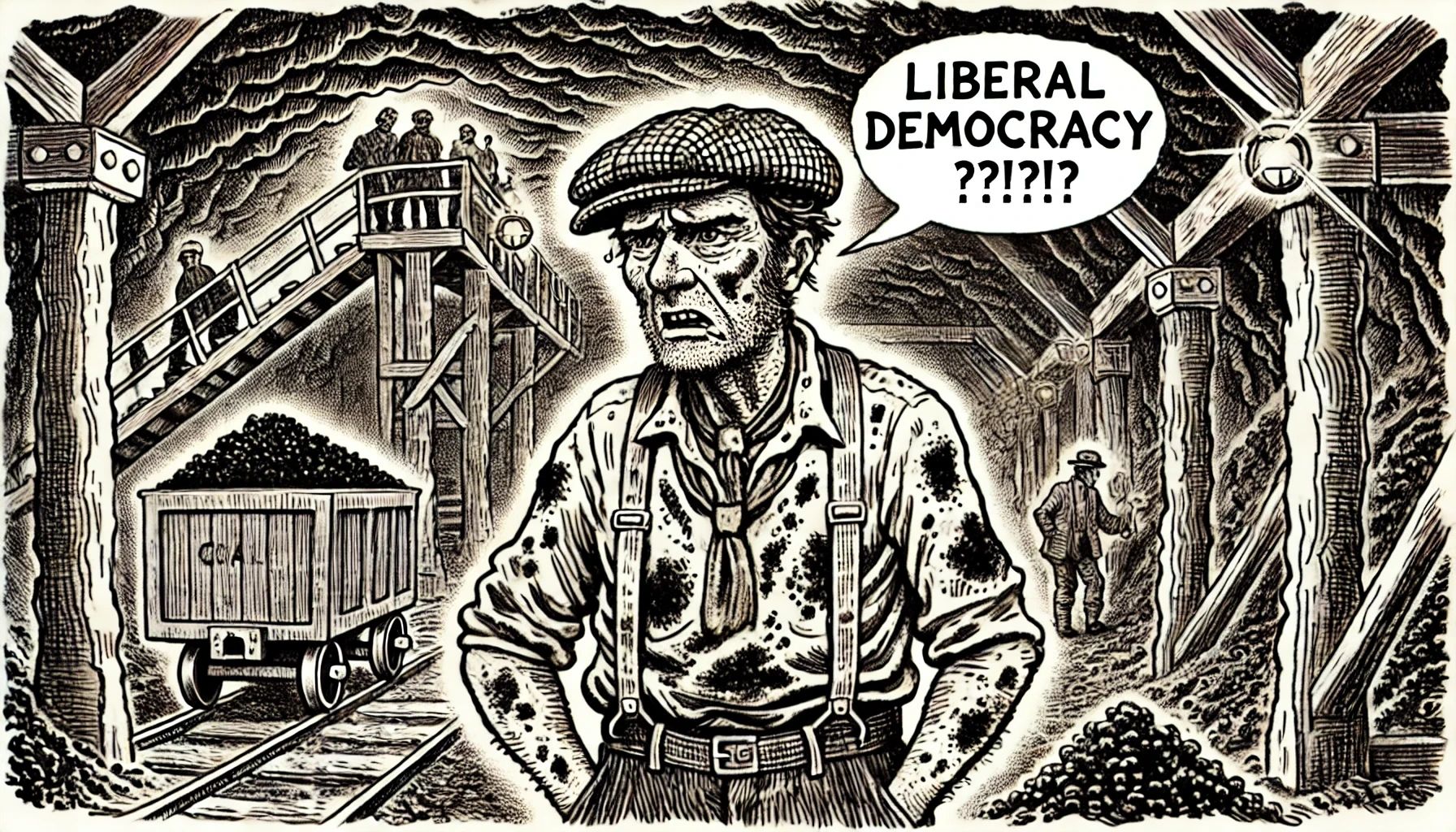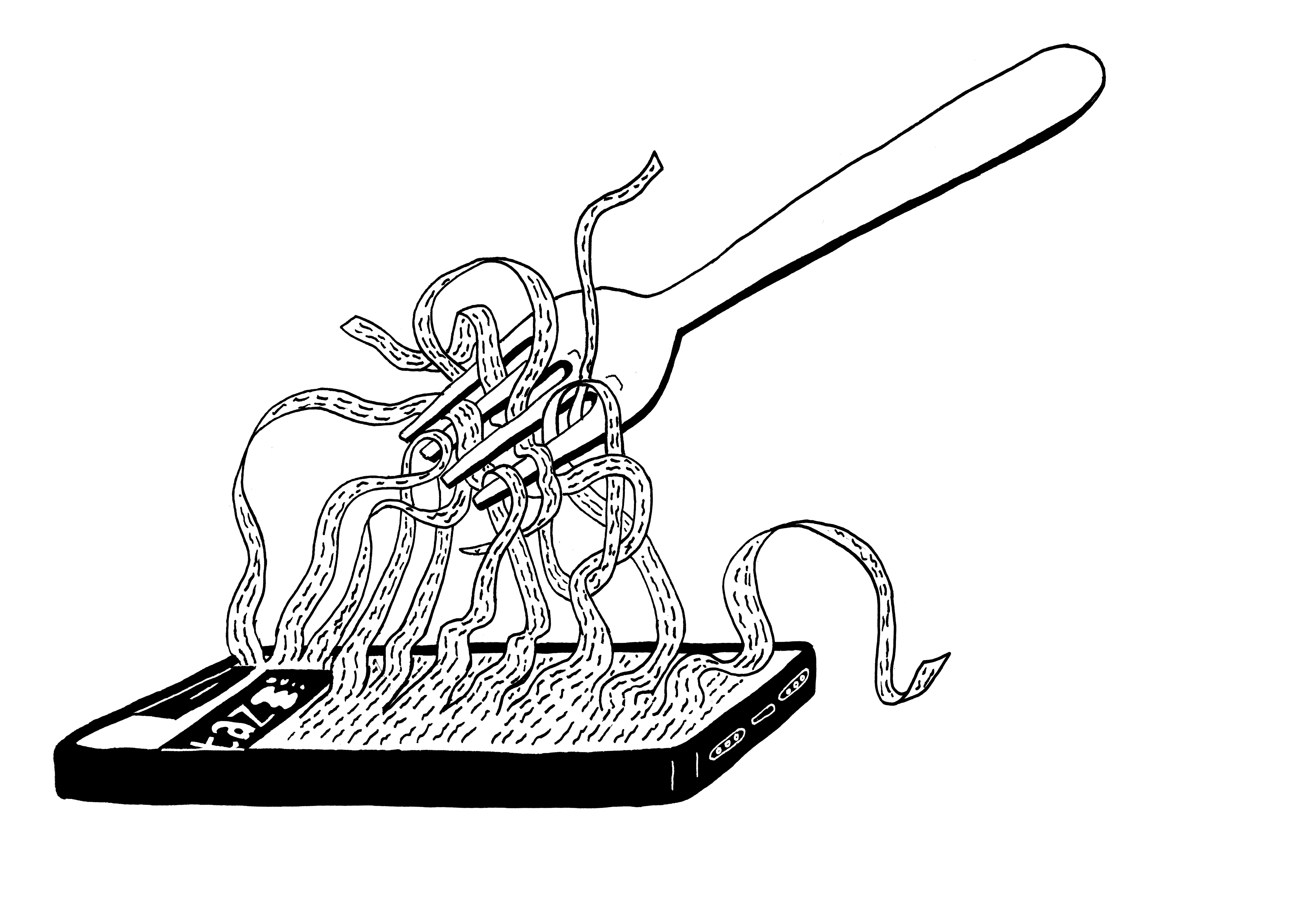Es wird oft behauptet, der Liberalismus habe Demokratie, Menschenrechte und individuelle Freiheiten erkämpft. In diesem Sinne nennen sich viele, die für gesellschaftlichen Pluralismus und Menschenrechte eintreten, „liberal“ oder „sozialliberal“. Und fast täglich lesen wir in der Zeitung von der „liberalen Demokratie“ – zumeist in dem Sinne, dass sie in Gefahr sei. Aber ein Blick in die Geschichts- und Philosophiebücher zeigt, dass Liberalismus wenig mit Demokratie und Rechten zu tun hat. Im Gegenteil, die Idee, dass Liberalismus ein „Champion“ der Demokratie gewesen sei, ist eine besonders unverfrorene Variante des Geschichtsrevisionismus.
Tatsächlich setzten sich klassische Liberale vor allem für „Vertragsfreiheit“ und „Eigentumsrechte“ ein – Begriffe, die in der Praxis bedeuteten, dass Großgrundbesitzerinnen der Landbevölkerung Böden „abkaufen“ konnten, die vorher Kommunal- oder Feudalbesitz waren, dass Industrie- und Großgrundbesitz vor Vergesellschaftung, Genossenschaften oder Agrarreform „geschützt“ wurde und dass Arbeiterinnen sich, ihre Körper, Arbeit und Zeit in rechtlich „Arbeits-“ und „Mietverträgen“ verkaufen konnten, anstatt direkt gezwungen zu werden – eine Form der vermeintlich freiwilligen Lohnsklaverei. Ideen und Praxen, die vor dem Liberalismus des 19. Jahrhunderts, wie Karl Polanyi feststellt, nicht existierten. All dies war ökonomische Zwangsherrschaft und Ausbeutung, von Liberalen als Rechte und Freiheiten verkauft.
Ein weiteres liberales Ammenmärchen lautet, dass Rechte und sozialer Fortschritt durch Wohlstand und inkrementale Reformen im Kapitalismus entstanden seien. Doch die historische Realität zeigt das Gegenteil: Jede Form von sozialem Fortschritt musste Liberalen abgerungen werden – sei es das allgemeine Wahlrecht, Arbeitsschutz oder Rentensysteme. Und seit der neoliberalen Revolution der 1980er Jahre wurden viele dieser Errungenschaften wieder rückgängig gemacht.
Das allgemeine Wahlrecht, Arbeitsschutz und soziale Grundrechte wurden dagegen meist von Sozialistinnen, Gewerkschaften und radikaldemokratischen Bewegungen erkämpft – oft gegen den heftigen Widerstand der Liberalen. In Großbritannien war es die Arbeiterbewegung der Chartisten (1838–1850er), die zuerst das allgemeine Wahlrecht für Männer forderte. Erst unter massivem Druck von Straßenprotesten, Gewerkschaften und der aufstrebenden Labour Party wurde mit dem Representation of the People Act 1918 das allgemeine Wahlrecht für Männer eingeführt – es schien mehr und mehr unhaltbar, Millionen von Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gekämpft hatten, nicht wählen zu lassen. Frauen erhielten begrenztes Wahlrecht, aber erst nach jahrzehntelangem Protest und der Suffragettenbewegung wurde 1928 mit dem Equal Franchise Act völlige Gleichstellung erreicht.
In Deutschland erkämpfte die Arbeiterbewegung 1918 das allgemeine Wahlrecht für Männer und Frauen während der Novemberrevolution, während Liberale und Konservative das Kaiserreich mit seinem Dreiklassenwahlrecht gestützt hatten. In Frankreich setzte die radikale Linke unter den Jakobinerinnen bereits 1793 das allgemeine Wahlrecht für Männer durch, das jedoch unter Napoleon und der Restauration von Liberalen wieder abgeschafft wurde.
Liberale blockierten Demokratie und soziale Rechte
Frühe Liberale unterstützten nur eine eingeschränkte politische Teilhabe: Zensuswahlrechte sorgten dafür, dass nur wohlhabende Männer wählen konnten, während Arbeiterinnen und Bäuerinnen ausgeschlossen blieben. In England, Frankreich und Deutschland hielten liberale Parteien lange an dieser Form der Plutokratie – der Herrschaft der Reichen – fest. Ihre Angst war stets, dass eine breite Wählerschaft durch demokratische Mehrheiten soziale Reformen erzwingen könnte. John Stuart Mill, einer der bedeutendsten liberalen Denker, schlug sogar ein Bildungswahlrecht vor, das Gebildeten mehr Stimmen gab – ein Vorschlag, der in einer Zeit, in der höhere Bildung fast ausschließlich Reichen offenstand, faktisch eine Absicherung des Elitenwahlrechts war.
Auch in anderen Bereichen war der Liberalismus selektiv: Meinungsfreiheit galt oft nur für Eliten, während Gewerkschaften und sozialistische Presse verboten oder zensiert wurden. In Großbritannien wurden frühe Gewerkschaften mit dem Combination Act (1799) kriminalisiert und erst 1871 legalisiert. In Frankreich wurde die sozialistische Presse unter der liberalen Orléans-Monarchie (1830–1848) massiv verfolgt, weil man ihre Kritik an wirtschaftlicher Ungleichheit für gefährlich hielt.
In Deutschland tolerierte Bismarck liberale Parteien, da sie seine wirtschaftliche Politik unterstützten, aber er ließ die sozialistische Arbeiterbewegung mit den Sozialistengesetzen (1878–1890) massiv unterdrücken. Sozialistische Zeitungen wurden verboten, Gewerkschaften verfolgt, und politische Organisationen der Arbeiterbewegung durften nicht existieren. Während Liberale diesen Kurs meist mittrugen, waren es Sozialistinnen und Gewerkschaften, die letztlich die politischen Freiheiten für Arbeiterinnen erkämpften. Hier, wie in anderen Fällen, schützte liberale „Rechtsstaatlichkeit“ Eigentümerinnen vor Vergesellschaftung oder Nationalisierung, aber nicht Arbeiterinnen vor Ausbeutung.
Besonders zynisch war die Haltung vieler Liberaler zur Kinderarbeit. Im 19. Jahrhundert arbeiteten Millionen von Kindern 12–16 Stunden täglich in Fabriken, Minen und auf Feldern – unter Bedingungen, die oft tödlich waren. Liberale Unternehmer argumentierten, Kinderarbeit sei „notwendig für den Wohlstand“ und „Teil der freien Marktwirtschaft“. Erst sozialistische Bewegungen und Druck von Gewerkschaften führten im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert zu Verboten von Kinderarbeit – oft gegen den massiven Widerstand von Liberalen.
„Vertragsfreiheit“ bedeutete, dass Fabrikbesitzer Arbeitszeiten und Löhne diktieren konnten, weil Arbeiterinnen „freiwillig“ unterschrieben – oft unter der einzigen Alternative des Verhungerns. In Großbritannien wurde der 10-Stunden-Tag erst 1847 durchgesetzt, nachdem liberale Unternehmer jahrzehntelang argumentiert hatten, Arbeitszeitbegrenzungen würden die Wirtschaft ruinieren. Mindestlöhne, Arbeitszeitbegrenzungen und Sozialversicherungen wurden von Sozialistinnen und Gewerkschaften durchgesetzt, während liberale Parteien sie oft vehement bekämpften.
Höhere Bildung: Ein erkämpftes Recht, nicht eine liberale Errungenschaft
Ähnlich war es beim Bildungszugang: Während liberale Denker Bildung als wichtig erachteten, wollten viele sie privat organisiert sehen. Erst sozialdemokratische oder wohlmeinende konservative Regierungen nach dem Zweiten Weltkrieg erweiterten sukzessive den Zugang zu höherer Bildung für alle Bevölkerungsschichten.
Liberalismus ist keine Demokratiebewegung
Heute gelten Demokratie, Bürgerinnen- und Menschenrechte als „liberal“, doch ironischerweise wurden sie meist gegen den massiven Widerstand von Liberalen durchgesetzt. Wie man im Englischen so schön sagt, hier kommt „insult to injury“. Das allgemeine Wahlrecht, soziale Absicherung oder Bildung für alle waren keine liberalen Errungenschaften, sondern wurden von Sozialistinnen, Gewerkschaften und radikaldemokratischen Bewegungen erkämpft – gegen den Liberalismus.
Der Liberalismus verteidigte in erster Linie die Interessen des entstehenden Kapitalisteninnenklasse – nicht Demokratie oder Menschenrechte.
Wer sich nicht als Sozialistin bezeichnen will, obwohl dies Mitglieder von Gewerkschaften, der SPD oder Labour Party noch bis vor kurzem taten, sollte sich lieber Pluralistin, Menschen- oder Bürgerrechtlerin nennen, anstatt „liberal“. So kann zumindest auf sprachlicher Ebene eine dringend notwendige Trennung zwischen Demokratie und Menschenrechten auf der einen und Liberalismus und Kapitalismus auf der anderen Seite beginnen.
© 2025 Alexander Jeuk für den Text. Für das Bild siehe die Bildunterschrift.