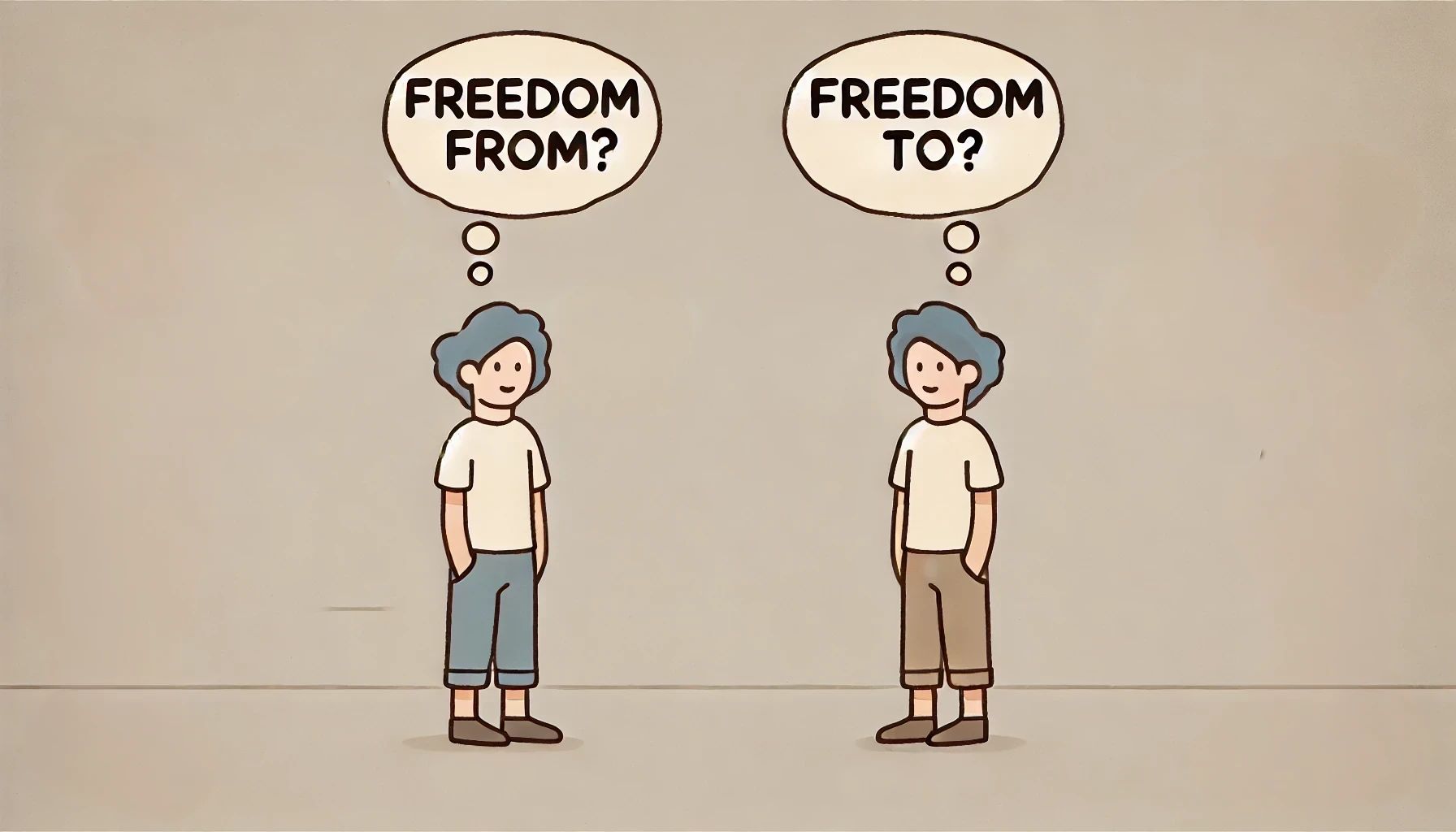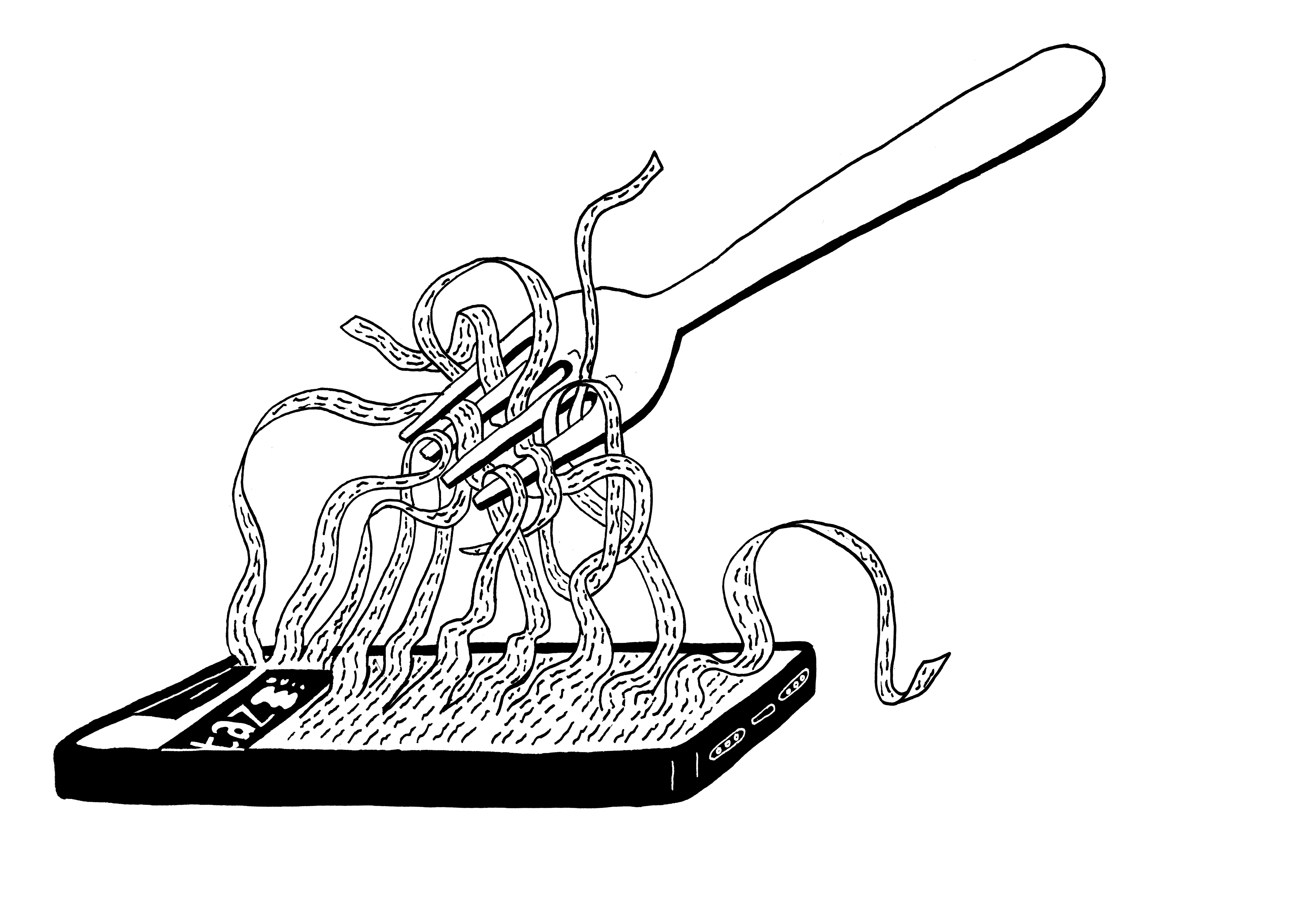Freiheit gilt klassischerweise als das zentrale Prinzip des Liberalismus, während der Sozialismus oft als Verfechter von Gleichheit betrachtet wird. Das ist schlicht Unsinn. Klassische Sozialistinnen, insbesondere Karl Marx, waren vor allem an Freiheit im Sinne der Befreiung der Arbeiterklasse von Ausbeutung interessiert. Sie wollten eine Gesellschaft schaffen, die frei von künstlichen ökonomischen Zwängen ist und in der alle ihre Interessen in verschiedene Richtungen entfalten können. Tatsächlich hat der Sozialismus in diesem Sinne die bisher kohärenteste Vorstellung von Freiheit entwickelt.
Leider haben viele Menschen, einschließlich Sozialistinnen, dieses klassische sozialistische Erbe vergessen. Dadurch hat sich folgendes Bild in unserem kollektiven Gedächtnis verankert: Der Liberalismus (z. B. Locke), insbesondere in seiner heutigen neoliberalen Variante (z. B. Hayek, Friedman), argumentiert vehement, dass Freiheit „Freiheit von“ Eingriffen bedeutet – vor allem von staatlichen Eingriffen.
Reflektierte Sozialistinnen oder sogenannte „sozialliberale“ Denkerinnen (z. B. Sen, Miller) – die nicht der ideologischen Verzerrung erlegen sind, dass es Sozialismus hauptsächlich um soziale Gerechtigkeit oder Gleichheit gehe – haben gegen dieses liberale Mantra argumentiert. Sie behaupten, dass es in Wirklichkeit um „Freiheit zu“ gehe: Echte Freiheit bedeute, die Unterstützung zu bekommen und die Möglichkeiten zu haben, um nach eigenen Vorstellungen handeln zu können, statt nur frei von Einschränkungen zu sein. Diese konzeptionelle Unterscheidung wurde stark von Isaiah Berlins Arbeiten inspiriert.
Diese Unterscheidung selbst ist jedoch künstlich. Wie ich zeigen werde, ist der Unterschied zwischen „Freiheit von“ und „Freiheit zu“ arbiträr. Beide sprachlichen Formen können genutzt werden, um kohärente Versionen des Freiheitsbegriffs zu formulieren. Dies stellt, wie ich weiter unten erklären werde, einen erheblichen Schlag gegen die philosophischen und ökonomischen Grundannahmen des Liberalismus dar.
Historische Genealogie
Der frühe Liberalismus entstand als Herausforderung gegen aristokratische und monarchische Herrschaft. Denker wie John Locke konzentrierten sich auf die Freiheit von staatlicher Übergriffigkeit und argumentierten für bürgerliche Freiheiten, rechtliche Gleichheit und Eigentumsrechte. In Gesellschaften, in denen die Hauptquelle der Unterdrückung von Monarchinnen und Grundbesitzerinnen ausging, ergab diese Argumentation damals Sinn: Die sichtbarste Einschränkung der Freiheit war der aristokratische Staat, der – trotz einiger historisch positiver Funktionen – letztlich eine Gesellschaft war, in der Aristokratinnen und Großgrundbesitzerinnen nahezu alle anderen ausbeuteten.
Doch als sich die Machtverhältnisse in der Gesellschaft zugunsten wirtschaftlicher Eliten verschoben und klar wurde, welche Möglichkeiten zur individuellen Entfaltung durch die technischen Wunderwerke der Industriellen Revolution entstanden, wurde der Kapitalismus zur neuen Form der Zwangsherrschaft. Gegen diese Form der Unterdrückung formierte sich der Sozialismus. Nicht nur die Freiheit von negativem staatlichem Zwang wurde relevant, sondern auch die Freiheit von kapitalistischer Wirtschaftsorganisation.
Wenn wir großzügig sind, könnten wir argumentieren, dass frühe Liberale den Zwang jenseits des Staates schlicht übersehen haben, da sie in einer Zeit lebten, in der die Hauptmacht in der Gesellschaft beim Staat lag und dieser oft ausbeuterisch agierte. Doch daraus folgt nicht, dass „Freiheit von“ nur auf den Staat beschränkt werden sollte oder dass sie per se auf den Staat anzuwenden ist – denn offensichtlich können Staaten sowohl in den Händen der Bevölkerung als auch in den Händen von Eliten sein. Staaten können eine unverzichtbare ermöglichende Rolle spielen oder eine ausbeuterische und tyrannische.
Künstliche Trennungen
Zurück zu meinem Argument, dass „Freiheit zu“ mit „Freiheit von“ zusammenfällt – und umgekehrt: Liberale bringen gern Beispiele wie: Ich bin nicht frei, wenn ich nicht frei von staatlichen Vorschriften bin, um mein eigenes Unternehmen zu gründen. Sozialistinnen könnten entgegnen, dass das zutreffen mag, es aber mindestens ebenso gültig sei zu sagen: Ohne eine gesetzliche Krankenversicherung bin ich nicht frei, ein sorgloses Leben zu führen. Ohne eine öffentliche Bildung bin ich nicht frei, meine Fähigkeiten zu entfalten.
Auch wenn das wahr ist, ist die Unterscheidung künstlich. Liberale könnten ebenso argumentieren: Ich bin nicht frei, wenn ich aufgrund staatlicher Vorschriften kein Unternehmen gründen kann. Und Sozialistinnen könnten ebenso sagen: Ohne eine gesetzliche Krankenversicherung bin ich nicht frei von Krankheit. Ohne öffentliche Bildung bin ich nicht frei von Unwissenheit.
Der Unterschied besteht lediglich in sprachlicher Konvention und arbiträrer grammatikalischer Form. Die pragmatische Bedeutung bleibt in beiden Fällen dieselbe.
Willkürliche Reduktionen
Nachdem wir die logische Struktur des Freiheitsbegriffs untersucht haben, wird klar, dass es keinen relevanten Unterschied zwischen „Freiheit von“ und „Freiheit zu“ gibt. Entscheidend ist nur, welche konkreten Beschränkungen die Handlungsmöglichkeiten von Menschen einschränken.
Daraus folgt, dass die neoliberale Reduktion von „Freiheit von“ auf staatliche Eingriffe willkürlich ist. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass staatliches Handeln per se problematisch statt hilfreich ist, und es ist ebenso wenig ersichtlich, warum das Konzept der Freiheit an der Grenze staatlichen Handelns enden sollte.
Wir können dies mit einem Beispiel verdeutlichen, das Liberale besonders schätzen: die Gründung eines Unternehmens. Nehmen wir an, ich werde in eine Arbeiterinnenfamilie hineingeboren, habe aber den Ehrgeiz, eine eigene Autofirma zu gründen. Es gibt zahlreiche Faktoren, die mich davon abhalten. In gewissem Sinne bin ich also nicht frei, mein eigenes Automobilunternehmen zu gründen, da ich nicht frei bin von der Dominanz großer Konzerne, die von Skaleneffekten, internen Einsparungen, einer besser entwickelten Lieferkette, Kapital, einer Marketingabteilung, First-Mover-Vorteilen und vielem mehr profitieren.
Darüber hinaus scheinen Liberale die Vorstellung zu vertreten, dass der Sinn des Lebens darin besteht, ein Unternehmen zu gründen. Doch die meisten Menschen interessiert das kaum. Sie möchten Künstlerinnen, Schriftstellerinnen, Aktivistinnen, Wissenschaftlerinnen oder etwas anderes werden. Doch sie sind nicht frei von den wirtschaftlichen Zwängen, die ihnen durch die künstliche Knappheit und Ineffizienz der kapitalistischen Organisation auferlegt werden dies zu tun – genau das zentrale Problem, das Marx in seinen philosophischen Manuskripten thematisiert.
Es ist dieses Fehlen von Freiheit von den Strukturen der kapitalistischen Organisation, das bestimmt, welche Berufe wir ausüben, welche Unternehmen wir gründen können, wie viel Freizeit uns bleibt, ob unsere Tätigkeit als sinnvoll empfunden wird, welches Einkommen und Vermögen wir generieren können und so weiter.
Fazit
Ich hoffe, dass ich mit diesem Artikel zwei Dinge erreicht habe. Erstens habe ich gezeigt, dass die Unterscheidung zwischen „Freiheit von“ und „Freiheit zu“ künstlich ist. Das bedeutet, dass sozialistische Anliegen, die mit „Freiheit zu“ ausgedrückt werden, in „Freiheit von“ formuliert werden können. Und wichtiger noch: „Freiheit von“ kann genutzt werden, um eine umfassendere und kohärentere Freiheitskonzeption zu formulieren. Zweitens habe ich argumentiert, dass die klassische sozialistische Idee von Freiheit in diesem Sinne das vollständigere und kohärentere Freiheitskonzept ist, da es sich nicht nur oder per se auf staatliche Eingriffe beschränkt, sondern auf alle relevanten Formen von Zwang und Einschränkung.
Sozialistinnen – und damit meine ich alle Sozialistinnen, vor allem Sozialdemokratinnen – sollten sich auf Freiheit als politische Botschaft konzentrieren, anstatt auf soziale Gerechtigkeit oder Gleichheit. Letztere Begriffe sind aus verschiedenen Gründen für viele unattraktiv; Freiheit hingegen wird zu Recht von den meisten als wünschenswert angesehen.
Der Artikel ist eine Übersetzung aus dem Englischen. Das Original findest du hier.
Wenn dir dieser Artikel gefallen hat, teile ihn bitte mit Freund*innen oder in den sozialen Medien.
Wenn du an meiner Forschung interessiert bist, schaue doch auf alexjeuk.com vorbei.
© 2025 Alexander Jeuk für den Text. Für das Bild siehe die Bildunterschrift.