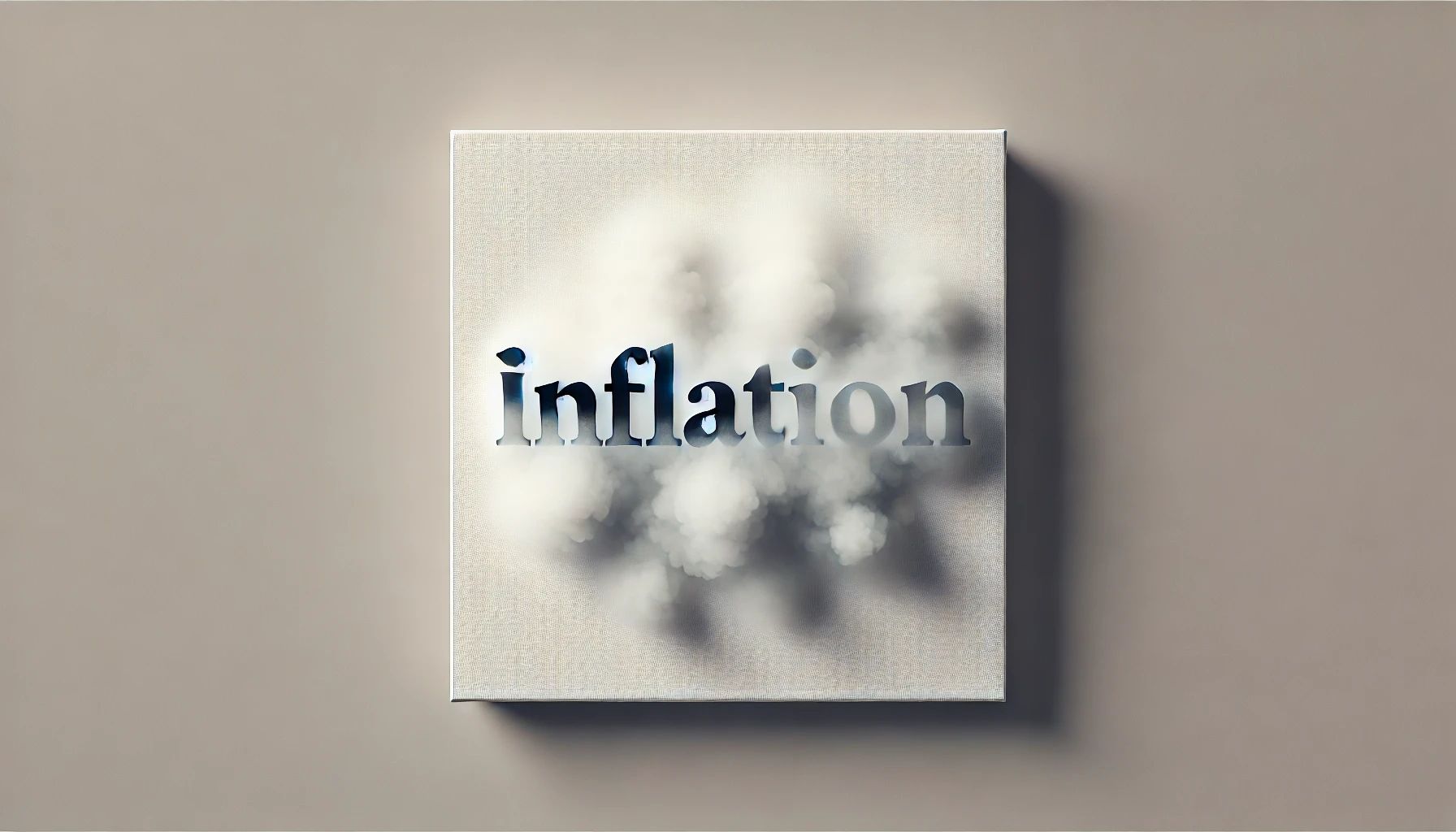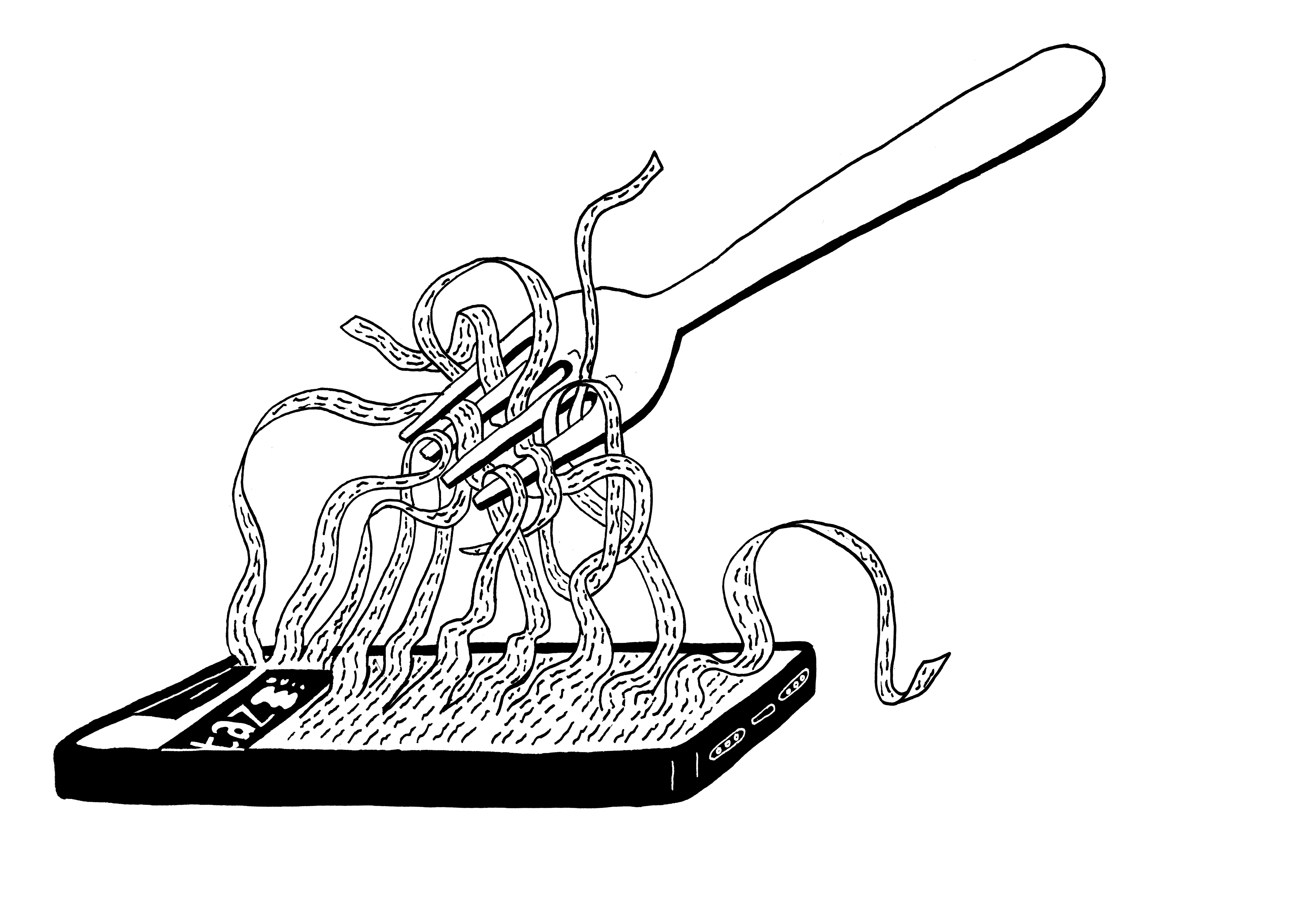„Inflation“ – Wie ein Wort ökonomische Verantwortung verschleiert
Als Philosoph arbeite ich im Bereich des „Genealogical Debunking“. Dabei geht es darum, Worte und Begriffe zu hinterfragen, die wir alltäglich verwenden: Sind sie tatsächlich gerechtfertigt, oder setzen wir sie nur ein, weil sie sich über die Zeit etabliert haben – oft durch den Einfluss von Autoritäten?
Bei meiner Arbeit ist mir kaum ein Wort begegnet, das so problematisch ist wie „Inflation“.
Das Wort „Inflation“ als Verschleierung
Inflation bedeutet Preisanstieg oder Preiserhöhung. Doch selbst sehr gebildete Menschen haben oft Schwierigkeiten, den Begriff klar zu definieren.
Fragt man dagegen nach einem Preisanstieg, dessen Folgen oder möglichen Gegenmaßnahmen, fallen den meisten Menschen sofort Antworten ein – ob diese korrekt sind, sei dahingestellt. Doch zumindest ist klar, worüber man spricht.
Wie so viele Begriffe, die Ökonominnen verwenden, verschleiert „Inflation“ Einfachheit, wo Komplexität suggeriert wird. Inflation gilt als Fachbegriff der Ökonominnen – Preisanstiege hingegen sind für alle verständlich.
Grammatikalische Verschleierung durch „Inflation“
Die grammatikalische Form von „Inflation“ verschleiert zudem Verantwortung. Während wir sagen können, dass Unternehmen Preise erhöhen oder steigern, macht es grammatikalisch keinen Sinn, zu sagen, dass Unternehmen „Inflation begehen“.
Man hört oft Aussagen wie: „Die Preiserhöhungen durch Unternehmen tragen zur Inflation bei.“ Doch das ist offensichtlich bizarr – es ist nichts anderes als die tautologische Aussage, dass Preiserhöhungen zu Preiserhöhungen führen.
Inflation wird gerne wie ein physikalischer Prozess dargestellt, als wäre sie eine Naturgewalt. Das ist kein Zufall: Wie viele andere ökonomische Begriffe suggeriert „Inflation“, dass wir es mit einem naturwissenschaftlichen System zu tun haben, das menschlichem Eingriff widersteht. Diesen Gedanken wird man kaum teilen, wenn man einfach von Preisanstiegen spricht.
Der Monetarismus und seine Begriffsmanipulation
Das ideologische Verschleierungspotenzial von „Inflation“ kommt nirgends besser zum Vorschein als bei der neoliberalen Revolution – jenem Projekt, getragen von Ökonominnen, Think Tanks, Medien und Politikerinnen, das das sozialdemokratische, keynesianische Wirtschaftssystem der Nachkriegsjahre wieder auf das liberal-kapitalistische Vorkriegssystem umgestellt hat.
Das vielleicht einflussreichste „intellektuelle“ Argument für diesen ökonomischen Geschichtsrevisionismus ist Milton Friedmans Monetarismus. Friedman argumentierte, dass die sogenannte „Stagflationskrise“ der 1970er – also steigende Inflation kombiniert mit schwachem Wirtschaftswachstum – durch sozialdemokratische Geld- und Wirtschaftspolitik verursacht wurde. Die großen Geldmengen, die Regierungen einsetzten, um die durch den Ölpreisschock (1973/1979) ausgelösten Krisen zu überwinden, seien für die hohe Inflation verantwortlich gewesen.
Friedmans Urteil: “Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon.” (Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen.)
„Monetär“ ist ein weiteres Wort, mit dem Ökonominnen die Einfachheit (und Falschheit) ihrer Aussagen verschleiern. Essenziell bezeichnet „monetär“ alles, was sich auf Geld, Geldpolitik oder die Steuerung der Geldmenge durch Staaten oder Zentralbanken bezieht.
Damit meint Friedman also: Jeder Preisanstieg ist immer und überall auf Geldpolitik zurückzuführen. Wenn wir „Inflation“ durch „Preisanstieg“ ersetzen, wird die Absurdität dieses neoliberalen Dogmas sofort deutlich: Preisanstieg ist immer und überall auf Geldpolitik durch Staaten und Zentralbanken zurückzuführen.
Diese Aussage ist offensichtlich analytisch falsch. Unter einer analytischen Falschaussage versteht man die falsche Nutzung eines Begriffes, dessen Bedeutung eigentlich durch Konvention festgelegt ist. „Preisanstieg“ bedeutet eben Erhöhung von Preisen. Jeder Mensch kann jederzeit den Preis eines Produktes oder einer Dienstleistung erhöhen. In der Tat ist das die gängigste Form von Preiserhöhung – und die Ölkrise von 1973 ist das beste Beispiel.
Die OPEC erhöhte bewusst den Preis von Öl, um den Westen für seine Unterstützung Israels im Jom-Kippur-Krieg zu bestrafen. Das ist wortwörtlich ein Preisanstieg – eine Preiskrise. Aber genau diesen Zusammenhang verschleiert der Begriff „Inflation“. Das soll nicht heißen, dass Geldpolitik nicht zu Preiserhöhungen führen kann. Aber Geldpolitik ist nur eine von vielen möglichen Ursachen – und keine notwendige.
Das Einzige, was Friedman mit seinem Ansatz verhindern wollte, ist, dass Staaten ökonomisch gestaltend werden (oder bleiben), wofür sie natürlich Geld in die Hand nehmen müssen. Mit Preiserhöhungen hat das per se nichts zu tun. Doch genau das wird schwerer zu verstehen, wenn wir von Inflation reden.
Demokratische Ökonomie ohne Wortklauberei
Ökonomie ist das zentrale Fundament gesellschaftlichen Wohlstands und politischer Gestaltung. Einer der Gründe, warum wirtschaftspolitische Fragen jedoch so wenig öffentliche Debatte erzeugen, liegt in der Vorstellung, dass Ökonomie eine hochkomplexe Wissenschaft sei, die nur Expertinnen verstehen. Natürlich gibt es wirtschaftliche Zusammenhänge, die tiefgehende Analysen erfordern – aber viele auch nicht.
Die sogenannte „Cost of Living Crisis“ (Lebenshaltungskostenkrise), die spätestens mit der Covid-Pandemie begann, ist das beste Beispiel. Spricht man von Preiserhöhungen statt von „Inflation“, wird sofort klarer, dass es sich um eine Kostenkrise handelt, die nicht selten durch Unternehmensentscheidungen ausgelöst wird. Und genau das macht Verantwortlichkeiten sichtbar und Gegenmaßnahmen transparent.
In genau diesem Sinne setzt eine demokratische Debatte über Wirtschaft voraus, dass wir ökonomische Begriffe klar und allgemeinverständlich nutzen.
Wenn dir dieser Artikel gefallen hat, teile ihn bitte mit Freund*innen oder in den sozialen Medien.
Wenn du an meiner Forschung interessiert bist, schaue doch auf alexjeuk.com vorbei.
© 2025 Alexander Jeuk für den Text. Für das Bild siehe die Bildunterschrift.