Wie kann scheinbar Unaussprechliches doch sagbar gemacht werden? Wie findet man als junger schwuler Jude seinen Weg ins Erwachsensein? Und was haben Holocaust und Aids-Epedemie gemeinsam? Eric Steel skizziert in seinem eleganten und fast kontemplativen MINJAN einige Antworten. Im Februar 2021 läuft MINJAN im Streaming-Programm der Queer Film Nacht der Edition Salzgeber. Alle Details dazu auf queerfilmnacht.de. Dieser Text basiert auf Notizen während der Sichtung des Films auf der Berlinale 2020 und einer erneuten Sichtung im Homeoffice im Februar 2021.
„Ist er ein guter Jeschiwa-Schüler?“ – „Er ist ein guter Mensch.“
Es braucht zehn Juden, um einen Minjan zu bilden. Ohne Minjan kein Gottesdienst. Der Minjan ist eine Art heiliges Mindestmaß an Betenden. Eine uralte Regel aus einer uralten Schrift, der Tora.


David ist ein Teenager, gerade noch so, das Erwachsensein scheint nicht mehr fern. Er lebt mit seinen Eltern in Brighton Beach. Ein Stadtteil mit der Metropole New York im Rücken, der lärmenden Hochbahn mittendurch und dem Atlantikstrand nach vorne raus. Ein urbanes Paradies. Zeitlos fotogen, die magische Aura New Yorks mühelos und in einem Maße auf die Leinwand transportierend, wie es das glatt gentrifizierte Manhattan schon lange nicht mehr vermag. Erst recht, wenn die filmische Erzählung an der Zeit dreht und uns in eine längst vergangene Epoche transportiert: New York, 1986/87.
David lernt die Bedeutung des Minjan in der Jeschiwa, der jüdischen Religionsschule in seinem Viertel. Doch statt die Tora zu studieren, ist er eher damit beschäftigt, seinen Klassenkameraden anzuhimmeln. Ausgerechnet dort.
In den Augen von Davids Mutter ist die Jeschiwa ein Safe Space für ihren jüdischen Sohn, denn dort kann er als Jude nicht dafür verprügelt werden, dass er Jude ist. Ja, als Jude mag man in der Jeschiwa tatsächlich sicher sein – doch als Schwuchtel nicht so sehr. Brighton Beach.

Diese Zeit, 1986/87, zwar schon fast Ende der 80er, aber doch noch in sicherer Entfernung zum Epochenwechsel 89/90, spiegelt Filmemacher Eric Steel in seinem Spielfilmdebüt MINJAN in vielerlei Hinsicht. Da wäre besagter David, der erste Sohn jüdischer Emigrant:innen, die, wie so viele andere Juden auch, in den 1970ern aus der Sowjetunion nach Brighton Beach kamen.
Da wäre der Autor James Baldwin, der am 1. Dezember 1987 verstarb und dessen Bücher hier einen wichtigen Platz einnehmen. Wie überhaupt Bücher in MINJAN eine Art Hauptrolle haben, allen voran die Tora.
Nicht zuletzt markiert diese Zeit die Hochphase der AIDS-Epidemie – mit New York als Epizentrum einer Katastrophe, die ganze Generationen schwuler Männer auslöschte. David steht für eine neue Generation. Eine neue Generation schwuler Männer, aber vor allem: Juden. Juden, die fernab jener mit den Schrecken des Holocaust gefüllten Orte Osteuropas aufwachsen. Und die doch für das allgegenwärtige Klammern der vorherigen Generationen an den Traditionen des Glaubens und den Erinnerungen an Heimat und Holocaust einen Umgang finden müssen. Erwachsenwerden als schier unlösbare Aufgabe.

Was ist dieser Film? Coming-Out-Film? Drama? Dramödie? Milieustudie? Kammerspiel? Gängige Genrezuschreibungen, die ja immer auch eine Marktkonformität implizieren, lassen sich nur schwer vornehmen. Und von den vermarktungsfreundlichen 90 Minuten ist MINJAN mit 118 Minuten Laufzeit auch eher weit weg. Die formale Uneindeutigkeit des Werks korrespondiert mit den uneindeutigen Herumtasten von David, der Hauptfigur. Wohin will er in seinem Leben, wohin in seinem Glauben und was soll er mit seinem Begehren anstellen?
Doch zunächst beginnt alles mit dem Tod. Die erste Sequenz zeigt uns eine eher schmucklose Trauerzeremonie in einer genauso schmucklosen Wohnung. Hässlicher Teppich, hässliche Couch, hässliche Tapete. Davor die Trauergemeinde in Schwarz und auf Socken.
Davids Großmutter ist verstorben, die hinterbliebenen Familienmitglieder stehen zusammen. Der Großvater, Josef, spricht das Kaddisch, das jüdische Totengebet. Kaum ist er verstummt, löst sich die Gruppe auch schon auf. Davids Mutter stürzt sich unverhohlen auf Papiere. Die Wohnung ist zu teuer murrt sie, Josefs Rente allein reicht nicht für die Miete. „Hör nicht auf sie“, versucht David seinem Großvater beizustehen. „Ich hab schon vor langer Zeit aufgehört, auf sie zu hören“, entgegnet der lapidar.

Wir merken schnell, Großvater und Enkel sind sich eng verbunden, was insbesondere durch die faszinierende Performance von Samuel H. Levine (David) und Ron Rifkin (Josef) vermittelt wird. Es braucht auch nicht lange, um zu lernen, weshalb die Verbindungen zur Generation dazwischen, zu Davids Eltern, schwierig sind. Auswanderer wie sie haben in einer neuen Heimat eigene Kämpfe auszufechten, denn oft lassen sie in der alten Heimat mehr zurück als geplant. Wenig verwunderlich also, dass David Konflikte mitunter versucht durch Wodka zu beruhigen. Wodka, der zwischenmenschliche Schmierstoff für jede Gelegenheit. Klappt, nicht immer.
Dass Josef den umkämpften Platz in einem jüdischen Altersruhesitz ergattert, hat nichts mit Hochprozentigem zu tun. Josef und David erfüllen zusammen schlicht jenes Quorum, damit der Leiter und Rabbi des Seniorenheims Gottesdienste zum Schabbat anbieten und damit die Erwartungen seiner Bewohner:innen befriedigen kann. Geben und Nehmen.
Für David wird die Seniorenresidenz indes zum Fluchtpunkt. Hier bei seinem Großvater scheint für ihn eine Geborgenheit vorhanden zu sein, die Zuhause fehlt. Zuhause wartet nur seine überfürsorgliche Mutter – eine verhinderte Zahnärztin, die nicht sehen will, dass ihr Mann, der Ex-Boxer, heimlich andere Frauen vögelt.

Dabei könnte das Altersheim, dieser bizarre Mikrokosmos voller lebender aber deshalb nicht unbedingt ausgesprochener Erinnerungen an Krieg und Holocaust, für junge Typen wie David kaum unvorstellbarer sein. Aber David tickt anders als seine Altersgenossen. Seltsam abgekoppelt scheint er von seiner eigenen Generation, von Klassenkameraden, die sich Abends in ersten körperlichen Annäherungen ans andere Geschlecht probieren. David beobachtet es und wir spüren, wie wenig das alles mit ihm zu tun hat und wie sehr ihn selbst das zu einem rast- und ratlos Suchenden werden lässt.
Nur, was ist das Ziel dieser Suche? Lässt sich das überhaupt formulieren? Und wenn ja, lässt es sich auch aussprechen? Manche Dinge bleiben an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit vielleicht einfach unsagbar. So wie die Beziehung, die die freundlichen Nachbarn von Davids Großvater pflegen: Itzik und Herschel. Alle im Heim sagen, es sind nur zwei alte Witwer die sich eine Wohnung teilen. Doch mit Zahnbürsten im selben Zahnputzbecher und nur einem Ehebett im Schlafzimmer, wirkt das auf David eher nicht wie eine Wohngemeinschaft. Unausgesprochen erkennen sich hier drei Männer in dem was sie wirklich sind.
MINJAN kann als filmisches Nachdenken über die Dinge gelesen werden, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht gesagt oder nur zwischen den Zeilen formuliert werden können. Eric Steel skizziert mit großer Empathie, wie eine Alltagskultur aussieht, die von schmerzhaften Erinnerungen, von Tabus, Traumata und unheilbaren Narben dominiert ist. Wo Menschen allenthalben versuchen, mit dem Unbegreiflichen des Holocuast irgendwie zu leben. Eine Katastrophe, die sie nur durch genauso unbegreifliche Fügungen des Schicksals überlebt haben, während ihre Familien ermordet wurden.

Eric Steel versteht es dabei sehr klug, die großen Gesten zu vermeiden. Es sind die kleinen Details, die in diesem zuweilen hypnotischen Film ganze Welten zeichnen. Jede Figur hat eine eigene Geschichte, oft nur durch eine Nuance angetippt und doch in vielerlei Hinsicht tiefgreifend. Der bis in die Nebenrollen hinein herausragende Cast leistet seinen Teil, damit diese Geschichten nachhaltig in Erinnerung bleiben. MINJAN als großes und elegantes Schauspieler-Kino schafft, was nur wenige Filme fertig bringen – der Streifen verlässt einen nicht. Monate, oder, wie im Fall des Autors dieses Textes, fast ein Jahr später, sind die Bilder, die Gesichter, die Storys dahinter noch immer im Kopf. Ein Film wie ein Gefährte.
Wo Worte nicht taugen, dringen andere Kommunikationsformen nach vorne. In MINJAN erzählen uns die Augen was los ist. Wir sehen Blicke, mal abschätzend, mal prüfend, mal nach Sicherheit tastend, manchmal auch einfach nur den Versuch einer Selbstvergewisserung unternehmend – mit ungewissem Ausgang. Häufig blicken die Augen in Spiegel, manchmal auf die halb entblößte Hüfte eines jungen Männerkörpers oder einen nackten Po auf der Couch.
Manchmal blicken die Augen ins nur scheinbar Leere. In diesen stillen Momenten tastet sich die Kamera sachte an die Gesichter heran, versucht das Unaussprechliche doch irgendwie verständlich zu machen. Versucht in den Menschen zu lesen; Menschen wie Bücher.
Es gibt in diesem Film eine nicht zufällige Irritation. Eric Steel hat seine Erzählung auf einer Kurzgeschichte des kanadischen Autors David Bezmozgis aufgebaut – dort ist diese Irritation bereits angelegt – und mit seinen eigenen Lebenserfahrungen als junger schwuler Jude im New York der 80er angereichert. Es geht um die emotionalen Erfahrungen von Holocaust-Überlebenden und Überlebenden der AIDS-Epedemie. Eric Steel (und David Bezmozgis) erkennen hierin eine Ähnlichkeit.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Es geht nicht um eine Gleichsetzung. Weder im Subtext des Films noch in diesem Text. Es gibt zum Holocaust keine Entsprechung, jeder Vergleich verbietet sich.
Und doch plädiert Eric Steel dafür, dass die Verheerungen, die zigfaches und willkürliches Sterben in den Seelen jener anrichtet, die zurückbleiben, eine unleugbare Wesensverwandtschaft aufweisen. Nicht zuletzt in der Weise, wie die Überlebenden versuchen, einen Umgang mit den Erinnerungen zu finden. Ein streitbarer Standpunkt? Vielleicht. Doch darüber zu streiten ist zweifelsohne legitim.
An einer Stelle in MINJAN wird David von Bruno, Davids erstem und viel älteren Lover, wütend gefragt, ob er denn überhaupt nichts wüsste. David hatte darauf insistiert zu erfahren, was die Namensliste in Brunos Küche bedeutet. Und nein, von AIDS weiß dieser David nichts – noch nicht.
Dafür weiß er um andere Schrecknisse, überschatten sie sein Leben doch seit seiner Geburt. Aber er weißund wir wissen es am Ende dieses faszinierenden und leisen Films ebenso, wie wenig es bringt zu schweigen. Und wie wichtig es ist, sich offen auszutauschen und ehrlich für den eigenen Standpunkt einzustehen.
Ein Coming-Out-Film ist MINJAN nicht. Zum Glück. Es ist ein Plädoyer für die Macht der Empathie.

MINJAN | USA 2020 | Eric Steel | 118 Min | Berlinale 2020, Panorama
Eine komprimierte Version dieses Textes ist am 01. Februar 2021 in der Sissy erschienen.



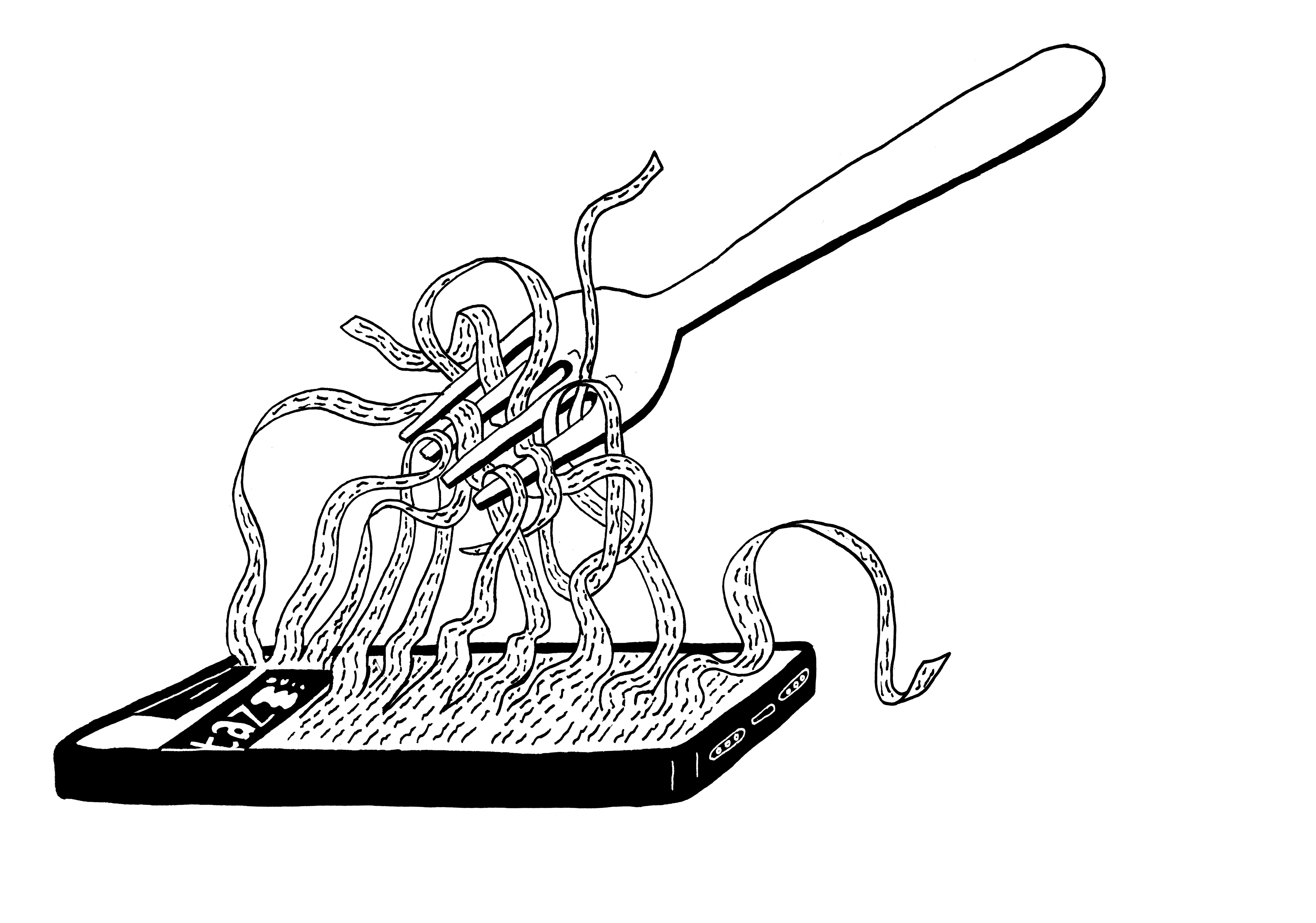
Danke für die Anregung!