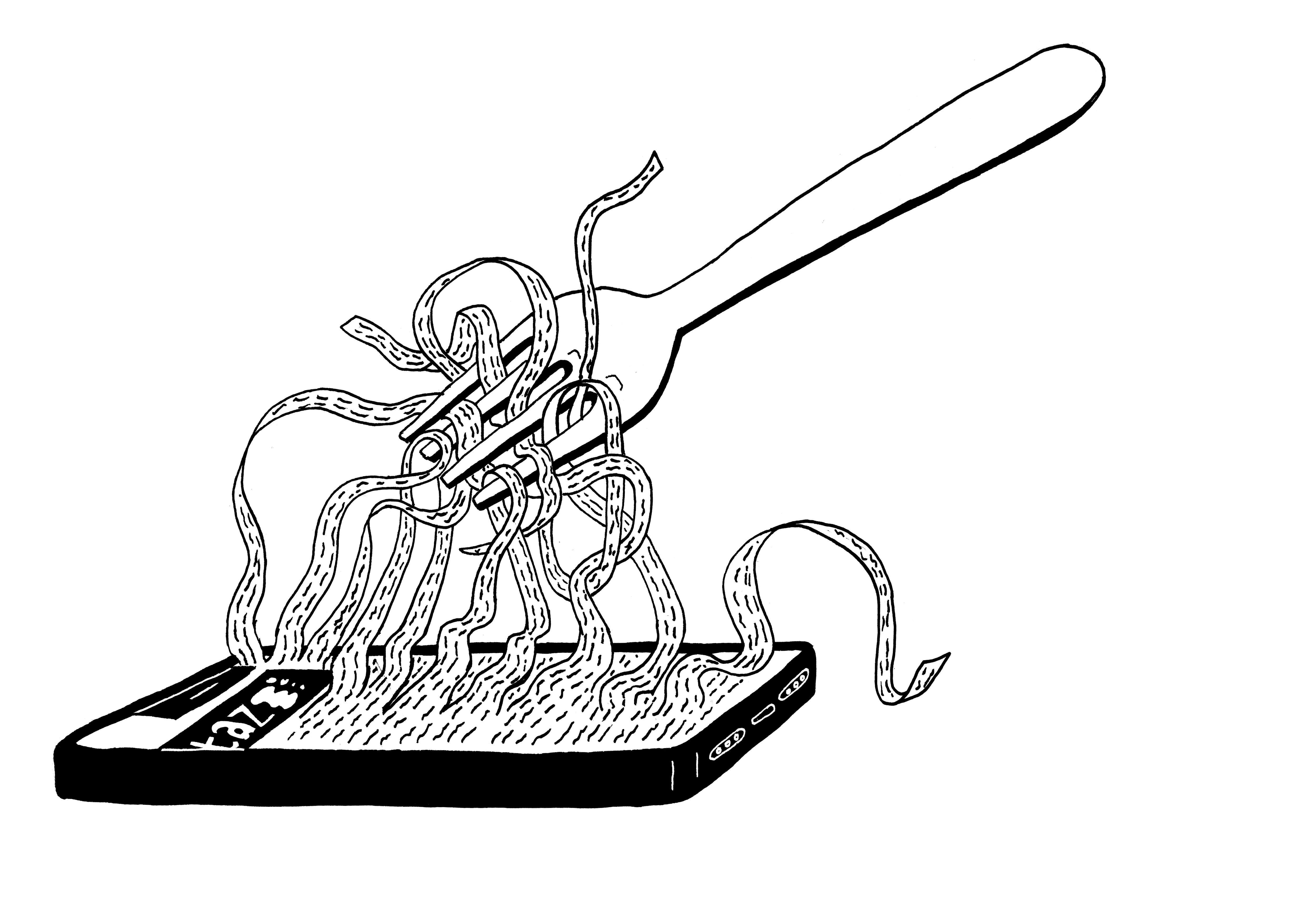(Bevor es in diesem Text dionysisch wird: Gegenwärtig recherchiere ich über die neuen Chancen des Widerstands gegen den Tourismuswahn und die verführerischen Visionen für Venedig. Der Beitrag wird am 13. Juni hier erscheinen, kurz vor dem längsten Banner in der Geschichte dieser geprügelten Stadt.)
Aber nun:
Jacopo, Luca, Manuel, und dann, jessas, Andrea, Pietro und Gloria. So heißen die Menschen, die ich in diesen Tagen kennenlerne und kaum je vergessen werde. Im Wortsinn verkörpern sie ein junges, fröhliches, bisweilen freches neues Seelenstück von Venedig. Alle arbeiten im Tourismus.
Echt jetzt? In dieser absaufenden Stadt soll es nicht nur Nepp auf Schritt und Tritt geben – und nicht bloß Qualitätsservice lediglich für (Neu)Reiche? Ja. Zumindest derzeit und hoffentlich noch lange.
Der Antrieb, hierher zu kommen, entstand aus einer belastenden persönlichen Fehlentscheidung. Monatelang hatte ich abgewogen, ob ich mich von der Wohnung meiner verstorbenen Mutter am Bodensee trennen sollte. Kaum war es geschehen, bereute ich es. Als melancholischer, vergangenheitskonzentrierter und vor allem blicksüchtiger Österreicher drängte sich die Flucht auf, ab in die Serenissima. Auch sie ist ja für uns verloren, seit 1866, also seit kurzem. Damals schlitterten die Habsburger in eine Niederlagenserie. Und Leopold von Sacher-Masoch ist ja auch mein Landsmann.
Die morbide Schönheit der Lagunenstadt lädt ein, sich im Selbstmitleid zu suhlen. Meinen Mitösterreichern werden bis zum 16. Juni Italienreisen bei der Rückkehr mit einer 14-tägigen Quarantäne vermiest. Das mögen sich wenige antun, schon gar nicht bequeme Hauptstädter. So lockte mich zusätzlich die Chance auf gepflegten Weltschmerz ohne übermächtige Wiener Konkurrenz. Was für eine exklusive Aussicht.
 Pech gehabt. Zwar war ich im Zug nach Venedig am vergangenen Freitag wohl der einzige Nichtitaliener, doch das erste Touristenpaar im Vaporetto lässt sich nicht verkennen. Sie sind zum ersten Mal hier. Ihre Eindrücke: „Also mir ham gleich nasse Füße gekriegt“, sagt die Frau, um die 60 wie ich. „Aber es isch nett und ned so dunkel wie in die Krimis im Fernsehen.“ Schwaben? Die geradezu entrüstete Antwort: „A nei, aus Donaueschingen. Baden!“ Für Detailunkundige ist der Unterschied so groß wie zwischen Ulmern und Neu-Ulmern, also denen um Ulm herum. Letztere sind schon Bayern.
Pech gehabt. Zwar war ich im Zug nach Venedig am vergangenen Freitag wohl der einzige Nichtitaliener, doch das erste Touristenpaar im Vaporetto lässt sich nicht verkennen. Sie sind zum ersten Mal hier. Ihre Eindrücke: „Also mir ham gleich nasse Füße gekriegt“, sagt die Frau, um die 60 wie ich. „Aber es isch nett und ned so dunkel wie in die Krimis im Fernsehen.“ Schwaben? Die geradezu entrüstete Antwort: „A nei, aus Donaueschingen. Baden!“ Für Detailunkundige ist der Unterschied so groß wie zwischen Ulmern und Neu-Ulmern, also denen um Ulm herum. Letztere sind schon Bayern.
Wie noch nie zieht es mich auf den Markusplatz. Da sind zu Mittag Aufnahmen möglich, die zweifeln lassen, ob es zum Zeitpunkt ihres Entstehens bereits Farbphotographie gab. Der gerühmte Salon Europas glänzt ohne Menschen aus der Fremde. Fast.

Die wenigen anderen sind dieselben. Aus der Tiefe des Platzes stößt das Paar von der Donauquelle auf mich zu und setzt sich im Café „Quadri“ selbstbewußt an einen der beiden Tische auf dem Podium, das ansonsten Musikern vorbehalten ist. „Jetzt schicken wir ein Neidfoto“, sagt sie, und er meint: „Da trinken wir jetzt was, egal, was es koschtet“. Wir kommen ins Gespräch, es sind weitgereiste, interessierte Leute, aber in ihrem Kulturkreis gefangen. Sie erfragen Tipps, doch verabschieden sich mit dem Satz: „Wenn wir uns das dritte Mal sehen, koscht des a Bier. Und wenn wir es selber zahlen müssen.“
Sorry, liebe Lebensfreunde aus Schwaben und auch Baden: Das Heimtückische an Klischees ist, dass sie oft zutreffen. Das gilt folgerichtig auch für uns Österreicher. Siehe oben.
Doch Venedig? „Da habe ich in meinem Leben nur gehungert, weil das Essen so schlecht war. Touristenscheiß“, meint eine befreundete Berliner Verlegerin am Telefon, als ich ihr meinen Aufenthaltsort nenne. „Und kaum junge Leute.“ Zwei Klischees, aber neuerdings beide falsch. You will see.
Nach meiner fast perfekten Zeitreise in die vortouristische Zeit am Markusplatz steuere ich die „Pensione Wildner“ an. Sie verankerte sich bei meinem ersten Besuch vor 39 Jahren im Gedächtnis, mit ihren bescheidenen Zimmern, aber dem grandiosen Blick bis zum Lido. Es ist das „Danieli“ für Arme, keine 100 Meter von diesem weltberühmten Luxushotel entfernt. Das „Wildner“ ist aber ebenso geschlossen wie noch fast alle anderen Hotels in dieser verwunschenen Zeit.
Neben dem „Danieli“ dann doch eine offene Tür: ins „Savoia & Jolanda“. An der Rezeption begrüßt mich Jacopo Derai als erster „Walk-in“, als erster Gast, der nach der Corona-Sperre einfach eintritt. Das Zimmer mit dem Himmelbett und Lagunenblick bietet er mir zu einem Bruchteil des üblichen Preises an. Jacopo, erzählt er später, ist selbst der Hotelmanager, Personal lohnt sich derzeit noch kaum. Jung ist er auch, und aufgeschlossen. Gleich rennt der Schmäh (zu Deutsch: es ist entspannt lustig). Und dies, obwohl er sich als Fan des AC Milan outet. Impossibile.


Am Abend öffnet sich doch noch das „Wildner“. Der Sohn des Hauses, Luca, hat dorthin sein ansonsten etwas abgelegenes Weinrestaurant „Local“ als Pop-up verlegt. Sommelier Manuel kam erst kürzlich nach Jahren in London zurück. Die Weine sind weit weg von den üblichen Industrieitalienern, das Essen auch.


Am nächsten Mittag bin ich schon im „CoVino“. Winzerfreund Martin Gojer aus Bozen hat es mir empfohlen und dem Wirten Andrea mich. Auf der Weinkarte fällt es schwer, eine Flasche auszulassen. Und das Essen kann mit vielen Sternelokalen mithalten, doch das Überraschungsmenü mit vier Gängen kostet lediglich 42 Euro. In Nicht-Corona-Zeiten ist das Lokal beständig ausgebucht. Verständlich: Da willst du nicht mehr weg.
So treffen wir uns am Abend darauf gleich wieder. Um elf zieht Andrea die Rollläden herunter, Koch Pietro und seine Kollegin Gloria bleiben auch. Wir trinken und tanzen, tanzen und trinken, nicht nur.


Vor drei Uhr will niemand weg. Zum Glockenschlag stehe ich wieder neben dem Campanile am Markusplatz. Allein.

Bis Nachtfalter die Schönheit mit mir teilen.



Unfreiwillig kundenfrei schließt das „Savoia & Jolanda“ am Montag wieder. Wohin mit mir? Jacopo und auch Luca vom „Wildner“ bieten eine Lösung an. Als „Hausmeister ohne Dienstauftrag“ könne ich doch in ihrem jeweiligen Hotel bleiben. Die Fenster zur Lagune dürfe ich aber nur noch zum Fotografieren öffnen. Daran halte ich mich. Im Vorbeigehen klopfe ich an der verriegelten Metalltüre des „Danieli“. Ob da vielleicht bald einmal in der Lounge wieder Kaffee serviert würde? „Non abbiamo una data“, wir haben dafür noch kein Datum, antwortet ein Bursch entschuldigend durch das viereckige Guckloch. Zero tourism statt Overtourism.
Auf dem Weg durch die verlassene Stadt leert sich der Akku meines Telefons. Im „Art Cafe“ am Campo Santo Maria Nova kann ich ihn aufladen und bestelle pflichtbewußt ein Glas Schaumwein.

Der Wirt, Andrea, lädt mich darauf ein. Seine Frau ist so herzlich wie viele Wirtinnen in meinem Geburtsbundesland zusammengenommen nicht. Ich beginne, mich zu genieren.

Bis vor kurzem galten selbst für Ortsansässige strenge Ausgangsregeln. Für Jacopo ist das Corona-Virus „eine weitere Art, um Menschen arm zu machen“. Mit den ersten Lockerungen gehörte Venedig jedoch nur den Venezianern, ein historisch einmaliges Ereignis in dieser Handelsstadt. Der Hotelmanager nutzte die einmalige Gelegenheit, um Paolo Veroneses „Das Gastmahl im Hause des Levi“ in der Gallerie dell’Accademia zu bestaunen. „Es hängt ums Eck, doch ich war nie da.“ Ein Schicksal, das viele Städter auf allen Kontinenten miteinander teilen. Die Besucher kommen, um Berühmtes zu sehen, die Bewohner meiden die Museen, um den Touristenmassen fernzubleiben. Auch eine Form der Enteignung. Oder der Umverteilung von Kulturgut, je nachdem.
Schritt für Schritt belebt sich seit Beginn der Woche die Stadt wieder, vor allem durch Italiener aus dem Umland. Gut so. Auch ein fremdenfreies Venedig ist ein totes Venedig. In den vergangenen Tagen wurden im gesamten Veneto mit seinen knapp fünf Millionen Einwohnern nur eine Handvoll neue Corona-Infektionen gezählt. Bei der allerorts vorherrschenden Geschichtsvergessenheit wird übersehen, dass Venedig im Lauf der Jahrhunderte knapp zwei Dutzend Mal von der Pest heimgesucht wurde und dagegen Zug um Zug ein weitgehend seuchenresistentes Gesundheitswesen aufbaute.
Der Flughafen Marco Polo wird am kommenden Wochenende wiedereröffnet. Auch Österreichs nationalchauvinistischer Kanzler steht kurz vor der Öffnung der Grenzen nach Süden.
Hinter der Seufzerbrücke trinken gästelose Gondolieri am Dienstagmorgen stilvoll eine Flasche soliden Prosecco zu ihren Brötchen. Ein Foto? Kein Problem, aber hoffentlich kommen bald wieder Touristen. Bitte, aber auch nicht wieder zu viele. Bitte.

Auf der Suche nach einem Waschsalon für die Hemden des Hausmeisters ohne Dienstauftrag stoße ich auf dem Campo Santo Maria Formosa auf eine Versammlung von mehr als 100 Venezianern. Sie engagieren sich für eine Lagunenstadt mit einer visionären Zukunft. Darüber übermorgen in meinem Blog. Ein „New Game“ statt „Game Over“?