Von Sabine Mohamed
Die letzte Workshopeinheit im Konferenzraum der taz fand am vergangenen Sonntag statt – eine Rückschau:
Kritik gibt’s Gratis. Kritik sollte kein Problem sein. Bei uns schien es auch so. Vielleicht weil die Zeit ihr übriges tat. Denn vor der Kritik war kaum Raum für Gedankenausuferungen einer wie auch immer gearteten Kritik am Baby. Die Texte mussten produziert werden. Das Zeitkorsett ziemlich eng geschnürt. Das mag kritisch klingen. War es auch. Immerhin: alle Texte waren redigiert und eingespeist in die Maske. Aber die Hände von taz.de Redakteurin Franziska Seyboldt erreichten sie kurz vor knapp. Eigentlich kein Problem, wenn Ihre Aufgabe nicht die der Seiten- und Textkritik gewesen wäre.
Trotzdem sitzen wir mit erwartungsvollen Augenpaaren auf den Stühlen. Wer weiß, vielleicht sitzt auch die Kritik. Auf dem Tisch unserer Kritikerin stapeln sich zehn von ungefähr 20 Texten. Der Rest vermutlich im Laufwerk A,B,C,D, et cetera der taz-Rechner. Mehr ging leider nicht, sagt sie. Einen Blick auf unsere Seite, die als Beilage in der Montagsausgabe erscheinen soll, hat sie geworfen. Geworfen, weil es Verzug mit der Produktion gab. Ausgerechnet heute: Probleme mit dem Provider und andere technische Komplikationen, die ich selbst nicht verstand. Ein wenig verflixt war das schon. Franziska sagt zur Seite: „Optisch ganz gut“.
Kritik austeilen geht gut. Kritik bekommen geht auch. Mit Kritik umgehen? Das hängt dann doch wieder von einem Selbst und an der Form der Kritik ab. Die Kritik, um die es hier gehen soll, das war zumindest mein Gedanke, richtet sich an uns, die Teilnehmenden. Aber es kommt anders. Vorerst.
Eine der ersten Fragen, machte sich das Thema zum Thema. Warum denn „Internet-Hauptstadt Berlin“ gewählt wurde, fragt die Kritikerin, blickt in unsere Runde. Damit fragt sie nach der Urheberschaft des Themas. Einer von den Mitverantwortlichen sitzt direkt neben ihr, taz.de Chef Matthias Urbach. Er erklärt knapp die Genese. Ok. Andersrum. „Wart ihr denn mit dem Thema zufrieden? Sagt einfach mal“, schlägt sie vor.
Die meisten von uns, ich eingeschlossen, mussten sich erst einmal durchs Netz googlen, um das Thema zu verstehen. Und wie bereits im Editorial unserer Seite festgestellt wurde: Hier twittert niemand. Nur wenige im Besitz eines Smart Phone. Nicht wirklich repräsentativ, oder etwa doch?
Das vorgegebene Thema am ersten Tag des Workshops zu ändern, die Wahl, wir hatten sie. Vor Ort lockte die Aussicht das Thema tatsächlich zu ändern, vor allem sich auf ein neues zu einigen, nicht sonderlich. Also abgelehnt. Alles bleibt wie es ist. Wir wollten einfach loslegen. Das mit dem „einfach“, das steht auf einem anderen Blatt. Berlin, eine Internet-Hauptstadt? Sagt wer? Berechtigte Fragen, wir hätten sie stellen sollen. Taten wir. Wir haben einen Film (Knotenpunkt; allgemein zum Netz) dazu. Einen kritischen Text etwa im Post-Privacy Kommentar, ihn gab es ja auch. Zugegeben, irgendwie fehlte doch die kritische Auseinandersetzung in verschrifteter Form.
Nächster Punkt: Die Anzahl der Start-ups, die in Form von Bericht und Portraits verfasst wurden. Sie sagt, es waren viele. Stimmt auch. Warum gibt es keinen allgemeinen Text zu den Start-ups, fragt die Kritikerin. Wie viel gibt es davon in Berlin, seit wann, und warum? Das habe ihr schon etwas gefehlt. Wo bleibt eine kritische Perspektive? Auch bei den einzelnen Texten: Warum gibt es eben jenes Start-up? Bei einigen fehle ihr so gar eine tiefreichendere Hintergrundinformation. Was macht das Unternehmen so besonders? Schön, dass es Start-ups gibt, sagt sie. Aber wo, bleibe denn eine Zusammenschau? Das wäre schön gewesen. Was bringt mir das?
Sie sei gestolpert. Gestolpert über den Begriff „Netzgemeinde“, das sei irgendwie pauschal. Die in der print schreiben vielleicht so, aber in der online Redaktion passiere dies nicht so häufig. Was sie denn sagen würde, anstatt „Netzgemeinde“? Sie überlegt: „user“. Und damit ging dann auch ein weiteres Feld auf: moderner Sprachgebrauch. Heißt es ein App/eine App? Das blog/der blog?
Und dann sagt sie: „Mir fehlt die Metaebene.“ Jetzt greift Kritikerin Nr. 2, Elisabeth Schmidt, ein. Sie hat wohl so ziemlich alle Texte von uns gelesen, teilweise mehrmals redigiert. Sie sagt, die Texte seien stilistisch schön, bei jedem war etwas zu entdecken. Was Eigenes, Kreatives, Sprachliches und in den Texten, die es sich nicht zum Thema machten, fanden sich kritische, philosophische Gedanken/Ansätze.
Aber auch Kritikerin Nr. 1 fand die Texte schön, einige davon sprachlich sehr gelungen etwa den von Hannah, der zeitgleich gut über das nachhaltige Netz zu informieren wusste. Aber Kritik muss sein. Sie war auch gut. Nur reichte es nicht für alle Texte. Die Texte sind vielseitig, interessant und spannend geworden. Jeder von ihnen hätte eine Kritik verdient.
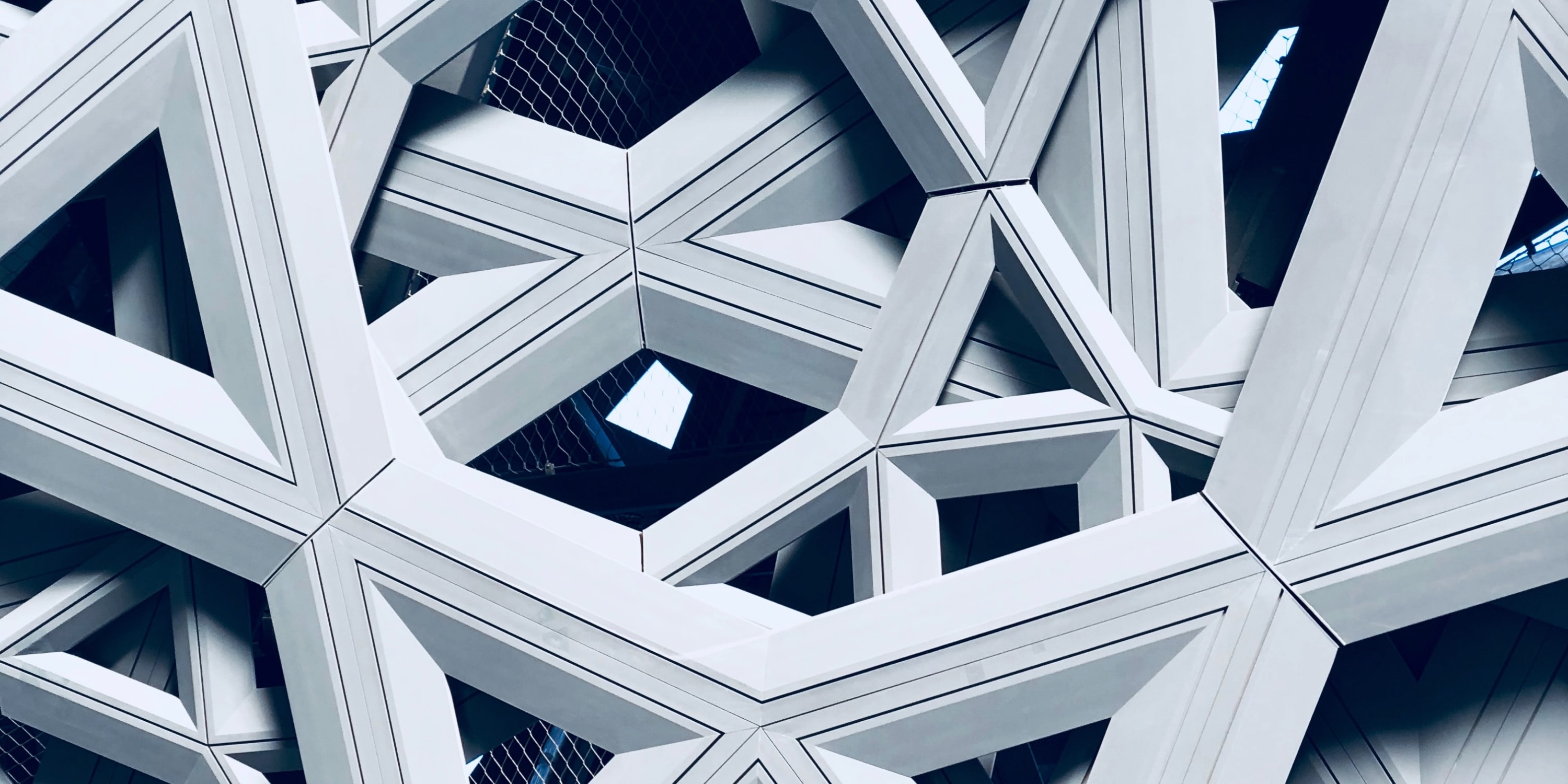



@Sabine Aha, danke für den Hinweis. Ich neige ja zu Unterspezifikation, daher wurde vielleicht nicht ganz klar, dass meine Ausführungen unabhängig von der Welt waren, die Ausgangspunkt für Ihren Text war, sondern sich nur auf den Text bezogen, der am Ende herauskam. Aber gut: da es einen Bericht und mehrere Portraits gab, hätten Sie einheitlich einen generischen Singular benutzen können „in Form von Bericht und Portrait“ oder auch jede andere grammatikalisch korrekte Form, z.B. „in Form eines Berichtes und mehrerer Portraits“. Wie dem auch sei: viel Erfolg beim Dranbleiben! Das ist nicht böse gemeint, aber es wäre gut, wenn Sie an sich arbeiten. Gerade weil es in (Online-)Redaktionen keine Lektoren gibt, die Ihnen behilflich sein können.