Wenn ich morgens die taz aufschließe, sehe ich auf dem Hof manchmal einen alten Kater. Obwohl das Altersheim anscheinend das Halten von Hunden erlaubt, zwei Bewohner sollen dort inzwischen schon Hunde besitzen, habe ich bisher noch nicht rauskriegen können, ob auch der schwarz-weiße Kater mit den zerbissenen Ohren und dem geknickten Schwanz dort lebt. Auf den taz-Hof kommt er vor allem wegen der Lebensmittelreste des Restaurants „Sale e Tabacchi“, vielleicht füttern die Köche ihn manchmal auch vom Fenster aus. Er ist sehr scheu. Jemand meinte neulich, er muß zum Altersheim gehören, denn er sehe ihn immer mal wieder in deren Garten. Vielleicht halte ihn sich eine Bewohnerin dort heimlich – schon allein damit er nicht den zwei Hunden ins Gehege komme. Und immerhin würde die Gerontologie immer öfter den alten vereinsamten Leuten raten, sich ein Haustier anzuschaffen, so dass auch immer mehr Altersheime ihr Tierhaltungsverbot lockern. Den Kater sah ich zuletzt vorgestern morgen. Ich erschrak, als er bei meinem Kommen hinter einem Haufen Europaletten hervorschoß und fauchend an mir vorbeilief. Dabei kenne ich ihn schon länger und habe sogar auch schon wiederholt versucht, ihn mir gewogen zu machen, indem ich ihm kleine Fleischstückchen hinlegte. Bisher habe ich dabei aber noch keine Fortschritte erzielt.
„An der Nahtstelle vom Menschen zum Tier verläuft das Phantasma der Natur beider als einer Zone unheimlicher Begegnungen,“ behauptete die Kulturwissenschaftlerin Gertrud Koch in einem Vortrag, wobei sie sich auf zwei Spielfilme konzentrierte: In dem einen geht es um eine Raubkatze im Zoo und in dem anderen um die Katzenwerdung von Menschen. Die Filmwissenschaftlerin Christine Noll hatte bereits im Zusammenhang einer Analyse von Tierfilmen gemeint: „Alles leiblich Schöne erlebt man erst an Tieren. Wenn es keine Tiere gäbe, wäre niemand mehr schön.“ Einen ähnlichen Gedanken entwickelte auch schon Walter Serner in seinem Roman „Die Tigerin“. Umgekehrt – über die Tierwerdung – äußerte Franz Kafka einmal: Man schreibe „jetzt so viel von den Tieren.“ Und gehe sogar noch über das Rousseausche „Zurück zur Natur“ hinaus: „Man sagt es nicht – man tut es. Man kehrt zum Tier zurück. Das ist viel einfacher als das menschliche Dasein.“
In einem Vortrag über „tierische Parallelwelten“ in Wien 2006 erinnerten die Autoren, Peter Berz und Christoph Hoffmann, daran, dass auch viele andere K.u.K.-Schriftsteller und Wissenschaftler eine große Vorliebe entwickelten, sich in andere Lebewesen rein zu versetzen: „Ende des 19. Jahrhunderts hatte der Wiener Physiologe Sigmund Exner, das erste Buch über die Facettenaugen von Insekten geschrieben. Er präparierte ein Käferauge, spannte es vor eine Kamera und photographierte aus dem Fenster. Voilà: So sieht ein Käfer die Welt! Als einige Jahre später der legendäre Entwicklungsbiologe Paul Kammerer ebenfalls in Wien einigen Grottenolmen aus der Krajna, die seit Tausenden von Jahren blind sind, in einer Dunkelkammer des Vivariums im Prater Augen züchtet, wagt er erst gar nicht zu fragen: Welche Welt sehen diese Augen? Österreich k.u.k / k.k., eine Welt aus Parallelwelten, scheint auch die Lust zu erfinden, sich in tierische Parallelwelten zu begeben. Was sähen wir, fragt Mach, wenn unsere zwei Augen wie beim Junikäfer einen halben Zentimeter auseinander lägen? Wie wacht man, fragt Kafka, als Käfer auf? Was sieht ein Pferd, fragt Musil, wenn es einen Frauenmörder im Gefängniswagen über den Ring zieht? Diese Lust an tierischen Parallelwelten hat bis heute viele Nachfolger.“
Unter den Haustieren scheint es vor allem der Hund zu sein, der sich in die menschliche Parallelwelt gedanklich reinversetzt. Bei der Katze ist es umgekehrt der Mensch: Zahllos sind die Bücher über Katzen. Im Gegensatz zu den meuteliebenden Hunden scheinen es die einzelgängerischen Katzen dennoch bis heute geschafft zu haben, dabei halbwegs autonom zu bleiben. Oder jedenfalls gibt es mit ihnen nicht solche Hund-Herrchen-Beziehungen, die ins Paranormale übergreifen. Der von der morphogenetischen Feldtheorie des Alexander Gurwitsch ausgehende englische Botaniker Rupert Sheldrake hat das auf dem Wege einer nahezu weltweit durchgeführten Internet-Korrespondenz mit Hunde- und Katzenhaltern kürzlich quasi verifiziert.
Neben den expliziten Katzenbüchern sind auch die Erinnerungen, besonders die von Prominenten und Politikern, voll mit Katzengeschichten. All diese Bücher basieren weniger auf dem „Dialog“ als auf Beobachtung.
Einen „dritten Weg“ hat jetzt Olga Kaminer gefunden, indem sie ihr Leben auf Sachalin, in der Leningrader Boheme und in Prenzlauer Berg nach ihren Katzen, die sie von klein auf bis heute besaß, sequenzierte. Auf diese Weise hat sie an allen ihren bisher etwa zwölf Wohnorten genaugenommen immer bei mindestens einer Katze gelebt – ohne ihnen dadurch jemals zu nahe gekommen zu sein. Katzen mögen es eher umgekehrt: daß sie einem nahekommen – oder auch nicht.
Mag sein, dass das für eine andere Berliner Autorin, die Jugendbuchverfasserin Sigrun Casper, eine Binsenweisheit ist, für ihren Roman „Eine andere Katze“ hat sie sich jedoch desungeachtet forsch der Katze Idia genähert und sieht nun gewissermaßen mit eigenen Augen deren (Um)welt. Die selbe Verwandlungstechnik (der noch etwas vom weiblichen Pendant zur Lykanthropie anhaftet) hatte vor einiger Zeit bereits der jakutische Autor Juri Rytcheu in seiner Tiergeschichtensammlung „Mondhund“ angewandt. Dabei waren aber bloß einige Märchen bei herausgekommen.
Während Olga Kaminer in der Menschenwelt bleibt (was ihr geharnischte Katzen- und -buchliebhaber übel nehmen könnten), muß Sigrun Casper notgedrungen die Katzenwelt vermenschlichen, wobei sie natürlich versucht, dabei neuestes Wissen aus der experimentellen Biologie anzuwenden: z.B. dass Katzen nicht farbig sehen können. Aber die Autorin scheint ansonsten gedacht zu haben, da muß ich durch, denn im Verlauf ihrer Geschichte versucht sie doch noch, nicht hinter Kafkas Tierverwandlungsgeschichten zurück zu fallen, indem ihre Katze quasi über sich selbst hinauswächst – eben anders als die anderen Katzen wird, wobei sie es mit Mäusen zu tun kriegt, mit denen die Pluralität ins Spiel kommt (wie das meistens bei Mäusen der Fall ist).
Claude Lévy-Strauss meinte: Wenn er einmal zauberhafterweise einen Wunsch frei hätte, würde er gerne mit einem Tier sprechen können. Schon der Pariser Kardinal Melchior de Polignac sagte fast flehentlich, als er den im Jardin du Roi ausgestellten lebenden Orang-Utan sah: „Sprich – und ich taufe Dich!“ Ludwig Wittgenstein gab demgegenüber zu bedenken: „Wenn ein Löwe sprechen könnte, wir könnten ihn nicht verstehen.“
Später erklärte der Genetiker Francois Jacob einmal einen Streit mit seinem Kollegen Jacques Monod damit, dass ihm die Labortiere, mit denen sie forschten – Bakterien, plötzlich zu unpersönlich geworden wären: „Ich wollte etwas Sichtbares, mit Hormonen, Leidenschaften, mit einer Seele. Ich wollte Tiere, denen man ins Auge blicken, die man individuell erkennen, ja benennen konnte. Und die fähig waren, einem auch selbst in die Augen zu blicken.“ Francois Jacob dachte dabei an weiße Mäuse, um die herum er ein ganzes Institut zu gründen beabsichtigte.
Von der Katze kommt man fast automatisch zur Maus, denn das ist ihre Aufgabe im Haus: es mäusefrei zu halten, wobei sie nicht nur die Beute behalten dürfen, sondern dazu auch manchmal noch als Belohnung eine Schale Milch bekommen. In dieser Juxtaposition zum Haushalt, wozu in Russland auch Flughafenempfangsgebäude und Läden zählen, ist sie besonders in Agrarländern unentbehrlich geworden. Wenn man die Katzen dort abschaffte, aus religiösen oder sonstwelchen Gründen, und stattdessen Mäuse- und Rattenfänger einstellte, die nach der Zahl ihrer abgeschnittenen Schwänze bezahlt wurden, kam es regelmäßig dahin, dass diese schärfer als die Katzen kalkulierten: Sie fingen das Ungeziefer lebend, schnitten ihnen die Schwänze ab – und ließen sie wieder laufen. Die Katze geht quasi umgekehrt vor.
Die Bücher von Olga Kaminer und Sigrun Casper haben dies gemeinsam, dass ihre Katzen sich vom Mäusefangen gewissermaßen emanzipiert haben, d.h. sie bekommen von ihren Haltern (Katzenbesitzer sind keine Herrchen!) Vollkost vorgesetzt. Das schafft neue Abhängigkeiten – bis dahin, dass in Amerika viele Katzen schon regelmäßig in psychologische Behandlung müssen. So nahe ist ihnen dort der Mensch bereits auf den Pelz gerückt. Bei Sigrun Casper tun das die Mäuse, Olga Kaminer wahrt dagegen durchgehend Distanz. Die Katzen sind einfach mit einem bestimmten Lebensabschnitt der Autorin verknüpft – in Wohnungen, wo auch sie ein- und ausgehen (können). Ihre sowjetische Katzenzeit war eine Zeit der Wohnungsnot, die mit dem Umzug nach Berlin, wo eher Bewohnernot herrscht, abrupt endete. Dafür hat sie jetzt zwei Katzen, von denen das letzte Kapitel ihres Buches bereits handelt: Die Katzengeschichten darin werden also chronologisch erzählt und enden mithin im Jetzt – sie bilden die Lebensgeschichte der Autorin. Während die Handlung bei Sigrun Casper ihr Heil (die Spannung, das nichtnachlassende Leseinteresse) in einer zunehmenden Phantastik sucht, die zugleich literaturanspielungsreich wieder gezügelt wird. Sie stellt die Lebensgeschichte der Katze Idia dar.
In dem eingangs erwähnten Vortrag ging Gertrud Koch davon aus, dass „die Grenzen des Verstehens die Grenzen der Lebenswelten“ sind. Und deren Regeln werden von der Sprache selbst konstituiert. Im Maße also die Raubkatze sprechen würde, würden wir versuchen, sie zu „übersetzen“ und uns mit ihr zu „verständigen“. Dabei würde sie jedoch aufhören, Katze zu sein, „und mit der Sprache die Welt der Menschen teilen“. Trotz dieser Unmöglichkeit (auch die umgekehrten Kafkaschen Verwandlungen, besonders die von Gregor Samsa, enden tragisch), gehen die Versuche der Verständigung zwischen Mensch und Tier weiter. Gertrud Koch erwähnt die regelmäßigen Zoobesucher, die es zu bestimmten Tieren hinzieht: „Diese Menschen studieren die Tiere nicht sondern spielen mit ihnen, sie bauen Regeln auf, die die Tiere mit ihnen teilen sollen und die sie darin zu Mitspielern machen wollen. In gewisser Weise könnte man sagen, dass sie ein imaginäres und ästhetisches Verhältnis zu den Tieren haben. Sie betrachten sie weniger als das, was sie für sich sind als vielmehr, was sie für sie sind.“ Der langjährige Bremerhavener Aquariumspfleger Werner Marwedel gebrauchte einmal ein ähnliches Wort wie „Mitspieler“, als er einen Doktorfisch zeigte und ihn als „unseren ältesten Mitschwimmer“ bezeichnete. Seine Haltung geht jedoch insofern über das „imaginäre und ästhetische Verhältnis“ des Zoobesuchers zu den Tieren hinaus, als er sich bei der Haltung und Pflege der Fische alles mögliche einfallen läßt und sie dazu auch studiert, um sie zu möglichst langjährigen „Mitschwimmern“ in der Aquariums-Schau zu machen.
In der Haustierzucht wird dies noch weitaus rigoroser versucht – und mindestens der Hund ist darüber bereits ein halber Mitspieler geworden: Seine „interartliche Intelligenz“ ist schon so weit entwickelt, dass er als einziges Tier selbst versteckte Hinweise des Menschen – mit der Hand oder den Augen – verstehen kann. 1959 begann der in der Lyssenko-Ära nach Sibirien ausgewichene sowjetische Genetiker Dimitrij Beljajew mit Domestikationsversuchen bei Blaufüchsen – auf Wunsch einer Pelztierfarm, der weniger ängstliche Füchse die Arbeit erleichtern sollten. Nach 35 Generationen und 45.000 Blaufüchsen war Beljajew am Ziel: die Tiere waren zahm! Er hatte stets die zutraulichsten weiter gezüchtet. Dabei hatten diese sich – sozusagen im Nebeneffekt – auch wie die Hunde körperlich verändert: sie bekamen Schlappohren, bellten, wedelten mit dem Schwanz zur Begrüßung und hatten weiße Flecken. Daneben besaßen sie noch ein Merkmal, das bereits Konrad Lorenz bei domestizierten Tieren aufgefallen war, nämlich „niedliche“ Gesichter, runde, wie Teddybären. So sehen alle Säugetiere aus, wenn sie klein sind. In der freien Natur streckt sich später der Schädel, er wird lang und spitz. Die zahmen Füchse behielten dagegen ihre Rundköpfe! Damit war klar, dass auch die Hunde vor etwa 10.000 Jahren nicht auf äußerliche Merkmale gezüchtet worden waren. Diese stellen sich vielmehr von selbst ein, wenn man auf Verhalten zielt. Beljajew erlebte seinen Erfolg nicht mehr: er starb in den 80er-Jahren. Nach dem Zerfall der Sowjetunion mußte sein der Farm angeschlossenes Institut Mitarbeiter entlassen und die Fuchszucht verkleinern. Dann entdeckte der Harvard-Wissenschaftler Brian Hare das Experiment: Er tat sich mit den übrig gebliebenen Kollegen aus Nowosibirsk zusammen und testete, ob die Füchse auch können, was die Hunde können: den Hinweisen von Menschen folgen. Sie können es, obwohl sie nie darauf trainiert wurden (siehe dazu „Current Biology“, 15, S. 226). Katzen können das nicht – vielleicht wollen sie es aber auch nicht können. Schon allein, um keine Schlappohren zu bekommen. Sie sind um so schöner, je distanzierter sie bleiben.
„Die Sowjetunion war ein Katzenland,“ behauptet Olga Kaminer. Deutschland ist dagegen ein „Hundeland“ – und sein Wappentier der Schäferhund – über den Alexander Solschenizyn einmal meinte, dass man ihn unbedingt in die internationalen Abrüstungsgespräche mit aufnehmen müßte, denn er setze – scharf gemacht – den Menschen mehr zu als alle Interkontinentalraketen zusammen.
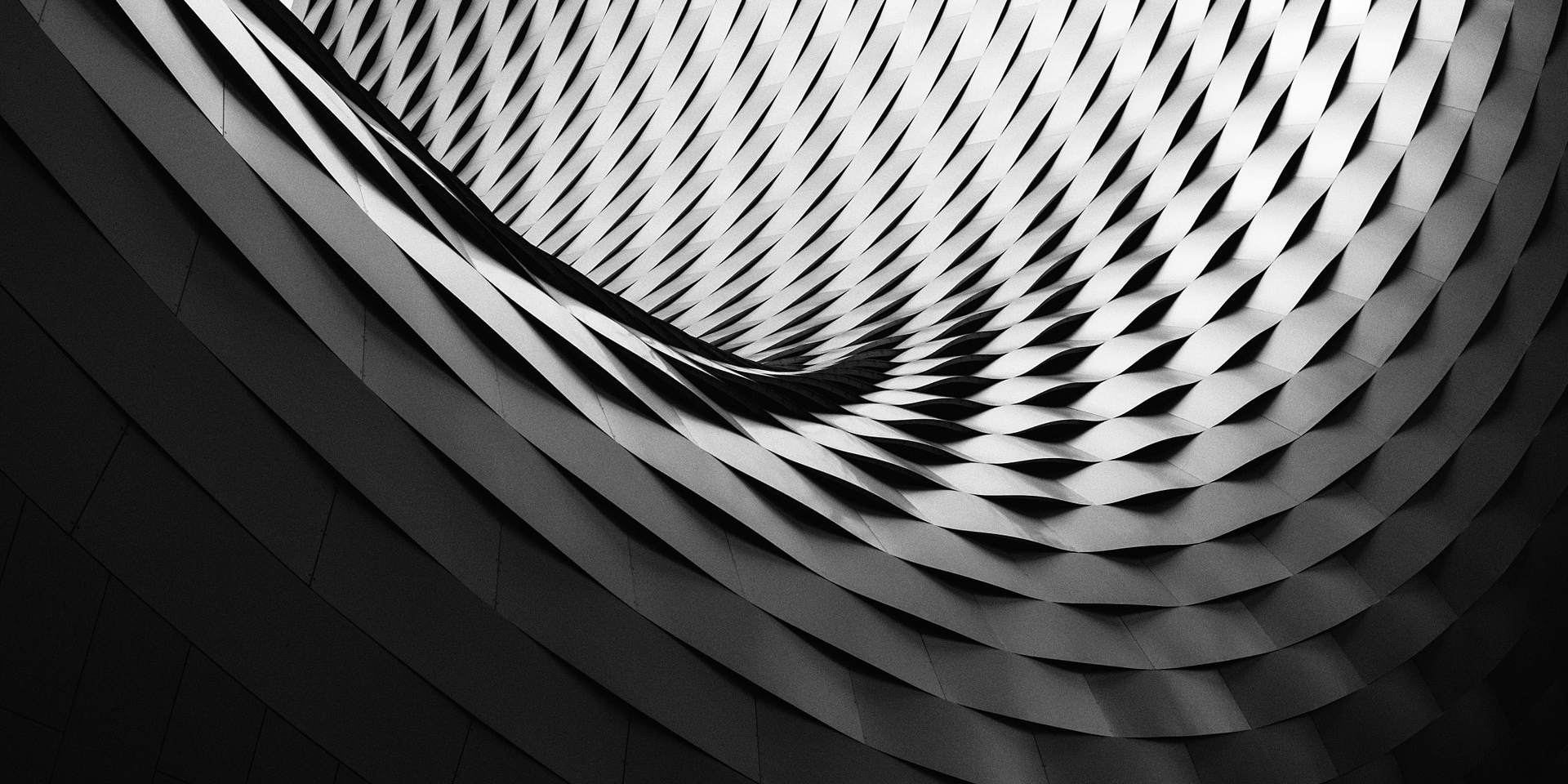



„Derridas Katze“ heißt eine Ausstellung in der NGBK, die sich mit Tieren befaßt.
Derridas knappe Bemerkungen über seine Katze sind der Ausgangspunkt von Donna Haraways Überlegungen zu ihrem Buch „When Species Meet“.
Darin beschreibt sie u.a. die Arbeitsweise der Pavianforscherin Barbara Smuts und der von ihr beobachteten Paviane als eine Form des »Gemeinsam-Werdens«, die über das spinozistische »Tier-Werden« bei Deleuze/Guattari hinausgeht, weil sich dabei ein Feld (in einer Feldforschung) eröffnet habe, auf dem sich zwei Spezies “begegnen”.
Dazu merkt der Biologe Cord Riechelmann an: “Haraway definiert so die Grenzen des Begriffs »Tier-Werden«, unterschlägt aber, das die beiden Theoretiker diesen Vorgang vor allem als eine Schreibposition begreifen, den Begriff also viel abstrakter auslegen, als dies im Kontext der Tierforschung möglich ist.”
Eine kühne Behauptung – dass es dem Philosophen Gilles Deleuze und dem Psychiater Felix Guattari bei ihrer Konzeption des nach überall hin “Affizierens” und “Affiziert-Werdens” um eine “Schreibposition” geht, um einen “abstrakten Begriff”. Denn immerhin hätten die beiden zu Lebzeiten sofort das situationistische Credo unterschrieben: “Um schreiben zu können, muß man gelesen haben und um lesen zu können, muß man zu leben verstehen – sonst kommt man nur dahin, die abstrakten Forderungen einer abstrakten Existenz endlos zu wiederholen.”
Wenig später sagt Riechelmann es selbst: “Ihren Begriff entwickeln sie zuerst im Kafka-Buch von 1975 und präzisieren ihn dann 1980 in ihrem Hauptwerk »Tausend Plateaus« in dem Kapitel »Intensiv-werden, Tier-werden, Unwahrnehmbar-werden«. Schon die Aufzählung im Titel deutet an, dass »Tier-werden« nur eine Form eines allgemeiner gefassten Begriffs von »Werden« ist.
»Tier-Werden« versucht, von Melville über Kafka bis hin zu Deleuze/Guattari immer auch Fluchtlinien aufzuzeigen, mit denen man leben kann, ohne eine Utopie entwerfen oder auf die Erlösung hoffen zu müssen. In diesem Sinn entwirft der ganze Werden-Komplex bei Deleuze/Guattari auch eine Ethik. Freilich ist diese Ethik keine des Geistes oder gar des Denkens, sondern allein eine des Körpers. Es geht um das Tätigkeits- oder Trägheitsvermögen eines Körpers. Der Denker, der das Verhältnis der zwischen den Körpern wirkenden Kräfte am besten begriffen hat, ist für Deleuze Spinoza. Der Gegensatz von Affizieren und affiziert Werden spanne das Machtgefüge auf, in dem man sich begegnet.”
Damit macht der ausgebildete Biologe aus dem Deterritorialisierungsforscher Deleuze flugs-”freilich” einen Reterritorialisierer.
Tatsächlich spricht Deleuze in seinen “Cours” (auf deutsch in http://www.webdeleuze.com) von unserer spinozischen “Macht affiziert zu werden”. Und diese “ist die Macht eures Wesens affiziert zu werden”. Mit “euer” sind hier seine Hörer angesprochen.
Als Beispiel führt Deleuze den Sonnenverehrer und überhaupt “Pantheisten” D.H. Lawrence an:
“Die Wesenheiten sind unterschieden, und gleichzeitig unterscheiden sich die einen von den anderen lediglich im Inneren. So dass, wenn mich die Sonne affiziert, ich mich eben durch die Strahlen selbst affiziere, und die Strahlen, durch die ich mich selbst affiziere, die Strahlen der Sonne sind, die mich affizieren. Dies ist solare Auto-Affektion. In Worte gefasst, hat dies ein groteskes Aussehen, aber versteht, dass das auf der Ebene der Lebensweisen ganz anders aussieht.”
Riechelmann bemüht sich aber nicht nur, kurz und schmerzlos die Arbeiten der Feldforscherinnen Smuts und Strum und der Biologin Haraway abzutun. Weil diese sich als “Bündnispartner” der “Akteur-Netzwerk-Theoretiker” um Bruno Latour verstehen, erledigt er auch diesen gleich mit: In einem taz-Artikel, der als Nachruf auf den Ethnologen Claude Lévi-Strauss gedacht war. Claude Levi-Strauss hatte einmal (in einem Zeit-Interview) über einen lang gehegten Wunsch gesprochen: “Ich hätte mich gern einmal richtig mit einem Tier verständigt, Das ist ein unerreichtes Ziel. Aber da ist die Grenze, die nicht überschritten werden kann”. Riechelmann schreibt anknüpfend an dieses Zitat: “An dieser Grenze hat er bis zuletzt nicht gerüttelt. Er hat sie, als er in der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag kurz vor seinem 101. Geburtstag in Paris verstarb, mit ins Grab genommen.” Die Grenze?
Weiter schreibt Riechelmann: “Das kann man wie ein Vermächtnis lesen.” – Das daran nicht gerüttelt werden darf? “Der einflussreichste Ethnologe des 20. Jahrhunderts hält einen aus dem Kitsch-Universum fern, das Mensch und Tier in einen Topf wirft und das auch noch für fortschrittlich hält, wie es zurzeit etwa exemplarisch der Wissenschaftsdenker Bruno Latour tut.” Der damit nämlich eindeutig gegen das Tier-Mensch-Grenz-Vermächtnis von Lévi-Strauss verstößt.
Aber die Affenforscher, auch Riechelmann war mal einer, geben nicht auf: auf ihrer Nachrichtenseite “primates online” berichtete gerade eine Gruppe von Anthropologen, die freilebende Japanmakaken erforschen, dass die Grossmütter in ihren sozialen Verbänden eine wichtige Rolle spielen, indem sie sich – wie die Süddeutsche Zeitung hervorhebt – den von ihren Muttern vorübergehend verlassenen Kleinkindern annehmen. Dank ihrer Betreuung überleben mehr Japanmakaken als in Affenpopulationen, wo es diese Großmutterfunktion nicht gibt. Bei Elefanten gibt es sie ebenfalls – sowie auch bei kanadischen und finnischen Menschenfamilien im 18. und 19.Jahrhundert, wie eine Vergleichsstudie ergab. “Allerdings ließ sich dieser positive Effekt nur für Omas mütterlicherseits nachweisen. Bei Großmüttern väterlicherseits war er nicht erkennbar,” schreibt der SZ-Rezensent und erwähnt dann eine weitere Ausnahme: “In einer anderen Untersuchung an Familien der ostfriesischen Region Krummhörn hatten die Schwiegermütter sogar einen negativen Effekt auf das Wohlergehen ihrer Enkelkinder. Lebten sie in der Nähe, stieg das Sterberisiko der Babys auf das Zweieinhalbfache an.” Man kann vermuten, dass diese ostfriesischen Großmütter in vielen Fällen die Aufgabe hatten, die Kinder ihrer Töchter bzw. Schwiegertöchter zu töten, weil die Großfamilien in diesem armen Landstrich nur wenige Kinder ernähren konnten, gleichzeitig jedoch mutig genug waren, um das selbst zu bestimmen.
Zurück zu dem “Intensiv-Werden, Tier-Werden, Unwahrnehmbar-Werden” von Deleuze/Guattari: Wenn das eine Reihung sein soll, dann wäre hier das “Tier-Werden” bzw. das Feld, auf dem dies zu geschehen hätte, nur eine Zwischenstation. Und erst einmal müßte das “Intensiv-Werden” gelingen. Über das “Werden” generell führen D&G aus: Es gehöre “immer einer anderen Ordnung als der der Abstammung an. Es kommt durch Bündnisse zustande…Werden besteht gewiß nicht darin, etwas nachzuahmen oder sich mit etwas zu identifizieren; es ist auch kein Regredieren-Progredieren mehr; es bedeutet nicht mehr, zu korrespondieren oder korrepondierende Beziehungen herzustellen; und es bedeutet auch nicht mehr, zu produzieren, eine Abstammung zu produzieren oder durch Abstammung zu produzieren. Werden ist ein Verb, das eine eigene Konsistenz hat; es läßt sich auf nichts zurückführen und führt uns weder dahin, ‘zu scheinen’ noch ‘zu sein’.” Das Werden ist eine Vermehrung, die durch Ansteckung geschieht. So wie beim Vampir – der sich ja auch nicht fortpflanzt, sondern ansteckt. Für Deleuze/Guattari “gibt es ebensoviele Geschlechter wie Terme in der Symbiose, ebensoviele Differenzen wie Elemente, die bei einem Ansteckungsprozeß mitwirken.” In diesem Zusammenhang betonen sie, dass es sich beim Tier-Werden immer um ein Plural handelt – also um Schwärme, Meuten, Banden… Und diese bilden sich eben durch “Ansteckung”. Man könnte stattdessen auch von “affizieren und affiziert-werden” reden.
Über eine Arbeit von Lisa Strömbek, die in der NGBK-Ausstellung „Derridas Katze“ gezeigt wird, schreibt Cord Riechelmann:
„Thematisiert wird in dieser Arbeit das Blickregime des Menschen über das Tier. Die Materialität des Blickes als Herrschaftsinstrument wird hier in Szene gesetzt. »Dear Friends« heißt eine Serie der Künstlerin, in der sie fünf Hundeporträtfotos zeigt. Auch wenn die Bilder der fünf Freunde tatsächlich ästhetisch gelungen sind, sind sie doch ein bedrückendes Dokument der ewigen Zurechtweisung des Tieres durch sein Herrchen oder Frauchen. Sichtbar wird aber auch, dass die Hunde mit der Art und Weise, wie der Mensch hier seine Vorherrschaft ausübt, gar keine Schwierigkeiten zu haben scheinen. Im Gegenteil, offensichtlich genießen sie hier ihre Erniedrigung. Dies ist eine Verhaltensvariante, die Derrida im Verhältnis zu seiner Katze gar nicht erst in den Blick nimmt, die aber den Pariser Philosophenkollegen Gilles Deleuze zu der Überzeugung brachte, dass diese Tiere keine Tiere mehr seien, sondern schon in die Menschenwelt eingepflanzt und deshalb komplett verblödet.“