Heute hat mich doch glatt ein Praktikant gesiezt. Das ist eines der vielen Zeichen, dass es mit den alternativen Duz-Betrieben langsam zu Ende geht – d.h. dass das schlechte Ganze langsam nach innen zuwächst, dort, wo man einst die „homogene Welt“ aufgerissen hat. Medienbetriebe sind aber wahrscheinlich ganz besonders versucht von dieser Kapitulation – in der sogenannten sich globalisierenden „Informations- und Dienstleistungsgesellschaft“.
Als erstes ging der Radiosender 100,6 perdu, wo viele von uns kostenlos mitgearbeitet hatten: Es gab mehr Autoren als Zuhörer bei diesem Sender. So ähnlich wie beim Kassler Offenen Radio, das uns im Frühjahr 2006 einlud, um über einen lamarckistischen „Anti-Darwinismus“ zu diskutieren – wahrscheinlich zur Abwehr jeglichen neodarwinistischen Verschwindens.
Der unangenehmste Mitarbeiter bei Radio 100 – Thomas Thimme – mendelte sich dort irgendwann zum Geschäftsführer heraus – und versuchte, ein Geschäft daraus zu machen. Zuletzt schrieb uns ein Finanzgericht an und fragte, ob wir als Autoren wirklich für jeden Beitrag Soundsoviel Honorar bekommen hätten. Das verneinten wir reinen Herzens. Thomas Thimme hatte damit anscheinend versucht, das unerklärliche Verschwinden von Radio-100-Geldern zu erklären – auf uns abzuwälzen, so als ob wir Steuern hinterzogen hätten. Die taz schrieb jetzt – rückblickend:
„Pikanterweise erklärte Thimme Radio 100 genau zu dem Zeitpunkt für zahlungsunfähig, als sich der französische Radiokonzern NRJ für den Berliner Radiomarkt interessierte. Nur kurze Zeit später hatte Thimme der NRJ eine Frequenz besorgt und wurde zwischenzeitlich bei Energy Geschäftsführer des ersten kommerziellen Berliner Radios.“
Dann wurde Thimme Geschäftsführer des ehemaligen Immobilienhändler-Radiosenders 100,6. Als solcher stand er nun wegen Konkursverschleppung vor Gericht. Er bekam eine Bewährungsstrafe. Zu dem Vorwurf, er habe auch noch Gelder in Größenordnungen veruntreut, erklärte sein Anwalt:
Sein Klient habe aber immer nur versucht, den Sender zu retten. Bei den veruntreuten 230.000 Euro habe es sich um ein Darlehen gehandelt, mit dem Thimme sich und seine Mitarbeiter bezahlt habe.
Silke Leuckfeld, stellvertretende Landesvorsitzende des Journalistenverbands DJU, zweifelt an dieser „interessanten“ Version. „Da würde ich ein großes Fragezeichen dahintersetzen“, sagte die Journalistenvertreterin. Auch ehemalige Mitarbeiter von Radio 100,6 glauben nicht, dass Thimme mit dem Darlehen ihre Gehälter bezahlt hat. Vom „Privatmann Thimme“ seien nie Gehälter bezahlt worden, immer nur von dessen Firmen, erklärte gestern Margit Ehrlich, ehemalige Redakteurin und Betriebsrätin bei 100,6, die zusammen mit 30 Kollegen ihren Job wegen der Insolvenz verlor.
„Mit dem Urteil können die Öffentlichkeit und der Angeklagte gut leben“, kommentiert Thimmes Anwalt die Entscheidung des Gerichts. „Das Strafmaß steht in keinem Verhältnis zu dem, was vorgefallen ist“, meint dagegen Silke Leuckfeld.
Ja, Thimme hat sich mit seinem Radio-Engagement viele Feinde unter den Berliner Radioautoren und -Machern geschaffen – im Laufe seiner Berliner Karriere. Aber in der taz -Berlinredaktionist ist man nun – trotz des geringen Strafmaßes – einigermaßen beruhigt:
„Vom Berliner Radiomarkt muss sich der 56-jährige Thimme wohl erst mal verabschieden. Mit seiner neuen Firma Power Radio GmbH hatte er sich noch zu Beginn des Jahres erneut für die Frequenz 100,6 beworben, von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg jedoch eine Abfuhr erhalten. Auf der ersten privaten Radiowelle sendet heute Motor FM in Zusammenarbeit mit der Netzeitung.“
Der Geschäftsführer der Netzeitung Michael Meyer wollte von Anfang an – während seiner Berliner Karriere – an einem möglichst großen Rad drehen – bis ihm der Hamburger „stern“ eine Nummer zu groß war, seitdem backt er zwar immer kleinere Brötchen, aber bis zum Schaffung eines Duz-Betriebes wird er es nie bringen (wollen), im Gegenteil: je kleiner die Netzeitung wird, desto sieziger geht es da zu. Neulich bekam ich dort als Rezensent von Arbeiterfilmen ein „Schreibverbot“, mit Meyers Begründung – über den Kulturredakteur an mich weiter geleitet: ich sei „zu taznahe“.
Die Veränderung beim Alternativbetrieb „Zweite Hand“ ging ganz anders vor sich – dieser wurde spätestens mit der Wende immer größer und erfolgreicher. Schon 1990 sah man kaum einen Polen oder Russen auf der Straße bzw. im Café, der nicht die „Zweite Hand“ studierte. Aber sechs Jahre später kam eine Gruppe von Ex-Betriebsräten der „Zweiten Hand“ in die taz. Sie wollten uns darüber aufklären, wie ihr Duz-Konzern gerade umgebaut wurde:
In vielen Westberliner „Alternativ“-Betrieben passieren jetzt solche Geschichten: Erst wurden die Mitarbeiter großzügig behandelt, auch pekuniär, mit der Wende erfolgte dann eine Expansion in den Osten, die scheiterte, und jetzt geht es mittels der gängigen Mobbing-Mechanismen von oben ans Eingemachte.
So rief etwa der Betriebsrat der Kleinanzeigen-Zeitschrift Zweite Hand nach fünfzehnmonatigen Verhandlungen über neue „Lohnstrukturen“ eine Einigungsstelle an, die das Arbeitsgericht jedoch abwies. Schließlich trat er am 18. April 1996 zurück: „Das Ganze hat unheimlich viel Kraft gekostet“, resümiert eine ehemalige Betriebsrätin des GmbH-Geflechts „Zweite Hand“ ihre vergeblichen Bemühungen um den Erhalt des Betriebsklimas.
Das erfolgreiche „Offertenblatt“ für kostenlose Kleinanzeigen (Umsatz 1995 zirka 15 Millionen Mark) wurde 1983 unter anderen von dem heutigen Hauptgesellschafter Konrad Börries in der Potsdamer Straße gegründet, zweiter Geschäftsführer ist seit 1988 Herbert Borrmann. Anfangs erschien die Zweite Hand einmal wöchentlich, ab 1986 dreimal. 1993 koppelte man den samstäglichen Autohandelsteil aus. Mit der „Wiedervereinigung“ versuchte die Geschäftsführung erfolglos, „die DDR zu erobern“ (die fünf ostdeutschen Filialen sind längst wieder abgewickelt).
Seit einiger Zeit gilt der Anzeigenblätter-Markt als „gesättigt“, die ZH-Auflage stagniert seit 1994 bei 162.000. Eine Tochter-GmbH, die Abteilung „WAS“ (Werbe- Anzeigen-Service), akquiriert Anzeigen von gewerblichen Kunden, bei der Abteilung „kostenlose Kleinanzeigen“ kam 1992 eine zusätzlich geldbringende Daueranzeigenannahme hinzu. Die Beratungsleistung in diesen Abteilungen wurde extra vergütet. Die für alles Neue offene Geschäftsleitung erfand zudem „Nationale“, „Chiffre“ und „Blickfang-Anzeigen“ sowie über eine „Phone-Box“ zu schaltende „Kontakt- und Partyanzeigen“ und käufliche „Horoskope“. Dafür wurde eine weitere GmbH kreiert. Für die Entwicklung einer am Treptower Park 75 erworbenen üppigen Ost-Immobilie war es dann eine GbR, die Börries und Borrmann mit einem Bauunternehmen gründeten. Das Richtfest für den dortigen „Zweite Hand“-Neubau fand Ende 1994 statt, im selben Jahr begann auch die erste große Umstrukturierung im Betrieb: „Alle Leute sollten fortan alle Anzeigen aufnehmen können“ – und dafür nach Lohngruppe A3 umgeschichtet werden, plus Provision, wenn mehr als 30 Anzeigen pro Stunde aufgenommen würden. „Jetzt verdient ihr euch alle eine goldene Nase!“ versprach die Geschäftsleitung. Das Modell „funktionierte jedoch nicht“.
Im Juni 1995 wurde ein neues mit dem Betriebsrat ausgehandelt: mit einem Grundlohn von 19,50 Mark und einer Provision ab der 41. Anzeige von 35 Pfennig für jede weitere, plus Umsatzbeteiligung. Diese Betriebsvereinbarung sollte für die knapp 100 Mitarbeiter der Abteilung „Kleinanzeigen“ gelten. Parallel dazu hatte man sich in der oberen Etage ein neues Wirtschaftsmodell ausgedacht – das „Call-Center“: mit gleicher Technologie und gleicher, von der konzernnahen „ISV-GmbH“ entwickelten Software. Die Umsetzung übertrug man der betriebsratlosen „Audio-Service-GmbH“, die damit 60 Arbeitsplätze in Treptow, am neuen Firmensitz, schaffen soll: „Das Call-Center bietet Telefondienstleistungen aller Art für Fremdfirmen an.“ Erwähnt sei ferner die ebenfalls betriebsratlose „Lloyd Presse GmbH“, in der das Stadtmagazin 030 entwickelt wurde, dem man defizitbedingt zunächst nur eine „Galgenfrist“ bis zur Love Parade 96 gab. Auch im Internet surft man mit: „blinx – Zweite Hand Online“. Zudem werden noch monatlich die Biker- Börse und das Single-Sondermagazin date sowie jährlich der Branchenführer „Leihen“ herausgegeben. Ein 10prozentiger Anteil an Radio Energy wurde inzwischen wieder abgestoßen.
Das Call-Center in Treptow beschäftigt vor allem Leichtlohnkräfte: für 10 Mark die Stunde werden dort in Konkurrenz zur Potsdamer Straße Kleinanzeigen erfaßt, dazu gibt es 20 Pfennig pro Auftrag. Mitarbeitern, die von Schöneberg in den Osten übersiedeln, stehen 12 Mark Stundenlohn zu, sie können auch im Westen bleiben. Nur, dort müssen sie befürchten, bis Ende 1997 abgewickelt zu werden. „Ihr wollt zurück in die Anfänge der Industrialisierung!“ bekam die Geschäftsleitung schon vom Betriebsrat zu hören. Im Westen ist zwar ein mit der IG Medien ausgehandelter Haustarifvertrag gültig, darüber hinaus gibt es eine Jahresleistung und sechs Wochen Urlaub. Aber die dortige Belegschaft hat das Gefühl, auf „einem schon fast abgesägten Ast“ zu sitzen: „Es geht seit 94 kontinuierlich bergab.“ Seitdem 1995 der Lohn um rund 10 Prozent gekürzt wurde, stieg die Zahl der – erfolglosen – Arbeitsgerichtsklagen, ebenso die der Krankmeldungen und Kündigungen.
Bisher haben fast nur Ostler sich bereit gefunden, nach Treptow rüberzugehen. Ein ehemaliger Betriebsrat beklagt zudem, daß sich die von der WAS angestellten Mitarbeiter sowie die in der Uniset GmbH zusammengefaßten Layouter und Grafikdesigner nie mit den „Tippern“, die das Gros der Belegschaft bilden, solidarisierten, obwohl auch ihre Gehälter schon um bis zu 310 Mark gekürzt wurden. Ihr aller Chef Herbert Borrmann folge allen Moden des Kapitalismus, er eile dabei sogar der CDU voraus – etwa indem er die Jahresleistung von Fehlzeiten abhängig mache. Von seiner Kalifornien- Tour brachte er vor einiger Zeit das „Lean Management“ mit, und nach dem Spiegel- Artikel „Deutschland: Weltmeister im Blaumachen“ habe der Personalchef den Tippern prompt die Krankenlisten vorgehalten. Das Rollback Richtung „Lohndrückerei“ im Call-Center gehe so weit, daß dort erst nach Aufnahme von 50 Anzeigenaufträgen pro Stunde die Mindestleistung erfüllt werde – diese Anzahl sei jedoch mit der ACD-Telefonanlage und der Zweite-Hand-Software „das absolute Maximum“, was überhaupt in der Stunde zu schaffen sei: „Schließlich muß man dabei immer freundlich bleiben.“
Seit der Inbetriebnahme des Call-Centers häufen sich die Kundenbeschwerden: falsche Rufnummern, verstümmelte Texte, patzige Live-Operator. Gerade der „freundliche, schnelle und kompetente Service“ (so das hausinterne Dienstleistungscredo) wird der ZH-Belegschaft ob der rücksichtslosen Profitpolitik der Geschäftsleitung zunehmend schwerer gemacht. Dafür schafft diese einen echten Christo fürs Treptower Foyer an… Derart geht die gute alte WG-Zeit nun also auch in Schöneberg langsam zu Ende – nahezu kampflos.
—————————————————————————————————————————————
Ob die taz diesem Entwicklungsprozeß nachfolgt, ist noch nicht raus. Es gibt Hinweise dafür. Nicht zuletzt, um dieszu diskutieren, wurde dieser Aushilfshausmeister-Blog eingerichtet, ich selbst hätte lieber einen „Biologie-Blog“ gehabt, den statt meiner jetzt Heiko Werning ausfüllt.
Nachdem erst das Alternativ-Radio 100 und dann auch die Zweite Hand aus der Potsdamer Straße verschwunden waren, gab dort erst die Medienbar auf und dann zog sich auch die Medien-Buchhandlung wieder nach Kreuzberg zurück. Dafür bekam der ganze Straßenabschnitt ein professionelles Quartiers-Management verpaßt. Merke: Es muß immer qualifiziert betreut werden!
Das Geld dafür kommt von oben (Brüssel, Berlin), die Ideen sollen aber von unten (Neukölln, Wedding, Wilmersdorf) kommen – und dazwischen moderieren die „Quartiers-Manager“ (QM). Sie sind aus den üppigen „Stadtteil-Vereinen“ der Siebzigerjahre und dem Planungskonzept „Bürgerbeteiligung“ hervorgegangen, wurden aber vor allem durch das Ausmagern der Verwaltungen mittels „Auslagern“ (an andere Träger) forciert.
Die Trägerschaft und die Konflikte, denen die QM gegenüberstehen, sind überall anders, auch wenn es stets darum geht, ihren Wirkungsbereich attraktiver zu machen. Den Wrangelkiez managte zuerst das altalternative GmbH-und ABM-Geflecht „Kirchbauhof“. Dann traten nach einer Neuausschreibung zwei mit frechen Flip-Charts ausgerüstete junge Frauen an, die eine ist Deutsch-Brasilianerin und die andere Türkin.
Manche QM sind vor allem mit Imagekorrektur beschäftigt. So versichert der QM Killewald aus Oberschöneweide der Öffentlichkeit ständig, es habe sich an seinem Wirkungsort bereits „gewaltig viel getan“. Tatsächlich aber klagen immer mehr Gewerbetreibende: „Man kriegt hier schlechte Laune und Kopfschmerzen.“ Und nachdem ganze Bürgerinitiativen gegen den QM vom Boxhagener Platz in Friedrichshain mobilisiert hatten, diskutierten die Kontrahenten ihre konfliktuösen Kiezkonzepte öffentlich. Die Berlinredaktion der taz moderierte. Dort, im dritten Stock der Kochstraße 18, hält man sich inzwischen bereits eigene QM-Korrespondenten.
Am Helmholtzplatz im Prenzlauer Berg wollen die drumherum wohnenden Yuppies gerne die lauten Penner und Punker in der Mitte weghaben. QM in diesem unversöhnlichen Konflikt ist die ehemals alternative Sanierungsagesellschaft S.T.E.R.N. Für die Penner spricht die Ostphilosophin und Obdachlosenzeitungsgründerin Sonja Kemnitz. Sie ist pessimistisch.
Das Quartiersmanagement am Kottbusser Tor hat sich selbst basisdemokratisiert – mit einem „Beirat“, der auch sehr gute Arbeit leistet. Einer aus dem Gremium erzählte mir neulich, sie hätten kürzlich alle Glücksspielorte um den „Kotti“ erfaßt, nur die in den Vorderhäusern allerdings. In nächster Nähe gibt es dort: 13 Wettbüros bzw. Spielhallen, 18 Internet-Telecafés sowie 12 Männercafés und 14 „Kultur“- bzw. „Sport“-Vereine. „Hier gibt es bald nur noch Geschäfte, die auf die eine oder andere Weise Glück verkaufen,“ erklärte er mir, „in gewisser Weise gehört auch noch der Heroindealplatz direkt am Kotti dazu.“ Gegen diese geht dort eine „Mütter-Initiative“ vor, die vor einigen Wochen von gleich mehreren westdeutschen Radiosendern interviewt wurde, u.a. meinte deren Sprecherin, man solle versuchen, die Fixer vom Kotti zu vertreiben – „meinetwegen vors Kanzleramt“. Die WDR-Reporterin fand das so gut, dass sie seufzte, leider gäbe es solch eine Mütterinitiative noch nicht gegen die Fixer bei ihr in Köln.
Es gibt 15 QM-„Einheiten“ in Berlin. Das Büro im Lützowviertel Südlicher Tiergarten, das aus drei Managern und mehreren freien Mitarbeitern besteht, hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Zunächst entschärfte es mit Hilfe der dort schon lange aktiven Sozialarbeiterprojekte den dortigen Anwohnerkonflikt rund um den Fixerinnen- und Afrikanerinnen-Strich zwischen Kurfürsten- und Lützowstraße (rund um Möbel-Hübner) und dem damit zusammenhängenden nächtlichen Autoverkehr der Freier. Diese „Szene“ verlagert sich jetzt langsam woandershin. Anschließend sammelten die QM Ideen, wie man den „Durchtausch“ der Bewohner verlangsamen, d. h. die Wegzugsquote senken könnte – damit im Südlichen Tiergarten so etwas wie eine „Kiez-Identität“ entsteht. Das Ergebnis war, dass man den in Charlottenburg lebenden russischen Regisseur Victor Shulman engagierte, ein Konzept für eine „interkulturelle Bühne“ zu erstellen.
Victor Shulman schreibt darin: „Unser Ziel ist offensichtlich und deutlich: die Erhöhung der Attraktivität vom Kiez durch die Verbindung der aus 150 Staaten Gebürtigen, die hier wohnen. Wir wollen die Bewohner des Kiezes im Sinne der Kultur und des Alltags beheimaten.“ Die im Lützowviertel domizilierte damalige Ausländerbeauftragte der Stadt Berlin, Frau Barbara John, bezeichnete das Konzept als besonders viel versprechend.
Mein Augenarzt, Dr. Maung Maung Mra, der ebenfalls an der Potsdamer Straße wohnt, würde gerne zurück in seine Heimat Burma gehen, doch die Militärdiktatur lässt das nicht ratsam erscheinen, und seine Frau, eine Holländerin, würde sowieso lieber nach Amerika ziehen, bzw. weiterziehen. Aber natürlich hätten sie nichts dagegen, irgendwo etwas mehr „beheimatet“ zu sein – und gegen ein multikulturelles Theater-Festival, organisiert von Victor Shulman, hätten sie schon gleich gar nichts. Es soll auf mehreren Bühnen im Lützowviertel stattfinden, auf den Möbel-Hübner-Parkplätzen, den Fritzlar-Homberg-Schulhöfen, im Kulturzentrum „Pumpe“, im Hotel „Berlin“, im Gemeindehaus der Apostelkirche und auf fünf Straßenkreuzungen.
Allerdings müsse man „genau und behutsam das Verhältnis zwischen deutscher und nicht-deutscher Teilnahme auf den Bühnen beachten“, betont Victor Shulman. Die deutsche Sprache soll dabei das „Medium“ sein. Einerseits sollen „möglichst viele Bewohner zur Mitwirkung“ bewegt werden, „gleichzeitig muss unser Fest (aber) nach Weltniveau streben“. Das heißt es werden „Profis“ auftreten, aber auch Laientheatergruppen, Theaterschul-Gruppen, Volkskunstgruppen und Chöre wie der der „Zwölf-Apostel-Gemeinde“.
Victor Shulman gibt zu, dass seine inhaltlichen Vorstellungen derzeit noch etwas russischlastig sind, aber er befinde sich ja auch noch am Anfang seiner Akquise und habe noch Zeit. Zuerst muss mal die Finanzierung gesichert sein.
___________________________________________________________________
Ich weiß nicht ob das QM-Event dann überhaupt stattfand, auch ob es das Quartiersmanagement dort noch gibt, weiß ich nicht. Der von ihm angeblich woandershin „verlagerte“ Fixer- und Babystrich hat sich jedenfalls wieder an seinen alten Standorten eingefunden, neuerdings noch erweitert sogar durch bulgarische Prostituierte, die dort schon mal vor 12 Jahren anschaffen gingen – und dann aber seltsamerweise wieder verschwanden.
Inzwischen gibt es in der Brandenburgischen Straße sogar ein Bordell – als Duz-Betrieb: von Felicitas. Es ist zwar mittlerweile das berühmteste „Bordell neuen Typs“ in Berlin, aber die Profite gehen nicht groß über die von Alternativbetrieben raus: die meisten Männer kommen nur zum Kucken und trinken dazu ein billiges Bier oder einen ebenso billigen Kaffee.
Felicitas schob vor einigen Jahren eine Gesetzesinitiative an, die die allgemeine Lage der Prostituierten verbessern sollte. Heraus – aus dem Bundestag – kam dabei schließlich das ProstG. Ein Jahr später lud mich die Frankfurter Prostituiertengruppe „Donna Carmen“ ein, um mit ihnen und einigen „Laufhaus“-Geschäftsführerinnen aus Süddeutschland über die Auswirkungen dieses Gesetzes zu diskutieren. Wir kamen überein, dass das neue Gesetz nur für die deutschen Prostituierten gemacht sei, die gäbe es jedoch kaum noch – und bei den ausländischen Prostituierten gehe es völlig an deren Problemlagen vorbei. Nicht nur das, für die sei ein neues Gesetz – zur Verschärfung der Bekämpfung von Schlepperbanden – in Vorbereitung, das ihre Lage sogar verschlechtern werde. Aber der Reihe nach:
Eine der ersten türkischen Journalistinnen – Suzan Gülfirat – schrieb für die „Morgenpost“ einen Bericht über einen Spezialpolizeieinsatz in der Kreuzberger Kneipe „Le Soleil“, die Hassan K. und seiner Frau gehörte. Es war ein Überfall, der so brutal war, dass ein daran beteiligter Polizist und Türke beschämt den Schauplatz verließ. Hassan K. schloß anschließend das Lokal und ging in die Türkei zurück. Wie zum Hohn bekam er wenig später die deutsche Staatsbürgerschaft. Eigentlich hatten die Beamte bloß Hassan K.’s Sohn gesucht. In der Morgenpost stand dann, die Polizisten hätten nur „aus Eigenschutz“ gehandelt und „ein Arzt habe keine Notwendigkeit gesehen“, tätig zu werden. Dabei war gar keiner anwesend gewesen. Suzan Gülfirat bekam wenig später einen Journalistenpreis. Als ich sie einmal auf einer Vernissage in Mitte auf ihren Artikel ansprach, meinte sie: Er sei völlig umgeschrieben worden. Später beim Tagesspiegel wehrte sie sich dann auch gegen solche oder ähnliche Umschreibversuche – über das hausinterne Emailsystem.
Etwas anders verlief bis jetzt die Berliner Karriere der ukrainischen Journalistin Lilli Brand. Ich lernte sie über Helena und Ira kennen, zwei Prostituierte, die im Friedrichshainer „Lord Gabriel“ anschaffen gingen und sich immer mal wieder bei mir meldeten, wenn sie ein Behördenproblem oder Ähnliches hatten. Helena wollte z.B. ihre Tochter, die in Odessa bei einer Freundin lebte, zu sich nach Berlin holen – auf dem Wege der „Familienzusammenführung“, aber als sie sie endlich mit einem Touristenvisum hier hatte, sagte man ihr, die Tochter werde demnächst schon 16 und damit bestünde keine Notwendigkeit eines permanenten Aufenthalts bei der Mutter mehr. Auch ein hinzugezogener Anwalt konnte da nichts machen. Aus lauter Kummer fing Helena an zu trinken. Und wollte mich nicht mehr sehen – bzw. mir nichts mehr erzählen. Ira hatte ihre Tochter bereits bei sich, aber sie zerstritt sich irgendwann mit ihrem Scheinehemann, bei dem sie – in Hellersdorf – lebte – und verschwand aus Berlin. Zuvor hatten die beiden Frauen mir immer mal wieder Bruchstücke aus ihrem Leben und über ihre Arbeit erzählt. Diese hatte ich dann – u.a. für die Frauenzeitung „Weibblick“ – zu einer Geschichte verarbeitet, in der es u.a. über Schleppenbanden ging, die vor allem Frauen aus Osteuropa brutal in die hiesigen Bordelle verschleppen. Aus den Gesprächen mit Helena und Ira – und später mit Lilli Brand hatte ich dagegen den Eindruck gewonnen, dass die Brutalität gegenüber diesen Frauen eher vom deutschen Staatsapparat und der Polizei ausgeht.
Ira und Lilli waren mit einer Kiewer Schlepperbande nach Berlin gekommen, Helena hatte es jedoch alleine hierher geschafft, obwohl sie, wie sie sagte, im Gegensatz zu Ira und Lilli keine Studierte sei. Aber einfacher hätte sie es jetzt auch nicht: Allein die Geldüberweisungen für ihr Kind kosten jedesmal 90 DM, jedes Paket mit Anziehsachen allein 50 DM Porto und laufend kämen weitere Kosten dazu, kurzum „Meine Mafia ist mein Kind!“ Ira und Lilli mußten auch erst einmal nichts für den illegalen Transit zahlen, sondern nur ihre Pässe einem „Russen“ geben, der sie zusammen mit einigen hundert Dollar einem korrupten Visabeamten bei der deutschen Botschaft in Kiew in die Hand drückte. Dieser bewilligte ihnen daraufhin Touristenvisa. Ein anderer „Russe“ brachte dann die Mädchen mit dem Zug nach Berlin, wo sie in einer Puffpension am Stuttgarter Platz untergebracht wurden. Für Ira und Lilli ging es von dort aus gleich weiter nach Freiburg, wo sie in einem Club tanzen und anschaffen sollten. Vorher bekamen sie von dem „Russen“ noch Geld für neue Klamotten. Obwohl sie danach über 2000 DM Schulden bei ihm hatten, ließ er ihnen die Pässe, denn im Falle einer Razzia konnten sie damit nachweisen, dass sie sich immerhin legal in Deutschland aufhielten. Ohne Papiere wurden die Frauen dagegen oft so lange verhört, bis eine von ihnen die Namen ihrer Schlepper verriet.
Während Ira hier schon beim ersten Aufenthalt einen Ehemann fand, mußte Lilli die Dienste der Kiewer Schlepperbande später noch einmal bemühen, bis auch sie sich verheiraten und damit in Deutschland bleiben und arbeiten konnte. Inzwischen hat sie schon alle möglichen Jobs gemacht – und spricht fast perfekt Deutsch.
Deswegen lag es nahe, dass sie mir die Geschichten sozusagen in die Maschine diktierte. Dadurch war ich nur noch so etwas wie ein Hilfsredakteur. Weil sie beim Geschichtenerzählen merkte, dass sich damit auch Geld verdienen ließ, sah sie darin bald eine Möglichkeit, sich als Journalistin selbständig zu machen. Dazu forcierte sie das Geschichtensammeln derart, dass sie bald nicht mehr zur Arbeit ins Bordell ging. Dafür interessierte sich dann eine renommierte Literaturagentur für ihre Texte. Um Kosten zu reduzieren gab sie zudem ihre teure Wohnung am Kurfürstendamm auf und zog an den Stadtrand zu einem Bekannten. Dort hatte ihr Hund auch mehr Auslauf. Sie trieb sich die meiste Zeit in der Stadt herum – mit einem Aufnahmegerät bewaffnet: nosing-around. So entstanden die meisten Artikel. Irgendwann riefen zwei Beamte von der Polizei bzw. vom BKA bei mir an und wollten sich mit Lilli treffen. Sie lehnte das jedoch kategorisch ab. Kurz zuvor hatte sie gerade eine kleine taz-Reportage über einen brutalen Polizeieinsatz am Leopoldplatz gegen zwei Araber veröffentlicht gehabt. Und dann hatte man sie auch noch verhaftet und für mehrere Wochen eingeknastet, weil sie irgendwelche Schulden nicht bezahlt und auf alle Schreiben nicht reagiert hatte.
Nicht dass sie Auseinandersetzungen mit den Behörden scheute, im Gegenteil: Weil sie ständig irgendwelche Dokumente verlor oder ihr geklaut wurden, war sie sogar laufend damit beschäftigt, ihre Papiere wieder in Ordnung zu bringen – wozu sie immer wieder irgendwelche Formulare ausfüllen und Behördentermine einhalten mußte. So manche Verabredung mit ihr in der taz kam deswegen nicht zustande. Und dann machten ihr auch noch ihre Männer ständig Ärger. Aber es ging voran, wenn auch viel langsamer als geplant. Außerdem veränderte sich das „Thema“ mit der Zeit: weg von Prostitution, Schlepperbanden, Polizeirazzien, Abschiebung und Knast. Stattdessen erzählte sie Geschichten aus ihrer Kindheit – vom Großvater auf dem Dorf, von ihrem Hund, von ihrem wilden Freund Felix und ihrem durchgeknallten Freund Alexander, beides Fixer. Harmlos waren auch diese Geschichten nicht. Dafür beruhigte sich ihr persönliches Hinterland ein bißchen, nachdem sie bei ihrem eifersüchtigen türkischen Rentner ausgezogen bei einem alten deutschen Philosophen eingezogen war. Dort wurde sie nun aber erneut – von fünf Polizisten – verhaftet: Wieder hatte sie eine Rechnung nicht bezahlt – 400 Euro oder so. Außerdem gab es da noch einen Strafbefehl wegen des taz-Artikels vom April 2002 über den „Zwischenfall“ am Leopoldplatz. U.a. wurde ihr in dem Schreiben vorgeworfen, sich dazu unrechtmäßig – mit einem Presseausweis und einem Aufnahmegerät – Informationen beschafft zu haben. Da Lilli Brand zur Zeit immer noch in der JVA-Frauen, Alfredstraße 11, einsitzt, bemühte sich der alte Philosoph um eine Kopie des Strafbefehls, den er an die taz weiterleiten wollte. Das Amtsgericht teilte ihm jedoch schriftlich mit: „Der Strafbefehl konnte hier nicht ermittelt werden“.
Ich befürchtete gleich, dass hier eine harte Journalistin weich geklopft werden soll, die das offizielle Bild von den guten deutschen Polizisten, die uns und die ausländischen Frauen vor den bösen ukrainischen Zuhältern schützen, beschmutzt. Zuletzt polierte das Montagsmagazin Spiegel im Zusammenhang der Friedman-Affäre diese Lüge ganz groß wieder auf, obwohl zuvor auf einem Prostituierten-Kongreß der Gruppe „Dona Carmen“ in Frankfurt von nahezu allen Teilnehmern festgestellt worden war, dass nicht der Frauenhandel das Problem sei, sondern das neue – allzu halbherzige – Prostituiertengesetz, das für die ausländische Frauen überhaupt nichts bringe – inländische es unterdes aber kaum noch gebe, wenigstens in Frankfurt und Berlin.
——————————————————————————————————————————-
Noch dicker kam es dann mit der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer, zu der die Frankfurter Prostituiertengruppe „Dona Carmen“ eine neue Kampagne startete:
Die Fußball-Weltmeisterschaft (kurz WM) sollte angeblich Prostituierte (kurz P) von überall her anlocken. Im Vorfeld des Ereignisses hatten sich deswegen landauf landab lauter WM-P-Aktionsgruppen gebildet. Ihren heterogenen Interessen entsprechend reichten die Forderungen vom Kampf gegen die Zwangsprostitution (und damit gegen Organisierte Kriminalität) bis zur strengsten Freierbestrafung („à la Schweden“) – Minimum: eine Freieraufklärung. Letzteres wurde sofort in Angriff genommen: mit einer „Hotline für Männer“. Daneben hatten katholische Nonnen aus sechs Ländern auch schon eine für ausländische Zwangsprostituierte eingerichtet. Das breite Mittelfeld bestand u.a. aus folgenden Organisationen zur Eindämmung der WM-P: Medica Mondiale, Deutscher Frauenring, Bund deutscher Kriminalbeamter, Männer gegen Männergewalt, Männerarbeit der evangelischen Kirche, Amnesty International, Bundesverband sexuelle Dienstleistungen, Unicef…
Einzig die in Frankfurt/Main ansässige Hurenorganisation „Dona Carmen“ trat dagegen an, d.h. sie bekämpfte diese ganzen reaktionären „Bündnisse“ – und hatte dazu u.a. nachgerechnet: Von den rund 300.000 Prostituierten in der BRD sind 150.000 Migrantinnen, und davon sind 99% nicht vom Frauenhandel betroffen. Die Zahlen stammten vom BKA „Lagebild Menschenhandel“. In bezug auf die hohe Dunkelziffer ergänzte sie das LKA Berlin dahingehend, dass eine „seriöse Dunkelfeldforschung“ noch ausstehe. Die Frankfurter Frauengruppe hatte jede Tagung und jede Debatte der WM-P-Aktionsgruppen verfolgt. In Summa machten sie dann den „Freier-Kampagnen und allen anderen Formen der Dramatisierung von Menschenhandel und Zwangsprostitution den Vorwurf, dass sie ein Randphänomen von Gewalt im Migrationsprozeß missbrauchen, um Prostitution als Ganzes in Zusammenhang zu bringen mit Zwang, Gewalt und organisiertes Verbrechen, um sie damit zu stigmatisieren und zu kriminalisieren.“
Was für die eigentliche Arbeit der „Dona Carmen“-Gruppe gilt, die es hauptsächlich mit in Frankfurt temporär anschaffenden P. aus Lateinamerika zu tun hat (weswegen ihre Zeitschrift „Muchacha“ heißt), traf auch auf die meisten hier antretenden Fußballer zu, die da vor der Weltpresse dribbeln, abgeben und schießen mußten: Sie kommen aus Lateinamerika. Fast täglich sind irgendwelche Fußballmanager aus Europa irgendwo in Südamerika unterwegs – auf Talentsuche. Manchmal gleich in ganzen Rudeln – als Reisegruppe. En passant sammeln sie dabei auch noch jede Menge P-Erfahrungen. Da kommt es also bereits zu einer ersten zarten Berührung zwischen WM und P.
In Sao Paula trieb es eine solche Gruppe einmal so doll, dass ihnen einer der Talentsucher abhanden kam. Erst zwei Tage später fanden sie ihn – benommen vorm Hotel liegen. Man hatte ihn entführt und einer Niere beraubt. Die sofort alarmierte brasilianische Polizei blieb gelassen: Erst einmal müßten sie beweisen, dass er mit zwei Nieren eingereist sei – dann könne man eventuell was tun. Beim Einkauf von lateinamerikanischen Spielern für europäische Fußballmannschaften haben sich mehrere Polen als eine Art Zwischenhändler bewährt. Einer, mit einem umgebauten Gutshof als Trainingscamp, kauft in Lateinamerika gleich ganze Dorfmannschaften auf, schafft sie zu sich nach Hause und läßt sie dort unter der Anleitung eines belgischen Ex-Schiris trainieren und von einem Sportlehrer schulen. Danach werden sie einzeln oder in Kleingruppen weiterverkauft. Ähnlich entwickeln sich die Verhältnisse auch auf den lateinamerikanischen Model- und Pornodarsteller-Märkten.
Was die ganze Aktivisten gegen die WM-P ausklammern, ist der gewerbliche Hintergrund – nicht der P, sondern der WM. Es ist ein Fast-Globalevent für Berlin: einmal ökonomisch, aber auch, dass wir (Deutschland) so etwas händeln können: Nicht wie die Russen Tschetschenien oder die Amis New Orleans, für das zuletzt sogar der Spiegel-Redakteur Christian Malzahn ein Spendenkonto einrichten mußte…
Das ist jedoch nur die halbe Wahrheit (für die eingrenzenden Sicherheitskräfte und Politikberater freilich die ganze). Gleichzeitig muß das Megaevent nämlich auch das Gegenteil sein: mindestens so interessant – um nicht zu sagen: entgrenzend, dass die anwesenspflichtige Weltpresse sich nicht langweilt, wohlmöglich auf dumme Gedanken kommt – und z.B. die idiotischsten Berlinismen an den Rändern der jetzt nur noch 3,3 Millionen-Metropole vorführt – ja vorführt! Also muß Stimmung gemacht werden. Und wie kann man es am Besten knallen lassen – außer mit einem teuren Feuerwerk nach dem anderen (Pyroart heute genannt)? Genau! Bei Weib, Wein und Gesang. Vulgo: Mit Nutten, Alkohol und anschließendem Gegröhle. Nicht nur der marode Goya-Club, das Tempodrom, der Kudamm, die Paris-Bar und das extra zur WM errichtete Wellness-Großbordell in Halensee – nach der griechischen Stürmergöttin „Artemis“ genannt, auch die ganzen Hotels und so genannten Flaniermeilen in Mitte sowie 4000 Studentinnen als „WM-Hostessen“ – erwarten sich von der WM wahre Wunder – in ökonomischer Hinsicht.
Es blieb nicht anderes mehr übrig: Die altbewährte „High-Life-Combo“ mußte wieder ran, die sich schon bei der B-750-Feier (wo noch Ostberlin gegen Westberlin antrat) wacker geschlagen hatte. Es war nicht schwer, sie zu revitalisieren: Die Dienststellen, in denen sie nach 1987 einzeln untergekommen war, waren sowieso zur WM-Zusammenarbeit verpflichtet. Die „WM-Taskforce“ traf sich zu ihrem ersten „Brainstorming“ in Konstanz – im Hotel am Hafen. In dessen Konferenzsaal besprachen sie erst mal einige Auswertungen der WM-Erfahrungen anderer Städte. Dann hechelten sie die großen Momente der eigenen Nachkriegsfeiern in Berlin durch: Gina Lollobrigida auf der Berlinale, Kennedy, Kreuzberg, der Mauerfall, Schabowsky…Viel zu lange wurde über die Love-Parade diskutiert (im Saal herrschte Rauchverbot). Während einer Pause ging die halbe Taskforce zum Frischeluftschnappen runter an den Hafen.
Dort steht seit 1993 am Ende der Mole eine über 15 Meter hohe sich langsam drehende Riesenplastik, die von weitem wie eine winkende Statue of Liberty aussieht. Es ist aber „die schöne Imperia“, nach einem Roman von Balzac benannt, der u.a. in Konstanz zu Beginn des 15. Jahrhunderts spielt. Den Berliner Brainstormern sagte der Roman nichts, sie waren in Globalgedanken versunken – und von Konstanz selbst erhofften sie sich dabei am allerwenigsten was. Ein ortsansässiger Bodenseefischer (einer von vieren) belehrte sie eines Besseren: Die sich drehende halbnackte Riesenfrau mit spitzen Brüsten aus Beton symbolisiert die wegen des berühmten Konzils von Konstanz zwischen 1414 und 1418 in die Stadt geströmten P aus aller Welt und aus allen Klassen (Balzac hat nur eine aus den oberen interessiert, ähnlich wie nach ihm Defoe und das halbanonyme „Tagebuch einer Verlorenen“, das während der Weltwirtschaftskrise von G.W.Papst verfilmt wurde).
Auf dem Konzil verhandelte man die Thesen des böhmischen Theologen Jan Hus, dem Kaiser Sigismund freien Abzug zugesichert hatte. Aber dann geriet das Konzil doch derart in Rage über den Reformer, dass sie ihn sofort an Ort und Stelle verbrannten. In Böhmen entstand daraus, noch während das Konzil weitertagte und -feierte, die Hussitenbewegung, die dann alle drei gegen sie aufgebrachten Kreuzzugsheere zusammenschlug, wobei sie u.a. erstmalig Bauernwagen und Pistolen einsetzte – und ganz Europa in Aufregung versetzte. Dies war der eigentliche Beginn der Bauernkriege und der Reformation – wie Luther selbst 100 Jahre später schrieb. Hus wurde 1996 beinahe vom Papst rehabilitiert, der in der Sache jedoch Sigismund die Schuld gab. Das interessierte aber die WM-Taskforce alles gar nicht. Nur ein Aspekt an der ganzen Geschichte, der auch die Konstanzer bewogen hatte, an dem in ihren Mauern einst tagenden Konzil mit dem größten Hurendenkmal der Welt zu erinnern, ließ sie aufhorchen: Dass so ein Topevent P aus aller Herren Länder zusammentrommeln konnte – und es damit für alle Beteiligten zu einem bleibenden Erlebnis machte. Nicht grundlos tagte damals das Konzil vier Jahre lang (mit kleinen Unterbrechungen, um wieder flüssig zu werden).
Die schöne Imperia trägt auf ihren Händen den Kaiser und den Papst. Ganz eindeutig ist damit gemeint, dass auf den in Konstanz versammelten P letztlich das Schicksal der Völker ruhte. Die ganzen wichtigtuerischen Debatten der kirchlichen und weltlichen Würdenträger, ihre geckenhaften Hofschranzen, die schneidigen Pferde und schicken Karossen, der brennende Scheiterhaufen…Das war alles Show! An Jan Hus erinnert in Konstanz nur noch ein kleines Denkmal – irgendwo zwischen den Häusern eingeklemmt. In Wahrheit ging es damals darum: Wer wen. Und für Konstanz wurde dieser ökonomische Zwang der Verhältnisse am Beginn der Neuzeit erkennbar an den „P. aus aller Welt“.
Das Imperia-Denkmal für sie an der Stelle weist aber zugleich auch noch über diese ganzen historischen Fakten hinaus. Das ist sein utopischer Gehalt: nämlich den kleinen Kaiser und den verschrumpelten Papst gewissermaßen in die Tasche zu stecken. Denn nunmehr – Imperia dreht sich seit 12 Jahren – ist die Prostituierung allgemein geworden, d.h. es wird allenthalben hart daran gearbeitet. Dazu gibt es inzwischen eine ganze „Sex-Industry“ – die sich permanent zum Kulturbetrieb hin erweitert, der uns gleichzeitig immer ökonomischer kommt.
Nach Sichtung aller TV-Übertragungen der Oscar-Verleihung, kam die New York Times neulich zu dem Schluß, dass es dabei um die „Dekonstruktion der Prominenz durch den Zuschauer“ gehe, wobei deren Dekonstruktionskompetenz unterstützt werde von einer wachsenden Industrie der Stylisten, Dermatologen, Chirurgen und Trainern aller Art. Sie wittern die Fälschung noch hinter der natürlichsten Erscheinung. Die Dekonstruktion laufe zuletzt auf eine „Prominenz mit entmenschlichtem Antlitz“ hinaus. Der Berliner Mythologe Peer Schmidt hält dieses NYT-Resümee für eine der neuen Kulturindustrie angemessene Form des „Klatsches“, denn es gehe dieser Industrie nicht mehr um kulturelle Inhalte oder ihre Verkitschung, „sondern um solche für die industrielle Fertigung des menschlichen Körpers, also um etwas wesentlich Weitergehendes. Der ominöse Begriff der Kulturindustrie kann mithin als veraltet gelten“. Zugearbeitet wird ihr von der Gentechnik-Branche – gleichsam aus der Tiefe des Mikroraumes. Dies ließ beim Berliner Molekularbiologiehistoriker Hans-Jörg Rheinberger bereits den Verdacht aufkommen, es hierbei mit einer neuen „Kulturwissenschaft“ zu tun zu haben.
Nicht um die Oscar-Verleihung der Filmproduzenten (Fiction), sondern um die Pornoindustrie (Doku), die sich ebenfalls selbst Preise verleiht, geht es Georg Seeßlen: „Die Pornographie hat seit den Neunzigerjahren ihre eigene politische Ökonomie zum Inhalt. Der pornographische Diskurs verwirft den weiblichen Körper nicht mehr (um ihn in einem seltsamen Jenseits, dem Pornotopia der Literatur wie des ‚Rotlichtmilieus‘ und allen ihren Romantisierungen, zu restaurieren), er fügt ihn vielmehr in den Mainstream ein… Pornographie ist die letzte große Illusion der Teilhabe der unnützen Menschen am System,“ schreibt Seeßlen, der die „alte ‚Elendsprostitution‘ – vorwiegend in der Form der sexuellen Ausbeutung der proletarischen Frau durch den bürgerlichen Mann oder der kolonialisierten Frau durch den kolonialistischen Mann“ – nur noch für einen „Störfaktor“ hält in der Entwicklung der globalen Prostitution, „die den Wert des ‚fuckable‘ Menschen nicht durch institutionellen Zwang, sondern durch Marktkonkurrenz bestimmt.“
Seeßlen vermutet, dass die neue pornographische Sexualität, die auch den Krieg und die Folter „genußvoll“ mit einschließt, auf folgende Kernaussage hinausläuft: „Dein Körper gehört dir, nicht wie ein geistiges oder historisches Eigentum, sondern wie ein Auto oder ein Bankkonto. Er gehört dir wie Waren im Kreislauf, du kannst ihn verkaufen, vermieten, drauf sitzenbleiben, ihm Mehrwert abtrotzen oder ihn verspekulieren. Je neosexueller du bist, desto weniger kannst du Heimat in ihm haben, aber desto mehr Profit kannst du ihm entnehmen.“
Vielleicht versteht man jetzt das P-Denkmal in Konstanz – die WM-Vorbereitungsgruppe ‚Rahmenbedingungen‘, wie ihr Name quasi-offiziell lautet, tat jedenfalls so. Sie nahm von dort den Vorschlag mit nach Hause: Wir müssen alle möglichen Organisationen und Institutionen gegen die „P aus aller Welt“ bewegen („motivieren“). Dann werden die Fußballfans und auch noch ganz andere Männermassen von selbst nach Berlin strömen. Wer wird sich so etwas entgehen lassen? Die Frankfurter Hurenorganisation sprach in diesem Zusammenhang von der „Karriere eines Gerüchts“.
Die schien jedoch zunächst gefährdet, denn die Hauptstadtjournaille von Bild bis BZ griff die Idee sofort, d.h. vorzeitig (durch Verrat?) auf – und los gings; derart ,daß sich der eine und andere „Verantwortliche schon bald die bange Frage stellte: Manchem Fußballfan reicht vielleicht bereits der ganze Medienrummel darüber – im Vorfeld?! Das wäre natürlich absolut kontraproduktiv. Wenn die alle zu Hause blieben und sich bloß vorstellten – wie es da wieder mal in Berlin richtig abgeht. In den ganzen Youthhostels, Swingerclubs, Pornodiscos…Und hinter jedem Baum im Tiergarten kniet eine Nutte und bläst den Männern reihum einen – mit Kondom natürlich nur.
„In meinen Mund kommt nur Gummi“. Apropos: Die BVG plante auch zur WM wieder kostenlos Präservative an ihre Fahrgäste zu verteilen – natürlich nur an zahlende. Und der Berliner Spiegelredakteur Michael Sontheimer machte sich zusammen mit dem Historiker Götz Aly an eine Monographie über die Berliner Präservativ-Weltmarke „Fromms“. Als der Vorschlag, dem untersten Marktsegment der P abseits gelegene garagenartige „Verrichtungsboxen“ zur Verfügung zu stellen, gerade vom Tisch war, lenkte die Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer schon die öffentliche Aufmerksamkeit auf die besten und teuersten P – in der Zeit (sic).
Dort schrieb sie, dass sich die russischen Nutten schon jetzt in Rudeln auf den Rolltreppen des KaDeWe tummeln würden, um Ausschau nach zahlungskräftigen Männern zu halten. Bestätigt wurde dies Ressentiment von der russischen Journalistin Natalia von den Gentschenfelde, die dazu noch ergänzend hinzufügte, dass es zu besonderen Anlässen (Sylvester, ITB, Führergeburtstag, WM) auch im Ritz-Carlton von russischen Nutten zwar noch nicht wimmele, aber immerhin. Für das KaDeWe startete die ewig Westrige BZ daraufhin eine ganze SubWM-P-Aufkärungs-Serie. Das KaDeWe selbst ertrug schweigend die vielen männlichen Rolltreppenbeobachter, die davon ins Haus gelockt wurden, und – weil sie schon mal da waren – auch gleich noch irgendwas kauften. Spätestens in der Lebensmittelabteilung stießen sie dabei auf thailändische P, die dort schon seit über 20 Jahren morgens nach der Arbeit an der Sektbar frische Austern essen, die sie Muscheln nennen.
Genauso mindestens so ähnlich hatte die Taskforce sich das Funktionieren ihrer Idee vorgestellt. Sie war also mehr als freudig überrascht. Selbst die verschlafensten Bordelle gerieten plötzlich in WM-Hektik. In immer mehr Billigpuffs wurden und werden Sportsender sowie Großbildschirme installiert. Mancherorts wurde für die Mädchen sogar statt der „Heim und Welt“ (in der alle „Laufhaus“-Verwalterinnen ihre P-Wünsche annoncieren) der „Kicker“ ausgelegt. Im Friedrichshainer Club „Helena“ erzählte mir eine P – aus dem Osten: Ihre Hauptkampfzeit, das seien früher immer die Messetage in Leipzig gewesen, aber einmal hieß es dort, im Palast-Hotel habe die Mannschaft von Werder Bremen Quartier bezogen. Fast alle Mädchen hätten die alten Säcke in Leipzig sausen lassen und seien sofort zu den grünen Jungs nach Berlin gefahren. – Und sie hätten es nicht bereut: „Das war das wildeste, was ich bisher erlebt habe – war ne schöne Zeit,“ meinte sie.
Von der anderen Seite lotete die Professorin Sabine Grenz von der Humboldt-Uni das P-Problem aus. Sie veröffentlichte ihre Ergebnisse gerade – rechtzeitig zur WM. Es geht darin um die Freier: Was wollen sie, was nicht usw.? Es ist eine „Konsum“-Studie über „sexuelle Dienstleistungen“. Danach sehen viele Männer die Masturbation gegenüber der P als „qualitativ minderwertiger“ an, zumal sie sich auch noch einbilden, ihr Sexualtrieb sei stärker als der von Frauen, so daß sie quasi gezwungen wären, ihn bei den P abzuführen. „Die P ist dabei ein sexuelles Objekt“ – zu diesem überraschenden Befund kommt der Tagesspiegel in einer Besprechung der HUB-Studie, wobei er diese steile These wie zum Beweis mit einem prallen Nuttenarsch in weiß illustrierte. Aber gleichzeitig, so Dr. Sabine Grenz weiter, würden die Männer gerne prahlen, ihre P fast zum Orgasmus gebracht zu haben – da müsse also mehr als nur Geld im Spiel gewesen sein – fast eine „echte Beziehung“ usw.. Was die Genderforscherin den Freiern entlockte, hört sich wie aus einem ganz normalen Mann-Frau-Verhältnis geplaudert an, nur in finanzieller und zeitlicher Hinsicht gedrängter, ansonsten jedoch mit genau den selben Erwartungen und Interpretationen bzw. Projektionen: dass man all seine Investitionen zurück bekommt, dass sich dieses spekulative Risiko gelohnt hat usw. Die gute alte P eben – wird da beschworen. Dieses Gefühl trägt aber bloß bis zum Orgasmus der Freier, dem prompt ein postkoitaler Durchhänger folgt, woraufhin sie die P als „kalt“ empfänden und sich selbst als „schlecht“ – wie „ernüchtert“. Das hält die Männer allerdings nicht davon ab, weiterhin P aufzusuchen. Um so weniger, und das gilt besonders für die Zeit der WM (die keine vier Jahre dauert), wenn P aus aller Welt da sind – es also möglichst bunt und abwechslungsreich zugeht – aufregend eben.
Lange vor der Berliner Freier-Studie erschien bereits eine in Kamerun. Und zwar von einem Sozialforscher und Künstler der Universität Yaunde. Er arbeitete dazu mit P. zusammen, die er mit ihren jeweiligen Freiern photographierte – vor und nach dem Geschlechtsverkehr. Der Schweizer Entwicklungshelfer und „Projektprüfer“ Al Imfeld wirkte dabei mehrmals als Freier mit, auf Anraten „seiner“ P trug er auch finanziell dazu bei, dass die Studie später als Buch erscheinen konnte. Der Wissenschaftler teilte ihm dafür vorab mündlich einige seiner Forschungsergebnisse mit. Sie bestätigten bereits das, was nun auch die Berliner Studie feststellte – jedoch falsch interpretierte: „Alle bis anhin photographierten europäischen Männer zeigten nach dem Sexualverkehr weder Freude noch Erleichterung. Sie können Sex nicht lange genießen, sondern werden gleich vom bösen Geist des Gewissens in die Hand genommen.“
Bei den männlichen WM-Gästen in Berlin war es dann so, dass sie nur Interesse an Fußball zeigten und die Bordelle sich über Gästemangel beklagten. Und bei den ausländischen Prostituierten war es dann so, dass sie gar nicht erst anreisten. So dass selbst die Springerpresse das Thema WM-P bald fallen ließ.
______________________________________________________________________
Weitaus wichtiger waren in diesem Zusammenhang sowieso zwei neue Gesetze, die noch von der rotgrünen Regierung durchgebracht worden waren – und mit denen Arbeit und Prostitution sich verquickten, nicht zuletzt dann in der Person des VW-Managers Hartz selbst sowie bei einigen VW-Betriebsräten und einem Skoda-Manager.
Es geht dabei zum einen um das 2003 verabschiedete erweiterte (Hartz-) Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und dann um das 2005 im Bundestag verabschiedete erweiterte Gesetz gegen den Menschenhandel. Bei beiden Gesetzen handelt es sich um einen kompletten Bruch mit den bisherigen deutschen Rechtsauffassungen. Durch diesen Paradigmenwechsel im Doppelpack entledigt sich der Staat fast vollständig der Verpflichtung, die persönlichen Rechte verbindlich zu gewähren – und liquidiert gleichzeitig alle Möglichkeiten, sie gegen ihn wenigstens versuchsweise einzuklagen. Gleichzeitig forciert er noch einmal seine Überwachungs- und Polizeifunktionen und dehnt sie enorm aus.
Was ersteres – das vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen – betrifft, dazu hat der Richter am Bundesverwaltungsgericht Professor Uwe Berlit bereits alles gesagt – in der juristischen Fachzeitschrift „Informationen zum Arbeitslosen- und Sozialhilferecht“: Mit diesem Gesetz schaffe der Staat „rechtlose Untertanen, über die er bedingungslos verfügen könne, ohne auf deren Willen Rücksicht nehmen zu müssen. Vielmehr werde vorauseilender Gehorsam zur Voraussetzung, damit der Staat diesen entrechteten Menschen die sozialen Existenzgrundlagen nicht vollständig entzieht, wobei selbst diese Unterwürfigkeit keine Garantie biete, daß es nicht doch dazu kommt. Denn nahezu alles ist zukünftig eine Ermessenentscheidung der neuen ‚Fallmanager‘ des Arbeitsamtes, von deren Wohlwollen die Gewährung minimalster Rechte abhängt, da sie nicht mehr als rechtverbindliche Ansprüche existieren, somit auch vor Gerichten nicht einklagbar sind“. Diese Zusammenfassung der Gesetzeskritik von Berlit stammt aus einer Würdigung von Frank Rentschler – die er unter dem Titel „Fordern und Fördern im aktivierenden Staat“ in der neuen Zeitschrift der Erlanger Crisisgruppe „Exit“ veröffentlichte. Daneben wurde im Zusammenhang der bundesweiten „Montagsdemonstrationen gegen Hartz IV“ bereits mannigfaltige Kritik an diesem „Reformwerk“ geübt, wobei einige Autoren auch auf die UDSSR-Gesetze hinwiesen, in denen es einst kurz und knapp hieß: „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen!“.
Die hier folgende Kritik an dem neuen rotgrünen Strafrechtsänderungsgesetz zum Menschenhandel basiert im wesentlichen auf einem Referat von Juanita Henning, einer Mitarbeiterin der Frankfurter Prostituiertenorganisation „Dona Carmen“, das sie 2003 auf der „1. Internationalen Schleusertagung“ in Graz vortrug, nachdem die EU im Jahr zuvor einen „Rahmenbeschluß des Rates zur Bekämpfung des Menschenhandels“ veröffentlicht hatte, der dann nur noch auf Länderebene umgesetzt werden sollte. Die „Schleusertagung“ hatte der „Bundesverband Schleppen & Schleusen“ veranstaltet. Diese Organisation war 2005 auch mit einem Stand auf der „Zweiten Messe über Geldbeschaffungsmaßnahmen: Goldrausch“ vertreten, die im Kreuzberger Kunstamt stattfand. Die Frankfurter Prostituiertenorganisation und der Bundesverband kämpfen für ein und das selbe: „Mobilität ist unser Ziel!“ lautet ihr Motto. Wobei der Verband eine Art-„Lobby für Reisefreiheit ohne Dokumente“ ist und dabei eng mit lokalen Fluchthilfegruppen zusammen arbeitet.
Der Paradigmenwechsel von der staatlich geförderten „Fluchthilfe“ zum staatlich bekämpften „Menschenhandel“ wurde nach dem Ende des bolschewistischen Experiments 1993 in Budapest auf Ministerebene verkündet. Schon wenig später war die Oder-Neiße-Grenze zur „sichersten Grenze der Welt“ ausgebaut – und das Vorfeld weitgehend gesichert: 1998 wurden in Sachsen bereits Taxifahrer, die dennoch über die Grenze nach Deutschland gelangte „Flüchtlinge“ einfach als Kunden behandelt hatten, ohne zuvor ihren Ausweis kontrolliert zu haben, mit Gefängnis bestraft. In Italien gilt neuerdings Ähnliches für Fischer, die in Seenot geratene Flüchtlinge aufnehmen. Sie ebenso wie die ostdeutschen Taxifahrer fungieren damit als „mobile Grenzkontrollstellen“.
Das war vor 1989 noch ganz anders: 1977 entschied z.B. das Bundesverfassungsgericht, wer Flüchtende dabei unterstützt, „das ihnen zustehende Recht auf Freizügigkeit zu verwirklichen, kann sich auf billigenswerte Motive berufen und handelt sittlich nicht anstößig“. Er hat Anspruch auf ein Honorar und kann dies auch vor Gericht einklagen. In Westberlin war die Fluchthilfe sogar steuerabzugsfähig und besonders aktive Fluchthelfer (u.a. Furrer, Diepgen, Landwosky) bekamen als verdiente antikommunistische „Tunnelbauer“ staatliche Auszeichnungen, auch wenn ihre Honorare mitunter geradezu „unsittlich“ waren. Trotz der Verwandlung der freiheitsliebenden Fluchthelfergruppen in verbrecherische Schlepperbanden hat sich jedoch dieses Gewerbe mit dem Mauerfall nicht groß geändert, sieht man mal davon ab, dass es jetzt auch Schleusungen von West nach Ost gibt, für Osteuropäer, die kein Wiedereinreiseverbot in ihren Paß gestempelt bekommen wollen, und dass die Schlepper jetzt statt staatlich geschützt und gefördert zu werden sich rein privatwirtschaftlich organisiert haben.
Dazu führte 1999 der Direktor der „International Organisation for Migration“ (IOM) auf einer Konferenz des Bundesnachrichtendienstes (BND) aus: „Das kommerzielle Netzwerk umfasst zentrale Strukturen einer Schattenwirtschaft – meist im Herkunftsland, die aus Agenturen, Organisationen und Personen mit einer Angebotspalette relevanter Dienstleistungen besteht. Diese richten sich nach dem Bedürfnis der Kunden und können ‚Einmal-Greznübertritte‘, ‚Kompaktreisen vom Herkunfts- zum Zielort‘ oder auch ‚Garantieschleusungen‘ umfassen. Marktwirtschaftlich reguliert richten sich die Preise der Leistungen nach Angebot, Nachfrage, gewünschtem Komfort, Schnelligkeit, Risikozulagen etc. Im Vordergrund der Geschäftsbeziehungen stehen Zufriedenheit der Kunden mit der Hoffnung auf Weiterempfehlung. Zwangsmaßnahmen gegen zahlungssäumige Kunden bewegen sich zum Großteil im Rahmen dessen, was z.B. auch seriöse Kreditinstitute unternehmen, um ausstehende Gelder einzutreiben“.
Diese Experteneinschätzung hat jedoch nicht verhindert und sollte das auch nicht, dass man dabei heute von kriminellem Menschen- bzw. Frauenhandel spricht, den inzwischen auch immer mehr private Organisationen und Initiativen bekämpfen. Das geht so weit, dass sogar schon Prostituierten-Schutzgruppen der Polizei zuarbeiten und dafür staatliche Fördergelder kassieren. Sie tun dies im Bewußtsein, damit gewissenlosen Verbrechern, die Frauen ausbeuten und vergewaltigen, das Handwerk zu legen, wobei sie diese ausländischen Frauen meist als arme Opfer von geldgierigen Männern begreifen – als bloße Ware in den Händen einer skupellosen Mafia.
Demgegenüber behauptet der Bundesverband der Schlepper & Schleuser: „Von mafiaähnlichen Strukturen ist weit und breit nichts zu sehen, die einzigen Straftaten, die begangen werden, sind Dokumentenfälschungen und Beihilfe zu illegaler Einreise und Aufenthalt. So braucht es auch das Konstrukt der Organisierten Kriminalität, um saftige Strafen für geringe Verbrechen zu rechtfertigen“. In Polen wurde z.B. der Nachbar einer Frau, die er auf ihre Bitte hin mit seinem Auto nach Berlin gefahren hatte, wo sie dann Anschaffen ging, zu vier Jahren Gefängnis wegen einer solchen „Beihilfe“ verurteilt. Der „Bundesverband Schleppen&Schleusen“ hat sich zum Ziel gesetzt, diese ganzen nur dem Kapital dienenden Staats- und Polizeipolitiken als das zu entlarven, was sie sind: eine Riesensauerei!
Und das soll jetzt auch noch auf alle potentiellen Schwarzarbeiter, Saisonarbeiter, Putzfrauen etc. ausgedehnt werden – womit diese den Prostitutionsmigrantinnen gleichgestellt werden. Zudem wird mit dem neuen Gesetz auch noch aus dem „Zeugenschutz“ für die letzteren ein gigantisches „IM“-Programm: Schon die vorangegangene „Brüsseler Erklärung“ stützte sich bei den „Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels“ vor allem auf die „Opfer“, die dazu gebracht werden sollen, sich zu entscheiden, ob sie „sich als Zeuge oder Informant zur Verfügung stellen“.
Es herrscht jedoch ein ständiger und zunehmender Mangel an „Opfern“, denn wie überall in der „New Economy“ verfeinern sich die Sitten bzw. wird „Unsittlichkeit“ politisch-juristisch abgebaut. Schon rein optisch: So bestehen zumindest die russischen Schlepperbanden z.B. längst nicht mehr aus kahlköpfigen „Men in Sportwear“ sondern aus seriösen Schlips- und Anzug-Trägern. Umgekehrt wurden aus den meisten feministischen Frauenberatungsstellen hierzulande flexible, moderne „NGOs“, die gewissenlos der Polizei und Justiz zuarbeiten, um weiterhin Sach- und Personalmittel zu bekommen, denn da die als Illegale aufgegriffenen Frauen kein Vertrauen in die Staatsorgane haben, müssen diese Beratungsstellen für sie einspringen. Darauf ist z.B. Gerline Iking von der „Dortmunder Mitternachtsmission“ sogar stolz: „Wenn Razzien anstehen, müssen wir parat stehen!“ Früher weigerten sich die Sozialarbeiterinnen und Ärzte in den inzwischen aufgelösten „Geschlechtsberatungsstellen“, selbst bei ihren regelmäßigen „Bordellbegehungen“ von der Polizei auch nur begleitet zu werden. Heute fordert eine Frauenbetreuungs-Organisation wie „Solwodi“ sogar die Teilnahme von NGOs an Razzien: „Die Aufgaben der Fachberatungsstelle und das Zusammenwirken von Polizeibeamten und Beraterinnen kann im Einsatzbefehl festgeschrieben werden“. Die „Ökumenische Arbeitsgruppe“ (heute: FIM genannt) gibt dazu bereits „Empfehlungen“ heraus: „Es ist ein klar durchstrukturiertes Vorgehen bei Razzien zu zeigen“. Für die dabei verhafteten Frauen gilt dann, was das „Opferschutzzentrum Hannover“ auf einer „Fachtagung“ festhielt: „Zuerst müssen wir sie als Menschen betrachten und dann kann man in einer guten Zusammenarbeit zwischen NGO und Polizei gute Zeuginnen gewinnen“.
Leider weigern sich immer mehr aufgegegriffene Frauen, da mit zu spielen. die Berliner Organisation „Ban Ying“ beklagte schon 1998, dass die von ihr betreuten Fälle kaum in der Lage seien, „ein Bewußtsein über das ihnen zugefügte Unrecht zu entwickeln, dass essentiell ist für die Bereitschaft auszusagen“. Einen Ausweg sieht „Ban Ying“ vor allem in der schärferen Bekämpfung von Scheinheiraten, denn dadurch verschaffen sich diese Frauen bloß einen „legalen Aufenthaltsstatus“ – und werden prompt „bei einer Razzia in einem Bordell o.ä. nicht mehr vernommen oder gar mit zum Präsidium genommen“…. Das ist mehr als bedauerlich – waren doch früher gerade die „Razzien für gehandelte Frauen eine Möglichkeit des Ausstiegs bzw. der Flucht“. Für „Ban Ying“ erklärt sich bereits mit dem Anstieg von Scheinehen und dem dadurch bewirkten Rückgang von festgenommen Frauen, „warum thailändische Opfer von Menschenhandel statistisch immer weniger sichtbar werden“.
Anders gesagt: Die zunehmende Legalisierung und damit Stabilisierung migrantischer Notbehelfe in bezug auf Aufenthalt, Prostitution, Einkommen etc. – das ist für diese Berliner Opfer-Betreuungsorganisation schon fast existenzbedrohend geworden. Da weiß die im ungleich dynamischeren Frankfurt ansässige Organisation „Agisra“ guten Rat, denn sie hat beim Umgang mit den festgenommen Frauen inzwischen eine neue Aufgabe gefunden: „Wir leiten bewusstseinsbildende Prozesse zur Anahme der Rolle bzw. Identität als potentielle Opferzeugin ein“. Aber auch dabei treten mitunter noch Probleme auf, von denen z.B. die Prager Organisation „La Strada“ zu berichten weiß, die ihre Kontakte zu einheimischen Frauen von westlichen Beratungsstellen bekommt und die zu ausländischen Frauen von der tschechischen Polizei: Bei den einen wie den anderen ist „die Bereitschaft zur therapeutisch begleitenden Be- und Verarbeitung des Erlebten gering“. Solch gewissenlosen Prostituierten warf dann sogar die rotgrüne „Landesregierung Nordrhein-Westfalens“ in einer offiziellen „Antwort“ eine „Verdrängungs- und Verharmlosungshaltung…gegenüber der eigenen Unterdrückung“ vor.
Da hilft nur Gegendruck: „Manchmal sind wir fast Polizeibeamte, die sagen, wenn du jetzt nicht anzeigst, können wir dir bald nicht mehr helfen,“ so drückte es eine mit Prostitutionsmigrantinnen arbeitende Vertreterin der „Caritas Mailand“ aus. In Summa: „Die Grenzen der Arbeitsaufgaben zwischen Polizei und Opferschutzstelle scheinen sich zu verwischen,“ wie es bereits 2001 in einer Bielefelder Studie über den europäischen Frauenhandel und -beratungswandel hieß.
Da es nun mit dem neuen Gesetz aber nicht mehr nur um die Bekämpfung des Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung geht, wobei dazu nun auch die „Pornographie“ gehört, sondern ebenso gegen den Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung der menschenlichen Arbeitskraft, brauchen Eurocops und Eurolaw „Opfer“ in allen Preislagen – und diese sollen sich nach ihrem erzwungenen Zeugenauftritt auch noch möglichst als engagierte Spitzel weiter betätigen: „Ein globaler Ansatz zur Bekämpfung des Menschenhandels muß die Ausbeutung in all ihren Formen – sexuelle Ausbeutung, Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft, insbesondere Kinderarbeit und Bettelei – in Angriff nehmen, “ hieß es schon – durchaus doppeldeutig! – in der „Brüsseler Erklärung“. Wobei konkret daran gedacht war, zukünftig „die Sex- und Arbeitsmärkte einer deutlich sichtbaren Überwachung zu unterstellen und internationale Informantennetze aufzubauen“. All diesen praktischen Empfehlungen bereitete dann auch erwartungsgemäß der „Gesetzentwurf von SPD/Grünen zum Entwurf eines (neuen) Strafrechtsänderungsgesetzes“ auf deutschnationaler Ebene eine rechtliche Grundlage. Er geht im übrigen weit über das hinaus, was die UNO einst (am 21.3.1950) mit ihrer „Konvention zur Unterdrückung des Menschenhandels und der Ausbeutung von Prostituierten“ verabschiedete, und worin man ebenfalls schon überein gekommen war, „jede Person zu bestrafen, die, um die Leidenschaften einer anderen zu befriedigen, eine andere Person, auch mit Zustimmung jener Person, zum Zwecke der Prostitution beschafft“. In anderen Worten: Auch wenn eine Kundin mit ihrer Schleusung zufrieden ist, wurde ein verbrecherischer Menschenhandel an und mit ihr verübt – und wenn man sie dann in einem Bordell aufgreift, werden aus ihren korrekten Schleppern quasi automatisch kriminelle Zuhälter.
1975 hat die DDR diese UNO-Konvention freudig in ihre „Gesetzessammlung“ übernommen, denn nicht wenige ihrer Republikflüchtlinge, Ehepaare zumeist, bekamen damals Hilfe von Westberliner Schlepperbanden bzw. „Tunnelbauer“, bei denen sie hernach in eine Art Schuldknechtschaft standen, aus der sie nur herauskommen konnten, indem die Ehefrauen sich prostituierten – im noch heute existierenden Schöneberger Bordell „King George“ z.B..
Die Mitarbeiterin der Frankfurter Prostituiertenorganisation „Dona Carmen – Juanita Henning merkt zur neuesten Rotgrünen Initiative an: „Mit diesem Gesetzentwurf wird die Politik der Hartz-Gesetze der Bundesregierung flankiert: der Niedriglohnsektor soll den in Deutschland legal lebenden Arbeitslosen zustehen (in den sie verstärkt abgeschoben werden), nicht aber den illegalisierten Arbeitsmigrantinnen. Der Niedriglohnsektor den Deutschen bzw. den hier bereits lebenden Migranten – das ist der tendenziell nationalistische Ausgrenzungskern des neuen Gesetzentwurfs.
Da die bislang fehlenden Zahlen einen Frauenhandel größeren Ausmaßes nicht bestätigen konnten (800 Opfer jährlich, Tendenz fallend seit 1999), soll ihm nun durch Erweiterung der Definition Realität eingehaucht werden“. Nach Verabschiedung des rotgrünen Gesetzes im Bundestag (am 28.10. 2004) holte die taz-Autorin Mareke Aden für ihren Kommentar aktuelle Daten von Menschenrechtsorganisationen ein: Dort schätzt man die Zahl der in die BRD verschleppten Frauen auf 140.000, dem gegenüber stehen jedoch „nur 431 Ermittlungsverfahren“. Die Autorin findet deswegen: Wichtiger als das Gesetz zur Bekämpfung des Menschenhandels sei ein neues Ausländerrecht – „ein solches Zuwanderungsgesetz müsste den Frauen erlauben, sich legal als Prostituierte in Deutschland selbständig machen zu können. Dann könnten sie ihren Verdienst ganz für sich behalten, und die Gewinne der Menschenhändler würden schrumpfen.“
Hierzu sei angemerkt, dass das 2002 verabschiedete Prostitutionsgesetz (ProstG) ja gerade die Besteuerung der legalen Prostituierten eingeführt hat – also die fiskalische Abschöpfung ihres „Verdiensts“, was in Berlin bereits zur Folge hat, dass die Steuerfahnder laut BZ vom 30. 10. 2004 nun sogar schon die Frauen auf dem Straßenstrich „jagen“. Aber ob nun legal oder illegal erworben und versteuert oder nicht – der „Verdienst“ der Frauen hat nichts zu tun mit den „Kosten“ der von ihnen in Anspruch genommenen Dienstleistung Schleppen & Schleusen, geschweige denn mit den „Gewinnen“ der Besitzer dieser Service-Unternehmen. Deren Profite lassen sich ausschließlich durch Zulassung von immer mehr Marktteilnehmern reduzieren, wie die neoliberalen Ökonomen und Politiker seit mindestens 20 Jahren nicht müde werden zu wiederholen. Aber selbst eine vollständige Legalisierung des Menschenhandels würde die Kosten dieser Dienstleistung nur theoretisch gegen Null bringen – weil man dann angeblich keine grenzkundigen Schlepper („Macher“ im Jiddischen einst genannt) mehr bräuchte.
In Wirklichkeit zeigen jedoch – z.B. die legalen Anwerbeaktionen von Gastarbeitern durch die BRD-Elektrokonzerne – in Italien, Jugoslawien und der Türkei, aber auch der Westberliner Krankenhäuser und der rheinischen Zechen in Südkorea, dass es ohne einheimische Schlepperbanden (Menschenmakler) nicht geht. Spät aber nicht zu spät hat man deswegen ja auch diese, früher „Sklavenhändler“ nun „Arbeitsvermittlungsfirmen“ genannten Zwischenhändler legalisiert – und damit zugleich das Monopol der Arbeitsämter gebrochen, die sich nun ihrerseits dynamisch umbenannt haben – in „Agenturen für Arbeit“. Ihre Mitarbeiter mußten ein Höflichkeitstraining absolvieren.
In Summa: Das alles gibt mit Sicherheit Stunk, aber von wo und wem der Widerstand ausgehen wird, ist noch nicht auszumachen.
___________________________________________________________________
Was Berlin betrifft – hier kann man sagen: „So viel Know-how gibt es sonst nirgends“, wie der Kreuzberger Arbeiterpriester Christian auf der Berliner Konferenz zum Thema „Fluchthilfe“ meinte. Es gibt hier sogar ein Schlepperbanden- Museum am ehemaligen Grenzübergang Checkpoint Charlie, seit 1994 geschmückt mit der „letzten Kreml-Fahne“. Vom Kreml aus wurden einst Millionen Menschen nach Sibirien verschleppt. Im Museum, unter deutsch-ukrainischer Leitung, versucht man heute höchstens in die andere Richtung zu „schleusen“. In West-Berlin konnte man seinerzeit die „Fluchthilfe“ von der Steuer absetzen, und besonders engagierte „Fluchthelfer“ bekamen stattliche Auszeichnungen. Den Geflüchteten wurde umgekehrt schnell ein Job in der Frontstadt verschafft.
Nach dem Mauerbau 1961 flüchtete auch der Sohn eines Spanienkämpfers und einer KPD- Kurierin, Peter Rambauseck, mit einem gefälschten amerikanischen Paß über den Checkpoint Charlie nach West-Berlin. Dort begann er ein Politologie-Studium. Bald half er beim „Tunnelbau“, um weiteren Ostlern die Flucht zu ermöglichen. Einige Tunnelbauer empfingen die Flüchtlinge mit einer Mao-Bibel, womit sie sagen wollten, daß es außer dem Gulag-Kommunismus noch einen anderen, besseren gäbe. Diese idealistischen Schlepperbanden wurden im antikommunistischen Bollwerk West-Berlin aber schnell durch professionelle verdrängt, die von der CDU und der Polizei unterstützt wurden. Als besonders draufgängerisch galt der spätere Astronaut Reinhard Furrer. Bei seinem letzten großen Fluchtunternehmen „Tunnel 57“ wurde 1964 der Grenzsoldat Egon Schultz erschossen. Die DDR errichtete anschließend bei Neu-Zittau eine Übungsanlage zur Abwehr künftiger Schlepperbanden, dazu bauten sie die Bernauerstraße und den Tunnel 57 im Maßstab 1:1 nach. Derzeit bemühen sich gleich vier Recherchebüros, Licht in einen anderen Tunnelbau zu tragen: 1977 hatte Felix Laue in der Quick eine Geschichte über eine CDU-Schlepperbande veröffentlicht, die Fluchthilfe und Bordellbetrieb verband. Sein Informant war angeblich der Bordellier Otto Schwanz, der später in der Bestechungsaffäre Antes und jetzt gerade wegen falscher Dollarnoten verurteilt wurde. Laut Spiegel vom 3.3. 1986 mußten die Ostlerinnen ihre „Fluchtkosten“ in einem Bordell abarbeiten.
Bevor Laue einen zweiten Text darüber veröffentlichen konnte, beauftragte ihn die Partei, das Wahlkampf-Info „CDU-Extra“ zu gestalten. Als nächstes betätigte sich wieder die Westberliner Linke als Schleuser: Im Rahmen ihrer Vietnamsolidarität half der SDS kriegsunwilligen GIs, insbesondere unter dem US-Militärrassismus leidende Schwarze, nach Schweden zu entkommen. Das Unternehmen hatte eine eigene Zeitung namens Forward!. Nach 1968 entstand im Republikanischen Club eine ähnliche Fluchthilfe für Bundeswehrdeserteure ins demilitarisierte West-Berlin. Die Christdemokraten konzentrierten sich derweil auf die „stille Hilfe“ mittels Aufenthaltsgenehmigungen, erst für „Jubelperser“, dann für nationalchinesische Unternehmer. In den 80er Jahren entstand auf breiter linker Basis die „Fluchtburg“, mit der man von Abschiebung nach Beirut bedrohten Palästinensern half.
Eine Gruppe um Pastor Quandt blockierte den Abschiebeflughafen Tegel. Seitdem bildete sich ein regelrechtes Netzwerk von Fluchthilfswilligen heraus: eine informelle Gesamtberliner Schlepperbande auf moralischer Basis. Auch wenn nun das „Geschäft“ nicht mehr unbedingt außen vor – bei den Christdemokraten – bleibt. D. h. für die Papiermagie, über Scheinehen, GmbH-Gründungen bis zu Beschäftigungsgarantien müssen die „Wirtschaftsflüchtlinge“ in Berlin durchaus „Gegenleistungen“ erbringen. Wie ja überhaupt das ganze linke (Subventions-)“Milieu“ sich langsam ökonomisch auf eigene Beine stellt. Fast alle Ost-West- Geschäfte verdanken sich mindestens einer „Fluchtbeihilfe“. Und wenn etwa ein Unternehmen hier einer Petersburgerin einen Managerkurs einrichtet und der Geschäftsführer dafür auf Beischlaf besteht, dann artet auch diese Schlepperaktion in Prostitution aus. Dennoch ist das Netz so stabil, daß lange Zeit die Staatsschutzorgane an der Oder-Neiße-Grenze sogar die unwissentliche „Fluchthilfe“ von Taxifahrern in Zittau mit Gefängnis ahndeten. Dafür wurde der 1994er Paragraph 92a des Ausländergesetzes strapaziert, der jede bezahlte Einreise-Hilfeleistung unter Strafe stellt. Um zu demonstrieren, daß die Taxifahrer in den Grenzstädten seitdem keine ausländisch aussehenden Bürger mehr befördern, auch wenn ein Notfall vorliegt, machte der aus Indien stammende Berliner Historiker Biblab Basu dort regelmäßig – im Auftrag von TV-Kamerateams aus aller Welt – den „Ausländertest“.
In Berlin kooperierten bald schon die ersten Standesbeamten beim Verdacht auf Scheinehe mit der Polizei. Desungeachtet ist heute jede vierte Kreuzberger Ehe deutsch-ausländisch. Dem versucht der Staat mit einem immer tiefer gehenden „Denunziationszwang“ entgegenzuwirken. Im Prinzip hat sich zu früher nichts geändert – außer daß seit der Wende statt der herausdrängenden die hereindrängenden Flüchtlinge verfolgt werden.
_________________________________________________________________
Als Beispiel sei Helena erwähnt.
Ein „Helen“ ist das Maß an Schönheit, das es braucht, um 1.000 feindliche Schiffe loszuschicken. Die Maßeinheit geht auf die antike Helena zurück, die Tochter Agamemnons, die einst eine Schlepperbande unter der Führung von Paris von der Krim nach Troja brachte. Gegen die heutigen Schlepperbanden sind noch weit mehr Schiffe unterwegs – um alle Helenas dieser Welt daran zu hindern, in die EU zu gelangen.
Eine, aus Odessa, schaffte es wie oben erwähnt dennoch – bis nach Berlin, wo sie in einem Bordell arbeitete: „Ich habe mich ganz alleine, ohne Schlepper, bis hierher durchgeschlagen,“ erzählte sie mir, „aber einfacher ist es deswegen auch nicht, denn ich habe meine Tochter zurückgelassen, und der muss ich laufend was zum Anziehen schicken und Geld überweisen. So ein Paket kostet jedes Mal vierzig Euro und eine Überweisung fünfzig. Meine Mafia ist mein Kind!“
Die Anti-Mafia-Einheiten der EU patrouillieren nicht nur an allen Grenzen, damit keine weiteren Helenas durchkommen, sie sitzen darüber hinaus in allen Ämtern, wo sie darüber wachen, dass die wenigen dennoch durchgeschlüpften hier ihres Lebens nicht froh werden – und sich nicht etwa durch Heirat einbürgern oder ihre Familienangehörigen nachkommen lassen. Der Helena aus Odessa verweigerten sie hier das Zusammenleben mit ihrer Tochter Dafna, weil diese – so die Begründung – bald 16 werde und deswegen auch allein weiter in Odessa leben könne. Helena grämte sich über dieses Urteil derart, dass sie darüber das Trinken anfing, zur Alkoholikerin wurde und schließlich als „hilflose Person“ in einem „Frauenprojekt“ Aufnahme fand. Wie es der Zufall wollte, wurde und wird dieses „Projekt“, initiiert von arbeitslosen Sozialarbeiterinnen, von der EU finanziert, und zwar im Rahmen ihrer „Daphne-Programme“. Bei Daphne handelte es sich ursprünglich um eine junge Nymphe, die vom schönen, aber liebestollen Apoll verfolgt wurde und sich daraufhin in einen Lorbeerbaum verwandelte.
Heute sollen die EU-Programme, die unter ihrem Namen laufen, allen von Männern verfolgten und bedrängten ausländischen Frauen helfen. Konkret gibt es dazu beispielsweise beim Berliner Migrationszentrum EMZ die Projekte „HeiRat 1 und 2“, in denen Soziologen untersuchen, welche Schutzmaßnahmen es für Heiratsmigrantinnen aus Drittländern in der EU gibt: etwa die deutschen Beratungsstellen „Ban Ying“ – für Frauen aus Südostasien, „Papatya“ – für türkische Frauen, „Imbradiva“ – für brasilianische Frauen sowie „Bella Donna“ – für polnische und „Doña Carmen“ – für spanisch sprechende Frauen. Derartige Anlaufstellen gibt es in fast jedem EU-Land – und dementsprechend finanzieren die „Daphne-Programme“ der EU denn auch analoge EMZ-Projekte in Italien, Holland, Griechenland und so fort, damit die dort ebenfalls alle staatlichen sowie auch selbst organisierten „Schutzmaßnahmen für Heiratsmigrantinnen“ untersuchen.
Es werden also einerseits zig Milliarden Euro von der EU ausgegeben, um alle Heiratsmigrantinnen abzuwehren, indem man diese Frauen direkt mit Visumverweigerung, Visumentzug, Papierkrieg und Abschiebung traktiert oder indirekt, indem man ihre Schlepperbanden verfolgt und vernichtet. Zu diesem Zweck werden von der EU auch noch jede Menge nichtstaatliche Organisationen gefördert. Sie heißen z. B.: Agisra, Die Pfundzkerle, KOK, Konferenz europäischer Kirchen gegen Frauenhandel, Human Rights Watch gegen Frauenhandel, Foundation of Women’s Forum, Foundation against Trafficking in Women, GAATW, Terre des Femmes und Reftra. Letzteres ist ebenfalls ein Berliner EMZ-Projekt, das die EU-Anstrengungen zur Bekämpfung der Schlepperbanden untersucht.
Andererseits gibt die EU aber weitere Millionen Euro dafür aus, die Heiratsmigrantinnen, die es trotzdem bis hierher geschafft haben, aber durch die immer teurer werdenden Schlepperbanden und die ebenfalls immer teurer werdenden Scheinehemänner in Abhängigkeit und Not geraten sind, zu unterstützen – bis dahin, dass sie die Organisationen, die diesen Frauen helfen, erforschen und koordinieren lässt. Und um diesem postfaschistischen Schwachsinn die Krone aufzusetzen, nennt man das Ganze triumphierend „offene Gesellschaft“!
Ich, der ich gegen jeden grenzüberschreitenden Warenverkehr bin, jedoch für den freien, passlosen Reiseverkehr und Wohnortswechsel von Menschen, habe bereits viermal kostenlos eine Scheinheirat angestrebt, um den betreffenden Frauen hier einen Daueraufenthalt zu ermöglichen. Nie hat es geklappt, obwohl alle Freunde von mir schon längst, teilweise sogar mehrere glückliche Scheinehen eingegangen sind. Die Scheinheirat ist eine altehrwürdige kommunistische Pflicht! Ja, ich würde sogar so weit gehen: Jeder, der aus Liebe – und dann auch noch monokulturell – heiratet, ist ein angepasstes Arschloch und verdient unsere ganze Verachtung: Es ist eine asoziale Verschwendung von EU-Pässen!
Zum Glück passiert das, zumindest in Berlin, immer seltener. Als ich zuletzt Olga, die ukrainische Putzfrau eines befreundeten „Spiegel TV“-Journalisten, heiraten sollte und wollte, begab ich mich mit meiner Zukünftigen aufs Standesamt Friedrichshain/Kreuzberg: Dort warteten ausschließlich Mischpärchen darauf, abgefertigt zu werden – mit einer handgeschriebenen Nummer auf dem Schoß, die sie unentwegt anstarrten.
Nr. 17, eine Iranerin, sagte zum Informationsfräulein, das erst mal alle „Kunden“ auf die einzelnen Standesbeamten verteilt: „Ich will heiraten, weiß aber noch nicht wen.“ Ehrlich währt hier jedoch nicht am längsten! Die Standesbeamte sind bei Verdacht einer Scheinehe zur Denunziation angehalten. Nr. 12, eine Weißrussin, die mit einem Weddinger angetanzt war, sagte: „Wir müssen uns beeilen, ich bin schon im 6. Monat schwanger.“ Ungerührt fragte das Informationsfräulein zurück: „Und haben Sie sich schon entschieden – mit der Musik und so?!“ An den Flurwänden hing Reklame – von Firmen, die Hochzeitsfotos, -ringe und -kleider verkaufen, im Wartesaal, der wie ein Wickelraum wirkte, lagen Hochzeitsauto-Kataloge. Eine philippinische Braut, Nr. 9, entschied sich für einen weißen Omega, aber ihr Neuköllner Alphamännchen winkte sofort ab: „Entweder einen Ford oder deine zwei Kinder herholen – beides ist nicht drin!“ Die Nummern 27 und 28 hielten zwei Jamaikaner, die ihre Blondinen in der Karibik-Disko am Zoo kennen gelernt hatten, wo sie auch ihre Hochzeit feiern wollten. Sie waren sich nur noch nicht einig, welchen DJ sie dafür anheuern sollten – über den Musikstreit überhörten sie fast den Aufruf ihres Standesbeamten. Auch die Nr. 29 war nicht ganz bei der Sache: Ein Sinologe, der sich natürlich – aus Berufsgründen – eine Chinesin geangelt hatte oder umgekehrt. Zwar war er einverstanden, ihre Großfamilie zur Hochzeit nach Berlin einzuladen, aber diese ganze peinlich-peinigende Prozedur mit x Dokumenten, ISO-Norm-Übersetzungen und -Beglaubigungen war ihm nun zu „prollig“. Seine Braut verstand ihn nicht und blätterte verzweifelt im Mandarin-deutschen Wörterbuch nach, fand das Schimpfwort aber nicht. Das ließ nun wieder ihn verzweifeln – nämlich an der Distinktionsfähigkeit seiner Zukünftigen. Ich machte mich ämternützlich und wies eine Bulgarin darauf hin, dass sie sich eine Nummer vom Haken nehmen müsse. Als die Nr. 28 aufgerufen wurde, meinte sie beleidigt: „Aber Sie haben mir doch eben gesagt, die Nr. 28 sei schon drin!“ Ich lächelte nur und dachte: „Gut, dass ich die nicht heiraten muss – was für eine Kampfhenne!“
Dann waren wir, die Nummer 31, Olga und ich, dran. Es ging alles sehr schnell: „Aha, Ukraine“, sagte der Beamte, holte eine Formular hervor und kreuzte darauf alle Dokumente an, die Olga beizubringen hatte. Damit schoben wir wieder ab. Anschließend trafen wir uns mit einer befreundeten Russin, die dolmetschen sollte: Da Olga geschieden war und zwei Kinder hatte, musste sie zusätzlich zur Familienstandsbescheinigung, zur Geburtsurkunde, zur polizeilichen Anmeldung, zur Aufenthaltsbescheinigung, zum Kindernachweis und zur beglaubigten Visumkopie auch noch ein gerichtliches Scheidungsurteil und dazu eine Bestätigung von der Miliz einholen. Das alles aus der Ukraine! Und dass sie hier schwarzarbeitete und nicht angemeldet war, verkomplizierte die Sache noch einmal. Mutlos ging sie nach Hause. Eine paar Wochen später trafen wir uns wieder, die Dolmetscherin hatte ich dazubestellt: „Es geht nicht“, sagte Olga, „ich krieg die Papiere nicht zusammen!“ „Dann heiratet doch in Dänemark“, riet uns die Dolmetscherin. Ich rief daraufhin beim Standesamt in Tonder an. Sie wollten zwar etwas weniger Papiere haben, aber die waren genauso schwierig zu beschaffen, außerdem war der „mehrtägige Aufenthalt“ dort teuer. Um es kurz zu machen: Irgendwann gaben wir auf! Ich bin immer noch ledig, und Olga lebt wieder in Kiew. Für die traurige Rückreise nahm sie, nebenbei bemerkt, für 500 Euro die Dienste einer Bande in Anspruch, die Touristen von West nach Ost schleppt, damit diese kein Wiedereinreiseverbot in den Pass gestempelt bekommen.
Ich war deprimiert: Andere hatten es doch auch geschafft. Ich kenne sogar eine ganze Frauenclique, die gleich sechs Nigerianer auf einen Schlag geheiratet hat. Sie treffen sich einmal im Monat, um im Rahmen einer kleinen Party gemeinsam die in der Zwischenzeit angefallene Papiermagie zu erledigen. Der Geschäftsführer vom Kaffee Burger heiratete eine Weißrussin – aber das zählt nicht, da er es völlig unpolitisch bloß aus Liebe tat. Mein Freund Murat aber: Er verheiratete seine bulgarische Freundin für 2.000 Euro mit einem deutschen Fixer. Und meine Freundin Noy, eine thailändische Ein-Frau-Schlepperbande – sie verheiratet laufend „ihre Mädchen“ mit irgendwelchen dubiosen Geschäftsmännern (solche Ehen sind übrigens die „glücklichsten“, wie gerade die Untersuchung einer thailändischen Soziologin aus Kassel ergab). Meine Freundin Lilli Brand hatte innerhalb von drei Tagen einen hirnkranken Nürnberger geheiratet. Im polnischen Osno stieß ich einmal auf gleich ein Dutzend von Berlin dort hingezogene deutsch-polnische Ehepaare – „Mischlinge“ nennen sie sich. Und dann die ganzen Heiratsmigrantinnen aus Russland und Afrika, die bei „Jack’s“ in der Uhlandstraße oder im „Dorian Gray“ rumsitzen? Die wollen noch nicht einmal irgendeinen Deutschen heiraten, sondern nur einen mit viel Geld. Wie schaffen die das bloß? Ich komme mir langsam wie ein Versager vor: Seit neun Jahren bin ich fest entschlossen zu heiraten – und noch immer habe ich in meinem Badezimmer keine Zahnbürste einer Ausländerin liegen – für den Fall einer Kontrolle durch die Fremdenpolizei.
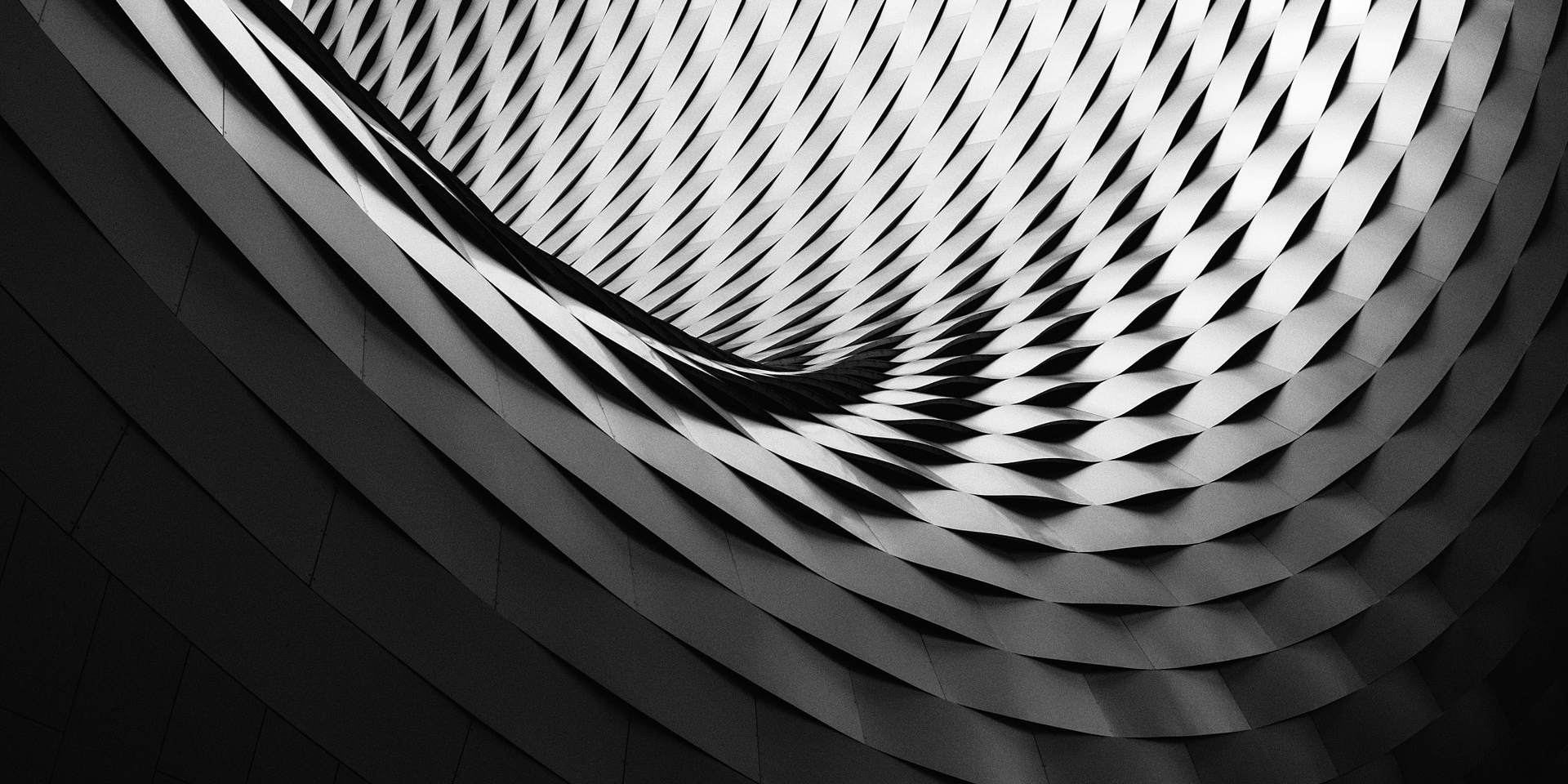



sono eccitato circa questo luogo, buon lavoro!:) http://www.obiettiv4i64.info/pompini